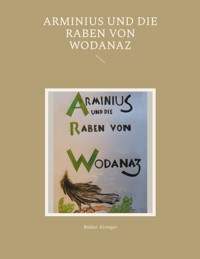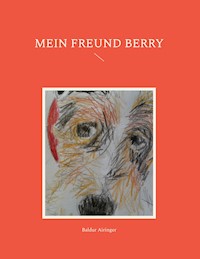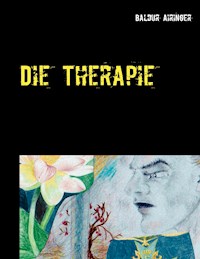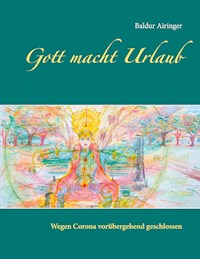Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nicht so trocken wie mein antikes Werk "De bello gallico". Passt aber gut zu einem trockenen Wein! 42 oder der Sinn des Lebens - wer das nicht kennt, hat die Welt verpennt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Er ist im Grunde seines Herzens friedliebend und hasst den Krieg, doch wenn er kämpft, dann unaufhaltsam und brutal.“
Über Achilleus.
Inhalt
Feuer in den Lenden
Siddhartha
Pause
Hass
Fieber
Interessante Gesellschaft
Panik
Eigenes Reich
Im Tempel des Ich
Training
Willkommen in der „Unterwelt“
Gier
Ron
Brennen
Der Auftrag
König David
Tod
Erkenntnis
Schmerz
Erwachen
Styx
Im Feuer des Kamaloka
Kampf
Innerer Friede
Am Grund des Tartaros
Zeit der Bienen
Feuer in den Lenden
Luke Carrigan saß bereits in seinem Linienflug von Berlin nach Nagoya.
In der Coronazeit waren nicht alle Plätze besetzt, aber der Lockdown war aufgehoben und so war der einzige freie Platz im ganzen Flugzeug der neben ihm.
Jede Sitzreihe hatte drei Plätze nebeneinander. Luke saß am Fenster. Der Sitz am Gang war von einem Herrn mittleren Alters gebucht, der die Zeit vor dem Abflug nutzte, um noch eben zur Toilette zu gehen.
Ob das möglich war?
Vor dem Start noch zum Örtchen? Am Boden?
Luke wusste es nicht, obwohl er Vielflieger war, er hatte seine Blase unter Kontrolle und solch ein hastiges Vorgehen daher nie benötigt.
Als sein Nachbar-Fluggast zurück kam von seinem Geschäft, schloss der seinen Hosen-Reißverschluss in dem Moment, bevor er sich wieder hin setzte.
Interessante Angewohnheit.
Luke war ein Mensch, dem nichts entging. Weder die kleinste Kleinigkeit, noch die beiläufigste Bemerkung oder eine instinktive Handbewegung eines anderen Menschen blieben ihm verborgen.
Dennoch schaffte er es, dabei mit seiner Aufmerksamkeit voll und ganz bei sich selbst zu sein. Dieses hohe Konzentrationsvermögen verlieh ihm im Alltag eine raubtierartige Wachheit und Präsenz, der sich kaum jemand in seiner Gegenwart zu entziehen vermochte. Möglicherweise war das auch der Grund für das starke Charisma, welches seine Mitmenschen normalerweise an ihm bewunderten.
Dabei hatte er die Gabe, dieses Charisma an- und abzuschalten, wann, wo und wie er es brauchte.
Es gab Momente, in denen er sich so unauffällig durch eine Menschenmenge bewegen konnte, dass niemand ihn bemerkte und er total in der Masse unterging.
Solch ein Moment war nun gekommen, denn Luke war nach einem arbeitsreichen Tag zufrieden mit der Welt, erschöpft und müde und er freute sich auf einen angenehm langweiligen, ruhigen und komplikationslosen Rückflug ohne weitere Vorkommnisse. Doch weit gefehlt.
Nun begann die Klimaanlage zu surren, das Personal schien sich auf den Abflug vorzubereiten. Da es bald Abend wurde, war nun auch die Raumbeleuchtung gedimmt und Luke räkelte sich dermaßen ungestüm in seinem Sitz, dass er anschließend den Platz in der Mitte, der ja offensichtlich frei bleiben sollte, mit benutzte.
Der ältere Herr, der in den guten Fünfzigern zu sein schien, blickte ihn mit zusammengekniffenen Augenbrauen über seine elegante, diskrete silbern eingefasste Lesebrille über Brille und Zeitung hinweg an, sein weißes Haar glänzte im Licht seiner Sitzbeleuchtung, als eine Bewegung den jungen Mann am Fenster aufblicken ließ.
„T’schuldigung, na, das is’ dann wohl meiner! Darf ich mal?“
Luke räusperte sich.
„Klar“, knurrte er leicht angepisst und überrascht, dass das Personal so kurz vor dem ‚Countdown’ doch noch jemanden rein gelassen hatte.
Ein junges Mädchen quetschte sich zwischen ihn und den älteren Herrn, das ausgedruckte Flugticket zwischen den Zähnen, die kleine rote Ledertasche in den Händen, ihr schwarzes Haar fiel ihr ungebändigt und zottelig in die Stirn, dass der junge Mann kaum ihr Gesicht erkennen konnte.
Außer einem großen roten Fleck unter der Mähne fiel nur ein Schatten in ihr Gesicht von dem schwarzen Filzhut, den sie trug. Der rote Fleck dürfte wohl ihr Mund sein.
Leicht verärgert verschränkte Luke die Arme über seiner Brust und der Dritte in der Reihe schüttelte seine Zeitung zurecht, die gerade eben von der jungen Frau zerwühlt worden war.
Na, das kann ja heiter werden, dachte der junge Herr und zog die Augenbrauen zusammen, doch ein Geräusch ließ ihn erschaudern.
Die Frau hatte nun endlich offenbar eine angenehme Sitzposition gefunden.
Als Ausdruck dessen ließ sie ein kaum hörbares „Haahh“ vernehmen. Dieses Ausatmen trieb Luke unweigerlich ein gefühltes Bierglas voll Adrenalin ins Blut und er bekam am ganzen Körper eine Gänsehaut.
Der junge Mann, der Betriebswirtschaft studierte und nebenbei im Konzern seines Vaters in seinem Heimatland Japan arbeitete, war bei seinen Kommilitonen für seine besonders gute Selbstkontrolle bekannt, doch dagegen konnte auch er nichts machen.
Seine Körperbehaarung richtete sich eigenwillig auf, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Und nicht nur diese.
Schnell kramte er aus dem Fach an der Sitzlehne vor ihm eine Zeitschrift hervor. Jagd und Hund. Ja. Die gefiel ihm. Das war genau das Richtige, um die Schlange zu verbergen, welche sich gerade in seiner Schoßgegend aufgerichtet hatte, obwohl die Mitnahme von Tieren ohne Käfig bestimmt in diesem Flieger verboten war.
Der BWL-Student schloss seine Augen und versuchte zu schlafen.
Wilde Gedanken schossen ihm durch den Kopf, die ihm wohl weder Erholung noch ein Nickerchen garantierten … .
Siddhartha
Kapilavatthu. Neunzehntes Regierungsjahr meines Vaters Shuddhodana. Gartenhaus im Palastgarten.
„Puuuuuuuups!“
Ich halte den Atem an und schaue meiner Mutter in ihre schönen Augen. Sie lächelt.
„Es ist in Ordnung, Sid,“, sagt sie und lacht.
„Deine Püpse riechen nicht, sie duften, weil du nur Lotuspflanzen isst.“
Jetzt strahlt Mama und meine Schwester hebt eine Scheibe der frischen Lotuswurzel vom Boden, die ihr herunter gefallen ist vom Tisch, als ich meine Luft abgelassen habe.
Sundari Nanda, meine Schwester, lacht auch, tupft sich ihren Mund mit einem Tuch ab. Ich betrachte ihr herrliches, glänzendes, langes kastanienbraunes Haar, ihren indigofarbenen Sari, der eine Goldborte hat.
Auch ich besitze viele Saris mit Goldborte, viele Röcke und Hosen von solch edler Qualität mit brokatdurchwirkten Stoffen, aber ein kurzes, einfaches Tuch um meine Lenden gefällt mir besser, als alle feinen Gewänder.
„Mama, ich war heute schon im Garten, ganz früh, da ging gerade die Sonne am Horizont auf und das Licht leuchtete so durch die grünen, frisch duftenden Zweige der Bäume direkt in mein Herz hinein! Es war herrlich und – “
Sundari Nanda hebt ihre Hand, blickt mich an, lächelt freundlich und sagt:
„Ich möchte hinaus in den Hof zu meinen Freunden gehen!“
„Du möchtest Atmanasvati schöne Augen machen. Du möchtest den Jungen sehen!“, flüstert meine Mutter sanft und schmunzelt.
Sundari Nanda, die wir einfach oft Sunda nannten oder Nanda, wie ihren Bruder Nanda, leuchtete auf einmal wie die aufgehende Morgensonne. Ihr Licht spiegelte sich in ihren Augen, ihren Ohren, ihren Hüften und unter ihren Füßen wieder, es strahlte zur Tür hinaus und wies ihr den Weg zu ihren Freund Atmanasvati, der plötzlich in der Tür stand und uns zu lächelte.
Er verneigte sich kurz und sein Antlitz leuchtete still.
„Mutter, darf ich?“, rief Nanda, erhob sich elegant von ihrem Platz. Dabei vollführte ihre schlanke Taille eine besonders anmutige Bewegung wie bei einem traditionellen Tanz.
Begierig blickte sie Mutter an. Ihr Antlitz strahlte und das Lächeln auf ihren wohl geschwungenen Lippen kündete von ihrer Sehnsucht nach dem jungen Mann, der erwartungsvoll am Eingang des großen, hellen Balkons unter der Markise wartete. Meine Schwester wippte auf ihren Fußsohlen.
Ja, mein Kind, geh. Aber entfernt euch nicht zu weit, wenn ihr in den Wald geht, hört ihr? Seit zum Mittagstisch wieder da. Du kannst gern bei uns essen, Atmana, sagte Ma zu Sundas Freund und die beiden verschwanden in den Garten und in den Wald. Sie vibrierten vor Freude.
Ich kaute meine Lotusscheibe zu Ende und Ma bat mich, weiter zu erzählen.
„Also ich war im Garten, da gab es Tau auf dem Boden und auf den Blättern der Pflanzen und in jedem Tropfen schien ein Regenbogen, Mama! Und das Licht, wie es so schien, ich setzte mich auf einen Stein, der schon etwas warm war von der Sonne und erkannte, dass ich selbst aus dem selben Licht bestehe, wie der Regenbogen in dem Tau.
Denn aller Tau ist nur ein Teil des ganzen Wassers auf der Erde und wir sind Eins, die Erde, alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Steine, alles Wasser, alle Luft, alles Holz, alles Metall, alle Erde, alles Licht, auch das Licht in deinen Augen, Mama, und du und Vater und Nanda und ich und alles ist eins, Mama!
Und das Licht hat in Wahrheit die Farben des Regenbogens!
Das ist herrlich, Mama!“
Ich hüpfte auf Mamas Schoß.
Sie lachte und gab mir einen Kuß auf die Stirn.
Ich war zwar schon zwölf Jahre alt aber Mama war schwanger und ich durfte von ihrer Brust trinken. Ihr gefiel es, wenn ich saugte, oder meine Geschwister oder Vater und es schmeckte köstlich. Nicht so viel, dass wir dem Neugeborenen die ganze Milch wegtrinken, nur einige Schlücke.
Die Milch bildet sich schon wieder nach. Das ist so natürlich. Mütter haben oft gleichzeitig mehrere Kinder zu versorgen und so ist immer genug Milch da. Auch für euch hungrige Mäuler! Es ist das beste, was du bekommen kannst, Siddhartha!, sagte sie.
„Auch besser als Lotus?“, fragte ich.
„Ja. Auch besser als Lotus!“, gab sie zurück und ihr warmherziges Lächeln hüllte mich in einen Schleier der Liebe.
„Du, Mama, ich habe heute Morgen auch ein Reh gesehen!“
„Das ist schön, mein Sohn, mein lieber Gotama, mein Ganesha!“, sagte Mama und ich rutschte von ihrem Schoß, um mir noch eine knackige, frische Scheibe Lotuswurzel zu holen, die schmeckte einfach wunderbar zu Mamas warmer, süßer Milch.
„Das Reh war etwa so groß wie ich. Ein wenig kleiner. Es hat stets mit dem Schwänzchen gewedelt. Es stupste mich sogar mit der Nase und spielte mit mir. Und dann habe ich es gestreichelt. Erst über den Nasenrücken, über seine Wangen, seinen Rücken und seine Brust, seine Flanken. Es wurde ganz ruhig davon. Und dann habe ich es begattet. Mitten in der Morgensonne im Garten inmitten der duftenden Pflanzen voller frischem Tau. Es war warm und stark. Es war herrlich. Ist das gut, Mama?“
„Mein lieber Sohn, das Reh kann sich glücklich schätzen! Du bist gütig und liebevoll zu ihm gewesen. Was gut für dich ist, musst du selbst wissen. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen und deinen eigenen Weg gehen, mein Prinz!“
„Ja, Mama. Schau, ich habe Nibbannaya wieder getroffen. Das Reh! Es ist eine Freundin aus einem anderen Leben. Das fühle ich!“, rief ich stolz und legte die Hand auf meine Brust, dort, wo mein Herz schlägt.
Man erinnert sich überhaupt an alles mit seinem Herzen. Ich ganz besonders.
„Weißt du, du hast recht. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen!
Großvater Sinahanas Priester, der ja auch Papas Lehrer ist, sagt, ich soll selbst wählen, welcher Lebensweg für mich der Richtige ist.
Ich möchte gern mehr von unserer schönen Stadt sehen und die Leute kennen lernen, lernen, wie sie zu leben, ihre Fragen, Gedanken und Lieder kennen lernen und mit ihnen gemeinsam speisen!
Mama! Können wir sie nicht hier zu uns einladen? Oder noch besser: Wir gehen zu ihnen und bereisen ganz Kapilavatthu!
Ich möchte jeden einzelnen Menschen unserer Stadt kennen lernen, Mama!“
Ich sprang vom Schoß meiner Mutter Pajapati Gotami, auf dem ich mittlerweile wieder gelandet war. Ich liebte natürlich auch Pajapati, die eine jüngere Schwester meiner leiblichen Mutter Maya war.
Ich konnte meine leibliche Mutter Maya sehen, wenn ich die Augen schloss.
Sie hatte mich schon oft an meiner Schulter berührt, an der Schulter meines brokatenen Lichtgewandes, das ich trug, wenn ich meine Augen schloss. Sprechen konnte ich mit ihr in meinem Herzen, ohne, dass ich meine Stimme zu nutzen brauchte.
Ihr Leben war nun leichter, denn sie hatte ihr materielles Dasein für eine Zeit lang abgeworfen. Sie war so lange bei mir geblieben, bis ich geboren war. Ich bin ihr sehr dankbar dafür.
„Wohin gehst du, Siddhartha?“, fragte Mutter mich, als ich das Gartenhaus verließ und die Stufen hinab trabte.
„Vater suchen!“, rief ich ihr fröhlich hinterher und war schon durch den Garten in den Hof verschwunden.
Pause
November 1986. Tinnum. Nordseeinsel Sylt.
Allmählich wird es kalt auf dem Schulhof.
Die Herbstferien sind schon lange vorüber.
Nun fängt es wieder an, das Ärgern und Hänseln, und dass die Kinder über mich lachen und mir doofe Fragen stellen.
Ich hingegen frage mich manchmal wirklich, warum ich auf der Welt bin.
„Friss ruhig weiter dein Käsebrot, wir gehen schon mal in die Klasse“, ruft Bernd mir zu.
Ob er mir nur sagen wollte, dass die Pause jetzt vorbei ist?
Das hätte er auch netter sagen können.
Bernd redet immer, was er will. So wie er wäre ich auch gern. Irgendwie glaube ich, dass er freier ist, als ich. Innerlich.
Mal wieder in meinen Tagträumen versunken, habe ich den Gong gar nicht gehört.
Zwei mal beiße ich noch hastig in mein leckeres Pausenbrot aus Paderborner Graubrot, Butter und Butterkäse, mmh, das schmeckt gut.
Es ist lecker für mich, wenn ich die feste Kruste kauen kann und noch leckerer, wenn dann in der Mitte nur noch der würzige Käse, die cremige gute Butter und das Weiche vom Inneren des Brotes kommt. Das ist für mich ein Stück Paradies.
Eilig schließe ich die Brotbox aus Kunststoff einer bekannten Herstellerfirma.
Meine Mutter hat sie sozusagen als Werbegeschenk einer selbst ausgerichteten Party bekommen.
Die Dose riecht mittlerweile nach Brot und Käse aber auch etwas nach Spülmittel.
Und ich soll dieses Plastik jetzt unbedingt jeden Tag benutzen, weil es ja so toll ist, und weil es meiner Mutter so gut gefällt.
Nur noch Birgit und ich sind jetzt auf dem Schulhof. Birgit ist sehr groß und sehr, sehr dick.
Sie ist zwar nicht meine Freundin, aber im Gegensatz zu den anderen Kindern habe ich mir vorgenommen, sie nicht zu hänseln. „Dicke Birgit“ oder „fette Kuh“ habe ich noch nie zu ihr gesagt. Im Gegensatz zu den anderen Kindern.
Birgit war selten gemein zu mir. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Kinder einen ständig kritisieren. Warum auch immer, tief in mir drin ist auf seltsame Weise der Satz verankert: „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu!“
Wo dieser Satz herkommt, würde ich auch gern mal wissen, aber ich weiß es nicht. Still betrachte ich Birgit, ihre dunklen, kurzen Locken, die kleine Brille und bemerke das liebe, traurige Lächeln in ihrem runden Gesicht.
Auf gar keinen Fall will ich zu spät zum Unterricht kommen.
Entschlossen marschiere ich auf Birgit zu, grinse sie an und sage:
„Komm, wir gehen rein, es ist kalt!“. Sie lächelt zurück und nickt. Ich lasse sie vor, die kleine Treppe hoch und dann durch die schöne Vordertür des Schulgebäudes. Innen im Haus ist es warm.
Froh atme ich tief durch und fühle, wie die Kälte langsam aus meinem Körper weicht.
Meine Schule mag ich, die hohen, weißen Holzfenster, die nach oben in einem großen Bogen auslaufen, die tiefen Fensterbänke aus Holz, die alten Steinmauern an Türen und Fenstern und besonders die Außenmauern, die in einem warmen Sonnengelb – fast Orange – gestrichen sind.
Einige Farben mag ich besonders gern. Manchmal auch die Farben meiner Kleidung. Meine Kleidung würde ich mir gern selbst aussuchen, aber das macht meine Mutter für mich. Und meine Oma.
Heute trage ich rote Strumpfhosen, einen dunkelroten Cordrock, der bis zu den Knien geht und einen rosa Pullover, den meine Oma selbst gestrickt hat.
Wenn meine Mutter sich so sehr freut, wenn ich diese Sachen trage, kann ich nicht dagegen an, obwohl diese Kleidung sich an meinem Körper und bis hinein in meine tiefste Seele unangenehm für mich anfühlt und enorm meine Bewegungsfreiheit einschränkt.
Wenn meine Oma mir manchmal Röcke strickt, habe ich keinen Mut, auch nur daran zu denken, ihr zu sagen, dass ich Röcke hasse. Ich liebe meine Oma so sehr. Sie gibt mir mehr Geborgenheit als meine Eltern. Vielleicht, weil ich seltener dort bin. Aber wie könnte ich sie verletzen?
Mir ist schon lange kalt in diesem Jahr, wenn ich Röcke tragen muss. Ich würde viel lieber Hosen tragen, wie die Jungen.
Hosen, die weit und angenehm für mich sind und vor allem warm genug. Keine Latzhosen, die mir immer von meinen schmalen, nach außen hin absinkenden Schultern rutschen.
Von meinem schwächlichen Körper, wegen dem ich mit fünf Jahren lange im Krankenhaus war.
Grün und Dunkelrot mag ich, da es nun gut zu den Farben des Herbstes und des Herbstlaubes passt. Aber ich hasse Rosa.
Rosa soll die Farbe sein, die für das Mitgefühl steht. Da von meinen Mitmenschen auch niemand Mitgefühl für mich hat oder zu haben scheint, weshalb soll ich dann Mitgefühl mit den Menschen haben?
Hass und Adrenalin geben mir Kraft und sind der Sinn in meinem Leben.
Vor allem enttäuschen sie mich nicht. So wie mein Käsebrot. Mein Käsebrot enttäuscht mich nicht. Hass und Ärger enttäuschen mich nicht.
Das ist einfach und ich mag das einfache Leben.
Wie soll ich aber meinen Hass meiner Oma gegenüber zeigen?
Bei meiner Oma finde ich auf eine seltsame Art keinen Grund, sie zu hassen, denn alles, was sie sagt, auch, wenn es mich zunächst verletzt, alles, was sie tut, auch wenn es mir in meinem innersten Wesen widerstrebt, das tut sie aus ihrer tiefen Liebe heraus, die sie für mich empfindet.
All ihr Handeln geschieht aus inniger Verbundenheit und bedingungsloser Liebe zu mir. Das spüre ich deutlich.
Auch wenn mich ihre Worte oder Taten vielleicht verletzen, so komme ich darüber hinweg, denn dies geschieht nur an der Oberfläche.
Was uns verbindet, sind Ruhe, Geborgenheit, Zufriedenheit, Zuversicht und Liebe.
An dieser Stelle kann ich nicht hassen.
Wo ich bedingungslos liebe, bin ich nicht mehr fähig, zu hassen.
Meine Oma Änne liebe ich und sie strickt wochenlang für mich die schönsten Kleidungsstücke mit edlen, of sehr komplizierten Strickmustern. Obwohl meine Oma schon Schmerzen in den Händen vom vielen Stricken hat.
Ich finde die Sachen auch schön und bin dankbar für die Mühe.
Aufmerksam spüre ich die Liebe und Anstrengung, die sie in die Arbeit hinein gegeben hat.
Nur die Farben könnten anders sein. Ich mag keine hellen Farben außer Orange.
Ansonsten liebe ich dunkelgrün und alles, was moosgrün ist, alle dunklen Farben, auch Rot und Braun, besonders jedoch Schwarz.
Aber meine Oma würde mir wohl nie einen schwarzen Pullover stricken, immer müssen es helle, „fröhliche“ Töne sein.
Oft fühle ich mich aber nicht fröhlich, zumindest nicht, wenn ich rosa tragen muss.
Auf Hellblau oder Türkis, Hellgrün oder Gelb könnte ich mich ja noch einlassen.
Solcherlei Kleidung bekomme ich jedoch selten geschenkt.
Die Erwachsenen zwingen mir überhaupt auf, was sie schön finden. Ob ich es mag, oder ob ich gar darunter leide, danach fragt keiner.
Was aber ist mein Wesen?
Wenn ich mal vorsichtig versuche, zu sagen, was mir nicht gefällt, kommt immer:
„Ja, aber, das ist doch schön“.
Drei mal sage ich es, dann gebe ich auf. Ich weiß bei den Erwachsenen einfach nicht weiter und schaffe es nicht, meine Welt, meine ureigensten Gedanken und meine innersten Gefühle zu ihnen herüber zu bringen.
Mir fehlen die Worte, der Mut und der Weg zum Bewusstsein der Erwachsenen, ihnen mein Wesen zu offenbaren.
So habe ich schon sehr früh begonnen, meine Träume, meine Gefühle, Ideen und Gedanken, die sie nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, für mich zu behalten und ganz tief innen in mir drin als mein Geheimnis wie einen Schatz zu hüten, den niemand finden darf.
Denn, wenn ich davon beginne, zu erzählen, dann sagen sie:
„Ach, das kann doch gar nicht sein,“ oder:
„Aber, das ist doch gar nicht wahr,“ oder:
„Ja, aber das ist doch gar nicht möglich“.
Und so reden sie mir meinen Schatz kaputt und er bröckelt immer mehr – ich bröckele immer mehr und mehr und ich habe große Angst, dass von mir, von der Sabrina, die ihre ganz eigene Welt hat und die eigentlich ein Junge ist, bald nichts mehr übrig bleibt.
Nackt stehe ich im Spiegel vor mir und jeder, der mich berührt, kann mich zerbrechen.
Wie heißt es in dem ganz besonderen Lied?
„Alone, confused and naked Is when we are most sacred“
So singt Terence Trent D’Arby.
Hass
Solcherart vor mich hin träumend bin ich den anderen Kindern in die Umkleidekabine gefolgt. Leider gibt es eine für Jungen und eine für Mädchen. Da ich mich als Junge fühle, möchte ich mich im Grunde lieber bei den Jungen umziehen. Aber wie soll ich das anstellen? Die Welt läuft wie am Fließband bei Spar ab. Es gibt niemals eine Pause.
Nur, wenn ich bezahle.
Aber selbst dabei muss ich mich ja beeilen. Auch wenn kein Kunde hinter mir steht, drängelt die Kassiererin freundlich, dass sie die Regale einräumen muss.
Zu einem kleinen Klön oder Schnack, einem kurzen Gespräch hat niemand Zeit.
Und was wäre, wenn ich im Laden oder auf der Straße einfach herumstehen würde und träumte. Da bekäme ich doch von den Erwachsenen und auch von den Kindern sicher einen blöden Spruch. Die Leute haben keine Zeit, sind immer geschäftig, und wenn einer anders ist, kriegst du eins auf’n Latz.
Ich weiß, diese ewige Hetze ist das Werk der Erwachsenen.
Sie sind jene, welche unsere Welt in immer schneller fahrenden Bahnen lenken.
Vor lauter Geschwindigkeit sehen wir die Welt nicht mehr.
Vor lauter Eile fühlen wir uns selbst nicht mehr.
Weil diese Hast der Erwachsenen Werk ist, müssten sie doch auch eigentlich in der Lage sein, dieses Fließband anzuhalten.
Das schaffen aber noch nicht mal meine Eltern in ihrer eigenen Familie.
Ich zumindest habe in meinen ganzen zwölf Jahren keinen Augenblick gefunden, ich habe noch nicht einmal einen schaffen können, in dem meine Eltern wirklich einmal MIR zuhören.
Da sich die Erwachsenen ihrer Macht über die Zeit nicht bewusst sind, können sie diese nicht stoppen.
Ich jedoch bin Kind.
Auch, wenn meine Seele Weltenalter zählt, so bin ich doch Kind geblieben.
In meinem Wesen, meinem inneren Kern.
In meiner Wahrheit.
Ich bin der Lenker meiner Welt.
Ich allein kann sie anhalten.
Langsam sein.
Den Augenblick genießen.
Allerdings nur für mich selbst, in meinem eigenen Rahmen.
Bei den Mitgliedern meiner Familie, die alle erwachsen sind, zeigt sich mir die Grenze, berühre ich die Mauern der Wirkkraft meiner Macht.
Wenn ich das Mädchen spiele, das sie offenbar sehen und hören wollen – das brave, „artige“, angepasste Mädchen in heller Kleidung, das freundlich, nett und hilfsbereit ist, sind auch sie freundlich und nett.
Aber wehe, wenn ich mal etwas aus mir herausgehen will. „Sei artig“, sagt meine Oma. „Nicht in diesem Ton“, sagt meine Mutter, die sich beinahe jeden Tag kommentarlos von ihrem Mann anschreien lässt. „Bis still“, sagt mein Vater, der lieber Dialekt spricht, was ich weiß, seitdem wir nach Nordfriesland gezogen sind und ich in die höhere Schule gekommen bin.
Hier unterscheiden wir klar zwischen Friesisch und Hochdeutsch und lernen beides genau. Und das finde ich klasse.
Mein Vater spricht etwas, das weder Friesisch noch hannoveranisches Hochdeutsch ist.
Doch es ist nicht richtig, allein seine Schwächen zu nennen, nur die Dinge aufzuzählen, welche ihm als Gaben nicht gegeben wurden.
Jetzt haben wir in meiner Grundschule kein Friesisch, sondern Sportunterricht.
Während ich mich umziehe und die Turnschuhe aus meinem orangefarbenen Sportbeutel nehme, überlege ich so vor mich hin.
Mag ich eigentlich Sport?
Ich mag Sport nicht, obwohl ich mich für mich selbst eigentlich ganz gern bewege. Morgens, bei Mathe und Deutsch, sitzt jeder an seinem Platz und wenn die Kinder reden oder in der Klasse herum laufen, bekommen sie einen Verweis.
Das ist auch sehr gut so, denn sonst könnten sie mich wieder beleidigen, sagen:
“Dein Brot stinkt nach Käse“ oder: „Deine Haut ist Scheiße“ oder: „Du bist eine dumme Heulsuse“, weil ich dann bereits begonnen habe, zu weinen.
Oder noch schlimmer, sie könnten zu mir herüber kommen, an meinen Platz, wo ich sitze und könnten mir meinen Stift oder meinen Füller weg nehmen. Sie könnten mir am Zopf ziehen, an dem Zopf, den ich so hasse, mich hauen und mich dann auslachen.
Das war im Kindergarten schlimm. Da hatte keiner einen festen Platz, an dem er sitzen bleiben musste, da konnten alle immer herum laufen und mich beleidigen.
Oder mir das Spielzeug aus der Hand schlagen und dann böse fauchen: „Mit dir spiel ich nich’!“.
Und immer stand ich nur da und wusste nicht, warum die Kinder so gemein zu mir sind. Und wenn ich dann geheult habe, dann lachten sie.
Die einzige, zu der ich Vertrauen hatte, war unsere Obererzieherin, Frau Stein.
Genau so ist es auch beim Turnen.
Alle laufen herum und können mit mir machen, was sie wollen. Wenn die Lehrerin nicht bald herein kommt, dann gehen die so weit und rupfen mich auseinander.
Ich glaube, wenn man Menschen lässt, schlagen sie einen zu Tode.
Ich habe schon oft Angst gehabt, dass Menschen mich einfach kaputt machen, und dann noch darüber lachen, weil ich ihnen nichts wert bin und weil ich mich nicht gewehrt habe.
Auch heute dauert es wieder eine Weile, bis die Turnlehrerin in der Halle erscheint. Ich habe mich schnell auf eine Bank im Turnraum gesetzt, denn da fühle ich mich sicherer. Ich umarme im Sitzen meine Knie. Dabei beschaue ich mir meine Haut. Ja, sie ist offen, rissig und schuppig und blutet auch manchmal.
Das kommt von meiner Neurodermitis, die ich schon habe, seit ich sechs Wochen alt bin. Aber muss man deshalb einen anderen Menschen derart heftig ablehnen?
Was ist mit meinen tollen Spielideen, die ich habe? Man könnte mit mir bestimmt gut Räuber und Gendarme spielen, das wäre mein Lieblingsspiel in einer Gruppe und ich wäre dann immer gern der Räuber, glaube ich. Aber danach fragen die anderen Kinder gar nicht. Sie finden meine Haut einfach nur doof und ekelig oder sie sagen: „Deine Creme stinkt“ oder: „Du stinkst“, oder: „Du bist doof“ und wollen nicht mit mir spielen.
Ganz schlimm ist immer, wenn wir beim Turnen in der Klasse Mannschaften wählen sollen. Christine und Sonja wählen dann meistens.
Christine ist sehr frech, wild und gemein, sie sagt immer, was sie denkt und beleidigt nicht nur mich, sondern auch die anderen Schüler. Sie haben das Kartoffelfeld hinter der alten großen Scheune, die zu dem großen Bauernhof in Tinnum gehört, einer der letzten auf der Insel Sylt. Und meine Mutter geht natürlich immer zu Christines Eltern Kartoffeln kaufen, das ist nur ein kurzer Weg über die Straße, und dann ist sie super freundlich zu ihnen.
Als ich eines Tages mit meiner Mutter den Mittagstisch zubereitete und ihr mal erzählen wollte, dass Christine mich schon oft beleidigt hat und dass ich sehr unter ihrer Art leide, hat meine Mutter gesagt: „Das kann ja sein.“ Dann hat sie gelacht und erklärt: „Aber sie haben sehr gute Kartoffeln! Und der Papa muss nicht extra nach Spar fahren.“
Während ich auf der Bank kauere und nachdenke, habe ich gar nicht gemerkt, was in dieser Zeit in der Turnhalle passiert. Marc hat irgendwo einen roten Ball, mit dem wir manchmal Handball spielen, herbekommen. Alle Schränke sind noch abgeschlossen, weil die Lehrerin, Frau März, immer noch nicht da ist. Aber nun erblicke ich ganz oben über der Sprossenwand auf dem schmalen, dreckigen kleinen Fenster noch einen blauen Handball, der dort auf etwa sieben Meter Höhe irgendwann einmal liegen geblieben ist.
Gerade, als ich mir ausdenken will, wie da einer hochklettern müsste, um den blauen Ball zu holen, trifft mich plötzlich etwas hart am linken Auge. Dann höre ich Gelächter. Mein Auge tut weh und ich bekomme sofort starke Kopfschmerzen.
„Voll getroffen,“ ruft Oliver und grinst.
„Nein, das geht noch besser,“ sagt Rene, „lass mich mal“.
Er nimmt Anlauf. Jetzt schießt Rene und trifft mich mitten auf die Nase. Das hat sehr weh getan. Ich halte mir das linke Auge zu, in dem es zu klopfen beginnt und fange an zu weinen.
„Gib mal her, ich treff’ die dumme Kuh noch mal“, sagt Sonja.
Sonja ist die Schülerin, die mich am häufigsten hänselt und über mich lacht, meistens aus der Ferne, wenn sie mit ihren Freundinnen zusammen sitzt, zu mir schaut und kichert.
Ich bekomme den Ball an die Schulter, der Ball hatte Wucht und rollt, nachdem er an der Wand hinter mir abgeprallt ist, zu den Kindern zurück.
Ich will hier weg!
Jetzt heule ich mit meinem ganzen Körper.
Es gibt Menschen, die von sich behaupten, dass sie sich selbst nicht spüren können.
Derlei Sorgen habe ich nicht.
Durch den körperlichen und seelischen Schmerz, den ich jeden Tag durch meine Mitmenschen erlebe, Hass, Eifersucht und Leid aufgrund meiner mannigfaltigen Allergien, meinem Asthma und meiner Neurodermitis, welche mich bereits seit meiner Geburt begleiten, spüre ich mich in jedem Augenblick sehr intensiv.
Es ist seltsam, aber durch meine Krankheiten habe ich auch eine gewisse Kraft bekommen. Ausdauer. Stärke. Zorn. Einfühlungsvermögen. Leid. Schmerz. Mitgefühl.
Oft habe ich geträumt, dass durch das große vergitterte Fenster auf der anderen Seite der Turnhalle mal irgendwann Zorro und die fünf Freunde plötzlich einsteigen und mich retten. Aber bisher ist keiner von ihnen gekommen, obwohl ich es mir mit aller Kraft gewünscht hab’.
Ich hab’ wohl nicht genug Kraft. Ich komme ja auch zu Hause nicht gegen meinen oft schreienden Vater und gegen meine sehr oft gemeine, zickige Mutter an.
Sie lassen sich auch nicht von mir helfen, wenn sie sich streiten. Oder gegen ihre komischen, dummen, normalen Freunde und deren normale Kinder.
Gegen die komme ich auch nicht an.
Manchmal empfinde ich, dass meine Mitmenschen nur dazu da sind, mich abzuhärten und zu stählen.
Denn nichts anderes tun sie, wenn ich ihren Hohn, ihre Lästereien sowie die Demütigungen, welche ich durch sie täglich erfahre, einmal aus einer anderen, aus einer eher unpersönlichen Perspektive betrachte.
„Wer sich selbst besiegt, erringt den größten Sieg,“ steht auf dem Kalenderblatt.
Was das wohl bedeuten mag?
Außer mit meiner Freundin Uta, manchmal mit Marina oder Monika, selten auch von Seiten der Jungen ist nichts gutes oder schönes in ihren Worten und Taten, weder gezielt Liebevolles, noch bewusst Mitfühlendes ist dabei.
Jedes mal, wenn sie mich hänseln und beleidigen, wächst meine Wut in mir.
Wut und Zorn sind eine gewaltige Kraft und der Quell meiner Macht.
Jeder, der mich tritt, macht mich stärker.
Jeder Mensch, der mich schlägt, wie einmal Inga morgens in der Klasse, macht mich härter.
Nur weh getan hat es.
Peinlich war es.
Vor anderen Menschen geschlagen zu werden passt einfach nicht in mein Selbstbild.
Wäre ich wie Jesus Christus, könnte ich locker damit umgehen.
Jesus ist einer, der hält bewusst auch noch die andere Wange hin.
Darunter leidet er nicht.
Im Gegenteil, er führt ihre Menschenseelen.
Jesus ist ein Lehrer der Menschen.
Er ist Seelenführer.
Psychopompos.
Wie der Fährmann in der Unterwelt.
Aber ist dieser Fährmann nicht eher der Teufel?
Jesus führt die Menschen in die Engelwelt, der Teufel führt die Seelen in die Unterwelt und beide sind sie einfach nur zwei Seiten einer Münze.
Wenn ich nur einem von ihnen folge, bin ich nur den halben Weg gereist.
Ich wäre gern Zorro. Der bin ich oft in meiner Phantasie. Aber in Wahrheit kenne ich leider weder die fünf Freunde noch bin ich Zorro.
Auch Zorro bewegt sich und kämpft in der Nacht. Seine Kraft liegt verborgen in der Unterwelt.
So wie die meine.
Doch wer bin ich?
Ich bin ein Versager.
Bisher habe ich es nicht geschafft, meine Anliegen, Dinge, die mir in meinem Inneren wichtig sind, in meine Außenwelt zu tragen, zu den Menschen oder Wesen um mich herum.
Die Leute hören nicht auf mich, nehmen mich nicht wahr, nehmen mich nicht ernst.
Immer gerate ich in die ständig wiederkehrenden Mechanismen ihrer Lust, sich an mir auszulassen.
Was auszulassen?
Unzufriedenheit, sich wichtig tun wollen, sich groß tun wollen, jemanden unterdrücken wollen, was auch immer.
Und dann bin ich immer ihr Opfer. Opfer ihrer Langeweile, ihres Frustes, ihrer Arroganz und Ignoranz, ich bin das Opfer ihrer Unsicherheit und Unzufriedenheit.
Egal, wovon, aber ich bin und bleibe ihr Opfer in der Schule, in der Familie, in meiner Außenwelt allgemein.
Manchmal, wenn ich an einer Bushaltestelle stehe und auf den Bus warte, der nach List in den Norden fährt, überlege ich, ob ich vielleicht die Fußabtretmatte der Gesellschaft bin, weil mich selbst fremde Leute an Haltestellen blöd und unfreundlich angaffen.
Warum?
Während ich so träume und Angst habe, dass ich auf dem linken Auge vielleicht blind werde, haben die Kinder den anderen Ball auch noch geholt. Michael ist hinauf geklettert. Sonja führt die anderen an. Sie und Christine schreien am lautesten: „Du blöde Kuh“ und wiederholen es immer wieder.
Mit „blöde Kuh“ bin ich gemeint.
Dabei lachen sie und bewerfen mich immer wieder mit den Bällen. Ich wackele vor Weinen und Verzweiflung am ganzen Körper. Ich schreie schon fast beim Heulen. Da kommt Sonja zu mir und klatscht mir ins Gesicht. Auch Inga haut mich. Nathaly und Britta lachen und nun lacht die ganze Klasse. Am nächsten ist mir Sonja.
Sie kommt immer ein Stück näher.
Auf einmal passiert etwas in mir.
Ein Entschluss wird in mir groß und füllt mich aus, durchströmt von innen meinen Leib vollkommen.
Ich bringe Sonja um!
Am ganzen Körper zitternd stehe ich auf und gehe mit einem Gemisch aus Entschlossenheit und Verzweiflung auf das Mädchen zu.
Wie aus der Ferne höre ich im Hintergrund eine Tür zuschlagen.
Dann kommt Frau März die kleine Holztreppe in die Halle hinunter.
„So, ich bringe jetzt die Sonja um!“, sage ich mit voller Entschlossenheit zu Sonja gerichtet, während ich an der Lehrerin vorbei gehe, ohne diese anzusehen.
Die Kinder flitzen schnell auf die Bänke und Sonja und Marc lassen die beiden Bälle schleunigst darunter verschwinden.
„Hier wird niemand umgebracht“, sagt Frau März wie beiläufig.
„Sabrina, setz dich.“
Ich stehe völlig verwirrt vor der Lehrerin.
Die geht an mir vorbei, nimmt ihr Klassenbuch hervor, das sie unter den Arm geklemmt hatte und beginnt die Namen aufzusagen. Das ist das Ritual, mit dem jeder Lehrer in jeder neuen Stunde wieder prüft, ob die Schüler auch alle da sind.
Es geht nach Alphabet.
Dabei bin ich eben die Erste.
Ich müsste jetzt eigentlich sitzen und deutlich hörbar „Ja“ antworten, sobald ich aufgerufen wurde.
Erst weiß ich jedoch nicht, was ich tun soll, will noch etwas zu Frau März sagen, aber die schaut nur ins Klassenbuch. Dann blicke ich schüchtern auf die Kinder.
Sonja grinst hämisch und streckt mir die Zunge heraus, Marc und Bernd tuscheln mit Christine, dann blicken sie mich heimtückisch an.
„Orringer Sabrina“ ruft Frau März und sucht, wo ich mittlerweile auf einer Bank sitze.
Sie geht nicht auf meinen Ausspruch mit dem Umbringen ein, zieht einfach den Unterricht durch.
Das Klassenbuch zwingt mich, in jeder Stunde als erstes meinen gehassten Namen zu hören und dazu auch noch „ja“ zu sagen. Doch im Moment stehe ich immer noch wie angewurzelt da.
„Setz dich hin!“ befiehlt sie. Ich setze mich zögernd etwas abseits von den anderen Kindern auf eine Bank. Dass mein Nachname Auringer ausgesprochen wird, hat sie in den zwei Jahren, die ich nun auf der neuen Schule bin, auch noch nicht verstanden. Ihre Art mir gegenüber ärgert mich. Ich nenne sie ja auch nicht „Frau April“.
Wir spielen Völkerball zum Aufwärmen.
Dabei werden wieder Mannschaften gewählt. Ich werde natürlich wieder als letzter gewählt. Birgit hat heute eine Befreiung für Sport. Ich darf mir nun die blöden Sprüche und Grimmassen allein einfangen.
Aber so ist das eben. Frau März sagt nie etwas gegen das Mobbing in der Klasse. Und so traue ich mich auch nicht, zu ihr zu gehen, und mich darüber zu beschweren.
Ich soll es wohl aushalten! Mein Vater meint das so.
Nach Mathe und Deutsch am Morgen verläuft in der Doppelstunde Sport der Tag weiterhin normal.
Die Art, wie die Kinder mit mir umgehen, kenne ich eben nicht anders.
Das Aufwärmen ist nun zu ende, die Bänder, rot und gelb, mit denen wir die Mannschaften markieren, werden eingesammelt, sowie auch der Ball.
Wir beginnen im Turnunterricht heute mit Steppen und alle machen ohne einen Mucks mit, mich eingeschlossen.
Obwohl ich das badeanzugähnliche Ding hasse, das meine Mutter mir stolz aus ihrem Kleiderfundus für das neue Sportthema gegeben hat, streife ich es widerwillig über.
Nun darf ich zwar endlich schwarz tragen, aber ich mag es nicht, wenn ich unten herum nur so dünn bekleidet bin. Außerdem sieht man so mein Hohlkreuz und meinen dicken Bauch. Ich fühle mich durch dieses Kleidungsstück sehr unsicher und wie auf dem Präsentierteller, obwohl es schwarz ist.
Das Geschehen mit den Bällen und meine Schmerzen, die in meiner Seele und an meinem Körper daher kommen, kann ich irgendwie in diesem Augenblick nicht verarbeiten und auch für die anderen Schüler bleibt es wie eine schwelende Wolke aus stinkendem Schwefel in der Luft hängen.
Keiner aus meiner Klasse geht zu der Lehrerin und sagt etwas darüber und ich wage es auch nicht.
So ist das halt. Kommt eben manchmal vor, dass man absichtlich angeschossen wird.
Immer noch pocht meine Nase und mein Gewürzprüfer sowie mein Auge tun mir weh.
Die zwei Stunden Turnen habe ich nun auch geschafft.
Nur so kann ich mit meinem Leben fertig werden: Ich hake alles ab, bis es endlich vorbei ist.
Hoffentlich bald.
Das Steppen ist ganz in Ordnung aber für mich eigentlich langweilig. Fechten oder Kampfsport würden mich, glaube ich, mehr interessieren. Boxen, Präzisionsschießen oder was es da an sportlichen Betätigungen alles so gibt.
Die Kinder, auch ich, watscheln nun wieder wie Enten hintereinander her in die Kabine zum Umkleiden. Ich überlege, während ich mich wieder umziehe, ob ich mich zu Haus meinen Eltern anvertrauen soll. Aber die haben meistens alles mögliche zu tun, das sie, warum auch immer, nicht unterbrechen wollen oder können, als ob jemand hinter ihnen stünde und die beiden dazu zwingen würde, alles eilig zu tun oder die Zeit zählen würde, in der sie waschen, spülen, abräumen, das Gemüse putzen, den Boden wischen, einkaufen, und, und, und.
Ein Karussell ohne Ende.
Ist das denn so schlimm, wenn mal eine Sache davon ausfällt, und meine Eltern sich statt dessen wirklich die echten Sorgen des Kindes anhörten, anstatt so zu tun, als ob alles andere wichtiger wäre und man beim Erzählen wie gehetzt Kartoffeln schält.
Man ist nicht einmal in der Lage, wirklich ohne schlechtes Gewissen das Küchenmesser beiseite zu legen und einfach nur wirklich zuzuhören.
Und wenn doch, schaut man schon wieder wie getrieben umher nach der nächsten Arbeit, die unbedingt sofort erledigt werden muss.
Warum ist das so?
Einmal habe ich meinem Vater davon erzählen können, wie die Kinder mit mir umgehen. Und er, er hat auch wirklich zugehört. Ich war gespannt auf seine Antwort.
Er hat einen Augenblick nachgedacht, hat dann freundlich gelächelt, mit den Schultern gezuckt und gesagt: „Tja, wat soll man da machen. Über mich lachen meine Leute auch manchmal. Dat musste eben aushalten“, meint er und nickt mir lieb lächelnd zu.
Er ist Gärtner bei der Inselverwaltung. Man hat ihm einen Vorarbeiterposten gegeben. Damit er mehr Geld hat, auch eben für das kranke Kind, also für mich.
Dafür hat er aber auch mehr Schwierigkeiten. Menschen zu führen und anzuleiten ist glaub ich nicht so sein Ding. Er ist manchmal ganz schön fertig, wenn er nach Hause kommt. Das kann ich ihm ansehen. Wenn ich dann frage, was los ist, sagt er nur schroff: „Hach, lass“, und verschwindet in dem Schlafzimmer meiner Eltern, um sich umzukleiden.
Auch ich bin mit meinem Umkleiden nun fertig. Ich habe den schwarzen Steppanzug, der unten wie ein Badeanzug geformt ist, aber oben Ärmel hat und einen sehr weiten Ausschnitt, mit Widerwillen über meinen Körper gestreift und in den gelben Turnbeutel zu den Turnschläppchen gestopft.
Früher hatte ich nicht solche Probleme, mich zu zeigen, denn für mich war meine offene, rote Haut, meine Neurodermitis ja normal und ich verstand die Ablehnung und das Lachen von Seiten meiner Mitschüler nicht.
Seit dem mein Körper mir und allen anderen langsam zeigt, dass er ein Mädchen ist, hasse ich diesen Körper aber und damit auch mich selbst immer mehr.
Denn ich bin ja auch mein Körper.
Nach dem Völkerball zum Aufwärmen, als die Mädchen mit dem Steppen begannen, durften die Jungen in der anderen Hälfte der Turnhalle Zirkeltraining üben.
Da hätte ich viel lieber mitgemacht, selbst wenn ich mit meinem Asthma kaum etwas geschafft hätte, aber ich wünsche mir unbedingt, einen starken, muskulösen Körper zu haben, wie ein Junge. So wie Marc oder Bernd zum Beispiel.
Ich weiß: in meinem Inneren bin ich ein Junge.
Anschließend an das Turnen haben wir, nach einer Zwanzigminutenpause, freitags immer zwei Stunden Kunst.
In der Schule habe ich für meine zweite Pause den Aufstieg zum Sirenenturm entdeckt. Die Eisentür und der Gang dort hin ist nie abgeschlossen. Da gibt es zwar nur die alte, mechanische Sirenenanlage und sonst nichts, nur Staub, keine Sitzgelegenheit.
Mein Auge schmerzt immer noch. Auf der Toilette habe ich nachgesehen, in den Spiegel geschaut. Es ist etwas dick und schmerzt. Auch meine Nase tut noch sehr weh.
Also hoffe ich, dass es mir beim Essen besser geht. Ich habe nämlich Hunger.
Hunger nach Brot. Hunger nach Butter und Käse.
Aber vor allen Dingen Hunger nach Anerkennung.
Hunger nach Geborgenheit und Liebe und etwas Ruhe.
Im Sirenenraum angekommen setze ich mich auf meinen Toni und schaue aus dem Fenster, während ich die Dreieckige Kuchendose aus meinem Tornister hole – wieder so eine Besonderheit aus Plastik der eben erwähnten Firma – und das selbstgebackene, aber etwas verbrannte Stück Käsekuchen esse, das mittlerweile ziemlich trocken geworden ist. Dafür ist viel Feuchtigkeit in der Dose.
Aber es schmeckt lecker süß und das tut mir gut, macht mich fröhlich und gibt mir neuen Mut.
Wo soll man sonst etwas wirklich Gutes erfahren, wenn nicht beim Essen?
Essen belügt einen nicht, ändert plötzlich seine Meinung oder den Geschmack, es kann nicht weglaufen oder sagt auf einmal zu mir: „Iiieh, da ist ja die Sabrina, nein, von dir will ich nicht gegessen werden“ und hüpft mir aus der Hand.
Nein, so etwas macht Essen zum Glück nicht.
Hier, in meinem Versteck, kann mich niemand ärgern und ich kann einen Teil des Schulhofs überblicken, die Mauern sind so dick, dass man aus dem Fenster nicht viel sehen kann.
Ein seltener Baustil für die friesische Insel, wo sonst alles in Backsteingotik und wenn nicht, dann weiß und nicht gelb gestrichen ist.
Jetzt haben wir 1986. Vielleicht haben sie das Gebäude ja in den Siebzigern gestrichen, wo so tolle Farbkombinationen wie Orange, gelb und Braun mit Rot zu finden waren, die ich als kleines Kind liebte.
Weit in die extrem breite, steinerne Fensternische hinein zu lehnen, traue ich mich nicht, dann wird mir komisch und ich bekomme Höhenangst. Auch die steile Treppe hoch muss ich mich am Geländer festhalten.
Sechs oder sieben Stunden Unterricht am Tag finde ich viel, aber in der sechsten Klasse ist das normal, sagen die Erwachsenen und sie meinen, dass Sport und Kunst leicht zu ertragen sind.
Die sollten sich mal sieben Stunden am Stück von anderen Kindern ärgern lassen!
Meine Freundin Uta und ich, wir würden erst gar nicht auf die Idee kommen, uns dauerhaft und nachhaltig gegen die anderen Kinder zu wehren.
Aber das brauchen wir auch nicht. Wer haben unsere Rückzugspunkte und Nischen gefunden.
Machen das auch die Jugendlichen so, einen Rückzugspunkt und eine Nische finden, wenn sie Drogen nehmen, rauchen und andere Sachen machen, die schädlich für sie sind, weil sie sonst in der Welt keiner versteht?
Wenn ich meine Eltern frage, wie es für sie in der Schule war, scheint es immer „nicht so schlimm“ gewesen zu sein. Trotz Krieg?
Bald ertönt der viertönige, wohlklingende Pausengong und weist darauf hin, dass die Zeit zum Durchatmen, meine Nische zum Rückzug nun beendet ist.
Ich atme einmal tief durch und merke, dass meine Nase immer noch weh tut, aber das Auge hat etwas aufgehört, zu tränen.
Vorsichtig steige ich die Treppe des Turmes hinunter und gleite leise durch die alte schöne Metalltüre, die grün gestrichen ist, hinaus auf den Pausenhof.
Nun also zu dem, was jetzt ansteht. Malen.
Zum Glück male ich wirklich gern. Hier kann ich innerlich mit dem fertig werden, wozu weder ich momentan die Macht habe, es mir einzurichten, noch die Klasse und die Schule, geschweige denn die Gesellschaft, die Menschen da draußen untereinander wirklich Gelegenheit haben: Zeit.
Zeit für mich, Augenblicke, um zu mir zu finden, Ruhe, Klarheit, Achtsamkeit.
An einen wirklichen ganz authentischen Austausch miteinander, mit mir selbst, den anderen Kindern und Erwachsenen wage ich gar nicht zu denken.
Heute passiert im Kunst – Unterricht etwas Interessantes.
Ich kann auch wieder ein Stück weit besser gucken, mein Auge hat sich ein wenig beruhigt, meine Nase schmerzt.
Die Lehrerin, eine Dame aus Finnland, legt klassische Musik auf und wir sollen dazu auf Papier mit den Händen malen.
Ich finde es schön und male so etwas wie einen blauen Strudel, der in der Mitte des Blattes seinen Mittelpunkt hat. Dabei verliere ich mich im Genuss der verschiedenen vielen Blau-, mancher Grün- Gelb- und Lilatöne. Ich bin ganz in mir, ganz beim Malen.
Das Geschehen von vor etwa einer Stunde scheint fast vergessen.
Die Nase schmerzt noch etwas, das linke Auge beginnt zu jucken und tränt noch ein wenig nach. Mein Körper muckt nur manchmal auf, wenn ich schluchzen muss. Dann zuckt es durch mich hindurch.
Auch die anderen Kinder beginnen bald mit der Aufgabenstellung. Marc und Oliver fangen aber nach einiger Zeit an, zu lachen und ärgern sich mit dem Malpinsel. Als die Jungen nicht aufhören, sich gegenseitig zu bemalen, sehe ich plötzlich, dass die Lehrerin weint. Stimmt das wirklich, oder täusche ich mich?
Ich sehe genau hin.
Nein, ich täusche mich nicht. Sie weint wirklich. Sie nimmt ihre Brille ab. Von den Kindern hat es niemand gesehen, die sind mit sich selbst zu sehr beschäftigt.
Eine Zeit lang hört man nur die leise Streichermusik. Die Lehrerin, Frau Harunen, hat nicht bemerkt, dass ich mitbekommen habe, dass sie weint.
Alles ist ruhig, malt. Frau Harunen beginnt, ihre Brille zu putzen.
Plötzlich lacht Oliver laut auf und ruft: „Lass mich in Ruhe, du Esel!“
Gemeint war wohl Marc. Frau Harunen setzt die Brille wieder auf. Erst sind alle still, aber Oliver fängt plötzlich laut an, zu lachen und verschwindet unter dem Tisch, um seinen Pinsel aufzuheben.
„Du hast Farbe auf den Boden gemacht, wisch das auf“, sagt Frau Harunen.
Als Oliver zum Waschbecken gehen will, stellt Marc ihm ein Bein, der Pinsel fliegt in die Ecke und die beiden beginnen wieder laut zu lachen und sich zu raufen.
Ich schaue in den Klassenraum. Alle anderen sitzen ruhig an ihren Tischen.
Wenn wir jetzt alle hier herumspringen würden, hätte Frau Harunen aber viel zu tun, bei 30 Kindern.
Plötzlich schluchzt sie und ruft zu Marc und Bernd: „Ihr seid Asslösser!“
Einige Kinder kichern und wiederholen das falsch ausgesprochene Wort. Frau Harunen spricht ziemlich mit Akzent.
Auch ich freue mich innerlich, jedoch darüber, dass Marc und Oliver, die so oft frech sind und mich auch viel ärgern, endlich mal eins drüber bekommen haben.
Geschieht ihnen recht.
Auf der Uhr an der Wand sehe ich, dass wir noch dreißig Minuten haben.
Jetzt malen alle, Oliver hat den Boden, den er eingefärbt hat, eher schlecht als recht geputzt, alle sind ruhig.
Ich überlege, ob ich die Ecken meines Bildes weiß lassen soll, oder den Strudel wie einen See auf das ganze Bild erweitern soll. Mit Einräumen schaffe ich das noch. Ich beschließe, viel Blau, auch hell Blau, etwas Dunkelgrün und auch ein wenig Gelb zu nehmen.
Auf einmal bemerke ich, dass es Frau Harunen wohl ebenso geht, wie mir. Sie fühlt sich von den Kindern nicht ernst genommen. Nur im Gegensatz zu mir kann sie die Kinder zur Ordnung rufen.
Vielleicht müsste ich Lehrerin sein!
Fieber
Nachdem am Freitag der Kunstunterricht beendet ist, beginnt für mich schon das Wochenende.
Bereits auf dem Rückweg von der Schule nach Hause ist mir übel, sehr schwindelig und mein Kopf ist ganz heiß.
Meine Nase schmerzt noch etwas.
Müde schaffe ich es bis nach Hause.
Was sonst nie vor kommt, ist, dass ich keinen Appetit habe, noch nicht einmal auf Möhren und Kartoffeln untereinander mit Butter und leckeren Frikadellen, die meine Mutter oft kocht, die liebe ich normalerweise.
Aber an diesem Nachmittag legt meine Mutter mich ins Bett. Ich weine. Von den Geschehnissen in der Schule schaffte ich nicht, zu erzählen, dafür ist mir zu elend.
Mir ist immer noch sehr schwindelig und ich glaube, dass mich das, was in der Schule passiert ist aber vor allem das, was nicht passiert ist, krank gemacht hat.
Passiert ist, glaube ich, was ein Bekannter meiner Mutter einmal lachend „Mobbing“ genannt hat. Das Wort Mobbing sei in seiner Firma jetzt ein ganz neues Modewort und man würde die Leute zu diesem Thema durch Lehrgänge schleusen, aber wirklich im Arbeitsalltag etwas davon umzusetzen, dazu sei keiner bereit und es fehlte einfach der zeitliche und organisatorische Rahmen.
Zudem müsse ja auch die Führung dahinter stehen… .
Daran, an dieses Erwachsenengespräch, kann ich mich in meinem fiebrigen Zustand gerade noch erinnern.
Krampfhaft versuche ich anschließend daran zu denken, was mich vor allem krank gemacht hat, an das, was nicht passiert ist, nämlich die Klärung, das Gespräch, so was wie im Kreis sitzen und die Gruppe, Kinder wieder zusammenführen, als echte Klassengemeinschaft.
Einer hätte kommen müssen und mich fragen müssen, er hätte das Wort „umbringen“ aufgeschnappt und was ich denn damit gemeint hätte.
Dann hätte man die ganze Klasse fragen müssen, was soeben geschehen sei.
Auch mich. Und auch alle anderen. Und jeder hätte genug Zeit zu reden gehabt.
Am besten hätte man sich dazu in einen Kreis auf den Hallenboden aus Holz gesetzt. Die Lehrerin hätte das anleiten müssen.
Sie hat jedoch nur den reibungslosen Ablauf des Unterrichts im Sinn, hat mich ja noch nicht einmal angesehen. Obwohl sie gehört hat, wie ich gesagt habe, dass ich Sonja umbringen will.
Ich bin mir ganz sicher, dass sie es gehört hat.
Ich weiß es.
In meinem Herzen habe ich gespürt, dass sie meine Worte genau verstanden hat.
So etwas sage ich doch sonst nicht.
Das hätte ihr doch seltsam vorkommen müssen und da hätte ihr innerer Impuls, ihre innere Stimme ihr doch laut und deutlich sagen müssen, das da erst einmal etwas zu regeln ist, bevor man mit dem Turnen anfängt oder mit der Klassenliste, die durchzunudeln wie ein Tonband jeden Tag. Ist das denn den Lehrern nicht auch mittlerweile langweilig oder zu doof?
Die Frau März ist doch erwachsen. Die muss doch eine innere Stimme haben.
Aber sie hat wahrscheinlich einfach nicht auf ihre innere Stimme gehört.
Vielleicht hat sie ja auch gar keine. Möglicherweise kommt das auch davon, dass wir eben eher preußisch, gehorsam, geprägt sind, als germanisch, im Allthing, gemeinschaftlich. Das sagt mir eine vage Erinnerung.
Bin etwa ich selbst gefragt?
Bin ich diejenige, bin ich die einzige Person, die ihre eigene innere Stimme hört, sie wahrnimmt und deshalb auch die alleinige Person oder der einzige Mensch, der auf seine eigene innere Stimme hören kann?
Muss ich in Zukunft solche Situationen selbst regeln?
Wenn ja, wie?
Fieberhaft fällt mir ein, dass ich Frau März unbedingt bald fragen muss, ob sie eine innere Stimme hat. Das ist bestimmt die Lösung!
Vielleicht ist es ja doch die Lehrerin, die sich bei einer Mobbingsituation mit ihrem professionellen Können und Geschick einbringen muss.
Anstelle von „meiner Einer“ – von mir.
Leider kann ich die Lehrerin im Augenblick nicht fragen, ob sie eine innere Stimme hat, die ihr immer sagt, was sie tun soll und die ihr auch sagt, was richtig und falsch und was wichtig und was weniger wichtig ist.
Ich habe so eine innere Stimme, aber die ist klein und leise und leider verlasse ich mich nicht immer darauf, zumindest wohl nicht genug.
Mann, das wäre doch mal ein Unterricht, in dem wir Menschen uns darauf konzentrieren, unsere innere Stimme, unsere inneren Gefühle wahrnehmen zu lernen und uns nicht immer nur mit Themen unserer Außen- und Umwelt zu beschäftigen.
Durch letzteres drehen wir uns ständig im Kreis und erkennen uns selbst nicht!
Mein Zorro aus den Zorroheften, der konnte das. Der hat auf seine innere Stimme gehört, ist ihr gefolgt und hat getan, was richtig und was wichtig ist.
Und er hat das gelassen, was falsch ist.
Er hat getötet. Aber nicht aus Freude am Töten.
Er hat Frauen nicht benutzt.
Er hat sich dafür eingesetzt, dass Gerechtigkeit wieder hergestellt wird, wenn andere Recht verbogen hatten.
Er hat Menschen nicht ausgenutzt, er hat sie beschützt.
Er war sehr aktiv.
Aber auch nur nachts, im Dunkeln, im Verborgenen.
In der „Unterwelt“, der Nacht.
Niemand sollte von seiner Tat, dem Kampf des namenlosen „Zorro“, des Fuchses, des Kriegers für die Gerechtigkeit, auf ihn, Diego de la Vega, schließen.
Die Maske, der schwarze Umhang, eine Verkleidung also, sollte seine wahre Identität verbergen in Las Vegas, Reina de los Angeles, oder wo das war.
Ich dagegen bin sehr passiv.
Ich hasse meinen Mädchennamen.
Diego – das bedeutet, so weit ich weiß, Richard. Das war sein richtiger Name.
Mit solch einem Namen könnte ich mich gut identifizieren.
Klingt für mich aufrecht.
Sabrina klingt nur niedlich.
So sehen mich jedenfalls meine Verwandten.
Zorro. Der Fuchs, das ist eher ein Titel.
Er, Diego de la Vega, kämpfte nicht unter seinem richtigen Namen für das Recht und für andere Menschen.
Warum nicht?
War er auch zu feige, so wie ich?
Aber er war doch kein Versager, so, wie ich es von mir empfinde.
Ich selbst empfinde mich als ein Nichts.
Nicht mehr Wert als der Müll in meiner Mülltonne.
Das bin ich.
Vielleicht hat Zorro unter dem Titel gekämpft und nur nachts, weil Richard kein Angeber war und gar nicht wollte, dass die Menschen wissen, was er kann und wie sehr er sich für die Leute einsetzt.
Er wollte sich nicht hervortun.
Das könnte auch sein. Und was heißt: Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen? Meine Mutter sagt das immer zu mir.
All diese Empfindungen sind sehr viel für mich heute.
Schon im Halbschlaf suchen mich die inneren Bilder meiner Zorrohefte.
Ich habe drei Zorrohefte. Wie gern hätte ich noch mehr gehabt. Einmal habe ich meinen Mut zusammengenommen und an den Verlag geschrieben, ob es noch mehr Hefte gibt.
Sie haben nicht reagiert, haben mir nur meinen eigenen Brief zurück geschickt, mit lauter rotem Gekritzel drin. Als ich weinend zu meiner Mutter damit ging, sagte sie nur, dass der Mann vom Verlag mit Rotstift meine Rechtschreibfehler korrigiert hat.
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Warum hat meine Mutter, bevor wir den Brief losschickten, mir nicht geholfen?
Hatte sie es angeboten aber ich hatte ihre Hilfe abgelehnt, weil ich wollte, dass die Leute freundlich meinen Brief annehmen, wie er ist, vielleicht korrigieren und dann liebevoll eine Erklärung auf meine Frage hin dazuschreiben?
Der Gedanke, dass die Welt lieblos und unachtsam ist, das alle Kinder und Erwachsenen gemein sind und mich mit meinen Gefühlen allein lassen, bringt mich wieder zum Weinen und ich bekomme noch stärkere Kopfschmerzen. Alles das ist wie, als wenn ich vor den Kopf gestoßen wäre von allen Menschen.
Was in der Welt abgeht, weiß ich, seit ich vor dem Schlafengehen immer die Tagesschau mit meinen Eltern ansehen muss, wenn ich nicht allein sein will, vor dem Zu Bett Gehen.
Das geht nun seit der ersten Klasse so, seit ich sechs Jahre alt war.
Warum können die von der Tagesschau nicht mal was Erfreuliches melden?
Geschieht denn auf unserem Planeten nichts in dieser Art?
Alle verdrecken die Umwelt, führen Krieg und die eine Nation will an die Reichtümer der anderen. Leute betrügen sich, nirgendwo scheint wirklich Frieden zu sein. Wieso eigentlich?
Ist Frieden denn „out“?
Und, wenn ja, wie kann man es machen, dass er doch wieder „in“ ist?
Es haut mich völlig um und ich schlafe sofort ein. Mein Schlaf ist sehr unruhig.
Ich glaube, ich bekomme wieder meine Tage. Oh nein, das bedeutet heftige schmerzende Bauch- und Magenkrämpfe, dass ich davon schreien und mich übergeben muss, wie Migräne, und das etwa vier Stunden lang. Ich hab das seit fast einem Jahr. Ich brenne in meinen Lenden! Mädchen zu sein ist scheiße!
Lieber wär ich ein Junge. Bei denen richtet sich in der Pubertät was auf. Die Stimme wird dunkler. Mächtiger. Ich jedoch werde schwach und bin an mein Bett gebunden. Verzweifelt versuche ich mich in den Schlaf zu weinen.
Vorher schaffe ich noch auf die Playtaste meines Kassettenrekorders zu drücken und das Stabat Mater von Josef Haydn anzumachen. Davon kann ich besser einschlafen, das lenkt mich ein bisschen von den Schmerzen ab.
Auch wenn es nur eine Stunde dauert, glaube ich.
Am Ende kommt dann Suzanne Vega mit dem Lied „Small Blue Thing“, das hab’ ich gestern auf den Rest des Bandes aufgenommen.
Dann ist die Seite der Kassette zwar irgendwann nach insgesamt 90 Minuten zu Ende, aber das Klicken des Rekorders, wenn die Playtaste automatisch am Schluss dieser Seite des Bandes wieder hoch gedrückt wird, höre ich meistens schon gar nicht mehr. Vega. Vega ist der Nachname der Sängerin.
Vega heißt auch das Schiff des Greenpeacers am Mururoa-Atoll. Vega. Oder Greenpeace III.
Ich glaube auch, ich habe einen furchtbaren, seltsamen Alptraum. Ich weiß überhaupt nicht, ob es ein Traum ist, oder was es sonst sein soll.
Vielleicht phantasiere ich. Träume von David Mc Taggert. Von seinen Reisen, Abenteuern und von meinem nicht gelebtem Wunsch nach der Teilhabe an eben diesen Abenteuern.
Ich will zu euch gehören. Zur Crew der Vega oder Greenpeace III und ich will Mitglied auf der Rainbow Warrior sein. Ich will bei Greenpeace arbeiten und im Frühjahr, in den Osterferien wollte ich allein mit dem Zug nach Hamburg und dort hin. Haus der Seefahrt, 2000 Hamburg 11.
Von Westerland mit’m Zug nach Hamburg. Und dann die Adresse zu finden, da muss ich mich nur durchfragen in Hamburg. Is’n Pappenstiel! Geld hab’ ich keins, aber ich hätt’ morgens in der Frühe einfach welches aus dem Portemonnaie meiner Mutter genommen und einen Entschuldigungsbrief daneben gelegt.
Sie soll sich was einfallen lassen, wie ich’s ihr abarbeiten kann, das Geld.
Krieg ich jetzt allein von der Vorstellung, das Geld zu nehmen, ein schlechtes Gewissen?
Warum ist meine Stirn so heiß und ich schwitze so heftig?
Sicher ist es Fieber.
Ich bin verzweifelt und verwirrt und habe große Angst.
Im Traum fühle ich mich immer noch wie allein gelassen. Meine Nase beginnt wieder stärker zu schmerzen.
Aber jetzt habe ich so etwas wie ein Brennen in der Brustgegend und jeder Atemzug macht es schlimmer.
Ich glaube, ich bekomme einen Asthmaanfall, wache aber nicht davon auf.
Obwohl ich genau zu wissen glaube, dass ich schlafe, öffne ich plötzlich die Augen.
Nicht, dass ich sie aufreiße, dazu bin ich viel zu schwach und zu müde.
Bei Schulbeginn hatte ich mal eine Gehirnerschütterung und kurz, bevor ich sozusagen ohnmächtig wurde, erklärte ich den beiden Direktoren im Lehrerzimmer noch, dass es mir gut gehe. Ich weiß noch genau, wie sie da standen, Herr Müller und Frau Beckmann, unsere erste Direktorin….
Als ich die Augen öffne und ein wenig klar denken kann, blicke ich um mich.
Was ist mit meinem Kinderzimmer passiert?
Dunkelbraunes Furniersperrholz mit Dunkel Ockergelb, dazu eine orange Schreibunterlage von der Firma Herlitz aus Plastik, die gleichzeitig Boxen für Stifte und Radiergummi hat und die ich sehr schön finde, ein einfaches Naturholz – Ikea – Regal, alles ist weg. Mein Klappbett aus dunklem Furniersperrholz, auch weg.
Die Wände sind dunkel geworden. Dunkelgrau. Meine Wände, meine Tapeten sind zu Sandsteinblöcken geworden, die mit einfachen, dunklen Wandteppichen behangen sind, wohl um die Wärme zu halten. Kalt ist es in diesem Raum.
Die Luft ist auch kalt und riecht scharf nach Rauch. Auf der anderen Seite des Raumes entdecke ich einen offenen Kamin.
Der Raum wird ansonsten durch Pechfackeln und Kerzen erhellt, die in Kerzenständern um mein Bett stehen sowie in den Ecken des für einen Schlafraum verhältnismäßig großen Zimmers.
Mein Bett ist aus dunklem Holz und wird nach oben hin begrenzt von einem Baldachin aus dunkelrotem Leinenstoff. Der soll wohl ein Wenig die Wärme bei mir halten und so etwas wie eine Privatsphäre schaffen. Von irgendwo höre ich verhaltenes Sprechen.
Ich muss husten, muss mich schwer räuspern aber es geht nicht vor lauter Schmerzen, verendet eher in ein Röcheln. Dabei verschlucke ich mich und fühle mich elend.
Die Bettdecke ist eigenartig schwer.
Als ich mich an der Augenbraue kratzen will, bemerke ich, dass ich kaum Kraft habe, meine Hände zu heben. Sie sind unter der Decke.
Mein Atem rollt schwer und ich keuche.
Es ist furchtbar. Nun habe ich auch ein Stechen und wieder ein grässliches Brennen im Brustkorb, das wahnsinnig schmerzt. Wieder muss ich husten, kann kaum atmen und kann nun sehen, dass ich Blut gehustet habe.