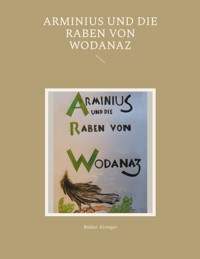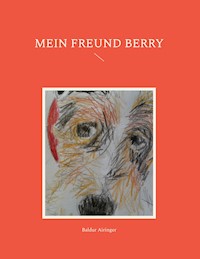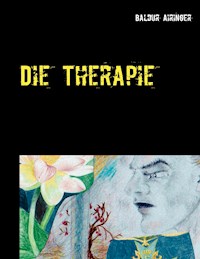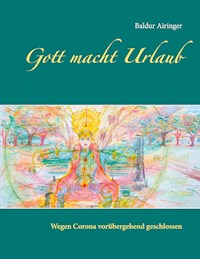Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Auftrag
- Sprache: Deutsch
Einst war ich ein großer König. Und als ich ein lütter Knabe war, erinnerte ich mich daran. Das war, bevor ich aus vielen Puzzleteilen ein Land mit Blut und Eisen in die Einheit zwang. Es fand statt, bevor ich in Jena ihm lieferte einen Waffengang, als mein Name gar nicht deutsch, sondern französisch klang. Französisch oder deutsch, spielt keine Rolle mehr, ausgesperrt wurde ich in beiden Fällen, hin oder her! Heute würdest du sagen: Ich wurde geparkt, ausgechased, abgesagt und abgehakt. Doch nun genug geklagt! Hier berichte ich euch von meiner Geschichte. Auf, drum, sei es gewagt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Verstehen kann man das Leben nur rückwärts,
leben muss man es vorwärts.“
Sören Kierkegaard
Bild: Baldur Airinger
Bildbearbeitung: Thomas Lindsay
Inhalt
Prolog | Rosenheim
Crazy | Lied von Gnarls Barkley
Kapitel 1 | Schmetterlinge
Kapitel 2 | Der Auftrag
Kapitel 3 | Visionen
Kapitel 4 | Miserere Mei Deus
Epilog | Literatur und Dank
Prolog | Rosenheim
Wer von Euch kennt Rosenheim?
Liebliche Landschaft, geformt von Gletschern in grauer Vorzeit.
Achtsam geschwungen.
Die Zeit hat euch geschaffen.
Und nun scheint alles still zu stehen.
Auch mein Atem stockte, könnt’ ich euch bald wieder sehn.
Vertrautes Tal, Hügel, von Sonne oft so hell beschienen, magisch von mächtigen Bergen umrahmt liegst träumend du geschützt im Nest, das ein Geheimnis birgt.
Es kommt ein Adler still heran geflogen.
Kein Steinadler, auch kein Fischadler.
Dieser Vogel ist mächtiger als alle, er kommt von weit her, aus dem Ort Friedrichsruh und gleitet hoch in den Wolken über Seen, Berge und Täler, Landschaften, wild und unbewohnt, dunkel, rau, dann sieht er die Sonne, fliegt mitten hinein ins Glück an diesem Tag.
In Rosenheim.
Der Adler taucht ein.
Streift ab sein mächtiges Gefieder.
Sinkt zur Erd hernieder.
Seele.
Du bist mein.
Crazy
„I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
There was something so pleasant about that place
Even your emotions have an echo in so much space
And when you’re out there, without care
Yeah I was out of touch
But it wasn’t because I didn’t know enough
I just knew too much
Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Possibly
And I hope that you are having the time of your life
But think twice
That’s my only advice
Come on now, who do you
Who do you, who do you
Who do you think you are?
Ha ha ha, bless your soul
You really think you’re in control?
Well
I think you’re crazy
I think you’re crazy
I think you’re crazy
Just like me
My heroes had the heart
To lose their lives out on a limb
And all I remember, is thinking
I wanna be like them
Mmhmm ever since I was little
Ever since I was little it looked like fun
And it’s no coincidence I’ve come
And I can die when I’m done
But maybe I’m crazy
Maybe you’re crazy
Maybe we’re crazy
Probably ooh hmm”
© Gnarls Barkley
Kapitel 1 | Schmetterlinge
Wie von Zauberhand geschaffen schweben elfengleiche Wesen um mich.
Sie sind groß, manche klein im hellen Sonnenlicht.
„Ich sehe viele Schmetterlinge, Mama!“
„Ja? Schön, mein Schatz!“
Mama lächelt mich an.
Sie berührt mich mit ihrer schlanken Hand sanft an meiner Schulter.
Ich kann mitten in ihr Herz sehen.
Und erschauere.
Still betrachte ich ihre feingliedrigen Finger.
Meine Schulter.
Entlang ihres eleganten Armes wandert mein Blick aufmerksam zu ihrem Gesicht.
Sie schaut mich tatsächlich einmal an!
Ich will den freundlichen Ausdruck ihrer Augen fangen und festhalten.
Genau wie die Schmetterlinge.
Gerade Mutters Mimik ist mir so kostbar wie ein seltenes Fluginsekt, das stark, mächtig und doch zart und zerbrechlich wirkt wie eine Fee aus einer anderen Welt.
Obwohl ich jetzt fünf Winter zähle, kenne ich Mutter erst seit zwei Jahren.
Bis zu meinem dritten Geburtstag war ich beinahe ununterbrochen in Pflegefamilien daheim.
Musste Mama so lange mit Papa weg sein, in der Ferne, auf der Arbeit?
Sie hätte bei mir bleiben sollen.
Ich will, dass sie jetzt für immer an meiner Seite ist!
Alles will ich an ihrem Blick aufsaugen, diesem kurzen Moment der Begegnung, den sie mir schenkt, in dem sich der Raum in meinem Herzen öffnet und sie mir echte Freude bereitet.
Ich will sie lieben!
Mit meiner kindlichen Seele sehne ich mich nach ihrer Aufmerksamkeit.
Nach ihrem verstehenden Herzen. Ich will, dass sie auch mich liebt.
Keine Macht habe ich über sie.
Nichts in der Welt kann Mama dazu zwingen, mich anzusehen.
Mich anzusehen und mich dabei auch wahrzunehmen.
Und bei mir zu bleiben.
Wann – wann darf ich die Liebe, die Flamme Deines Herzens spüren?
Ich kann’s ihr nicht befehlen!
Dafür hasse ich uns alle.
Ich hasse Mutter, weil sie mich nicht liebt, wie in meiner Zeit als Napoleone, da ihre süße Seite stets souveräne Strenge war.
Immer noch entzieht sich ihre Seele meinem Sinn, windet sich ihr Herz aus meiner Hand, ich vermag es nicht zu greifen gleich diesem Schmetterling.
In ihrer Umarmung liebt Mutter mich leidenschaftlich wie ein feuchter Feudel.
Ihre Blicke gleiten von mir fort.
Wieder zu Hermann, ihrem Freund.
Der auch noch meinen Namen trägt.
Oder habe ich den Seinen?
Hier auf seiner Burg – hier auf meiner Burg in Franken kann ich wenigstens leben, wie früher.
Als ich König der Franken war.
Auch damals gab es Schwierigkeiten mit meiner Mutter.
Hier kann ich frei umher laufen und Karl der Große, kann wieder Nobunaga oder Buonaparte sein.
Bonaparte.
Frei.
Spielend.
Ohne Mauern, die mich verbannen.
Hier sind Mauern, die mich beschützen!
Abgeschoben war ich als Kind auch.
Drei lange Jahre.
Die Menschen waren freundlich zu mir. Dennoch blieb ich Gast.
All dies ist mir wohl bewusst. Ich betrachte mich und mein Leben, erkenne alles ganz behutsam und genau.
Auch als Napoleone war ich am Ende meines Lebens ein von der Gemeinschaft Ausgestoßener.
Kalt.
Hart.
Ohne die Liebe meiner Leute.
Heute weiß ich, dass es allein an mir ist, ihnen treu zu sein.
Damals aber war ich nur verbittert.
Warum schieben sie mich weg?
Die Franzosen! Mama!
Hasst Ihr mich?
Es kommen wieder Schmetterlinge.
Viele sind schwarz und rot.
Andere bunt.
Sie sind schön.
Aber meistens bedrohlich.
Manchmal, wenn ich sie sehe, sitze ich dabei zunächst auf einem schmucklosen Holzstuhl.
Obwohl ich mich gut konzentriere, erkenne ich alles nur verschwommen.
Sie liegen vor mir auf dem einfachen Holztischlein.
Flach.
Wie aus Papier.
Und wir sind in einer Zelle.
Ein Mann ist bei mir.
Ich bin erwachsen.
Dann.
In meinem Tagtraum.
Doch nun beginnen sie sich aus den Papierseiten zu erheben.
Lösen sich sanft ab.
Schweben.
Um mich.
Groß.
Ruhig.
Würdevoll.
Bemessen schreite ich um sie herum.
Sie sprechen auch zu mir.
Sanft höre ich ihre Stimmen.
Wie aus der Ferne fragen sie:
„Wer bist du?“
Ich stehe nur da und weiß keine Antwort.
Als kleiner Junge, der ich bin.
Soll ich ihnen meinen Namen sagen?
Aber was ist schon ein Name?
Schall, der vergeht.
Ich zeige euch meine Seele, denn sie ist ewig.
Die Sonne blendet.
„Mama, siehst du die Schmetterlinge, Mama?“
„Wo sind sie denn, mein Schatz?“
Sie sieht mich an!
Ich tauche in ihren Blick ein.
Vollkommen.
In ihr Herz einzutauchen, wage ich nicht.
Darin ist mir zu kalt.
Mir ist zu kalt im Herzen meiner Mutter.
Friere ich immer, wenn ich mich dort hinein begeben habe, ganz, mit all meiner Lust, mit all meinem Mut, mit all meiner Liebe?
„Hermann?“
Meine Mutter lächelt mich an.
Ich neige den Kopf etwas zur Seite.
Dann lächele ich auch.
Ich werde sie nie wieder gehen lassen!
„Sie sind – um mich herum. In meinen Gedanken. Ich will sie fangen. Aber sie sind viel zu schnell.“
Ich bohre meinen Stock in den Sand vom Sandkasten, an dessen anderem Ende mein älterer Bruder auf dem Holzrand hockt und auf einem Zweig herum kaut.
Ich will eine kleine Sandburg bauen.
Später.
Aus unserem geräumigen Sandkasten klettere ich zu Mama, die auf Onkel Harrys Schoß auf der Schaukel sitzt.
„Fängst du mir einen?“, frage ich Mama und sehe ihr fest in die Augen.
Mama lacht.
Sie lässt die Hand ihres Freundes los.
Erhebt sich von der Schaukel.
Tanzt um mich herum.
Mit ihrem langen weißen Kleid.
Sie fängt Löcher in die Luft.
Klatscht dabei rhythmisch in die Hände.
Heute, in diesem Augenblick, ist sie gut aufgelegt.
„Komm, wir fangen Schmetterlinge,“ singt sie.
Du kannst sie nicht fangen. Sie sind hier drin, in meinem Geist.
In meinem Kopf.
Einen Augenblick betrachte ich sie hart und abwertend.
Aus meinem Antlitz ist alle Liebe gewichen.
Gewalt spiegelt sich in meinem Blick.
Meine Augen reflektieren die Kälte ihres Herzens.
Dann ermahne ich mich, sie lieb zu haben, wie sie ist und ihr Spiel mit zu spielen.
Sie will nur freundlich sein, denke ich und gebe mir einen Ruck.
Ich lache und hüpfe hinter ihr her.
In meine Hände klatschend.
Für diesen Moment habe ich die Schlacht gewonnen:
Ich habe das Herz meiner Mutter erobert!
Kapitel 2 | Der Auftrag
Sommer 1903.
In einem Internat in Franken.
Gelangweilt schnitze ich an der Holzkante meines Pultes, während Lehrer Grünrath schwärmerisch über die Karolinger parliert.
Eine hübsche Krone habe ich ins Tischlein geritzt.
Ich betrachte sie lange und ausgiebig.
Sie gefällt mir.
„Hermann!“
Die Stimme des Lehrers donnert durch den Klassenraum.
In Gedanken versunken habe ich gar nicht bemerkt, dass die anderen Jungen schon eine Weile zu mir herüber starren.
Schnell falte ich geschickt mit einer Hand, mit meiner rechten Hand, mein kleines Messer zusammen, trete aus der Bank heraus, stelle mich daneben auf und nehme Haltung an. Bin den Ablauf schon gewohnt. Dies ist nicht meine erste
„Höhere Lehranstalt“. Aus zwei Gymnasien bin ich schon ’rausgeflogen.
Andauernd lege ich großen Wert darauf, schnell zu reagieren, mich aufmerksam zu verhalten, nur wohl nicht immer dann, wenn es die Erwachsenen wünschen.
Meine Kameraden der Sexta sind oft so träge, da ist selbst ein Alpengletscher schneller.
„Jawohl, Herr Lehrer Grünrath!“, entgegne ich mit sicherer, lauter Stimme und bohre meinen festen Blick in des Lehrers sentimentale Augen.
„Hast du da ein Messer, Hermann?“
Erst antworte ich nicht.
„Nun?“
Grünrath versucht, drohend drein zu schauen.
„Und wenn es so wäre?“, kontere ich, senke leicht den Kopf und grinse ihn verschlagen an.
„Komm nach vorne!“
An der Fensterseite in der siebten Reihe sitze ich in der Bank außen, nicht im Gang.
Ich balle meine rechte Faust um mein Taschenmesser.
Mein Patenonkel hat es mir geschenkt. Wahrscheinlich, um sich meine Gunst zu kaufen.
Immerhin ist er der Freund meiner Mutter.
Auf meinem Weg nach vorne zum Podest des Lehrers komme ich an meinem Mitschüler Anton vorbei, der ein paar Reihen vor mir sitzt.
Er streckt den linken Fuß heraus und will mir ein Bein stellen, dass ich falle.
Aber instinktiv – eine Bewegung seines Oberkörpers – habe ich gewusst, dass er dies tun wird.
Ich kenne ihn und bin vorsichtig.
Aufmerksam schaue ich auf seinen vor mir hin gestreckten Fuß.
Plötzlich sehe ich viele nackte Füße.
Ich muss blinzeln, mir wird schwindelig und ich merke, wie die Panik, die Angst sich meiner bemächtigen will, doch ich ringe sie mit aller Macht nieder. Dafür muss ich mich an etwas festhalten.
Die Füße sind hager, leblos, liegen wie tot da an Bergen von Körpern.
Ich sehe meine Füße. Sie werden ein Teil von dem Bild. Mein Körper liegt nackt zwischen den Massen von Körpern. Dürr. Leblos. Weiß. Kalt. Erstarrt.
Ich merke, wie mein Herz einen Krampf bekommt und mir der Atem stockt.
Schnell zwinge ich mich, heftig einzuatmen.
Schwer nach Luft ringend suche ich den Blick von Anton.
Mit hart geballten Fäusten halte ich mich fest an seinem Blick.
Dieser gibt mir Kraft in meiner Verzweiflung und weil ich nicht verstehe, warum ich plötzlich lauter Leichen, nackte dürre Körper in der Todesstarre, lauter Füße sehe, gebe ich Anton die Schuld daran.
Ich trete ihn brutal von oben gegen sein Schienbein, dass sofort Tränen in seine Augen steigen.
Mein strafender Blick haftet unerbittlich an den zitternden Fenstern seiner Seele.
Ich warte, bis Anton sein Bein einzieht und gehe anschließend gerade aufgerichtet bis vor den Lehrer.
Als der etwas sagen will, strecke ich meinen rechten Arm aus.
In meiner Faust ist immer noch mein Messer, das zwar ziemlich breit aber so klein ist, dass es komplett in meiner Hand verschwindet.
Ich deute mit nach vorn gestrecktem Zeigefinder auf das Bild, welches der Herr Lehrer Grünrath für den heutigen Tag am Kartenständer aufgehängt hat, hole einmal tief Luft und beginne zu sprechen:
„Albrecht Dürer hatte keine rechte Ahnung von Karl dem Großen, denn selbst als Kaiser besaß Karl keinen Reichsapfel. Auch der Mantel stimmt nicht. Dürer hat Karl den Großen hier offensichtlich in seine eigene Zeit übertragen. Dies ist bei der bildlichen Darstellung historischer Anlässe und Persönlichkeiten oft als Stilmittel geschehen, beweist jedoch auch die Unkenntnis des Albrecht Dürer über das frühe Mittelalter.“
Nun nehme ich meine rechte Hand runter, lege sie vor meinen Bauch, die Linke darüber
„Der Künstler hat das Bild hier in Nürnberg gemalt, um 1513, glaube ich. Auch die Stadtgründung Nürnbergs erfolgte sicher nach dem Tod Karls des Großen,“ fahre ich mit meinem Vortrag fort.
Er ist ein Ablenkungsmanöver.
„Wenn wir dieses Bild betrachten, kann es uns keinen realistischen Eindruck des dargestellten Herrschers vermitteln,“ erkläre ich unter innerer Hochspannung, jedoch so weit ich mich in der Gewalt zu haben vermag, mit ruhiger, klarer Stimme.
„Außerdem,“ setze ich meine Rede fort, „wurde Karl der Große nicht in Aachen, wie Sie sagten, sondern in Alt – Sankt Peter in Rom zum Kaiser gekrönt. Die heutige Sankt – Peters – Kirche in der heiligen Stadt wurde etwa zur Zeit Martin Luthers erbaut.
Karl wurde im Jahr 800 in Alt – Sankt Peter von Papst Leo dem Dritten erst gesalbt und dann gesegnet, und zwar so – “ Schnell stecke ich mein Messer in meine Hosentasche und lege mich lang ausgestreckt mit nach rechts und links gerade ausgebreiteten Armen, meine Handflächen flach mit geschlossenen Fingern gerade auf den Boden, Beine und Füße geschlossen und eben hingestreckt.
Ich schließe meine Augen.
Plötzlich erinnere ich mich an Mutters Photographie – Alben von Vaters Arbeit in Haiti, die sie mir letztes Jahr an Weihnachten zeigte.
Und an die Daguerrotypien von einer Reise durch Indien.
Dort sah ich Männer mit Punkten auf der Stirn, bei denen ich immer an Pupillen denken musste.
Sie hatten seltsame Augen. Die „Pupille“ in der Mitte wirkte auf mich wie ein „drittes Auge“.
Ruhig und tief atmend trinke ich mit dem Punkt zwischen meinen Augen auf meiner Stirn die Kühle des Steinbodens.
Ich küsse ihn.
Niemand kann es sehen.
Bevor mein Lehrer seine Fassung wieder gewinnt und mich ansprechen kann, erhebe ich mich zügig, stelle mich wieder in korrekter Haltung vor ihn hin.
„Ich hatte mich mit meinem Kopf zu Ihnen hin ausgerichtet. Die Himmelsrichtung stimmt nicht. Richtig ist nach Osten,“ bemerke ich ruhig.
„Albrecht Dürer wurde im Mai 1471 in Nürnberg geboren und starb auch dort im April 1528,“ beende ich meinen Vortrag.
Drohend betrachte ich Lehrer Grünrath und schließe meine Rede in schneidendem, verachtenden Tonfall mit den Worten:
„Mein Patenonkel, der Arzt ist und manchen der Jungen in meiner Klasse hier schon geheilt hat, hat eine Kopie dieses Werkes im Hauptsaal seiner Burg hängen. Ich hasse es, denn es ist falsch. Karl der Große, König der Franken, kannte keine Reichsinsignien, wie wir sie heute kennen,“ ruhig atme ich ein und dann betont langsam aus und setze hinzu, indem ich meinem Lehrer herausfordernd in die Augen sehe:
„Wollen Sie mir vorwerfen, ich hätte Ihnen nicht zugehört?“
Im Klassenraum ist es still.
Der Lehrer Grünrath schaut vom Tafelbild zu mir hin und her.
Sein Atem geht hastig.
Ich hebe mein Kinn, prüfe kurz seinen Blick und schreite ohne Worte wieder zurück auf meinen Platz.
Eine Woche später lässt mich Vater zu sich zitieren und stellt mich zur Rede.
Extra um mich zu sprechen ist er zu meinem Onkel gefahren, wo ich mit Mutter wohne.
Ich kenne das schon.
Muss erst etwas verbocken, um Vater mal sehen zu können. Sonst kommt er nicht hier her.
Nicht einmal, um seinen alten Freund Harry zu besuchen.
„Hermann. Ich habe vom Direktor deines Internats ein Schreiben erhalten, nach dem du dich vor dem Lehrer Grünrath lang auf den Boden gelegt hättest. Ist das richtig?“
Ich nehme Haltung an und sehe meinem Vater in die Augen.
Sehr beschäftigt wirkt er. Müde. Abwesend mit seinen Gedanken. Obwohl ich direkt vor ihm stehe, ist er immer noch nicht ganz bei mir.
Ich hingegen konzentriere mich total auf ihn.
„Jawohl, Herr Vater, das ist richtig,“ antworte ich.
Nicht einmal ein „Na, Hermann, wie geht es dir?“ hat er rausgerückt.
Er kommt direkt zur Sache. Wie immer.
Die Weihnachtstage sind eben vorbei. Oder Ostern. An den Festen treffen wir uns. Auch an den jüdischen Festen. Da sind alle beisammen und Vater ist nett.
Aber reserviert.
Ich frage mich, warum erwachsene Menschen eigentlich Kinder in die Welt setzen, wenn sie sich dann doch nicht für sie interessieren. Manchmal denke ich, ich leiste hier auf der Erde ab, was ich abzuleisten habe und dann gehe ich wieder.
Was hält mich hier? Im Grunde nichts.
„Warum machst du so etwas?“
„Wir sprachen über die Königssalbung Karls des Großen 768 in Noyon zum König der Franken,“ rette ich meinem Lehrer in den Augen meines Vaters die Ehre, denn Herr Grünrath hat behauptet, Karl sei in Aachen zum König gesalbt worden.
„Ich habe Herrn Lehrer Grünrath gezeigt, wie das geht!“
Ruhig und gefasst schaue ich meinen Vater weiter lächelnd an.
Ich bin einfach froh, dass er jetzt da ist.
Dabei wundere ich mich, dass Vater nichts von Anton erwähnt.
Ganz klar habe ich damit gerechnet, von der Schule verwiesen zu werden.
Was würde das schon ausmachen?
Hier auf der Burg habe ich Bücher zu lesen, von denen sicher unsere Oberprimaner nichts wissen. Friedrich Nietzsche finde ich spannend.
Besonders fasziniert mich sein „Wille zur Macht“.
In Onkel Harrys Bibliothek kann ich mich weit ausgefeilter über wichtigere Themen bilden, als die Schulen es mit ihrem Unterricht vermögen, der außerdem ständig von Störungen unterbrochen wird.
Und wo es Lehrer gibt, die die jüngere Vergangenheit in der Geschichte oft verfälscht wiedergeben. Immer macht es mich wahnsinnig, wenn ein Lehrer eine Klasse dazu ermuntert, sich in Otto von Bismarck hinein zu versetzen.
Niemand, der nicht meinen Geist hat, der nicht meine Sorgen, Ängste und Seelenqualen kennt, vermag sich in meine Gefühle, Gemütsverfassung und Gedanken hinein zu versetzen!
Niemand!
Das ist zwar traurig, aber es ist die Wahrheit.
Im Geiste seh’ ich sie noch kämpfen bei Sedan.
Niemand auf der Welt weiß, dass Otto von Bismarck, dass er die Seele Karls des Großen ist, dass er Karl der Große war. Und Napoleon! Niemals waren in Wahrheit Deutschland und Frankreich Gegner! Niemals! Es wechseln nur Ansichten, Meinungen, Positionen, Menschen zu formen zu Nationen.
Weiterhin schmerzt es mich, ständig die Lobpreisungen General Blüchers ertragen zu müssen, wo er es doch war, an dem ich letztlich in meinem Leben als Napoleon gescheitert bin.
Insgeheim freue ich mich natürlich für ihn. Als alter Preuße, der ich bin.
Aber wer, außer mir, kann dies verstehen?
Aus Büchern und von meinen Ausflügen in die Gegend um die Burg, auf der ich hier zu Hause bin, solange Vater sich mit Onkel Harry gut versteht, weiß ich mehr vom Überleben in der freien Natur, vom Körperbau des Menschen, des Wildes.
Vom Segeln. Über Wappenkunde. Von den Ländern, Flüssen, Kontinenten.
Von Carl von Linné aus Schweden und der zoologischen Taxonomie, über die Geschichte der Waffen, der Feuerwaffen, der Geschichte und Aufstellung der Regimenter nicht nur Preußens, sondern der gesamten Welt.
Ich habe mit Onkel Harry unseren Monarchen besucht, da mein Onkel dessen Leibarzt ist.
Ich war in Berlin mit meinem Vater und habe gelernt, zu verstehen, dass Straßenbahnfahren gefährlich und Untergrundbahnfahren abenteuerlich ist und wie traurig das Leben der armen Leute ist, der Arbeiter und ihrer Kinder, die oft nichts als die Hinterhöfe im Schatten vieler hoher Häuser sehen, in denen sie elend mehr hausen, als dass sie darin leben.
Vom Bogenschießen weiß ich nicht nur aus Büchern, denn mein Onkel schenkte mir zum Geburtstag einen Bogen aus Eibenholz, den er von einem geheimen Baumeister hat bauen lassen, wie er sagt.
Axtkampf, Messerkampf und dessen Historie, Anfertigung von Klingenwaffen, Steinwaffen, dem Handwerk überhaupt, Hüttenbau aus Lehm, Holz, Wänden aus Weidenzweigen, von Dächern, die mit Gras oder Reet beziehungsweise Schilfrohr gedeckt sind, mit all solchen Sachen kenne ich mich ganz gut aus. Alles will ich wissen über die Welt. Gern zunächst einmal in der Theorie, aber lieber noch in der Praxis.
Ich will mal einen Riesenmarder sehen. Einen echten, lebendigen in seinem Jagdrevier. Mit ihm fühle ich mich seelenverwandt!
Ich warte darauf, die große Welt zu entdecken. Bis es so weit ist, lese ich hier von der Jagd, der Notfallversorgung bei Verletzungen, vom Herstellen einfachen Werkzeuges, vom Bauen eines sicheren Unterstandes in der freien Natur bei Hitze, Eis und im Regen. Vom Feuermachen im Freien ohne vorgefertigte Hilfsmittel.
Ich glaube, ich habe mir selbst bisher mehr Wissen und Kenntnisse beigebracht, als die Schule es vermochte.
Zunächst blickt mein Vater irritiert über meine Aussage, dann lächelt er zurück.
„Komm, setz’ dich zu mir,“ sagt er, steht vor dem Ofen.
Ich setze mich auf die breite Ofenbank an den Kamin, der jetzt aus ist, weil Sommer ist.
„Weiter schreibt Grünrath, du hättest einen Jungen getreten.“
Also doch.
„Das habe ich schon abgebüßt. Ich hatte zwei Tage Arrest.“
„Was ist geschehen?“
„Mein Klassenkamerad Anton Schilling hat mir ein Bein gestellt, als ich zum Lehrer kommen sollte,“ antworte ich wahrheitsgemäß.
Doch dann lüge ich: „Da muss ich wohl drüber gefallen sein.“
„Der Direktor schlägt vor, dass Harry“ – so nennt Vater meinen Patenonkel, seinen langjährigen Freund Hermann, meinen Namensgeber – „sich Antons Bein ansieht. Anton hat ein großes Hämatom und eine offene Stelle am linken Schienbein und klagt über starke Schmerzen.“
Ich bekomme Angst.
Wenn Onkel Harry sich Antons Bein ansehen würde, stünde es schlecht um mich.
Als Arzt würde er sofort erkennen, dass es sich bei der Wunde nicht um ein zufälliges Stolpern als Ursache der Verletzung, sondern um gezielte Gewaltanwendung handelt.
Ich prüfe den Blick meines Vaters, stehe stramm vor ihm und erkläre mit fester Stimme:
„Mit Verlaub, Herr Vater!
Anton Schilling ist ein Feigling!
Ich möchte sagen, der größte Feigling des Internats!
Er ist nicht mutig!
Er ist kein Krieger!“
Mein Vater wirkt verwirrt. Auf dem Themenplatz des Krieges ist er unsicher. So kann ich ihn für diesen Moment von mir ablenken.
„Dann wollen wir mal hoffen, dass sein Bein heilt!“, sagt er und lächelt mir zu.
Ich lächele zurück und denke:
Durch Hoffnung hat noch keiner eine Schlacht gewonnen.
Hätte Bismarck auf die Einigung des Reiches ausschließlich gehofft, er müsste heut noch hoffen.
Statt dessen veränderte er mit einem einzigen Brief das Geschick ganzer Völker.
Ich werde mir Anton zu einem geeigneten Zeitpunkt einmal vorknöpfen müssen.
„Na komm mal auf meinen Schoß,“ sagt Vater dann.
So was! Ich bin zwar noch keine Elf aber dafür, wie ein kleines Kind bei meinem Vater auf dem Schoß zu sitzen, deutlich zu alt.
Dafür müsste er selbst sich auch erst setzen.
Darüber hinaus erinnert mich Vater immer stark an den schon alternden Bismarck. Äußerlich natürlich. Weniger Haare hat er. Ähnlich dick ist er aber.
In seinem Inneren muss er wohl ein Schwächling sein, spricht der Hochmut aus meinem Kinderherzen. Weil er nicht für Mutter kämpft.
Noch immer nicht wage ich das „Dankeschön“, auf welches auch der Vater des Napoleon, Carlo, bis heut’ vergeblich wartet.
Oder bedeutet Männerfreundschaft, alles untereinander aufzuteilen, auch die Liebe zu den Frauen?
Niemand hatte mir je das Strammstehen beigebracht.
Als Krieger, der ich bin, vermag ich nicht auf des Fürsten Schoß zu sitzen.
Was ich aber kann, ist vor ihm Haltung annehmen.
Tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich selbst die Seele dieses alten Reichskanzlers in meiner Brust trage.
Seine letzten knapp ein halbes Dutzend Lebensjahre waren meine ersten.
Beide fanden wir in dieser Zeit keine innere Ruhe.
In meinem Herzen war ich als „Otto von“ schon 1890 gestorben.
Denn, Niccoliò, du hast wohl vergessen, dass es des Fürsten Aufgabe ist, dem Volk zu dienen, denn er dient seinem König und dieser dient seinem Volk.
Er soll auch für die Arbeiter, für die Bauern und Unfreien da sein.
Das hatte ich offenbar auch schon vor dem 20. März des besagten Jahres vergessen. Aber ist es nicht genial, dass ich bereits als Napoleon das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen positiv beeinflusste?
Und irgend etwas in mir, meine Grausamkeit tief in meinem Herzen beginnt sich zu regen, erkennt die Weiten meiner Seele und den Grund meines Schmerzes, den ich als kleiner Bub schon spüre.
Vater, du hast Mutter mit dir genommen in den ersten Jahren meines Lebens.
Kein Land, kein Geschenk, kein Orden, keine Auszeichnung, kein Rang, kein Titel und sei er noch so ruhmreich, ja, würde er mich selbst über alle Völker der Welt erheben, nichts kann den Schmerz lindern, die Wunden heilen, die du in mein Herz geschlagen, als du mir Mutter fort nahmst.
Nie wage ich sonst diesen Gedanken zu denken.
Eine Schwäche muss sein, wo das Herz des Kämpfers an die Welt sich bindet.
Keinen Marmor, keine Mauern, keine Mutter darf meine Seele besitzen, denn ich bin frei, bin überall zu Hause, in der Natur, dem Wald, dem weiten, wilden Hain.
Doch gerade Mutter ist’s, die ich vermisse, die ich ersehnte, Jahre lang.
Ich hielt mich aufrecht, bewahrte meine Fassung.
Aber ach wie lange noch, wie lang vermag ich dies, bin doch nur ein Knabe.
Ein Bärschla mit hehren Zielen.
Ein kleiner Knabe, der sich schon viel einbildet. Aufmandeln geht immer!
Halt letztlich nur ein Knabe.
Mit einem weichen Herzen, das sich nach Liebe sehnt.
Nach Nähe, der Nähe meiner Eltern.
Und wo mein Vater da so lächelnd vor mir steht, da will ich ihn umarmen, mit meinem ganzen Wesen.
Doch ich halte mich zurück.
„Bitte, du zuerst,“ sage ich freundlich zu meinem Papa und deute auf die Ofenbank.
Er grinst mich an, hebt die Augenbrauen. Nimmt Platz.
Und ich – ich setze mich auf seinen Schoß.
Er kann ja gar nicht Bismarck sein, wenn ich es bin.
Und auch Otto war einst ein Knabe, so wie ich jetzt.
Ich bin selig.
In diesem Moment könnte Vater mich bitten, mir befehlen, mir verbieten, ihm gehört mein Herz und ich würde alles für ihn tun, was er verlangt.
Was soll’s – ich liebe meinen Vater mit meinem ganzen Herzen.
Ich verzeihe alle Fehler Dir auf einen Schlag. Besser jetzt als nie.
Schnell geht eine Lebenszeit vorbei.
Ein alter Kämpfer Japans sang mal ein vergessenes Lied, dass des Menschen Leben fünfzig Jahre daure.
Glück hat, wer so lange lebt.
Vater hat die Fünfzig längst überschritten.
Der Reichseiniger Japans, von dem ich viel gelesen in Onkels Bibliothek, der wurde 48.
Vielleicht werde ich dann ja 52!
Fünfzig Lebensjahre im Durchschnitt für jeden von uns!
Ich lache und denke, dass ich schon groß bin.
Schließlich fehlt mir nur etwas mehr als ein Jahr, dann bin ich wie Karl der Große mit 12 Jahren praktisch erwachsen.
Wann andere Menschen meinen, dass ich ihrer Meinung nach volljährig sei, kümmert mich nicht.
Was scheren mich deren Gesetze?
Leute waren ja nicht mal in der Lage, mich mehrere Jahre an ihrer Seite auszuhalten.
Leute wie meine Mutter.
Und mein Vater.
Wenn ich ehrlich bin, hat es mein Patenonkel am längsten mit mir ausgehalten.
Er hat mich auch entbunden, sagt Mama.
Aber er hat mir Mama weggenommen.
Ich möchte gern dieses ihm vergeben.
Ich weiß noch nicht, wie.
Vielleicht klappt es irgendwann, doch heute fühl’ ich: Das verzeihe ich ihm nie.
Innerlich bin ich zerrissen zwischen den Welten.
Zwischen den Menschen.
Wie kann ich meine Verzweiflung heilen?
Allein dadurch, dass ich einen Gegner habe, kann ich mich als Kämpfer und als Krieger definier’n.
Kann aufrecht gehen.
Kann gerade stehen.
Und er, mein lieber Onkel Harry, soll mein Gegner sein.
Er hat das Format dazu.
Er allein ist reich und hat Einfluss.
Ich kenne persönlich keinen mächtigeren Mann auf der Welt.
Er gibt mir Essen, Nahrung, Kleidung, gab mir mein Leben.
Meine Eisenbahn, meine Soldaten, Kostüme, Uniformen, Degen.
Ja, er ist wahrlich ehrenwert und achtenswert.
Wie Achilles einst die am meisten liebte, gegen die er am erbittertsten kämpfte:
Du bist wie Hektor. Nur Du, Onkel, bist würdig, mein Gegner zu sein.
Krieg und Kampf, das sind mein Leben.
Macht ist mein Weg.
Suchen, forschen, töten, stets umher getrieben auf der Suche nach der nächsten Jagd.
Nur die Unruhe, Rastlosigkeit und niemals Reue sind’s, die in der Welt mich umtreiben, mich antreiben, mich am Leben halten, mich am Laufen halten, mich am Lieben halten.
Mein Leben gleicht einem Gefecht.
Kampf ist es, für den ich atme, was soll sonst im Leben sein?
Was ist denn sonst ein Leben?
Leer wären meine Taten, meine Arme, meine Augen, müde, matt und ohne Glanz.
Nichts bewegte meine Seele,
Nichts motivierte meine Liebe.
Nichts gäbe mir Stärke.
Wie kann im Nichts ich leben?
Panik bekomm’ ich und es graut mir bei der Vorstellung des Ostens, wie es in Onkels neuem Meyerschen Konversationslexikon heißt – das Nirwahn – furchtbar – nicht brennen – was soll mein Leben sein, wenn ich nicht brenne,
wenn ich nicht sehne, strebe, kämpfe, renne,
wenn ich nicht hoffe, neide,
siege und erleide?
Niederlage, Kampf und Krieg,
sind’s doch, die mein Leben prägen,
sind’s, die meine Hoffnung nähren,
was ist der Mensch denn ohne Hoffnung, ohne Sieg?
Wie kann das sein, dass es ein Leben ohne Hoffnung gäbe, ohne mich zu entzünden, zu verzehren für die Liebe und die Siege, ich mag es mir nicht vor zu stell’n, das Nirwahn.
Ein Alptraum ist’s, die Hölle, der ich jetzt nur kann entflieh’n, wenn ich mich konzentriere auf etwas starkes, auf eine Bewegung – ja, ich hab’s!
Es ist der Atem meines Vaters, wie er durch seinen Schnurrbart streicht.
Und jedes mal, bei jedem neuen Atemzug, da bewegt ganz leicht ein Härchen sich.
Das ist mir genug.
Daran vermag ich meinen Geist zu halten,
bevor er nieder fällt tief in des Abgrunds,
des Nirwahns ew’ge Spalten.
So hab’ die Angst ich nun besiegt.
Für dieses mal.
Was wäre ich ohne meine Gegner!
Vater kann ich lieben.
In diesem Moment.
Doch Onkel Harry – Er ist sehr wichtig für mich!
Er ist der gegnerische König auf dem Schachbrett!
Ohne ihn kein Sieg!
Ohne ihn kein Krieg!
Ohne ihn kein Spiel!
Ohne ihn kein Leben!
Ohne ihn kein Wagnis!
Ohne ihn kein Bangen!
Ohne ihn kein Hoffen!
Ohne ihn kein Ruhm!
Ohne ihn kein Sinn!
Wir sind wie zwei Seiten einer Münze.
Ich greife in meine rechte Hosentasche.
Dort ist mein kleines Taschenmesser.
Bewusst lege ich es auf den Kaminsims.
Und es ist noch etwas in meiner Tasche.
Ein Fünf Mark – Stück.
Ich nehme es in meine Hände und betrachte es mit meiner ganzen Aufmerksamkeit.
Das Antlitz unseres Königs Otto von Bayern auf der einen Seite.
Wie mag sich der König fühlen, dem einerseits das Königtum in die Wiege gelegt ist, der andererseits, wie man im Volke sagt, so weit ich weiß, seit seiner Jugend geisteskrank und daher regierungsunfähig ist. Ich wünsche ihm von Herzen, dass ihm die Gelegenheit, ein gesunder König zu sein, im vollen Besitz seiner Kräfte, zu einem anderen Zeitpunkt vom Schicksal erneut gegeben werden wird!
Der Deutsche Reichsadler auf der anderen Seite.
Ein mächtiger Adler.
Der mächtigste Adler der Welt – ein Vogel mit Schopf auf dem Kopf, gleich einer Krone – dies ist mein Seelenvogel, er drückt die Kraft, die Hoheit und die Macht meiner Innenwelt aus.
Er ist eine heilige Kraft, die mit noch drei anderen die Verbindung zum Allerhöchsten schafft. Ich sah sie einst in einem Traum.
Achtsam spüre ich die Münze in meinen Händen.
Sie ist kühl, doch nun erwärmt sie sich langsam durch meine Körpertemperatur.
Fein, schmal und ganz, ganz fest ist dieses Stück Metall.
Würde man versuchen, die Vorderseite von der Rückseite zu lösen – oder umgekehrt, so wär’ es doch kein Geldstück mehr.
So gehören auch die erbittertsten Gegner zusammen!
Wie zwei Seiten einer Medaille sind sie!
Eine diebische, beinahe räuberische Freude, aber auch eine aufgeregte Anspannung empfinde ich bei dem Gedanken, den Anton Schilling zur Rechenschaft zu ziehen, wie er darauf käme, mich zu verpetzen!
Was wäre ich ohne Anton Schilling?
Durch seine Streiche spüre ich meine Kraft!
Zwei Seiten einer Münze!
Anton und ich wie zwei Vögel hoch in der Luft im Kampfe!
Mit ihren Klauen eng ineinander verhakt, sich so im Fluge haltend.
Die Krallen ineinander gekrallt!
Schließlich war er es, der mir ein Bein gestellt hat!
Plötzlich spielen meine Gedanken Karussell und ich werde traurig, denn ich erinnere mich an ein Lied, dass ich bei Mutter Graf im Alter von drei Jahren gelernt hatte:
„O Jesu,
all mein Leben bist du,
ohne dich nur Tod.
Meine Nahrung bist du,
ohne dich nur Not.
Meine Freude bist du,
ohne dich nur Leid.
Meine Ruhe bist du,
ohne dich nur Streit.
O Jesu.“
Mutter Graf war meine Pflegemutter.
Das Lied hatte sie abends mit mir gesungen, wenn sie mich zu Bett brachte.
Die Grafs waren Christen.
Viel Christliches habe ich von ihnen gelernt, auch aus Pustets Gebetsbuch.
Immer ärgerte es mich, wenn meine Ziehmutter mich an den Sonntagen, wenn’s gleich zur Kirche ging, aus meinen Träumen riss, mich anzog.
Ich wollte weiterspielen.
Und ich musste doch meinen hell blauen Schlafanzug anbehalten.
Ich war einer der Engel, die das Heil der Welt verkünden.
Ein hellblauer Engel.
Der Schlafanzug war mein himmlisches Gewand.
In meinem Spiel.
Ich bereitete die Welt auf das Himmelreich vor, das Reich Gottes.
Das Paradies auf Erden, das da kommen wird und Wohnung nimmt in den Herzen der Menschen.
Dies ist der Ort des Paradieses und des Weltenheils.
Kein Platz auf der Erde, so wie wir es kennen.
Fürth oder Ansbach.
München oder Nürnberg.
Nein.
So ein Ort ist nicht gemeint.
Hier kommt mein Königreich.
Es ist in meinem Herzen.
Ich verkünde die Erlösung der Menschheit und den Weltfrieden.
Das Reich Gottes.
Es ist in unseren Herzen.
In den Herzen der Menschen.
In den Herzen der Menschheit.
Nur dort ist es zu finden.
Immer war es Mutter Graf, die mich aus diesem himmlischen Zustand der tiefen Konzentration, der tiefen Meditation riss, jeden Sonntag Abend, als wolle sie mir sagen:
Hör auf, dein Paradies nur zu träumen, trage es in die Welt hinaus!
Doch zunächst will ich bleiben. Lasse mir Zeit. Handle mit Bedacht.
In meinem kindlichen Spiel.
Von Außen, für meine Mutter Hille Graf, mag es so ausgesehen haben, als säße da nur ein kleiner Junge auf dem Boden, der sich langweilt, weil er nichts tut.
Anscheinend.
Er sitzt auch noch im Weg.
Mitten auf dem Boden im schmalen Flur, wo der Vater durch will und die anderen Kinder, die mich manchmal anschimpfen, wenn sie über mich stolpern, auch die Mutter.
Der kleine Störenfried sitzt da gelassen herum, im Sonnenlicht.
Er berührt mit seinen Babyspeck – Fingern den Holzboden im Flur der gemütlichen und viel zu voll gestellten, winzigen Wohnung, in der wir damals lebten.
Ich ertaste mit meinen zarten Händen die Sonnenstrahlen, die vom Wohnzimmerfenster aus morgens und wieder abends, wenn sie vom gegenüber liegenden Haus von einer Fensterscheibe zurück reflektiert werden, dort auf den Boden fallen.
Da auf dem Holz am Boden, da ist so eine kleine Nuss, ein Aststück, welches aus dem Parkett sich etwas hervor wölbt, woran ich immer mit den Strümpfen hängen bleibe.
Was ich dann bewusst spüre, wenn ich manchmal barfuß durch unsere kleine Wohnung laufe.
Hab mich dran gestoßen.
Hab mich geärgert, bin in heftigen Zorn geraten.
Stein des Anstoßes, der ich bin.
Eckstein.
Meine Herbstlaub – Gedankenfetzen spielen in meinem Geistessturm.
Jesus. Sonne. Sonnenbilder.
Unser Heim, die Wände voller kleiner Rahmen mit Augenblicken darin.
Außen still mit herrlich aufgewühltem Herzen schlendere ich durch die Zimmer.
Kammern meines Herzens. Herzkammern. Ich bekomme Zorn, Herzkammerflimmern. Betrachte die Familienbilder. Erna. Fanny. Meine Stiefschwestern. Nie habe ich versucht, sie in mein Herz zu schließen. Oft hasse ich alles hier. Will Mutter zurück. Fanny heißt ja auch Mama!
Ahnenbilder hatten wir und lauter kleine Schränke.
Mit handgeklöppelten Deckchen, auf denen das gute Porzellan stand.
Mit handgehäkelten Gardinchen vor manchen Fensterchen in den schönen Schränkchen, wo die Bücher stehen, über deren abgegriffene Rücken mein Blick so oft geglitten.
Im Möbelstück beschützt, damit das Licht sie nicht zerfrisst.
Sagt Mutter Graf.
Und Vater drängelt sie und sagt:
„Hille, Mausi, komm, es ist schon Vier. Die Kinder stehen fertig an der Tür. Zieh den Jungen an und dann komm!“
Ich wehrte mich heftig.
Damals. Ich wollte bleiben.
In meinem Engel – Tagtraum, dem Traum vom Zentrum meines Herzchakras.
In der Sonne mit meinen Händchen auf den hölzernen Dielen am Boden.
Viele Tagträume habe ich. Immer.
Von meiner Innenwelt, meinen leuchtenden Lichträdern.
Aber die Menschen können mich nicht verstehen.
Sie schütteln nur den Kopf und runzeln die Stirn, wenn ich ihnen davon erzähle.
Also habe ich es aufgegeben.
Sie rufen: „Sei artig!“ und gemahnen mich an meine Pflichten.
Sie sind selbst voller Pflichten und kriegen dann so eine steile Falte zwischen den Augenbrauen.
Wenn ich mich in sie hinein versetze, kann ich sie verstehn.
Es ist das Preußentum, das pflichtbewusste, das in ihrem Geist und ihren Herzen sitzt.
Auch, wenn wir hier in Bayern sind.
Ich kann ihnen keine Vorwürfe machen, dass sie so voll davon sind.
Der Bäcker Heinrich an der Straßenecke.
Der alte Herr Biernoth im Zeitungsladen am Ende der Allee.
Maria, unsere Nachbarin.
Stolz müsste ich eigentlich auf sie alle sein, wenn sie mich in meinen geistigen Reisen mitten in die himmlische Freude nicht verstehn, mich nur ermahnen, rügen und von dannen gehn.
War ich es doch, als Ministerpräsident Preußens, der sie führte und an die Pflicht gemahnte, sie in ihrem Herzen rührte.
Wenn Preußen untergeht, dann will ich mit ihm gehen.
Ich will bis zum Tod ihm recht zur Seite stehn.
Der letzte will ich sein, der als Ministerpräsident der Preußen geht und aufrecht dann vor Gottes Antlitz steht.
Gottes Antlitz, oft hab ich dich geschaut.
Allumfangende Liebe, wie bist du mir vertraut!
Ach Mutter Graf, würdest du mich noch einmal zum Kirchgang streng ermahnen!
Als ich klein war, hab ich es gehasst, aus meiner Versunkenheit, in der ich saß, zu gehen.
Ach, würdest heut ein einzigs mal an meiner Seit du stehn!
Heute vermiss’ ich sie, die aufgebrachten Zeiten, die Hektik um die Kirche, dass wir dort eintrafen, immer, wenn die Lieder schon erklangen.
Das ich meinen inneren Frieden nur hier herein gebracht hätt um ihn mit den Menschen in der Kirch zu teilen!
Es wäre so einfach gewesen!
Warum habe ich es damals nur nicht verstanden?
Heute vermisse ich die Lieder.
„Es ist ein Ros entsprungen“.
Feierlich.
„Tochter Zion“.
Königlich.
„Tantum Ergo“ – ich erinner’ mich.
Doch am liebsten „Stille Nacht“, wie hab ich oft meine Tränen verschämt versteckt vor den Leuten in der Heiligen Nacht.
Heute sehne ich mich danach, aus dem Spiel geholt zu werden, angezogen zu werden, diese Aufgewühltheit, Aufbruchstimmung, ermahnt zu werden – oh wie gern würd ich noch mal Mutter Grafs Stimme hörn.
Was gäb’ ich, könnt’ ich wieder mit ihnen Lieder singen.
In der Kirche.
Feierlich.
Weihnachtslieder!
Für mich war immer Weihnachten, als ich klein war, denn Christus war immer da, war in meinem Herzen.
Ich hätte mich auf die Kirche freuen sollen und mich nicht wehren sollen, da hin zu gehen, denn die Heilige Messe ist eine Fortführung meiner tiefen Visionen in meinem Inneren gemeinsam mit anderen Menschen in der Kirche und beim Singen. Ich muss vielleicht gar kein Geheimnis mehr aus meiner Innenwelt machen.
Bald!
Ich habe mich davor gefürchtet, Jesus nicht in den Augen der Menschen dort zu erblicken!
Ihre Augen schienen mir stumm, stumpf, abgestumpft.
Und so klangen ihre Lieder.
Abgestumpft ihre Gebete.
Es war nichts Heiliges darin.
Oft nuschelte sogar der Pfarrer vor sich hin.
Davor hatte ich Angst.
Wo ist Jesus in den Herzen der Menschen?
Ist er denn nur in meinem Herzen?
Ich gehe in die Stille.
Ich habe innere Ruhe.
Ich bin in meinem Inneren Frieden.
Menschen, findet Frieden im Herzen!
Wo ist der Frieden in den Herzen der Menschen?
Wo ist die Liebe in den Herzen der Menschen?
Wo ist Jesus, mein Sohn, in den Herzen der Menschen?
Jesus, mein Sohn.
Jesus, Du Sohn Davids.
Wo ist die Liebe in ihren Herzen?
Wo ist die Liebe in ihren Augen?
Ich habe als Kind Angst gehabt vor Menschen ohne Liebe in den Augen, wenn sie in der Kirch ihre Lieder sangen, deshalb bin ich nicht mehr gern hingegangen.
Ich hatte Angst vor den Menschen!
Weil ich erkannt hab, weil ich erblickt hab, dass die Menschen ohne Liebe sind.
Das war’s! Dies ist der Grund, warum ich schon als kleiner Junge Angst vor der Kirche hatte und nicht hin wollte: Ich sah, dass es nicht gut war, was ich als Karl der Große pflanzte, denn es war mehr Zorn als Liebe in meinem Vermächtnis!
Heute singen sie zwar die Lieder der Kirche – aber wo ist die Liebe, wo ist die Botschaft darin, wo ihr Vertrauen?
Was bedeutet die Frohe Botschaft, Leute, berührt sie euch?
Froh – wo bleibt die Freude in den Herzen und den Augen der Menschen?
Die Freude in den Herzen, Liebe in den Augen der Leute, danach sehn’ ich mich.
Das habe ich schon mit drei Jahren erahnt.
Und dann hatte ich Angst.
Angst vor meiner Mutter.
Vor der Kälte in ihrem Herzen.
Vor ihrem gezwungenen Lächeln zu mir, wenn sie die Welt umarmt und mich verstößt.
Wenn sie Onkel Harry umarmt und mich dabei vergisst.
Mutter, ich will um dich kämpfen.
Um Deine Liebe.
Hatschepsut.
Du tatest mir weh.
Nahmst mir die Krone erst.
Anschließend verbannte ich dein Andenken aus dem Weltgedächtnis für Dreitausendfünfhundert Jahre!
Stets fand ich nur Befriedigung im Üben von Vergeltung.
Oft heftiger als mein ursprüngliches Leid.
Das beruhigte mich.
Für einen kurzen Moment.
Durch das Betrachten vieler meiner gelebter Leben wird mir diese meine Art, mein tiefster Wesenszug, der Rachdurst, wohl bewusst.
Durch die Vergangenheit lerne ich, mich zu erkennen.
Es ist gut, zu wissen, wie ich bin.
Wie ich war.
Bisher.
In meiner ungezähmten, gewaltigen Wut.
Meinem Heiligen Zorn, den ich auch als Luther und Achilles besaß.
Aber das ist nun vorbei, jetzt hab’ ich Vertrauen in die Welt und Mut!
Ich will an den Feiertagen singen! Weihnachten. Ostern. Stehend aus dem Kaddisch für die Toten rezitieren. Ich wünsche es mir so sehr!
Vater und Mutter gehen selten mit Onkel Harry und den Mädchen in die Kirche oder in die Synagoge, und wenn sie es wieder tun, dann will ich mit!
An die Stimme des Vorbeters im Haus der Versammlung denke ich noch oft, an Yom Kippur in der neuen Synagoge Adass Jisroel letztes Jahr am elften Oktober auf der Essenweinstraße 7 in Nürnberg. Denn ich bin Asasel.
Keiner singt mehr mit mir Weihnachtslieder, keiner singt aus dem Kaddisch.
Auch jetzt muss ich weinen.
Aber ich schäme mich nicht mehr dafür!
Meine Freude bist du,
ohne dich nur Leid.
Meine Ruhe bist du,
ohne dich nur Streit.
O Jesu.
Dieses Lied, ohne Jesus keinen Sinn zu haben – ist das nicht das gleiche, wie meine Gedanken, ohne Gegner keinen Sinn zu haben?
Auch ich werde dem Jesus gleich bald eure Sünden tragen.
Dieses Sich hin geben an eine Person, an ein Volk, ist es nicht das Selbe?
Eure Sünden nehmen und die eurer geliebten Feinde als Asasel, als euer Sündenbock.
Meinen Liebsten mir zu töten, bevor es ein Anderer tut.
Meinen Liebsten mir zu nehmen, bevor es ein Anderer tut.
Meine Mutter mir zu nehmen, bevor es das Leben tut!
Ich werde als letzter von Bord gehen.
Mutter Graf, Hille Graf, Du warst einst meine Mutter!
Meine Ziehmutter.
Als meine leibliche Mutter, Franziska, mir den Rücken kehrte.
So oft.
Immer wieder.
Als sie mir den Eisdolch ihrer Gefühle mitten in mein Herz stieß.
Das Leben – Vater – Mutter – Ihr habt sie mir entrissen!
Ich will verzeihen.
Ich würde euch so gern begreifen!
Warum kann ich euch nicht verstehn?
Jedoch – ich kann euch vergeben. Schalom. Schalom Chaverim.
Es ist wohl das Grausamste auf der Welt, das einem Menschen widerfahren kann, wenn ihm als kleines Kind schon die Mutter genommen wird!
Ist dies ein Echo früherer Zeiten?
Wie vielen Gegner – Kindern, vie vielen Sachsenkindern habe ich einst als Karl der Große die Mutter genommen?
Da war ich unerbittlich grausam.
Und nun, da kommt die Grausamkeit zu mir!
Und der Herr sprach zu Abraham: töte mir einen Sohn.
Warum, Mama, kann ich dich nicht lieben, wenn du mir tönendes Erz bist und klingende Schelle, wenn du mit Engelszungen zu mir sprichst und mir all deine Habe gibst – und mich nicht liebst?
Ich bin ebenso eitel wie du.
An dir, meiner Lehrerin, will ich lernen, meinen Stolz zu besiegen.
Ich habe den Hektor geliebt.
Ich liebte Enkidu, der mir vom Todfeind zum Freund, zum Hort meines Herzens wurde.
Ich liebe dich, Solomon, mein Sohn.
Und Söhne, die ich liebte, gab es viele.
Jesus.
Jesus wird der Sohn Davids genannt.
Somit ist auch Jesus mein Sohn.
Als Karl, König der Franken, empfand ich es als meine größte Pflicht, ihm ein großes, befriedetes Reich zu Füßen zu legen und den Boden zu bereiten für seine Lehre.
Deutschen, Fränkischen, Französischen, Heiligen Boden.
Befrieden bedeutete damals Krieg führen.
Mein Todfeind Widukind wurde mein Freund.
Widukind ist die Widergeburt Salomons.
Absalom und Salomon.
Meine Söhne.
Salomon hat mich weit überstrahlt.
Mit Weisheit, Güte, Weitblick, Anmut, Herrlichkeit, Glanz, Größe und Macht.
Ihm erlaubte Gott, den Tempel zu bauen.
Nicht mir, dem David. Nein. Dem nicht.
Das war ein Schlag mitten in mein Herz.
Aber ich musste mich fügen.
Fügen der Weisung Gottes.
Meinen Neid niederkämpfen.
Meinen Zorn.
Da war er wieder, mein Zorn, bezogen auf die gleiche Seele.
Widukind – Salomon.
Ich liebe diese Seele.
Ich liebe Widukind.
Ich liebe Salomon.
Also füge ich mich und kämpfe meinen Zorn und meinen Neid nieder, ersetze beides durch Demut, Hochachtung und Liebe.
Ich vermisse Salomon und will ihn wieder sehen.
Ach, jetzt muss ich schon wieder weinen.
Weinen vor Sehnsucht nach einem Menschen, den ich so sehr liebe, einem guten Freund.
Es ist aber auch ein Weinen vor Freude!
Ich habe es geschafft, meine erbittertsten Feinde zu meinen liebsten Freunden zu machen durch meine Liebe!
Das macht mich glücklich!
Meine Aufgabe in diesem Leben ist, zu lernen, meine Feinde zu lieben!
So erkenne ich selbst in meiner tiefsten Not den Sinn eines Teiles meines Lebensweges.
In diesem Moment.
Vater räuspert sich und reißt mich somit aus meinen Tagträumen.
Auf einmal sehe ich zu ihm hoch.
Mittlerweise sitze ich gern auf seinem Schoß.
Ich hatte sogar schon mehrmals zu Haus – an dem Ort, den er im Augenblick zu Hause nennt – mit ihm Walzer getanzt, als ich bemerkte, wie viel ihm am Tanzen lag. All dies tue ich, um bei ihm zu sein.
Um mit ihm Zeit zu verbringen.
Die er von sich aus mit mir nicht teilen will.
Doch wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, so muss der Prophet eben zum Berg kommen.
Auf meine Frage „Tanzen – wie geht das eigentlich?“, gab er übermütig und fröhlich zurück: „Komm, Junge, ich zeig’ es dir!“, und streckte mir seine Hände hin.
Direkt in mein Herz hinein.
Darauf hatte ich es angelegt.
Ich tanzte recht oft mit ihm. Er legte seine Schellack – Platten auf.
Onkel Harry hatte ihm ein Grammophon geschenkt, welches einen feinen, weichen, klaren Ton abgab, besser, als sein eigenes, das nun in seinem Schlafzimmer steht.
Ich erinnere mich an Walzer von Strauss Vater und Sohn, von Tschaikowski, auf die mein Vater und auch Mutter mit mir tanzten.
Tschaikowski starb in dem Jahr meiner Geburt.
Und als ich acht oder neun war, sprachen wir darüber.
Mein Patenonkel liebte den Wiener Walzer, einen schnellen Tanz mit vielen Drehungen in engem Kontakt zum Partner, deshalb hatten wir davon auch viele Platten.
Anfangs fielen mir die Schritte schwer und Vater bewies viel Geduld, sie mir zu zeigen.
Als ich es einigermaßen verstanden hatte und umsetzen konnte, stellten wir diesen Tanz nach, allerdings blieben wir dabei auf Distanz, was dazu führte, dass die Drehungen nicht recht gelingen wollten.
Wir tanzten immer, wenn ich zwischen meinen vielen Aufenthalten bei verschiedenen Pflegefamilien mal bei Onkel Harry zu Hause sein durfte und auch Vater zufällig anwesend war.
Mama kam dann manchmal hinzu mit einem Glas Wein, gesellte sich zu uns, nahm Platz auf einem Sessel.
Ich tanzte so oft mit Vater, wie er wollte, nur, um in seiner Gegenwart sein zu dürfen.
Damals war ich sieben Jahre alt und verabscheute Dinge wie Tanzen zutiefst.
Lieber griff ich mir aus seinem Rapierschrank eine Waffe und focht damit gegen unsere Haselnusssträucher, gegen Rosenbüsche und Buchsbaumhecken.
Voss, unser Gärtner, schüttelte zwar den Kopf, sagte aber nichts. Vermutlich hatte er von Onkel Anweisung, mich in meinem wilden Spiel gewähren zu lassen.
Einmal kam er keuchend zu Onkel Harry, nahm seine Mütze ab, schwitzte, kratzte sich am Kopf, strich sich das Haar über der Stirn glatt, zog die Mütze wieder auf und beschwerte sich bei meinem Patenonkel, dass ich zwar noch klein sei, aber nichts als Krieg im Kopf hätte, bei meinen Spielen.
Onkel Harry hob die Augenbrauen, sah mich streng an, wollte jetzt von mir etwas hören, aber unser Gärtner Ferdinand Voss setzte noch hinterher: „Die ganze alte Tanne, die im letzten Sommer bei dem großen Gewitter der Blitz gespalten hat, da hat er die Axt ’rein geworfen und alles zerhauen!“
Das geschah öfter, noch vor ein paar Jahren.
Voss sah mich böse an.
„Ach so!“, entgegnete Onkel Harry und hob wieder die Augenbrauen, nun eher vor Erleichterung, wie es mir schien.
Ich erinnere mich noch gut an das große Gewitter im Sommer vor zwei Jahren, 1901.
Das war nicht das einzig turbulente in jenem Jahr. Es gab Saharastaub, heftiges Hochwasser und im Winter hatte es stark gefroren. Wotan schenkte mir sogar einen Orkan. Ich war voller Energie, „elektrisiert“, wie Mutter es nannte.
Erst war ich ein Wikinger, dann Sachse, dann natürlich Franke, ich zerlegte damals nicht nur eine Buchsbaumhecke, schlug nicht einfach auf eine alte Tanne ein.
Niemals würde ich Gewächse angreifen, Gräser achtlos behandeln, Bäume zerstören.
Pflanzen sind heilig, sie spenden und schützen das Leben.
Das hatte ich aus meinem Leben – aber vor allem nach meinem Leben als Karl der Große gelernt.
Im Feuer.
Ferner als ich selbst zu einem jungen Baume wurde, der früh gefällt sein Leben einem Schreiner schenkte.
Karl der Große liebte die Jagd und auch ich wünsche mir, einst jagen zu gehen, zur Jagd zu reiten, einfach zu jagen. All zu gern möchte ich die Beizjagd mit Greifvögeln erlernen!
Wichtig ist mir dabei aber, die Natur zu achten, das Jagdwild, die Beute sowie auch das Naturwild, alles Tier, ebenfalls den Wald, die Landschaft zu achten und zu respektieren.
In der Jagd mit Verstand vorzugehen, nicht zu verwüsten, nicht das Tier zu quälen, auf Landschaft, Wald, Umgebung, Steine, Pflanzen, Tiere, Wege, Pfade, Menschen und Siedlungen, auf Dörfer, auf Privatbesitz und fremdes Eigentum, den Besitz der Menschen acht zu geben, in der Jagd allseits verantwortungsvollen Umgang zu zeigen, umsichtig zu handeln, das ist wahres Weidmannstum, welches mit Achtsamkeit und Respekt bewusst sein Handwerk vollbringt.
Meine Liebe gilt Vielem, besonders allerdings der Macht, der Herrschaft und der Jagd.
Dies alles eigne ich mir hier im Freien auf Burg Neuhaus an, erarbeite mir im Spiel die verschiedensten Bedingungen von Kraft und Verfügungsgewalt immer wieder neu.
Oft saß ich ins Spiel vertieft still unter einem Baum, auf dem Boden oder in unserem Sandkasten, wenn meine älteren Geschwister für die Schule paukten oder bereits arbeiteten, da hatte ich Zeit, die nahm ich mir auch, mich herrlich in meine Einsamkeit zu vertiefen und oft gleichsam einer Trance ein alter König, im Traum ein Pharao, ein Gottkönig, Kaiser, Fürst und Daimyo, ein Löwe, Stier, Adler, ein geflügeltes Pferd, in meiner Versunkenheit Prophet, Kind, Knabe, Knappe, Magd, Mädchen oder mächtiger Herrscher im anmutigen Mantel der Macht zu sein, mit Gold geschmückt, mit Lorbeer umkränzt, Caesar, Kaiser, König im Lichterkranz, welcher Sonnenlicht auf den Tautropfen, gleißend hell in den Pfützen, diamantengleich Perlen im frühen Morgenlicht ähnelt, als einem Diadem. Es strahlt im hellen Licht, in dem ich mich erkenne: Mich, den David.
Ich kann mich als Kind im Garten auf dem Boden kugeln und schaue durch die farbig glitzernden Tautropfen direkt in die Morgensonne. Darin erblicke ich Engel, ich höre ihre Stimmen, finde Engelschöre, nehme die Welt wahr mit ihren Sinnen, bin selbst Herr der Heerscharen, bin selbst Sonne – ständig strahlend, schweigend in meinem ureigenen Lied, im stillen Schein, der ewig währt!
Ich zerstörte im Spiel vor zwei Jahren im Burgpark wiederholt das Heiligtum der Sachsen, die Irminsul, spielte Karl der Große, dann versöhnte ich mich mit Widukind, meinem erbittertsten Gegner – zwei Seiten einer Münze – es gab ein großes Fest, wir tranken aus Schalen, alten Pflanzschalen, die ich im Gartenhäuschen in einer Ecke gefunden hatte. Auch die kleine Axt hatte da gelegen.
Ich konnte sie nie richtig scharf bekommen damals.
„Wenn Sie mir zeigen, wie ich diese kleine Axt so bearbeiten kann, dass sie richtig schneidet, zerlege ich die ganze alte Tanne zu Brennholz und bekomme dann die Axt geschenkt, was halten Sie davon, Voss? Was hältst du davon, Onkel?“
Ich hatte Onkel Harry angestrahlt und wohl die ersten und ehrlichsten Gebete meines Lebens mit meinem Herzen gesprochen, so viel war mir an diesem Werkzeug gelegen, mit dem ich nicht nur ordentlich Holz hacken und spalten konnte, es gab auch noch eine prächtige Wurfaxt ab, genau richtig für meine Größe.
Sie hatte die gleiche Klingenform wie die, welche zur Zeit der Merowinger gebräuchlich war, lang, schmal, die untere Klingenkante leicht nach innen gewölbt.
Exzellent zum Werfen, ideal zum Entern oder Steigen, Schild niederreißen, geschwind vor allem im kurzen Schwung, gefährlich schnell und tödlich in der Ausholbewegung von der Seite, von oben oder unten.
Bei dem Gedanken, dass meine Mutter genau den gleichen Namen trägt, wie die alte Streitaxt der Franken, unterdrücke ich stets mein Schmunzeln, wenn meine Ma in der Nähe ist.
Mutter war herein gekommen.
Plötzlich ertönte eine andere Musik, damals.
Dass Ma am Grammophon war, hatte ich nicht bemerkt.
Sie kann sich ebenso gut anschleichen, wie ich, wird mir bewusst.
„Was ist das für ein Tanz, Mama?“, fragte ich sie.
Offenbar hatte sie im Moment mal Interesse an mir.
Das wollte ich nutzen.
Ich ließ Vater los, lachte ihn an, verneigte mich zum Dank.
Mutter lächelte, sagte zu ihrem Gatten: „Darf ich bitten?“, und führte mit einer eleganten Handbewegung erst meinen Arm, dann meine Hand in ihre.
Diesmal trug sie ein ebenholzfarbenes Kleid mit lauter Pailletten, dazu schwarze Ohrringe und anthrazit grauen Jugendstil – Schmuck, der mich total faszinierte.
Unbedingt musste ich diese Ohrringe tragen!
Inniglich war mein Wunsch, ihre Kleider anzuziehen, ihren Lippenstift, Nagellack aufzutragen, wenn sie fort war, abends im Tanzpalast mit Vater und Onkel Harry.
Ich blieb dann zu Haus mit dem Personal.
Mutter wollte ich verstehen, begreifen, wie sie fühlte, wollte ihr so nahe sein, wie ich konnte, hätte am liebsten meine eigene Haut ab- und ihre dafür über gestreift, um zu verstehen, was sie verstand, zu fühlen, was sie fühlt, zu erkennen, was sie erkennt, um den Sinn zu sehen – den Sinn, den sie sieht, darin, mich fort zu geben und mit Vater nach Haiti zu gehen und das Kind, das erst wenige Monate alt ist, von der Mutter Wärme, von der Mutter Stimme, von der Mutter Liebe, von der Mutter Herz und Brust zu lösen und einer anderen Frau in Obhut zu geben, nur, um mich dieser dann doch wieder fort zu reißen!
Warum?
Ich werde in Deine Kleider, in Deinen Schmuck, in Deine Schminke, in all Deine Maskerade, in Deine Rolle schlüpfen, die Du dem Leben, die Du mir vorspielst, begierig, Dich zu begreifen, verzweifelnd Dich zu verstehen, nur, um Dir nahe zu kommen, so nahe, wie möglich.
Um in Deiner Nähe zu sein und dort zu bleiben.
Denn du entziehst dich mir.
Entziehst dich mir mit deinem Herzen.
Weichst mir aus mit deinen Worten.
Suchst das Weite vor mir mit deiner Seele.
Auch in meinem Leben als Nobunaga in Japan trug ich sehr gern als Kind auch Frauenkleider, um meiner Mutter näher zu sein. Eine Nähe, die ich im Alter von sechs Jahren gegen das Fürstentum meines Vaters und die militärische Erziehung allerdings nicht ungern eintauschte.
Macht oder Mutter?
Ich will wie Du sein, will ganz zu Dir werden, um Dich zu verstehn.
Ich habe keinerlei Macht über Dich.
Ach, sag’ mir selbst, wie vermag ich Dich zu halten?
Mir wurde in diesem Moment bewusst, wie sie mir charakterlich glich.
Auch äußerlich. Wie zwei Seiten einer Medaille.
Oft hatte ich mein Gesicht im Spiegel betrachtet.
Mutter konnte den gleichen diabolischen Blick haben, wenn sie wollte, so wie ich.
Ich versetzte mich in Vaters, in Onkels Lage und wähnte mich selbst zehn Jahre älter. Ich verstand auf einmal, weswegen sich die Männer um sie stritten.
Glücklicherweise stritten Onkel Harry und Vater nie.
Das hätte ich nicht vertragen.
Beide waren sie meine Familie.
Und ebenso war es natürlich mit meiner Mutter.
Eine Mutter ist eine Person, die es im Leben nur einmal gibt.
Eine leibliche Mutter.
Ich hatte vier Mütter.
Frau Graf.
Frau Frank, eine andere „Ersatzmami“.
Dann Mama Ruttmann, meine Mutter in einer weiteren Pflegefamilie.
Schließlich meine Mutter Franziska.
„Es ist ein Menuett, mein Sohn,“ antwortete sie.
„Komm, ich zeig’ es dir!“
Menuett.
Ein majestätischer Tanz.
Ein königlicher Augenblick.
Wir tanzten eine Weile.
Diese Schritte begriff ich schnell.
Zum Dank drückte ich meine Mami an mein Herz und erhielt von ihr eine beherzte, kraftvolle Umarmung in der Weise eines kalten, nassen Putzlappens.
Wenn ich sie bat, mich fester zu umfangen, erdrückte sie mich bald.
Wie kann ich sie lehren, mich mit ihrem Herzen in den Arm zu nehmen?
Wenn ich mich selbst frage, wo ich zu Hause bin, so habe ich in Wahrheit außer Burg Veldenstein kein festes zu Hause.
Das Deutsche Reich ist mein zu Hause.
Immerhin hatte ich es mit Blut und Eisen höchstselbst geschmiedet.
In Gedanken versunken erkenne ich bald, dass mich mein Vater geduldig ansieht und milde lächelt.
Immer noch sitze ich auf seinem Schoß.
„Möchtest du mir etwas sagen?“, fragt er in unsere Gesprächspause hinein.
„Die Sache mit dem Anton Schilling ist aus dem Ruder gelaufen! Wir hätten es sein müssen, die dem Direktor umgehend einen Brief schreiben, denn immerhin hat der Junge mir ein Bein gestellt und nicht umgekehrt!“, erkläre ich in bestimmtem Ton und strahle Vater an.
Bevor er etwas erwidern kann, füge ich hinzu: „In der Schlacht kommt es darauf an, eine Situation als erster zu erfassen und den Gegner vor vollendete Tatsachen zu stellen! Wie zum Beispiel im Herrenzimmer bei meiner Bonaparte – Armee!“
Ich springe von Vaters Schoß und nehme ihn bei der Hand.
Sie können mich nur wahrhaft lieben, wenn sie mich wahrhaft kennen, denke ich.
Wenn sie mich wahrhaft kennen und mich dann noch lieben, dann lieben sie mich wirklich.
Vater fällt nichts besseres ein, als sich von mir in Onkels Gesellschaftssalon, den
„Kleinen Salon“, den Mutter auch Herrenzimmer nennt, führen zu lassen.
Hier stehen meine vielen Zinn – Soldaten über den ganzen Boden verteilt.
Einige Eicheln liegen geordnet herum, das sind Kanonen.
Rosskastanien sind Pulverfässer.
Aus den festen Pappkarten eines Burgen – Quartetts habe ich mehrere Militär – Zeltlager zusammengesetzt.
Onkel Harrys Manschettenknöpfe sind Haubitzen. Ich darf sie benutzen, er trägt sie nicht mehr. Natürlich habe ich ihn gefragt, in der Hoffnung, dass er Interesse an meinem Spiel bekundet.
Wenn ich jemals Kinder haben sollte, möchte ich, dass sie auch so frei und wild spielen können, wie es ihnen beliebt, so wie ich es hier auf Burg Veldenstein kann. Aber dann, so wünsche ich, möchte ich für meine Kinder da sein.
Ich möchte mich für sie interessieren.
Mitspielen.
Nachfragen.
Begeistern.
Mich in ihr Spiel einführen, einbinden lassen, wenn es geht.
Falls sie es wünschen.
Mein Vater sagt nichts und schaut nur erstaunt umher.
Ich betrachte ihn in seinem eleganten Anzug, wie sein Blick ziellos über meine Aufstellungen gleitet, die ich am gesamten Boden, auf Stühlen und sogar auf dem Tisch angeordnet habe.
Mein ganzes Leben lang hatten die Erwachsenen mir ihren Lebensstil aufgezwungen in Form ihrer Abwesenheit und meines ständigen Umherziehens, meiner Rastlosigkeit.
Stets musste ich ihrer Realität ins Auge sehen.
Die Tatsache, dass meine Seele keine Ruhe findet, begründe ich damit, schon als kleines Kind von einer Familie an die nächste weiter gereicht worden zu sein.
Es war etwas anderes, wenn, wie bei den Indianern, der ganze Stamm alle Kinder erzieht, wie ich in einem Reisebericht eines Missionars gelesen habe, statt eines Kindes, das immer hin- und her gereicht wird, als wisse man keine rechte Verwendung dafür.