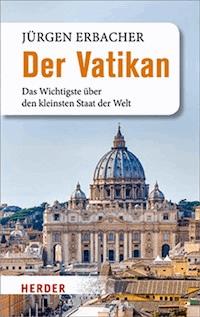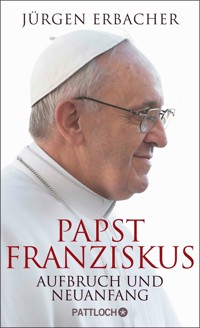4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieser Papst ist anders: Er verabscheut den Pomp, räumt im Vatikan mit Seilschaften auf und durchleuchtet das dubiose Finanzgebaren der Vatikanbank. Er steht in Lampedusa an der Seite der Flüchtlinge und küsst auf dem Petersplatz die Entstellten. Doch bei aller Herzlichkeit und Bescheidenheit, die ihm die Herzen der Menschen zufliegen lassen, ist Franziskus ein Mann klarer Worte. Seine Kritik am westlichen Kapitalismus hat ihm den Verdacht des Marxisten eingebracht. Unbeirrt legt er den Finger in die Wunden von Kirche und Welt. Jürgen Erbacher hat im Umfeld des Papstes und in seiner argentinischen Heimat recherchiert und weiß, was von diesem Papst noch alles zu erwarten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jürgen Erbacher
Ein radikaler Papst
Die franziskanische Wende
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Papst Franziskus ist radikal anders: Er verabscheut den Pomp, räumt im Vatikan mit Seilschaften auf und durchleuchtet das dubiose Finanzgebaren der Vatikanbank. Er steht in Lampedusa an der Seite der Flüchtlinge und küsst auf dem Petersplatz die Entstellten. Doch bei aller Herzlichkeit und Bescheidenheit, die ihm die Herzen der Menschen zufliegen lassen, ist Franziskus ein Mann klarer Worte und starken Willens. Seine Kritik am westlichen Kapitalismus hat ihm den Verdacht des Marxisten eingebracht. Unbeirrt legt er den Finger in die Wunden von Kirche und Welt. Der Vatikanexperte Jürgen Erbacher hat im Umfeld des Papstes und in seiner argentinischen Heimat recherchiert und weiß, was von diesem Papst noch alles zu erwarten ist. Kundig legt er ein Psychogramm des Pontifex vor, das seine philosophischen und theologischen Wurzeln und seine Spiritualität freilegt. Erbacher arbeitet das politische und theologische Regierungsprogramm des Papstes heraus und kommentiert seine Weichenstellungen im Umbau der römischen Kurie und der Weltkirche. Ein Schwerpunk liegt auf der Beziehung der deutschen Kirche zum neuen Papst und den großen Erwartungen, die er hierzulande geweckt hat.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Offen, zerbeult und nahe bei den Menschen
Synodal oder autoritär?
Unlösbare Aufgabe?
Freunde und Skeptiker
Ist Franziskus ein Marxist?
Eine arme Kirche für die Armen
Päpste, Theologen und Philosophen
Franz von Assisi, Ignatius und Co.
Kontinuität oder Bruch?
Kritik an vielen Fronten
Mann des Dialogs
Im Franziskusmodus?
Von Abtreibung über Familie bis Zölibat
Bildteil
Anhang
Literaturhinweise
Informationen im Internet
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Seine Wahl war eine Überraschung. Als Papst Franziskus begeistert er die Menschen weit über die katholische Kirche hinaus: Jorge Mario Bergoglio, der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires, sorgt als Papst Franziskus für Diskussionen. Das Time-Magazin kürt ihn schon nach nur einem halben Jahr im Amt Ende 2013 zum »Menschen des Jahres«. Selten habe ein »neuer Protagonist auf Weltebene in so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, bei Alt und Jung, Gläubigen und Nicht-Glaubenden wie Papst Franziskus«, lautete die Begründung. Er wird als »Papst der Menschen« definiert, und es wird unterstrichen, »der Führer der katholischen Kirche ist zu einer neuen Stimme des Gewissens geworden«. Zwar ist Franziskus nicht der erste Papst, dem diese Ehre zuteilwird, 1962 war Johannes XXIII. und 1994 Johannes Paul II. »Mensch des Jahres« des Time-Magazins. Doch interessant ist die Begründung. Der Aufstieg des Jorge Mario Bergoglio als Papst ging so rasant, dass er seinesgleichen sucht. Schon mit den ersten Gesten beim Auftritt auf der Mittelloggia des Petersdoms am Abend des 13. März 2013 erobert Franziskus die Herzen vieler Menschen. Denn sofort ist vielen klar: Dieser Papst ist anders. Und der erste Eindruck trügt nicht. Das zeigt sich, je länger das Pontifikat dauert. Die katholische Kirche befindet sich seit der Wahl Bergoglios zum Papst in einer Phase der Aufbrüche und des Neuanfangs.
Zwei Aussagen oder Bilder von Papst Franziskus stehen gleichsam wie eine Überschrift über seinem Pontifikat: der Wunsch einer »armen Kirche an der Seite der Armen« sowie die Vorstellung einer bisweilen »verbeulten Kirche«, die sich nicht in sich selbst verschließt, sondern sich öffnet und an die Ränder der Gesellschaft geht. »Ich träume von einer Kirche als Mutter und als Hirtin. Die Diener der Kirche müssen barmherzig sein, sich der Menschen annehmen, sie begleiten – wie der gute Samariter, der seinen Nächsten wäscht, reinigt, aufhebt.« Das erklärt er in einem Interview mit den Jesuitenzeitschriften im September 2013. Dieses Interview gehört zusammen mit seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium, das er im November 2013 veröffentlicht, zu den Schlüsseltexten des Pontifikats. Hier findet man das Programm des Papstes vom anderen Ende der Welt.
Blickt man auf die Sprache von Franziskus, dann wird sehr schnell deutlich, wie er sich die Kirche, wie er sich das Christentum vorstellt: gehen, laufen, herauskommen, folgen, schauen, hören. Das sind alles Verben der Bewegung und der Aufmerksamkeit. Die Kirche muss die Zäune niederreißen, die sie um sich aufgebaut hat, die Türen der Kirchen und Pfarrzentren öffnen und in die Welt gehen. Sie muss aufmerksam sein für die Sorgen und Nöte der Menschen. Bei den Substantiven sind es die Worte: Zärtlichkeit als eine Tugend, derer man sich nicht schämen müsse, Barmherzigkeit, die für Franziskus so etwas wie die Nagelprobe der Liebe ist, sowie Wahrheit und Gerechtigkeit. Umgekehrt gibt es Worte oder besser Verhaltensweisen, die Franziskus gleichsam rasend machen: Geschwätz, Klatsch und Tratsch sowie Gejammer.
Papst Franziskus hält alle Seiten in Atem. Diejenigen, die seit Jahren Reformen fordern, sehen in Bergoglio ihren Hoffnungsträger. Nur so recht scheint er die Reformen nicht anpacken zu wollen. Auf der anderen Seite sind die eher Konservativen, die glaubten, in Benedikt XVI. eine sichere Bank zur Verwirklichung ihrer restaurativen Ziele zu haben, bis mit dessen Amtsverzicht ihre Scheinwelt zerplatzte und sie nun umso härter auf dem Boden der Realität aufschlagen. Auf beiden Seiten strapaziert Franziskus die Nerven »seiner« Gläubigen. Sein Kurs passt noch weniger in das alte Schubladendenken, als es unter Benedikt XVI. schon der Fall war.
»Franziskus ist das, was er sagt.« Auf diese einfache Formel bringt es Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Seine Persönlichkeit verkörpere quasi seine Worte. Durch seine Art schaffe er keine Distanz zu den Gesprächspartnern, sondern eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe. Durch seine Art öffne er Türen und baue Brücken. In diesem Sinn ist Franziskus ein Pontifex – ein Brückenbauer.
Und er ist ein politischer Papst. Er mischt sich ein in die Politik, mahnt gerechtere Strukturen weltweit an. Mit seiner Aussage »Diese Wirtschaft tötet!« löst er weit über die katholische Kirche hinaus Diskussionen aus. Die einen nennen solche Worte Klartext, die anderen sehen in Franziskus einen Reformator und Revolutionär auf dem Stuhl Petri. Für abschließende Urteile ist das Pontifikat noch zu jung. Viele Veränderungen stecken noch in den Kinderschuhen. Doch eines ist bereits klar: Franziskus möchte Veränderungen in der katholischen Kirche sowie im Verhältnis der Kirche zur Welt, die durchaus eine radikale Wende bedeuten. Zwar sind in vielen Punkten seine Vorstellungen nicht neu, sondern zutiefst christlich und damit bereits 2000 Jahre alt. Doch angesichts der Entwicklungen in der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, stellen sie doch eine radikale Kurskorrektur dar. Franziskus möchte eine radikale Christusnachfolge für jeden einzelnen Gläubigen und die Kirche als Ganze.
Das vorliegende Buch will einen Schlüssel bieten, Papst Franziskus und sein Pontifikat besser zu verstehen. Die Analyse möchte auch eine Basis schaffen, um künftige Entscheidungen des Papstes und Entwicklungen in der katholischen Kirche besser einordnen und deuten zu können. In einem ersten Schritt werden das Bild der Kirche von Franziskus näher dargestellt, sein Leitungsstil und die Vorgänge rund um die römische Kurie. Schließlich sorgten die Vorgänge dort für heftige Diskussionen unter den Kardinälen im Vorkonklave und waren letztendlich auch mitverantwortlich, dass ein Externer zum Papst gewählt wurde: Jorge Mario Bergoglio.
Gerade weil Franziskus nicht aus der römischen Kurie stammt, braucht er gute Mitarbeiter, um seine Reformvorhaben umzusetzen. Einige der Papstvertrauten werden daher in einem eigenen Kapitel kurz vorgestellt. Mit dem Blick auf den politischen Papst beginnt ein Teil des Buches, in dem es um die Herkunft Jorge Mario Bergoglios geht. Denn seine Biographie prägt sein Pontifikat ganz entscheidend. Um Franziskus richtig verstehen zu können, sind seine Biographie, seine theologischen und geistlichen Wurzeln wichtig. Diese spannende Suche nach dem Fundament, auf dem Papst Franziskus steht, nimmt daher einen breiten Raum ein. Jede Veränderung ruft Widerstand hervor. Aus welchen Richtungen Papst Franziskus Gegenwind erfährt, wird ebenso beleuchtet wie die Frage, ob die katholische Kirche in Deutschland bereits im Franziskusmodus angekommen ist. Schließlich geht es in einem abschließenden Kapitel um die Frage, welche Veränderungen bei Lehre und Moral Papst Franziskus anpacken wird. Der Erwartungsdruck ist hoch; der Reformstau groß. Schon werden historische Vergleiche herangezogen. Von »Glasnost« ist die Rede, einer neuen Offenheit in der katholischen Kirche. Entsprechend warten die Menschen gespannt auf die »Perestroika«, die Reformen. Das letzte Kapitel wagt einen Ausblick.
Papst Franziskus überrascht immer wieder durch seine Spontaneität, durch Worte und Gesten. Daher ist es nicht einfach, ein Bild des ersten Papstes aus Lateinamerika zu zeichnen. Eine Hilfe ist, dass auch in Papst Franziskus sehr viel Jorge Mario Bergoglio steckt. Der Papst ist sich treu geblieben. Daher helfen für die Analyse Texte aus seiner Zeit vor der Wahl zum Papst sowie die Gespräche mit Weggefährten und Bekannten von Jorge Mario Bergoglio. Aus diesen Quellen sowie den Texten seit der Wahl speist sich das vorliegende Buch. Fehler in der Interpretation gehen zu Lasten des Autors.
Ein großer Dank gilt den zahlreichen Gesprächspartnern in Deutschland, Rom und Argentinien sowie denen, die bei der Durchsicht des Manuskripts geholfen haben. Ein Dank gilt auch dem Verlag, der nach dem ersten Buch über Papst Franziskus im Sommer 2013 nun dieses zweite Werk wagt. Es ist in gewissem Sinne eine Fortsetzung von Papst Franziskus – Aufbruch und Neuanfang. Viele Themen, die dort angerissen wurden, werden jetzt vertieft. Die beiden Bücher sind aber eigenständige Werke und versuchen, mit einem je eigenen Ansatz den Papst vom anderen Ende der Welt fassbar und begreifbar zu machen. Dabei geht es immer um zwei Pole: ein besseres Verständnis der Person einerseits und der franziskanischen Wende in der katholischen Kirche andererseits.
Offen, zerbeult und nahe bei den Menschen
Die Kirche, wie sie Papst Franziskus will
Jorge Mario Bergoglio hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie die katholische Kirche aussehen soll. Und er lebt dieses Modell von Kirche vor: schlicht im Stil, einfach, aber kraftvoll in den Worten, nicht ewige Nabelschau betreibend, sondern missionarisch und nahe bei den Menschen in ihrem konkreten alltäglichen Leben. Schon ist von der »Enzyklika auf zwei Beinen« die Rede. Durch seinen Stil prägt er das Papstamt neu und damit auch das Image der katholischen Kirche. Daher hilft ein Blick auf die Art, wie Franziskus sein Amt ausführt, um seine Idee von Kirche zu verstehen. In seiner Ansprache bei der Versammlung der Kardinäle vor dem Konklave im März 2013 finden sich bereits die zentralen Begriffe des Kirchenverständnisses von Jorge Mario Bergoglio. Nach den Berichten von Kardinälen nach dem Konklave sind es genau diese Ausführungen und die Tatsache, dass sie durch das bisherige Wirken des Erzbischofs von Buenos Aires gedeckt sind, die viele zu einer Stimme für Bergoglio veranlassten. Bereits zwei Wochen nach der Papstwahl veröffentlichte der Erzbischof von Havanna, Jaime Kardinal Ortega, mit Zustimmung Bergoglios eine schriftliche Zusammenfassung dieser Ansprache, die der Argentinier selbst verfasst hatte.
Schon nach kurzer Zeit ist offensichtlich, dass es sich bei den Worten Bergoglios aus dem Vorkonklave gleichsam um das Programm seines Pontifikats handelt. Er spricht von der Evangelisierung als eigentlichem »Daseinsgrund der Kirche«. Diese erfordere »apostolischen Eifer«. »Sie setzt in der Kirche kühne Redefreiheit voraus, damit sie aus sich selbst herausgeht. Sie ist aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geographischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends.« Er kritisiert einen »Geist des theologischen Narzissmus« in der Kirche. »Die um sich selbst kreisende Kirche glaubt, ohne dass es ihr bewusst wäre, dass sie eigenes Licht hat. Sie hört auf, das ›Geheimnis des Lichts‹ zu sein, und dann gibt sie jenem schrecklichen Übel der ›geistlichen Mondanität‹ Raum (nach Worten de Lubacs das schlimmste Übel, was der Kirche passieren kann). Diese (Kirche) lebt, damit die einen die anderen beweihräuchern.« Nach Bergoglio gibt es zwei Kirchenbilder: »die verkündende Kirche, die aus sich selbst hinausgeht, die das ›Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet‹; und die mondane Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt«. Die zuletzt geschilderte Kirche ist die, die Bergoglio zutiefst ablehnt, die er aber in Teilen der Kurie und der Weltkirche verwirklicht sieht. Damit teilt er die Sicht vieler Menschen, die die katholische Kirche als abgehoben, selbstzufrieden und vor allem mit sich selbst beschäftigt erleben.
Hier möchte Franziskus eine radikale Wende erreichen. Nicht die Kirche darf nach seiner Vorstellung im Mittelpunkt des Handelns stehen, sondern Christus muss im Zentrum stehen. Was eigentlich selbstverständlich klingt, scheint im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte in Vergessenheit geraten oder zumindest verdeckt worden zu sein. Denn schließlich ging es auch Benedikt XVI. darum, den Menschen Christus nahezubringen und die Frage nach Gott in der Gesellschaft wachzuhalten oder wieder neu zu entfachen. Doch er ist damit nicht durchgedrungen. Das Bild der Kirche in der breiten Öffentlichkeit war ein anderes. Von »kühner Redefreiheit« war keine Spur zu erkennen. Statt eine Kirche zu sein, die hinausgeht an die Ränder der Gesellschaft, hatten die Menschen den Eindruck, dass sich die katholische Kirche immer mehr von der Gesellschaft abkapselt, um eine kleine Herde der Einhundertprozentigen zu werden. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, auch Papst Franziskus stellt hohe Ansprüche an jeden einzelnen Katholiken. Das wird gerne übersehen. Trotzdem vermittelt er ein Bild von Kirche, das von Offenheit, Dialog und der Akzeptanz des anderen in seiner Andersartigkeit geprägt ist. Statt Ausgrenzung propagiert Franziskus eine Kultur der Begegnung. Das gilt für die Kirche intern ebenso wie für das Verhältnis der Kirche zur Welt. In seiner Videobotschaft aus Anlass des Festes des heiligen Kajetan in einem der wichtigsten Heiligtümer von Buenos Aires fasst Papst Franziskus im August 2013 diese Vorstellung zusammen: »Was Jesus in erster Linie lehrt, das ist, einander zu begegnen und in der Begegnung zu helfen. Wir müssen einander zu begegnen wissen. Wir müssen eine Kultur der Begegnung herstellen, schaffen, aufbauen. So viele gescheiterte Begegnungen, Auseinandersetzungen in der Familie, überall! Auseinandersetzungen im Stadtviertel, Auseinandersetzungen bei der Arbeit, Auseinandersetzungen auf allen Seiten. Und gescheiterte Begegnungen helfen nicht. Die Kultur der Begegnung. Hinausgehen, um einander zu begegnen.« Eindringlich appelliert er an Priester, Bischöfe und Ordensleute am Rande des Weltjugendtags im Juli 2013 in Rio de Janeiro: »Habt den Mut, gegen den Strom dieser leistungsorientierten Kultur, dieser Wegwerfmentalität zu schwimmen! Begegnung und Aufnahmebereitschaft für alle, Solidarität – ein Wort, das sich in dieser Kultur im Verborgenen hält, als sei es ein schlechtes Wort –, Solidarität und Brüderlichkeit sind Elemente, die unsere Kultur wirklich menschlich machen. Diener der Gemeinschaft und der Kultur der Begegnung sein! Ich möchte, dass ihr in diesem Sinn gleichsam besessen seid.«
Seine Rede vor den Bischöfen der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz CELAM am Ende seines Aufenthalts in Rio de Janeiro gehört zu den programmatischen Ansprachen des Pontifikats. Hier entwirft Papst Franziskus ausgehend vom Abschlussdokument der CELAM-Generalversammlung in Aparecida 2007 seine Vorstellung der katholischen Kirche. Die zentralen Gedanken sind für Franziskus: »Nähe und Begegnung. Keine der beiden ist neu, sondern sie stellen die Weise dar, in der Gott sich in der Geschichte offenbart hat. Er ist der ›nahe Gott‹ für sein Volk – eine Nähe, die ihren Höhepunkt in der Inkarnation erreicht. Er ist der Gott, der hinausgeht, seinem Volk entgegengeht.« Sein Kirchenbild ist radikal theozentrisch begründet. »Aparecida will eine Kirche, die Braut, Mutter, Dienerin ist, eine, die mehr den Glauben erleichtert, als ihn kontrolliert.« Franziskus möchte keine »Disziplinarpastoral«, kritisiert Pastoralkonzepte, »die auf Distanz angelegt sind«, und warnt vor restaurativen Tendenzen, die sich »in überzogenen Neigungen zu doktrineller und disziplinärer ›Sicherheit‹« zeigten. Der Papst spricht von einer notwendigen Umkehr in der Pastoral, die vor allem die »Grundeinstellungen und eine Reform des Lebens« betreffe. Die radikale Reform des Franziskus betrifft also zunächst nicht die Inhalte, sondern die Haltung. Allerdings wird sich die Haltungsänderung langfristig auch auf Theologie und Lehre auswirken, denn Glaubenspraxis und Glaubensinhalte sind aufs engste miteinander verwoben.
Franziskus möchte eine offene Kirche im doppelten Sinn. Bei Gesprächen mit römischen Priestern fordert er diese wiederholt auf, die Kirchengebäude offen zu halten. In Evangelii gaudium schreibt er: »Die Kirche ist berufen, immer das offene Haus des Vaters zu sein. Eines der konkreten Zeichen dieser Öffnung ist es, überall Kirchen mit offenen Türen zu haben. So stößt einer, wenn er einer Eingebung des Geistes folgen will und näher kommt, weil er Gott sucht, nicht auf die Kälte einer verschlossenen Tür.« (EG 46) Eine Kirche im Aufbruch sei eine offene Kirche, so Franziskus. Das ist die zweite Seite der »offenen Kirche«, nämlich die, die hinausgeht auf die Straße, an die Ränder der Gesellschaft und die Menschen sucht, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Dabei geht es nicht nur um die materielle Armut, sondern auch um die geistliche Not und eine entsprechende spirituelle Hilfe, um Menschen in Lebenskrisen und jene, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden wie Alte, Kranke, Menschen mit Behinderung oder Arbeitslose. »Mir ist eine ›verbeulte‹ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist […] Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos wiederholt: ›Gebt ihr ihnen zu essen!‹ (Mk 6,37).« (EG 49) Um seinen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, betont der Papst, hinauszugehen bedeute nicht, »richtungs- und sinnlos auf die Welt zuzulaufen«. Für Franziskus ist klar, der christliche Glaube, Jesu Worte und Taten, sind die Richtschnur für das Handeln jedes einzelnen Christen. Dabei kommt der Mensch in seiner konkreten Situation vor den Normen und Dogmen. Diese wirft Franziskus nicht über Bord. Aber er verändert die Perspektive und Priorisierung. Das macht vielen Menschen Hoffnung, die sich bisher in ihrer konkreten Lebenssituation nicht ernst genommen fühlten. Ein Beispiel dafür ist die Aussage von Papst Franziskus zum Thema Homosexualität. Bei der fliegenden Pressekonferenz auf dem Rückweg vom Weltjugendtag in Rio de Janeiro stellt er fest: »Wenn einer homosexuell ist und den Herrn sucht und guten Willen hat – wer bin dann ich, ihn zu verurteilen?« Er erinnert an den Katechismus der katholischen Kirche zu diesem Thema; er nimmt nichts von der dortigen Position zurück, und dennoch sorgt seine Aussage für positive Schlagzeilen. Der Schlüssel liegt schlicht darin, mit welcher Haltung Franziskus seine Aussage macht und wie diese Aussage durch sein Leben gedeckt ist. Franziskus geht offen auf die Menschen zu, ohne sie aufgrund ihrer Lebenssituation zu verurteilen. Das trifft auch auf die wiederverheirateten Geschiedenen oder Alleinerziehende zu, ja sogar für gleichgeschlechtliche Paare, die um die Taufe für ein uneheliches Kind bitten. So sorgt Franziskus für Aufsehen, als er das Kind eines nur zivil verheirateten Ehepaares in der Sixtinischen Kapelle tauft.
Franziskus lässt keinen Zweifel daran, dass er in Moralfragen die traditionellen katholischen Positionen vertritt. Aber er möchte eine neue Gewichtung innerhalb der Verkündigung der Kirche erreichen. Es dürfe nicht mehr nur um Moralfragen gehen, betont er immer wieder. Am deutlichsten wird das im Interview mit den Jesuitenzeitschriften im September 2013. »Wir können uns nicht nur mit der Frage um die Abtreibung befassen, mit homosexuellen Ehen, mit Verhütungsmethoden. Das geht nicht.« Nach Franziskus muss ein neues Gleichgewicht in der Verkündigung gefunden werden. »Die Lehren der Kirche – dogmatische wie moralische – sind nicht alle gleichwertig. Eine missionarische Seelsorge ist nicht davon besessen, ohne Unterscheidung eine Menge von Lehren aufzudrängen.« Es dürfe keine spirituelle Einmischung in das persönliche Leben der Menschen geben. Vielmehr müssten Bischöfe und Priester die Menschen in ihrem Leben »mit Barmherzigkeit« begleiten. Wie das konkret aussieht, sagt Franziskus nicht. Er warnt nur wiederholt vor Extremen. Die Beichtväter dürften weder zu rigoros noch zu lax sein. Allerdings scheint für Franziskus das vertrauensvolle Verhältnis zwischen dem einzelnen Glaubenden und seinem geistlichen Begleiter entscheidend zu sein. »Die Diener des Evangeliums müssen in der Lage sein, die Herzen der Menschen zu erwärmen, in der Nacht mit ihnen zu gehen. Sie müssen ein Gespräch führen und in die Nacht hinabsteigen können, in ihr Dunkel, ohne sich zu verlieren. Das Volk Gottes will Hirten und nicht Funktionäre oder Staatskleriker.« Das II. Vatikanische Konzil und in dessen Folge auch Papst Franziskus in Evangelii gaudium sprechen im Bereich der Ökumene von der »Hierarchie der Wahrheiten«. Der Papstvertraute und Rektor der katholischen Universität von Buenos Aires, Erzbischof Víctor Manuel Fernández, deutet die Papstworte zur neuen Priorisierung vor diesem Hintergrund.
Das setzt natürlich bestimmte Anforderungen an die Priester und Bischöfe voraus. Beinahe schon zum geflügelten Wort geworden ist die Formulierung von Papst Franziskus, die Hirten müssten den »Geruch der Schafe« annehmen. »Seid Hirten mit dem ›Geruch der Schafe‹, dass man ihn riecht – Hirten inmitten ihrer Herde und Menschenfischer«, ruft er den Priestern bei seiner ersten Chrisammesse als Papst wenige Tage nach seiner Wahl zu. Ebenso eingängig ist sein Bild von dem Hirten, der bisweilen vor der Herde gehen muss, manchmal in ihrer Mitte, aber auch gelegentlich hinter ihr her. »Daher sollen die Hirten vor der Herde sein, um den Weg zu weisen, inmitten der Herde, um sie zusammenzuhalten, hinter der Herde, um zu verhindern, dass jemand zurückbleibt, und weil die Herde sozusagen den Spürsinn hat, den Weg zu finden. So muss der Hirte vorgehen!« Das gilt für Priester, in besonderer Weise aber auch für die Bischöfe. Bei einer Ansprache vor den Nuntien, die bei der Auswahl geeigneter Bischofskandidaten eine wichtige Rolle spielen, erklärt Franziskus: »Das ist das erste Kriterium: Hirten, die den Menschen nahe sind. Er ist ein großer Theologe, ein kluger Kopf: Er soll an die Universität gehen, wo er viel Gutes tun kann! Hirten! Wir brauchen sie! Sie sollen Väter und Brüder sein, sie sollen sanftmütig, geduldig und barmherzig sein; sie sollen die Armut lieben, die innere Armut als Freiheit für den Herrn und auch die äußere Armut als Einfachheit und Schlichtheit des Lebens. Sie sollen keine Mentalität von ›Fürsten‹ haben. Achtet darauf, dass sie nicht ehrgeizig sind, dass sie nicht nach dem Bischofsamt streben.« Der enge Vertraute von Papst Franziskus, Kardinal Beniamino Stella, sieht in der Ernennungspolitik des Pontifex vor allem ein Merkmal: Franziskus setze auf Personen »geistlicher Vaterschaft«. Die Begriffe »Vaterschaft« oder »Mutterschaft« gehörten zu den am meisten gebrauchten von Franziskus. Daher suche er bewusst Personen aus, die diese Eigenschaften besäßen. Es ginge weniger um die Frage von Erfahrung in Diplomatie oder großer theologischer Bildung.
Der Papst verpflichtet Priester und Bischöfe darauf, die Beratungsgremien ernst zu nehmen. »Sind die Diözesanräte und jene auf Pfarreiebene für die Pastoral und die wirtschaftlichen Angelegenheiten wirkliche Räume für die Teilnahme der Laien an der Beratung, der Organisation und der pastoralen Planung? Das gute Funktionieren der Räte ist entscheidend.« Dabei ist für Franziskus allerdings klar, dass am Ende der Priester und der Bischof diejenigen sind, die entscheiden. Aber sie müssen die Räte in die Entscheidungen mit einbeziehen. Verbunden mit der Aufforderung von Franziskus, dass die Ämter einen Dienstcharakter für die Gemeinde und die Kirche haben, bedeutet das eine klare Absage an jegliche selbstherrliche Regentschaft eines Pfarrers über seine Gemeinde oder eines Bischofs über sein Bistum. Bereits Ende der 1980er Jahre stellt Bergoglio, damals noch Spiritual in Córdoba, in seinen »Geistlichen Reflexionen« fest: »Für einen Hirten muss die erste Frage jeder Strukturreform sein: ›Was will mein Volk von mir? Welchen Appell richtet es an mich?‹ Er muss den Mut haben, zuzuhören … und das, ohne den Blick für den weiteren Horizont der Geschichte zu verlieren.«
Der »Sensus fidei«, der Glaubenssinn der Gläubigen, ist für Franziskus eine wichtige Größe. Das II. Vatikanische Konzil stellt in der Konstitution Lumen Gentium fest: »Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren.« (LG 12) In der nachkonziliaren Theologie ist diese Kategorie des Glaubenssinns nicht sehr vertieft worden. Daher fällt es gegenwärtig schwer, diese richtig zu deuten und die Aussagen von Franziskus konkret einzuordnen. Die Internationale Theologenkommission hat bereits in der Amtszeit von Papst Benedikt XVI. begonnen, ein Dokument zum Glaubenssinn zu erarbeiten, das im Frühjahr 2014 veröffentlicht wurde. Darin wird zwar festgehalten, dass der Sensus fidei nicht einfach bedeutet, dass die kirchliche Lehre sich nach der Mehrheitsmeinung der Gläubigen zu richten habe. Schließlich sei die Kirche keine Demokratie. Zugleich gestehen die Theologen unter Leitung des Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, allerdings ein, dass eine Kluft zwischen Glaubenspraxis und kirchlicher Lehre in bestimmten Fällen ein Indiz dafür sein könne, dass eine Entscheidung des kirchlichen Lehramts ohne ausreichende Berücksichtigung des Glaubenssinns einfacher Katholiken gefällt worden sei. Wie allerdings dann mit diesem Befund umzugehen sei, wird nicht gesagt. Angesichts der großen Bedeutung, die Papst Franziskus dem Glaubenssinn der einfachen Gläubigen beimisst, besteht hier noch Nachholbedarf von Seiten der Theologie, um dieses Instrument zu einem wirksamen Mittel im Entscheidungsfindungsprozess der Kirche zu machen. Allerdings sieht es Franziskus hier, wie auch an anderen Stellen, an denen er theologische Impulse gibt, nicht als seine Aufgabe als Papst an, die entsprechenden Antworten zu geben, sondern er sieht die Theologen in der Pflicht. Das gilt etwa auch bei der Frage nach der stärkeren Präsenz der Frauen in Entscheidungspositionen der katholischen Kirche. Immer wieder plädiert Franziskus dafür, ohne konkrete Vorgaben zu machen, wie das umzusetzen sei. Das führt auch zu viel Unmut unter den Gläubigen, weil sie sich vom Papst klare und konkrete Richtungsweisungen wünschen. Doch da verweigert sich Franziskus.
Das macht er in Evangelii gaudium deutlich, wenn er sagt: »Ich glaube auch nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine endgültige oder vollständige Aussage zu allen Fragen erwarten muss, welche die Kirche und die Welt betreffen. Es ist nicht angebracht, dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Bewertung aller Problemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn spüre ich die Notwendigkeit, in einer heilsamen ›Dezentralisierung‹ voranzuschreiten.« (EG 16) Der Papst nimmt sich zurück. Das eröffnet einerseits interessante ökumenische Perspektiven, denn das Papstamt ist nach wie vor eines der großen Hindernisse auf dem Weg zur Einheit der christlichen Kirchen. Das verändert aber auch das innerkatholische Gefüge. Franziskus möchte die Bischofskonferenzen aufwerten und sie als »Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen« stärken, »einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität«. Der Papst ist überzeugt: »Eine übertriebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen.« (EG 32) Dahinter steckt die Vorstellung, die Bergoglio auch schon als Erzbischof von Buenos Aires und Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz vertrat, dass ein großer Teil der Herausforderungen der Kirche jeweils lokale oder regionale Antworten erfordert, da die pastorale Situation je nach Region, Kontinent oder Kultur sehr verschieden ist. Eine Kirche, die nahe bei den Menschen ist und in ihrem Handeln von der konkreten Situation der Menschen ausgeht, wird zwangsläufig viele verschiedene Gesichter haben. Hier stellt sich die seit Anbeginn der Kirche stets kontrovers diskutierte Frage, wie viel Vielfalt die Einheit verträgt. Dabei vertritt Franziskus ganz klar die Position, dass Vielfalt keine Bedrohung darstellt, sondern eine Bereicherung.
Wenig Beachtung in der öffentlichen Wahrnehmung haben die Passagen des Schreibens Evangelii gaudium gefunden, in denen es um das Thema Inkulturation geht. Unter der Überschrift »ein Volk in vielen Gesichtern« warnt Franziskus in den Abschnitten 115 ff. davor, dass es der Logik der Menschwerdung nicht gerecht werde, »an ein monokulturelles und eintöniges Christentum zu denken« (EG 117). »Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kontinente in ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Modalitäten nachahmen, die die europäischen Völker zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte angenommen haben, denn der Glaube kann nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise einer besonderen Kultur eingeschlossen werden.« Eine einzige Kultur könne das Erlösungsgeheimnis Christi nicht erschöpfend darstellen. Hier könnte die von Franziskus gewünschte größere Kompetenz der lokalen Bischofskonferenzen künftig zum Tragen kommen.
Schon die Tatsache, dass Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Dokumente einzelner Bischofskonferenzen zitiert, zeigt, dass er diesen eine gewisse »authentische Lehrautorität« zugesteht. So kommen im Kontext der Inkulturation die Bischöfe Ozeaniens zu Wort mit ihrer Forderung, »ein Verständnis und eine Darstellung der Wahrheit Christi zu entwickeln, welche die Traditionen und Kulturen der Region einbezieht« (EG 118). Die große Bedeutung, die Franziskus der Volksfrömmigkeit beimisst, lässt letztendlich gar keinen anderen Weg zu, als eine stärkere Inkulturation des Christentums voranzubringen. Das kommt schon einem radikalen römischen Kurswechsel gleich, hatte man in den letzten Jahren unter Benedikt XVI. doch verstärkt den Eindruck, dass das Einheitsmoment stärker betont wurde. Am auffälligsten war das etwa im Bereich der Liturgie, wo der Vatikan penibel in die Übersetzung liturgischer Bücher eingegriffen hat und Formulierungen einforderte, die mit der Alltagssprache der Menschen vor Ort nur wenig gemein hatten. Dies führte zu scharfen Protesten gegen die von Rom durchgesetzte Neuübersetzung des Messbuchs ins Englische und zu heftigen Diskussionen hinter den Kulissen bei der neuen deutschsprachigen Ausgabe. Gerade unter Papst Franziskus, der immer wieder von den Priestern fordert, dass sie nicht über die Köpfe der Menschen hinweg predigen sollen, sondern die Sprache der Menschen sprechen müssten, damit diese die christliche Botschaft auch verstehen könnten, ist eine alltagsferne liturgische Sprache schwer vorstellbar.
In Evangelii gaudium benennt Franziskus einige Grundprinzipien, die das Handeln des Menschen bestimmen sollten. Er bezieht diese zunächst auf die Frage nach dem Frieden zwischen und innerhalb von Nationen, leitet aber bei jedem der Prinzipien auch Konsequenzen für das Handeln der Kirche ab. So sei die Wirklichkeit »wichtiger als die Idee«. Die Idee diene dazu, die Wirklichkeit zu erfassen und zu verstehen. »Die von der Wirklichkeit losgelöste Idee ruft wirkungslose Idealismen und Nominalismen hervor, die höchstens klassifizieren oder definieren, aber kein persönliches Engagement hervorrufen.« (EG 232) Franziskus, wie überhaupt die Theologie und Kirche in Lateinamerika, vertritt also einen eher induktiven Ansatz, während in der europäischen Denktradition der katholischen Kirche bisher eher deduktiv gearbeitet wurde. Man ging von bestimmten Prinzipien aus und applizierte diese auf die Realität. Das bedeutet natürlich eine radikale Wende in der Herangehensweise an theologische Fragen durch Franziskus. Dieses neue Denken darf allerdings nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden in dem Sinn, dass jetzt die Lehre allein nur noch an den konkreten Situationen ausgerichtet wird nach dem Prinzip des »Alles ist möglich«. »Ich bin ein Sohn der Kirche«, betont Franziskus immer wieder, wenn es um die Fragen der kirchlichen Lehre geht. Er steht zur katholischen Tradition, sieht aber Möglichkeiten für neue Interpretationen und eine Weiterentwicklung sowie zur stärkeren Berücksichtigung der konkreten Situation der Menschen bei der Auslegung der traditionellen Lehre.
Ein weiteres wichtiges Prinzip des Papst Franziskus lautet: »Die Zeit ist mehr wert als der Raum.« »Dieses Prinzip erlaubt uns, langfristig zu arbeiten, ohne davon besessen zu sein, sofortige Ergebnisse zu erzielen.« (EG 223) Dem Raum Vorrang zu geben bedeute, sich vorzumachen, alles in der Gegenwart lösen zu können. »Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet, sich damit zu befassen, Prozesse in Gang zu setzen, anstatt Räume zu besitzen.« (EG 223) Dieses Prinzip bezieht Franziskus sowohl auf Politik und Gesellschaft als auch auf die Kirche. Damit wird deutlich, schnelle Reformen wird es unter diesem Papst nicht geben. Das führte etwa dazu, dass in einigen Bilanzen zum Jahrestag der Wahl von Jorge Mario Bergoglio zum Papst im März 2014 kritische Stimmen aufkamen, dieser Papst werde die in ihn gesetzten Reformerwartungen nicht erfüllen, denn bisher sei ja noch kaum etwas passiert. Zum einen wird die weitere Analyse hier zeigen, dass sich bereits vieles bewegt hat. Zum anderen gilt aber für die notwendigen Reformen: Zeit geht vor Raum. »Ich glaube, dass man immer genügend Zeit braucht, um die Grundlagen für eine echte, wirksame Veränderung zu legen«, berichtet Franziskus im Interview mit den Jesuitenzeitschriften über seine eigene Erfahrung in Leitungsverantwortung. Das Prinzip »Raum vor Zeit« gilt dabei sowohl für die persönlichen Entscheidungen, die Franziskus als Papst treffen muss, als auch für die Veränderungsprozesse in Kirche und Theologie. Schnellschüsse liebt er nicht. »Ich misstraue jedoch Entscheidungen, die improvisiert getroffen wurden. Ich misstraue immer der ersten Entscheidung, das heißt der ersten Sache, die zu tun mir in den Sinn kommt. Sie ist im Allgemeinen falsch. Ich muss warten, innerlich abwägen, mir die nötige Zeit nehmen. Die Weisheit der Unterscheidung gleicht die notwendige Zweideutigkeit des Lebens aus und lässt uns die geeignetsten Mittel finden, die nicht immer mit dem identisch sind, was als groß und stark erscheint.«
Franziskus versucht das zu leben, was er verkündet. Dafür lassen sich viele Beispiele finden. Er wirkt damit stilbildend für die katholische Kirche und prägt auf diese Weise ein neues Bild dieser Institution. Bei seinen Reisen fährt er an Brennpunktorte. Das wird besonders bei den inneritalienischen Visiten deutlich: nicht Mailand, Genua oder Venedig stehen als erste Ziele auf der Agenda, sondern die Flüchtlingsinsel Lampedusa, die Mafiahochburgen Caserta und Cassano all’Jonio in der Region Kalabrien sowie die Stadt Campobasso in der Region Molise, die wie die beiden kalabrischen Städte durch hohe Arbeitslosigkeit gezeichnet ist. Auf diesen Reisen besucht er Gefängnisse, Einrichtungen für Alte und Menschen mit Behinderung und isst in Caritaseinrichtungen zu Mittag. Auch bei den internationalen Reisen deutet sich dieser Trend an. Südkorea, Albanien, Sri Lanka und die vom Tsunami betroffenen Gebiete der Philippinen stehen hier auf der Agenda.
Selbst bei den Pfarreibesuchen in seinem Bistum Rom fällt auf, dass er in den ersten Monaten bevorzugt Gemeinden in sozialen Brennpunkten oder in Arbeitervierteln besucht. Für Bergoglio ist das nichts Neues. Schon als Erzbischof von Buenos Aires ist er am Sonntagmittag oft in Pfarreien seines Bistums gegangen, um etwa die Menschen in den Armenvierteln zu besuchen. Den Weg dorthin legte er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Eine kleine Änderung bei den römischen Pfarreibesuchen gibt es gegenüber den Vorgängern. Sie finden meistens am Nachmittag statt. Das hat den Vorteil, dass Franziskus nicht zeitlich eingeschränkt ist. Bei Besuchen am Vormittag drängt oft die Zeit, denn um 12 Uhr muss der Papst zurück im Vatikan sein, um mit den Gläubigen auf dem Petersplatz das Mittagsgebet zu sprechen. Gelegentlich kam es bei Johannes Paul II. und Benedikt XVI. vor, dass dieses aufgrund von Verzögerungen beim Pfarreibesuch später beginnen musste. Franziskus macht seine Visiten am Nachmittag und kann sich so viel Zeit nehmen, wie er möchte, um mit den Menschen in den Pfarreien zu sprechen. Wie bei seinen wöchentlichen Generalaudienzen lässt er sich viel Zeit für die Begegnung mit den Menschen, vor allem mit den Alten, den Kranken und den Menschen mit Behinderungen.
In seinen Ansprachen fasst sich Franziskus kurz und verwendet eine klare, einprägsame Sprache. Immer wieder versucht er mit den Zuhörern zu interagieren, stellt Fragen, lässt zentrale Begriffe seiner Ansprachen von den Menschen wiederholen, damit diese sie sich einprägen können. Berühmt sind mittlerweile schon die Wortschöpfungen von Papst Franziskus. Er kreiert Begriffe, die es im Italienischen eigentlich nicht gibt. Franziskus spricht beispielsweise davon, dass das Gebet »memoriosa«, voller Erinnerung der Gegenwart Christi, sein müsse. Sein engster Mitarbeiter, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, stellt dazu schmunzelnd fest: »Der Papst ist einfach so. Er bringt unser Leben durcheinander und auch unsere Sprache.« Die Sprache ist allerdings für einige Kritiker des Papstes auch ein Stein des Anstoßes. Und dabei geht es nicht nur um den teilweise sehr umgangssprachlichen Ton. Der gefällt den Gläubigen, nicht aber manchen Klerikern und Theologen, die intellektuelle Tiefe vermissen. Auch dass Franziskus nur italienisch spricht, von ganz wenigen, meist spanischen Ausnahmen abgesehen, erregt Anstoß. Es irritiert die Gläubigen, die an Weihnachten und Ostern beim Segen »Urbi et Orbi« auf die traditionellen Festtagsgrüße in mehr als 60 Sprachen warten. Es ruft aber auch Kritiker verschiedenster Couleur auf den Plan. Den einen geht damit ein Stück Internationalität des Papstamts verloren, andere sehen dadurch den direkten Kontakt von Franziskus zu den Gläubigen beeinträchtigt. Wenn der Papst etwa in Amman eine flammende Predigt für Frieden hält und den Waffenhandel in der Krisenregion geißelt, das aber auf Italienisch macht, bekommen die Menschen vor Ort davon nicht viel mit; selbst wenn es anschließend eine kurze arabische Zusammenfassung der Ansprachen gibt. Die für Franziskus so typische Interaktion mit den Gläubigen ist dann nicht möglich. Doch Bergoglio tut sich schwer mit Fremdsprachen. Daher beschränkt er sich auf Spanisch und vor allem Italienisch; Sprachen, in denen er auch improvisieren kann, und genau das liebt dieser Pontifex ja sehr. Oft legt er das vorbereitete Redemanuskript zur Seite und spricht frei, sehr zum Leidwesen seines vatikanischen Apparats. Denn so ist der Papst nur schwer zu kontrollieren.
Diese Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Papstes zeigt sich auch an anderen Stellen. Durch die Wahl seines Wohnorts und seinen Arbeitsstil entzieht sich Franziskus zu einem Teil der Kontrolle des Apparats. Er greift selbst zum Telefon und ruft alle möglichen Menschen an: vom Kardinal über Referenten in den Vatikanbehörden bis zu Freunden in aller Welt. Das trifft auch für Begegnungen zu. Am Vormittag sind die offiziellen Audienzen des Papstes im zweiten Stock des Apostolischen Palasts. Diese werden von der Präfektur des Päpstlichen Hauses in Abstimmung mit dem Staatssekretariat organisiert. Wen der Papst dann am Nachmittag im vatikanischen Gästehaus Santa Marta trifft, wo er zusammen mit mehreren Dutzend anderen Klerikern und Gästen wohnt, wird weitestgehend von ihm selbst bestimmt und läuft über seine Sekretäre. Da kommt es zu zufälligen Begegnungen mit den anderen Gästen im Haus. Es gibt aber auch viele Treffen mit alten Bekannten aus der Zeit vor der Papstwahl. Aus diesem Grund hat Franziskus unter anderem auch Santa Marta als Wohnort gewählt. Dort ist er unter Menschen und kann recht unkompliziert anderen begegnen. Was die Sicherheit anbetrifft, ist diese Wahl ein Mehraufwand. Für Franziskus bedeutet es mehr Freiheit.
Auch wenn der Papst betont, dass die Wahl seines Wohnsitzes in Santa Marta vor allem psychologische Gründe hat, so ist das leere Appartamento in der Terza Loggia des Apostolischen Palasts doch zugleich ein Statement. Ob es wirklich ein radikaler Bruch mit dem alten Papstamt ist, lässt sich nach eineinhalb Jahren Pontifikat noch nicht ermessen. Aber vieles deutet darauf hin. Es ist der Bruch mit einem vatikanischen System, in dem die Intrigen bis in das Vorzimmer des Papstes reichten, ein System, in dem am Ende des Tages der Papst alleine sitzt in seiner mehrere hundert Quadratmeter großen Wohnung hoch über einem der schönsten Plätze der Welt, dem Petersplatz. Dagegen wirkt das 70 Quadratmeterapartment im zweiten Stock des Gästehauses, das im Schatten des mächtigen Petersdoms liegt wie ein von der Masse des Petersdoms beinahe erdrückt werdendes Häuschen, wie der harte Aufprall in der Realität eines geschundenen, machtlosen Papstamts. Seit die Päpste Mitte des 15. Jahrhunderts dauerhaft in den Apostolischen Palast gezogen sind und erst recht, seit Papst Pius X. Anfang des 20. Jahrhunderts die Papstwohnung in den dritten Stock verlegt hatte, übrigens weil dort die Räume bescheidener waren als in der Seconda Loggia, der traditionellen Papstwohnung, in der heute die Gäste zu Audienzen empfangen werden, lag den geistlichen Herrschern beim Blick aus dem Fenster die Stadt Rom zu Füßen. Der Blick reicht bei guter Sicht bis weit in die Albaner und Sabiner Berge, die im Osten die Eterna begrenzen. Schaut der Pontifex heute aus dem Fenster, sieht er den großen gepflasterten Vorplatz von Santa Marta, auf dem gelegentlich Wagen mit Gästen vorfahren, die Koffer aus- oder einladen, eine Tankstelle im linken Anschnitt seines Blickfeldes, rechts den etwas trist wirkenden Bau der Sakristei von Sankt Peter, und mit etwas Mühe kann er die mächtige Kuppel des Petersdoms erahnen, wenn er steil nach oben schaut. Das Papsttum scheint mit Franziskus ganz unten angekommen zu sein. Und doch scheint Jorge Mario Bergoglio gerade in dieser Katharsis das Papstamt zu neuer Stärke zu führen.
Unabhängig davon, wie die Verhältnisse unter Benedikt XVI. wirklich waren, das Appartamento steht für ein Papsttum, das von Seilschaften, Funktionären und Sekretären, Karrieristen und Höflingen geprägt ist, in dem der Papst bisweilen selbst nicht mehr Herr im eigenen Hause ist. So ist zumindest die öffentliche Wahrnehmung. Santa Marta wird als Gegenpol zum Ort eines entzauberten Papstamts, das allerdings zugleich wieder ganz auf den Papst konzentriert diesem neue Macht verleiht. Franziskus versucht das Höfische abzuschaffen. Seine Sekretäre tauchen nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Der Papst trägt seine Aktentasche sowie Mantel selbst und spaziert zu Fuß zu Terminen im Vatikan. Zum Zahnarzt geht er ebenfalls zu Fuß in die Praxis des Vatikanzahnarzts und nutzt nicht das eigens eingerichtete päpstliche Behandlungszimmer im Apostolischen Palast. Bei den Gottesdiensten im Petersdom hat er die Tradition abgeschafft, dass hinter dem Papst bei der feierlichen Prozession zum Ein- und Auszug immer noch der Päpstliche Almosenmeister, der Präfekt des Päpstlichen Hauses sowie der Leibarzt und der Privatsekretär mitlaufen.
Bei den Liturgien trägt er schlichte Gewänder und bietet so keinen Anlass zu Diskussionen über Äußerlichkeiten. Damit schafft er Raum, sich wieder auf Inhalte zu konzentrieren. Unter Benedikt XVI. waren bisweilen die Schlagzeilen eher dadurch bestimmt, welche historischen Gewänder er bei bestimmten Zeremonien wieder aus den Archiven des Vatikans hatte holen lassen, als durch seine Botschaften. Obwohl sich das Umfeld des Papstes über diese Berichterstattung ärgerte und der Grundgedanke hinter der Nutzung historischer Mitren, Bischofsstäben und dergleichen verständlich sein mag, nämlich äußerlich, bildhaft eine Kontinuität des Papstamts zu symbolisieren, ging der Plan nicht auf. Die Botschaft ging hinter den Äußerlichkeiten unter. Das ist bei Franziskus anders. Die Schlichtheit seines Auftretens bei Liturgien ist nach den ersten Wochen zur Normalität geworden. Wenn es Variationen gibt, drückt er damit eine Botschaft aus. So nutzte er bei seinem Besuch in Lampedusa einen Bischofsstab, der aus Holz von Flüchtlingsbooten gefertigt war.
Durch seine Amtsführung prägt Franziskus einen ganz bestimmten Stil und ein ganz bestimmtes Image der katholischen Kirche. Der Justizminister des Vatikans, Kardinal Francesco Coccopalmerio, ist überzeugt, dass Bergoglio im ersten Jahr seines Pontifikats das Verhältnis zwischen Papst und den Gläubigen revolutioniert hat durch eine Art Sakralität des Papstamts, die sich in einer besonderen Nähe zum Volk ausdrücke. Diese Haltung werde von denen kritisiert, die unter Sakralität etwas anderes verstehen, nämlich Distanz zum gemeinen Volk. Doch Bergoglio habe eine Haltung, die ihm die Menschen auf »außergewöhnliche und unerklärliche Weise« nahebringe. Zudem sei es selbstverständlich, dass es in Zentren der Macht Kritiker gebe, die mit den gegebenen Umständen nicht zufrieden seien.
Synodal oder autoritär?
Der Regierungsstil des Papstes
Ein Kardinalsrat berät den Papst. Externe Firmen prüfen die Bücher und die Verwaltung des Vatikans. Eine weltweite Umfrage zum Thema »Ehe und Familie« sorgt für Aufsehen und schürt bei einigen konservativen Katholiken die Angst, basisdemokratische Elemente könnten Einzug in die katholische Kirche halten. Papst Franziskus hat in den ersten Monaten seines Pontifikats viel Unruhe in die Weltkirche gebracht, weil er einen unorthodoxen Regierungsstil pflegt. Das ist zum Teil seiner Person geschuldet. Viele Neuerungen gehen aber auch auf das Konto der Kardinäle im Vorkonklave, die sich Veränderungen im Regierungsstil des Papstes sowie im Verhältnis der römischen Kurie zu den Ortskirchen gewünscht hatten. Die Unzufriedenheit gerade unter den Kardinälen aus der Weltkirche war groß. Franziskus hat die Kritik sowie die Wünsche ernst genommen und unmittelbar nach seiner Wahl mit der Umsetzung begonnen. Dabei lässt sich bei einem ersten groben Blick auf die Entwicklungen eine doppelte Richtung feststellen: Einerseits baut Franziskus das Element der Beratung in einer institutionalisierten Form aus. Zugleich sind die Entscheidungsprozesse und -wege stärker als vorher auf den Papst zugeschnitten. Franziskus achtet penibel darauf, dass sich neben ihm kein »zweiter« Papst, kein Nebenpapst, entwickelt, der Entscheidungen an sich zieht und Macht gewinnt, wie das in den letzten beiden Pontifikaten bei den Kardinalstaatssekretären Angelo Sodano und Tarcisio Bertone der Fall war. Wobei man auch da noch einmal unterscheiden muss: Es gab zumindest in der Ära von Johannes Paul II. eine Form des »Checks and Balances« im Vatikan dahingehend, dass dem mächtigen Kardinalstaatssekretär bisweilen der enge Papstvertraute und Chef der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, als Korrektiv gegenüberstand. Diese Rolle blieb in der Ära des Kardinalstaatssekretärs Bertone ab 2006 unbesetzt, was in einer zu großen Machtkonzentration in der Person Bertones endete und entscheidend zu den bekannten Fehlern, Skandalen und der Unzufriedenheit beitrug.
Bereits im Vorkonklave wurde deutlich: Der künftige Papst wird in der Amtsführung seine Entscheidungen auf eine breitere Basis stellen müssen. In den Generalkongregationen sowie bei den »privaten« Treffen der Kardinäle in den Tagen vor dem Konklave diskutierten die Purpurträger schon sehr konkrete Vorstellungen, wie dies umgesetzt werden könnte. Da stand zum einen die Forderung im Raum, ein »Kabinett« zu bilden, also ein regelmäßiges Treffen der Leiter der vatikanischen Behörden. Zum anderen äußerten viele Kardinäle den dringenden Wunsch, die Weltkirche stärker in Entscheidungen einzubinden. Was das Kabinett anbetrifft, wurden schon unter Benedikt XVI. immer wieder solche regelmäßigen Treffen der Kurienspitze gefordert. Allerdings hatte Joseph Ratzinger nur wenige Male alle seine Minister an einen Tisch geholt. Dabei wurde im Verlauf seines Pontifikats mehrfach deutlich, dass eine bessere Kooperation, Koordination und Kommunikation innerhalb der römischen Zentrale notwendig gewesen wäre. Selbst Benedikt XVI. musste einsehen, dass ihm so manche Krise erspart geblieben wäre. So hätte wohl bei einer besseren internen Abstimmung beispielsweise Anfang 2009 bei der Rücknahme der Exkommunikation der vier Bischöfe der traditionalistischen Piusbruderschaft der Skandal um den Holocaustleugner Richard Williamson vermieden werden können.