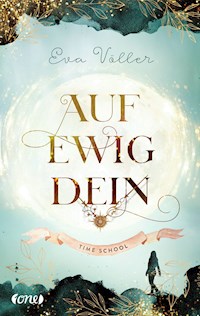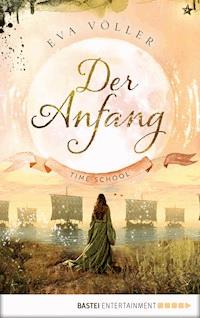9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Ruhrpott-Saga
- Sprache: Deutsch
Essen 1951: Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge Katharina Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes gefunden. Aber das Zusammenleben mit der barschen, zupackenden Schwiegermutter auf engstem Raum fällt der lebenshungrigen Frau schwer. Sie will ein besseres Leben für sich und ihre Töchter. Mit trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem ärmlichen Umfeld zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten Kriegsheimkehrer Johannes ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungTEIL 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7TEIL 2Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14TEIL 3Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21TEIL 4Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27NachwortBergbau- und RuhrplattglossarÜber dieses Buch
Essen 1951: Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge Katharina Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes gefunden. Aber das Zusammenleben mit der barschen, zupackenden Schwiegermutter auf engem Raum fällt der lebenshungrigen Frau schwer. Sie will ein besseres Leben für sich und ihre beiden Töchter. Mit trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem ärmlichen Umfeld zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten Kriegsheimkehrer Johannes …
Über die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.«
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
E V A V Ö L L E R
EinTraumvom Glück
L Ü B B E
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Daboost |
Andrius_Saz | Vyntage Visuals | tenkl | Jose Angel Astor Rocha
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7857-2670-9
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für meinen Vater und all meine anderen Altvorderen, die nie wirklich gegangen sind
T E I L 1
Kapitel 1
Katharina zuckte zusammen, als die Türklingel durchs Haus schrillte. Ihre Hand mit der Stecknadel rutschte von dem glatten Stoff ab.
»Verdellich«1, sagte ihre Nachbarin Elfriede, die vor ihr auf dem Schemel stand. »Jetzt hasse mich gestochen.«
»Tut mir leid.«
»Et hat geschellt«, sagte Elfriede überflüssigerweise. »Wahrscheinlich der Kohlenkerl, der wollte heute noch kommen«, erwiderte Katharina, ihr Gewicht auf den Knien verlagernd, während sie die nächste Stecknadel zwischen den Zähnen hervorzog und in den Stoff schob.
»Is euer Deputat schon widder alle? Ihr stocht aber auch auf Deubel komm raus.« Elfriede wies mit dem Kinn auf den bullernden Ofen in der Ecke.
»Ich hab’s gern warm«, sagte Katharina lapidar. »Und die Kinder auch.«
»Wo kann ich mich denn eigentlich im Spiegel bekucken?«, wollte Elfriede wissen.
»Bei mir im Schlafzimmer. Aber damit warten wir noch, bis das Kleid fertig ist.«
Elfriede deutete auf die Constanze, die aufgeschlagen auf dem Tisch neben ihr lag. »Et sieht dann aber wirklich so aus wie auf dem Bild da, oder nich?«
»Hast du ein enges Mieder?«
»Soll dat heißen, ich bin für dat Kleid zu dick umme Mitte?«
»Nicht, wenn ich es nähe«, sagte Katharina.
Sie heftete weiter den Kleidersaum ab, der ihr vor der Nase hing, umweht von Elfriedes strengem Körpergeruch. Viel länger würde sie das nicht aushalten können. Sie wollte endlich fertig werden.
Es klingelte erneut. Unten machte niemand auf, vermutlich war ihre Schwiegermutter Mine noch in der Waschküche oder im Hühnerstall beschäftigt. Und Inge war noch nicht aus der Bücherei zurück. Über die Schulter rief sie: »Bärbel, geh mal eben runter und mach die Tür auf! Sag dem Kohlenkerl, ich komme gleich! Und wehe, er kippt die Kohle wieder so nah bei der Haustür ab!«
»Aber ich hab doch Stubenarrest!«, ertönte die helle Stimme ihrer neunjährigen Tochter aus dem Nebenzimmer.
»Der ist für zwei Minuten unterbrochen.«
Nebenan fiel ein Stuhl um, und Katharinas Tochter kam aus dem benachbarten Raum geschossen. In einem Wirbel fliegender blonder Zöpfe, schief sitzender Kleidungsstücke und dünner Beine umrundete sie mit waghalsigem Schwung den Schemel, auf dem die Nachbarin zur Anprobe stand, bevor sie in großen Sätzen die Treppe hinuntersprang. Deutlich war zu hören, dass sie immer zwei Stufen auf einmal nahm und den Rest auf dem Geländer hinabrutschte.
»Dat Bärbel bricht sich noch den Hals«, kommentierte Elfriede.
»Das ist noch gar nichts«, sagte Katharina. »Du solltest mal sehen, wie sie auf Bäume klettert.«
»Dat Blach gehört öfters verschwatt, dann würd et dat schon sein lassen. Kricht dat überhaupt ma Senge?«
»Nein«, sagte Katharina.
»Ein Fehler«, erklärte Elfriede bestimmt. »Willsse wissen, wie ich dat bei meine Blagen mach?«
»Hm«, gab Katharina unbestimmt zurück. Elfriede Rabes Erziehungsmethoden waren kein Geheimnis. Nebenan verging kein einziger Tag ohne elterliche Züchtigung, unschwer zu erkennen am durchdringenden Geheul der drei Rabe-Sprösslinge.
»Dreh dich mal ein Stück im Uhrzeigersinn, Elfriede. Nein, nicht zum Ofen hin. Andersrum.«
»Aber die Uhr hängt überm Ofen.« Ein Hauch von Ärger klang aus Elfriedes Stimme. »Dauert et noch lange? Ich muss noch wat für dem Fritz sein Henkelmann morgen kochen.«
»Ich hab’s gleich. Wenn wir fertig sind, gibt es ein Gläschen Persiko, was hältst du davon?«
»Da sach ich nich Nein, dat weiße doch.«
»Mama, es ist überhaupt nicht der Kohlenkerl!«, rief Bärbel von unten.
»Wer denn dann?«
»Ein ganz armer Mann! Ich glaube, er ist ein Bettler! Er sieht schrecklich hungrig aus!«
»Wir geben nichts! Sag ihm das! Und mach die Haustür wieder zu!«
»Er sagt, er heißt Johannes und will zu Oma.«
»Noch en Mieter?«, erkundigte sich Elfriede mit scheinheiligem Mitleid. »Habt ihr dat wirklich so nötig? Aber da hasse wohl leider nix mitzureden, oder? Is ja der Ollen ihr Haus. Da kannsse wahrscheinlich froh sein, wenne die Kerle nich noch hier oben bei dir reingesetzt kriss.« Elfriede hielt inne und blickte sich suchend in der beengten Stube um. »Wo hasse denn den Persiko? Ich könnte getz schon en Schlücksken vertragen.«
Katharina widerstand dem Drang, die Nachbarin vom Schemel zu schubsen. Sie bekam Geld für das Kleid und konnte es sich nicht leisten, darauf zu verzichten. Elfriede war die schlimmste Klatschbase der ganzen Nachbarschaft, aber sie kannte Gott und die Welt und empfahl Katharina regelmäßig weiter. Sie war das, was Karl immer als wichtigen Multiplikator bezeichnet hatte – eine zufriedene Kundin.
»Sag dem Mann, er soll in einer halben Stunde noch mal vorbeischauen!«, rief Katharina in Richtung Treppe. Bis dahin war Mine sicher fertig mit dem, was sie gerade tat. Es wurde schon dunkel.
»Er sagt, du sollst mal bitte runterkommen, Mama«, rief Bärbel.
Katharina steckte die letzte Nadel in den Saum und richtete sich auf. »Warte kurz, Elfriede. Ich bin gleich zurück.«
Sie eilte nach unten. Die ausgetretenen Stufen knarrten unter ihren Füßen. Der Durchzug wehte eiskalte Luft herein. Bärbel stand unten im Flur und beäugte neugierig den Fremden, der draußen vor der Tür stand. Katharina schob die Kleine zur Seite und zog die Haustür bis auf einen handbreiten Spalt zu.
»Was wollen Sie?«, fragte sie den Mann durch die schmale Öffnung hindurch.
Der Fremde, ein hoch aufgeschossener, magerer Mensch in schlichter Kleidung, blies sich in die vor Kälte rot angelaufenen Hände, ehe er die Mütze vom Kopf zog und einen knochigen, bis auf kurze Stoppeln kahl geschorenen Schädel entblößte. Er verneigte sich vor ihr. »Guten Tag. Mein Name ist Johannes Schlüter. Ich bin aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt und möchte zu Frau Wilhelmine Wagner.« Atemwolken verschleierten sein hohlwangiges Gesicht, während er zu weiteren Erklärungen ansetzte.
»Auch dat noch, ein Spätheimkehrer«, unterbrach ihn Elfriede, die soeben von Neugier getrieben die Treppe herunterkam. »Da musse aufpassen, Käthe. Die klauen, watse inne Finger kriegen.« Missbilligend schüttelte sie den Kopf. »Die sind schlimmer wie die Polacken.« Argwöhnisch betrachtete sie den Mann. Dann trat sie entschlossen einen Schritt vor und schlug ihm die Tür vor der Nase zu. »So wat will dat Mine ganz bestimmt nich im Haus«, verkündete sie. »Et gibt genuch andere anständige Kumpels, die gerne inne Nähe vonne Zeche wohnen wollen.«
Hinter ihr ging die Tür zur Kellertreppe auf, und Mine trat in den Flur. Ihre dürre kleine Gestalt verschwand fast unter der verblichenen Kittelschürze und der Strickjacke, die sie darüber trug. Unter dem Arm hatte sie einen Korb mit Eiern.
»Da war ein Mann, der wollte zu dir, Oma«, erklärte Bärbel. »Ein Spätheimkehrer aus Russland. Mama, wieso sind die schlimmer wie die Polacken?«
»Als die Polacken«, korrigierte Katharina ihre Tochter. »Außerdem will ich nicht, dass du das Wort benutzt, das hab ich dir schon oft genug gesagt.« Elfriedes Schnauben ignorierte sie kurzerhand. »Sein Name ist Johannes Schlüter«, teilte sie ihrer Schwiegermutter mit. »Kennst du jemanden, der so heißt?«
Ihre Worte hatten eine unerwartete Wirkung auf Mine. Deren gerade noch rosig durchblutetes Gesicht wurde von einem Moment auf den anderen so fahl wie ihr strohiges Haar. Sie taumelte einen Schritt rückwärts, und bei dem Versuch, sich an der Wand abzustützen, ließ sie den Korb mit den Eiern fallen.
»Watt denn!«, sagte Elfriede mit ungläubig gedehnter Stimme. »Hasse gerade Johannes Schlüter gesacht, Käthe? Dat is doch der Jung vonne Mathilde!« Zusammenhanglos schloss sie: »Von die kaputten Eier kannsse noch Suppenstich machen, Mine.«
Mine verschwand kurz in der Küche und kam mit einem tiefen Teller zurück. Sie klaubte die zerbrochenen Eier vom Boden auf, indem sie alles mit den bloßen Händen in den Teller schaufelte. In ihrem Gesicht arbeitete es.
Mathilde … Es dauerte ein paar Augenblicke, bis bei Katharina der Groschen gefallen war. Mathilde war ihre Schwägerin gewesen, die ältere Schwester von ihrem Mann Karl. Mines einzige Tochter. Sie hatte einen Lehrer geheiratet und war von Essen weggezogen, ins Niedersächsische. Irgendwann war sie krank geworden und gestorben. Wie lange mochte das her sein? Zwanzig Jahre? Oder noch länger? Katharina konnte sich nicht erinnern. Sie hatte ihre Schwägerin Mathilde nie kennengelernt, nur ein paar Fotos gesehen. Als sie mit Karl zusammenkam und ihn schließlich heiratete, hatte seine Schwester schon nicht mehr gelebt. Aber Katharina entsann sich, dass Karl ihren Sohn erwähnt hatte – seinen Neffen Johannes.
Elfriede hatte gerade eben Mines Enkel ausgesperrt!
In diesem Moment klingelte es erneut an der Haustür, und eilig machte Katharina sie auf. Doch diesmal hatte wirklich der Kohlenlieferant geklingelt. Johannes Schlüter stand ebenfalls noch draußen, aber er hatte sich auf die Straße zurückgezogen, ein langer, dunkler Schatten in der verschneiten Umgebung. Katharina gab ihm durch ein kurzes Winken zu verstehen, dass er zurückkommen solle.
Der Pritschenwagen mit der Kohle stand tuckernd vorm Haus, und die Ladefläche hob sich bereits ächzend zur Schräge. Die Eierkohlen kollerten mit ohrenbetäubendem Gepolter bis vors Kellerloch. Katharina entwich ein zorniger Aufschrei, als einige versprengte Stücke in den Hausflur flogen. Erst am Morgen hatte sie das Linoleum ausgiebig gewischt und auf Hochglanz gebohnert. Nicht etwa, weil sie es gern tat (sie hasste es wie die Pest!), aber ein reinliches Ambiente war gut fürs Geschäft. Sie hatte im Laufe des Nachmittags zwei neue Kundinnen empfangen und bei beiden für Frühjahrskleider Maß genommen. Allein für diese Aufträge hatte sich das Wienern und Polieren gelohnt.
Doch meist war das Putzen ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Wenn der Wind ungünstig stand, wurde der Kohlenstaub hereingeblasen, sobald die Fenster zum Lüften offen standen. Er verteilte sich überall im Haus, wenn die beiden Grubenarbeiter am Wochenende ihr schmutzstarrendes Zeug zum Waschen mitbrachten oder sich auf der Fußmatte die Schuhe abtraten. An besonders schlimmen Tagen überzog der Staub sogar das Gemüse in den Beeten und die Wäsche auf der Leine mit dunklen Schlieren.
Katharina hatte sich in stummem Grimm gebückt, um die Kohlestücke aufzuheben und wieder nach draußen zu werfen. Statt mitzuhelfen, rannte Bärbel in Hausschuhen hinaus und beobachtete unter begeisterten Kommentaren die Entladung der Kohle.
Katharina schrak zusammen, als neben ihr Karls Neffe auftauchte. Kurz sah sie seine rettungslos verdreckten Stiefel, dann ging er neben ihr in die Hocke und half ihr beim Aufklauben der restlichen Kohle. Nur der Staub blieb am Boden haften, durchfeuchtet von dem Schnee, den der Wind hereingetrieben hatte.
»Danke«, sagte sie, während sie sich unvermittelt Auge in Auge mit ihm wiederfand. Sie richteten sich beide gleichzeitig auf. Er nahm abermals die Mütze ab und verneigte sich, als hätte das eine Mal vorhin nicht gereicht. Katharina musste gegen den Impuls ankämpfen, sich von ihm abzuwenden, denn er sah schrecklich aus. Das kurz geschorene Haar betonte seine totenkopfähnlichen Züge. Die Nase stand scharf in dem ausgemergelten Gesicht, die Augen lagen in tief eingesunkenen Höhlen.
»Tach, Jung«, sagte Mine. Sie stand immer noch an derselben Stelle. Ihre Stimme klang brüchig und ungewohnt zittrig.
»Guten Abend, Großmutter«, antwortete Johannes. Katharina registrierte seinen ausgesucht höflichen Ton und sein geschliffenes Hochdeutsch. Kein Hauch von Ruhrpottplatt. Angestrengt versuchte sie sich zu erinnern, was Karl ihr sonst noch über ihn erzählt hatte, aber es war zu lange her.
»Zieh dir was Warmes an!«, befahl sie ihrer Tochter. »Und dann wird geholfen!«
Bärbel rannte die Treppe hoch. Kohlenstaub wehte von ihren Pantoffeln, und Katharina seufzte ergeben.
»Da kommsse gerade richtig zum Scheppen«, sagte Mine zu Johannes. Ihre Stimme klang jetzt wieder so gleichmütig und beherrscht wie immer. »Die Schippe is unten im Kohlenkeller. Da hängt auch en Kittel, den kannsse drüberziehn.«
»Guten Abend«, sagte Katharina bemüht freundlich zu Johannes, während sie ihm die Hand reichte. »Es tut mir leid, dass der Empfang vorhin so unhöflich ausgefallen ist. Ich bin Katharina, die Frau von deinem Onkel Karl. Die Kleine von eben ist meine Tochter Bärbel. Wir sind aus Berlin und wohnen seit Kriegsende hier.«
Johannes räusperte sich. Er erwiderte ihren Händedruck und machte abermals einen Diener. »Angenehm.«
»Ich bin die Nachbarin«, sagte Elfriede. »Elfriede Rabe. Kennsse mich noch?«
»Nein«, erwiderte Johannes höflich. »Ich war nur ein einziges Mal hier.«
»Nä, dat is nich wahr«, widersprach Elfriede, während sie den Neuankömmling mit unverhohlener Neugier musterte. »Alsse noch klein wars, kam dat Mathilde öfters mit dich vorbei. Ohne dein Vatter, dem gefiel dat hier nich. Als dat Mathilde dann tot war, warsse nur noch einmal hier bei deine Omma, dann nich mehr.«
»Ich kann mich leider nur an meinen letzten Besuch hier erinnern«, sagte Johannes.
Elfriede zuckte mit den Schultern. »Wat is denn getz mit dem Persiko?«, fragte sie Katharina.
Katharina reagierte nicht darauf, sie war schon halb auf dem Weg nach oben, um sich fürs Kohleschippen umzuziehen. Je mehr Leute mithalfen, desto schneller war die Arbeit erledigt. Eine unerklärliche innere Abwehr hielt sie davon ab, sich länger mit Karls Neffen zu unterhalten. Etwas an ihm verstörte sie, und es dauerte eine Weile, bis sie dahinterkam, was es war: Er glich ihrem Mann. Karl wies ganz ähnliche Gesichtszüge auf – die klare Stirn, das kantige Kinn, die kühn vorspringende Nase, die dichten Brauen. Auch ihr Schwiegervater Jupp hatte so ausgesehen, jedenfalls auf den alten Fotos. Wäre Johannes nicht derart abgemagert gewesen, hätte Katharina die Familienähnlichkeit auf den ersten Blick erkannt.
Karl. Sie hatte sein Gesicht vor Augen, während sie sich oben in ihrer Schlafkammer einen Pullover überstreifte und die Schürze umband, die sie immer zur Gartenarbeit trug, bevor sie, angetan mit uralten Stiefeln und Fäustlingen, wieder nach unten ging.
Johannes hatte sich bereits Jupps alten Bergmannskittel angezogen und schwang die Schaufel, um die Kohlen über die Rutsche durchs Kellerloch abwärts zu befördern. Er arbeitete schweigend und schnell. Mine war in den Keller gegangen, um den neuen Kohlevorrat dort gleichmäßig zu verteilen und aufzuschichten.
Bärbel sprang um Johannes herum und sammelte weggerollte Stücke auf, die sie zurück auf den großen Haufen warf. Katharina holte sich ebenfalls eine Schaufel aus dem Keller und schippte fleißig mit.
Unterdessen kam ihre fünfzehnjährige Tochter Inge von der Bücherei nach Hause.
»Du musst auch mithelfen, Inge!«, rief Bärbel ihrer großen Schwester schadenfroh entgegen.
Inge verdrehte die Augen, doch sie fügte sich in ihr Schicksal. Wenn die Kohle vor dem Haus lag, mussten alle anpacken, ganz egal, wie spät es war. Es kam nicht infrage, den Vorrat über Nacht draußen zu lassen – bis zum nächsten Morgen hätten Langfinger alles geklaut.
Ohne auf Johannes zu achten, eilte Inge ins Haus, um sich ebenfalls für die Arbeit umzuziehen.
Katharina konnte nicht umhin, Johannes’ effiziente Arbeitsweise zu bewundern. Seine geschwächte Konstitution war ihm kaum anzumerken. Er schaufelte die Kohle, als hätte er jahrelang nichts anderes gemacht.
Vielleicht hat er das ja tatsächlich nicht, schoss es ihr durch den Kopf. Es war bekannt, dass die russischen Kriegsgefangenen wie die Sklaven schuften und die niedersten Arbeiten verrichten mussten. Seit dem Ende des Krieges waren nach und nach Hunderttausende ehemalige Wehrmachtssoldaten aus Russland heimgekehrt, und wie man hörte, hatten die meisten grauenhafte Geschichten zu erzählen. Auch über die vielen Namenlosen, die in Wahrheit nicht vermisst, sondern längst tot waren. Erfroren, verhungert, umgebracht, an Krankheiten gestorben, während ihre Familien immer noch auf ein Lebenszeichen warteten.
Die meisten Heimkehrer hatten vor dem Rücktransport mit ihren Angehörigen in Briefkontakt gestanden. Das war für die Menschen zu Hause ein Grund gewesen, auf ein Wiedersehen zu hoffen. Doch auch die anderen Familien, die nie eine Antwort auf ihre Suchmeldung erhalten hatten, hegten diese Hoffnung. Denn es gab wohl auch Lager, aus denen keine Nachrichten verschickt werden durften, nicht einmal die armseligen Rotkreuz-Karten, die konfisziert wurden, wenn sie mehr als ein Dutzend Wörter enthielten. Diese besonderen Lager mussten Orte sein, die schlimmer waren als die Hölle. Das, was Katharina bisher darüber gehört hatte, war zu entsetzlich, um genauer darüber nachzudenken.
Deshalb konnte und wollte sie nicht mehr daran glauben, dass Karl noch lebte. Sie hatte sich schon vor Jahren mit seinem Tod abgefunden und sich damit zu trösten versucht, dass er nun wenigstens alles überstanden hatte.
Ganz im Gegensatz zu Mine, die die Hoffnung niemals aufgeben würde, dass ihr einziger Sohn doch noch zurückkam. Auch nach all den Jahren zündete sie jeden Sonntag in der Kirche eine Kerze für seine Rückkehr an.
Seit Johannes’ Ankunft hatte ihre Schwiegermutter nicht viel von ihren Gefühlen offenbart, doch Katharina ahnte, was Mine beim Anblick ihres Enkels umtrieb: Wenn es möglich war, dass der Junge nach dieser langen Zeit noch nach Hause kommen konnte, dann konnte Karl es auch. Ganz bestimmt, eines Tages. Mine konnte nichts anderes glauben, denn Karl war ihr Sohn.
Katharina kam ein Spruch in den Sinn, den sie vor vielen Jahren einmal gehört hatte, über den Unterschied, einen Mann oder ein Kind zu verlieren. Ein Mann geht von der Seite, ein Kind vom Herzen. Seit sie selbst Mutter war und ihren Mann verloren hatte, wusste Katharina, dass es stimmte.
Es war schwer gewesen, Karl loszulassen, aber sie hatte es geschafft. Wäre es um eins ihrer Kinder gegangen – niemals hätte sie die Hoffnung aufgegeben, nicht bis ans Ende ihrer Tage.
*
Inge kam wieder nach draußen, ohne Schaufel, denn im Haus gab es nur zwei. Sie hatte stattdessen die Kohlenschütte aus dem Keller geholt und sammelte herumliegende Brocken ein, um dann mit Schwung eine größere Ladung aus der Schütte in den Schacht zu kippen.
Wie Katharina hatte sie alte Schuhe und einen verschlissenen Pulli angezogen und zusätzlich eine Schürze vorgebunden. Ein verdrossener Ausdruck stand auf ihrem hübschen jungen Gesicht, und Katharina fühlte sich bei dem Anblick unwillkürlich an Leo erinnert, Inges leiblichen Vater. Sie dachte kaum noch an ihn, aber manchmal, wenn Inge auf bestimmte Weise das Gesicht verzog, stellten sich Erinnerungen ein. Auch Leo hatte, wenn seine Laune sank, häufig diese Miene aufgesetzt – eine Mischung aus Langeweile, Widerwillen und Ärger. Zu Beginn ihrer Bekanntschaft hatte Katharina selten diesen frustrierten Gesichtsausdruck bei ihm gesehen, dafür gegen Ende umso häufiger. Ihre Beziehung mit Leo war der größte Fehler ihres Lebens gewesen, so viel stand fest. Abgesehen natürlich davon, dass daraus ihre Tochter entstanden war, weshalb Katharina auch selten um Leos willen mit dem Schicksal haderte. Zudem hatte Inge von Anfang an einen Vater gehabt, der diesen Namen verdiente: Karl hatte all das, was Leo versäumt und verweigert hatte, mehr als wettgemacht.
Katharina fiel auf, dass Inge scheue Seitenblicke in Johannes’ Richtung sandte. Inzwischen hatte sie ihn bemerkt und fragte sich sicher, wer dieser fremde Mann war und warum er ihnen beim Kohleschippen half.
»Das ist übrigens Johannes Schlüter«, erklärte Katharina, ein wenig betreten wegen ihrer wiederholten Nachlässigkeit. Johannes war ein Mitglied der Familie, und es gehörte sich, ihn allen ordentlich vorzustellen. »Er ist Papas Neffe. Johannes ist heute Abend aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und besucht Oma Mine. Johannes, das ist meine Tochter Ingrid, genannt Inge.«
Johannes streckte Inge die Hand hin. »Sehr erfreut.«
Inge ließ die Kohlenschütte sinken und nahm die dargebotene Hand. »Entschuldigung«, sagte sie mit verlegener Stimme. »Ich dachte, Sie … ähm, du gehörst zum Kohlenkerl. Äh, zum Kohlenlieferanten.«
»Als hätt der faule Sack schomma beim Scheppen geholfen«, meldete sich Elfriede abfällig aus dem Hintergrund. Mittlerweile hatten sich weitere Nachbarn vor dem Haus eingefunden, offenbar hatte Johannes’ Ankunft sich herumgesprochen. Katharinas Freundin Hanna und deren Bruder Stan schauten ebenfalls vorbei und begrüßten den Neuankömmling.
»Stan Kowalski«, stellte sich Stan vor. Er lächelte Johannes freundlich an. »Eigentlich Stanislaus, aber darauf höre ich schon lange nicht mehr. Seit fast fünfundzwanzig Jahren im Lande und damals gleich mit vierzehn auf der Zeche Pörtingsiepen angelegt.« Ein mitfühlender Ausdruck trat auf sein Gesicht. »War bestimmt nicht leicht in Russland, oder?«
Johannes hob nur stumm die Schultern, ohne mit dem Kohleschippen aufzuhören.
»Stan ist Steiger auf der Zeche«, erklärte Katharina. Wie immer spürte sie Stans Blicke auf sich – nicht ansatzweise aufdringlich oder lästig, aber dennoch wünschte sie sich, er hätte sie auf andere Weise ansehen können. Wie ein Freund, ohne Hintergedanken. Sie mochte und schätzte Stan aufrichtig, doch sie wusste auch, dass er sich immer noch Hoffnungen machte, die zu nichts führten. Nicht nur, weil sie eine verheiratete Frau war, sondern weil sie das, was er fühlte, nicht teilen konnte.
An ihm lag es bestimmt nicht. Er war ein ansehnlicher, großherziger, liebenswerter Bursche Ende dreißig, er verdiente weit besser als die meisten anderen Männer, die sie kannte, und vor allen Dingen war er ledig. Die Frauen liefen ihm in Scharen hinterher, er hätte zehn an jedem Finger haben können. Junggesellen, die all das von sich sagen konnten, waren in diesen Zeiten dünn gesät. Doch sein Interesse galt allein Katharina, die wiederum nicht recht wusste, wie sie ihm ein für alle Mal beibringen sollte, dass aus ihnen beiden nichts werden konnte.
»Eigentlich müssen wir diese Heimkehr feiern«, meinte Stans Schwester Hanna. »Noch einer, der überlebt hat.« Ihre melodiöse Stimme hob sich überdeutlich von dem hier allseits gebräuchlichen Platt ab, und wie üblich wurde sie von den anderen Anwohnern mit Missfallen beäugt. Hanna Morgenstern war jemand, der eigentlich gar nicht hätte da sein dürfen, eine von den wenigen Entkommenen, die im deutschen Alltag noch präsent waren. Sie war Polin, Witwe eines Juden, früheres Mitglied der französischen Résistance. Sie hatte nicht nur überlebt, sondern anschließend auch die Stirn besessen, herzukommen und den Leuten durch ihre bloße Anwesenheit zu demonstrieren, dass sie nicht in jenem dunklen Abgrund verschwunden war, in den so viele Deutsche sie nur zu gern hätten fallen sehen.
Über die Jahre hinweg war es Katharina nicht verborgen geblieben, wie die Nachbarschaft über Hanna dachte.
Den meisten gefiel es nicht, auf diese Weise mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden, nachdem doch in den letzten Jahren alles, was sich nicht vergessen ließ, erfolgreich geglättet, bagatellisiert und entnazifiziert worden war. Und so schlecht konnte es den Juden und Polacken ja wohl nicht gegangen sein, wenn eine von denen hier durch die Straße spazierte, angezogen und geschminkt wie Marlene Dietrich, auf hohen Hacken und mit einer Zigarette in einer silbernen Spitze.
Hannas Bruder Stan hatte im Gegensatz zu seiner jüngeren Schwester dauerhaft Wurzeln im Pütt geschlagen. Bereits zu Zeiten der Weimarer Republik war er im Ruhrgebiet ansässig geworden, gemeinsam mit seinem Onkel, ebenfalls ein Bergmann, der damals eine Deutsche geheiratet hatte. Die beiden hatten keine Kinder gehabt und daher Stan nach Kräften gefördert. Mit viel Fleiß und Ehrgeiz hatte er sich weitergebildet und es zum Steiger gebracht. Er war ein angesehener Kumpel und wurde von allen respektiert. Für die Leute war er zwar weiterhin der Polacke, aber das war inzwischen nur noch ein launiger Spitzname, von der Art, wie fast jeder hier einen hatte.
Ganz anders das höhnische Madame, das die Leute sich für Hanna ausgedacht hatten. Katharina hätte ausspeien können, als sie auf den Gesichtern der reihum versammelten Anwohner dieselbe dumpfe Ablehnung wahrnahm, die ihr damals bei ihrer eigenen Ankunft vor fast sechs Jahren zuteilgeworden war. Seinerzeit hatte sie ebenfalls ihren Spitznamen verpasst bekommen – die Schickse. Ursprünglich ein jiddisches Schimpfwort für nichtjüdische Frauen, hatte sich der Ausdruck im Ruhrgebiet als Bezeichnung für leichtlebige, verruchte Frauen etabliert. In den Augen der Leute war sie anscheinend eine wandelnde Versuchung für alle Männer, darauf aus, sich jeden zu angeln, der nicht schnell genug weglaufen konnte.
Rückblickend ließ sich nicht ergründen, wer von den Nachbarn damit angefangen hatte, sie so zu nennen. Es hätte theoretisch jeder sein können. Die Nachbarin Elfriede oder deren Mann Fritz. Witwe Krause drei Häuser weiter. Die Czervinskis aus dem Haus an der Ecke. Die Möllers von schräg gegenüber mit ihrem verfetteten Mops. Herr Brüggemann mit der Augenklappe, seines Zeichens ehemaliger Blockwart.
Katharina erinnerte sich an die scheelen Blicke und das Getuschel, dessen Inhalt kein Geheimnis war, denn oft wurden solche Unterhaltungen in Hörweite geführt. Lippenstift und Dauerwelle und Nylonstrümpfe, ja, dat kann die Schickse aus Berlin! Und sich dann mit zwei Blagen bei de arme alte Omma einnisten.
»Wir feiern lieber ein andermal«, sagte sie entschuldigend zu Hanna. Und dann schaufelte sie weiter die Kohlen ins Kellerloch, ohne noch einmal aufzublicken.
Kapitel 2
Nach der Arbeit wartete Johannes, bis Katharina und die beiden Mädchen wieder ins Haus gegangen und nach oben verschwunden waren.
Dann erst versuchte er, sich im Flur die Stiefel auszuziehen. Doch sosehr er auch daran zog und zerrte – er bekam sie nicht von den Füßen.
»Lasse an und komm erst ma rein«, sagte Mine zu ihrem Enkel. Sie ging voraus in die Küche und befahl ihm, sich dort an den Tisch zu setzen.
Johannes legte den Kittel ab. Den Mantel hatte er bereits vor dem Kohleschaufeln ausgezogen und an der Garderobe im Flur aufgehängt. Die Sachen, die er darunter trug, waren abgetragen, wirkten aber nicht zerlumpt – ein grob gestrickter Pullover, dazu eine an den Knien geflickte Hose aus dickem Stoff. Unter dem Stuhl, auf dem er saß, hatte er seinen Rucksack deponiert. Viel schien nicht darin zu sein, er lag schlaff zusammengefallen auf dem Fußboden.
Mine hängte den verdreckten Kittel an einen Türhaken und wandte sich dann wortlos dem Herd zu. Sie brachte das Feuer in Gang und stellte die große gusseiserne Pfanne auf die Kochplatte, dann schnitt sie mit geübten Bewegungen geräucherten Speck klein und ließ ihn aus. Während er in der Pfanne vor sich hin schmurgelte, schälte sie ein halbes Dutzend große Kartoffeln und hobelte sie in dünne Scheiben, die zum Speck in die Pfanne kamen. Auf dieselbe Weise verfuhr sie mit zwei dicken Zwiebeln. Sie wendete alles sorgfältig, gab Salz dazu und ließ es anschließend unter gelegentlichem Umrühren auf kleiner Flamme braten. Im großen Topf daneben erhitzte sie Wasser. Die ganze Zeit drehte sie sich nicht zu ihrem Enkel um und sprach kein einziges Wort. Er selbst schwieg ebenfalls.
Irgendwann fragte sie schließlich: »Hasse Läuse?«
»Momentan nicht«, antwortete er. »In meinen Sachen auch nicht. Wir haben vor dem Rücktransport noch saubere Kleidung bekommen.«
Die Küchentür öffnete sich knarrend, und Bärbel kam hereingehüpft. »Ich hab’s gerochen«, sagte die Kleine mit einem Kichern. »Bräterkes! Krieg ich auch welche, Oma?«
Mine deutete mit dem Kinn zum Tisch. Bärbel setzte sich und begann sofort ohne jede Scheu eine Unterhaltung mit Johannes.
»Wie lange warst du in Russland gefangen?«
»Fast sechs Jahre.«
»Mein Vater war auch Soldat. Er ist vermisst. Kennst du ihn?«
»Er ist mein Onkel. Ich bin ihm vor langer Zeit einmal begegnet, als ich hier zu Besuch war.«
»Hast du ihn auch in Russland getroffen?«
Mine hielt jäh die Luft an, doch die Antwort fiel wie erwartet aus.
»Leider nicht.«
»Warum warst du in Gefangenschaft?«
»Weil ich bei der Wehrmacht war.«
»Das war mein Vater auch. Vielleicht ist er auch in Gefangenschaft gekommen.«
»Ja, vielleicht. Es gibt immer noch sehr viele Kriegsgefangene in Russland.«
»Warum durftest du nach Hause und die anderen nicht?«
»Das weiß ich nicht. Man hat es uns nicht gesagt. Mir nicht, und den Übrigen auch nicht.«
An dieser Stelle geriet das Gespräch ins Stocken.
»Deck den Tisch«, sagte Mine zu Bärbel, während sie die Schalen aus den zerbrochenen Eiern pickte. Sie kippte die zerlaufene Masse über die Bratkartoffeln und rührte ein paarmal um, dann legte sie einen Untersetzer auf den Tisch und stellte die heiße, dampfende Pfanne darauf. Bärbel hatte drei Teller vom Wandbord genommen und auf dem Tisch verteilt, auf derselben alten Wachstuchdecke, die bereits bei Johannes’ letztem Besuch dort gelegen hatte. Mine entsann sich, wie der stille, verlegene Junge, der damals ungefähr so alt gewesen war wie Bärbel jetzt, mit dem Fingernagel ein paar Rillen hineingedrückt hatte. Auch die hatten sich über die Jahre erhalten. Anscheinend erinnerte er sich ebenfalls daran, denn er fuhr mit den Fingerspitzen darüber, als würde er einer verlorenen Fährte nachspüren.
Mine entging nicht, wie sehr seine Hände zitterten. Wie stark sein Körper sich angespannt hatte, wie seine Nasenflügel bebten, als der Duft des Essens ihm entgegenwehte. Es kostete ihn sichtlich Beherrschung, ruhig sitzen zu bleiben, und sie wusste warum.
Der Hunger war ihr ein vertrauter Begleiter gewesen, sie hatte ihn mehr als einmal nur knapp überlebt. Im Steckrübenwinter 1916/17 hatte es Tage gegeben, an denen sie vor Entkräftung nicht mehr hatte aufstehen können, weil sie alles, was es noch zu beißen gab, ihren Kindern überlassen hatte. Zwei ihrer Schwestern waren damals verhungert, und die anderen in der Familie, die in jenem Winter dem Tod von der Schippe gesprungen waren, hatten auch nicht mehr lange gelebt. Zwei weitere Schwestern und der Vater waren im Folgejahr an der Spanischen Grippe gestorben, zwei Brüder im Schützengraben an Chlorgas zugrunde gegangen.
Doch sie selbst lebte noch und häufte ihren Enkelkindern nun Bratkartoffeln auf die Teller. Ein paar Essiggurken packte sie als Dreingabe daneben. Das Kind bekam eine kleine Portion, der hungernde Mann den Rest, und sie legte noch die Gabeln dazu, die Bärbel vergessen hatte. Sie selbst aß nichts. Ein Stück Brot mit Gurke würde ihr später reichen.
Sie stand auf und machte sich wieder am Herd zu schaffen, denn sie wollte den Jungen nicht beim Essen beobachten, weil es ihm den Genuss daran verdorben hätte. Auch ohne hinzusehen wusste sie, dass er die Mahlzeit auf eine bestimmte Weise verzehrte. Die meisten lange hungernden Menschen aßen so, wenn ihnen eine Speise gereicht wurde, die ihnen keiner mehr wegnahm – nicht gierig und überstürzt, sondern bedächtig, Bissen für Bissen. Jedes Stück musste ausgiebig gekaut und lange im Mund behalten werden, auch wenn der Wunsch, alles blitzschnell hinunterzuschlingen, übermächtig war. Der Vorgang des Essens wurde auf beinahe religiöse Weise zelebriert, das Ende ewig hinausgezögert.
Bärbel hatte längst aufgegessen, als Johannes noch kaum ein Viertel seiner Portion vertilgt hatte.
»Hol ma wacker eingemachte Kirschen hoch«, sagte Mine zu ihr.
»Au ja! Kann ich auch welche haben?«
»Wenne hinterher beim Abwaschen hilfs.« Mine reichte Johannes ein Glas kaltes Wasser. Er bedankte sich höflich und trank es sofort in durstigen Zügen leer. Sie füllte nach und stellte es ihm hin.
Er blickte sie an. In seinen Augen flackerte etwas auf, und sie spürte, dass es Angst war.
»Darf ich hierbleiben?«, fragte er leise.
Sie nickte schweigend. Er war das Kind ihrer Tochter. Und er hätte Karl sein können.
Nach dem Essen scheuchte sie Bärbel nach oben, dann opferte sie eine genau bemessene Menge kostbarer Kaffeebohnen, die sie fein mahlte und in einer Tasse mit heißem Wasser aufgoss. Anschließend rührte sie noch einen Löffel Zucker hinein.
Johannes schloss die Augen und sog den aus der Tasse aufsteigenden Duft lange ein. Mine wollte ihm erklären, dass echter Bohnenkaffee heiß am besten schmeckte, aber dann ließ sie es sein. Er war erwachsen, ein fast sechsundzwanzigjähriger Mann.
Sie füllte eine Waschschüssel mit warmem Wasser und stellte sie auf den Boden, dann holte sie Jupps alten Stiefelknecht aus den Tiefen ihres Kleiderschranks. In seinen späten Jahren hatte ihr Mann ihn oft gebraucht, weil es mit dem Bücken nicht mehr geklappt hatte.
Es kostete Johannes einige Mühe, doch schließlich gelang es ihm, die festsitzenden Stiefel mitsamt den Strümpfen abzustreifen. Zum Vorschein kamen Narben, wie Mine sie schon öfters an den Füßen anderer Kriegsheimkehrer gesehen hatte – Folgen von Erfrierungen, häufig vereiterten Blasen und bis auf die Knochen entzündeter Geschwüre. Wie sie schon vermutet hatte, wies er auch Hungerödeme auf, man erkannte es an den geschwollenen Knöcheln.
Mine gab ein paar Schnitzer Kernseife in die Schüssel, und Johannes stellte mit einem tiefen Aufseufzen seine Füße hinein.
»Samstag kannsse richtig baden«, sagte sie.
*
Nach dem Fußbad kredenzte Mine ihm einen Aufgesetzten mit schwarzen Johannisbeeren.
»Nur ausnahmsweise«, stellte sie klar. »Nich datte denks, du kriss dat getz immer.«
Er nickte und trank den Alkohol in winzigen Schlucken, wieder mit geschlossenen Augen. Mine schenkte sich selbst auch einen ein. »Wie bisse eigentlich hergekommen?«
»Zu Fuß und per Anhalter.«
»Wat?! Von Russland?«
Er lachte, ein überraschend voller Klang.
»Nein, von Herleshausen. Es sollte von da aus weitergehen, nach Friedland zum Ankunftslager, aber ich hab mich vorher abgesetzt.«
»Warum dat denn?«
»Weil ich in kein Lager mehr wollte. Die registrieren einen da, Großmutter.« Der kurze Anflug von Heiterkeit war wie weggeblasen, sein Gesicht wurde mit einem Mal völlig ausdruckslos, als würde er bereuen, dass er schon zu viel verraten hatte.
»Sach lieber Omma Mine für mich. Wir sind ja hier nich inne Märchenstunde. Jung, wegen wat hasse Angst?«
Er schluckte schwer, dann fuhr er mit erkennbarer Anspannung fort: »Man erzählt sich, dass viele Freigelassene in die russischen Lager zurückgebracht werden. Sie werden von kommunistischen Einsatzkommandos verschleppt und wieder in die Waggons nach Osten gesperrt.«
Mine runzelte die Stirn. Ob das tatsächlich stimmte? Wundern würde es sie jedenfalls nicht. Die deutschen Kommunisten steckten mit dem Iwan seit jeher unter einer Decke, ein einziges verfilztes Gesocks. Jemand vom Roten Kreuz hatte ihr erzählt, dass die Spätheimkehrer in der Ostzone kein Sterbenswörtchen über ihre russische Lagerhaft verlieren durften, aus Sorge der Parteibonzen um den guten Ruf ihrer sowjetischen Brüder. Wer sich nicht daran hielt, durfte gleich in den Bau einziehen. Oder vielleicht sogar wieder in ein russisches Arbeitslager.
Mine hätte ihrem schwelenden Zorn gern Luft gemacht, doch es lag ihr nicht, viele Worte zu verlieren, also beschränkte sie sich auf wenige.
»Inne Hölle solln se braten.«
Johannes hob sein Glas. »Darauf trinke ich.«
Sie spendierte ihm noch einen Schnaps, und ganz gegen ihre Gewohnheit gönnte sie selbst sich auch noch einen und ließ sich sogar zu einem Trinkspruch hinreißen.
»Prost, Jung. Un keine Sorge. Hier bisse sicher.«
*
Später am Abend kehrten die beiden Hauer von ihrer Schicht zurück. Sie bewohnten das vordere Zimmer, das früher Mines und Jupps gute Stube gewesen war. Im Grunde hatten sie und ihr Mann den Raum nie wirklich gebraucht, nicht einmal damals, als ihre Kinder Karl und Mathilde noch bei ihnen gelebt hatten. Meist hatten sie alle in der Wohnküche zusammengesessen, und geschlafen hatten sie zu viert in der angrenzenden Schlafkammer, Mine und Jupp im Ehebett und die Kinder in Stockbetten. Im Obergeschoss hatten Jupps Eltern gewohnt, mit denen zusammen sie vor vielen Jahren das Haus gebaut hatten.
Später, als Karl heranwuchs, wurde in der guten Stube ein Schrankbett für ihn aufgestellt, und noch später, als Jupps Eltern nicht mehr lebten, hatten Karl und Mathilde oben jeweils ein eigenes Zimmer bezogen.
Nach Kriegsende hatte Mine die Möbel in der guten Stube abschlagen und auf den Dachboden schaffen lassen, um das Zimmer wegen der ständigen Zwangseinquartierungen zweckmäßiger einzurichten, mit vier Pritschen, vier Stühlen, einem Tisch und ein paar Wandhaken. Nachdem die letzten Flüchtlinge im vorletzten Jahr endlich ausgezogen waren, hatte Mine regelmäßig mindestens zwei der Schlafplätze an ledige Bergleute vermietet. In stetem Wechsel logierten immer wieder andere in der Stube, meist junge Burschen. Sie kamen aus dem gesamten ehemaligen Deutschen Reich und zum Teil sogar von noch weiter her, alle auf der Suche nach einem besseren Leben und einem neuen Anfang. Nirgendwo konnten Gelernte und Ungelernte mehr verdienen als im Pott. Landauf, landab wurden sie von den Arbeitsämtern angeworben und strömten in Scharen ins Revier an der Ruhr, zu den lärmenden, rußenden Hütten, Fabriken und Zechen.
Die beiden Männer, die derzeit das Zimmer bewohnten, hießen Pawel und Jörg. Meist waren sie nur zum Übernachten da. Pawel war vierundzwanzig, stammte aus Warschau und war im Krieg Zwangsarbeiter gewesen. Der zwei Jahre jüngere Jörg kam aus einem norddeutschen Kaff, dessen Namen Mine sich nicht merken konnte. Ihre Mahlzeiten nahmen sie entweder auf der Zeche oder im Wohnheim ein, wo viele der anderen alleinstehenden Bergleute untergebracht waren, die keine private Bleibe hatten. Sie duschten täglich in der Waschkaue und gingen nach Feierabend oft erst einmal in die Kneipe, bevor sie zum Schlafen anrückten. Sonntags waren sie zu irgendwelchen Unternehmungen unterwegs oder lagen faul im Bett. Den Ofen in der Stube mussten sie selbst befeuern. Mine hatte kaum Arbeit mit ihnen, abgesehen von der wöchentlichen Wäsche, die sie für ein paar Mark extra im Monat gern erledigte. Sie stanken nicht, lärmten nicht und spuckten nicht auf den Boden, und wenn sie irgendwem im Haus nicht passten, dann höchstens Katharina, weil sie sich von den jungen Kerlen begafft fühlte. Dagegen ließ sich nicht viel ausrichten. Kein gesunder Mann brachte es fertig, die Augen von ihr zu lassen, höchstens vielleicht der Papst.
Mine richtete eins der freien Feldbetten in der Stube für Johannes zum Schlafen her, während er auf den Lokus ging. Sie arbeitete leise und nur bei Kerzenlicht, denn Pawel und Jörg hatten sich sofort nach ihrer Heimkehr hingelegt und schliefen bereits.
Als sie fertig war, ging Mine geräuschlos zurück in ihr eigenes Schlafzimmer und überließ ihren Enkel seiner ersten sicheren Nacht in Freiheit.
*
Johannes wusste noch von seinem früheren Besuch, wo sich das Örtchen befand, und er erinnerte sich auch lebhaft an den Ekel, den er seinerzeit bei der Benutzung des Plumpsklos im Keller empfunden hatte. Von einer hölzernen Verschalung umgeben, nahm es eine Ecke der Waschküche ein, und soweit Johannes es nach all den Jahren beurteilen konnte, hatte sich auch im Inneren des kleinen Kabuffs nicht viel verändert. An der Wand hing immer noch eine Kordel mit passend zurechtgeschnittenem Zeitungspapier. Ein glatt gescheuerter Holzsitz umrahmte das Loch über der Senkgrube, und der aufsteigende Gestank beim Hochklappen des Deckels erfüllte die Luft sofort mit durchdringenden Fäkaliendünsten. Damals war ihm hier drin das Essen hochgekommen, heute waren es nur die Erinnerungen. Er hockte sich auf den Sitz und hing ihnen nach.
In seinem Elternhaus hatte es ein richtiges Bad mit Wanne, Waschbecken und einer emaillierten Toilettenschüssel mit Wasserspülung gegeben, ein Komfort, den er als Kind nur selten als solchen erkannt und gewürdigt hatte. Das war ihm erst viel später bewusst geworden, besonders in der Gefangenschaft, wo die verseuchten Latrinen so vielen Männern den Tod gebracht hatten. In einem Winter waren sie um ihn herum wie die Fliegen gestorben, ein paar Dutzend jede Woche, und weil sie wegen des frostharten Bodens nicht begraben werden konnten, wurden ihre Leichen hinter der Lazarettbaracke zu grausigen Wällen aufgetürmt. An ihm selbst war die Seuche wie durch ein Wunder vorübergegangen. Er wusste bis heute nicht genau, was dort grassiert hatte, Cholera oder Ruhr oder beides.
Jedenfalls war das Klo, auf dem er gerade saß, unter sämtlichen sanitären Anlagen, mit denen er seit Kriegsende in Berührung gekommen war, ein unvorstellbarer Luxus. Er blieb mindestens zehn Minuten darauf sitzen und kostete es aus, alle Zeit der Welt dafür zu haben, in dem sicheren Wissen, dass niemand ihn runterwerfen würde.
Mit einer Spur von Belustigung entsann er sich eines Donnerbalkens in einem Lager, den man so angebracht hatte, dass er zur Rückseite hin offen war, sodass ein Posten mit aufgepflanztem Bajonett die Ärsche aller Benutzer im Auge behalten konnte. So sollte sichergestellt werden, dass niemand bloß vorgab zu müssen. Wer auf dem Abtritt hockte und nicht konnte, lief Gefahr, das Bajonett in den Arsch zu kriegen. Da überlegte sich jeder dreimal, ob es wirklich so dringend war.
Passiert war dabei während Johannes’ Aufenthalt in diesem Lager allerdings keinem was, außer dem Posten selbst. Der hatte sich des Öfteren einen Becher Wodka zu viel hinter die Binde gekippt, und einmal war er in besoffenem Zustand kopfüber in die Jauche gefallen. Noch Wochen später hatten sie alle bei der Erinnerung daran in der Schlafbaracke Tränen gelacht.
Johannes hörte ein Geräusch in der Waschküche und erstarrte zu absoluter Reglosigkeit. Hatten sie ihn schon aufgespürt? Nein, völlig ausgeschlossen. Keiner wusste, dass er im Ruhrgebiet war. In seinen Akten stand nirgends, dass er hier eine Großmutter hatte. Auch während der vielen Verhöre hatte er es nie erwähnt, in keinen der Lebensläufe hineingeschrieben, die er vor den Vernehmungen häufig hatte verfassen müssen.
Nicht zu viel verraten, so hatte stets die unausgesprochene Devise gelautet, denn je weniger man von sich preisgab, umso weniger angebliche Ungereimtheiten konnten sie einem hinterher vorhalten.
Er wollte sich zwingen, an andere Dinge zu denken, um die Angst in Schach zu halten – diese Angst, von der er genau wusste, wie absurd sie war. Ihm war vom Verstand her völlig klar, dass es an Verfolgungswahn grenzte, aber er konnte das Gefühl nicht abstellen. Es tröstete ihn auch nicht, dass viele andere in den Lagern ebenfalls darunter litten. Von denen war jetzt keiner hier, um ihn damit zu beruhigen, dass seine zwanghafte Furcht ganz normal sei und bald verfliegen werde, spätestens in der Heimat, wo die Apparatschiks vom NKWD nichts zu melden hatten.
Jetzt war er in der Heimat, aber dummerweise verspürte er bisher keine Besserung, ganz im Gegenteil.
Langsam, millimeterweise, öffnete er den Riegel der Klotür. Er schob ihn so sacht zurück, dass kein Laut zu hören war. Danach drückte er, wieder mit äußerster Langsamkeit, die Tür einen Spaltbreit auf und lugte hindurch. Was er sah, verschlug ihm den Atem.
*
Katharina hatte ungeduldig darauf gewartet, dass im Haus Stille einkehrte. Im Erdgeschoss war es wie erhofft dunkel, als sie schließlich mit Taschenlampe und Handtuch bewaffnet nach unten in die Waschküche ging. Bevor sie die steile Kellertreppe hinabstieg, zog sie den Schlüssel ab, steckte ihn von der anderen Seite wieder hinein und schloss die Tür ab, nur für den Fall, dass in der nächsten Viertelstunde einer der Männer aufs Klo wollte. Wer unbedingt noch mal musste, konnte sein Geschäft draußen im Garten erledigen. Inge und Bärbel schliefen längst tief und fest, und Mine hatte für den Fall der Fälle ihren Nachttopf unterm Bett.
In der Waschküche brannte noch Licht, was Katharina kurz stutzen ließ. Strom war teuer, und ihre Schwiegermutter die Knauserigkeit in Person. Offenbar wurde Mine doch allmählich alt.
Der Schlauch, über dessen offenes Ende die gelochte Tülle einer großen Metallgießkanne gestülpt war, hing bereits in der Halterung an der Wand. Das Endstück war an einen Abzweig vom Wasserhahn angeschlossen. Ihr Schwiegervater Jupp hatte diese nützliche Vorrichtung vor vielen Jahren installiert, damals, als Karl und seine Schwester noch Kinder gewesen waren. Im Sommer hatten sie immer hier unten in der Waschküche geduscht. Natürlich kalt. Im ganzen Haus gab es keine Warmwasserleitungen.
Katharina zog den Bademantel aus und drehte das Wasser auf. Die Badelatschen waren aus Gummi, die behielt sie an.
Den Winter über kostete es enorme Überwindung, in den eiskalten Keller zu gehen und sich unter die noch viel kältere Brause zu stellen, aber Katharina tat es regelmäßig mit Todesverachtung, wenn sie das Gefühl hatte, es zu brauchen. Und das war heute der Fall, denn beim Schaufeln war sie ins Schwitzen geraten, ganz zu schweigen von all dem Kohlenstaub, mit dem sie sich vollgeschmiert hatte.
Sie schrie unterdrückt auf, als die eisigen Wasserstrahlen ihren nackten Körper trafen, doch mit zusammengebissenen Zähnen hielt sie es aus. Diesmal wusch sie sich sogar die Haare. Es war eindeutig eine Tortur, aber es führte auch auf unerklärliche Weise dazu, dass sie sich hinterher besser und stärker fühlte. Karl hätte dazu sicher einen passenden Spruch parat gehabt. Einmal hatte er gesagt, der schwerste Kampf sei immer der gegen sich selbst. Im Grunde passte das recht gut auf ihre gelegentlichen abendlichen Eisduschen. Allerdings beging sie nicht den Fehler, sich einzureden, dass sie das kalte Wasser dem warmen vorzog. So war es beileibe nicht. Sie badete gern heiß, so heiß, dass sie es kaum in der Wanne aushielt. Aber Badetag war immer nur samstags. Das war in Mines Leben der Lauf der Welt. An den übrigen Tagen musste es die Katzenwäsche am Spülstein oder vor der großen Emailschüssel tun, mit der Hand im Waschlappen und den Füßen auf dem zerlumpten alten Handtuch, das man hinterher zusammen mit dem Waschwasser noch zum Putzen verwenden konnte.
Katharina hatte bisher keine Energien darauf verschwendet, diese festgelegten Abläufe zu durchbrechen, etwa, indem sie häufiger die große Zinkwanne im Keller aufstellte und das zum Baden benötigte Wasser erhitzte. Es dauerte einfach viel zu lange, bis man endlich drinsaß.
Den plötzlich vor dem Klo auftauchenden Schatten ahnte sie mehr, als dass sie ihn sah.
Sie fuhr so schnell herum, dass sie fast ausgerutscht wäre. Johannes stand dort, mit abgewandtem Gesicht und eingezogenen Schultern.
Mit einem Aufschrei sprang Katharina unter dem eisigen Brausestrahl hervor und streifte sich in fliegender Hast den Bademantel über. Eilig drehte sie das Wasser ab und wickelte sich das mitgebrachte Handtuch um den Kopf.
»Schon gut, du kannst wieder gucken.«
Er drehte sich zögernd zu ihr um, und sogar im matten Licht der Deckenlampe war zu erkennen, dass sein Gesicht feuerrot angelaufen war. »Ich habe sofort weggeschaut«, versicherte er, das personifizierte schlechte Gewissen.
»Ja, klar«, gab sie sarkastisch zurück. »Deshalb hast du auch direkt Laut gegeben, als ich hier runterkam und den Bademantel ausgezogen habe.«
»Ich dachte … ich dachte …« Seine Stimme brach ab. Was immer er auch gedacht hatte, er konnte es ihr offenbar nicht erklären. In diesem Moment sah er so verzweifelt aus, dass Katharinas Wut schlagartig verflog.
»Das nächste Mal rufst du einfach, dass hier besetzt ist«, teilte sie ihm mit.
Er nickte stumm.
Sie deutete auf die Duschvorrichtung. »Das Ding hier kannst du übrigens auch gern benutzen, wenn du möchtest. Wir haben allerdings nur kaltes Wasser. Gebadet wird immer samstags.«
Wieder nickte er bloß. Aus einem Impuls heraus wollte sie ihn fragen, wie lange es her war, dass er das letzte Mal gebadet hatte. Richtig gebadet, in einer Wanne mit sauberem, warmem Wasser. Ließen die Russen ihre Gefangenen überhaupt je baden? Doch dann scheute sie vor der Frage zurück. Hatten die Deutschen etwa die KZ-Häftlinge baden lassen? Und was brachte einem ein heißes Bad, wenn man so unterernährt war, dass überall spitze Knochen hervorstanden? Jetzt, da Johannes weder Mantel noch Kittel trug, war unschwer zu erkennen, dass er jahrelang gehungert haben musste. Seine Schlüsselbeine zeichneten sich wie Stecken über dem Ausschnitt des schäbigen Pullovers ab. Seine Handgelenke waren kaum dicker als die darunterliegenden Knochen. Höchstwahrscheinlich hatte er sich heute Abend in Mines Wohnküche zum ersten Mal seit ewigen Zeiten richtig satt gegessen.
Katharina hatte gegen Ende des Krieges und in den beiden Jahren danach auch hin und wieder gehungert, aber das waren nur kurze Episoden gewesen, die meist bloß bis zur nächsten Hamsterfahrt oder bis zum nächsten Schwarzmarktgeschäft angehalten hatten. Die Kinder hatten sie und Mine immer irgendwie satt bekommen, auch im schlimmen Hungerwinter von 1946/47, denn in Mines Garten wuchs auch in schlechten Jahren immer genug Obst und Gemüse, um das Lebensnotwendige auf den Tisch zu bringen. Zum Ende der Zwangsbewirtschaftung hin waren sie zwar alle ziemlich dünn gewesen, aber nie bis aufs Gerippe abgemagert.
Immerhin ließen sich die körperlichen Folgen des Hungers rasch heilen, im Gegensatz zu manchen anderen Wunden, die der Krieg geschlagen hatte. Katharina schlang fröstelnd die Arme um sich. Nur nicht an Berlin denken!
Sie musste endlich nach oben, raus aus dem Keller. Hier unten war es viel zu kalt, sie holte sich noch den Tod, wenn sie nicht achtgab.
»Gute Nacht«, stieß sie hervor, dann hastete sie zur Treppe und rannte nach oben.
Kapitel 3
»Mehr nach links!«, schrie Bärbel in Klausis Ohr. Er saß vor ihr auf dem Schlitten und musste ihn lenken. Sie selbst hatte ihre Füße auf der hölzernen Abdeckung der Kufen abgestellt. Klaus Rabe war zwar ein Jahr jünger als sie, erst acht, aber er war größer und schwerer und trug bessere, widerstandsfähigere Stiefel. Solche, die richtig viel Schnee aushielten, nicht bloß rutschige Gummistiefel mit feuchten Rosshaarsocken darin, wie Bärbel sie anhatte, weil ihre Winterstiefel, mit Schuhcreme eingerieben, zu Hause standen. Außerdem gehörte ihm der Schlitten, weshalb er für sich das Privileg beanspruchte, vorn zu sitzen. Was jedoch nicht bedeutete, dass er wusste, was er tat, denn er schaffte es immer wieder, von der schon glattgefahrenen Bahn abzukommen und seitwärts im Gebüsch zu landen. Oder, was noch schlimmer war, an einem Baum. So wie der, auf den sie gerade zurasten.
»Links!«, wiederholte Bärbel kreischend. »Nicht rechts!«
Als ihr aufging, dass Klausi rechts und links nicht auseinanderhalten konnte, war es bereits zu spät. Mit einem weithin hörbaren Krachen prallte der Schlitten gegen den Baum, unmittelbar gefolgt von Klausi selbst, dessen Stirn schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Stamm machte. Bärbel kam vergleichsweise glimpflich davon, weil sie nur gegen Klausi geschleudert wurde, dessen dicke Winterjacke den Aufprall ein wenig abfederte. Die Nase tat ihr weh, aber es war nicht allzu schlimm. Hauptsache, es blutete nicht.
Auch bei Klausi floss kein Blut, sie mussten also nicht nach Hause, wie er sofort erklärte. Dass an seiner Stirn eine gewaltige Beule heranwuchs, schien ihn weniger zu stören als das schadenfrohe Gelächter der anderen Kinder, die den Schlittenhang bevölkerten. Er rieb nur einmal kurz über die Schwellung und beachtete sie danach nicht weiter, denn er hatte schon Schlimmeres erlebt. Klaus Rabe und seine beiden Brüder waren ständig von Blessuren gezeichnet. Sie fielen die Treppe hinunter oder von Bäumen, sie stürzten beim Rollerfahren oder holten sich blaue Flecken beim Raufen. Doch solange kein Knochen brach und kein Blut floss, mussten sie nicht extra vom Spielen nach Hause, das war eine der Regeln, die Klausis Mutter Elfriede ausgegeben hatte.
Bärbel und Klausi fuhren noch ein paarmal mit dem Schlitten den Hang hinunter, diesmal nicht ganz so verwegen wie zuvor, doch nach einer Weile begann Bärbel zu frieren. Ihre Füße fühlten sich an wie Eisklumpen, und ihre Augen tränten von dem kalten Wind, der ihr ins Gesicht wehte.
Dennoch hatte sie keine Lust, nach Hause zu gehen, denn dort wartete bloß Arbeit auf sie. Ihre Mutter hatte ihr aufgetragen, Schuhe zu putzen und anschließend ihr Bett abzuziehen. Bärbel hatte lustlos mit dem Schuhputzen angefangen und bei immerhin drei Paaren schon die Schuhcreme aufgetragen, aber dann hatte Klausi geklingelt und gefragt, ob sie mitwollte. Natürlich wollte sie.
Er hatte einen neuen Schlitten zu Weihnachten bekommen (eigentlich gehörte er nicht nur ihm, sondern auch seinen beiden Brüdern, aber die hatten gerade die Windpocken und durften nicht raus), und Bärbel brannte schon seit Tagen darauf, den Schlitten mit Klausi auszuprobieren. Das Schuhputzen konnte warten. Der Schnee würde vielleicht morgen schon wieder weg sein. Oder dermaßen von Kohlenstaub verdreckt, dass man das Schlittenfahren vergessen konnte.
Damit sich niemand Sorgen um sie machen musste, hatte sie Johannes kurz mitgeteilt, dass sie mit Klausi zum Schlittenfahren gehen wollte, worauf Johannes sich erkundigte, ob ihre Mutter das denn erlaubt habe.
»Sie hat’s nicht verboten«, antwortete Bärbel wahrheitsgemäß, und gleich darauf war sie auch schon rausgestürmt.
»Lass uns noch zum Bach runtergehen«, sagte sie zu Klausi, als sie vom Schlittenfahren endgültig die Nase voll hatte. Er erhob keine Einwände, so wie er auch sonst meist bereitwillig bei allem mitmachte, was sie vorschlug.
Klausi war der mittlere Rabe-Bruder, wobei der Altersabstand zwischen den drei Jungs so gering war, dass es nicht weiter ins Gewicht fiel – Manfred, genannt Manni, war nur dreizehn Monate älter als Klausi, den wiederum lediglich vierzehn Monate von seinem jüngeren Bruder Wolfgang, genannt Wolfi, trennten. Zusammen mit Bärbel bildeten Manni, Klausi und Wolfi ein unzertrennliches Vierergespann, wobei Elfriede Rabe unverhohlen der Ansicht zuneigte, dass ihre Söhne nur halb so viel ausfressen würden, wenn Bärbel sie nicht ständig zu allerlei Unfug angestiftet hätte. Katharina glaubte zwar, dass Elfriede übertrieb, aber im Großen und Ganzen war sie derselben Meinung. Allerdings fand sie im Gegensatz zu Elfriede Gefallen an dem Gedanken, dass ihre kleine Tochter schon in jungen Jahren lernte, sich in der Männerwelt durchzusetzen.
Bärbel und Klausi stromerten durch den Wald unterhalb der schneebedeckten Hänge, bis sie den Hesperbach erreicht hatten. Rauschend und gluckernd bahnte er sich seinen Weg durch das bewaldete Tal, das an dieser Stelle den trügerischen Eindruck einer gänzlich unberührten Natur erweckte, obwohl das Gelände von Pörtingsiepen nur einen Katzensprung entfernt war. In der großen Steinkohlenzeche arbeiteten, wie Bärbel wusste, über tausend Menschen, und wäre es nicht so ungemütlich kalt gewesen, hätte sie Klausi gefragt, ob er mit ihr zusammen am Zechentor auf den Schichtwechsel warten und Ausschau nach den Männern halten wollte, die aus den Tiefen des Schachts kamen, über und über schwarz von Kohlenstaub, bis auf die Augen, die wie unheimliche weiße Murmeln in den dunklen Gesichtern leuchteten.
Dort tuckerte auch regelmäßig die Hespertalbahn vorbei, deren Waggons vor Beginn jeder Schicht am zecheneigenen Bahnhof Hunderte von Bergleuten ausspien und im Gegenzug scharenweise andere Kumpel verschluckten, die Feierabend hatten und nach Hause wollten.
Auch Güterzüge verkehrten auf der Bahnstrecke, vollgeladen mit Abraum und Kohle und oft umweht von rußigen Staubwolken. Bärbel hätte für ihr Leben gern die Züge aus der Nähe beobachtet. Oder, wie Klausi und seine Brüder es manchmal taten, Stöcke auf die Gleise gelegt und dann aus dem Gebüsch heraus zugesehen, wie die Hindernisse von der heranschnaufenden Dampflok zermalmt wurden. Doch dieses Vergnügen musste sie sich verkneifen. Katharina hatte Bärbel streng verboten, auch nur in die Nähe der Bahnschienen zu gehen, und nachdem dieses Verbot einmal durch einen dreitägigen Hausarrest untermauert worden war, hielt Bärbel sich daran.
Sie war kein zu Ungehorsam neigendes Kind, im Gegenteil, es bedrückte sie, wenn ihre Mutter ihretwegen traurig oder zornig wurde. Deshalb setzte sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten einigen Ehrgeiz daran, Katharinas Gebote zu befolgen. Vorausgesetzt, selbige waren klar umrissen – woran es allerdings häufig haperte, denn Schlupflöcher fanden sich so gut wie immer. Etwa im Fall des Schuhputzens – ihre Mutter hatte nicht genau festgelegt, wann Bärbel damit fertig sein sollte, folglich war es sicher nicht allzu schlimm, dass sie es auf später verschoben hatte.
Es schwante Bärbel durchaus, dass sie sich darin vielleicht irrte, aber falls es wirklich gegen eine Regel verstieß, so zumindest gegen keine ausdrückliche wie das unmissverständliche und strikte Verbot, bei den Gleisen zu spielen oder in den Bach zu steigen.
Bärbel achtete bei ihren Spielen im Wald sorgsam darauf, dem Bach nicht zu nahe zu kommen, nachdem sie vor zwei Monaten aus Versehen hineingefallen und tropfnass und unterkühlt heimgekommen war, was nicht nur zwei Tage Stubenarrest, sondern auch eine böse Erkältung nach sich gezogen hatte.
Klausi zeigte Anzeichen von Lustlosigkeit. »Dat macht kein Spaß hier. Ich muss die ganze Zeit den Schlitten alleine ziehen.« Er rieb sich die Stirn. »Der Kopp tut mich auch weh.«
»Er tut mir weh«, verbesserte Bärbel ihn.
Klausi zog die Brauen zusammen. »Nä, dat ist doch mein Kopp, du Dusseldier!« Er kratzte sich die Wange, wo sich im Laufe der letzten Stunde rötliche Pusteln gebildet hatten. »Ich glaub, ich krich auch die Windpocken«, verkündete er. »Dat juckt anne Backe wie die Hölle. Guck ma, hab ich da schon Flecken?«
»Jede Menge«, stellte Bärbel nach einem prüfenden Blick fest. »Wenn du jetzt nach Hause gehst, darfst du zwei Wochen nicht mehr raus. Also spielen wir lieber noch ein bisschen.« Sie sprach aus Erfahrung, denn sie selbst hatte erst im Dezember Windpocken gehabt, was wohl auch der Grund dafür war, dass nun Wolfi und Manni sie am Hals hatten.
Sie dachte kurz nach, wie sich die knappe Zeit bis zum Dunkelwerden sinnvoll nutzen ließ. »Wir könnten einen Damm bauen«, sagte sie dann eifrig. »Mit dem Schlitten. Wir stellen ihn ins Wasser, und dann legen wir lauter Steine und Äste und Moos drüber, bis das Wasser gestaut wird.«
»Au ja!«, rief Klausi, sehr angetan von Bärbels Idee. »Dann wundern die sich nachher hinten beim Haus Scheppen, dat auf eima der Bach weg is!«
»Wieso beim Haus Scheppen?«
»Weil da der Hesperbach innen Baldeneysee mündet.«
Ja, das hatte Bärbel in Heimatkunde gelernt und auch schon mit eigenen Augen gesehen, aber sie wusste auch, dass Haus Scheppen bloß eine Ruine war, wo sich niemand aufhielt, dem das Fehlen des Baches auffallen konnte, schon gar nicht um diese Jahreszeit. Doch bis zur Mündung war es ja noch ein ganzes Stück, also würde irgendwer zwischen hier und dort auf alle Fälle darüber staunen, dass der Bach plötzlich nicht mehr floss!
Mit Blick auf Katharinas Verbot legte Bärbel eine passende Aufgabenteilung fest. Klausi musste den Schlitten in den Bach stellen, und sie würde ihm aus sicherer Entfernung die Steine und Äste anreichen, die er zwecks Errichtung des Dammes auf und unter dem Schlitten (sowie auch drum herum – der Bach war um einiges breiter als der Schlitten) aufschichten sollte.
Unseligerweise erwies sich das ganze Unterfangen von Beginn an als Fehlschlag. Der Schlitten glitt Klausi aus den in gestrickten Fäustlingen steckenden Händen und wurde von dem kräftig dahinsprudelnden Bach fortgerissen. Zwar nur ein paar Meter weit, bis er an einem ins Wasser ragenden Felsbrocken hängen blieb, aber im ersten Schreck beging Klausi den Fehler, dem Schlitten hinterherlaufen zu wollen. Dabei stolperte er und fiel der Länge nach in den Bach. Zum Glück gelang es ihm sofort, sich hochzustemmen und wieder ans Ufer zu waten, und er schaffte es sogar, sich vorher den abgetriebenen Schlitten zu schnappen und ihn unter Triumphgeschrei an Land zu zerren. Aber anschließend gab es keinen trockenen Fleck mehr an seiner Kleidung. Sogar der Bommel von seiner Pudelmütze hing triefend herab.
Bärbel betrachtete den klatschnassen Nachbarsjungen in einer Mischung aus Entsetzen und Resignation.
»Klausi, ich glaube, jetzt müssen wir doch nach Hause.«
*
Wie Bärbel bereits auf dem Heimweg befürchtet hatte, setzte es ein Donnerwetter.
»Hatte ich dir nicht verboten, am Bach zu spielen?«, fragte Katharina ihre jüngere Tochter, nachdem sie von der aufgebrachten Nachbarin das ganze Ausmaß des Vorfalls erfahren hatte.
»Nein, du hast mir bloß verboten, im Bach zu spielen. Und ich war ja gar nicht im Bach. Bloß der Klausi.«
»Dat has du dem armen Jung eingebrockt, du kleines Rabenaas!« Elfriede stand in Katharinas Küche, beide Hände in die Hüften gestemmt. Mit ihrer gesamten Körperhaltung signalisierte sie, dass sie Bärbel am liebsten die gleiche Tracht Prügel verabreicht hätte, die sie vorher ihrem Sohn verpasst hatte. »Der Klausi hätte glatt ersaufen können!«
»Der Bach geht doch bloß bis zum Knie«, rief Bärbels Schwester Inge, die im Nebenzimmer saß und durch die offene Verbindungstür jedes Wort der laut geführten Auseinandersetzung mithören konnte.
»Und Klausi hat den Freischwimmer«, fügte Bärbel hinzu, damit erst gar keine falschen Vorstellungen aufkamen.
Elfriede erkannte, dass weitere Tiraden zwecklos waren. Wutschnaubend räumte sie das Feld und trampelte die Treppe hinab. Gleich darauf knallte unten in anklagender Lautstärke die Haustür hinter ihr zu.
Katharina machte ihrem Ärger Luft. »Bärbel, das gibt zwei Tage Hausarrest, damit das klar ist.«
»Wieso? Ich hab doch nichts gemacht!«
»Ja, ganz genau. Du solltest Schuhe putzen und dein Bett abziehen. Beides hast du nicht erledigt.«
»Ich mach’s gleich noch. Du hast nicht gesagt, dass es sofort sein muss, Mama.«
»Das stimmt, Mama«, pflichtete Inge ihrer Schwester von nebenan bei.
»Halt dich da raus, Inge.« Eindringlich sah Katharina ihre jüngere Tochter an. »Bärbel, du bist spielen gegangen, ohne dich abzumelden.«
»Das ist nicht wahr. Ich hab’s Johannes gesagt.«
Katharina merkte sich vor, mit Johannes darüber zu reden. Doch damit war der Fall keineswegs erledigt. »Das mit dem Schlitten im Bach – es war deine Idee, oder?«
Bärbel nickte kleinlaut. »Aber Klausi wollte es auch!«
»Er will meist das, was du willst, das muss dir doch klar sein! Auch wenn es der verrückteste Blödsinn ist!«
»Ein Damm ist nicht blöd«, verteidigte Bärbel sich. »Biber bauen auch Dämme!«
»Du bist aber kein Biber«, stellte Katharina klar. »Deinetwegen ist Klausi in das kalte Wasser gefallen und musste in seinen nassen Sachen den ganzen Weg durch den eisigen Wind nach Hause gehen. Er könnte schwer krank werden. So krank, dass vielleicht sogar der Doktor kommen muss.«