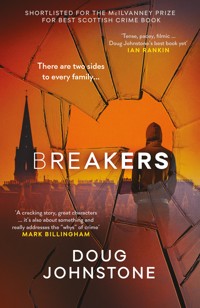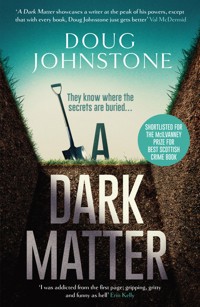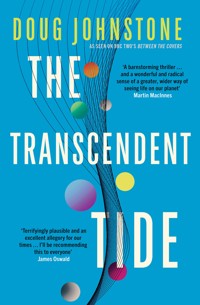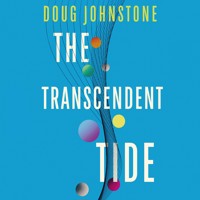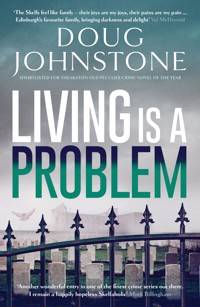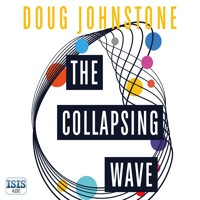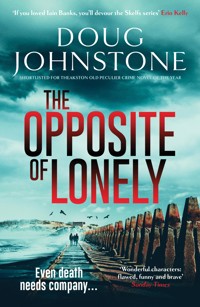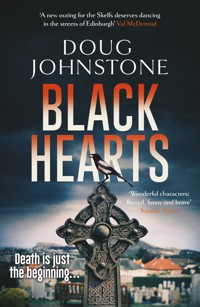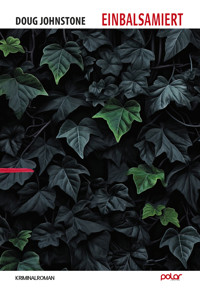
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Skelf-Frauen leben jeden Tag im Schatten des Todes und führen das Familienunternehmen für Bestattungen und Ermittlungen in Edinburgh. Im dritten Band der Skelf-Reihe beginnt die Matriarchin Dorothy eine Beziehung mit dem Polizisten Thomas, während sie gleichzeitig eine jugendliche Untermieterin bei sich aufnimmt, die sich von ihrer Familie entfremdet hat. Dorothys Hund Einstein findet einen menschlichen Fuß auf den Wiesen, aber als sie ihn in einem Hundehaufenbeutel zur Untersuchung ins Bestattungsinstitut zurückbringt, wirft das mehr Fragen auf, als es beantwortet. Der Fuß hat nach dem Tod einiges mitgemacht. Auch Tochter Jenny und Enkeltochter Hannah haben alle Hände voll zu tun: Die mysteriösen Umstände des Todes einer reichen Frau ziehen sie in ein unerwartetes Familiendrama hinein. Darüber hinaus behauptet Hannahs neuer Astrophysiker-Kollege, er empfange Botschaften aus dem Weltall. Nichts ist klar, als die Skelfs tiefer in ihre bisher schwierigsten Fälle eintauchen. Als die Tochter von Jennys gewalttätigem und flüchtigem Ex-Mann spurlos verschwindet und ein wildes Tier in den Parks von Edinburgh gesichtet wird, scheint die Welt der Skelfs schlagartig zu überdrehen. Spannend, düster, warmherzig, humorvoll. Es steht mehr auf dem Spiel denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Doug Johnstone
Einbalsamiert
Aus dem Englischen von Jürgen Bürger
Herausgegeben von Wolfgang Franßen
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung gültig sind.
Originaltitel: The Great Silence
Copyright: © Doug Jonstone 2021
The moral right of the author has been asserted
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2024
Aus dem Englischen von Jürgen Bürger
Mit einem Nachwort von Sonja Hartl
© 2024 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Eva Weigl
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Dannchez/Adobe Stock_KI
Autorenfoto: © Chris Scott
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI Books GmbH, Ulm, Deutschland
ISBN: 978-3-910918-12-2
e-ISBN: 978-3-910918-13-9
Das hier ist für Karen Sullivan, die den Skelf-Frauenein Zuhause gegeben hat.
Inhalt
1 DOROTHY
2 JENNY
3 HANNAH
4 JENNY
5 DOROTHY
6 HANNAH
7 JENNY
8 DOROTHY
9 JENNY
10 HANNAH
11 DOROTHY
12 HANNAH
13 JENNY
14 DOROTHY
15 HANNAH
16 DOROTHY
17 JENNY
18 HANNAH
19 DOROTHY
20 JENNY
21 HANNAH
22 DOROTHY
23 JENNY
24 HANNAH
25 DOROTHY
26 JENNY
27 HANNAH
28 DOROTHY
29 JENNY
30 HANNAH
31 DOROTHY
32 JENNY
33 HANNAH
34 JENNY
35 DOROTHY
36 HANNAH
37 JENNY
38 DOROTHY
39 HANNAH
40 JENNY
41 DOROTHY
42 HANNAH
43 DOROTHY
44 JENNY
45 DOROTHY
46 HANNAH
47 DOROTHY
48 JENNY
49 HANNAH
50 JENNY
51 DOROTHY
52 HANNAH
53 JENNY
54 DOROTHY
55 JENNY
56 DOROTHY
57 HANNAH
58 JENNY
59 HANNAH
60 DOROTHY
61 JENNY
62 HANNAH
63 DOROTHY
64 HANNAH
65 JENNY
66 HANNAH
67 JENNY
68 DOROTHY
69 JENNY
70 HANNAH
71 JENNY
72 DOROTHY
Danksagungen
Weiterleben Ein Nachwort von Sonja Hartl
1DOROTHY
Sie würde sich nie daran gewöhnen, Einsteins Hundescheiße einzusammeln.
Der Border Collie hockte sich mit zitternden Hinterbeinen hin, scharrte dann mit den Pfoten übers Gras und schlenderte über den Bruntsfield Links davon, einer frühmorgendlichen Witterung folgend.
Dorothy zog einen Kackbeutel aus der Tasche und schob die Hand hinein. Ihr tat der Rücken weh, als sie sich vorbeugte, um den Hundekot aufzuheben, und die durch den Beutel dringende Wärme ließ sie angeekelt zusammenzucken. Dann erreichte der Geruch ihre Nase, und sie spürte einen aufsteigenden Brechreiz, als sie den Beutel umstülpte und fest zuband.
Sie legte eine Hand auf ihr Kreuz, als sie sich aufrichtete, ließ den Kopf kreisen, versuchte, die Verspannungen der letzten Nacht wegzubekommen. Früher hatte sie morgens als Erstes einen Kaffee getrunken und Yoga gemacht, bis dann vor einem Jahr der Hund buchstäblich in ihr Leben gekracht war. Jetzt leckte Einstein ihr zu einer bescheuerten Uhrzeit übers Gesicht, um sie zu wecken, besonders blöd im Sommer, wenn es so früh hell wurde.
Sie sah sich im Park um. Die Sonne war vor einer Stunde aufgegangen, aber es dauerte eine Weile, bis sie über Arthur’s Seat auftauchte, weswegen die große Grünfläche immer noch in Morgendunst gehüllt war. Links von ihr rumpelte hin und wieder ein Lieferwagen die Straße hinunter, während auf den Wegen durch den Park der eine oder andere frühe Jogger und Leute mit ihrem Hund unterwegs waren.
Einstein schnüffelte in der Nähe der Whitehouse Loan um einen Golden Retriever herum, während in einigem Abstand Goldies Besitzer folgte, ein älterer Mann, dessen Namen Dorothy noch nicht erfahren hatte. Ein Teil von ihr mochte das kumpelhafte Miteinander hier auf dem Links, ein anderer Teil mied den sozialen Aspekt.
»Einstein!«, rief sie und kam sich blöd vor. Der Name war Hannahs Idee gewesen. Sie hatten bereits eine Katze namens Schrödinger, und anscheinend hatten sich der echte Schrödinger und der echte Einstein nicht besonders verstanden, also leuchtete die Namensgebung durchaus ein. Einstein tappte den Leamington Walk hinunter, die Nase immer dicht über dem Boden, während er hin und her lief. Dorothy sah an ihm vorbei zum Turm der Viewforth Church, dann über die weite Fläche der Meadows und noch weiter dahinter zum Edinburgh Castle, das über der Stadt hockte und von dem aus sich die Royal Mile wie das Rückgrat eines großen schlafenden Drachens zog.
Es war eine so wunderbare Stadt, deren Teil man war, aber man vergaß es leicht, wenn man seinem Alltag nachging. In Dorothys Fall bedeutete dies, die Toten zu beerdigen und die Hinterbliebenen in dem Bestattungsunternehmen zu trösten, dessen Sitz sich in ihrem Haus direkt hinter ihr befand. Aber dieses frühmorgendliche Ritual, die frische Luft und die weite, offene Fläche, das gemähte Gras, die Eichen und Platanen, die unglaubliche Aussicht, das alles erinnerte sie immer daran, was für ein Glück sie hatte.
Einstein blieb an einem Baum stehen und hob ein Bein, wobei seine Bewegung wegen des fehlenden Auges ein wenig unbeholfen war. Dorothy drehte sich zu dem Haus hinter ihr um. Drei Etagen viktorianisches Stadthaus aus dunklem Backstein, seit hundert Jahren im Besitz der Familie Skelf, wo sie ein Bestattungsunternehmen und in jüngerer Zeit zusätzlich eine Detektei führte. Dorothy dachte daran, wie sehr sich ihr Leben in den letzten beiden Jahren verändert hatte, von der Unterstützung ihres Mannes Jim bei den Vorkehrungen für Bestattungen bis zur Übernahme beider Geschäftszweige nach seinem Tod, als sie ihre Tochter Jenny und Enkelin Hannah einspannte, um ihr zu helfen.
Sie stellte sich Jenny vor, die im ersten Stock noch im Bett lag. Sie stellte sich Hannah schlafend in ihrer gemeinsamen Wohnung mit Indy vor, zehn Minuten zu Fuß um die Meadows. Das war heutzutage ein weiteres ihrer Morgenrituale, sich die Stadt schlafend auszumalen, während sie selbst wach war.
Sie sah zum obersten Stockwerk des Hauses, zu dem Studio, in dem ihr Schlagzeug stand, wo Abi auf dem Futon schlief, eine ihrer Schülerinnen im Teenager-Alter, die vor einem Jahr einen Platz zum Pennen gebraucht hatte und dann nicht mehr gegangen war. Und sie dachte an Archie, ihre rechte Hand im Bestattungsunternehmen, der am anderen Ende der Stadt wohnte und sich bald aufmachen würde zu einem weiteren Tag Särge bauen, Verstorbene einbalsamieren, Leichen für die Aufbahrung vorbereiten, all die kleinen Dinge zu tun, die es ein wenig leichter machten, mit einem toten Verwandten oder Freund umzugehen, wenn sie nur gut zurechtgemacht waren. Dorothy dachte an ihre eigene Trauer. Nur weil sie eine Expertin bei anderen Leuten war, musste sie ja nicht unbedingt wissen, wie sie mit sich selbst klarkam.
Sie registrierte, dass sie immer noch den schwarzen Beutel mit Einsteins Kacke in der Hand hielt, also ging sie zu der Mülltonne für Hundekot und ließ ihn dort hineinfallen. Sie schaute sich nach dem Hund um, sah seinen schwarz-weißen Schwanz zwischen den Kiefern an der Ecke verschwinden. Dahinter befand sich Sam’s Coffee Box, die alte, umgebaute Polizei-Telefonzelle, und die öffentliche Toilette. Einstein schnüffelte immer dort herum, manchmal raste er hinter einem Eichhörnchen her oder bellte eine Ringeltaube in den Bäumen an. Sie betrachtete eine Weile Gestrüpp und Bäume, aber nichts rührte sich.
»Einstein.«
Ein Bus rumpelte Bruntsfield Place hinunter. Der Van eines Raumausstatters fuhr vorbei, und sie entdeckte sofort zwei grammatische Fehler in dem Werbespruch auf der Seite.
Zwischen den Bäumen immer noch keine Bewegung.
»Einstein.«
Sie setzte sich zu den Kiefern in Bewegung, blickte auf den Boden unter ihnen, nur Moos und Nadeln. Je näher sie kam, desto besser konnte sie zwischen die Stämme sehen, aber von dem Hund immer noch keine Spur.
»Einstein.«
Sie erinnerte sich, wie sie ihn das erste Mal gesehen hatte, sein beunruhigtes Gesicht, als er den Kopf vom Rücksitz eines verunglückten Autos nach vorn streckte und seinen toten Besitzer beschnüffelte.
Sie spürte ein Ziehen im Bauch und erkannte, wie sehr sie den Hund und seine frühmorgendlichen Verfolgungsjagden ins Herz geschlossen hatte, wie er Schrödinger in dem Versuch, sich bei ihm einzuschmeicheln, im Haus ständig hinterherlief, worauf der Kater nur noch genervter reagierte.
Sie war bereits halb zwischen den Bäumen, als Einstein wiederauftauchte und im Takt seiner trabenden Pfoten mit dem Kopf wippte.
Zuerst empfand Dorothy Erleichterung, dann etwas anderes. Der Hund hatte etwas im Maul. Hatte er es doch noch geschafft, ein Eichhörnchen zu fangen? Vielleicht war aber auch ein kleiner Vogel aus einem Nest gefallen. Sie war es eher gewohnt, dass Schrödinger ihr kleine tote Gaben brachte.
Als Einstein näher kam, sah sie die Farbe, ein helles Pink, etwas Rot, und sie schluckte schwer. Der Hund erreichte sie, sah erwartungsvoll zu ihr auf, hielt das Ding fest zwischen seinen Zähnen.
Dorothy spürte, wie ihr wieder übel wurde.
»Aus«, sagte sie und zeigte auf den Boden.
Einstein schien verunsichert, wollte seine Beute nicht aufgeben.
»Aus!«, wiederholte Dorothy schärfer.
Einstein senkte den Kopf und legte den Gegenstand aufs Gras, schaute mit seinem einen Auge auf und wollte gelobt werden. Dorothy ging in die Hocke und berührte geistesabwesend seinen Kopf. »Braver Junge.«
Sie kraulte das Ohr des Hundes und starrte das Ding an. Es war lädiert, ein Ende war stark angeknabbert, die Haut grau, aber es gab keinen Zweifel.
Es war ein menschlicher Fuß.
2JENNY
Sonnenschein schillerte auf dem Water of Leith, als Jenny an der Ecke The Shore und Commercial Street stand. Sie starrte auf das sich kräuselnde Wasser hinunter und spürte die Wärme auf dem Gesicht, kniff die Augen zusammen und stellte sich vor, wie das Vitamin D in ihre Haut sickerte und sie gesünder machte.
Inzwischen war ihr dieser Teil von Leith vertrauter denn je. Wenn ihr alles zu viel wurde und die Erinnerungen an ihren Ex-Mann sie fertigmachten, kam sie hierher. Es war jetzt ein Jahr her, seit er auf dem Weg ins Gericht geflohen war, dann zunächst ihren damaligen Freund Liam und danach Jenny selbst entführt hatte. Wäre Hannah nicht gewesen, hätte er sie beide umgebracht. Das war schon was, wenn man seiner Tochter das Leben zu verdanken hatte.
Heute begann sie wie üblich im Malmaison Hotel, zeigte dem Personal dort das Foto von Craig, nur für den Fall, dass er sich hier herumtrieb. Es wäre völlig verrückt, das zu tun, aber alles, was er in den letzten zwei Jahren gemacht hatte, war verrückt. Er war irgendwo da draußen. Er hatte seinen Reisepass, aber den Behörden lagen keine Erkenntnisse vor, dass er ihn auch benutzt hatte. Vielleicht hatte er sich als blinder Passagier auf einen norwegischen Tanker geschlichen oder war auf einem Fischkutter unterwegs, weiß Gott, wohin, oder er nahm den Zug in den Süden und verpisste sich durch den Eurotunnel. Er konnte auf eine Million Wegen auf die andere Seite des Planeten gekommen sein, aber das schien zu einfach für ihn. Er hatte zu Jenny gesagt, sie seien noch nicht fertig miteinander, und sie glaubte ihm, deswegen war sie jetzt auch hier.
Nach dem Malmaison hatte sie sich durch die Bars und Restaurants vorgearbeitet, war im Fishers, The Shore, The Ship on the Shore gewesen. Inzwischen kannte sie überall das Personal, man begrüßte sie mit Namen, hatte häufig schon einen Gin Tonic für sie vorbereitet. Es hatte als eine Art Ritual begonnen, hier nach Craig zu suchen, war aber inzwischen etwas anderes geworden, ein Mittel, sich als Teil einer Gemeinschaft von Kneipen- und Restaurantleuten zu fühlen, eine willkommene Gelegenheit, die Gerüche des Hafens und die salzige Luft aufzusaugen.
Und es war eine Möglichkeit, den Druck von der Arbeit im Bestattungsunternehmen abzulassen. Es waren jetzt zwei Jahre vergangen seit dem Tod ihres Dads und ihrem Einstieg in das Familienunternehmen, und sie hatte sich immer noch nicht daran gewöhnt. Sie war nicht so geschickt im Umgang mit Trauer wie ihre Mum oder Hannahs Freundin Indy. Sie nahm Anrufe entgegen, notierte Einzelheiten und kümmerte sich um die Bestellungen von Gottesdiensten und Blumen, Zelebranten und Lokalitäten, aber es ging ihr unter die Haut und machte sie nervös. Sie hatte keine Schranke zwischen der Trauer anderer und ihrer eigenen.
Und heute Morgen war da dieser Scheißfuß. Ihre Mum war in die Küche marschiert gekommen, als Jenny noch ihren Toast mampfte, und hatte einen Kackebeutel hochgehalten. Wegen der Abmessung und des Gewichts war klar, dass es nicht einer von Einsteins Haufen sein konnte. Jetzt fanden die Skelfs also schon menschliche Füße im Park. Jenny fragte, warum zum Teufel sie ihn nicht einfach dort gelassen hatte, aber Dorothy hatte einen Fuchs erspäht und daher Sorge, dass der sich damit aus dem Staub machen könnte. Also hatte ihre Mum Thomas angerufen, ihren Freund bei der Polizei, der ihr zuerst einen Anschiss verpasste, weil sie den Fuß vom Fundort entfernt hatte, dann aber sagte, er sei mit einem Typ von der Spurensicherung und mehreren uniformierten Beamten zur Absicherung des Tatorts unterwegs.
Jenny beobachtete zwei Möwen, die sich über weggeworfene Fritten auf der Straße hermachten. Es war noch nicht mal Mittag, und sie hatte bereits drei Gin Tonics intus. Was ganz offensichtlich ein Fehler war, allerdings einer, den sie durchaus begrüßte. Sie betrat das The King’s Wark, den alten Pub, wo sie zum ersten Mal mit Liam gesprochen hatte, zu dem Zeitpunkt in ihrer Eigenschaft als Privatermittlerin, engagiert von seiner misstrauischen Frau, um ihn zu beschatten. Eine Zeit lang war es dann ihr Lokal, ein Running Gag, aber jetzt war Liam Jennys Ex, also, wer lachte zuletzt?
Sie kannte die Barfrau nicht, klein und mit kräftigen Beinen, Pferdeschwanz und polnischem Akzent. Sie bestellte einen GT, zeigte ihr auf ihrem Telefon das Foto von Craig und erhielt nur ein Kopfschütteln. Er geisterte irgendwo dort draußen herum und lauerte darauf, sie wieder heimzusuchen.
Sie schlürfte den Drink und schaute sich um. Fast leer bis auf zwei Frauen mittleren Alters in Kostüm an einem Fenster, die früh zum Mittagessen da waren. Jenny fragte sich, wie es wohl wäre, jeden Tag in ein Büro zu gehen, Small Talk am Wasserspender, Tratsch über Debbie aus der Buchhaltung, was Nigel mit seinen Haaren gemacht hatte und wann er sich endlich outete. Tatsächlich war so was noch nie ihr Ding gewesen, hatte sie sich doch ihr Leben lang als Außenseiterin gefühlt. Andererseits war das vielleicht auch nur ihre Art der Rechtfertigung, keine Freunde zu haben und mit sechsundvierzig bei ihrer Mum zu wohnen.
Die Tür ging auf, ließ Verkehrslärm und ein bisschen Sonne herein. Gegen ihren Willen schaute Jenny auf und verspürte mehr als nur einen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht Liam wäre. Blöd, aber sie konnte nichts dagegen machen. Sie hatte letztes Jahr mit ihm Schluss gemacht, weil es zu gefährlich war, sich in ihrer Nähe aufzuhalten, hatte es dann aber bedauert, als die Monate verstrichen und Craig nicht gefunden wurde. Liam arbeitete immer noch im Victoria Quay, einem Regierungsgebäude, und hatte immer noch sein Kunstatelier direkt um die Ecke, daher war es kein völlig abwegiger Gedanke, dass er hereinkommen könnte.
Aber natürlich war er es nicht, es war eine dritte schick gekleidete Geschäftsfrau, die zu den beiden anderen ging, Lächeln und Umarmungen, ein Gläschen Wein, einfach nur Leute, die auf eine Art befreundet waren, die Jenny nur schwer nachvollziehen konnte.
Sie nippte an ihrem Glas und überlegte, Liam anzurufen, wie sie es bereits Hunderte Male getan hatte, wenn sie hier saß und sich ein neues Leben wünschte. Ihr Handy summte, eine Nachricht aus dem Universum. Sie schluckte, als sie es aus der Tasche zog, aber es war nur eine Erinnerung ihres Kalenders: McEwan Hall, 12 Uhr mittags.
Scheiße, das hatte sie völlig vergessen, was war sie für eine beschissene Mum. Sie leerte ihren Gin und ging zur Tür, war auf dem Weg zur Abschlussfeier ihrer Tochter.
3HANNAH
Sie kam sich ziemlich albern vor in dem schlabbrigen schwarzen Talar über einem dunklen Kostüm, das sie sich von Indy geborgt hatte. Als Studentin besaß Hannah keine schicken Klamotten, aber Indy benötigte anständige Kleidung, wenn sie mit Hinterbliebenen zu tun hatte. Das Etikett im Nacken kratzte Hannah, sie spürte das Gewicht der olivgrünen Kapuze mit dem weißen Kunstpelz-Besatz. So viel dämliche Tradition war hier im Spiel, aber wenigstens trug keiner mehr diese absolut lächerlichen Kappen mit der viereckigen Platte samt Quaste auf dem Scheitel.
Die McEwan Hall brodelte vor Energie, Hunderte Absolventen in den Farben ihres Fachgebiets, Freunde und Familien im Innenraum und auf den Galerien. Hannah schaute zu der kunstvoll verzierten Kuppel auf, das wenige Tageslicht, das durch die Fenster hoch oben hereinfiel, die riesige Pfeifenorgel vorn auf der Bühne. Studenten gingen forsch und im Gänsemarsch über die Bühne, bekamen mit einer alten Mütze einen Klaps auf den Kopf, erhielten Schriftrollen und wurden fortgeführt. Sie blickte zur Galerie auf und entdeckte Jenny, Dorothy und Indy, die zu ihr hinabstrahlten. Eigentlich machte sie das alles hier nur für sie, denn ihr selbst war’s völlig schnurz.
Schon bald war sie dran, verließ schlurfend ihre Sitzreihe, hinauf auf die Bühne, hörte, wie ihr Name verlesen wurde. Sie schaffte es, während ihrer zehn Sekunden des Ruhms nicht zu stolpern, dann zurück zu ihrem Platz. Ein Einserabschluss in Physik an der University of Edinburgh war schon eine Hausnummer, aber fast hätte sie es nicht geschafft. Wegen alldem mit ihrem Dad hatte sie ein hartes drittes Jahr gehabt, aber als er dann abtauchte, hatte sie die bewusste Entscheidung getroffen, ihren Scheiß geregelt zu bekommen, sich nicht ihr Leben diktieren zu lassen von ihm. Also hatte sie sich in ihrem letzten Studienjahr richtig reingekniet, in Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie und Kosmologie geschwelgt, ihre ganze Energie aufs Studieren und Überarbeiten, Experimentieren und Schreiben verwandt. Und hier war sie nun, eine der Besten ihres Jahrgangs, mit einer finanziell voll abgesicherten Doktorandenstelle am Institut für Astrophysik.
Applaus brandete durch den Saal. Hannah registrierte, dass die Feier vorbei war und alle strahlten. Sie sah ihre Studienkameraden an, fühlte sich ihnen verbunden, aber mehr auch nicht, denn die meisten gingen ihr wegen der Sache mit Craig aus dem Weg, dazu dann noch das Bestattungsunternehmen und die Arbeit als PI. Sie war keine normale Studentin. Sie klopfte mit den Fingern auf die zusammengerollte Urkunde; sie mochte ja vielleicht keine normale Studentin sein, aber sie war definitiv eine gute.
Die versammelte Professorenschaft verließ die Bühne und den Saal, ein alter Mann an der Spitze schwenkte einen Stock mit prächtig verziertem, silbernem Knauf. Hannah sah ihre Familie stehend applaudieren. Sie schenkte ihnen ein herzliches Lächeln und wedelte mit ihrem Diplom, dann trat sie aus der Tür und blinzelte in der Sonne.
• • •
Im Sonder war viel los für die Mittagszeit, größtenteils Absolventen und deren Familien. Wenigstens war sie nicht die Einzige in Talar und mit Kapuze. Sie saß mit ihrer Gran auf einer Seite einer Tischnische am Fenster, Jenny und Indy saßen ihnen gegenüber. Das Lokal war in Minzgrün und Grau gehalten, die ausgelastete offene Küche hell erleuchtet.
Hannah warf einen Blick in die Speisekarte, ausgefallenes Zeugs für einen Zehner pro Vorspeise und einen Zwanziger für ein Hauptgericht. Auf der Speisekarte gab es eine Erklärung für den Namen des Restaurants: »Sonder: Die Erkenntnis, dass jeder Passant ein so lebendiges und komplexes Leben führt wie du selbst.« Sie schluckte zustimmend und dachte daran, womit die drei anderen Frauen am Tisch ihren Lebensunterhalt bestritten: Sie traten zu einem schrecklichen Zeitpunkt in das Leben von Menschen und behandelten ihre Trauer, als wäre es das Kostbarste auf der Welt. Was ja auch so war.
Sie schaute aus dem Fenster und sah einen jungen Mann mit Decken über den Schultern, der vor dem Geldautomaten auf der anderen Straßenseite bettelte. Sie dachte über sein lebendiges und komplexes Leben nach, die schlechten Entscheidungen und Schicksalsschläge, die ihn an diesen Ort geführt hatten. Dachte daran, wie leicht es wäre, genauso zu enden. Dann musste sie fast zwangsläufig an ihren Dad denken, der sich irgendwo versteckte, schuldig, aber in Freiheit.
Indy klopfte mit einem Messer gegen ihr Glas. Dorothy hatte Champagner bestellt, und Hannah konnte sich nicht erinnern, ob sie das Zeug schon mal getrunken hatte.
Indy strahlte. »Ich würde gern was sagen.«
Hannah strahlte zurück.
»Also, zuerst mal gratuliere ich dieser wunderbaren Frau zu ihrer gottverdammten Eins in Physik.« Sie blickte Hannah in die Augen, die spürte, wie ihr das Herz aufging. »Sie hat so hart dafür gearbeitet, sie hat’s echt verdient. Es wäre so leicht gewesen, einfach zu sagen, ›scheiß drauf‹, und sich ein Jahr freizunehmen, aber, Hannah, du bist so stark, viel stärker, als du selbst weißt, und ich bin unglaublich stolz, dich meine Freundin nennen zu dürfen.«
Indy griff über den Tisch, nahm Hannahs Hand und blickte in die Runde. »Auf Hannah.«
Hannah errötete, und die Bläschen kitzelten in ihrem Hals, als sie den Champagner trank.
Indy zog ihre Hand zurück. »Da ist noch etwas.«
Sie stellte ihr Glas ab. Sie trug ein tief ausgeschnittenes rotes Kleid mit großem Blumendruck, wie etwas von Georgia O’Keefe, und, was am besten war, es hatte Taschen. Hannah hatte keine Ahnung, wo Indy solche Sachen immer fand. Indy strich ihre grün gefärbten Haare hinters Ohr und schluckte.
»Ich hab gerade gesagt, ich wäre so stolz darauf, dich meine Freundin nennen zu dürfen«, sagte sie. »Aber ich hab gehofft, ich könnte dich anders nennen.«
Sie rutschte aus der Nische und nahm etwas aus ihrer Tasche. Sie kniete sich hin, öffnete das Ringkästchen und hielt es Hannah hin, die sich auf einmal ganz benommen fühlte. Es war ein Platinring mit einem kleinen Smaragd in der Mitte, die Fassung ein verflochtenes Hindu-Muster. Hannah starrte ihn an und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Hannah, würdest du mir die Wahnsinnsehre erweisen und meine Frau werden?«
Hannah sah sie an, Indys leuchtende Augen, ihr liebevolles Lächeln, und die Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie registrierte vage, wie ihre Mum und Gran lächelten, aber in diesem Moment existierte in ihrem Universum nur eine einzige Person.
»Natürlich«, sagte sie, zog Indy hoch und küsste sie.
• • •
Die Meadows platzten förmlich vor Leben, als Hannah und Indy Arm in Arm die Melville Terrace hinunterschlenderten. Oder vielleicht war es einfach auch nur Hannahs Gemütslage oder der tagsüber getrunkene Champagner, den sie nicht gewöhnt war. Indy drückte Hannahs Arm und legte den Kopf auf ihre Schulter, und glückselig verliebt wippten sie auf ihren Absätzen.
Barbecueduft zog ihr von der anderen Straßenseite in die Nase, sie sah Leute mit Frisbees und Fußbällen spielen, hörte die typischen Schläge von Bällen auf den Tenniscourts. Elstern flitzten zwischen den Bäumen, Hunde nahmen Witterung auf, Eichhörnchen klammerten sich an Baumstämme.
Sie erreichten die Ecke Argyle Place, und Hannah sah zu ihrer Wohnung hinüber. Es müssten Millionen Sachen vor der Hochzeit geklärt werden, aber daran dachte sie nicht, sie versuchte nur, jeden einzelnen Moment aufzusaugen.
Indy öffnete die Tür zum Treppenhaus, drehte sich um, drückte sie gegen die Wand und küsste sie lange und fest. Hannah erwiderte den Kuss.
»Uff«, machte Indy. »Ich liebe dich.«
»Gleichfalls, Babes.«
Beide sprachen mit einem Lachen in der Stimme.
Sie gingen drei Treppenabsätze hinauf, und Indy wollte schon die Tür aufschließen, runzelte dann jedoch die Stirn. Sie war nur angelehnt. Indy stieß mit der Hand dagegen, und sie schwang auf. Als Indy hineinging, bemerkte Hannah, dass das Holz um das Schloss herum zersplittert war.
»Was ist hier los?«, raunte Hannah.
Indy stand im Flur. Hannah sah an ihr vorbei zu dem großen Plakat, das quer über der hinteren Wand hing. »HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!« in bunter Schrift, drei überflüssige Ausrufungszeichen am Ende, auf einem Hintergrund mit Partyballons und Luftschlangen.
Hannah berührte den noch ungewohnten Ring an ihrem Finger, drehte ihn mit der anderen Hand, stellte sich vor, wie Champagner-Blut in ihre Fingerspitzen perlte.
Indy drehte sich zu Hannah um, schüttelte den Kopf.
»Ich war das nicht«, sagte sie, und Hannah wusste sofort, was das bedeutete.
4JENNY
Jenny folgte Dorothy in die Küche.
»Mein Gott, Mum, ist das der Fuß?«
Mitten auf dem Küchentisch in der Größe und Form eines Fußes lag ein Kackebeutel.
»Sorry«, sagte Dorothy, hob ihn am zugebundenen Ende auf und warf ihn mit Schwung auf die Arbeitsfläche der Küche. »Irgendwohin musste ich ihn ja tun, damit der Hund oder die Katze nicht rankamen.«
»Wir haben unten sechs große Leichenkühlschränke.«
»Alle belegt.« Dorothy füllte den Wasserkessel an der Spüle und schaltete ihn ein.
Jenny sah zu den beiden großen Whiteboards an der einen Wand ihrer Wohnküche hinüber, das eine für Bestattungen, das andere für die Fälle der Detektei. Das mit den Beerdigungen war voll, jede Menge Arbeit mit Toten. Auf dem der Detektei war deutlich weniger los, lediglich eine noch laufende Suche nach einer vermissten Person und ein möglicherweise untreuer Ehemann, heutzutage ihr Alltagsgeschäft.
Das Zischen und Rauschen des Kessels wurde lauter, während Dorothy den Tee machte und den Tisch mit einem feuchten Tuch abwischte, wo zuvor der Fuß gelegen hatte.
»Prima Hygienekonzept«, meinte Jenny trocken, als sie zum Fenster ging und auf den Bruntsfield Links hinausschaute. Spätnachmittag, und der Park war voll, Familien, Studierende und Touristen, die die unerwartete Sonne genossen. Die Asche ihres Dads war dort draußen verstreut, und sie stellte sich gern vor, dass sein Geist ins Gras gesickert war, auch wenn sie so etwas nicht glaubte. Aber wenn sie so etwas jedes Mal dachte, wenn sie aus diesem Fenster schaute, war es dann nicht so was, wie daran glauben? Die Arbeit in der Begräbnisbranche hatte ihr klargemacht, dass Wahrheit angesichts des Glaubens nicht viel zählte. Bei dem Kram der Detektei ging es mehr um Wahrheit, allerdings war sie nicht überzeugt, dass es immer half, die Wahrheit zu kennen.
Schrödinger kam hereingeschlichen, schlug wie gewöhnlich einen großen Bogen um sie und streckte sich dann in einem breiten Sonnenstrahl, der auf einen Sessel fiel. Der Kater hatte immer noch die drahtige Statur und die verächtliche Grundhaltung seiner Wurzeln als Straßenkatze. Einstein folgte der Katze in den Raum, hob schnuppernd die Nase zu dem Fuß in der Tüte auf der Arbeitsfläche, wedelte dann mit dem Schwanz Schrödinger zu, der ihn ignorierte. Es war im Grunde mitleiderregend, aber beide schienen etwas aus ihrer Beziehung zu ziehen, denn warum sonst sollten sie sie haben?
»Ich glaub’s immer noch nicht, dass meine Tochter heiraten wird«, sagte Jenny und drehte sich zu ihrer Mum um.
Dorothy lächelte. »Ich weiß. Unsere kleine Hannah.«
Jenny war alles andere als rührselig, was die Ehe betraf, dafür sorgte schon ein gescheiterter Versuch mit einem Scheißmörder, aber Hannah und Indy waren grundsolide, so viel stärker als alles, was sie je gehabt hatte, eine Tatsache, die einen Anflug von Reue in ihr aufkeimen ließ.
Dorothy stellte zwei Becher mit Tee auf den Tisch und setzte sich. »Weißt du noch, wie dein Dad sie sich im Garten immer auf die Schultern gesetzt hat, als sie noch klein war? Wie sie auf und ab hüpften bei dem Versuch, an die Ringeltauben in den Bäumen heranzukommen? Ich dachte immer, das bringt ihn noch um.«
Sie wurde nachdenklich. Die Trauer starb nie, sie schlummerte nur und überraschte einen wie aus heiterem Himmel mit Wellen des Schmerzes. Das Spielen mit seiner Enkelin hatte ihn nicht umgebracht, das erledigte später ein Herzinfarkt.
»Sie hat so ein Glück, Indy zu haben«, sagte Jenny.
Sie freute sich wahnsinnig für Hannah, aber ihre eigene Ehe war gescheitert, und jetzt hatte sie einem Typen den Rücken gekehrt, mit dem sie vielleicht eine zweite Chance gehabt hätte. Dorothys über fünfzigjährige Ehe war vorbei, aber zumindest war sie jetzt mit Thomas, ihrem ehemals nur platonischen Freund, wieder im Rennen. Jenny war ihm in letzter Zeit einige Male frühmorgens in der Küche begegnet, also schlief er hier.
Dorothy trank ihren Tee in kleinen Schlucken. »Wir haben alle ein Glück, dass wir uns haben.«
Eine so offenkundige Feststellung, dass sie keine Antwort brauchte, aber es war gut, die Wahrheit zu hören.
Jenny nahm ihren Tee und deutete mit dem Kopf auf die Tüte auf der Arbeitsfläche. »Was ist jetzt mit dem Fuß?«
»Thomas ist aufgehalten worden, er wird bald hier sein.«
»Was denkst du?«
»Noch nichts.«
»Dann ist es also einfach nur ein menschlicher Fuß, der im Park aufgetaucht ist?«
Dorothy zuckte mit den Achseln.
Jenny trank einen Schluck. »Männlich oder weiblich?«
»Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, es ist der Fuß einer Frau, allerdings ein bisschen groß.«
Jenny starrte die Tüte an, stellte sich vor, wie sie von der Arbeitsfläche hüpfte und aus dem Haus ging. Unten wurde eine Tür zugeschlagen, dann Schritte. Jenny stellte sich einen zweiten Fuß vor, der jetzt auf der Suche nach seinem Kollegen zwei Stufen auf einmal nehmend heraufgesprungen kam.
Hannah kam durch die Tür gestürmt, Indy ihr dicht auf den Fersen, ihre Mienen aufgewühlt.
»Dad ist zurück«, sagte Hannah.
Jenny schluckte, ihr wurde schlecht.
Dorothy reckte die Schultern. »Was?«
Hannah erzählte ihnen von dem Einbruch, dem Plakat zum erfolgreichen Abschluss, sah Indy Bestätigung suchend an, aber für Jenny fühlte es sich an, als wäre die Lautstärke im Raum heruntergedreht und von einem Klingeln übertönt worden, das sich zu einem Getöse steigerte. Urplötzlich registrierte sie jedes Stäubchen, das durch den Sonnenstrahl schwebte, das tiefe, pulsierende Schnurren, das Schrödinger in seinem Hals machte, das Wischen von Einsteins Schwanz auf den Bodendielen.
»Bist du sicher, dass er es war?«, fragte Dorothy.
Aber wer sonst sollte am Tag ihrer Abschlussfeier in ihre Wohnung einbrechen und ein Plakat aufhängen, um sie wissen zu lassen, dass er an sie dachte, um sie wissen zu lassen, dass sie niemals sicher wäre, um einen eiskalten Pfahl in ihr Herz zu rammen, gerade als sie dachte, sie hätte sich von ihm befreit.
Hannah ging die Luft aus, Indy stand jetzt etwas abseits, als hätte Craigs Irrsinn sie ein Stück weit auseinandergebracht.
Dorothy nickte. »Du solltest hierherziehen, nur für eine Weile. Um sicher zu sein.«
Hannah sah Jenny an. »Mum, du hast nichts gesagt.«
Jenny schüttelte den Kopf. Ihr ganzer eigener Scheiß kam ihr jetzt in den Weg, sie musste das hier so logisch wie möglich anpacken. Sie hatte das in der Vergangenheit nicht getan, und das war einer der Gründe, warum Craig immer noch dort draußen war.
»Wir müssen es der Polizei sagen, klar. Hast du das schon gemacht?«
Indy schüttelte den Kopf. »Wir sind direkt hierher.«
Klang vernünftig, denn die Skelfs waren das stützende Netz, der Trost in all dieser Scheiße.
Dorothy stand auf. »Thomas ist ja sowieso auf dem Weg hierher, um sich den Fuß anzusehen.«
Hannah runzelte die Stirn. »Was für ein Fuß?«
Dorothy nickte genau in dem Augenblick zu der Tüte auf der Arbeitsfläche, als es unten klingelte. »Das wird er sein.« Sie nahm die Tüte und ging zur Tür.
5DOROTHY
Thomas gab ihr am Empfang einen Kuss auf die Wange und stellte ihr dann Emilia von der Spurensicherung vor. Emilia war hübsch, schlank, blonder Pferdeschwanz, etwa Mitte dreißig, und Dorothy durchfuhr ein Schuss Neid auf ihre Jugend.
Dorothy nahm Thomas’ Hand. »Hör zu, Hannah ist oben, sie sagt, Craig wäre in ihre Wohnung eingebrochen.«
»Mit ihr alles okay?«
»Ja, ihr geht’s gut, sie ist nur ein bisschen aufgewühlt. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Kannst du mit ihr sprechen?«
»Klar.«
Dorothy schaute die Treppe hinauf, dann fiel ihr Blick auf die Tüte in ihrer Hand.
»Vielleicht lässt du ihr noch ein paar Minuten, um sich zu beruhigen, sie läuft ja nicht weg. Wir sollten uns vorher um den Fuß kümmern.«
»Ist er das?«, fragte Thomas mit Blick auf die Tüte.
Dorothy nickte zum hinteren Teil des Gebäudes. »Lass uns in den Versorgungsraum gehen.«
Sie ging voraus zu dem abgetrennten Teil auf dem Gelände der Skelfs. Vorn standen Lilien und Eichenmöbel, befanden sich Aufbahrungsräume und die Kapelle für die Abschiednahme, plüschiger Teppichboden und Kartons mit Taschentüchern. Den Gang hinunter und durch eine Tür gelangte man in den geschäftlichen Bereich, den Versorgungsraum, der hauptsächlich für Einbalsamierungen genutzt wurde, und die Leichenkühlfächer, die Sargwerkstatt sowie das Lager, fahrbare Bahren vor der Garage, wo der Leichenwagen und der Transporter parkten. Dorothy spürte die Kälte der Klimaanlage, sobald sie den Versorgungsraum betraten, und sah Archie über den Körper von Mrs Raven gebeugt, einer älteren Dame, die nach sehr kurzer Krebserkrankung friedlich im Schlaf verstorben war. Dorothy wünschte all ihren Kunden einen so freundlichen Tod, doch die Wahrheit sah ganz anders aus. Es gab so viele schmerzhafte, in die Länge gezogene und würdelose Tode – Demenz, ALS, Parkinson –, da war es nicht weiter überraschend, sich ein schnelles, einfaches Ende zu wünschen.
Archie schaute von Mrs Raven auf und nickte. Die Balsamierungspumpe tuckerte vor sich hin, presste künstliches Leben in ihre Adern. Mrs Raven war nur fünf Jahre älter gewesen als Dorothy, was sie schwer schlucken ließ.
»Kannst du bitte mal rüberkommen?«, bat Dorothy.
Archie warf einen Blick auf das Display der Pumpe, schloss sich ihnen dann vor dem zweiten metallenen Leichentisch an. Er war etwa in Jennys Alter, wirkte aber älter, hatte eine rasierte Glatze, einen gepflegten Vollbart, war stämmig und zurückhaltend. Er schien mit dem Tod seiner eigenen Mutter im Jahr zuvor ganz gut klargekommen zu sein. Es hatte sein Cotard-Syndrom nicht verschlimmert, er war dank seiner Medikamente ausgeglichen und engagiert geblieben, und dafür war Dorothy dankbar. Er war die unverzichtbare Maschine des Unternehmens, ohne ihn lief gar nichts.
Dorothy legte die Tüte auf den Tisch. Sie wirkte zu klein. Sie blickte kurz zu den Ablaufrinnen des Tischs, dachte an abfließende Flüssigkeiten. Sie sah zu den sechs Kühlfächern hinüber, jedes mit einer magnetischen Tafel an der Tür, auf denen die Details der darin liegenden Person standen. Es war ein Geschäft, natürlich, aber auch mehr als das.
Emilia öffnete einen kleinen Koffer und nahm blaue Nitrilhandschuhe heraus, öffnete die Tüte und drückte die Seiten herunter, wodurch der Fuß sichtbar wurde. Dorothy zog ein billiger Duft in die Nase, und sie erkannte es als das Zeug, mit dem man diese Tüten einsprühte, um den Geruch nach Scheiße zu kaschieren. Der Fuß selbst verströmte lediglich einen leichten, grasig-erdigen Geruch.
Emilia sah zu der Reihe Kühlfächer hinüber.
»Bevor Sie etwas sagen«, sagte Archie, »der gehört zu keiner von uns.«
Als Archie zur Arbeit gekommen war, hatten sie als Erstes sämtliche Leichen in den Kühlfächern überprüft, nur für alle Fälle. Archie hatte ihr versichert, dass es nicht möglich sei, und natürlich hatte er recht.
Dorothy warf einen kurzen Blick auf Mrs Ravens nackte Füße, die kleiner, aber breiter waren als der auf diesem Tisch hier. Sie sah wieder den einzelnen Fuß an, bemerkte, dass der zweite Zeh länger war als die Großzehe. Bedeutete das nicht irgendwas? Es war ein linker Fuß, und Dorothy fragte sich zum hundertsten Mal an diesem Tag, wo wohl der rechte war.
Emilia hob ihn auf, die Fingerspitzen dabei auf Ferse und Zehen gedrückt, und drehte ihn um.
»Weiblich, Größe 40, würde ich sagen. Der Elastizität der Haut nach zu schließen, würde ich auf einen älteren Menschen tippen. Eine bessere Vorstellung bekommen wir nach einer gründlichen Untersuchung im Labor.«
Sie strich einen Finger über die Sohle, und Dorothy spürte, wie sich ihre Zehen krümmten, als ihr eigener Fußballen vor einer eingebildeten Berührung zurückzuckte. Sie fragte sich, ob es Archie genauso erging, wenn er mit den zahllosen Leichen beschäftigt war, die durch diesen Raum gingen.
Emilia strich über den Spann des Fußes, über den Rist zum Knöchel. »Er ist balsamiert worden.«
»Interessant«, sagte Thomas.
»Ach, ja?«, meinte Dorothy.
»Nun, daraus ergeben sich Schlussfolgerungen.«
»Zum Beispiel, dass es sich nicht um einen Mord handelt.«
»Nicht unbedingt.« Thomas fuhr mit einem Finger um sein Kinn.
Dorothy beobachtete ihn und spürte ein Vibrieren im Bauch. Für einen Mann in den Fünfzigern war er ziemlich attraktiv und schlank, die Haare raspelkurz, der Bart grau meliert. Er besaß ein hart erkämpftes Selbstvertrauen nach Jahren als schwarzer Schwede bei der schottischen Polizei, aber es wirkte völlig ungezwungen. Sie dachte daran, wie seine Hände im Bett über ihren nackten Arm glitten, ihre Seite hinunter, über ihren Po und weiter über den Oberschenkel. Vor etwas über einem Jahr hatte sie ihn zu so etwas wie einem Rendezvous eingeladen, und sie ließen es langsam angehen. Sie waren beide verwitwet, hatten den Partner des jeweils anderen gekannt. Dorothy war fünfzig Jahre verheiratet gewesen, Thomas dreißig. Diese Geister ließen einen niemals los, aber der Trick bestand darin, sich mit seinem Geist zu versöhnen und sich nicht von ihm vorschreiben zu lassen, wen man küssen oder berühren oder mit wem man ins Bett gehen durfte. Sie und Thomas schliefen schon seit einigen Monaten miteinander. Es hatte mit dem einfachen Vergnügen begonnen, dass ein Mann ihren Körper berührte, eine feste Präsenz in ihrem Bett, dann wurde es mehr, erheblich mehr. Sie fühlte sich jetzt bei ihm zu Hause. Sie hatte zugelassen, geliebt zu werden, und sich ihm geöffnet. Die Liebe bestand nicht aus großen Gesten und Feuerwerksmomenten, sondern vielmehr aus dem gemeinsamen Gang zum Bäcker, dem gemeinsamen Frühstück am Morgen, dem Aufheben eines Haares vom Pullover des anderen, ohne groß darüber nachzudenken.
»Es ergibt nicht viel Sinn, dass man sie einbalsamiert, nachdem sie ermordet wurde«, sagte Emilia.
Thomas nickte Dorothy zu »Einen Fuß auf den Bruntsfield Links zu finden aber auch nicht.«
Dorothy lächelte. »Stimmt.«
Die Spurensicherung war bereits draußen und suchte, aber Dorothy hatte bereits nachgesehen, wo Einstein aus den Bäumen gekommen war, und da war nichts, nur eine kleine Baumgruppe, eine Kaffeebude und eine öffentliche Toilette.
Dorothy hörte ein rhythmisches Klopfen und Schlagen von ganz oben im Haus und sie warf einen Blick auf die Uhr. Emilia sah sie an, die beiden anderen kannten es lange genug, um Bescheid zu wissen.
»Das ist Abi«, sagte Dorothy. »Übt Schlagzeug. Sie wohnt bei uns.«
Emilia wirkte verwirrt, aber Dorothy zuckte nur mit den Achseln, es wäre zu viel zu erklären gewesen. Das Schlagzeug rumorte im Hintergrund, Abi ließ ordentlich Dampf ab.
»Darf ich?«, fragte Archie, streckte die Hände aus, trug noch seine blauen Handschuhe.
Emilia vergewisserte sich bei Thomas, dann gab sie ihm den Fuß.
Archie drückte zuerst auf den Rist, dann auf das Gewölbe, spreizte die Zehen und fuhr mit der Hand über die Ferse. »Beschissene Arbeit.«
»Was?«, fragte Emilia.
»Die Einbalsamierung ist furchtbar. Wenn das bei meinem Angehörigen so gemacht worden wäre, würde ich mein Geld zurückverlangen. Hier wurde nicht anständig drainiert, eine billige Austauschflüssigkeit verwendet, insgesamt eine handwerklich schlecht ausgeführte Arbeit.«
Thomas kniff die Augen zusammen. »Könnten Sie sagen, wo das gemacht worden ist?«
Archie schnalzte mit der Zunge. »Ich kann mich umhören.«
Emilia nahm den Fuß zurück. »Wir nehmen im Labor eine DNA-Probe. Außerdem können wir uns vielleicht ein Bild davon machen, was sie getötet hat.«
Archie sah Thomas an, dann Dorothy, dann wieder den Fuß.
»Na ja, da wär natürlich der Tierverbiss.« Er streckte eine Hand aus und berührte den schartigen Knöchel, lose Hautlappen, den bleichen Knochen, der aus dem schwammartigen Fleisch herausragte. »Das hier sieht aus, als wäre darauf herumgekaut worden.«
»Von wem?«, fragte Thomas.
Dorothy schüttelte den Kopf. »Ich hab nicht gesehen, dass es Einstein war.«
Archie zuckte mit den Achseln. »Dann muss es wohl was anderes gewesen sein.«
»Oder jemand anderer«, ergänzte Emilia.
6HANNAH
Es war ein dreißigminütiger Fußweg vorbei an den großen Häusern von The Grange und Blackford und weiter den Berg hinauf zum Royal Observatory. Hannah wurde schlecht bei dem Gedanken, dass Dad in ihre Wohnung eingedrungen war. Sie wusste nicht, wann sie und Indy wieder zurückziehen könnten, und war einfach nur froh, dass Gran sie aufgenommen hatte. Wann würde diese Scheiße endlich aufhören? Und sie waren nicht mal im Haus der Skelfs sicher, denn Craig kannte es gut, fast alle Frauen seines Lebens drängten sich dort ängstlich zusammen. Nein, so durfte sie nicht denken. Sie hatte jetzt diesen Termin, und ihr Leben musste so normal wie möglich sein. Sie war eine verlobte Frau, um Himmels willen, und sie sollte eigentlich glücklich sein.
Sie ging den grasbewachsenen, von Ginster und Weiden gesäumten Weg am Rand des Blackford Hills hinauf, Bienen schwirrten von einem Strauch zum anderen, Hunde folgten irgendwelchen Witterungen durch das Gestrüpp. Sie dachte an Einstein mit dem Fuß im Maul. In was für eine verrückte Scheiße war Dorothy jetzt wieder hineingeschlittert?
Die Sonne brannte vom Himmel und Hannah hatte feuchte Flecke unter den Armen, als sie den Gebäudekomplex des Campus erreichte. Der sechseckige grüne Turm des Observatoriums überragte die Gebäude aus verschiedenen Epochen, Torpfosten mit verzierten Lampen flankierten den Eingang. Sie war in ihrem letzten Studienjahr zu Kursen über frühe Kosmologie und Astrobiologie schon einmal hier gewesen. Sie hielt sich links zum Higgs Centre for Innovation. Es handelte sich um ein neues Gebäude aus Stein und Glas, dessen weitläufige Rotunde das Observatorium spiegelte. Die Universität Edinburgh hatte aus dem Nobelpreis für Peter Higgs Kapital geschlagen, indem sie dieses Gebäude in enger Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen errichtete und bei der Gelegenheit den die Straße hinunter gelegenen Fachbereich für theoretische Physik ebenfalls nach Higgs zum Higgs Centre for Theoretical Physics umbenannte.
José Ramírez erwartete sie an der Rezeption und begrüßte sie mit einem herzlichen Handschlag. Er war klein und stabil gebaut, hatte dichtes schwarzes Haar und einen Bart, trug die typische Postgraduierten-Kleidung: kariertes Hemd, verschlissene Jeans und Converse-Turnschuhe.
»Hannah Skelf?«, fragte er. »Ich führ dich mal bei uns herum.« Sein spanischer Akzent mit gerolltem »r« war deutlich.
Er war sehr freundlich, während er sie durch eine Handvoll Gebäude führte, vom futuristischen Higgs-Komplex bis zum viktorianischen Observatorium neben prosaischeren Büros der Postdocs, wo sie nickend und lächelnd eine ganze Reihe Leute begrüßte. Der Besuch hier war ein reines Entgegenkommen ihrerseits, denn ihren Doktortitel hatte sie in der Tasche. Normalerweise führte das Institut für Astrophysik Vorstellungsgespräche mit potenziellen Bewerbern, aber sie hatte ein Examen mit Auszeichnung hingelegt, arbeitete bereits an der Universität und hatte sich praktisch schon der mit Exoplaneten befassten Forschungsgruppe verpflichtet. Sie nutzten die aktuellsten Daten der Kepler-Missionen der NASA, um Planeten, die in der Nähe anderer Sterne gefunden wurden, zu kategorisieren und ihre Merkmale zu definieren, um herauszufinden, welche davon erdähnlich waren. Es war ein ständig wachsendes Forschungsgebiet mit Tausenden von neuen Planeten, und es gab sogar ein quelloffenes, für die breite Allgemeinheit geöffnetes Projekt, nachdem die NASA Unmengen an Daten freigegeben hatte, damit Leute selbst forschen konnten.
Genau darüber sprach José gerade, nannte es das Planetenjäger-TESS-Projekt.
»Das steht für Transiting Exoplanet Survey Satellite«, sagte er und lispelte dabei die Zischlaute.
Er saß vornübergebeugt an dem Tisch im Café und spielte mit seinem leeren Wegwerfbecher.
»Ich selbst habe bereits acht mögliche Planeten aufgespürt«, sagte er.
Der Blick aus dem Fenster hinter ihm wirkte ablenkend, ein breites Stück des Blackford Hills, grasbewachsenes Heideland, durchzogen von Wegen für Leute, die ihre Hunde ausführten, dahinter dann die Braid Hills und die Ausläufer der Pentlands. Es war fast, als gäbe es gar keine Stadt.
»Das machst du also in deiner Freizeit, ja?«, fragte Hannah.
»Ich weiß, das ist ziemlich geeky«, sagte er. »Ein Hobby zu haben, das ziemlich ähnlich ist wie unsere Arbeit hier.«
»Ich find’s cool.«
Er lächelte. »Dann wirst du wunderbar zu uns passen.«
Sie war an die skurrilen Untertöne der Physik gewöhnt, und je tiefer man in das Gebiet eindrang, desto skurriler wurde es, aber all das akzeptierte sie bereitwillig.
»Ja, ich glaube auch.«
Es war nett, hier zu sitzen, über Exoplaneten zu plaudern und nicht an Dad zu denken.
José zupfte am Rand seines Bechers herum, legte kleine Fetzen zu einem ordentlichen Häufchen zusammen. »Dann wirst du das Angebot also definitiv annehmen?«
Hannah stellte sich vor, jeden Tag hier zu sitzen, eine Pause von der Datenverarbeitung zu machen, von dem Versuch, dort draußen Planeten zu finden, auf denen Leben existieren könnte, Leben, das unserem total ähnlich sein könnte oder auch so völlig anders, dass wir es noch nicht begreifen konnten. Sie dachte an all die verschiedenen Arten von Intelligenz, die es auf unserer Erde gab und mit denen wir nicht kommunizieren konnten – Delfine, Ameisen, Bäume –, eine Milliarde Pflanzen und Tiere, die uns Menschen immer noch ein absolutes Rätsel waren. Wie konnten wir da hoffen, mit Leben da draußen im Universum reden zu können? Aber wir mussten es versuchen, denn der Versuch war das Entscheidende.
Sie bemerkte, dass sie ihm noch nicht geantwortet hatte. »Ja, werde ich.«
José nickte, zupfte weitere Stückchen aus seinem Becher, legte sie auf den Tisch. Sein Lächeln verblasste, er ließ den Kopf hängen. »Ich muss dich was fragen.«
Hannah wartete. Möwen standen draußen im Wind und sie stellte sich vor, dort draußen bei ihnen zu sein, den Wind im Gesicht, den buttrigen Duft des Ginsters.
»Du bist eine Skelf, wie diese Beerdigungsleute?«
Hannah lächelte und nickte. Sie bekamen ihre Aufträge auf alle möglichen Arten, meistens aber durch Mundpropaganda.
José hob den Kopf und sah sie fest an. »Und auch noch Privatdetektivin?«
Hannah hatte sich immer noch nicht ganz daran gewöhnt, selbst nach ein paar Jahren, die Geheimnisse von Leuten herauszufinden. »Richtig.«
»Vielleicht habe ich einen Fall für euch. Sagt man das so, ein Fall?«
Hannah sah ihn an. Er besaß den typisch spanischen Charme, war offen und freundlich auf eine Art, die natürlich wirkte. Er hatte haselnussbraune Augen, dicke Finger, einen feinen Haarflaum auf dem Handrücken.
»Was für ein Fall?«, fragte sie.
Er nickte und schaute sich um, so als wolle er sich vergewissern, dass niemand mithörte.
»Ich glaube, jemand versucht, mich in den Wahnsinn zu treiben.«
Hannah war überrascht: einen weißen Mann von Mitte zwanzig in den Wahnsinn treiben? »Wie meinst du das?«
José wirkte betreten. »Ich hab Nachrichten bekommen.«
»Was für Nachrichten?«
José schüttelte den Kopf. »Ich möchte keine Einzelheiten preisgeben, bevor du den Fall annimmst.«
»Was steht in diesen Nachrichten?«
»Ich bin nicht sicher.«
Hannah berührte ihr Ohr. »Ich verstehe nicht.«
José schluckte und schien eine Entscheidung zu fällen. »Die Nachrichten scheinen von … da draußen zu kommen.« Er hob das Kinn und deutete aus dem Fenster.
Hannah sagte nichts.
José starrte auf seine Hände. Den Becher hatte er inzwischen vernichtet, er war nur noch ein Haufen Papierschnipsel. »Also, nicht von der Erde.«
Oh Mann. Ein Postgrad in Astrophysik, der glaubte, Aliens wollten ihn in den Wahnsinn treiben. Hannah presste ihre Lippen fest zusammen.
José strich mit einer Hand durch sein Haar. »Ich weiß, ich weiß. Ich glaube den Nachrichten nicht, ich weiß ja, dass sie nicht echt sein können.«
»Was soll ich denn für dich tun?«
»Du sollst beweisen, dass sie Fake sind«, sagte José. »Ich möchte, dass du herausfindest, wer mich fertigmachen will. Wer immer es ist, die wissen genau, was sie tun.«
»Wer würde denn so was machen?«, fragte Hannah.
»Genau das möchte ich ja wissen«, sagte José. »Übernimmst du den Fall?«
Hannah schaute aus dem Fenster, die Möwen waren weg. Sie dachte an ihren Dad, der irgendwo dort draußen war, der ihr ebenfalls Botschaften schickte, um sie fertigzumachen. Der sie nie zur Ruhe kommen ließ.
»Mache ich«, sagte sie.
7JENNY
Wenn Jenny an Cramond dachte, stellte sie sich die Gezeiteninsel vor, den Bootsverein, Häuser am Wasser, Sommerspaziergänge mit Eiscreme. Aber Cramond Vale war nichts davon. Jenny fuhr den Van die von klotzigen Sechzigerjahre-Häusern und stummeligen braunen Mietskasernen mit winzigen Fenstern gesäumte Straße hinunter. Sie parkte vor Hausnummer 23, ging zur Haustür und klingelte.
Sophia machte mit einer Reiswaffel in der Hand auf. Ihr blondes Haar war zu einem strengen Pferdeschwanz zurückgebunden, was sie irgendwie steif und förmlich wirken ließ. Jenny versuchte, sich zu erinnern, wie alt Hannahs Halbschwester jetzt war, acht? Sie trug ein weinrotes Polohemd mit dem Logo einer Schule auf der Brust, ein altes Segelboot.
»Hi, erinnerst du dich noch an mich?«, fragte Jenny.
Jenny hatte vor einem Jahr einige Zeit bei Fiona verbracht, als es mit ihrem gemeinsamen Ex losging. Das war in Fionas und Craigs altem Zuhause gewesen, einem teuren Reihenhaus in Stockbridge. Jetzt lebten Fiona und Sophia bei Fionas Mum, und Sophia war von der Privatschule geflogen.
Sophia nickte und kaute auf ihrer Reiswaffel. »Mum hat geweint wegen dir.«
»Das war nicht wirklich so.« Jenny wollte sagen, dass Sophias Dad ihre Mum zum Weinen gebracht hatte. »Ist sie da?«
Sophia nickte und deutete mit dem Kopf hinter sich. »Hinten durch.«
Das Mädchen nahm sein Handy von einer Kommode und verschwand in einen Nebenraum. Hatten Achtjährige jetzt schon Handys? Jenny ging zur Küche, wo Fiona mit einem Laptop und einem Glas Rioja an einem kleinen Klapptisch saß, die halb leere Flasche daneben. Sie war in jeder Hinsicht weniger als Jenny, schlank, klein, wie eine Taschenbuchausgabe. Sie waren gleich alt, aber Fiona hatte immer mehr auf sich geachtet, allerdings war es ein Jahr her, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten, und jetzt hatte Fiona etwas Zerrissenes an sich, als hätte sie sich nie ganz erholt. Fiona trug immer noch den gleichen hohen Pony, hatte scharfe Gesichtszüge, war schick gekleidet, aber es umgab sie auch eine gewisse Anspannung … oder vielleicht projizierte Jenny auch nur etwas in sie hinein.
Jenny klopfte mit einem Knöchel an die offene Tür. »Hi.«
Fiona schaute auf, deutete mit dem Kopf auf einen freien Stuhl, wirkte resigniert. »Dann ist er also wiederaufgetaucht.«
Jenny hatte mit ihr telefoniert, hatte von der Sache in Hannahs Wohnung erzählt. Sie setzte sich, während Fiona ein Glas aus dem Schrank nahm, es füllte und ihr zuschob. Der Tisch war aus den Siebzigern, und die Holzplatte war übersät mit Ringen.
»Wir gehen davon aus, ja«, sagte Jenny.
Fiona räusperte sich und trank einen Schluck. »Was meint die Polizei?«
»Sie haben sich noch nicht richtig damit befasst«, sagte Jenny. »Sie haben sich in der Wohnung umgesehen, aber für mehr fehlt ihnen das Personal.«
Fiona nickte, schaute sich in der Küche um. »Hier ist vor ein paar Jahren eingebrochen worden. Mum hat oben geschlafen. Die haben sämtliche elektronischen Geräte mitgenommen, Bargeld, Autoschlüssel. Haben die Scheibe der Hintertür eingeschlagen.« Fiona sah zu der Tür, die in den kleinen Garten führte. »Die Polizei hat einen Scheiß getan. Der Beamte von der Kriminalprävention hat ihr geraten, sie solle sich eine Alarmanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung anschaffen, den Zaun höher machen und das Haus weniger angreifbar machen als das Nachbarhaus.«
Jenny nickte und trank einen Schluck Wein. Fiona schaute sich um, als stellte sie sich gerade vor, wie ein Einbrecher im Haus herumschlich und sich bediente.
»Bist du sicher, dass es Craig war?«
»Wer sonst sollte am Tag ihrer Abschlussfeier in Hannahs Wohnung einbrechen und ein Glückwunsch-Transparent anbringen?«
Fiona zuckte mit den Achseln. »Ein sexbesessener Student oder Dozent?«
Jenny biss sich auf die Lippe. »Hannah ist niemand eingefallen.«
»Aber es könnte schon sein.«
»Wär möglich, ja. Aber du kennst Craig, er war’s.«
Fiona trank einen Schluck. »Ja, scheiße, er war’s.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich hab blöderweise gedacht, er würde uns vielleicht in Ruhe lassen. Würde vielleicht einfach verschwinden, irgendwo ein unauffälliges Leben führen.«
»Das ist nicht wirklich sein Ding.«
»Nein.«
Sie hatten beide eine Tochter von dem Mann, beide kannten sie ihn nur zu gut. Sie waren beide auf seinen Charme hereingefallen, sein Selbstbewusstsein, wie er das Gefühl vermitteln konnte, man wäre die wichtigste Frau auf der Welt.
Fiona zeigte auf ihren Laptop. »Es war so naheliegend, ich glaub’s einfach nicht, dass ich nie daran gedacht hab.«
Jenny schüttelte den Kopf. »Wir wussten ja nicht mit Sicherheit, dass er noch in der Nähe war. Er hätte auch nach Thailand oder Venezuela verschwunden sein können.«
»Er ist noch hier.« Fiona sah wieder aus dem Fenster auf den zwei Meter hohen Zaun am Ende des Gartens, senkrecht angebrachte Holzlatten, obendrauf NATO-Draht.
»Er hat diese Adresse«, sagte Fiona, gestikulierte mit einer Hand. »Er weiß auch, wo du wohnst.«
Jenny dachte an das Haus der Skelfs, ein Leuchtfeuer am Rand des Bruntsfield Links. Komm und hol mich, sagte es, komm zu den Skelfs und mach uns fertig.
»Genau.«
Fiona tippte auf den Bildschirm des Laptops. »Du denkst also, einer unserer früheren Klienten hilft ihm?«
Jenny zuckte mit den Achseln. »Wir wissen, dass er seit einem Jahr in Edinburgh oder ganz in der Nähe lebt. Wie ist das möglich? Ich kontrolliere regelmäßig Herbergen und Obdachlosenunterkünfte, nichts. Seine Kreditkarten sind nicht benutzt worden, auf seinem Girokonto hat sich nichts getan. Er muss von irgendwem Hilfe bekommen. Er muss an Essen herankommen und im Warmen sein. Wie kriegt er das hin?«
Fiona trank wieder einen Schluck Rioja. Sie hat schon immer tagsüber etwas getrunken, aber das jetzt wirkte wie mehr. Sophia kam herein, holte ein Päckchen Reiswaffeln aus einem Schrank und ging wieder.
»Wie kommt sie klar?«, fragte Jenny.
»Sie sind so unverwüstlich. Zuerst hat sie ihre Freunde von der Schule vermisst, aber sie hat neue Freunde hier in Cramond gefunden. Ich habe ihr immer noch nicht die Wahrheit über ihn gesagt. Aber ich habe ihr gesagt, dass er nie mehr zurückkommen wird, und wie es aussieht, hat er mich wieder zur Lügnerin gemacht.«
»Wir sind hier nicht schuld.«
Fiona fuchtelte mit den Händen in der Luft. »Ich weiß, dass er verantwortlich ist, nicht wir, bla, bla, bla, aber es fühlt sich gottverdammt beschissen an.«
»Ja, tut es.«
Stille in der Küche, Spatzen zwitscherten in einem Baum draußen, Sonnenstrahlen fielen durch das Laub und die Zweige aufs Gras.
Fiona drehte den Laptop zu Jenny, und sie sah eine Tabelle mit Namen und Zahlen.
»Ich hab hier ein paar Kandidaten«, sagte Fiona. »Drei unserer früheren Klienten, die Craig sehr mochten, die Arschlöcher genug sein könnten, ihm trotz allem zu helfen. Jeder von denen verfügt über die Mittel, ihm zu helfen, unsichtbar zu bleiben.«
Sie leerte ihr Glas mit einer überschwänglichen Geste, stellte es laut auf dem Tisch ab und stach mit einem Finger auf den Bildschirm. »Gehen wir sie fragen.«
8DOROTHY
Sie war mit mindestens vierzig Jahren Vorsprung vor allen anderen die Älteste im Sneaky Pete’s. Es war eine winzige Spelunke an der Cowgate, voller Kids und, wie Dorothy erfreut feststellte, einem hohen Anteil junger Frauen, zweifellos wegen des Programms. Das Publikum war genauso gekleidet wie Indie-Kids aller Zeiten, selbst geschneiderte Jacken und Tops, völlig unpassende Hosen und bunte Stiefel.
Dorothy nippte an ihrem Whisky und schaute sich um. Es war nicht viel größer als ihre Küche, eine schrabbelige Bar auf der einen Seite, mit hübschem Hipster-Personal hinter der Theke. Sie stand zwischen einer unverputzten Backsteinsäule und dem Mischpult, das lediglich aus einer tätowierten Frau mit einem Laptop auf einem Ständer bestand. Zwei Wände waren mit schwarz-weißen Wandmalereien bedeckt, eine davon verkündete in riesigen Buchstaben »Dance Yrself Clean«, was Dorothy zu ihrer Freude als Titel eines Songs von LCD Soundsystem erkannte. Die Tatsache, dass in den letzten vier Jahrzehnten immer wieder junge Leute bei ihr Schlagzeug gelernt hatten, brachte einige Vorteile, zum Beispiel, dass sie in Sachen Musik millionenfach mehr auf dem Laufenden war als andere in ihrem Alter.
Abis Band war auf der Bühne und machte einen Höllenlärm. Die Blood Queens hatten einen Hauch von Riot Grrrl an sich, Abi am Schlagzeug, der Alibi-Typ Taylor am Bass und Kazuko schredderte ihren Fender Telecaster und schrie ins Mikro. Abi hatte Dorothy erzählt, dass der Name Kazuko in der japanischen Muttersprache ihrer Eltern »friedliches Kind« bedeutete, ein Anspruch, dem sie nie gerecht geworden war. Dorothy hatte Abi darin bestärkt, eine Band zu gründen, denn es gab Grenzen für das, was man im Unterricht lernen konnte. Ab einem bestimmten Punkt musste man den Sprung ins kalte Wasser wagen und anfangen, mit Freunden Lärm zu machen, denn was sollte das Ganze sonst? Eigene Songs zu schreiben, selbst die Schlagzeugparts, setzte ganz andere Fähigkeiten voraus, als begleitend zur Lieblingsmusik zu spielen. Es war kreativ und gemeinschaftlich, der Wesenskern des Lebens, zumindest wie Dorothy es sah.