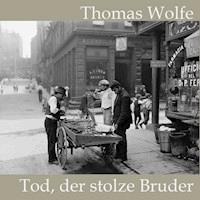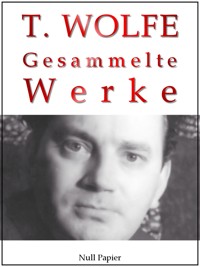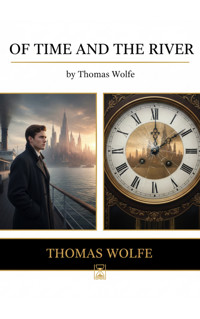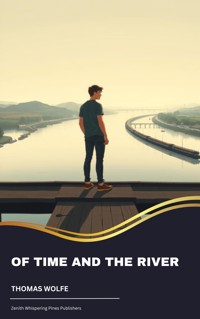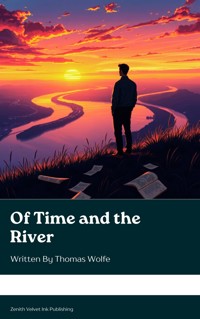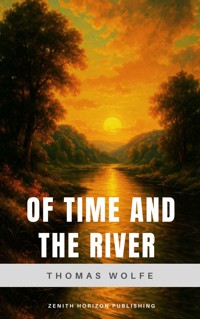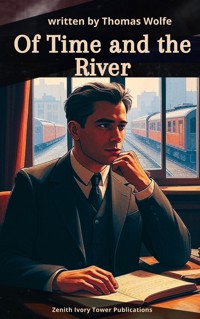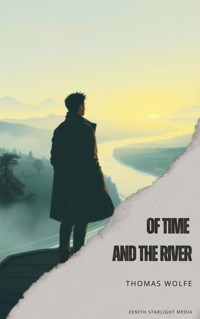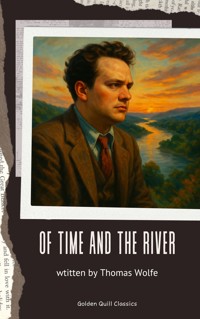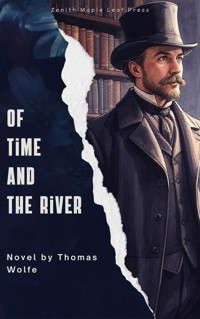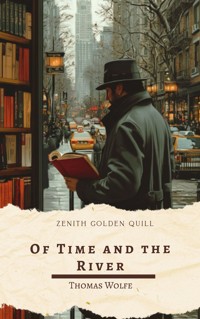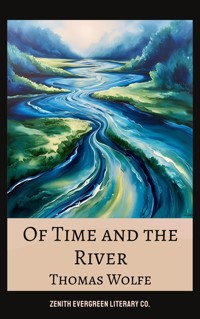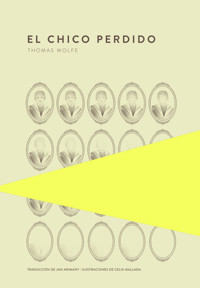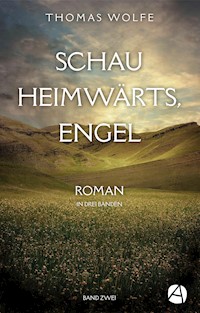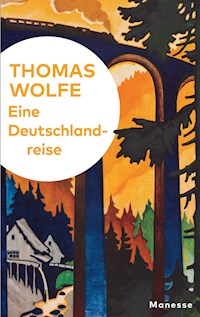
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln blickt liebevoll-kritisch auf das Deutschland zwischen 1926 und 1936
Er schlenderte mit James Joyce durch Goethes Geburtshaus, schunkelte auf dem Münchner Oktoberfest und durchzechte mit seinem Lektor Heinrich Maria Ledig-Rowohlt Berliner Sommernächte. Kein Autor der amerikanischen Moderne drang tiefer in deutsche Kultur und Mentalität ein als Thomas Wolfe, und so sind seine Deutschlanderkundungen zwischen 1926 und 1936 auch Reisen zu sich selbst. Im liebevollen und zugleich kritischen Blick des großen Erzählers lässt sich jene entscheidende Epoche miterleben, als die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts die denkbar fatalste Wendung nahm.
Dieser Band enthält drei Stories («Dunkel im Walde, fremd wie die Zeit», «Oktoberfest», «Nun will ich Ihnen was sagen»), den Zeitschriftenartikel «Brooklyn, Europa und ich» sowie weitere faszinierende Fundstücke aus den Notizbüchern und Briefen des Autors in Erst- und Neuübersetzung, exklusiv zusammengestellt von Oliver Lubrich. Im Spannungsfeld zwischen Zeitdokumenten und erzählender Literatur entsteht ein beeindruckendes Panorama deutsch-amerikanischer Kulturgeschichte.
Mit 8 Originalseiten aus den Notizbüchern des Autors und 20 historischen Fotos
Schon als Sechsundzwanzigjähriger, bei seinem ersten Besuch, schwärmt Wolfe für die Heimat von Dürer, Goethe und Beethoven. Als er wiederkommt, steht er staunend vor den Schaufenstern deutscher Buchhandlungen, pilgert durch deutsche Museen und Bierkeller. Er besingt die Schönheit des Rheins, lässt sich bezaubern von den Altstadtidyllen Frankfurts und Nürnbergs, vom märchenhaften Schwarzwald, vor allem aber von der gastfreundlichen Aufnahme durch ein Kulturvolk, das sich seine Herzlichkeit und seinen liebenswerten Eigensinn bewahrt zu haben scheint. Keineswegs blind für bedenkliche Zeitsymptome, überwiegen doch die positiven Eindrücke bei Weitem. Nicht einmal eine blutige Wiesn-Schlägerei heilt den amerikanischen Dauergast von seiner akuten Germanophilie. Mitte der 1930er kehrt Wolfe als Weltberühmtheit in das Land seiner Vorväter zurück, wo man den Autor von «Schau heimwärts, Engel» euphorisch feiert. Er wird Zeuge des nationalsozialistischen Massenwahns und der Selbstinszenierungsorgie des «Dark Messiah» (wie er Hitler nennt) während der Olympischen Spiele 1936. Was Thomas Wolfe lange nicht wahrhaben wollte, wird ihm nun schlagartig klar: «Good old Germany», die Heimstatt von Humanität und unbedingtem Freiheitsstreben, gibt es nicht mehr. Und so endet die Liebe zu Deutschland, seiner zweiten Heimat, mit der schmerzlichen Abkehr und dem Abschied für immer.
«I have the deepest and most genuine affection for Germany, where I have spent some of the happiest and most fruitful months of my life.» Thomas Wolfe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Er schlenderte mit James Joyce durch Goethes Geburtshaus, schunkelte auf dem Münchner Oktoberfest und durchzechte mit seinem Lektor Heinrich Maria Ledig-Rowohlt Berliner Sommernächte. Kein Autor deramerikanischen Moderne drang tiefer in deutsche Kultur und Mentalität ein als Thomas Wolfe, und so sind seine Deutschlanderkundungen zwischen 1926 und 1936 auch Reisen zu sich selbst. Im liebevollen und zugleich kritischen Blick des großen Erzählers lässt sich jene entscheidende Epoche miterleben, als die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts die denkbar fatalste Wendung nahm.
«I have the deepest and most genuine affection for Germany, where I have spent some of the happiest and most fruitful months of my life.» Thomas Wolfe
Thomas Wolfe wurde im Jahr 1900 in Asheville, North Carolina, geboren. Seinen literarischen Durchbruch feierte er 1929 mit «Look Homeward, Angel» (2009 bei Manesse in Neuübersetzung). Zwischen 1926 und 1936 bereiste er Deutschland sechs Mal. 1938, im Jahr des «Anschlusses» Österreichs an das Deutsche Reich und der antisemitischen Novemberpogrome, stirbt er achtzehn Tage vor seinem 38. Geburtstag.
«Wolfe ist es gegeben, Kunst zu machen … Bei Wolfe handelt es sich um einfache Dinge, sie sind leicht zu lesen, schwer zu schaffen.» Gottfried Benn
«Der erste Autor, der mich wirklich fasziniert hat … so ungeheuer vital und jung und gescheit.» Thomas Bernhard
«Ich liebe Thomas Wolfe, seinen Roman ‹Schau heimwärts, Engel›.» Peter Handke
«Phänomenal: diese Fabulierwut und Sprachkraft.» Arno Geiger
«Man hat gesagt, wichtiger als die Entdeckung Amerikas sei die Erfindung Amerikas gewesen. Dazu hat Wolfe entscheidend beigetragen.» Klaus Modick
«Wieder so ein amerikanischer Gigant, der einem die Brust schwellen lässt – vor Bewunderung und Neid!.» Michael Köhlmeier
Thomas Wolfe
Eine Deutschlandreise
in sechs Etappen
Literarische Zeitbilder 1926–1936 herausgegeben von Oliver Lubrich
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Renate Haen, Barbara von Treskow und Irma Wehrli
Mit 8 Originalseiten aus den Notizbüchern des Autors und 20 historischen Fotos
MANESSE
Vorwort
Am 29. Januar 1925 gesteht der damals vierundzwanzigjährige Thomas Wolfe am Ende eines in Paris verfassten Briefs einem heute unbekannten Adressaten eine sehr klischeehafte Vorstellung von Deutschland:
«I don’t know where, but I’ve had an eagle eye fastened on Munich and beer, and robust blondes for some time.»
Elfeinhalb Jahre später, im September 1936, wird er in sein Notizbuch den folgenden Eintrag schreiben:
GERMANY
1st Trip: Dec. 1926–Stuttgart–Munich–Zurich–Paris–etc.–2 weeks
2nd Trip: July–Aug. 1927–Munich–Augsburg–Berchtesgarten–Salzburg–Vienna–Prague–Nuremberg–Paris–etc.–2 weeks
3rd Trip: July–Oct. 1928–Köln–Bonn–Mainz–Wiesbaden–Frankfurt–Munich (Oct.-Fair)–Oberammergau–Salzburg–Wien–etc.–3 months
4th Trip: Aug.–Sept. 1930–Basel–Freiburg–Strasbourg–etc.– 1 month
5th Trip: May–July 1935–Hanover–Berlin–Leipzig–Weimar–Eisenach–Magdeburg–Hamburg–Bremen–etc.–2 months
6th Trip: Aug.–Sept. 1936–Bremerhaven–Bremen–Berlin–Munich–Garmisch–Innsbruck–Kufstein–etc.–1 mo.
Die nüchterne Bilanz von insgesamt sechs Deutschlandbesuchen hat etwas Definitives, Abschließendes. Der Autor weiß, dass dieser sechste Besuch der letzte gewesen sein wird. Möglicherweise hat er den Eintrag sogar noch in Deutschland verfasst, in jenem Zug, in dem er ein allerletztes Mal die deutsche Grenze passieren und einen Schlussstrich unter eine prägende Erfahrung ziehen wird.
Innerhalb eines Jahrzehnts hat Thomas Wolfe insgesamt knapp acht Monate in Deutschland verbracht. Dieses Buch versammelt nun erstmals alle relevanten Selbstzeugnisse des Autors. Dabei zeigt sich: Die literarischen und außerliterarischen Deutschlandtexte Thomas Wolfes sind nicht nur Geschichtsdokumente ersten Ranges. In der chronologischen Abfolge lassen sie sich als individuelles Drama einer tragischen Deutschlandliebe in sechs Akten lesen.
Im Folgenden werden drei Textsorten miteinander verschränkt, die drei Entwicklungsstufen darstellen – aus den lakonischen Einträgen der «Notebooks» entstanden die ausformulierten Narrative der Briefe, und beide wurden durch literarische Stilisierung und Autofiktionalisierung zu dichten Erzählungen versponnen.
Thomas Wolfe spickte seine muttersprachlichen Texte mit deutschen Begriffen und Wendungen – nicht ohne augenfälligen Stolz auf seine Auffassungsgabe und offenkundig in dem Bestreben, schreibend in die Geheimnisse des fremden Idioms einzudringen. Diese deutschen Einsprengsel werden hier getreu und unverfälscht, also auch in ihrer Unbeholfenheit oder Fehlerhaftigkeit wiedergegeben, um einen authentischen Eindruck von den Deutschkenntnissen des Autors zu vermitteln, die er Heinrich Maria Ledig-Rowohlt gegenüber selbstironisch als «taxi-driver’s German» beschrieben hat.
mauritius images: Alamy/Asar Studios/Carl Van Vechten
1926
Zwei Wochen im Dezember Stuttgart, München
«Ach Gott! The neck. The neck.»
NOTIZBUCH-EINTRÄGE
Der rasierte Schädel eines Hunnen1 scheint oberhalb seines Nackens abgesägt und passgenau aufgesetzt worden zu sein, der gezahnten Speckfalten wegen.
Ratskeller*,2 Stuttgart: Ach Gott!*3 Der Nacken. Der Nacken.
Sing sunk gesank4 in einem neuen Land – Wer kann das so gut wie ich?
Stuttgart, Dienstagabend [7. Dezember 1926]:
Kaffee–Restaurant Königen Olga Bau.*5
Als ich den Rhein heute von Straßburg her überquerte – fügte ich ein weiteres Land hinzu – Abends in meiner Unterkunft warf ich mich in die Brust von wegen: «Ha, ihr Saubande, das könnt ihr mir nie mehr nehmen!» Das flache Land spult sich endlos weit ab in den verwischten halb dunklen Wäldern.
Der Hunnenkopf – klein kompakt über einem vollen länglichen Gesicht – sieht aus wie irgendwas zum Schlagen zum Zerschmettern zum Damitfahren.
Stuttgart:
Frau Warren’s Gewerbe* von Bernhard Shaw.6
In den hiesigen Buchhandlungen gibt es Ausgaben britischer und amerikanischer Schriftsteller – Galsworthys «Forsythe Saga», Shaw, Chesterton, Cooper, Mark Twain, Wilde.7
Heute! Heute!*
Das Grosse und Kleine Schauspielhaus.*
Stuttgarter Hügel – breit, mit hellen, perligen Hügellichtern zwinkernd des Abends – Die Stadt in der Ebene – Der Marktplatz, Rathaus und die [Bild einer Gabel]8 gegabelten vorkragenden hellfarbigen Spielzeughäuser.
Ein Tal, das zwischen den Hügeln dahinströmt wie ein Fluss.
Cannstatt – ein Vorort von Stuttgart.
Der Ausflug von Stuttgart aus: Friedrichshafen, Augsburg, Ulm – Auf dem ersten Teil der Reise die romantische Landschaft – die steilen Hügel dicht an dicht – das Arbeitspferd – langsam sich drehende Maschine – Die Felder gegen den dunklen Himmel – die Grasstreifen und gepflügte Erde – einförmiger als Frankreich, finde ich.
Der alte Deutsche bei mir im Waggon. Das geschlossene Abteil – Wir schliefen beide ein, von der Hitze betäubt – Der Schaffner mit der hochgeschlagenen Uniform.
München – Vororthaltestellen rauschen vorbei – Nahverkehrszug und Elektrische warten – Ähnlichkeit aller Großstädte überall im Industriezeitalter – der Bahnhof – der Prellbock.
Nach dem Passieren der Schranke warte ich außerhalb in zunehmender Ekstase. Während er mit dem Gepäckschein* zur Gepäckaufgabe* geht.
Der alte Mann mit dem Wägelchen – die sarkastischen Bemerkungen auf dem Weg durch die überfüllten Weinachts*straßen – Hotel «Vier Jahreszeit»*.
Später – das Hofbrau Haus* – Untere Mittelschicht9 – Das großartige Bier, dunkel dunkel dunkel – Das Lokal schmuddlig und erfüllt von der Kraft des Biers und Rauchs und der ungemein fröhlich-lebhaften Vitalität seiner zwölfhundert Stimmen.
[Zeichnung eines Maßkrugs]Der Hunnenchauffeur oder -pförtner mir gegenüber. Die rubinroten, bierfeuchten Lippen tropfend vor ausgerülpstem Bier. Die Hutkante [Zeichnung] – Die Kellnerinnen in ihren schwarzen Kleidern – zahnlose, böse fröhliche Gesichter – Schlüssel an der Hüfte – Sehniger und knochenhintriger Gang – blonder junger Mann in Alpentracht – Alter Mann zieht Brot durch die Bierpfütze, bevor er es isst – Hinreißender Landstreicher mit Bart, der sich eine lange Pfeife anzündet [Zeichnung einer geschwungenen langen Pfeife] – Verbeugt sich förmlich, aber blödsinnig vor den Leuten am Nachbartisch.
Betrunkene aufgekratzte Stimmen erheben sich draußen über den Lärm – Ecke nass von Pisse – Teniers10 – Morgen Sonntag, aber alles geöffnet, die letzten zwei vor Weihnachten. […]
Deutsche Museum* – Ungeheuer faszinierend – Die kleinen deutschen Jungen, die mit den Maschinen spielen durften – Leibnitz, Ohm, Röntgen – Wärme* – die Energie – das Bild von der Luftpumpe und ihre Vorführung in Magdeburg – Pferde konnten nicht auseinanderziehen.11
Aber ach, die Flugzeuge – ich begriff sie, weil sie zunächst von Verrückten ersonnen wurden – Menschen wie ich, bar jeder Wissenschaft.
Sonntagnacht [12. Dezember]
Der Zug noch Westen,12Deutsches Theater*13: Eine Revue wie die meisten andern, französische und amerikanische – Kleine Tische auf dem Balkon, wo ich saß – Das kindliche Entzücken des Publikums über die amerikanische Tänzerin – Die fette blonde Komödiantin – Sie war lustig – alle aßen und tranken in der Pause.
Danach: Das Wiener Restaurant*14 – Wien*-Gulasch – Warum sind Zigaretten in Deutschland so teuer?
Heute Morgen Welt Reisen*15 – Zwei Briefe vom Juden16.
Glyptothek: Der feinste Apoll, den ich je gesehen habe17[Zeichnung darunter].
Ein gut weiss wein: Deidesheimer Leinhöhle*
Karlplatz – Ein dunkeles bier.*
Dunkeles gibt es nicht – gibt es weiss bier.*
Die Bücher über Amerika und England in den Fenstern.
Die Studenten mit den Wangenverwundungen nach dem Theater im München Café* – Einer war da mit einer zolllangen Wangenwunde, die gerade erst heilte – Die Bewegung der Menschen auf den Straßen – Dieser Augenblick für immer vergangen und eingefangen.
Die teure, die unschätzbare Seite an Jungen ist ihr Eifer. Die Jungen in Frankreich und Deutschland, die mir nach New York schreiben werden.
Dienstag: Spät aufgestanden – Deutscher Kellner lachte, als er mich so dösen sah. Ging zum Amtliches bayerisches Reisebureau*18 – Kein Telegramm – Ging in die großartige Frauenkirche [Zeichnung] – Wie zwei steife Schwänze19 sind die Türme.
Im dunklen und eingefrorenen Maximilianeum habe ich mir den Fuß ver*staucht.20 Jetzt tut er weh. Wie der dunkle Fluss strömte – Greifbar – Kaskade um eine Insel – die Holzteilchen darin eingekeilt.
[Zeichnung eines Kopfs mit Beschriftung] Hunnenkopf, Schwerthieb, die Nackenlinie.
Was tut die fernere Welt?
Heute Abend: Shaws Mensch und Übermensch – Dargeboten mit teutonischer Gründlichkeit – Das Zwischenspiel in der Hölle21 – Wie sehr es ihnen gefiel – Gott, was für ein Bühnenbild – und wie unerfreulich der Anblick mancher Leute war – Aber hübsche Frauen.
[Zeichnung] Hunnenhelm.
Das Rheingold* heute Abend hervorragende Aufführung – Ich war im fünften und obersten Rang, eingeklemmt zwischen frauleins*, die mir Löcher in die Nieren stießen. Aber umwerfend – Die gewaltige Größe der Riesen – Die Düsternis, die großen, die Düsternis durchblasenden Hörner – das flammend rote Ufer, wie der Schrecken des Bösen – der Degen22 in der gigantesken Düsternis. […]
Die Tausende deutscher Studenten, die schlagenden Verbindungen angehören – Der Säbel schneidet in ihre Gesichter – Wangenknochen, normalerweise – [Zeichnung] Nasenwunde.
Ein Mann mit gebrochener Nase. Ein Säbelhieb aber nicht so schlimm wie der Hieb, den die Jahre versetzen. [Zeichnung] […]
Die Tausende deutscher Studenten, die schlagenden Verbindungen angehören – Der Säbel schneidet in ihre Gesichter – Wangenknochen, normalerweise – Nasenwunde. – CORPSSTUDENTEN IN VOLLWICHS BEIM FESTCOMMERS.
Süddeutsche Zeitung Photo
Wenn dich einer dieser narbengesichtigen Jungen herausfordert, beantwortest du seine Herausforderung, indem du seinen Kopf mit einer Flasche oder sein Gesicht mit deiner Faust zerschmetterst – Sie sind Messer gewohnt, stolz auf die Narbe – Wollen doch mal sehen, wie ihnen Fingerköchelarbeit gefällt.
Die Kunst des Hassens – Sie ist so selten, so großartig als Kunst, dass sie nur von Menschen mit einem großen Herzen erfolgreich ausgeübt werden kann.
Unsere Freude über die Niederlage der Deutschen war zum Teil gerechtfertigt – Erfreulich ist es, den Mann, der sich in Erwartung eines Kampfes Kriegslust antrainiert, geschlagen zu sehen. […]
Für und Wider eines subventionierten Theaters – Das großartige Deutsche Schauspielhaus* – Wie ein Regierungsgebäude – massive Hallen und Treppenhäuser.
Platzl.*23 Das bayerische Vaudeville24 – Vielleicht das Interessanteste, was ich in München* sah.
Wiener Café* – Orlando di Lasso25 – Ebendort traf ich die Studenten von der schlagenden Verbindung – wo sie ahnungslos an ihrem Tisch saßen.
Samstag: Wieder im Zug – In Elsass-Lothringen. Ich reiste gestern von München nach Zürich* – Traf dort am Abend ein – Am Morgen fing es in München zu schneien an – Südwärts durch Bayern – im Bergland – Schneegestöber – Boden weiß – Der Schwindsüchtige, der bei mir im Abteil saß – Seine ziemlich junge und ansehnliche Frau in München.26
Zürich eine deutsche Stadt – Jeder hier spricht deutsch. […]
BRIEFE
An Aline Bernstein27
Stuttgart/Freitagnacht [10. Dezember 1926]
Meine Liebe,
ich bin am Montag nach Straßburg gereist und gestern hier angekommen. Bevor ich Paris am Montagmorgen verließ, erreichte mich ein Telegramm von Dir, das ich beantwortet habe. In Straßburg erhielt ich ein weiteres, und heute habe ich Dir aus Stuttgart gekabelt und Dich gebeten, Deine Antwort an American Express Co., München*, zu richten, obwohl ich nicht sicher bin, ob es dort ein Büro gibt. Wenn nicht, werde ich Dir eine andere Adresse nennen, sobald ich dort bin.28 Morgen reise ich ab. Endlich nach Deutschland zu gelangen hat mich in derart stürmische Aufregung versetzt, dass ich mich gestern ein bisschen krank fühlte. Ich näherte mich der deutschen Grenze bis Straßburg, wo ich zwei oder drei Tage blieb und mich in der bizarren Giebelhausstadt verlor: Ich verspeiste Gänseleberpastete und trank Bier und wanderte überall herum. Aber ich wusste nicht, wo in Deutschland ich landen würde; ich war mir nicht sicher, wo ich mich geografisch befand. Schließlich kaufte ich mir eine Karte von Süddeutschland und beschloss, hier in Stuttgart zu übernachten und dann nach München weiterzureisen. Ich habe nicht die Zeit, kreuz und quer durch die Gegend zu fahren – ich werde in München bleiben müssen, bis ich nach Paris zurückkehre. Gestern Morgen stand ich auf, bepackt mit einem Stempel und einem Fahrplan29, versah mich in einer Bank mit ein paar Mark und verließ Strasbourg30 um 10.40 Uhr. Eine Viertelstunde später überquerte ich den Rhein und war in Deutschland. Ich wurde beinah verrückt vor Aufregung und Frohlocken, rannte von der einen Abteilseite zur andern, um auf den Fluss hinabzublicken, und schrie: «Ich hab dich ausgetrickst, du Schwein!», weil ich diese fixe Idee habe, verfolgt, behindert und ausgebremst zu werden. In dem Grenzstädtchen Kehl, wo man mein Gepäck durchsuchte, musste ich umsteigen und ebenso in Appenweier und Karlsruhe. Zunächst war die Rheinlandschaft weitläufig, vollkommen eben, nebeldampfend in der grenzenlosen Ferne. Hinter Karlsruhe fuhren wir den ganzen Nachmittag langsam durch ein steiles Tal bergan, die Hügel rauschten am Zug vorbei abwärts, die kleinen Ortschaften – das spitzgiebelige Spielzeugland, von dem ich immer geträumt habe – fielen auf verrückte Art zum Zug hin ab und den anderen Hang hinauf. Ich kam in der Dunkelheit hier an. Es ist eine Stadt mit 400 000 Einwohnern, sie liegt in einem Tal und ist vollständig von unmittelbar angrenzenden Hügeln umschlossen. Nachts ist sie voll von hellem Licht – die Hügel ringsum sind gestützt auf das Konzept (die wesentliche, unzerstörbare und ewige Idee) von Schubkarren, dem sie und alle Schubkarren, die jemals waren oder jemals sein werden, entstammen müssen. Nun, diese hiesigen Neubauten, das ist Architektur nach Konzept. Verstehst Du?
Vom Bahnhof geht die schnurgerade Hauptstraße ab – Kaiserstrasse* –, am Abend erfüllt von kaltem, hartem Licht, Neonreklame; über die Seitenstraßen gelangte ich jedoch heute Morgen wieder ins Spielzeugland – der Marktplatz, das Rathaus* und spitzgieblige, hell getünchte Häuser wie aus dem Märchen.
Die Buchhandlungen sind voll mit Ausgaben von Engländern und Amerikanern – Galsworthy und Shaw, Wilde, Chesterton, Cooper, Mark Twain. Heute Abend ging ich in ihr Theater – auf dem Spielplan steht derzeit Frau Warren’s Gewerbe* von Bernhard* Shaw, und auf dem Titelblatt einer Satirezeitschrift ist Shaw als Karikatur im Badeanzug zu sehen.
Ich habe mich heute in diesem Ort verloren; ich kaufte am Morgen ein Wörterbuch – ich komme erstaunlicherweise zurecht. Ich fing an, Deutsch zu sprechen, sobald ich gestern den Rhein überquert hatte – ich bin allein auf einem Abenteuer, das mich begeistert, ich entdecke, reise, erneuere mich selbst, sauge alles in mich auf. Als ich dreizehn war, las ich einige kleine Geschichten auf Deutsch, unter der Obhut eines Lehrers, der weniger wusste als ich – meine Bemerkungen beschränken sich im Wesentlichen auf «Geben Sie mir dies?», «Wo ist das?» und so weiter, aber sie verstehen mich, antworten auf Deutsch, und dank eines seltsamen intuitiven Wissens verstehe ich sie. Das Sprechen einer Fremdsprache ist nicht meine Stärke, aber ich verfüge über eine eigenartige Fähigkeit der instinktiven Anpassung und des Verstehens. Diesen Winter nach meiner Rückkehr werde ich lernen, die Sprache ebenso gut zu lesen wie die französische, das heißt etwa so gut wie die englische. Einige der Bücher werde ich mir kaufen, vor allem von Mann und Wassermann, ein neues Stück von Hauptmann, Kaiser und ihren anderen Leuten.31 Ich glaube, ich werde ihre hässlich-kraftvolle Sprache mögen, weil sie damit bauen wie ein Kind mit Bauklötzen und weil ihre Städte Spielzeugstädte sind. Ihre Schaufenster sind voller fröhlicher Weihnachtssymbole und Nikoläuse und aufeinandergestapelter Schlitten. Anscheinend kann man jedes Wort erfinden, das gerade gebraucht wird – eine Baufirma, die gegenüber dem Bahnhof ein Gebäude errichtet, hat ein Schild draußen mit einem phänomenalen Wort, das sie zur Erklärung der Geschäftstätigkeit erfunden hat, so etwas wie Bahnhofsplatzbauarbeitengesellschaftverein*.
[…] Ich habe mich kürzlich gefragt, in welches tiefe Meer Ikarus fiel, wo nun sein Haar über seinem ertrunkenen Gesicht schwebt und wo Poseidon bestattet wurde, und dann denke ich an die großen Himmelstürme, die an der amerikanischen Küste schweben, so fern des ertrunkenen Ikarus. Das frage ich mich vor allem, weil er sie nie durch Deutschland heranziehen sah. Gestern begegnete ich den Hügeln, den Wäldern, den verrückten Städtchen zum ersten Mal – sie klangen in mir, ich schenkte ihnen Leben, das zuvor nicht existiert hatte.
München/Sonntagnacht [12. Dezember 1926]
[…] München gefällt mir, und mir gefällt, was ich bis jetzt von Deutschland gesehen haben – die Menschen sind, glaube ich, schlicht, ehrlicher und sehr viel freundlicher als die Franzosen. Und ich denke nicht, dass ihre Freundlichkeit und Ehrlichkeit das Resultat einer böswilligen Verschwörung zur Unterdrückung der Welt durch Täuschung sind … Anscheinend leben wir in einer Welt, in der man sich bis zum Ende seiner Kräfte durch eine Wüste der Absurdität kämpfen muss, um bei einer sehr einfachen und offensichtlichen Tatsache anzulangen. Gestern Abend ging ich ins Hofbrau Haus* und trank einen großen Krug vom besten Bier, das ich je gekostet habe. Um die Tische in dem gigantischen Raucherzimmer saßen 1200 oder 1500 Menschen der unteren Mittelschicht. Das Lokal war ein gewaltiger Lärmgenerator. Die Fußböden und Tische waren feucht von Bierlachen; die Kellnerinnen kamen vom Land und hatten sanfte, harte, freundliche, alte Gesichter – das Bier troff aus den schaumigen Krügen, als sie durch diesen Mahlstrom flitzten32 … Jenseits der Türen sang ein Chor trunkener Stimmen – Frauen und Männer, schaurig und herzlich, schwangen gegeneinander in Tausenden natürlichen kraftvollen krugerhobenen Posen, ganz wie bei Teniers. Das Lokal war ein einziger riesiger Ozean aus Bier, Stärke, teutonischer männlicher Energie und Lebenskraft. Es war, als sähe man einem gewaltigen Hefepilz zu, der sich aus seinen eigenen Innereien entfaltet: Er war Mark, Herz und Gedärm ihrer Stärke – das sich entfaltende und unvorhergesehene Ding, das nicht zurückgehalten oder zugestöpselt werden kann.
Dienstagnacht [14. Dezember]
Ich ging heute Abend in eines der städtischen Theater – ich sah ein Stück von Hauptmann33: eine sehr fade Komödie, aber gut gespielt, mit ebenjenem Naturalismus, den man bei uns für den höchsten Gipfel alles Russischen hielt. Als ich heute Abend diesen Menschen zusah, die so gut über die Bühne brachten, was sie schon Hunderte Male so gut über die Bühne gebracht hatten, als ich den schurkischen alten Bauern über seinem Schnaps husten sah, wie er seit Jahren gehustet hatte, ihn so bäurisch reden hörte mit dem Mund voll Brot und Fleisch – und all das, weil der große Stanislawski34 ihn darin geschult hatte, jahrelang zu husten –, kam mir in den Sinn, dass dies alles für Menschen, die Bücher schreiben, ein allzu erbärmliches Geschäft sei und dass Ästhetik nicht aus zwanzigjähriger Hustenausübung entsteht. Ihr alle seid ein armseliger, trauriger Haufen kleiner Schurken und Idioten – sagt euren Leuten, sie sollen ihre Erzeugnisse nach einer Woche Übung herzeigen, aber doch nicht nach zehn Jahren – dann mag es wieder Poesie geben – sicherlich aber gibt es Leben.
[…] Dieser Ort ist gespickt mit großen, massiv wirkenden Museumsbauten – ich ging heute in die Glyptothek35, um mir die Skulpturen der Deutschen anzusehen – sie haben ein halbes Dutzend großartiger Stücke in der ägyptischen und der griechischen Abteilung – zwei Apollos:36 die besten, die ich je gesehen habe.
[…] Ich ging heute zu einer großen Kirche – der großen Frauen-Kirche*, die zwei grandiose Türme hat wie dies hier. [Zeichnung] Und ich ging zu einer großen Gruft namens Maximilianeum: Es war geschlossen, ich ging hinein und fiel eine Treppenflucht hinunter, wobei ich mir den Fuß verstauchte. Es war sehr dunkel und kalt. Abends ging ich ins Shauspielhaus* und sah mir Shaws Mensch und Übermensch*an, inszeniert mit deutscher Gründlichkeit, einschließlich des Zwischenspiels in der Hölle. Diesmal war das Bühnenbild ärgerlich, die Männer unerquicklich, die Frauen jedoch sehr anziehend. Und die Deutschen lachten und lachten.
Ich sollte die Menschen, die ich von früher kenne, wiedersehen, die Luft meiner Heimaterde atmen; Rückkehr, Rückkehr. Für diesmal habe ich alles bekommen, was ich wollte. Ich bin Kopf-und-Herz-müde. Deutschland war freundlich und leidenschaftlich interessant. Ich bin beladen, und ich bin erschöpft. Ich habe das Staunen beinah verlernt, außer in meinem eigenen Herzen – es gibt wenig in Büchern und Gemälden und, Gott verzeih mir, in neuen Ländern, was mich noch in Begeisterung versetzt. Wenn ich etwas sehe oder lese, erinnere ich mich, dass ich es bereits kenne, und schiebe beiseite, was sie sagen. Das klingt nach Sättigung, stimmt’s? Aber ich weiß, das andere wird wiederkommen. Immer der Tod, immer wieder das Leben.
Ich habe wochenlang nicht geschrieben – das ist das Leben, das wohl wieder in mir erwacht ist.
Die Nacken der deutschen Männer machen das [Zeichnung von Speckwülsten]. Mir wäre es lieber, sie ließen es sein – es ist so einfach für die Karikaturisten. Und so viele sehen aus wie diese Schwertwunde aus Schwerttagen [Zeichnung eines Mannes mit eingezogenem Hals und Doppelkinn und Schmiss auf der Backe]. […]
Hunnenkopf, Schwerthieb, die Nackenlinie […] Der Hunnenchauffeur oder -pförtner mir gegenüber. Die rubinroten, bierfeuchten Lippen tropfend vor ausgerülpstem Bier. (Zeichnungen aus Thomas Wolfes «Notebooks», 1926) – DEUTSCHE PHYSIOGNOMIENI.
Copyright © 2020 by Eugene Winick, Administrator C. T. A. of the Estate of Thomas Wolfe
DUNKEL IM WALDE, SELTSAM WIE ZEIT
Vor einigen Jahren,37 auf dem Münchner Hauptbahnhof, waren unter den Menschen, die auf einem der Bahnsteige neben dem fast abfahrbereiten Schweiz-Express standen, eine Frau und ein Mann – eine Frau, so hübsch, dass sie dem Geist eines jeden, der sie sah, eindringlich38 in Erinnerung bleiben würde, und ein Mann, in dessen dunklem Gesicht sich bereits die Legende einer seltsamen und verhängnisvollen Begegnung abzeichnete.
Die Frau, etwa fünfundvierzig Jahre alt, befand sich auf dem makellosen Höhepunkt voll entwickelter und strahlender Schönheit. Sie war ein herrliches Geschöpf, das bis zur letzten roten Reife ihrer Lippe vor Leben und Gesundheit strotzte, ein Wunder an Liebreiz, in dem sich die Elemente der Schönheit mit solch erlesenem Ebenmaß und einer so rhythmischen Ausgewogenheit verbanden, dass man seinen Augen nicht einmal dann trauen wollte, wenn man sie ansah, so magisch wandelte es sich und blieb sich doch gleich.
So schien sie, obwohl nicht übermäßig hochgewachsen, bald über eine stattliche, königliche Größe zu verfügen, bald fast frauchenhaft klein und anschmiegsam zu sein, als sie sich eng an ihren Gefährten drückte. Dann wieder schien ihre entzückende Figur, obgleich voll, üppig, wogend in der ganzen sinnlichen Reife der Weiblichkeit, nie die biegsame Schlankheit ihrer Mädchenzeit verloren zu haben, und jede ihrer Bewegungen war erfüllt von verführerischer Anmut.
Die Frau war modisch, chic und teuer gekleidet; ihr kleiner, kochmützenartiger Hut saß behaglich auf einer Krone kupferrötlichen Haars und überschattete ihre rauchblauen, unergründlichen Augen, die sich fast zu einem Schwarz verdunkeln konnten und sich bei jedem noch so raschen Gefühlsumschwung mit veränderten. Sie sprach in leisem, zärtlichem Ton mit dem Mann und lächelte ein vages und wollüstiges Lächeln, wenn sie ihn ansah. Sie redete eifrig, ernsthaft, vergnügt auf ihn ein und brach von Zeit zu Zeit in ein kurzes Lachen aus, das leise, volltönend, lustvoll und zärtlich aus ihrer Kehle quoll.
Als sie im Gespräch den Bahnsteig auf und ab gingen, schob die Frau ihre kleine behandschuhte Hand in den Ärmel seines schweren Mantels und schmiegte sich eng an ihn, wobei sie manchmal ihren hübschen Kopf, so stolz und anmutig wie eine Blume, an seinem Arm barg. Dann wieder hielten sie inne und sahen einander einen Augenblick lang unverwandt an. Jetzt machte sie ihm scherzhaft Vorwürfe, schalt ihn, rüttelte ihn sanft an den Armen, schlug die mit schwerem Pelz besetzten Revers seines teuren Mantels zusammen und drohte ihm warnend mit einem kleinen, behandschuhten Finger.
Und die ganze Zeit sah der Mann sie an, sagte wenig, verschlang sie jedoch mit seinen großen, dunklen Augen, in denen stetig das Feuer des Todes loderte und die sich körperlich von ihr zu nähren schienen, mit der unersättlichen und gefräßigen Zärtlichkeit der Liebe. Er war Jude, von riesigem Wuchs, ausgemergelt und von der Krankheit so aufgezehrt, dass seine Gestalt in den schweren und teuren Kleidungsstücken, die er trug, verloren ging, verschlungen und vergessen wurde.
Sein schmales weißes Gesicht, abgemagert zu einer fast fleischlosen Hülle von Haut und Knochen, lief in einer riesigen Hakennase zusammen, sodass sein Gesicht weniger ein Gesicht als vielmehr ein großer Todesschnabel war, erhellt von zwei brennenden und gefräßigen Augen und an den Seiten eingefärbt von zwei rot lodernden Flaggen. Dennoch war es, trotz der ganzen Scheußlichkeit der Krankheit und Auszehrung, ein eigentümlich einprägsames und bewegendes Gesicht, ein irgendwie vornehm tragisches Antlitz mit dem Mal des Todes.
Doch nun war die Zeit des Abschieds gekommen. Die Schaffner ermahnten die Reisenden durch laute Zurufe; auf der ganzen Länge des Bahnsteigs entstand rasche und dicht gedrängte Bewegung, ein eiliges Strudeln unter den befreundeten Grüppchen. Man sah Menschen einander umarmen, lachen, schreien, für noch einen festen schnellen Kuss zurückkehren und dann hastig ihre Abteilwagen erklimmen. Und man hörte in fremden Zungen die Gelöbnisse, Schwüre, Versprechungen, die Scherzworte und hingeworfenen Andeutungen, die jeder Gruppe vertraulich und kostbar waren und sie zu unvermittelten Lachstürmen hinrissen, die Worte des Abschieds, die in der ganzen Welt dieselben sind.
«Otto! Otto! … Hast du bei dir, was ich dir mitgegeben habe? … Fühl mal! Ist es noch da?» Er fühlte, es war noch da; Lachsalven.
«Triffst du Else?»
«Wie war das? Ich versteh nichts», schreiend, die Hand hinters Ohr gelegt, den Kopf wendend mit ratlosem Gesichtsausdruck.
«Ich – hab – gefragt – ob – du – Else – triffst», ziemlich laut zwischen zu einem Trichter geformten Händen über den Tumult der Menge hinweggebrüllt.
«Ja. Ich glaub schon. Wir werden sie wohl in St. Moritz treffen.»
«Sag ihr, dass sie mir schreiben soll.»
«Wie? Ich kann dich nicht hören.» Dieselbe Pantomime wie zuvor.
«Ich – hab – gesagt – sie – soll – mir – schreiben.» Abermals gebrüllt.
«Oh, ja! Ja!» Schnelles Nicken, Lächeln. «Ich werd’s ihr sagen.»
«Sonst bin ich ihr böse.»
«Was? Ich kann dich nicht hören bei dem ganzen Lärm.» Alles wie gehabt.
«Ich – hab – gesagt – sonst – bin – ich – ihr – böse.» Wieder mit äußerster Lungenkraft gebrüllt.
An dieser Stelle wandte sich ein Mann, der heimlich mit einer Frau getuschelt hatte, die vor unterdrücktem Gelächter bebte, mit einem Grinsen im Gesicht dem abreisenden Freund zu, um ihm etwas zuzurufen, wurde jedoch von der Frau daran gehindert, die ihn am Arm packte und mit einem vor Lachen roten Gesicht hysterisch keuchte: «Nein! Nein!»
Doch der Mann legte, immer noch grinsend, seine Hände um seinen Mund und brüllte: «Sag Onkel Walter, er muss sie anziehen, seine …»
«Wie war das? Ich versteh nichts!» Hand hinterm Ohr und Drehen des Kopfes zu einer Seite wie zuvor.
«Ich – hab – gesagt …», begann der Mann absichtsvoll zu brüllen.
«Nein! Nein! Nein! Pscht», keuchte die Frau hektisch und zerrte an seinem Arm.
«… du – sollst – Onkel Walter – sagen – er – muss – seine – wollenen …»
«Nein! Nein! Nein! – Heinrich! … Pscht», kreischte die Frau.
«… die – dicken – die – Tante – Bertha – mit – seinen – Initialen – bestickt – hat!», fuhr der Mann unbarmherzig fort.
Hier brüllte die ganze Gruppe, und die kreischend protestierende Frau wieherte vor Lachen, als sie laut «Pscht! Pscht!» machte.
«Ja* – ich werd’s ihm sagen», johlte der grinsende Passagier zurück, sobald der größte Aufruhr sich gelegt hatte. «Vielleicht – hat – er – sie – gar – nicht – mehr», fügte er als glücklichen nachträglichen Einfall lautstark hinzu. «Vielleicht – hat – eins – der – Frauleins* – da – unten …» Er schnaufte und keuchte vor Lachen.
«Otto!», kreischte die Frau. «Pscht!»
«Vielleicht – hat – eins – der – Frauleins* – sie – ihm – wegge …» Er begann vor Lachen zu keuchen.
«Ot-tooo! … Schäm dich – pscht!», kreischte die Frau.
«Souvenir – aus – dem – alten – München», brüllte ihr witziger Gefährte zurück, und abermals krümmte sich die ganze Gruppe vor Lachen. Als sie wieder einigermaßen zu sich gekommen waren, begann einer der Männer mit fiepender und stockender Stimme, während er sich die nassen Augen wischte: «Sag – Else …» Hier brach ihm mit einem schwachen Quieken die Stimme, und er hielt inne, um sich nochmals die Augen zu wischen.
«Was?», johlte der grinsende Passagier ihm zu.
«Sag – Else», begann er mit festerer Stimme, «dass Tante – Bertha … O mein Gott», ächzte er wieder schwach, wankte, wischte sich die nassen Augen und musste sich mit einem ohnmächtigen Schweigen begnügen.
«Was? – Was?», brüllte der grinsende Passagier scharf, die Hand ans aufmerksame Ohr gelegt. «Was soll ich Else sagen?»
«Sag – Else – dass – Tante – Bertha – ihr – das – Rezept – für – ihre – Schichttorte – schickt.» Der Mann kreischte jetzt geradezu, als ob er die Worte um jeden Preis vor dem drohenden Kollaps herausbringen wollte. Die Wirkung dieses scheinbar sinnlosen Hinweises auf Tante Berthas Schichttorte war erstaunlich: Nichts von dem Vorangegangenen hatte auch nur annähernd diese krampfartige Wirkung auf die Gruppe von Freunden hervorgerufen. Binnen eines Augenblicks waren sie nur noch ein einziger bebender Lachkrampf, wie Betrunkene taumelten sie umher, umklammerten einander kraftlos auf der Suche nach Halt, Tränenfluten stürzten aus ihren verquollenen Augen, und aus ihren weit geöffneten Mündern kamen dann und wann schwache Geräuschfetzen, ersticktes Keuchen, mattes Kreischen der Frauen, ein schnaufender, ohnmächtiger Ausbruch von Heiterkeit, von der sie sich schließlich mit einer Art befreiendem Aufschluchzen erholten.
Worum es hier ging – die vollständige Bedeutung dieses scheinbar banalen Hinweises, der sie alle in einen solch krampfartigen Heiterkeitsausbruch getrieben hatte –, könnte kein Fremder je ergründen, doch seine Wirkung auf die anderen Menschen war ansteckend; sie sahen in Richtung der Freundesgruppe und schmunzelten, lachten, schüttelten die Köpfe. Und so ging es entlang des ganzen Bahnsteigs. Hier waren würdige, fröhliche, traurige, ernste, junge, alte, ruhige, zwanglose und aufgeregte Menschen; hier waren aufs Geschäft oder aufs Vergnügen versessene Menschen; hier waren Menschen, die mit jeder Handlung, jedem Wort und jeder Geste die Erregung, Freude und Hoffnung teilten, die die Reise in ihnen geweckt hatten, und Menschen, die erschöpft und teilnahmslos dreinblickten, sich auf ihre Sitze niederließen und kein weiteres Interesse an den Szenen des Aufbruchs zeigten – aber überall war es dasselbe.
Die Menschen sprachen die universelle Sprache des Aufbruchs, die sich in der ganzen Welt nicht unterscheidet – jene Sprache, die oft banal, belanglos, ja sogar unnütz und gerade deshalb eigentümlich bewegend ist, da sie dazu dient, eine tiefere Empfindung in den Herzen der Menschen zu verbergen, um die Leere in ihren Herzen beim Gedanken an den Abschied zu füllen, um als Schild zu fungieren, als täuschende Maske für ihre wahren Gefühle.
Und eben darum lag in der Zeremonie der Zugabfahrt für den jungen Mann, den Fremden und Ausländer, der diese Dinge hörte und sah, etwas Mitreißendes und Ergreifendes. Als er diese vertrauten Worte und Gesten hörte und sah – Worte und Gesten, die jenseits der Barriere einer fremden Sprache jenen glichen, die er sein ganzes Leben lang unter seinesgleichen erlebt hatte und gewohnt war –, empfand er mit einem Mal so stark wie nie zuvor die überwältigende Einsamkeit der Vertrautheit, das Gefühl menschlicher Gleichheit, das auf so seltsame Weise alle Menschen der Welt eint und das im Gefüge des menschlichen Lebens wurzelt, weit jenseits der Sprache, die einer spricht, und der Rasse, der er angehört.
Doch nun, da die Zeit des Abschieds gekommen war, sagten die Frau und der sterbende Mann nichts mehr. Sich bei den Armen haltend, sahen sie einander an, mit dem Starrblick brennender, gieriger Zärtlichkeit. Sie umarmten sich, ihre Arme umschlangen ihn, ihr lebendiger und wollüstiger Körper drängte sich an ihn, ihre roten Lippen saugten sich an seinem Mund fest, als ob sie ihn nie würde fortlassen können. Schließlich riss sie sich geradezu von ihm los, versetzte ihm mit den Händen einen verzweifelten kleinen Stoß und sagte: «Geh, geh! Es ist Zeit!»
Da wandte sich die Vogelscheuche um und bestieg rasch den Zug, der Schaffner kam vorbei und warf brüsk die Tür hinter ihm zu, der Zug begann gemächlich aus dem Bahnhof zu rollen. Und die ganze Zeit beugte sich der Mann aus einem Fenster im Gang und sah sie an, und die Frau lief neben dem Zug her und versuchte, ihn so lang wie möglich im Blick zu behalten. Nun nahm der Zug Fahrt auf, die Frau ging langsamer, blieb stehen, mit feuchten Augen, ihre Lippen murmelten Worte, die niemand zu hören vermochte, und als er ihrem Sichtfeld entschwand, rief sie «Auf Wiedersehen!»*, führte ihre Hand an die Lippen und sandte ihm einen Kuss hinterher.
Der junge Mann, der für die kurze Dauer dieser Reise der Begleiter jenes Gespensts sein sollte, blieb noch einen Augenblick am Gangfenster stehen und blickte den Bahnsteig mit der hohen, bogenförmigen Überdachung entlang; es schien, als ob er dem Pulk von Leuten nachsähe, die den Bahnsteig verließen, doch in Wirklichkeit sah er allein die große, hübsche Gestalt der Frau, die langsam davonging, gesenkten Kopfes, mit langen, bedächtigen Schritten von unvergleichlicher Anmut und lustvollem Wogen. Einmal hielt sie inne, um nochmals zurückzublicken, dann wandte sie sich um und ging langsam weiter wie zuvor.
Da plötzlich blieb sie stehen. Aus der Menschenmenge auf dem Bahnsteig hatte sich ihr jemand genähert. Es war ein junger Mann. Die Frau blieb bestürzt stehen, erhob eine behandschuhte Hand zum Protest, machte Anstalten weiterzugehen, fand sich im nächsten Augenblick in einer wilden Umarmung gefangen, und sie verschlangen einander mit leidenschaftlichen Küssen.
Als der Reisende zu seinem Platz zurückkehrte, war der sterbende Mann, der bereits vom Gang ins Abteil gegangen war, in die Polster seines Sitzes gesunken, atmete schwer, beruhigte und erholte sich. Einen Augenblick lang betrachtete der junge Mann aufmerksam das schnabelartige Gesicht, die geschlossenen müden Augen, und fragte sich, ob dieser sterbende Mann jene Begegnung auf dem Bahnsteig beobachtet hatte und was ein derartiges Wissen nun für ihn bedeuten mochte. Doch die Maske des Todes war rätselhaft, verschlossen; der Jüngere fand dort nichts, was er hätte lesen können. Ein schwaches und lichtes Lächeln umspielte den schmalen Mund des Mannes, und seine brennenden Augen waren jetzt geöffnet, doch fern und versunken; sie schienen aus einer unsagbaren Tiefe auf etwas Fernes zu blicken. Unvermittelt, in einem tiefgründigen und zärtlichen Ton, sagte er: «Das war meine Frau. Jetzt, im Winter, muss ich allein fort, denn so ist es am besten. Aber im Frühling, wenn es mir besser geht, wird sie zu mir kommen.»
Während des ganzen winterlichen Nachtmittags brauste der stolze Zug durch Bayern. Rasch und kraftvoll gewann er an Fahrt, ließ die letzten verstreuten Ausläufer der Stadt hinter sich, und in Traumeseile brauste der Zug über die flache Ebene dahin, die München umgibt.
Der Tag war grau, der Himmel undurchdringlich und ein wenig schwer und doch erfüllt von einer starken, reinen, alpinen Lebenskraft, von jener geruchlosen und doch hochgestimmten Vitalität kalter Gebirgsluft. Binnen einer Stunde hatte der Zug die Alpenregion erreicht; nun gab es Hügel, Täler, unmittelbar aufragende Gebirgsketten und die dunkle Verzauberung der deutschen Wälder, jener Wälder, die mehr sind als nur Bäume – die ein Bannspruch, Zauber und Hexerei sind und die Herzen der Menschen und vor allem die Herzen jener Fremden erfüllen, die eine Rassenverwandtschaft mit dem Land verbindet, mit einer dunklen Musik, einer eindringlichen Erinnerung, die sich nie ganz fassen lässt.
Es ist das überwältigende Gefühl einer unmittelbaren und unausweichlichen Entdeckung, wie es Menschen empfinden, die zum ersten Mal in das Land ihrer Vorväter kommen. Es ist, als käme man in jenes unbekannte Land, nach dem unser Geist sich in der Jugend so leidenschaftlich sehnt, das die dunkle Seite unserer Seele ist, der fremde Bruder und das Gegenstück zu dem Land, das wir in unserer Kindheit kannten. Und es wird uns in jenem Augenblick schlagartig offenbart, da wir es sehen, mit einer kraftvollen Empfindung vollkommenen Wiedererkennens und Unglaubens, mit jener traumgleichen Realität der Fremdartigkeit und Vertrautheit, die Träumen und allen Verzauberungen eigen ist.
Was ist das nur? Was hat es mit dieser wilden, heftigen Freude und Trauer auf sich, die in unseren Köpfen schwillt? Was hat es mit dieser Erinnerung auf sich, die wir nicht ausdrücken können, mit diesem unaufhörlichen Wiedererkennen, für das uns die Worte fehlen? Wir können es nicht sagen. Wir besitzen nicht die Mittel, all dem Ausdruck zu verleihen, keinen ordnungsgemäßen Beleg, um es zu beweisen, und spöttischer Hochmut mag uns für unseren törichten Aberglauben verhöhnen. Und doch kennen wir das dunkle Land auf Anhieb: Wir kommen dorthin, und obwohl wir keine Sprache, keinen Beweis, keinen Ausdruck besitzen für das, was wir empfinden, haben wir, was wir haben, wissen wir, was wir wissen, sind wir, was wir sind.
Und was sind wir? Wir sind einsame, nackte Menschen, die verlorenen Amerikaner. Unermessliche und einsame Himmel wölben sich über uns, und zehntausend Menschen schreiten mit uns in unserem Blut. Woher kommen sie, das beständige Verlangen und die brennende Begierde und die Musik, dunkel und feierlich, märchenhaft, zauberisch, den Wald durchklingend? Wie kann es sein, dass dieser Junge, der Amerikaner ist, dieses fremde Land von jenem Augenblick an kannte, da er es sah?
Wie kann es sein, dass er seit der ersten Nacht in einer deutschen Stadt die Sprache verstand, die er nie zuvor gehört hatte, sie augenblicklich sprach und alles sagte, was er sagen wollte, in einer fremden Sprache, die er nicht beherrschte, in einem eigenartigen Jargon, der weder der seine noch der ihre war, wobei er sich dessen nicht einmal bewusst war, so sehr schien er den Geist der Sprache, nicht deren Worte, auszusprechen, und auf diese Weise sogleich von jedem, mit dem er redete, verstanden wurde?
Nein. Er konnte es nicht beweisen, und doch wusste er, dass es da war, tief vergraben in dem alten, hordenererbten Gehirn und Blut der Menschen, das vollkommene Wissen um dieses Land und das Volk seines Vaters. Er hatte all das empfunden, das tragische und unlösliche Gemisch der Rasse. Er wusste um die schreckliche Verschmelzung des Brutalen und des Geistigen. Er kannte die namenlose Furcht vor dem alten barbarischen Wald, den Kreis der brutalen und barbarischen Gestalten, die ihn mit ihrem finsteren und unheimlichen Ring umgaben, das Gefühl, in den blinden Waldesschrecken barbarischer Zeit zu ertrinken. Er trug all das in sich, die beharrliche Völlerei und Begierde des unersättlichen Schweins wie auch die eindringliche, seltsame und kraftvolle Musik der Seele.
Er kannte den Hass und Abscheu der nimmersatten Bestie – der Bestie mit der Schweinsvisage und dem unstillbaren Durst, dem unaufhörlichen Hunger, der feisten, beharrlichen, zerrenden Hand, die mit roher, schwelender und nie zu stillender Begierde umhertastete. Und er hasste die große Bestie mit höllischem und mörderischem Hass, weil er sie kannte und in sich spürte und selbst die Beute seiner eigenen reißenden, unstillbaren und obszönen Lüste war. Flüsse von Wein, ganze Ochsen, die sich am Spieß über dem Feuer drehten, und durch des Waldes Düsternis, durch den brüllenden Wall riesiger Bestienleiber und den barbarischen Lärm um ihn das üppige Fleisch der herrlichen blonden Frauen, in der rohen Ausschweifung des alles verschlingenden Rachens eines großen Gelages, ohne Ende oder Sättigung – all das durchmengte sein Blut, sein Leben, seinen Geist.
Es war irgendwie auf ihn gekommen aus dem dunklen Zeitenschrecken des alten Waldes, zusammen mit all dem Erhebenden, Glorreichen, Eindringlichen, Seltsamen und Schönen: der heisere Hörnerklang, der sanft und märchenhaft durch die Wälder zog, die endlosen seltsamen Gewebe, dicht gewirkte Verwandlungen der alten hordenverheerten germanischen Menschenseele. Wie grausam, unergründlich, seltsam und beklagenswert war das Rätsel der Rasse: die Kraft und Stärke des unbestechlichen und emporstrebenden Geistes, der sich aus der verderbten Bestie mit solch strahlender Reinheit erhob, und die machtvollen Zauber großartiger Musik, edler Poesie, so traurig und unabänderlich verwoben und eingewirkt in den blinden, brutalen Hunger des Bauches und der Bestie.
Es war all das, und all das war in seinem einen Leben enthalten. Und nie würde es, wie er wusste, aus ihm herausdestilliert werden können, ebenso wenig, wie man das Blut seines Vaters vom eigenen Fleisch absondern kann, die alten und unwandelbaren Gewebe dunkler Zeit. Und aus diesem Grund hatte er, als er nun aus dem Zugfenster auf das Land blickte, das ihn nicht mehr losließ, auf die eindrucksvolle und einsame alpine Landschaft des Schnees und des dunklen, verzauberten Waldes, unmittelbar das Gefühl vertrauten Wiedererkennens, das Gefühl, dass er diese Gegend schon immer gekannt habe, dass sie ihm Heimat sei. Und etwas Dunkles, Wildes, Feierliches und Fremdartiges ließ ihn frohlocken, ließ seine Lebensgeister erwachen wie eine großartige und eindringliche Musik, die er im Traum gehört hatte.
Und nun, da sich eine freundliche Bekanntheit eingestellt hatte, begann der Geist mit der unersättlichen, besitzergreifenden Neugier seiner Rasse seinen Gefährten mit zahllosen Fragen zu traktieren, die sein Leben, sein Zuhause, seinen Beruf, seine gegenwärtige Reise und den Grund für diese Reise betrafen. Der junge Mann antwortete bereitwillig und ohne Verärgerung. Er wusste, dass er unbarmherzig ausgequetscht wurde, doch die flüsternde Stimme des sterbenden Mannes war so einnehmend, freundlich, sanft, sein Betragen so höflich, liebenswürdig und einschmeichelnd, sein Lächeln mit der Andeutung eines schwachen und doch angenehmen Ausdrucks von Müdigkeit so hell und gewinnend, dass die Fragen sich fast von selbst zu beantworten schienen.
Der junge Mann war Amerikaner, nicht wahr? … Ja. Und wie lang war er bereits im Ausland – zwei Monate? Drei Monate? Nein? Fast ein Jahr! So lang schon! Dann gefiel ihm Europa also, ja? Es war seine erste Überseereise? Nein? Seine vierte? – Der Geist hob in ausdrucksvollem Erstaunen die Augenbrauen, und dennoch umspielte seinen empfindsamen schmalen Mund die ganze Zeit jenes schwache, müde zynische Lächeln.
Schließlich war der Junge restlos ausgequetscht: Der Geist wusste alles über ihn. Dann saß er einen Augenblick lang da mit seinem schwachen, hellen, ganz leicht spöttischen und doch liebenswürdigen Lächeln und starrte den jungen Mann an. Schließlich sagte er müde, geduldig und mit der ruhigen Endgültigkeit der Erfahrung und des Todes: «Sie sind sehr jung. Ja. Jetzt wollen Sie alles sehen und haben – doch Sie haben nichts. Das stimmt doch – ja?», sagte er mit überzeugendem Lächeln. «Das wird sich alles ändern. Eines Tages werden Sie nur noch ein bisschen wollen – und dann werden Sie, vielleicht, ein bisschen haben …», und wieder ließ er sein helles, gewinnendes Lächeln aufblitzen. «Und das ist besser – ja?» Er lächelte wieder, und dann sagte er müde: «Ich weiß. Ich weiß. Auch ich bin überall hingegangen, wie Sie. Ich habe alles zu sehen versucht – und hatte nichts. Jetzt gehe ich nirgends mehr hin. Es ist überall dasselbe», sagte er, erschöpft aus dem Fenster blickend, mit einer abschließenden Geste seiner schmalen weißen Hand. «Felder, Hügel, Berge, Flüsse, Städte, Menschen … Sie möchten über all das Bescheid wissen. Ein Feld, ein Hügel, ein Fluss», flüsterte der Mann, «das ist genug.»39
Er schloss für einen Moment die Augen; als er wieder zu sprechen begann, war sein Flüstern fast unhörbar: «… ein Leben, ein Ort, eine Zeit.»
Dunkelheit senkte sich herab, und im Abteil gingen die Lichter an. Wiederum machte das Flüstern des schwindenden Lebens nachdrücklich, sanft und unerbittlich seinen Anspruch auf den jungen Mann geltend. Diesmal bat es, das Licht im Abteil zu löschen, während der Geist sich auf dem Sitz ausstreckte, um zu ruhen. Der jüngere Mann stimmte bereitwillig und sogar freudig zu: Seine eigene Reise näherte sich ihrem Ende, und draußen beschien der früh aufgegangene Mond die alpinen Wälder und Schneefelder mit einem seltsamen, blendenden und eindringlichen Zauber, der dem Dunkel des Abteils etwas von seinem eigenen geisterhaften und geheimnisvollen Licht abgab.
Der Geist lag ruhig ausgestreckt in seinen Sitzpolstern, seine Augen waren geschlossen, sein abgemagertes Gesicht, auf dem die beiden hellen, rot lodernden Flaggen nun zinnoberrot leuchteten, seltsam und grausig in dem zauberischen Licht wie der Schnabel eines großen Vogels. Der Mann schien kaum zu atmen: Kein Geräusch, keine Bewegung war in dem Abteil wahrzunehmen außer dem Stampfen der Räder, dem ledrig sich dehnenden und knarzenden Geräusch des Waggons und der ganzen fremdartig-vertrauten und stimmungsvollen Symphonie der Laute, die ein Zug von sich gibt – jene gewaltige symphonische Monotonie, die der Klang der Stille und Ewigkeit selbst ist.
Vom Bann der magischen Beleuchtung und der Zeit eine Weile umfangen, saß der junge Mann da und starrte aus dem Fenster auf die verzauberte Welt in Weiß und Schwarz, großartig und fremd, die im eindringlichen und geisterhaften Glanz des Mondes vorbeihuschte. Schließlich stand er auf, trat auf den Gang hinaus, schloss behutsam die Tür hinter sich und ging entgegen der Fahrtrichtung des stampfenden Zuges Waggon für Waggon die engen Gänge entlang, bis er den Speisewagen erreicht hatte.
Hier herrschte nichts als strahlende Helligkeit, Betriebsamkeit, Luxus, sinnliche Wärme und Fröhlichkeit. Das ganze Leben des Zuges schien sich nun auf diesen einen Punkt zu verdichten. Die Kellner, trittsicher und geschickt, bewegten sich rasch durch den Gang des schwankenden Wagens und blieben an jedem Tisch stehen, um den Leuten von den großen Platten, die sie auf Tabletts trugen, fein zubereitete Speisen zu servieren. Hinter ihnen entkorkte der Sommelier hohe, schlanke Flaschen eisgekühlten Rheinweins: Er hielt die Flasche zwischen den Knien, wenn er den Korkenzieher angesetzt hatte, und der Korken kam mit einem erheiternden Geräusch heraus, woraufhin er in einem kleinen Korb abgelegt wurde.
An einem Tisch speiste eine verführerische, schöne Frau mit einem verlebt aussehenden alten Mann. An einem anderen starrte ein riesiger, kräftig aussehender Deutscher mit steifem Kragen, rasiertem Schädel, einem großen Schweinsgesicht und einer erhaben-einsamen Denkerstirn mit dem konzentrierten Gesichtsausdruck bestialischer Fressgier auf das Tablett mit Fleisch, von dem der Kellner ihm auftat. Er sprach in einem kehligen und lüsternen Ton, als er sagte: «Ja! … Gut! … Und etwas von diesem hier auch …»*
Die ganze Szenerie strahlte Reichtum, Macht und Luxus aus und beschwor nachdrücklich das Reisegefühl in einem erstklassigen europäischen Schnellzug herauf, das sich von jenem des Fahrgasts in einem amerikanischen Zug unterscheidet. In Amerika vermittelt einem der Zug eine Empfindung ausgelassener und einsamer Freude, ein Gefühl für die ungebändigte, unbegrenzte und unermessliche Wildnis des Landes, durch das der Zug rast, eine wortlose und unsagbare Hoffnung, wenn man an die verzauberte Stadt denkt, auf die der Zug zueilt; das verborgene und sagenhafte Versprechen des Lebens, das man hier finden wird.
In Europa ist die Empfindung von Freude und Vergnügen unmittelbarer, stets gegenwärtig. Die luxuriösen Züge, die prachtvolle Möblierung, die tiefen Kastanien-, dunklen Blautöne und die frischen, gepflegten, lebhaften Farben der Waggons, das gute Essen und das weltbürgerliche Aussehen der Reisenden – all das erfüllt einen mit einer kraftvollen sinnlichen Freude, einem Gefühl sich erfüllender Erwartung. Binnen weniger Stunden durchquert man Land um Land, Jahrhunderte der Geschichte, eine an Kultur überreiche Welt und Nationen, in denen es vor Menschen wimmelt, von einer berühmten Stadt des Vergnügens zur nächsten.
Und anstelle der ausgelassenen Freude und namenlosen Hoffnung, die man beim Blick durch das Fenster eines amerikanischen Zuges empfindet, wenn man die einsame, ungebändigte und unermessliche Erde sieht, die ruhig und unerschütterlich an einem vorüberzieht wie das Antlitz von Zeit und Ewigkeit, empfindet man hier (in Europa) eine unglaubliche Verwirklichungsfreude, eine unmittelbare sinnliche Befriedigung, ein Gefühl, dass es auf Erden nichts anderes gibt als Wohlstand, Macht, Luxus und Liebe und dass man dieses Leben führen und genießen kann, in all seinen unendlichen Spielarten des Vergnügens, für immer und ewig.
Nachdem der junge Mann seine Mahlzeit beendet und seine Rechnung bezahlt hatte, machte er sich auf den Rückweg, Wagengang um Wagengang, durch die ganze Länge des stampfenden Zuges. Als er wieder an seinem Abteil angelangt war, sah er den Geist dort liegen, wie er ihn verlassen hatte, ausgestreckt auf dem Sitz, und das leuchtende Mondlicht funkelte noch immer auf dem großen Schnabelgesicht.
Der Mann hatte seine Lage nicht das kleinste bisschen verändert, und doch wurde der Junge mit einem Mal einer fast unmerklichen, verhängnisvollen Veränderung gewahr, die er nicht zu benennen vermochte. Was war es nur? Er setzte sich wieder auf seinen Platz und blickte eine Zeit lang starr auf die stille, geisterhafte Gestalt ihm gegenüber. Er dachte, war sich fast sicher, er sehe seine Atembewegungen, das Heben und Senken der ausgemergelten Brust, und war sich doch nicht sicher. Ganz deutlich hingegen erkannte er jetzt eine Linie, zinnoberrot in ihrer monddunklen Tönung, die aus einem Winkel seines zu Festigkeit entschlossenen Mundes geflossen war, und einen großen zinnoberroten Fleck auf dem Fußboden.
Was sollte er tun? Was konnte man tun? Das eindringliche Licht des verhängnisvollen Mondes hatte, wie es schien, mit seinem dunklen Hexenwerk seine Seele durchtränkt, mit dem Zauber unermesslicher und unbeweglicher Ruhe. Auch verringerte der Zug bereits seine Geschwindigkeit, die ersten Lichter der Stadt tauchten auf, es war der Zielort seiner Reise.
War es nicht gut, alles so still und unberührt zu belassen, wie er es vorgefunden hatte? Könnte es nicht sein, dass es in diesem großen Traum der Zeit, in dem wir leben und die Spielfiguren sind, keine größere Gewissheit gibt als diese, dass es nach der Begegnung, nach dem Gespräch, der augenblickskurzen Bekanntschaft, sowie wir irgendwo auf dieser Erde zwischen zwei Zeitpunkten weiter durch das Dunkel geschleudert werden, gut ist, uns damit zu begnügen, einander nach der Begegnung den Rücken zu kehren, jeden allein seinem festgelegten Ziel entgegengehen zu lassen, nur dieses einen gewiss, nur dieses einen bedürfend – dass für uns alle Stille herrschen wird, nichts als Stille am Ende?
Und nun, kurz vor dem Halt, wurde der Zug immer langsamer. Da waren die Scheinwerfer von Zügen, die wechselnden Lichter am Bahnhof, klein, hell und hart, grün, rot und gelb, die das Dunkel durchschnitten, und auf anderen Gleisen konnte er die kleinen Güterwagen sehen und die Reihen verdunkelter Züge, alle leer, dunkel und mit ihrer seltsamen Aufmerksamkeit auf neues Leben wartend. Dann begannen die langen Perrons gemächlich an den Zugfenstern vorbeizugleiten, und die stämmigen, bockartigen Gepäckträger setzten sich in Bewegung, unter eifrigem Grüßen, Reden und Zurufen an die Leute im Zug, die bereits angefangen hatten, ihr Gepäck durch die Fenster hinauszureichen.
Sachte nahm der Junge seinen Mantel und Koffer von der Gepäckablage über seinem Kopf und trat hinaus in den engen Gang. Leise schob er die Abteiltür hinter sich zu. Im Halbdunkel des Abteils lag die gespenstische Leichengestalt auf dem Polster, unbewegt. Der Zug war vollends zum Stillstand gekommen. Der Junge lief bis zum Ende des Gangs, und gleich darauf, den erfrischenden Schock kalter Luft in seinen Lungen, mit hundert anderen Leuten den Perron hinunter, alle bewegten sich in dieselbe Richtung, einige strebten Sicherheit und Zuhause zu, andere einem neuen Land, Hoffnung und Verlangen, der wachsenden Vorahnung der Freude, dem Versprechen einer leuchtenden Stadt. Er wusste, eines Tages würde er nach Hause zurückkehren.
1927
Zwei Wochen im Juli und August München, Augsburg, Berchtesgaden, Salzburg, Wien, Nürnberg
«They are a very powerful and energetic people, quite ignorant, I believe, of their unpleasant qualities.»
ANSICHTSKARTE
Nürnberg, 23. August 1927
Liebe Mama1, nach ein paar Tagen Prag bin ich wieder in Deutschland. Dies ist eine der zauberhaftesten alten Städte der Welt – mit mittelalterlicher Stadtmauer und intakter Altstadt. Reise von hier nach Paris weiter.
Liebe Grüße an alle, Tom
Dies ist eine der zauberhaftesten alten Städte der Welt – mit mittelalterlicher Stadtmauer und intakter Altstadt … – NÜRNBERG UM 1925.
imago images: UIG
NOTIZBUCH-EINTRÄGE
Nürnberg, 24. Aug., Mittwoch
Heute Morgen ins Deutsche Museum2. Prachtvoller Wohlgemuth3 – Seine Gemälde und Holzschnitte. Pleydenwurff – die Jungfrau mit dem Kind4 – Exquisite Klarheit. Cranachs großartige Lucretia5 und Dürers zwei Könige – einer ist Karl der Große6.
25. Aug., Do., 12.00 Uhr
[…] In einer Bar gegenüber dem Hotel. Rückreise nach Paris heute Abend um 19.25 Uhr – Muss Fritz Day und George Wallace eine Karte schreiben7 – Diese Reiseaufzeichnungen auf den neuesten Stand bringen – ab jetzt. Essen in Nürmberg* wunderbar – Gansbraten* – (Leipziger Allerlei* ganz ausgezeichnet) Schöner Weißwein (Riesling*)
[…] «Valentin Sorg»8 – sie weinte – Amerikaner, die herblickten – Jene Nacht auf dem Weg nach Deutschland – Soldaten, die unsere Küsse sahen und lachten, am Bahnhof – Menschen, die während der Nacht am Bahnhof zum Fenster hereinschauten – Karlsruhe – Stuttgart – Morgen, das flache Land rings um München – München (ein Ort, der ihr sehr gefiel) […]
Bayerisches Museum in München9: Riesenhafter und prächtiger Bau – die gotischen Madonnen – Der verrückte junge Deutsche, der uns führte – Der meilenweite Ramsch im GlasPalast*10 – Bilder von Amerikanern auf Boulevards, komisch und primitiv – Der Apoll in der Glyptothek – Grässliche Bilder in der Neuen Pinakothek – ein oder zwei ganz ordentliche von Lenbach11. Großartige hingegen in der Alten Pinakothek.
Berchtesgaden: Schönes Land, gemeine Menschen – wir bekamen die Hunnenschädel und Dreifachnacken allmählich sehr satt – Unser Hotel – Geschrubbte Fußböden – Bergsteigende bayerische Burschen und Mädel singen die ganze Nacht besoffene Lieder. Ich war reizbar und ungeduldig zu jener Zeit.
BRIEF
Wien, 11. August 1927
Lieber Herr Professor Watt12,
[…] Seit zwei Tagen bin ich nun in dieser bezaubernden Stadt Wien: Ich reiste von München durchs bayerische Gebirge an. Drei Wochen zuvor hat hier eine Revolte stattgefunden, bei der vierhundert Menschen ihr Leben verloren,13 aber dem fröhlichen Leben hier in der Stadt sieht man das jetzt nicht mehr an. Diese Menschen scheinen einer völlig anderen Zivilisation anzugehören als die Deutschen. Dem hiesigen Leben wohnen eine Leichtigkeit, eine Feinfühligkeit und ein Zauber inne, die so unteutonisch sind wie nur was. Die ganze Stadt mutet in ihrem Erscheinungsbild eher französisch an; ein kleineres Paris, aber ich glaube, die Fröhlichkeit der Leute ist spontaner als die der Pariser – hier gibt es mehr aufrichtige Herzlichkeit: Es fehlt ihnen die sehr böse gallische Härte.
Ich fahre von hier nach Prag und von dort nach Paris zurück. Ich werde wohl um den 10. September herum gen New York abdampfen. Dies war eine stille und sehr ergiebige kleine Reise. Ich verschlinge gefräßig die deutsche Sprache brockenweise und kaufe Bücher mit beiden Händen. Wissen Sie, dass ich Deutsch mit diesen Leuten spreche? Sehr schlechtes, unbeholfenes, stockendes Deutsch, wohl wahr, aber sie verstehen mich. Meine Möglichkeiten, eine Sprache flüssig zu sprechen, sind beschränkt, aber ich habe ein echtes Talent für deren Verständnis und sauge sie in mich auf. Ich kann jetzt mit schlechter Geläufigkeit Französisch sprechen und es so gut lesen und verstehen wie Englisch. Vor Ablauf eines weiteren Jahres werde ich ebenso viel für mein Deutsch getan haben. Dann werde ich mich dem Italienischen zuwenden. Es ist einfach faszinierend, in eine neue Sprache versunken zu sein, wenn die Namen aller Dinge, die man benötigt – Tabak, Seife, Streichhölzer, Kalbsschnitzel und so weiter –, einem als in fremder Zunge gesprochen und gedruckt begegnen. So sickert sie durch die Poren der Haut ein.
Die Zeitungen hier (und in ganz Europa) erregen sich ungeheuer über den Sacco-und-Vanzetti-Fall14. Ganze Titelseiten nimmt er ein. Anscheinend besteht ein universelles Verlangen nach Begnadigung der beiden. Es ist sehr schade, dass eine derartige Angelegenheit plötzlich das schrecklich bittere Gefühl, das die ganze Welt heute Amerika gegenüber hegt, sozusagen kanalisiert und symbolisiert. Ich beende diesen Brief übrigens einige Tage nachdem ich ihn begonnen habe: Ich bin seit knapp einer Woche in Wien, und der ungeheure Charme der Stadt hat mich ganz durchdrungen. Wenn ich wiederkomme, dann komme ich für mehrere Monate her, um mir die Sprache anzueignen. München war eine prachtvolle Stadt, mit einigen der großartigsten Dinge, die ich je gesehen habe, aber man kann es einfach nicht leugnen: Es gibt eine Sorte Deutscher – junge Herren mit Duellnarben im Gesicht und ältere mit rasierten Kugelköpfen, Schweinsäuglein und drei Wülsten über dem Kragen hinten –, die ich wirklich, wirklich nicht mag! Ich wich ihnen auf den Gehsteigen bedachtsam und ruhig aus, bis ich feststellte, dass diese Herren die unglückselige (und, wie ich glaube, unbewusste) Angewohnheit hatten, nicht nur die vier Yard15 zu beanspruchen, die ihnen zustanden, sondern auch jene acht Zoll, die mir gehörten. Alles, woran ich bezüglich der Unverletzlichkeit der Freiheit und der Menschenrechte je geglaubt hatte, kochte über, ich ging finster entschlossen meines Wegs, vergrößerte meine Schritte, sobald ich auf Höhe des verblüfften Hunnen war, bevor er zurückweichen konnte. Gott vergebe mir diese geistige Niedertracht: Ich kann Ihnen versichern, dass mein Vorurteil, wenn überhaupt vorhanden, aufgrund der bösartigen Kriegspropaganda gegen die Deutschen ein positives war. Sie sind ein sehr kraftvolles und energisches Volk, das sich seiner unerfreulichen Eigenschaften, glaube ich, gar nicht bewusst ist; ihre schöpferische und intellektuelle Kraft ist enorm: gewaltig, tiefsinnig, unergründlich und welterschütternd (wie Kant und Wagner), aber es fehlt ihnen diese wienerische feine Empfindsamkeit und Weltläufigkeit. […]
1928
Drei Monate von Juli bis Oktober Köln, Bonn, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, München, Oberammergau, Salzburg, Wien
«Munich almost killed me.»
NOTIZBUCH-EINTRÄGE
Dienstag, 7. Aug., Köln
Langte am vergangenen Abend hier an, nach bizarren Erlebnissen in Nordbelgien bei dem Versuch, ein Zimmer zu finden. Mechelen, wo ich zwischen Dieben schlief – Antwerpen – das verblüffende Spektakel dieser Stadt – die zahllosen Cafés – und nichtöffentliche kleine «Wirtshäuser» und Weinläden – Gang durch die Altstadt auf Zimmersuche – Immer dieses Ankommen bei Dunkelheit in einer Stadt – Alte Straßen mit zahllosen kleinen, dreckigen Buden aber nicht sehr anziehend – entlang der Kais – Canadian-Pacific-Schiffe längsseits vertäut. […]
Donnerstag [9. August]
Aufgestanden um zehn – leckeres deutsches Frühstück mit Tee, Marmelade, Roggenbrot, Wurst, Rindfleisch, gekochtem Schinken und Zunge. Verbrachte den restlichen Morgen mit Brief an Aline – Dann Wäscherei und Haus-Platte* mit Bier im Hofbrau Haus*1 – Dann Gemälde im Museum2 – Einige sehr schöne Frühe deutsche Primitive3 – Meister des Marienlebens4 – Bilder des gekreuzigten Christus inmitten der Schächer – Frühe kölnische Gemälde, auf denen Christus mit einem kleinen Lendentuch, aber ohne mannhafte Organe zu sehen ist – Zwei Schächer tragen große, gut gefüllte Schamkapseln5 – Vorstellung vom Kastratengott also althergebracht, nicht bloß eine Idee des YMCA6. Großer della Robbia7 der Heiligen Jungfrau – Moderne Gemälde – impressionistische und postimpressionistische Schule: großteils sehr schlecht – aber prachtvoller Picasso – eine spanische Familie8 und feiner van Gogh9 und guter Renoir10. Muss noch mal herkommen.
Danach zum German KoffeeHaus*11 – Danach zum Rasieren – sehr eleganter Laden – ziemlich junge deutsche Mädchen als Maniküren – danach zur Buchhandlung – wieder stelle ich fest12
Hier in Deutschland, da der Zeitpunkt ihrer Heimkehr näher rückt – fängt es wieder an – nicht das starke Verlangen, sie zu sehen, sondern die Erinnerung, immer noch schmerzhaft und bitter, an das Leid und die Scham, die ich erduldet habe.
Köln. Aber ach! der Trost, mich in einem Land aufzuhalten, in dem alles gut gemacht wird – wo (in der Regel) ein Preis gilt; wo es keine zahllosen Betrugsversuche und Feilschereien gibt. Wenn es um Abkommen, Verträge und staatliche Versprechen geht, mögen die Deutschen ja Diebe und Verräter sein, wie ihre Feinde behaupten, aber wenn es um Hotelrechnungen, Preisbindung, Trinkgelder und so weiter geht, sind sie rechtschaffener, als die Franzosen je waren.
Köln, «Presse»: Sie haben das kolossalste Ausstellungsgebäude errichtet,13 das ich je gesehen habe – durchweg im modernen Stil und sehr, sehr gut*! Da ist eine Entschlossenheit und kraftvolle Energie in allem, was sie tun, die ihren Willen zeigen, «wieder hochzukommen». Raum für Raum wird umfassend und erschöpfend alles gesagt, was über Zeitungen gesagt werden kann. Und die prachtvolle Buchausstellung – viele Ausgaben der Franzosen – Carco, Morand, Cocteau, Larbaud und so weiter.14 Lafontaine – Voltaire – La Bruyère.15
Deutsche – Hauptmann, Schillers und Goethes Gedichte, Graf Luckner, Rilke, Rathenau, Wassermann, Schnitzler.16
Viele erste Seiten der Bibel, prachtvoll gesetzt und in verschiedenen Sprachen – eine deutsche «Hamlet»-Ausgabe, herausgegeben von Hauptmann, mit lateinischen und französischen Quellenangaben am Rand.17
Die Wirkung der «Ausstellung» ist überwältigend. Wie gewöhnlich haben die Deutschen die Dinge mit unbedingter Sorgfalt erledigt – das Herz rutscht einem in die Hose angesichts der Tonnen von Zeitungspapier, die hier zu sehen sind.
Samstagmorgen [11. August]
Frühstück – dann zu Cook18