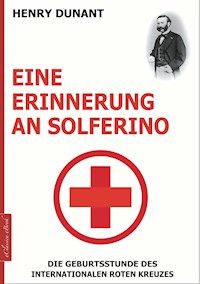
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Henry Dunant: Eine Erinnerung an Solferino – Die Geburtsstunde des Internationalen Roten Kreuzes | 2021er Neuauflage, mit Begleitwort und zahlreichen Fußnoten und Erklärungen | »Die Sonne des 25. Juni beleuchtete eines der schrecklichsten Schauspiele, das sich erdenken lässt. Das Schlachtfeld ist bedeckt von Leichen und Pferden ... an anderen Stellen liegen Unglückliche, die von Kugeln und Granaten getroffen zu Boden gestreckt sind, denen aber darüber hinaus noch die Räder der Geschütze, die über sie hinwegfuhren, Arme und Beine zermalmt hatten ... Dort liegt ein völlig entstellter Soldat, dessen Zunge aus dem zerschmetterten Kiefer hängt ... Einem anderen Unglücklichen ist durch einen Säbelhieb ein Teil des Gesichts fortgerissen worden...« – Diese Worte schrieb der Schweizer Henry Dunant, der auf einer Geschäftsreise während der Schlacht von Solferino* am 24. Juni 1859 in die Nähe des Kampffeldes geriet. Nach dem Gemetzel war er aufs Tiefste erschüttert von den Zuständen vor Ort: Tausende von Sterbenden und Schwerstverletzten auf freiem Feld, wenige, schlecht ausgebildet Sanitätssoldaten, auf Tausend Verletzte kam ein Chirurg. | Seine geschäftlichen Pläne stellte der Schweizer zurück und schrieb stattdessen dieses Buch, der dramatische Erlebnisbericht eines Außenstehenden, den das Leid, das Entsetzen und die Qualen, die er hautnah miterlebt hatte, erschütterte. Dunant ließ das Buch auf eigene Kosten drucken und schickte es an führende Persönlichkeiten in Politik und Militär in Europa, mit dem Appell, eine Staaten übergreifende Institution zu schaffen, die an Kriegsschauplätzen überall auf der Welt als neutrale Partei auftritt und Verwundete beider Seiten versorgen kann. – Diese Idee war die Geburtsstunde des Internationalen Roten Kreuzes. | [*Die Schlacht von Solferino gilt als eine der blutigsten auf europäischem Boden, bei der rund 300.000 Soldaten aufeinander trafen. Sie entschied den Sardinischen Krieg, auch Zweiter Italienischer Unabhängigkeitskrieg genannt, der 1859 zwischen Österreich einerseits, und anderseits Sardinien-Piemont, verbündet mit dem französischen Kaiserreich, ausgetragen wurde.] | © Redaktion eClassica, 2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
— Contents —
Innentitel
Begleitwort
Vorwort zur zweiten Original-Ausgabe
EINE ERINNERUNG AN SOLFERINO
Anhang
Impressum
Fußnoten
Begleitwort
»Die Sonne des 25. Juni beleuchtete eines der schrecklichsten Schauspiele, das sich erdenken lässt. Das Schlachtfeld ist bedeckt von Leichen und Pferden ... an anderen Stellen liegen Unglückliche, die von Kugeln und Granaten getroffen zu Boden gestreckt sind, denen aber darüber hinaus noch die Räder der Geschütze, die über sie hinwegfuhren, Arme und Beine zermalmt hatten ... Dort liegt ein völlig entstellter Soldat, dessen Zunge aus dem zerschmetterten Kiefer hängt. Ich benetzte seine vertrockneten Lippen und seine verdorrte Zunge. Einem anderen Unglücklichen ist durch einen Säbelhieb ein Teil des Gesichts fortgerissen worden. Nase, Lippen und Kinn sind vom übrigen Teil des Kopfes getrennt ...«
Diese Worte schrieb der Schweizer Henry Dunant, der auf einer Geschäftsreise während der Schlacht von Solferino (s. u.) am 24. Juni 1859 in die Nähe des Kampffeldes geriet. Nach dem Gemetzel war er aufs Tiefste erschüttert von den Zuständen vor Ort: Tausende von Sterbenden und Schwerstverletzten auf freiem Feld und in notdürftig errichteten Lazaretten, kein medizinisches Personal, keine Wundversorgung, keine Medikamente, nicht einmal Verbandsmaterial gab es. Die wenigen Sanitätssoldaten waren schlecht ausgebildet, und auf tausend Verletzte kam ein Chirurg. Dunant beginnt mit Anwohnern Hilfe zu leisten, kauft Verbandszeug, lässt in Kirchen behelfsmäßig Spitäler einrichten.
»Die Frauen von Castiglione«, so schreibt er später, »erkannten bald, dass es für mich keinen Unterscheid der Nationalität gibt, und so folgten sie meinem Beispiel und ließen allen Soldaten, auch wenn sie ihnen völlig fremd waren, das gleiche Wohlwollen zuteil werden. ›Tutti fratelli‹1, wiederholten sie gerührt immer wieder.« Sobald ein Soldat verwundet ist, so Dunants Einstellung, ist er kein Soldat mehr, sondern ein Mensch, der alle Hilfe verdient. Jeder Verwundete muss versorgt werden, egal welche Uniform er trägt.
Seine geschäftlichen Pläne stellte der Schweizer nun zurück und schrieb stattdessen dieses Buch, ein dramatischer Erlebnisbericht eines Außenstehenden, den das Leid, das Entsetzen und die Qualen, die er hautnah miterlebt hatte, erschütterten. Dunant ließ das Buch auf eigene Kosten drucken und schickte es an Staatsmänner und führende Persönlichkeiten in Politik und Militär in Europa, mit dem Appell, eine Staaten übergreifende Institution zu schaffen, die an Kriegsschauplätzen überall auf der Welt als neutrale Partei auftritt und Verwundete beider Seiten versorgen kann. – Diese Idee war die Geburtsstunde des Internationalen Roten Kreuzes.
Dunants Buch erschien im Jahr 1862 und gilt als literarisches Meisterstück; eine zweite Auflage kam schon vier Monate später in die Buchläden und wurde zum Bestseller. Schon kurz darauf folgten Übersetzungen in fast alle europäische Sprachen.
Bereits im folgenden Jahr kam es in Genf zur Gründung des ›Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege‹, das seit 1876 den Namen ›Internationales Komitee vom Roten Kreuz‹ (IKRK) trägt. Die 1864 beschlossene ›Genfer Konvention‹ geht wesentlich auf Vorschläge aus Henry Dunants Buch zurück. Im Jahr 1901 erhielt er für seine Lebensleistung zusammen mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis, der je vergeben wurde.
* * * * *
Die Schlacht von Solferino gilt als eine der blutigsten auf europäischem Boden, bei der rund 300.000 Soldaten aufeinander trafen. Sie entschied den Sardinischen Krieg, auch Zweiter Italienischer Unabhängigkeitskrieg genannt, der 1859 zwischen dem Kaisertum Österreich einerseits, und anderseits Sardinien-Piemont, verbündet mit dem französischen Kaiserreich, ausgetragen wurde.
Die Heere trafen bereits gegen vier Uhr morgens aufeinander. Die Schlacht entwickelte sich auf einer Front von etwa 15 Kilometern Länge und zog sich, mit mehrfachen Vormärschen und Rückzügen beider Seiten, fast über den gesamten Tag hin. Am Abend des 24. Juni 1859 lagen in der Nähe der Ortschaft Solferino, südlich des Gardasees, mehrere Zehntausend Männer niedergemetzelt und verstümmelt am Boden: 6000 Soldaten waren gefallen, 24.000 schwer verletzt. – Die Niederlage der Österreicher ebnete den Weg zur Einigung Italiens.
© Redaktion eClassica, 2021
Vorwort zur zweiten Original-Ausgabe
Da diese Schrift anfänglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, so kam die ganze erste Auflage nicht zum Verkauf; allein der Verfasser, von vielen Seiten aufgefordert, gab endlich seine Zustimmung zum Wiederabdruck. Er gibt sich übrigens der Hoffnung hin, dass er mit ihrer Veröffentlichung nur umso eher den Zweck erreicht, den er sich vorgestellt und der ihn auch veranlasste, den an ihn gelangten, so zahlreichen Begehren zu entsprechen.
* * * * *
EINE ERINNERUNG AN SOLFERINO
Der blutige Sieg von Magenta hatte der französischen Armee die Tore Mailands geöffnet und der Enthusiasmus der Italiener erreichte seinen Gipfelpunkt; in Pavia, Lodi und Cremona wurden die Befreier überall mit Begeisterung begrüßt; die Linien der Adda, des Oglio und der Chiese waren von den Österreichern aufgegeben worden; denn, um endlich für die vorhergehenden Niederlagen eine glänzende Genugtuung sich zu verschaffen, sollten an den Ufern des Mincio bedeutende Streitkräfte vereinigt werden, an deren Spitze sich der junge und ritterliche Kaiser von Österreich stellte.
Den 17. Juni kam Victor Emmanuel nach Brescia woselbst ihn die seit zehn langen Jahren unterdrückte Bevölkerung mit begeisterten Huldigungen empfing, indem sie im Sohn Karl Albert’s nicht allein einen Retter, sondern auch einen Helden begrüßte.
Den darauffolgenden Tag hielt Kaiser Napoleon in derselben Stadt seinen Siegeseinzug, umwogt von einer Bevölkerung, welche im Freudentaumel sich glücklich schätzte, dem Herrscher seine Erkenntlichkeit zu bezeugen, der ihr zur Wiedererlangung der Freiheit und Unabhängigkeit behilflich war. Den 21. Juni zogen der Kaiser der Franzosen und der König von Sardinien aus Brescia, das von ihren Truppen schon Tags vorher verlassen worden war. Den 22. wurden Lenato Castenedolo und Montechiaro besetzt; den 23., abends gab der Kaiser, als Oberkommandant des ganzen Heeres, den Befehl an die bei Desenzano lagernde Armee des Königs Victor Emmanuel, welche den linken Flügel der Alliierten bildete, den 24. morgens gegen Pozzolengo aufzubrechen. Marschall Baraguey d’Hilliers sollte gegen Solferino, der Herzog von Magenta gegen Cavriana, General Niel nach Guidizzolo und Marschall Canrobert nach Medole marschieren, indessen die kaiserliche Garde in Castiglione Stellung zu fassen hatte. Die ganze alliierte Streitmacht war 130.000 Mann stark mit etwa 400 Geschützen.
Dem Kaiser von Österreich standen in der Lombardei neun Armee-Corps in der Gesamtstärke von 230.000 Mann zur Verfügung, da seine Invasionsarmee durch die Besatzungen von Verona und Mantua verstärkt worden war. Auf den Rat des Feldzeugmeisters Baron Heß hatten sich die kaiserlichen Truppen, von Mailand und Brescia an, deshalb fortwährend zurückgezogen, damit zwischen der Etsch und dem Mincio sämtliche Streitkräfte Österreichs in Italien vereinigt würden; allein nur sieben Armee-Corps oder 170.000 Mann mit etwa 500 Geschützen konnten als für die Kriegsoperationen verwendbar angesehen werden.
Das kaiserliche Hauptquartier war von Verona nach Villafranca und von da nach Valeggio verlegt worden, worauf die Truppen Befehl erhielten den Mincio bei Peschiera, Salionze, Valeggio, Ferri, Goito und Mantua wieder zu überschreiten. Das Gros der Armee wurde von Pozzolengo nach Guidizzolo verlegt, um von da aus, auf den Ratschlag mehrerer erfahrener Feldmarschall-Lieutenants die franco-sardische Armee zwischen dem Mincio und der Chiese anzugreifen.
Die österreichischen Streitkräfte bildeten unter den Befehlen des Kaisers zwei Haupt-Armeen. Die erste wurde von dem Feldzeugmeister Graf Wimpffen kommandiert, unter dessen Befehlen die Corps der Feldmarschall-Lieutenants Prinz Edmund von Schwarzenberg, Graf Schaafgottsche und Baron von Veigl, sowie die Kavallerie-Division des Grafen Zedtwitz standen. Diese erste Armee bildete den linken Flügel und fasste in der Umgegend von Volta, Guidizzolo, Medole und Castel Goffredo Stellung.
Die zweite Haupt-Armee war vom Kavallerie-General Graf Schlick befehligt, und unter ihm standen die Feldmarschall-Lieutenants Graf Clam-Gallas, Graf Stadion, Baron von Zobel und Ritter von Benedek, sowie die Kavallerie-Division des Grafen Mensdorf. Diese Armee bildete den rechten Flügel und hielt Capriana, Solferino, Pozzolengo und San Martino besetzt.
Alle Höhen zwischen Pozzolengo, Solferino, Cavriana und Guidizzolo waren somit den 24. morgens in den Händen der Österreicher und starke Batterien schmückten die Mamelons, welche das Zentrum einer ausgedehnten Offensiv-Linie bildeten und dem rechten und linken Flügel erlaubten, sich im Notfall unter den Schutz der als uneinnehmbar angesehenen befestigten Höhen zurückzuziehen. Obgleich beide feindlichen Heere sich gegeneinander in Bewegung setzten, so dachten sie doch nicht, so bald und so heftig aufeinander zu stoßen. Die Österreicher hatten gehofft, dass nur ein Teil der franco-sardischen Armee die Chiese überschritten habe, sie kannten den Plan Napoleons nicht und waren überhaupt ohne jede genauere Nachricht über die feindlichen Bewegungen.
Auch die Alliierten glaubten nicht, so schnell der Armee des Kaisers von Österreich zu begegnen; denn die Rekognoszierungen, die Beobachtungen und Berichte der Plänkler, sowie die während des 23. in die Höhe gelassenen Luftballons ließen in keiner Weise die Spur einer neuen feindlichen Offensivbewegung oder gar eines Angriffsplans entdecken.
So war also, trotzdem dass beide Teile sich auf eine baldige und große Schlacht vorbereitet hatten, der Zusammenstoß der Österreicher und der Franco-Sarden am Freitag den 24. Juni ein gegenseitig überraschender, Dank der Unkenntnis der Heerführer über die gegnerischen Bewegungen.
Wohl jedermann hat über die Schlacht von Solferino einen Bericht gehört oder gelesen. Eine so ergreifende Erinnerung verwischt sich gewiss nicht so leicht, und hier wohl um so minder, als die Folgen dieses Tages in mehreren Staaten Europas jetzt noch fühlbar sind. Als einfacher Tourist, und dem Zweck dieses großen Kampfes vollkommen ferne stehend, hatte ich, durch besondere Umstände begünstigt, das seltene Vorrecht, bei dem ergreifenden Schauspiel, das ich hier zu schildern versuchen werde, zugegen zu sein. Ich will übrigens in den folgenden Zeilen nur meine persönlichen Eindrücke wiedergeben, und man wird darum auch hier weder genauere Einzelheiten, noch strategische Aufschlüsse entdecken, die in anderen Werken ihren Platz finden mögen.
Während des denkwürdigen Tages, des 24. Juni, standen sich mehr als 300.000 Mann gegenüber, die Schlachtlinie hatte eine Ausdehnung von fünf Meilen und man schlug sich während 15 Stunden.
Die österreichische Armee musste, nachdem sie während der ganzen Nacht vom 23. die Strapazen eines anstrengenden Marsches zu überdauern hatte, vom frühen Morgen des 24. an den gewaltigen Schock der alliierten Armee aushalten musste, hatte sie überdies bei der drückendsten Hitze vom Hunger und Durst zu leiden, da mit Ausnahme einer doppelten Ration Branntwein der größte Teil dieser Truppen während des ganzen Tages keine Nahrung zu sich nehmen konnte.
In der französischen Armee, die sich mit Tagesanbruch in Marsch setzte, hatten die Leute nur den Morgenkaffee zu sich genommen, sodass die Erschöpfung der Streiter und besonders der unglücklichen Verwundeten am Ende dieser furchtbaren Schlacht den höchsten Grad erreicht hatte. Gegen drei Uhr morgens setzten sich die von den Marschällen Baraguey d’Hilliers und Mac Mahon befehligten Corps gegen Solferino und Cavriana in Marsch; allein kaum hatten die Spitzen ihrer Kolonnen Castiglione überschritten, so stießen sie auf die österreichischen Vorposten vor sich, welche ihnen das Terrain streitig machten.
Beide Armeen rüsten sich zum Kampf. Auf allen Seiten ertönen die Trompeten zum Angriff, wirbeln die Trommeln. Kaiser Napoleon, welcher die Nacht in Montechiaro zugebracht hatte, begibt sich in aller Eile nach Castiglione. Um sechs Uhr hat der Kampf ernstlich begonnen. Die Österreicher rücken in vollkommener Schlachtordnung auf den gebahnten Straßen vor. Im Zentrum ihrer festgeschlossenen Massen in weißen Waffenröcken sieht man die schwarz gelben Fahnen mit dem kaiserlichen Adler Österreichs flattern.
Unter allen am Kampf teilnehmenden Corps bietet besonders die französische Garde einen imposanten Anblick dar. Es ist ein herrlicher Tag und der blendende Schein der Sonne Italiens spiegelt sich in dem Waffenschmuck der Dragoner, Guiden, Lanziers und Kürassiere wieder.
Mit dem Beginn der Aktion hatte der Kaiser Franz Joseph mit seinem Generalstab sein Hauptquartier verlassen, um sich nach Volta zu begeben; er war von den Erzherzogen des Hauses Lothringen begleitet, unter denen man besonders den Großherzog von Toskana und den Herzog von Modena bemerkte.
Inmitten eines den Alliierten vollkommen fremden und ungeheure Schwierigkeiten darbietenden Terrains fand der erste Zusammenstoß statt. Die französische Armee musste sich vor allem durch die mit Nebengeflechten verbundenen Maulbeerbaumreihen, die als wirkliche Terrain-Hindernisse betrachtet werden können, Bahn brechen, außerdem hemmten große ausgetrocknete Gräben, dann zwar niedere, aber mitunter breite und lang hinziehende Mauern jedes rasche Vorrücken; die Pferde mussten die Mauern erklimmen, durch die Gräben traben.
Die auf den Höhen und Hügeln aufgestellten Österreicher ließen ihre Batterien auf die französische Armee spielen, welche mit einem Hagel von Vollkugeln, Kartätschen und Bomben überschüttet wurden. In die dichten Wolken des von den Geschützen aufsteigenden Pulverdampfes mischt sich die durch rikoschettierende2 Geschosse aufgeworfene Erde und der aufwirbelnde Staub. Die Franzosen, trotzend dem verheerenden Feuer der Batterien, die den Tod in ihre Reihen schleudern, stürzen sich wie ein tobendes Gewitter von der Ebene her im Sturm gegen diese Stellungen, entschlossen sie um jeden Preis zu nehmen.
Während der steigenden Mittagshitze ist auf allen Seiten der Kampf am heftigsten entbrannt. Geschlossene Kolonnen dringen aufeinander ein mit dem Ungestüm zerstörender Ströme, die alles auf ihrem Weg niederreißen; ganze französische Regimenter werfen sich in Pläncklerketten auf die immer zahlreicher in Linie rückenden drohenden österreichischen Massen, welche gleich Mauern von Eisen festen Fußes den Angriff erwarten; ganze Divisionen legen die Tornister ab, um sich besser und rascher mit dem Bajonett auf den Feind werfen zu können; wenn ein Bataillon zurückgeworfen ist, rückt ein anderes an seiner Stelle vor. Um jeden Mamelon3, um jeden Hügel, um jeden Felsvorsprung werden hartnäckige Kämpfe geliefert, ganze Haufen von Toten sind auf den Hügeln, in den Hohlwegen aufgetürmt.
Österreicher und Alliierte töten einander auf den blutigen Leichnamen, sie morden sich mit Kolbenschlägen, zerschmettern sich das Gehirn, schlitzen sich mit Säbeln und Bajonetten die Leiber auf: kein Pardon wird mehr gegeben, es ist ein Gemetzel, ein Kampf wilder, wütender, blutdürstiger Tiere, und selbst die Verwundeten verteidigen sich bis zum Äußersten; wer keine Waffen mehr besitzt fasst seinen Gegner an der Gurgel und zerfleischt ihn mit den Zähnen.
Dort findet ein ähnlicher Kampf statt, allein er wird noch schrecklicher durch das Nahen einer Eskadron Kavallerie, welche im Galopp heransprengt; die Pferde zertreten unter ihren Hufen Tote und Sterbende; einem armen Verwundeten wird die Kinnlade zerrissen, einem andern die Hirnschale zerschmettert, einem Dritten, der noch zu retten gewesen wäre, die Brust eingetreten. In das Wiehern der Pferde mischen sich Flüche, Schmerzens- und Verzweiflungsrufe und Wutgeschrei. Dort ist es die Artillerie, die in gestrecktem Lauf der Kavallerie über die umherliegenden verstümmelten Leichname und Verwundete folgt, und sich wie jene über sie Bahn bricht; auch hier gibt es zertretene Hirnschalen, zerschmetterte Gebeine, der Boden wird mit Blut getränkt, mit menschlichen Überresten bedeckt.
Die französischen Truppen stürmen mit unwiderstehlicher Gewalt die steilen Abhänge gegen die Mamelons, unter dem Gewehrfeuer der österreichischen Infanterie, dem Kartätschenhagel und dem Zerplatzen der Bomben. Kaum ist jetzt ein Mamelon genommen, kaum haben etliche Eliten-Kompanien in höchster Ermattung und im Schweiß gebadet den Gipfel erstiegen, so stürzen sie sich gleich einer Lawine auf die Österreicher, werfen sie zurück, treiben sie von Posten zu Posten und verfolgen sie bis in die Hohlwege und Gräben.
Die Stellungen der Österreicher sind ausgezeichnet, sie haben sich in den Häusern und Kirchen von Medole, Solferino und Cavriana verschanzt. Allein nichts hält, nichts verhindert oder vermindert das Gemetzel, man tötet sich im Großen und im Kleinen, jeder Fleck Bodens wird mit dem Bajonett erkämpft, jedes Gehöft wird Schritt um Schritt verteidigt; die Dörfer werden nur Haus um Haus, Scheune um Scheune erobert, jedes Gebäude muss einzeln belagert werden, und die Tore, die Fenster und die Höfe sind Schauplätze des wildesten Mordens.
Das französische Kartätschenfeuer verursachte eine große Unordnung in den österreichischen Massen; es bedeckte die Hügelabhänge mit Toten und schleuderte Verheerung und Tod selbst bis auf unglaubliche Entfernungen in die Reserven der österreichischen Armee. Allein wenn gleich die Österreicher wichen, so geschah dies doch nur Schritt um Schritt, und um bald wieder zum Angriff zu schreiten; ihre Reihen schlossen sich wieder und immer wieder zusammen, um gleich darauf von Neuem durchbrochen zu werden.
In der Ebene treibt der Wind Staubwolken von der Straße vor sich her und wie ein dichtes Nebelmeer verdunkelt dieses Gewölk die Luft und erblindet fast die Streiter.
Wenn auch da und dort für Augenblicke das Kämpfen nachzulassen scheint, so beginnt es doch bald wieder mit erneuerter Wut. Die frischen Reserven der Österreicher füllen bald die Lücken wieder aus, welche die Wucht der eben so hartnäckigen als tödlichen Angriffe in ihren Reihen gerissen. Fortwährend hört man auf dieser oder jener Seite zum Angriff die Trompeten blasen, die Tamboure schlagen.
Die Garde gibt Beweise des höchsten Mutes. Die Schützen, die Jäger und die Linientruppen wetteifern mit ihr an Ausdauer und Kühnheit. Die Zuaven4 stürzen mit dem Bajonett, aufspringend wie wilde Tiere, mit furchtbarem Geschrei voran. Die französische Kavallerie dringt auf die österreichische ein, Ulanen und Husaren durchbohren und zerfleischen sich; die von der Hitze des Kampfes selbst erregten Pferde werfen sich auf die feindlichen und beißen sich, indessen ihre Reiter aufeinander einhauen oder sich niederstoßen. Die Kampfeswut ist so groß, dass man auf einigen Punkten, wo die Munition ausgegangen und auch die Gewehre schon zerschmettert worden, zu Steinen seine Zuflucht nimmt und Leib an Leib damit aufeinander losschlägt.
Die Kroaten töten alles, was ihnen begegnet; sie geben den alliierten Verwundeten mit dem Kolben den Gnadenstoß, indessen die algerischen Jäger, deren Führer vergebens ihrer Grausamkeit Einhalt zu tun suchen, mit den österreichischen Verwundeten, gleichviel ob Offiziere oder Soldaten, in gleicher Weise verfahren und bei dem Handgemenge ein wildes Geschrei ausstoßen. Die stärksten Positionen werden genommen, wieder verloren, wieder gewonnen, um von Neuem wieder verloren, wieder erobert zu werden. Überall fallen zu Tausenden Streiter dahin, verstümmelt, von Kugeln durchbohrt oder von Geschossen jeder Art tödlich getroffen.
Wenn auch der Zuschauer von den dem Städtchen Castiglione zunächst liegenden Höhen nicht die ganze Schlachtlinie zu übersehen im Stande war, so konnte er doch leicht erkennen, dass die Österreicher das Zentrum der Alliierten zu sprengen suchten, um Solferino zu decken, das durch seine Lage zum Hauptobjekt, zum Zankapfel der Schlacht wurde; man bemerkte wohl, welche Mühe sich der Kaiser der Franzosen gab, um die verschiedenen Corps seiner Armee zusammenzuhalten, damit sie sich gegenseitig unterstützen könnten.
Sobald Kaiser Napoleon bemerkte, dass es bei den österreichischen Truppen an einer zusammengreifenden umfassenden Leitung fehlte, befahl er den Armee-Corps von Baraguey d’Hilliers und Mac Mahon und alsdann ebenfalls der von Marschall Regnaud de St. Jean d’Angely kommandierten Kaisergarde, zu gleicher Zeit die Verschanzungen von Solferino und S. Cassiano anzugreifen und das feindliche Zentrum zu sprengen, das die Armee-Corps Stadion, Clam-Gallas und Zobel bildeten, die nur nach und nach zur Verteidigung dieser so wichtigen Stellung in die Linie rückten.
Bei San Martino hält der tapfere und unerschrockene Feldmarschall Benedek mit nur einem Teil der zweiten österreichischen Armee gegen die ganze sardische Armee Stand, welche mit Heroismus unter den Befehlen ihres Königs kämpft, von dessen Gegenwart entflammt. Der rechte Flügel der alliierten Armee, von den Corps des Generals Niel und des Marschalls Canrobert gebildet, leistet mit unbeugsamer Energie der vom Grafen Wimpffen befehligten ersten österreichischen Armee Widerstand, deren drei Corps unter Schwarzenberg, Schaafgottsche und Veigl freilich nicht im Stande sind, in ihre Bewegungen eine passende Übereinstimmung zu bringen.





























