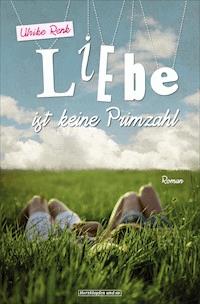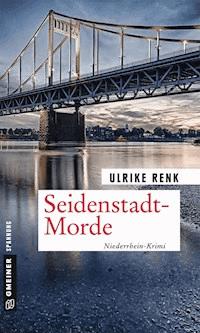14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die ersten beiden Bände der Familiensaga rund um Künstlerinnen erstmals in einem E-Book Bundle!
Eine Familie in Berlin - Paulas Liebe
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie nennen ihn "Merlin", weil er alle verzaubert – der Mann, den ihr Bruder ihr als seinen Freund vorstellt. Paula Oppenheimer, die in einem offen jüdischen Haushalt groß geworden ist, verliebt sich in den jungen Dichter Richard Dehmel. Er verkehrt mit vielen Literaten und will als Künstler leben. Paula wird zu seiner Muse und zur strengen Kritikerin seiner Texte. Als sich ihre Eltern gegen ihre Verbindung stellen, kämpft Paula für ihre Liebe. Doch dann muss sie sich fragen, ob Richards wilde, unkonventionelle Art sie auf Dauer glücklich machen kann …
Das Porträt einer Künstlerin in unruhigen Zeiten: Am Anfang war sie die Ehefrau des Dichters Richard Dehmel – dann wurde sie selbst zur Schriftstellerin.
Ursula und die Farben der Hoffnung
Potsdam 1911: Ursulas größte Leidenschaft ist die Kunst. Seit sie denken kann, zeichnet sie, alles hat für sie Formen, Farben und eine Geschichte. Als sie die Kunststudentin Vera Dehmel kennenlernt, taucht sie an ihrer Seite in eine ganz neue Welt ein. Nicht nur lernt sie Veras Kommilitonen und Künstlerfreunde kennen, sondern auch ihren Bruder Heinrich. Schnell ist klar, zwischen ihnen besteht eine ganz besondere Verbindung – allen Hindernissen zum Trotz. Die Geschwister Dehmel geben Ursula den Mut, sich an der renommierten Kunstakademie in Berlin zu bewerben und ihren Traum zu verfolgen, Bücher zu gestalten und zu illustrieren. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und plötzlich hat Ursulas Leben alle Farbe verloren. Was ihr bleibt, ist die Hoffnung …
Warmherzig und authentisch: Die reale Geschichte einer jungen Künstlerin, die für ihre Eigenständigkeit kämpft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1309
Ähnliche
Über das Buch
Eine Familie in Berlin - Paulas Liebe
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie nennen ihn "Merlin", weil er alle verzaubert – der Mann, den ihr Bruder ihr als seinen Freund vorstellt. Paula Oppenheimer, die in einem offen jüdischen Haushalt groß geworden ist, verliebt sich in den jungen Dichter Richard Dehmel. Er verkehrt mit vielen Literaten und will als Künstler leben. Paula wird zu seiner Muse und zur strengen Kritikerin seiner Texte. Als sich ihre Eltern gegen ihre Verbindung stellen, kämpft Paula für ihre Liebe. Doch dann muss sie sich fragen, ob Richards wilde, unkonventionelle Art sie auf Dauer glücklich machen kann …
Das Porträt einer Künstlerin in unruhigen Zeiten: Am Anfang war sie die Ehefrau des Dichters Richard Dehmel – dann wurde sie selbst zur Schriftstellerin.
Ursula und die Farben der Hoffnung
Potsdam 1911: Ursulas größte Leidenschaft ist die Kunst. Seit sie denken kann, zeichnet sie, alles hat für sie Formen, Farben und eine Geschichte. Als sie die Kunststudentin Vera Dehmel kennenlernt, taucht sie an ihrer Seite in eine ganz neue Welt ein. Nicht nur lernt sie Veras Kommilitonen und Künstlerfreunde kennen, sondern auch ihren Bruder Heinrich. Schnell ist klar, zwischen ihnen besteht eine ganz besondere Verbindung – allen Hindernissen zum Trotz. Die Geschwister Dehmel geben Ursula den Mut, sich an der renommierten Kunstakademie in Berlin zu bewerben und ihren Traum zu verfolgen, Bücher zu gestalten und zu illustrieren. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und plötzlich hat Ursulas Leben alle Farbe verloren. Was ihr bleibt, ist die Hoffnung …
Warmherzig und authentisch: Die reale Geschichte einer jungen Künstlerin, die für ihre Eigenständigkeit kämpft
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga, die Ostpreußen-Saga, die Seidenstadt-Saga, die große Berlin-Saga um die Dichterfamilie Dehmel und zahlreiche historische Romane vor.
Mehr zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Eine Familie in Berlin - Paulas Liebe & Ursula und die Farben der Hoffnung
Die ersten beiden Bände der Familiensaga rund um Künstlerinnen erstmals in einem E-Book Bundle!
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Eine Familie in Berlin - Paulas Liebe
Kapitel 1 — Berlin, 1878
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4 — Berlin, Frühjahr 1879
Kapitel 5 — Berlin, Spätherbst 1879
Kapitel 6 — Berlin, Frühjahr 1881
Kapitel 7 — Ostsee, Frühjahr 1881
Kapitel 8
Kapitel 9 — Berlin, Herbst 1882
Kapitel 10 — Ahrenshoop, Sommer 1885
Kapitel 11 — Berlin, Januar 1886
Kapitel 12 — Berlin, Frühjahr 1887
Kapitel 13
Kapitel 14 — Bad Reichenhall, Herbst 1887
Kapitel 15 — Berlin, Mai 1889
Kapitel 16
Kapitel 17 — Frühsommer 1890
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20 — Pankow 1893
Kapitel 21 — Berlin 1896
Nachwort
Danksagung
Ursula und die Farben der Hoffnung
Kapitel 1 — Potsdam 1911
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6 — Graal-Müritz, Sommer 1912
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12 — Potsdam, Dezember 1912
Kapitel 13 — Berlin, Mai 1913
Kapitel 14 — Berlin, Ende November 1913
Kapitel 15 — Berlin, März 1914
Kapitel 16 — Berlin, April 1914
Kapitel 17 — Sommer 1914
Kapitel 18 — Ahrenshoop, Sommer 1914
Kapitel 19 — Vohwinkel, Weihnachten 1914
Kapitel 20 — Berlin, Sommer 1917
Kapitel 21 — Berlin, Silvester 1917
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von dieser großen Saga begeistert ist, liest auch ...
Orientierungsmarken
Copyright-Seite
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Ulrike Renk
Eine Familie in Berlin - Paulas Liebe
Roman
Für
Regina Polensky
Paulaurenkelin
Kapitel 1
Berlin, 1878
»Bald wird es Herbst«, sagte Paula, schloss die Augen und lehnte sich an den Walnussbaum, der auf der Wiese hinter dem Haus stand.
»Ich glaub, du tickst nicht richtig«, entgegnete ihr Bruder Franz, der ausgestreckt vor ihr im Gras lag und in den Himmel schaute. »Es ist erst Anfang September, eigentlich fast noch August. Also Sommer, nicht Herbst.« Er brach einen langen Grashalm ab, steckte ihn in den Mund und kaute darauf herum.
»Warum isst du Gras, Franz? Bist doch kein Hase«, sagte Elise spöttisch, die im Schneidersitz neben Paula saß.
»Heute Abend, wenn es dunkel wird, wirst du merken, dass der Herbst kommt«, murmelte Paula, öffnete träge die Augen und blickte zu Carl, dem jüngsten der Oppenheimer-Geschwister. Dann sah sie Franz an. Mit seinen dreizehn Jahren war er knapp zwei Jahre jünger als sie. Elise war gerade elf geworden und der kleine Carl erst drei. Sie alle liebten den kleinen Nachzügler und passten gerne auf ihn auf, wenn das Kindermädchen Line sie darum bat.
Heute aber hätte Paula gerne bei der großen Wäsche geholfen, die den ganzen Haushalt beschäftigte, doch Mutter hatte sie zu den Geschwistern geschickt. Paula hatte sich gefügt und war zu den anderen hinter das Haus gegangen, die im Schatten des Walnussbaumes im Gras spielten.
»Unfug. Die Abende sind lau«, gab Franz jetzt zurück. »Lau und angenehm. Da ist noch keine Spur von Herbst.«
»Doch, wenn man aufmerksam ist, kann man die ersten Anzeichen schon erahnen. Es sind immer nur feine Veränderungen, sachte und leise – der Rauchgeruch eines Feuers auf den Feldern, der mit einem Mal in der Luft liegt. Die nächtliche Kühle der Luft, die vor wenigen Tagen noch hitzeschwer war. Und warte ab, schon bald wird der Nebel über die Gärten und Straßen wabern, wie ein feuchter, kühler Schleier. Dann werden sich die ersten Blätter verfärben – wenige zuerst und nur am Rand.«
»Hach«, seufzte Elise. »Du bist immer so poetisch. Du solltest Schriftstellerin werden.«
»Ja, genau«, brummte Franz. »Dann kannst du deine Phantasien aufs Papier verbannen. Herbst – pff, es ist noch Sommer, und es wird auch noch Sommer bleiben. Ganz bestimmt noch ein paar Wochen.«
»Man kann sie nicht anhalten«, sagte Paula.
»Was kann man nicht anhalten?«, fragte Franz.
»Es läuft und hat keine Beine, es gibt viele und doch nur eine. Wer zu viel hat, kann’s nicht verschenken, wer zu wenig hat, muss es beschränken. Bald geht es langsam, bald schnell, mal ist es dunkel, mal hell«, antwortete Paula grinsend. »Was ist das?«
Franz runzelte die Stirn, dann spuckte er den Grashalm aus. »Es ist die Zeit. Die kann man nicht anhalten – sie läuft, auch wenn sie keine Beine hat.«
»Gut, kleiner Bruder. Sehr gut.«
»Noch eins«, bat Elise. »Ich liebe deine Rätsel, Paula.«
»Viel Glieder hab ich, die einander gleichen. Ich helf’ auf des Verbrechens dunklem Pfade, doch himmelshell führ ich empor zur Gnade, manch hohen Stand kannst du mit mir erreichen. Bist du’s, so darfst du wanken nicht noch weichen, denn Ehre trägst du neben mancher Last, die arbeitsfroh du übernommen hast, ob du im Kleinen wirkst, ob hoch im Grade«, trug Paula lachend vor.
Elise runzelte die Stirn und legte ihren Zeigefinger an die Nase. »Das ist schwer.«
»Viele Glieder«, murmelte Franz. »Viele Glieder … ein Wurm?«
»Aber ein Wurm trägt keine Last«, wendete Elise ein.
»Ne, stimmt.« Wieder grübelte Franz, dann ging ein Strahlen über sein Gesicht, und er zeigte zum Apfelbaum. »Dort steht die Lösung – eine Leiter.«
Paula nickte. »Das war dann wohl zu einfach.«
Franz hob den Kopf und lauschte. »Man hört noch kein Klappern aus der Küche«, seufzte er. »Dabei muss doch schon bald Zeit fürs Abendbrot sein.«
»Du könntest immer essen, nicht wahr?«, neckte Paula ihn. »Heute musst du dich wohl noch gedulden. Vater hat Besuch von einem der Rabbiner aus der anderen Gemeinde. Sie führen bestimmt mal wieder hitzige Diskussionen.«
»Allzu lange kann es aber nicht mehr dauern«, meinte Elise. »Heute ist Freitag, und der Sabbat beginnt gleich.«
»Wie gut, dass das für uns nicht mehr gilt«, sagte Franz. »Ich muss morgen zur Schule.«
»Du Armer«, sagte Elise mitleidig, dann sprang sie auf, um Carl, der brabbelnd Richtung Gemüsegarten stampfte, hinterherzugehen.
»Eigentlich ist es gar nicht schlimm«, sagte Franz zu Paula gewandt. »Mein neuer Lehrer ist knorke. Einfach famos. Ich habe noch nie so einen Lehrer gehabt.«
»Was macht ihn denn so besonders?«, fragte Paula. »Du schwärmst dauernd von ihm, sagst aber nie, warum.«
Franz rollte zur Seite und stützte sich auf seinen Ellenbogen. »Hm«, machte er nachdenklich. »Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.«
»Versuch es einfach.« Paula lächelte.
Wie so oft verspürte sie in solchen Momenten die innige Verbindung zu ihrem Bruder. Das lag nicht nur am geringen Altersunterschied oder daran, dass sie sich seit einiger Zeit wieder ein Zimmer teilten. Es war mehr – ein Seelenband. Sie dachten ähnlich, hatten den gleichen Humor, und die Zuneigung zwischen ihnen war tief.
»Weißt du«, Franz zeigte auf das Haus. Sie wohnten am nördlichen Rand von Berlin, in der Auguststraße, auf der Rückseite der Häuser befanden sich große Gärten, und dahinter erstreckte sich Brachland bis zu den Weiden und Feldern der nah gelegenen Bauernhöfe. »Wir haben hier so viel Platz, ein eigenes Haus.«
Paula verzog das Gesicht. »Im Grunde schon. Wenn die finanzielle Situation nicht immer wieder so prekär wäre.«
»Das stimmt«, sagte ihr Bruder und nickte. »Aber eigentlich macht das nichts, denn wir haben viel Weite – viel innere Weite. Denk allein an Vaters Arbeitszimmer, es ist so viel Wissen in diesem Haus, wir müssen es uns nur aneignen.« Er sah seine Schwester an, ein ernster, aber auch fragender Blick. »Verstehst du, wie ich das meine?«
»Ja, ich verstehe dich. Wir sind schon sehr gut dran, weil wir so viele Bücher haben und unsere Eltern um unsere Bildung bemüht sind.«
»Nicht nur das, Paula.« Franz klang plötzlich ganz aufgeregt. »Wir haben so viel mehr Möglichkeiten. Nicht nur die Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, zu uns kommen Menschen aus aller Welt und allen Schichten zu Gast. Und jeder bringt etwas mit – etwas Neues.«
»Nicht jeder«, sagte Elise und schnaufte. Sie hatte den strampelnden und krakeelenden Carl im Arm und setzte ihn neben sein Holzpferd auf den Boden. »Die Eierfrau zum Beispiel …«
»Die Eierfrau bringt Eier«, sagte Paula lachend. »Und dann redet sie noch mit der Köchin. Ich bin mir sicher, für die Köchin ist die Eierfrau wie eine Art Zeitung.«
Die Geschwister sahen sich an und prusteten los. Carl, der gerade noch beleidigt geweint hatte, starrte die drei verblüfft an, stimmte dann aber in ihr Lachen ein. Glockenhell und glücklich, aller Kummer war vergessen.
Paula liebte dieses Kleinkinderlachen, sie blickte ihn beglückt an und breitete die Arme aus. Carl sprang auf und lief zu ihr, ließ sich in ihre Arme fallen und juchzte.
»Du hast schon recht«, sagte Paula dann zu Franz. »Wir sind privilegiert. Aber was hat das mit deinem Lehrer zu tun?«
»Bisher habe ich alles gelesen. Querbeet. Was mir halt so unter die Finger kam. Bis mir Herr Voigt gezeigt hat, wie ich gezielt lernen kann, nämlich das, was mir auch etwas bringt.«
»Aber es ist doch schön, sich in vielen unterschiedlichen Bereichen auszukennen. Ich verehre Menschen wie zum Beispiel Alexander von Humboldt«, entgegnete Paula nachdenklich. »Menschen, die ein großes, fast allumfassendes Wissen haben – jedenfalls zu ihrer Zeit. Was ist dagegen einzuwenden?«
»Ist das heute überhaupt noch möglich, Schwesterlein?«, fragte Franz. »Das Allgemeinwissen wächst. Ständig werden neue Entdeckungen gemacht. Die Wissenschaft entwickelt sich fast genauso schnell wie die Maschinerie und die Gesellschaft. Wie soll man da allumfassend lernen? Voigt meint, man sollte offen sein und auch offen bleiben, sich aber dennoch auf die Bereiche konzentrieren, die einem wichtig sind. Und in diesen Bereichen seine Kenntnisse mehr und mehr vertiefen.«
Paula runzelte die Stirn, dann nickte sie. »Da ist was dran, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Weißt du schon, worauf du dich konzentrieren willst?«
Franz schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, leise und ein wenig gequält. »Nein, das weiß ich noch nicht.«
»Du musst es ja auch noch nicht wissen«, beruhigte Paula ihn. »Du bist auch erst dreizehn. Und selbst wenn du glaubst, du hättest deinen Bereich gefunden, kann sich das immer noch ändern. Ich fänd das auch nicht schlimm, Interessen verlagern sich. Das siehst du doch an Vater und Mutter.«
»Ihr seid so langweilig«, unterbrach Elise sie maulend. »Können wir nicht noch was spielen, bevor es Essen gibt? Ihr könnt ja noch die halbe Nacht diskutieren – das tut ihr doch sowieso immer.«
Paula und Franz sahen sich beschämt an.
»Woher weißt du das?«, fragte Franz.
»Ich dachte, du schläfst«, fügte Paula hinzu.
»Ihr glaubt zwar, dass ich schlafe – aber auch wenn ihr flüstert, höre ich es, ich bin ja nicht taub«, sagte Elise. »Wenn ihr über wichtige Dinge redet, könnt ihr das ruhig ein wenig lauter machen, damit ich was verstehe. Ansonsten schlaf ich über eurem Gemurmel immer wieder ein.«
Paula und Franz sahen sich verblüfft an.
»Ich höre nun auch etwas«, sagte Paula, stand auf und nahm Carl auf den Arm. »Jemand spielt Klavier. Chopin, das kann nur Tante Guste sein«, sagte sie aufgeregt. »Oh, wäre das schön!«
Wieder verdrehte Elise die Augen. »Tante Guste, meine Güte. Auch das noch.«
Franz knuffte sie in den Arm. »Nun sei mal nicht eifersüchtig, Lischen. Ick gloob nich, dat dir dat steht, Mädel.«
»Wenn Vater hört, dass du so blöd berlinerst, holt er den Rohrstock.« Elise streckte ihm die Zunge raus.
»Wenn du es ihm sachst, mach ich dich lang …«
»Musste mich erst mal kriegen!« Sie lachte und rannte los, und Franz lief ihr johlend hinterher.
»Will auch laufen«, sagte Carl und verzog das Gesicht.
»Na dann.« Paula setzte ihn auf den Boden und folgte ihren Geschwistern Richtung Haus.
Die Klavierklänge vermischten sich mit dem Rauschen des Windes in den Blättern und dem Zwitschern der Vögel. Noch waren sie alle da, aber schon bald würden die ersten in den Süden ziehen, dahin, wo es warm war, dachte Paula wehmütig. Eigentlich mochte sie den Herbst – wenn er nur nicht immer so feuchtkalt wäre. Sie liebte es, wenn sich die Blätter erst gelb, dann rot färbten, sich an den Seiten einkringelten und zusammenzogen und schließlich trocken vom Baum fielen. Sie liebte die klaren, kälteren Abende, an denen der Himmel so viel weiter zu sein schien, so unendlich groß. Am meisten aber liebte sie die Farben, sie waren klarer als in der flirrenden Sommerhitze, alle Ränder schienen schärfer zu sein. Vom Haus, vom Dach, von den Blättern, selbst die Grashalme, die noch einmal mit aller Kraft wuchsen, waren deutlicher voneinander zu unterscheiden. An diesen Tagen war sie am liebsten draußen und schaute genau hin, beobachtete, nahm wahr.
Wenn es jedoch nass wurde und Feuchtigkeit in der Luft lag, verzog sich Paula vor den Kamin. Dann fiel ihr das Atmen schwer. Genau wie durch den Staub- und Qualmschleier, der wegen der vielen neuen Fabrikgebäude und der Dampfmaschinen in den Hinterhöfen immer häufiger über der Stadt lag. Industrialisierung nannte man das. Immer mehr Menschen suchten Arbeit in Berlin, schnell und noch schneller wurden neue Wohnhäuser errichtet, sogar hier, am Stadtrand, wurde gebaut.
Paula war sich nicht sicher, ob sie diese Veränderungen mochte. Sie schüttelte den Kopf, jetzt war nicht der Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Tante Guste war zu Besuch. Weil sie und ihr Mann Werner selbst keine Kinder hatten, hatte Tante Guste die Oppenheimer-Kinder besonders ins Herz geschlossen und verwöhnte sie. Immer, wenn die Tante kam, gab es Schokolade – das war sicher.
Carl kletterte die Treppe zur Veranda hoch.
»Wie siehst du denn aus?«, fragte Line und musterte ihn gespielt streng. »So kannst du aber nicht vor Leute treten, kleiner Mann.«
»Warum nich?«, fragte Carl und blickte an sich herunter.
Seine Hose war grün vom Gras, das Hemd voller Staub und seine Hand braun von der Erde, in der er gewühlt hatte.
Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte Line zu Paula.
»Wir haben ihn nicht durch den Garten gezogen. Er ist uns entwischt und …«, sagte Paula und versuchte ernst zu bleiben.
»Sssstimmt!« Carl nickte ernsthaft. »Bin alleene auf den Apfelbaum jeklettert.«
»Alleine geklettert bist du«, sagte Line. »Sprich vernünftig, kleiner Mann.«
»Jawoll, dat werde ick.«
Line grinste Paula an. »Noch ist es nicht hoffnungslos. Wir werden ihn schon hinbekommen. Ich zieh ihn schnell um und wasche ihm das Gesicht, dann fällt es gar nicht auf.« Sie hob Carl auf den Arm. »Ausgebüxt bist du also und auf den Baum geklettert? Lass das bloß nicht deine Mutter hören, die zieht dir die Ohren lang. Weißt doch, dass du das nicht darfst.«
Paula blieb an der Verandatür stehen und lauschte. Immer noch war das Stück von Chopin zu hören. Ihre Tante spielte wunderbar, sie vermochte dem Instrument Töne zu entlocken, die manchmal fast unirdisch klangen. Paula liebte es, Klavier zu spielen, und übte fast jeden Tag. Stundenlang. Aber die Leichtigkeit, mit der Guste die Finger über die Tasten gleiten ließ, hatte Paula noch nicht erreicht. Vielleicht würde sie es auch niemals können. Aber das war egal. Musik war ein wichtiger Teil ihres Lebens, Musik tröstete sie in dunklen Momenten und verstärkte die schönen. Nun endete das Stück. Was würde Tante Guste als Nächstes spielen? Doch es blieb still.
»Hast du noch einmal darüber nachgedacht, Toni?«, hörte Paula ihre Tante fragen.
»Über Paula?«, antwortete die Mutter, ihre Stimme klang gedrückt. »Ja, das tue ich ständig. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen.«
Wozu durchringen?, fragte sich Paula verwirrt. Sie wusste, dass sie nicht lauschen sollte, aber es ging doch offensichtlich um sie. Nur worum genau?
»Es wäre nur zum Vorteil für das Kind. Das weißt du. Und ich liebe sie, als wäre sie mein eigen Fleisch und Blut.«
»Aber sie ist mein Fleisch und Blut«, entgegnete die Mutter so leise, dass Paula die Worte kaum verstehen konnte. »Meine Tochter, mein ältestes Kind. Du weißt, wie sehr ich sie liebe.«
»Das steht doch außer Frage, Toni. Das weiß ich und jeder, der dich kennt. Aber gerade deshalb solltest du dich dazu entscheiden. Paula wird im Winter sechzehn. Sie ist bald eine junge Frau.«
»Das dauert noch, so Gott will. Sie hat noch so viele kindliche Züge – sie ist noch immer ganz vernarrt in ihre Märchenbücher.«
»Das ist dein Mann auch.« Guste schnaufte. »Und ihre Züge sind alles andere als kindlich.« Wieder schnaufte sie. »Ich weiß, das Leben ist nicht immer gerecht, und ihr habt es nicht leicht. Aber ihr nehmt es hin, ohne zu murren …«
»Guste, es ist alles in Ordnung, wir haben es gut. Julius geht in seinem Beruf auf. Er könnte nie etwas anderes sein als Rabbiner. Und vor allem in keiner anderen Gemeinde als in dieser. Es ist so wertvoll, was sie tun, so außerordentlich wichtig für das Judentum. Er und die anderen sind wie Martin Luther für die Evangelen. Sie werden das jüdische Leben verändern – zum Besseren.«
Nun seufzte Tante Guste. »Das weiß ich doch, Schwester. Und ich bin stolz, dass er diesen Weg geht. Auch …«, nun senkte sie die Stimme, »auch wenn es euch nicht viel Geld einbringt.«
»Die Gemeinde kann einfach nicht mehr zahlen«, entgegnete ihre Mutter fast trotzig. »Und das Wort Gottes zu verbreiten, lässt sich nicht mit Geld aufwiegen.«
»Allein mit Gottes Worten lassen sich aber keine Rechnungen begleichen«, stellte Guste trocken fest.
Paula hörte, wie die Klavierbank zurückgeschoben wurde und jemand durch den Raum ging.
»Liebe Schwester, liebste Toni, ich will doch nur helfen. Ich weiß, ihr tut euer Bestes, aber wenn Paula zu uns ziehen würde, hättet ihr es doch auch ein wenig einfacher. Und auch für sie … ich meine, sie wird sechzehn und muss sich das Zimmer mit ihren Geschwistern teilen. Mit Franz … Ob das so gut ist?«
Paula hielt die Luft an. Sie sollte zu Tante Guste ziehen? Ihr wurde schwindlig. Sie liebte ihre Tante sehr, aber hier war doch ihr Zuhause. Hier war ihre Familie. Paula atmete tief ein, versuchte ihr wild pochendes Herz zu beruhigen.
»Franz und Paula lieben sich«, sagte ihre Mutter jetzt. »Außerdem sind sie Geschwister, und das Zimmer ist groß. Warst du mal in Berlin? Hast du gesehen, wie viele Familien dort inzwischen in einem oder zwei Zimmern hausen? In den Hinterhöfen?« Ihre Stimme klang empört.
»Ja, das weiß ich, und das ist ganz sicherlich nicht mit eurer Situation zu vergleichen.«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, sagte Toni entschieden. »Und jetzt muss ich in die Küche und nach dem Essen sehen. Du bleibst doch?« Die Frage klang ein wenig spitz.
Guste lachte. »Ja, ich bleibe, Toni. Ich bleibe sehr gerne zum Essen. Ich habe die Kinder ja auch noch gar nicht gesehen.«
»Gut.«
Paula seufzte erleichtert auf. Offensichtlich war das Thema damit beendet. Wie kam die Tante nur auf so eine Idee?
Essen, dachte Paula plötzlich. Gleich gibt es Essen. Und ich habe mich noch nicht frisch gemacht und umgezogen. Außerdem sollte ich Line und Mutter beim Tischdecken helfen. Sie eilte ins Haus, nahm die Hintertreppe, um nicht gesehen zu werden.
Das Zimmer war leer, Franz war bereits nach unten gegangen, seine Sachen hatte er achtlos auf das Bett geschmissen. Mechanisch legte Paula sie zusammen.
Wer würde das tun, wenn ich nicht mehr hier wäre? Wie kommt Tante Guste nur auf die Idee, dass es Mutter entlasten würde? Ich helfe doch schließlich. Mit entschlossenem Griff zog sie sich die Schürze aus und spürte, wie sie zornig wurde.
Sie schlüpfte aus dem Kleid, wusch sich an der Waschschüssel, zog ihr besseres Kleid an und fuhr flüchtig mit der Bürste durch ihre dunklen Locken. Kurz hielt sie inne und musterte sich im Spiegel. Sie war nicht hübsch, hatte aber angenehme Gesichtszüge – das hörte sie jedenfalls immer. Ein wenig trotzig warf sie die Haare nach hinten und ging nach unten.
Im Esszimmer wurde schon mit den Tellern geklappert. Aus dem Wohnzimmer konnte sie Franz’ Stimme hören, er diskutierte mit dem Vater, Tante Gustes Lachen mischte sich unter die Worte. Elise war nirgendwo zu sehen – wahrscheinlich war sie in der Küche und naschte. Mutter und Line deckten den Tisch. Paula schaute, was noch benötigt wurde, und holte die Servietten, die gebügelt auf einem Stapel auf der Anrichte lagen.
»Wir sind heute …«, Mutter hielt kurz inne und überlegte, »zu acht. Wir vier, meine Schwester, zwei der Pensionsgäste – Herr Meyer und Herr Goldschmidt. Herr Kronzweig ist nicht da, deswegen kann Elise mit uns essen, und Carl isst mit Line im Kinderzimmer.«
»Gut«, sagte Line und legte ein weiteres Gedeck auf. »Wissen Sie schon, wie lange die beiden Herren noch bleiben?«
Mutter schüttelte den Kopf. »Gezahlt haben sie bis Ende der Woche. Ich werde es heute Abend ansprechen.«
Line beugte sich vor und wisperte: »Sehen Sie zu, dass Sie den Meyer loswerden. Die Zugehfrau weigert sich schon, sein Zimmer zu reinigen. Er ist ein wahrer Dreckspatz.«
»Ja, das hörte ich. Aber er zahlt pünktlich.«
»Dann sollte er für die Reinigung noch was drauflegen«, brummte Line und rümpfte die Nase. »Grete ist wirklich nicht empfindlich, wenn selbst sie sich beschwert …«
»Ich weiß«, sagte Mutter seufzend.
»Muss er denn hier wohnen?«, fragte Paula. »Ich weiß, wir brauchen das Geld für die Zimmer, aber er …« Sie senkte den Kopf, spürte, dass sie rot wurde.
Mutter hob den Kopf und sah sie scharf an. »Warum?«, fragte sie.
»Er … er ist einfach seltsam«, murmelte Paula verlegen. »Er schaut mich immer so an. Und ich mag nicht neben ihm sitzen …«
»Warum nicht?«
»Weil er …« Es war ihr unsagbar peinlich, darüber zu sprechen, aber jetzt konnte sie nicht mehr zurück. »Weil er immer sein Knie an meins drückt. Und manchmal«, sagte sie und holte tief Luft, »manchmal legt er auch seine Hand drauf.«
Mutter runzelte die Stirn. »Ist das wahr?«, sagte sie kaum hörbar.
»Ja, Mutter, es tut mir leid. Es liegt sicher an mir …«
»Sssh!«, unterbrach Toni ihre Tochter. »Wir sprechen später darüber.«
»Es tut mir leid …«
»Nein! Es muss dir nicht leidtun. Und nun heb den Kopf und hilf Line.«
Mutter klang streng. Hoffentlich hatte sie keinen Fehler gemacht. Eigentlich hatte Paula ihr das nicht erzählen wollen. Sie sollten sich doch nicht schlecht über die Pensionsgäste äußern, aber Herr Meyer war nun schon ein halbes Jahr bei ihnen, und er wurde immer aufdringlicher. Seine Blicke, die Art, wie er sie ansah, sein Lächeln, das so aalglatt schien wie das mit Pomade eingefettete Haar – alles an ihm war unangenehm.
Mutter wechselte einen schnellen Blick mit Line. »Ich muss mal kurz mit meinem Mann reden.« Dann ging sie ins Nebenzimmer.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragte Paula Line unsicher.
»Nein, du hast das sehr richtig gemacht«, sagte Line und nahm sie in den Arm. »Ich glaube, wir beide müssen demnächst mal ein ernstes Gespräch führen«, flüsterte sie. »Es gibt Dinge, die du wissen solltest.« Sie räusperte sich. »Aber nicht hier und jetzt.«
Kurze Zeit später läutete Vater die Glocke, um alle zu Tisch zu rufen. Doch statt sich wie sonst an das Kopfende der Tafel zu setzen, blieb er im Flur und schloss die Tür hinter sich.
Schweigend saßen sie um den Tisch und warteten. Die Atmosphäre war seltsam angespannt – ein Sommergewitter, das in der Ferne grollte.
Als Esther die Suppe auftrug, sah Franz seine Schwester erstaunt an. Normalerweise wurde die Suppe erst gebracht, wenn Vater am Tisch saß. Ihre Mutter wirkte so wie immer, füllte die Teller und sprach das Tischgebet.
Plötzlich waren aus dem Flur Stimmen zu hören. Vater und Herr Meyer, erkannte Paula. Zu gern hätte sie gehört, was gesprochen wurde, aber Mutter verwickelte Herrn Goldschmidt in ein Gespräch, und auch wenn dieser erst sehr einsilbig antwortete, konnte sie nichts verstehen.
»Und du, Paula?«, drang Tante Gustes Stimme an ihr Ohr. Sie hatte die Frage wohl bereits mehrmals gestellt.
»Entschuldigung. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Was wolltest du wissen?«
Franz grinste. »Wo bist du denn mit deinen Gedanken?«
Wieder spürte Paula, wie sie rot wurde. Schon das zweite Mal an diesem Abend, wie peinlich. Sie war doch schon fast erwachsen und sollte gelassener reagieren. Nun straffte sie die Schultern und würdigte ihren Bruder keines Blickes.
»Ich wollte wissen, was du im Moment auf dem Klavier übst.«
»Ich habe dich vorhin spielen hören«, antwortete Paula. »Und ich denke, ich sollte mich auch an Chopin versuchen.«
»Das bekommst du mit etwas Fleiß hin. Ich liebe die Musik, seine Noten. Es klingt alles so … besonders, meinst du nicht?«
»Ich weiß nicht, ob ich ihm schon gewachsen bin«, gab Paula zu.
»Paulalein, Chopin war ein Meister der Improvisation. Man sagt, wenn er spielte, klang ein Stück nie so wie zuvor – das macht es doch leicht. Viel leichter als Bach und Beethoven.« Guste lachte leise.
»Hmmhmm«, machte Paula, ihr fiel es schwer, dem Gespräch zu folgen. Sie löffelte ihre Suppe, doch sie schmeckte nichts. Endlich kam Vater in das Esszimmer, jedoch ohne Herrn Meyer. Er schaute nur kurz in die Runde, setzte sich und sprach ein stilles Gebet. Mutter sah ihn fragend an.
»Herr Meyer verlässt uns«, erklärte Vater, seine Stimme klang merkwürdig gepresst. »Heute noch.«
Mutter nickte, auf ihrem Gesicht lag ein zufriedener Ausdruck, und Paula spürte, dass Franz die ganze Zeit zu ihr schaute, aber sie wich seinem Blick aus und senkte den Kopf.
Die Köchin brachte den Hauptgang, Mutter und Tante Guste versuchten immer wieder erfolglos, ein Gespräch zu beginnen. Etwas lag in der Luft – das Gewitter kam näher. Es hatte mit ihren Worten über den Mieter zu tun. Mutter war streng, sie hatte den Kindern wieder und wieder eingeprägt, dass die Familie auf die Pensionsgäste und das Geld, das die Zimmer einbrachten, angewiesen war. Und deshalb hatten die Kinder immer höflich, nett und zuvorkommend zu den Gästen zu sein. Immer. Egal, was sie taten – aber diesmal war es nicht egal gewesen, dachte Paula.
Nett – das war ich doch, sagte sie sich. Ich war immer freundlich zu Herrn Meyer. Ich habe ihn nie spüren lassen, wie unangenehm mir sein Verhalten war. Und ich habe es heute das erste Mal erwähnt, aber vielleicht war das mein Fehler. Vielleicht hätte ich einfach nicht darüber sprechen sollen.
Nach dem Hauptgang blickte Vater aus dem Fenster, dann auf seine Uhr. »Die Sonne geht unter. Lasst uns die Sabbatkerzen anzünden.«
Mutter holte die Streichhölzer, die in dem Kästchen auf der alten Anrichte lagen, ein Erbstück von Vaters Familie, dann sprach sie die Gebete. Sie warteten, bis die Streichhölzer in der Schale verglüht waren, setzten sich dann wieder. Nun begann der Sabbat – eigentlich. Doch die Neue jüdische Gemeinde feierte ihn nicht so wie die meisten Juden.
Zum Nachtisch gab es Apfelkompott. Langsam taute die Stimmung wieder auf.
»Was sagt denn Rabbi Rosenfeld, lieber Julius?«, fragte Tante Guste. »Er ging gerade, als ich kam.«
»Wir haben – wie immer – über die Gesetze diskutiert«, sagte ihr Vater und seufzte. Er schaute zur Anrichte, auf der der Leuchter stand. »Sabbat ist ihnen heilig und wird es immer bleiben. Sie sagen, Gott habe den Sabbat mit all seinen Regeln geschaffen, und es ist nicht an uns, sie zu brechen oder zu verändern.«
»Aber wir verändern sie doch gar nicht wirklich. Wir passen uns doch nur an«, sagte Herr Goldschmidt. Auch er war Mitglied der neuen Gemeinde, wie fast alle ihre Pensionsgäste. »Sie müssen doch endlich begreifen, dass es Zeit ist, uns zu integrieren, um einen sicheren Platz in dieser Gesellschaft zu haben. Wir können uns nicht immer auf die Thora berufen, die vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde, als das Leben noch ganz anders war. Damals gab es das israelische Volk, später den Staat Israel, wir hatten ein Land, waren ein Volk und konnten nach unseren Gesetzen leben.« Er klang hitzig, und es war nicht das erste Mal, dass er dies vorbrachte. »Aber unser Alltag heute sieht ganz anders aus. Heute sind wir eine Religionsgemeinschaft, leben in Hunderten von Ländern verstreut, die alle ihre eigenen Gesetze haben. Wir müssen uns anpassen, um ein Teil des Staates zu sein, in dem wir leben. Und in christlichen Ländern ist nun mal der Sonntag der Ruhetag. Wir haben doch einen Gott – Jesus war schließlich Jude. Warum auch immer die Christen aus dem Sabbat, dem Tag, den Gott als Ruhetag geschaffen hat – dem siebten Tag –, den Sonntag gemacht haben und wir den Samstag – es ist egal. Gott möchte, dass wir an einem Tag die Arbeit ruhen lassen. Und das tun wir – dort, wo wir sind an dem Tag, an dem es alle anderen auch machen. So sollte es jedenfalls sein.« Er schnaufte und wischte sich mit der Serviette über das Gesicht. »Warum Rabbi Rosenfeld das nicht einsieht, ist und bleibt mir schleierhaft.«
Julius lächelte. »Beruhigen Sie sich, guter Mann«, sagte er leise. »Sie wissen, dass ich genauso denke. Und ich glaube, vielen anderen Juden geht es ebenso. Viele wenden sich sogar von unserem Glauben ab, um ein Teil der Gesellschaft zu sein. Aber es ist natürlich besser, die Gebote und Gesetze ein wenig zu dehnen und dem heutigen Leben anzupassen, als den Glauben ganz aufzugeben, denke ich und unsere Gemeinde ja auch. Deshalb ändern wir diese Dinge nach und nach. Aber diese Neuerung braucht Zeit, viel Zeit. Die Leute müssen sich an solche Gedanken erst gewöhnen.«
»So wie damals bei Luther«, sagte Franz.
Vater nickte. »Ja, er hat den christlichen Glauben auch reformiert – jedenfalls für einen Teil der Christen.«
»Einige unserer Änderungen sind ja mit seinen identisch – habt ihr es von ihm?«, fragte Franz nun. »Wie zum Beispiel die Gebete und die Thora zu übersetzen. Ich finde es schön, die Gebete auf Hebräisch zu hören, aber natürlich verstehe ich sie besser, wenn sie auf Deutsch gesprochen werden.«
»Ja, da war er uns ein Vorbild. Ich glaube, dass die Gemeinde die Worte verstehen möchte. Was wir verstehen, können wir auch eher begreifen und in unser Herz übernehmen. Deshalb predige ich auf Deutsch. Rabbi Rosenfeld sieht das immer noch anders. Für ihn und die anderen Vertreter der alten jüdischen Ordnung sind wir Ketzer. Er begreift nicht, dass wir zwar die Kerzen anzünden, doch dann die Regeln nicht weiter einhalten und erst am Sonntag ruhen … eben weil es für viele Gemeindemitglieder schwierig ist, ihre Geschäfte am Samstag nicht zu führen, nicht am Leben teilzunehmen. Man kann das einschränken, kann sich zurücknehmen, aber sich ganz herauszunehmen ist schwer in der heutigen Zeit.«
»Ja, und genau deshalb müssen wir das auch in andere Gemeinden tragen. Wir müssen diese Ideen verbreiten, den jüdischen Glauben so verändern, dass wir ihn leben, aber dennoch ein Teil der Gesellschaft sein können«, sagte Goldschmidt. »Nächste Woche fahre ich ins Rheinland und besuche dort einige unserer Gemeinden, stelle unser Konzept vor.«
»Nächste Woche schon?«, fragte Mutter. »Dann brauchen Sie Ihr Zimmer nicht mehr?«
»Das ist richtig. Ich komme wahrscheinlich in ein paar Wochen zurück und würde mich dann gerne wieder bei Ihnen einmieten, wenn es recht ist?« Unsicher sah er sie an. »Ich weiß nicht genau, was mit Meyer vorgefallen ist, aber ich weiß, dass er manchmal ein schwieriger Zeitgenosse ist und …«
»Lieber Herr Goldschmidt, natürlich sind Sie uns hier jederzeit willkommen«, unterbrach ihn Toni. »Machen Sie sich darum keine Gedanken. Herr Meyer wollte schon länger abreisen, und nun hat er seinen Entschluss einfach ein wenig vorgezogen. Aus rein persönlichen Gründen.« Sie lächelte, ein strahlendes Lächeln. Es erreichte nicht ihre Augen.
Kapitel 2
»Was hast du ihm gesagt?«, fragte Mutter.
»Was hat er dazu gesagt?«, wollte Tante Guste wissen.
»Was ist hier eigentlich los? Irgendetwas ist doch passiert«, sagte Franz.
Sie hatten die Tafel aufgehoben und saßen nun alle im Wohnzimmer. Nur Elise war ins Bett gegangen.
»Weißt du, was hier los ist?« Franz nahm Paula am Arm, zog sie zu sich.
»Nein, ich …«, murmelte Paula und versuchte sich seinem Griff zu entwinden. »Ich verstehe auch nicht so recht, was passiert ist.«
»Toni, genau aus dem Grund möchte ich, dass Paula …«, fing Tante Guste an, doch Mutter fuhr ihr ins Wort.
»Nicht jetzt, Guste, nicht jetzt!«
»Wieso, was ist denn?«, wendete sich Vater an seine Schwägerin.
Mutter drehte sich zu ihm um. »Nicht vor den Kindern.«
»Aber …«
»Nein!« Mutter sah Paula und Franz an. »Paula, geh in die Küche und hilf beim Abwasch. Franz, du kannst noch die Hühner in den Stall bringen und dann auf euer Zimmer gehen.« Ihr Tonfall ließ keinen Widerspruch zu.
»Jetzt schon? Es ist doch noch so früh«, maulte Franz.
»Aber es ist fast dunkel. Also höchste Zeit für die Hühner, damit der Fuchs sie nicht holt.«
»Du hast doch sicherlich noch etwas für die Schule zu tun«, fügte Vater hinzu. Franz seufzte tief auf und zog von dannen, er wusste, es wäre zwecklos, weiter zu protestieren.
Paula wartete, bis er den Raum verlassen hatte, dann drehte sie sich zu den Eltern um und holte mit klopfendem Herzen tief Luft.
»Ich weiß, dass es mit dem zu tun hat, was ich über Herrn Meyer gesagt habe.« Sie schluckte. »Die Mieter sind wichtig für uns, das ist mir sehr bewusst. Sollte mein Verhalten zu Unstimmigkeiten geführt haben, dann tut es mir leid. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht.« Paula stocke, sie senkte den Kopf, ihre Augen brannten. Sie hörte, wie ihre Mutter sich räusperte. »Mein liebes Kind. Mach dir bitte keine Gedanken. Du hast am wenigsten Schuld.« Sie nahm Paula in die Arme, drückte sie fest an sich. »Du bist die beste Tochter, die man sich denken kann.«
»Aber …?«, fragte Paula leise. »Was ist denn überhaupt passiert?«
»Zum Glück noch nicht allzu viel«, sagte Tante Guste nun resolut. »Herr Meyer hat seine Grenzen überschritten, und du hast es erkannt. Dabei hätten wir alle es sehen müssen.«
»Meyer hat sich nicht ehrenvoll dir gegenüber verhalten, und das tut mir sehr leid«, sagte nun der Vater. »So etwas dulde ich in meinem Haus nicht. Lieber habe ich keine Untermieter, als dass so etwas passiert.«
»Er hat ja nicht wirklich etwas getan …«
»Doch, Paula, das hat er«, sagte Tante Guste und strich ihr über das Haar. »Er hat dich berührt. Und das sicher nicht in guten Absichten.«
Nun wurde Paula bewusst, dass das Verhalten des Mieters nicht so arglos gewesen war, wie sie es gehofft hatte. Sie war kein Kind mehr, sie stand an der Schwelle zum Erwachsensein, aber bisher hatten die Untermieter sie wie ein Kind behandelt. Meyer nicht, auch wenn sie das lange nicht hatte wahrhaben wollen, denn hier – in ihrem Zuhause – hatte sie sich immer geborgen und sicher gefühlt.
Erschrocken schaute Paula von Mutter zur Tante.
»Er wollte … wollte … mich …«, stammelte Paula erschrocken.
»Das wissen wir nicht. Seine Annäherungen waren auf jeden Fall unlauterer Art, mein Kind. Aber nun solltest du Esther in der Küche zur Hand gehen und danach ins Bett. Der Tag war lang und anstrengend genug. Er ist ja nun weg, und du brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen«, sagte Mutter und räusperte sich. Ihre Stimme hatte zwischendrin unsicher gezittert, auch das war Paula neu. Sie fügte sich aber und fragte nicht noch weiter nach.
Im Souterrain klapperte Esther mit dem Geschirr. Sicherlich spülte sie schon, und eigentlich sollte sie sich sputen, um ihr zu helfen. Aber die Neugierde war stärker, und so blieb sie hinter der Tür stehen und lauschte.
»Ich habe so etwas befürchtet«, sagte ihre Tante in einem düsteren Ton. »Ich habe es dir gesagt, Toni. Paula ist kein Kind mehr – körperlich, auch wenn sie noch so ein reines Gemüt hat. Es ist kein Leben hier für sie.«
»Was?«, fragte Vater und lachte bitter auf. »Wo soll sie denn sonst hin?«
»Zu mir.« Guste machte eine Pause. »Ich nehme sie zu mir. Bei uns kann sie wohnen, und ich werde sie unterstützen. Das entlastet euch finanziell, und Paula gibt es Raum, sich zu entwickeln. Überleg doch, Julius – sie wird im Dezember sechzehn und teilt sich das Zimmer mit ihrem Bruder. Und dann sind da noch die Pensionsgäste, auf die ihr offensichtlich nicht verzichten könnt …«
»Wir brauchen sie nicht«, sagte Toni resolut. »Ich werde noch mal das Haushaltsbuch durchgehen. Sicherlich können wir noch etwas sparen.«
»Ach Toni, Liebes«, sagte Vater, er klang erschöpft und traurig. »Wir brauchen die Untermieter. Jedenfalls in diesem Jahr. Vielleicht wird es im nächsten besser. Vielleicht kann mir dann die Gemeinde mehr Geld zahlen – aber bis dahin? Was willst du denn noch einsparen?«
»Wir könnten den Garten besser bewirtschaften und Gemüse anbauen, wir …«
»Es ist Herbst. Was willst du jetzt noch pflanzen? Selbst wenn, es würde euch erst im nächsten Jahr helfen. Und wer soll die ganze Arbeit übernehmen? Du? Der alte Gärtner? Die Kinder?«, fragte Tante Guste.
»Du würdest also Paula zu dir nehmen wollen?« Vaters Stimme klang plötzlich brüchig.
»Ja, Julius, das würde ich. Werner und ich haben das lange diskutiert. Wir haben so viel Platz. Paula könnte noch ein paar Jahre unbeschwert leben, sich weiterbilden, lernen, Klavier spielen. Wir würden selbstverständlich alle Kosten tragen.«
»Das ist ein sehr großzügiger Vorschlag, Guste.«
»Überlegt es euch einfach. Mehr als anbieten kann ich es nicht.«
»Aber Paula sollte es auch wollen …«, sagte Toni nun. Sie klang mit einem Mal gar nicht mehr so abwehrend.
»Ich rede mit ihr …«
»Nein, das mache ich. Ich muss darüber noch nachdenken. Paula ist meine … kleine Große.« Wehmut lag in Tonis Stimme. »Irgendwann wird sie heiraten und aus dem Haus gehen, das weiß ich, und der Gedanke ist schon schwer genug. Aber schon jetzt? Sie ist noch so jung. Und sie ist doch mein Kind …«
»Sie bleibt ja dein Kind, liebste Toni. Sie wird immer dein Kind bleiben – egal, was kommt. Du bist schließlich auch mit sechzehn ins Lehrerinnenkolleg gezogen. Da warst du nur ein halbes Jahr älter, als Paula jetzt ist.«
»Das waren ganz andere Zeiten damals. Vater war schwer krank, ich war die Älteste und musste zum Einkommen beitragen. Das kann man mit heute nicht vergleichen.«
»Das stimmt«, sagte Julius nun. »Dennoch ist der Vorschlag deiner Schwester etwas, worüber es sich nachzudenken lohnt. Aber nun sollten wir alle einen Schluck trinken, um unsere Nerven ein wenig zu beruhigen.«
Paula hörte, wie sich seine Schritte der Tür näherten, und eilte nach unten.
»Na, ditt is ja n Ding«, sagte Esther lachend. »Ick hab schon jedacht, du kämst jar nich mehr. Kannst de Jläser abtrocknen. Abba schön jründlich, wa?«
»Mach ich, Esther. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin.«
»Hauptsache, du bis jetzt da, wa? Wasisn oben los? Klang nach nem richtijen Tohuwabohu. Der olle Meyer is zum Jlück abjereist. War ne fiese Charakter, der Mann.«
Während Paula die Gläser abtrocknete, blickte sie aus dem Fenster in den Garten. Langsam legte sich Dunst auf den Rasen, und die Nacht senkte sich über die Stadt. Jeden Tag wurde es jetzt ein wenig früher dunkel.
Ob sie im Winter noch hier wohnen würde, schoss es Paula plötzlich durch den Kopf, und sie spürte, wie ihr die Tränen kamen. Nicht mehr hier wohnen? Das konnte sie sich nicht vorstellen. Mutter wollte ihr die Entscheidung überlassen – das bedeutete aber auch, dass Mutter sich schon entschieden hatte. Sie würde Paula zu ihrer Schwester geben.
Ausziehen – der Gedanke traf sie plötzlich wie ein Schlag. Sie liebte Tante Guste, aber … bei ihr wohnen? Wie sollte das werden? Die Wohnung in der Lothringer Straße war sehr großzügig, und Tante Guste war häufig allein, weil Onkel Werner als Weinhändler häufig unterwegs war und manchmal bis nach Frankreich oder Italien reiste. Ihr Salon war so groß, dass darin nicht nur ein Klavier, sondern ein richtiger Flügel stand. Aber würde ein Flügel ihre Familie ersetzen?
Die Gedanken rasten durch Paulas Kopf, und beinahe hätte sie eins der Gläser fallen lassen. Im letzten Moment bekam sie es wieder zu fassen und stellte es behutsam auf den Tisch.
»Na, wat is denn mit dich los?«, fragte die Köchin.
»Ich war wohl nur unachtsam. Tut mir leid.«
»Nu, et war’n langer Tag, mit der jroßen Wäsche un allem. Kannst nach oben gehen, wa?«
»Nein, ich helfe noch …«
»Ach, lasset jut sen. Mach, dat de wegkommst.«
Langsam ging Paula nach oben. Im Zimmer brannte das Petroleumlicht auf niedriger Stufe. Elise schien schon fest zu schlafen, aber Franz war noch wach und las.
»Du wirst dir die Augen verderben«, flüsterte Paula.
»Ich würde die Lampe ja aufdrehen, aber ich fürchte, dann gibt es Ärger mit Line. Wir sollen das Licht löschen, sobald du im Bett bist«, sagte Franz und setzte sich auf. »Was zum Kuckuck ist eigentlich los? Du stehst ja gänzlich neben dir.«
Elise murmelte etwas, und Franz biss sich auf die Lippen, doch sie schien nur zu träumen.
Paula ging leise hinter den Paravent und zog sich um, drehte das Petroleumlicht aus und ging dann zu Franz’ Bett. »Rutsch«, flüsterte sie. Abends lagen sie meist noch zusammen in einem Bett und unterhielten sich leise. Oft rezitierten sie sich aus den Büchern, die sie gerade lasen. Paula liebte besonders Gedichte aus dem Echtermeyer, den sie fast auswendig konnte. Aber heute Abend war für Poesie nicht die richtige Zeit. Paula zog sich die Decke bis zum Kinn und überlegte kurz.
»Ich habe gelauscht«, sagte sie dann. »Als wir aus dem Garten hereinkamen. Tante Guste will, dass ich zu ihr ziehe.«
»Aber warum?«
»Damit … weil … na ja, ich schätze, weil ich dann weniger Geld koste. Tante Guste würde alle Ausgaben für mich übernehmen.«
»Was kostest du denn?«
Paula seufzte auf. »Ach Franz, Essen, Kleidung, alles, das Leben kostet Geld.«
»Aber die Eltern können dich doch nicht einfach wegschicken, du gehörst doch zu uns«, flüsterte er entsetzt.
»Daran würde sich ja nichts ändern, und von der Lothringer Straße bis hier ist es nicht weit …«
»Willst du das etwa? Willst du zu Tante Guste ziehen?«, fragte Franz verblüfft.
»Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht – das kommt alles so überraschend, eine große Welle, die über mich hinwegspült …«, gab Paula zu. »Aber vielleicht sollte ich mir überlegen, was ich nächstes Jahr mache, wenn ich die Schule abgeschlossen habe.«
»Mache?«
»Nun, welchen Beruf ich ergreifen soll – damit ich Geld verdienen kann.«
»Du bist erst fünfzehn.«
»Es gibt viele, die in meinem Alter schon arbeiten. Geh mal in die Stadt.«
»Ich weiß, aber … das ist doch was anderes, du willst sicher keine Blumen verkaufen oder Kohlen schleppen oder so etwas.«
»Nein«, sagte Paula leise. »Aber Mutter hat eine Ausbildung gemacht und ist dann zu einer Familie gegangen als Hauslehrerin. Da war sie nicht viel älter als ich.«
»Weil sie musste, das erzählt sie immer wieder. Weil Großvater so krank war. Vater ist nicht krank.«
»Dennoch will ich der Familie nicht auf der Tasche liegen.«
»Aber willst du überhaupt Lehrerin werden?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich mir mein späteres Leben vorstelle.« Sie hielt kurz inne. »Natürlich will ich irgendwann heiraten und Kinder haben. Aber bis dahin? Ich habe immer gedacht, es wird sich schon etwas ergeben.« Wieder seufzte sie. »Wenn ich nächstes Jahr die Schule beendet habe, kann ich noch mehr im Haushalt helfen. Vielleicht brauchen wir dann Line nicht mehr.«
»Du willst dich um Carl kümmern und um den ganzen Haushalt? Du?«
»Warum nicht?« Paula sah ihren Bruder an. Inzwischen war es so dunkel, dass sie sein Gesicht nur erahnen konnte.
»Wegen deiner Gesundheit, Paula«, sagte Franz kaum hörbar. »Was Line tut, ist anstrengend. Sehr anstrengend. Und sie ist auch viel kräftiger als du …«
»Dann muss ich halt bis zum nächsten Jahr an meiner Konstitution arbeiten.« Paula biss sich auf die Lippe. »Ich könnte Kindermädchen werden. Ich mag Kinder, und ich glaube, ich kann gut mit ihnen umgehen.«
»Ja, das stimmt. Aber überleg mal, in dir steckt doch so viel anderes, so viel mehr. Du bist klug und interessiert, du liest viel, du kannst reimen und Rätsel erfinden – die besten Rätsel der Welt. Und du spielst Klavier, du spielst so gut. Musik liegt dir im Blut, würde ich meinen.« Er stockte. »Was würdest du denn am allerliebsten machen?«
»Ja, ich liebe und liebe die Musik, aber auch die Literatur und … ich weiß es nicht. Ich glaube, darüber muss ich in Ruhe nachdenken«, sagte sie schließlich.
»Und was war jetzt mit Meyer?«
Paula fühlte sich plötzlich wie mit heißem Wasser übergossen. »Ach, der Meyer … lass uns nicht über den reden.«
»Unfug«, sagte Franz beleidigt. »Nun sag es schon.«
»Beim Tischdecken ging es irgendwie um Meyer, und dann habe ich gesagt, wie unangenehm ich ihn finde. Und … dass er immer versucht, unter dem Tisch mein Bein zu berühren …«, flüsterte sie.
»Das hat er gemacht? Die Sau«, sagte Franz laut und empört.
Elise regte sich.
»Pst«, sagte Paula erschrocken. »Leise, sonst wacht sie noch auf …«
Für eine Weile lagen sie stumm nebeneinander, dann spürte Paula, wie Franz ihre Hand nahm und sie drückte.
»Ich will nicht, dass du weggehst«, murmelte er fast tonlos.
»Ich auch nicht …« Paula wartete noch einen Moment, aber Elise blieb ruhig. Dann gab sie Franz einen leichten Kuss auf die Wange und lief hinüber zu ihrem Bett, schlüpfte unter die Decke. Sie schloss die Augen, aber ihre Gedanken spielten immer noch Fangen.
Es war eine unruhige Nacht, immer wieder wurde sie wach, drehte sich um, stopfte ihr Kissen zurecht und lauschte auf die regelmäßigen Atemzüge ihrer Geschwister.
Ich wünschte, ich hätte noch ihre Unschuld, wäre noch so jung wie sie, dachte Paula. Dass es so schwer sein könnte, eine Entscheidung über mein Leben zu treffen, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gehofft, dass sich ein Schritt nach dem anderen ergibt und sich das Leben fügt – so wie bisher. Franz’ Weg schien vorgezeichnet – er würde die Schule beenden, studieren, zum Militär gehen und einen Beruf ergreifen. Er hatte es viel leichter als sie.
Am nächsten Morgen fühlte sie sich wie gerädert.
»Husch, husch, aufstehen, meine Lämmchen«, sagte Line und zog die Vorhänge zur Seite, öffnete die Fenster. »Heute scheint es noch mal sehr warm zu werden. Das perfekte Wetter, wir haben immer noch Wäsche zu waschen.« Sie ging zu Franz’ Bett. »Du musst dich sputen, junger Mann, sonst kommst du noch zu spät zum Unterricht.«
Franz stöhnte und drehte sich zur Seite. »Muss ich wirklich?«, fragte er gequält.
»Nein, du kannst auch aufstehen und Steffens im Garten und Stall helfen. Den ganzen Tag. Und morgen und übermorgen. Alle Tage kannst du ihm helfen. Wässern und misten und den Rasen mit der Sense mähen – für den Rest deines Lebens. Oder du stehst auf und gehst zur Schule und lernst etwas Ordentliches. Du hast die Wahl.«
»Oh, Line, du hast nie Erbarmen«, seufzte Franz und schlug die Decke zur Seite.
»Nein, warum auch? Du bist jung, kräftig und wissensdurstig. Nutz die Chance, die du hast.« Line drehte sich um und ging zu Paulas Bett. »Und du, Prinzessin, was ist mit dir?«
Paula sah sie an. »Ich steh gleich auf. Versprochen. Und ich helfe auch wieder bei der Wäsche.«
Mit gerunzelter Stirn musterte Line sie und legte ihre Hand auf Paulas Stirn. »Geht es dir nicht gut? Fieber hast du nicht, aber du siehst blass aus. War wohl gestern zu viel für dich. Bleib du mal liegen und ruh dich noch ein wenig aus.«
»Aber ich will nicht zu Hause bleiben«, sagte Paula.
»Nun, ich würde mich freuen, wenn ich noch im Bett bleiben dürfte.« Damit drehte sich Line zu Elise um.
»Es ist erstaunlich, wie fest manche Menschen schlafen können«, sagte sie und lachte. »Neben dir könnte ein Baum umfallen, und du würdest trotzdem weiterschlafen.« Sie rüttelte leicht an Elises Schulter. »Guten Morgen, du kleine Fee. Es ist Zeit aufzuwachen.«
Elise räkelte sich und strahlte Line an. »Guten Morgen«, sagte sie. »Ist es wirklich schon hell?«
»Ja, das ist es. Noch. Bald schon wird es um diese Zeit dunkel sein.« Line schnaufte. »Aber solange wir noch Sommer haben, sollten wir ihn nutzen.« Sie strich Elise über die Haare. »Ich glaube«, sagte sie mit einem gespielten Flüstern, das jedoch so laut war, dass alle es hören konnten, »dass die Köchin heute früh Waffeln macht. Würde dich das zum Frühstück locken?«
»Waffeln?« Elise warf ihre Decke zur Seite und sprang auf. »O ja. Dafür decke ich auch gerne den Tisch.«
»Dann zieh dich mal an. Aber das Waschen nicht vergessen.« Line stellte einen Waschkrug mit warmem Wasser auf die Kommode.
»Warm waschen im Sommer ist was für Schwächlinge«, rief Franz, sprang auf, griff sich Hemd und Handtuch und lief in den Hof, wo die Pumpe stand. Das Wasser aus der Pumpe war eiskalt, aber das störte ihn nicht.
Elise schaute zu Paula. »Willst du zuerst?«, fragte sie ein wenig ungeduldig.
»Nein, ich lasse dir den Vortritt«, sagte Paula und lächelte. Jetzt im Spätsommer war das noch einfach. Im Winter war es anders – dann kühlte das warme Wasser schnell aus, denn die Zimmer waren nicht beheizt, die Fenster undicht, da und dort bröckelte der Kitt aus den Rahmen, und der Wind pfiff oft kalt von Osten um das Haus.
Tante Guste wohnte in einer dicht bebauten Straße, in der die Häuser große Innenhöfe und Gärten hatten und viel moderner waren. Wäre es das wert, fragte sich Paula. Fang ich jetzt wirklich an abzuwägen? Ist das nicht falsch? Ich sollte und sollte und sollte doch bei meiner Familie bleiben wollen. Familie ist schließlich viel wichtiger als Komfort. Und ich liebe sie alle. Andererseits könnte ich zu Tante Guste ziehen und dennoch täglich herkommen und helfen … dann würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – die Eltern wären entlastet, und trotzdem hätten sie meine Hilfe. Aber … wäre das richtig? Was will ich in meinem Leben erreichen? Was will ich werden? Und wie finde ich das heraus?
Wie benommen lehnte sie sich in ihre Kissen zurück, hörte, wie ihre kleine Schwester sich eilig fertig machte und dann summend den Flur hinunterhüpfte.
Der Duft von Waffeln und Eiern zog durch den Flur, Esther bereitete das Frühstück zu.
Ich sollte auch aufstehen, dachte Paula und konnte sich dennoch nicht dazu aufraffen. Jeder Knochen in ihrem Körper fühlte sich auf einmal unendlich schwer an, zu schwer, um ihn zu bewegen.
Dann hörte sie Schritte auf der Treppe, und ihre Mutter öffnete die Tür.
»Line sagt, dir geht es nicht gut?«, fragte sie besorgt und setzte sich auf Paulas Bett.
»Du bist blass, hustest du?«
Paula schüttelte den Kopf. »Alles in Ordnung«, log sie. »Ich habe nur schlecht geschlafen.«
»Warum?«
»Weil … ich mir Gedanken gemacht habe.«
»Worüber?«
Paula drehte sich weg, um sich dem forschenden Blick der Mutter zu entziehen. »Ach Mutter, sei doch nicht so«, sagte sie leise. »Das ist ja wie ein Verhör.«
»Ich bin besorgt um dich, das ist alles«, antwortete ihre Mutter empört.
»Ich habe einfach nur schlecht geschlafen. Schläfst du nie schlecht?«, fragte sie und drehte sich wieder um.
»Doch. Natürlich. Manchmal. Aber selten«, sagte Toni und räusperte sich.
»Nun, siehst du – dies war eben eine dieser seltenen Nächte, in denen ich schlecht geschlafen habe«, entgegnete Paula und hoffte, dass es leicht klang, leichter, als sie sich fühlte.
Aber ihre Mutter schüttelte dann den Kopf. »Du siehst nicht nur übermüdet aus, mein Liebes.« Toni seufzte. »Es kann ja nicht allein die Geschichte mit Meyer sein, die dir so zu schaffen macht. Du hast gestern wahrscheinlich unabsichtlich mehr mitbekommen, als für deine Ohren bestimmt war, oder?«
»Ich habe … ich wollte nicht … ich meine«, stotterte Paula, dann riss sie sich zusammen. »Willst du wirklich, dass ich zu Tante Guste ziehe?« Sie setzte sich im Bett auf und sah ihre Mutter fest an.
Toni schloss kurz die Augen. »Nein, das will ich nicht. Natürlich nicht. Es war Gustes Idee.«
»Aber?«
Toni schüttelte den Kopf. »Kein Aber. Sie hat es vorgeschlagen, ich finde es nicht akzeptabel.« Sie griff nach Paulas Hand, ihr Blick war voller Ernst, aber auch voller Gefühl. »Ich liebe dich sehr. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dich nicht mehr bei mir zu haben. Irgendwann wirst du von selbst gehen wollen – in dein Leben. Auch das möchte ich mir jetzt noch nicht vorstellen.«
»Aber du warst doch selbst kaum älter, als du angefangen hast, zu arbeiten und deine Familie zu unterstützen. Und schließlich sind wir auch nicht reich.«
»Wer ist schon reich?«, fragte ihre Mutter lachend und nahm sie in die Arme. »Machst du dir wirklich Sorgen um unsere Finanzen? Das musst du nicht. Wir haben nicht viel, aber alles, was wir brauchen.«
»Aber wir müssen Zimmer vermieten«, flüsterte Paula. »An Männer wie Meyer.«
»Wir vermieten nie mehr an Männer wie Meyer«, sagte Toni mit fester Stimme. »Falls irgendwer wieder so etwas macht, musst du es mir sagen. Sofort und nicht Tage oder Wochen später. Sofort. Keiner darf das. Niemand. Nur, dass sich manche Männer nicht daran halten«, sagte sie und biss sich auf die Lippen. »Sie glauben, sie hätten das Recht dazu. Aber sie dürfen das nicht. Es ist schwierig – diese Geschichte zwischen Mann und Frau.«
»Was ist daran schwierig?«
»Gott schuf Mann und Frau, und sie sollten sich ergänzen, das war seine Intention. Sie sollten zusammenleben, sich lieben und Kinder bekommen. Das ist Gottes Plan. Aber nicht immer geht das auf. Die Thora, das Alte Testament, beinhaltet viele Schriften aus alten Zeiten, als die Welt noch anders war, das Leben anders war. Und heute denken einige Männer immer noch, dass sie den Frauen überlegen sind und über sie bestimmen dürfen. Sie behaupten, dass es dafür Belege in den Schriften gäbe – aber das stimmt nicht. Gott hat nie gesagt, dass der Mann über die Frau bestimmen darf. Niemals.« Ihre Mutter schnaufte wütend. »Doch solche Männer wie Meyer werden das wohl nie begreifen.« Sie sah Paula an. »Deshalb ist es wichtig, dass du mir sagst, wenn sich jemand nicht benimmt.«
»Aber er hat doch nur …«
»Nein, nicht nur, so fängt es an, mein Kind. Aber das zu begreifen, bist du noch viel zu jung.«
»Aber ich sollte es besser jetzt schon begreifen, Mutter, solange es Männer wie Meyer gibt.«
Toni schaute Paula in die Augen. »Ja, vermutlich hast du recht«, sagte sie schließlich. »Lass mich aber erst darüber nachdenken, wie …«
»Du meinst diese Sache zwischen Mann und Frau … die körperliche Geschichte?«
»Das gehört dazu.«
»Aber was ist daran so schwierig?«
»Wenn man sich liebt, Paulaschatz, so wie Vater und ich uns lieben, dann ist daran nichts schwierig. Wenn man sich liebt und sich einig ist, dann ist alles gut – dann kann man sich vereinigen und … eben lieben.«
»Ich weiß, woher die Kinder kommen«, sagte Paula empört. »Ich weiß das schon lange. Es ist bei Menschen hoffentlich ein wenig schöner und liebevoller als bei den Kaninchen.«
»Bei Menschen ist es nicht so wie bei den Kaninchen, nein …« Toni biss sich auf die Lippen und unterdrückte ein Lachen.
»Was ist denn jetzt so komisch?«
»Ich muss an Fred, unseren Kaninchenbock, denken. Er hat so gar nichts mit Vater gemeinsam.« Nun prustete Mutter los.
»Mutter!«, sagte Paula entsetzt. »Wie kannst du nur?«, flüsterte sie.
Toni lachte noch immer, das Lachen perlte nur so aus ihr heraus. Sie nahm Paula in die Arme, drückte sie an sich. »Ich finde den Gedanken so lustig.« Dann räusperte sie sich.
Paula grinste. »Ich werde Fred nie wieder so sehen können wie früher.«
»Grundgütiger, Paulakind …«, Toni prustete wieder los. »Ich fürchte, er muss demnächst ins Rohr. Ich werde ihn auch nie wieder nur als Kaninchen sehen können.«
»Wir können ihn doch deshalb nicht essen«, sagte Paula entsetzt.
»Er ist eh zu zäh inzwischen«, sagte ihre Mutter und versuchte wieder ernst zu werden.
Nun prustete Paula los. »Vater?«, fragte sie kichernd.
Die beiden lagen sich lachend in den Armen. Es war ein befreiendes Lachen, ein Lachen, das die Beklemmung nahm, die seit gestern über ihnen lag.
»Was ich eigentlich sagen wollte«, meinte Toni, als sie sich wieder ein wenig im Griff hatte, »ist, dass du es nicht erlauben sollst, wenn ein Mann deine Grenzen überschreitet.« Plötzlich war sie wieder ganz ernst. »Keiner darf dich anfassen, ohne dass du das willst. Nicht am Knie, nicht am Po, noch nicht einmal am Ellenbogen. Wenn es dir unangenehm ist, dann sag es.«
Paula runzelte die Stirn. »Was sag ich denn dann?« Sie sah ihre Mutter an. »Wirklich – was sagt man in so einer Situation? ›Lassen Sie das? Gehen Sie weg? Lassen Sie mich in Ruhe?‹«
Toni biss sich auf die Lippen. »Das weiß ich auch nicht so genau«, gab sie leise zu. »Sag ›Nein‹ – wenn immer du meinst, du müsstest Nein sagen. Wenn immer es dir unangenehm ist – geh aus der Situation. Und danach kommst du zu mir.«
»Ist dir das denn auch schon mal passiert? Dass jemand komisch, aufdringlich war?«
»Ja.«
»Und was hast du gemacht?«
Toni schluckte. »Es ertragen. Weil ich hilflos war, überrumpelt. Doch niemand fasst meine Tochter in meinem Haus an.« Sie setzte sich auf, streckte das Kinn. »Niemand. Und so ein Meyer schon gar nicht.«
»Jetzt ist er weg …«
Toni nickte.
»Aber … aber …« Paula schüttelte den Kopf.
»Was?«
»Aber ihr müsst das Zimmer wieder vermieten.«
»Das weiß ich noch nicht.« Toni schluckte. »Du könntest in das Zimmer ziehen.«
»Ich?«
»Du wirst sechzehn. Du bist jetzt eine junge Frau. Du solltest nicht mit deinem Bruder ein Zimmer teilen.«
»Weil Tante Guste das sagt? Mich stört es nicht, warum auch?« Paulas Stimme wurde lauter. »Wir sind Geschwister und lieben uns.«
»Dennoch wäre es besser.«
»Aber das Geld?«
»Darüber musst du dir keine Sorgen machen.«
In den nächsten Tagen kreisten Paulas Gedanken immer wieder um die Frage, aber das Thema wurde nicht mehr angesprochen. Bis ihr Vater am Sonntag nach dem Gottesdienst mit einem Zettel aus der Synagoge zurückkam und ihn seiner Frau überreichte. Er blieb immer noch länger, verstaute die Thora und sprach mit Gemeindemitgliedern, die geduldig auf ihn warteten.
»Goldschmidt zieht ja nun auch aus, aber ich habe zwei Nachfragen für die Zimmer«, sagte er.
»Und Paula?«, fragte Toni.
»Darüber sollten wir nachdenken, ja«, stimmte ihr Vater zu. »Aber das eilt ja nicht. Im Moment sind die Kinder ja noch zufrieden damit, wie es ist.«