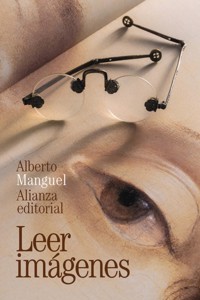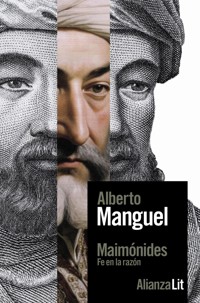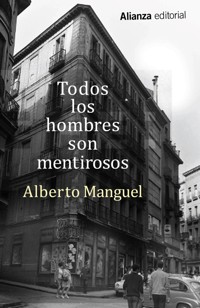9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Abenteuerreise durch die Menschheitsgeschichte der Neugierde - mit Alberto Manguel Der Bestsellerautor Alberto Manguel ist der Leser unserer Zeit, ein Gelehrter und Geschichtenerzähler. Was ihn antreibt ist die Neugierde, die seit jeher Quell des Fortschritts, der Kunst und des Scheiterns ist. Nun geht er dieser selbst auf den Grund und entführt seine Leser auf eine überraschende Reise durch die Geschichte der Neugierde. Seine Wegbegleiter sind die großen Denker, von Dante über David Hume, Rachel Carson und Lewis Carroll bis Sokrates. Auf den Spuren der größten Literaten und Philosophen der Menschheitsgeschichte entwirft er ein Panorama der Kunst des Fragens und erzählt mit viel Witz und Verstand, warum Weisheit nicht in den Antworten, sondern in den Fragen liegt. Manguel stellt sie den Büchern seines Herzens, die großen und die kleinen Fragen, und wo er keine Antwort findet, so doch immer eine bessere Frage. Alberto Manguels bisher persönlichstes Buch ist eine vielseitige Geschichte der menschlichen Neugierde, ein großes Fest der Ideen und der eigenen Vorstellungskraft und die Lebenserinnerung eines international gefeierten Romanciers, Kritikers und Übersetzers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alberto Manguel
Eine Geschichte der Neugierde
Aus dem Englischen von Achim Stanislawski
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Amelia, die, wie das kleine Elefantenkind,
voll unersättlicher Neugierde ist.
Mit all meiner Liebe.
Vergil erklärt Dante, Beatrice habe ihn gesandt, um Dante auf den rechten Weg zu führen. Holzschnittillustration zum zweiten Gesang des Inferno aus einer 1487 erschienenen Ausgabe der Commedia mit Kommentaren von Cristoforo Landino.
(Beinecke Rare Books and Manuscript Library, Yale University)
Vorwort
Als sie im Sterben lag, hob Gertrude Stein den Kopf und fragte: »Was ist die Antwort?« Als niemand etwas erwiderte, lächelte sie und sagte: »In dem Fall: was ist die Frage?«
Donald Sutherland,Gertrude Stein: A Biography of Her Work
Ich bin neugierig auf die Neugierde.
Eines der ersten Wörter, die jedes Kind lernt, ist »Warum«. Schon bald nachdem wir unsere allerersten gebrabbelten und gegurrten Laute von uns gegeben haben, fangen wir an – teils weil wir etwas über diese mysteriöse Welt erfahren wollen, in die wir ohne unseren Willen hineingeboren wurden, teils weil wir lernen möchten, wie die Dinge in ihr funktionieren, und teils weil wir ein ureigenes Bedürfnis verspüren, mit den anderen Bewohnern dieser Welt in Beziehung zu treten – nach dem »Warum« zu fragen.[1] Und wir hören nie wieder damit auf.
Wir lernen schnell, dass unsere Neugierde nur selten mit sinnvollen und zufriedenstellenden Antworten belohnt wird. Dafür weckt sie in uns ein immer größeres Verlangen, noch mehr Fragen zu stellen, und verschafft uns die einzigartige Freude, sich mit anderen austauschen zu können. Wie jeder erfahrene Fragesteller weiß, gleicht eine vorschnelle Antwort eher einer Zurückweisung des Gesprächspartners, während Nachfragen verbindet. Durch unsere Neugierde erklären wir unsere Verbundenheit mit der Menschheit.
Vielleicht lässt sich die ganze Vielfalt der Neugierde mit der berühmten Frage Michel de Montaignes aus dem zweiten Buch seiner Essais zusammenfassen: »Que sais-je?« – »Was weiß ich?« Dort schreibt Montaigne, es sei den Skeptikern deshalb nicht gelungen, ihren philosophischen Grundgedanken auf verständliche Weise Ausdruck zu verleihen, weil sie dazu nicht weniger als »eine neue Sprache« hätten erfinden müssen. »Die unsere«, schreibt Montaigne, »ist aus lauter affirmativen Sätzen gebildet, die mit ihrer Lehre völlig unvereinbar sind.« Er fährt fort: »Diese Anschauung läßt sich eindeutiger fassen in der Frage: ›Was weiß ich?‹ Daher habe ich sie als meinen Wahlspruch auf eine Medaille prägen lassen.« Zweifellos geht diese Frage auf das sokratische Motto »Erkenne dich selbst« zurück. Doch Montaignes Frage zielt weniger auf diese existentialistische Selbstvergewisserung, den Zwang, erkennen zu müssen, wer wir sind; vielmehr drückt die Frage einen Zustand des ständigen Befragens der Territorien unseres Geistes aus. Und dies betrifft sowohl die Territorien, die wir im Denken durchqueren (oder schon durchquert haben), als auch die unbekannten Gebiete, die noch vor uns liegen. Im Bereich des Montaigne’schen Denkens wenden sich die affirmativen Annahmen in der Sprache gegen sich selbst und werden zu Fragen.[2]
Meine Verbundenheit mit Montaigne reicht zurück bis in meine frühen Jugendjahre. Mit der Zeit sind seine Essais so etwas wie eine Autobiographie für mich geworden, weil ich mein ganzes Lebens lang immer wieder meine eigenen Gedanken und Erfahrungen bei ihm wiedergefunden habe, übersetzt in strahlend schöne Prosa. Mit seinen kritischen Betrachtungen über scheinbar selbstverständliche Gemeinplätze des Denkens (über die Pflicht der Freundschaft, die Grenzen der Erziehung, die Schönheit des Landlebens) und über außergewöhnliche Themen (Kannibalismus, die mögliche Existenz monströser Wesen, den Gebrauch der Daumen usw.) hat Montaigne meiner eigenen Neugierde, so wie sie sich an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten geäußert hat, immer wieder neue Richtungen gewiesen. »Die Bücher«, gesteht er einmal, »haben mir weniger zur Belehrung denn zur Übung gedient.«[3] Genauso ist es auch bei mir.
Zum Beispiel scheint es mir eingedenk Montaignes eigener Lesegewohnheiten durchaus vertretbar, einige Bemerkungen zu seinem »Que sais-je?« zu machen, indem ich mir, seiner eigenen Methode folgend, Ideen aus seinen Büchern leihe (er verglich sich selbst mit einer Biene, die Nektar einsammelt, um daraus ihren eigenen Honig zu machen) und diese konsequent auf meine eigene Zeit anwende.[4]
Wie Montaigne sicherlich selbst zugegeben hätte, war eine Untersuchung darüber, was wir wissen können, schon im 16. Jahrhundert keine ganz neue Unternehmung mehr. Die Frage nach dem Akt des Fragens selbst hat viel tiefere Wurzeln. »Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden«, fragte Hiob in seinem Schmerz, »und wo ist der Ort der Einsicht?« Bezug nehmend auf diese Frage schreibt Montaigne: »Nichts gibt es, worauf das Denken nicht anwendbar wäre und worin es nicht ein Wörtchen mitreden wollte. Deshalb benutze ich für die Versuche, die ich hier mache, jedweden Anlaß. Handelt es sich um einen Gegenstand, von dem ich keine Ahnung habe, erprobe ich mein Denken erst recht daran, indem ich ihn zunächst von weitem ins Auge fasse; entdecke ich hierbei eine Furt, sondiere ich sie, und finde ich sie für meine Statur zu tief, bleibe ich am Ufer.«[5] Diese bescheidene Herangehensweise empfinde ich als wunderbare Bestärkung meiner eigenen.
Gemäß der Theorie des Darwinismus ist die menschliche Einbildungskraft zunächst eine vorteilhafte Anpassung im Kampf ums Überleben. Um mehr über die Welt in Erfahrung zu bringen und dadurch besser darauf vorbereitet zu sein, mit ihren Unwägbarkeiten und Gefahren fertig zu werden, entwickelte der Homo sapiens die Fähigkeit, die äußere Realität im Geiste zu rekonstruieren, um so bestimmte Situationen virtuell schon einmal durchzuspielen, bevor sie tatsächlich eintrafen.[6] Weil wir uns unserer selbst und der uns umgebenden Welt bewusst sind, können wir mentale Kartographien unserer Umgebung erstellen und sie im Geiste unzählige Male auskundschaften, um den sichersten und effizientesten Weg durch dieses oft schwierige Gelände zu finden. Montaigne hätte dieser Ansicht sicherlich zugestimmt: Wir müssen uns die Welt vorstellen können, um zu existieren. Und wir sind neugierig, um unsere immer hungrige Vorstellungskraft nähren zu können.
Die Einbildungskraft ist eine wesentlich kreative Fähigkeit, die sich durch ständige Übung und nicht durch eine wie auch immer geartete Form des Gelingens weiterentwickelt. Denn jeder errungene Erfolg, jede richtige Schlussfolgerung mündet in eine Konklusion, einen Abschluss, der letztlich nichts als eine Sackgasse ist. Eine Entwicklung jedoch besteht aus lauter Fehlschlägen, aus Versuchen, die sich als fehlerhaft erweisen, und damit neue Anläufe nötig machen, die, wenn der Himmel uns wohlgesinnt ist, zu weiteren Fehlschlägen führen. Die Geschichte der Kunst und Literatur, Philosophie und Wissenschaft ist eine Geschichte der genialen Fehlschläge. Beckett bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: »Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.«[7]
Doch um immer »besser zu scheitern«, müssen wir dazu in der Lage sein, bestimmte Fehler und Ungereimtheiten bereits frühzeitig im Geiste zu erkennen. Wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, dass dieser oder jener Pfad nicht in die angestrebte Richtung führt, oder dass diese und jene Kombination von Wörtern, Farben und Zahlen nicht dem intuitiven Bild in unserem Kopf entspricht. Allzu gerne erinnern wir uns an die großen Momente, in denen die jeweiligen Archimedese in ihren Badewannen ihr »Heureka!« gebrüllt haben. Weniger gerne hingegen denken wir an die vielen Begebenheiten zurück, in denen wir wie der Maler Frenhofer in Balzacs Geschichte von dem unbekannten Meisterwerk ausrufen: »Nichts! Nichts! … Nichts habe ich also erschaffen!«[8] Aber diese wenigen Momente des Triumphes und die ungleich größere Zahl der Niederlagen sind miteinander verbunden: durch die eine, entscheidende Frage: »Warum?«
Unsere heutigen Bildungssysteme tun im Großen und Ganzen so, als wäre das unvermeidliche Scheitern keine notwendige Etappe auf dem Weg zur Erkenntnis. Weil sie nur noch an messbarer Effizienz und finanziellem Profit interessiert sind, ermutigen unsere Bildungsinstitutionen die ihnen anvertrauten Jugendlichen nicht mehr zum Denken um des Denkens willen oder zum zweckfreien Gebrauch der Einbildungskraft. Anstatt eine Plattform für Diskussionen zu bieten, haben sich Schulen und Universitäten in reine Trainingscamps für qualifizierte Facharbeiter verwandelt. Unsere Schulen und Universitäten sind nicht mehr die Brutstätten jener kritischen Geister, die Francis Bacon einst die »Lichthändler«[9] genannt hat. Wir haben uns selbst dazu abgerichtet, nur noch darauf zu achten, wie viel eine Sache kostet und wie schnell sie produziert werden kann, anstatt nach dem »Warum?« zu fragen.
»Warum?« ist eine Frage (in all ihren Ausprägungen), bei der der initiale Akt des Hinterfragens viel bedeutsamer ist als das Streben nach einer Antwort, das sie scheinbar motiviert. Schon die bloße Artikulation dieser Frage eröffnet uns einen Raum unendlicher Möglichkeiten und kann dazu führen, vorgefasste Meinungen zu erschüttern und an ihre Stelle einen produktiven Zweifel zu setzen. Sie mag vielleicht auch einige vorläufige Antworten nach sich ziehen, aber wenn ihr initialer Impuls stark genug ist, wird sich keine dieser Antworten jemals als gänzlich zufriedenstellend erweisen. Schon ein Kind spürt intuitiv, dass die Frage nach dem Warum uns Ziele jenseits unseres eigenen geistigen Horizontes setzt.[10]
Das sichtbare Zeichen unserer Neugierde – das Fragezeichen, das in den meisten westlichen Sprachen als ein in sich selbst verfangener Schnörkel am Ende eines Interrogativsatzes sich gegen den Hochmut des Dogmatismus emporreckt – entstand erst spät. In Europa setzten sich die verbindlichen Interpunktionszeichen erst gegen Ende der Renaissance durch, als der Enkel des berühmten venezianischen Druckers Aldus Manutius 1566 ein Handbuch für Interpunktionsregeln herausgab: das Interpungendi ratio. Dieses Handbuch führte unter den Zeichen, die einen Paragraphen abschließen können, den auch schon im Mittelalter bekannten punctus interrogativus, den Manutius der Jüngere als ein Zeichen definierte, welches eine Frage anzeigt, auf die gewöhnlich eine Antwort erwartet wird. Eine im 9. Jahrhundert angefertigte Kopie eines Cicero-Textes, die sich heute in der Bibliothèque Nationale de France in Paris befindet, kann als das wohl älteste Dokument angesehen werden, in dem ein Fragezeichen auf diese Weise verwendet wird. Es sieht wie eine Treppe aus, die in einer gewundenen Diagonale von einem Punkt links unten nach rechts oben verläuft. Hier bildet das Fragezeichen selbst einen Tritt für den Geist, der hinaufführt.[11]
Beispiel eines punctus interrogativus in einer aus dem 9. Jahrhundert stammenden Abschrift von Ciceros Cato maior de senectute.
(Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS lat. 6332, fol. 81)
Die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch taucht die Frage »Warum?« auf mannigfaltige Weise und in unterschiedlichsten Kontexten auf. Es mag zu viele dieser Fragen geben, um jede einzelne mit der ihr angemessenen Aufmerksamkeit zu untersuchen, auch sind die von ihnen berührten Themen zu unterschiedlich, um sie alle in einen kohärenten Zusammenhang zu bringen. Aber dennoch hat es einige Versuche gegeben, zumindest die drängendsten nach unterschiedlichen Kriterien zu ordnen.
So wurde zum Beispiel 2010 anhand einer unter Philosophen und Wissenschaftlern durchgeführten Umfrage des Guardian eine Liste der »zehn wichtigsten Fragen, auf die die Wissenschaft eine Antwort finden muss« erstellt – wobei »müssen« vielleicht etwas zu scharf formuliert ist. Diese Fragen lauteten: »Was ist das Bewusstsein?«, »Was geschah vor dem Urknall?«, »Können Wissenschaft und Technik uns unsere Individualität zurückgeben?«, »Wie sollen wir mit der Bevölkerungsexplosion umgehen?«, »Gibt es ein Muster in der Verteilung der Primzahlen?«, »Gibt es eine allumfassende wissenschaftliche Theorie?«, »Wie können wir das Überleben und das Wohlergehen der Menschheit sichern?«, »Kann man // lässt sich das Konzept eines unendlichen Weltraums adäquat veranschaulichen?«, »Werden wir in Zukunft dazu in der Lage sein, die Aktivität unseres Gehirns aufzuzeichnen wie eine Fernsehsendung?«, »Wird die Menschheit die Sterne bereisen?« Diese Fragen folgen keiner Hierarchie, sie gehen nicht zwingend auseinander hervor, und es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass sie wirklich eines Tages beantwortet werden können. Vielmehr entstehen sie ungeordnet und spontan aus unserem Bedürfnis nach umfassender Erkenntnis. Sie sind das Ergebnis einer kreativen Auslese aus unserem gesammelten Wissen. Und trotzdem lässt sich eine bestimmte Struktur in diesem Mäandern ausmachen. Wenn wir diese notgedrungen eklektische Ansammlung von Fragen, die sich an unserer Neugierde entzündet haben, genauer betrachten, können wir darin vielleicht so etwas wie eine parallele Kartographie unserer Vorstellungskraft entdecken. Das, was wir zu wissen begehren, und das, was wir uns vorstellen können, sind zwei Seiten derselben, magischen Medaille.
Die meisten Leser entdecken irgendwann in ihrem Leben dieses eine Buch, das sie wie kein anderes dazu befähigt, die Welt und sich selbst zu erforschen. Es scheint unerschöpflich, und zugleich konzentriert es auf eine ganz vertraute und unnachahmliche Weise den Blick auf noch so unscheinbare Aspekte des Lebens. Manche Leser machen diese Erfahrung bei einem der anerkannten Klassiker, zum Beispiel in einem Werk von Shakespeare oder Proust. Für andere wiederum ist es ein weniger bekannter Text oder einer, bei dem die Meinungen weit auseinandergehen, der in ihnen aus unerklärlichen und geheimnisvollen Gründen eine tiefe Resonanz hervorruft. Ich habe diese wunderbare Erfahrung im Laufe meines Lebens bei unterschiedlichen Büchern gemacht. Viele Jahre lang waren es die Essais von Montaigne, dann Alice im Wunderland, Borges’ Fiktionen, der Don Quijote, Tausendundeine Nacht und Der Zauberberg. Jetzt, in einem etwas fortgeschrittenen Alter, ist für mich die Commedia von Dante das Buch, das einfach alles zu beinhalten scheint.
Ich habe die Commedia erst spät für mich entdeckt, kurz vor meinem sechzigsten Geburtstag. Aber schon nach der ersten Lektüre wurde sie für mich zu diesem ungeheuer persönlichen und gleichzeitig alles umfassenden Buch aller Bücher. Wenn ich die Commedia hier als ein tatsächlich allumfassendes Buch bezeichne, meine ich damit, dass ich dem Werk gegenüber eine Art abergläubische Ehrfurcht hege: vor seiner unendlichen Weisheit, seiner geistigen Beweglichkeit und diffizilen Konstruktion. Doch selbst diese hochtrabenden Worte können nicht annähernd ausdrücken, welche wunderbaren Erfahrungen ich durch das Lesen und Immer-wieder-Lesen dieses Textes gemacht habe. Dante sprach von seiner Dichtung als einem Werk, »an welchem Erd und Himmel Anteil haben«.[12] Und das ist keine Übertreibung, beschreibt es doch genau die Erfahrung, die seine Leser seit dem Erscheinen von Dantes Werk und bis heute mit ihm gemacht haben und immer noch machen. Doch die Bezeichnung »Konstruktion« ist nicht ganz stimmig, impliziert sie doch einen, wie auf Flaschenzügen und Zahnrädern beruhenden, künstlichen Mechanismus, der, selbst wenn er offen zutage tritt (wie zum Beispiel bei der von Dante erfundenen Strophenform der terza rima und den daran anschließenden, wiederkehrenden Verweisen auf die Zahl drei in der ganzen Commedia), lediglich auf ein Detail in der gewaltigen Komplexität des Werkes hinweisen kann, aber weit davon entfernt ist, uns die ganze atemberaubende Perfektion des Werkes vor Augen zu führen.
Giovanni Boccaccio verglich die Commedia mit dem »engelhaft« in vielen Farben irisierenden Federkleid eines Pfaus. Jorge Luis Borges verglich sie mit einem unendlich kleinteiligen, allumfassenden Bild und Giuseppe Mazzotta mit einer universellen Enzyklopädie. Ossip Mandelstam schrieb über sie: »Würden die Säle der Eremitage plötzlich verrückt, würden sich die Bilder aller Schulen und Meister plötzlich von den Nägeln lösen und ineinander übergehen, sich mischen und die Zimmerluft mit futuristischem Gebrüll und tobender Erregung der Farben füllen, bekämen wir etwas, was der Danteschen ›Komödie‹ vergleichbar wäre.« Und trotzdem kann keiner dieser Vergleiche die Vollkommenheit, Tiefe, Reichweite, Musikalität und kaleidoskopische Bilderwelt, die unendliche Fülle an Ideen und die perfekt ausbalancierte Struktur dieses Werkes ganz einfangen. Die russische Dichterin Olga Sedakova hat treffend bemerkt, dass Dantes Langgedicht eine Form der »Kunst sei, die Kunst gebiert«, des »Denkens, das Denken gebiert« und – vielleicht noch wichtiger – der »Erfahrung, die Erfahrung gebiert«.[13]
Jorge Luis Borges und sein Freund Adolfo Bioy Casares erdachten für eine großangelegte Parodie aller künstlerischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts (vom Nouveau Roman bis zur Conceptual Art) eine Form der Kunstkritik, die, angesichts der Unmöglichkeit, ein Kunstwerk in all seiner Großartigkeit vollständig zu analysieren, das Werk einfach komplett reproduzierte. Gemäß dieser Logik müsste ein akribisch genauer Kommentator der Commedia diese Zeile für Zeile zitieren.[14] Und möglicherweise ist das auch der einzig richtige Weg. Denn selten fühlen wir, wenn wir auf eine besonders schöne Passage oder auf ein besonders poetisches Zitat stoßen, das uns beim vormaligen Lesen nicht aufgefallen war, den Impuls, es unverzüglich zu kommentieren. Lieber werden wir es einem Freund laut vorlesen, um etwas von der Epiphanie dieser Entdeckung mit ihm zu teilen. Denn die Worte wollen in eine andere Form von Erfahrung übersetzt werden. Vielleicht meint Beatrice genau dies, wenn sie im Marshimmel zu Dante sagt: »Schau um dich her und lausche / denn nicht nur in meinen Augen ist der Himmel.«[15]
Ich möchte, ohne allzu große akademische Ambitionen, ohne allzu bewandert in der umfangreichen Forschungsliteratur zu sein und mit Rücksicht auf meinen eigenen Horizont, selbst einige Lesarten der Commedia anbieten, einige persönliche Kommentare, die sich aus meinen Überlegungen, meinen Beobachtungen und der Übertragung dieser Leseerfahrungen auf mein eigenes Leben ergeben haben. Die Commedia verfügt über eine geradezu majestätische Großzügigkeit, weil sie niemandem, der versucht ihre Schwelle zu übertreten, den Eintritt rundweg verweigert. Was genau der Leser jedoch dort findet, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
Es gibt ein tiefgreifendes Problem, mit dem sich jeder Autor (und jeder Leser) auseinandersetzen muss, wenn er sich auf einen Text so vollkommen einlässt. Wir wissen, dass das Lesen nicht ohne den festen Glauben an die Sprache und ihre hoch gepriesene Fähigkeit zur Vermittlung geistiger Inhalte funktionieren würde. Jedes Mal, wenn wir ein Buch aufschlagen, glauben wir trotz aller vorangegangenen Erfahrungen doch immer wieder fest daran, dass die Essenz des Textes sich uns dieses Mal offenbaren wird. Und trotz dieses frommen Wunsches sind wir doch jedes Mal, wenn wir die letzte Seite eines Buches erreichen, wieder ein bisschen enttäuscht. Besonders, wenn wir ein Buch gelesen haben, das man, mangels eines besseren Begriffs, als einen »Klassiker« bezeichnen könnte. Denn unsere Hoffnung darauf, den Text in all seiner Komplexität und Vielschichtigkeit vollständig auszuloten, bleibt doch immer wieder hinter unserer Fähigkeit, diese zu erfassen, zurück. Und deshalb zieht es uns wieder und wieder zu ihm hin, erfüllt von der Hoffnung, dass wir ihn vielleicht dieses Mal vollends verstehen werden. Zum Glück für die Literatur, zum Glück für uns verstehen wir nie alles. Auch ganze Generationen von Lesern können diese Bücher nicht ausschöpfen. Das Unvermögen der Sprache selbst, etwas wirklich vollkommen auszusagen, verleiht diesen Texten eine unendliche Tiefe an Bedeutungsebenen, die jeder nur gemäß seiner eigenen Fähigkeiten ergründen kann. Deshalb hat noch kein Leser jemals die unergründliche Tiefe des Mahabharata oder der Orestie vollständig erkundet.
Aber die Einsicht, dass ein Vorhaben unmöglich ist, hindert uns nicht daran, es zu versuchen. Jedes Mal, wenn ein Buch aufgeschlagen, wenn eine Seite umgeblättert wird, erwacht in uns wieder die Hoffnung, diesen Text, wenn auch nicht in seiner Gänze, so doch ein bisschen besser als bei der letzten Lektüre, zu ergründen. Dadurch erstellen wir mit den Jahren ein Palimpsest des Lesens, welches der Kraft des Werkes immer wieder aufs Neue Gestalt verleiht. Die Ilias der Zeitgenossen von Homer ist nicht unsere Ilias, aber sie enthält sie, genau wie unsere Ilias alle zukünftigen bereits enthält. Die Vorstellung der Chassidim, der Talmud beginne mit der zweiten Seite, weil der Leser sich immer vor Augen halten soll, dass er noch nicht einmal die erste Seite erreicht habe, trifft vielleicht auf jedes große Buch zu.[16]
Der Ausdruck Lectura Dantis wurde eingeführt, um ein spezifisches Genre zu beschreiben: die Lesarten der Commedia. Ich bin mir dessen bewusst, dass nach etlichen Generationen von Dante-Kommentaren, beginnend mit seinem Sohn Pietro, der seine Lectura Dantis bereits kurz nach dem Tod seines Vaters vorlegte, es schier unmöglich ist, eine kritische Zusammenfassung der Kommentare zu versuchen oder nach all den Jahren einen gänzlich originellen und neuen Zugang zu dem Gedicht zu finden. Und trotzdem könnte man ein solches Unternehmen beginnen, wenn man bedenkt, dass eine Lektüre weniger eine Übersetzung des Sinngehalts oder eine kritische Reflexion über die originäre Bedeutung des Textes ist, sondern vielmehr so etwas wie ein Selbstporträt ihres Lesers. Das Lesen ist ein Akt der Bekenntnis und Reflexion, in ihm erfahren wir uns selbst.
Der erste Leser, der die Commedia einer autobiographischen Lektüre unterzogen hat, war Dante selbst. Auf seiner Jenseitsreise, zu deren Beginn ihm gesagt wird, er müsse einen neuen Weg im Leben finden oder sich selbst für immer verlieren[17], wird Dante von dem leidenschaftlichen Wunsch gepackt, zu erfahren, wer er ist und was ihm auf seiner Reise begegnen wird. Diese unablässige Frage durchzieht die gesamte Commedia, vom ersten Vers des Inferno bis zum letzten im Paradiso.
Montaigne zitiert Dante in seinen umfangreichen Essais nur zweimal. Die Philologen gehen davon aus, dass er die Commedia nie komplett gelesen hat, ihm aber Teile durch die Kommentare anderer Autoren bekannt waren. Wenn er sie gelesen hätte, wäre Montaigne höchstwahrscheinlich von der dogmatischen Struktur, in die Dante seine Jenseitsreisen bettet, nicht sehr angetan gewesen. Trotzdem hat er auf Dante Bezug genommen. In einem Essai räsoniert Montaigne über die Sprache bei den Tieren und zitiert dabei drei Verse aus dem sechsundzwanzigsten Gesang des Purgatorio, in welchem Dante die reuigen Sünder beschreibt, die, »wie die Ameisen in ihren braunen Scharen, sich gegenseitig beschnuppern«[18].
An einer anderen Stelle paraphrasiert Montaigne eine Passage von Dante in seinen Überlegungen zur Knabenerziehung. »Der Lehrer ermuntere den Zögling«, schreibt Montaigne, »alles durchs eigene Sieb zu schlagen, und nichts setze er ihm lediglich kraft seiner Autorität und seines Ansehens in den Kopf; die Leitsätze des Aristoteles sollen für den Zögling ebenso wenig Leitsätze sein wie die der Stoiker und Epikureer. Man breite diese ganze Vielfalt der Auffassungen vor ihm aus: Er wird dann, wenn er kann, seine Wahl treffen; wenn nicht, möge er weiterzweifeln; nur Narren sind sich immer sicher und ein für allemal festgelegt.« Daran anschließend zitiert Montaigne einen Ausspruch Dantes: »Daß ich so gern wissen wie zweifeln (dubbiar) möchte.« Diesen Satz richtet Dante im sechsten Kreis der Hölle an Vergil, nachdem dieser ihm erklärt hat, warum die aus bloßer Unmäßigkeit begangenen Sünden Gott weniger erzürnen als diejenigen, die wir willentlich begehen. Dante drückt mit dem Satz die erwartungsvolle Freude aus, die man in dem Moment kurz vor einer wichtigen Einsicht verspürt. Für Montaigne hingegen drückt sich darin das fruchtbare Gefühl eines konstanten Zweifels aus, das es ihm erlaubt, eine Vielzahl möglicher Meinungen nebeneinander gelten zu lassen, aus denen er sich eine eigene aussucht. Doch für beide ist der Zustand des Zweifelns genauso befriedigend wie der des Wissens (möglicherweise sogar befriedigender).[19]
Kann man aber als Atheist Dante (oder Montaigne) lesen, ohne an denselben Gott zu glauben, den beide anbeteten? Ist es nicht anmaßend, zu glauben, man könne zu einem dezidierten Verständnis ihrer Werke gelangen, ohne den Glauben mit ihnen zu teilen, der ihnen dabei geholfen hat, ihr menschliches Schicksal mit all seinen Leiden, Verwirrungen und Qualen (aber auch Freuden) auf sich zu nehmen? Ist es nicht heuchlerisch, die diffizile theologische Struktur ihrer Werke und die Raffiniertheit ihrer religiösen Dogmen zu untersuchen, ohne von den Glaubenssätzen überzeugt zu sein, auf denen sie beruhen?
Als Leser beanspruche ich für mich das Recht, an die Bedeutung einer Erzählung zu glauben, unabhängig von den in sie eingebetteten Narrativen. Ich muss nicht an die Existenz der märchenhaften Großmutter und des bösen Wolfs glauben, Aschenputtel und Rotkäppchen müssen keine echten Personen sein, um mich von ihrer inneren Wahrheit zu überzeugen. Der Gott, der im Garten des Paradieses »gegen den Tagwind einherschreitet« (Genesis 3:8), und der Gott, der noch am Kreuz einem Schächer das Paradies versprochen hat, haben mich auf eine Weise berührt, wie es nur große Literatur vermag. Ohne Geschichten wären alle Religionen nur dumpfe Predigt. Es ist immer eine Geschichte, die uns überzeugt.
Die Kunst des Lesens ist in vielerlei Hinsicht der des Schreibens entgegengesetzt. Das Lesen ist ein Vorgang, der den Text eines Autors bereichert, indem er ihn gleichzeitig vertieft, erweitert und verdichtet. Der Leser kann im Text seine eigenen Erfahrungen wiederfinden und zugleich ausdehnen. Er wird an die Grenzen seines eigenen Universums und darüber hinaus geführt. Das Schreiben dagegen ist eine Kunst der Resignation. Der Autor muss akzeptieren lernen, dass sein Text letztlich immer nur das verschwommene Spiegelbild des Werkes ist, das er die ganze Zeit über im Kopf hatte. Der niedergeschriebene Text ist nie ganz so erhellend, subtil, erschütternd oder präzise, wie der Autor ihn sich vorgestellt hat. Die Einbildungskraft des Autors mag grenzenlos sein und ihn ständig von neuen, außergewöhnlichen Werken und ihrer sagenhaften Perfektion träumen lassen. Doch letztlich kommt immer der Abstieg aus diesen Träumereien in die Sprache. Im Übergang vom Gedanken zum Ausdruck geht vieles, sehr vieles verloren. Diese Regel kennt (fast) keine Ausnahme. Deshalb bedeutet ein Buch zu schreiben immer, sich mit einem unausweichlichen Scheitern abzufinden, wie verdienstvoll dieses auch sein mag.
Weil ich mir meiner Anmaßung nur allzu bewusst bin, dachte ich, dass es nicht schaden könnte, sich an Dante selbst ein Beispiel zu nehmen. So wie er sich auf seinen Reisen auf unterschiedliche Führer (Vergil, Statius, Beatrice, den heiligen Bernhard) verlassen konnte, so will ich mich auf ihn als Führer für meine eigene Reise verlassen und mich von seinen unablässigen Fragen durch meine eigene Neugierde navigieren lassen. Obwohl Dante diejenigen, die versuchten, mit ihren eigenen winzigen Ruderbooten in seinem Kielwasser zu schwimmen, scharf ermahnte, umzukehren und wieder das vertraute Ufer anzusteuern, damit sie sich nicht selbst verlorengingen,[20] glaube ich trotzdem, dass er einem Reisenden seine Hilfe nicht ausschlagen wird, wenn dieser gleich ihm ein Gepäck mit ähnlichen dubbi dabeihat.
Dante und Vergil treffen auf die Sünder, die Zwietracht gesät haben. Holzschnittillustration zum achtundzwanzigsten Gesang des Inferno, aus der Landino-Ausgabe von 1487.
(Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University)
1Was ist Neugierde?
Alles beginnt mit einer Reise. Eines Tages, ich mag acht oder neun Jahre alt gewesen sein, verlief ich mich auf meinem Nachhauseweg von der Schule. Die Schule, eine der vielen, die ich während meiner Kindheit besuchen sollte, war nicht weit entfernt von unserem Haus im von Bäumen gesäumten Viertel Belgrano in Buenos Aires. Damals ließ ich mich – wie übrigens auch heute noch – sehr schnell von allen möglichen Dingen ablenken, wenn ich in meinem gestärkten weißen Kittel, den seinerzeit alle Schulkinder tragen mussten, nach Hause lief. Da war der Lebensmittelladen an der Ecke, der, noch war die Ära der Supermarktketten nicht angebrochen, mit großen Fässern voll salziger Oliven, mit in hellblaues Papier eingewickelten Kegeln aus Zucker und blauen Keksboxen der Marke Canale aufwartete. Etwas weiter kam der Schreibwarenladen mit seinen patriotischen Notizbüchern, auf denen die Gesichter unserer Nationalhelden abgebildet waren, und ganzen Regalen vollgepackt mit den charakteristisch gelben Heften einer Robin-Hood-Reihe für Kinder. Dann war da dieses eine hohe, schmale Tor mit bunten Glasfenstern, das manchmal offen stand und den Blick auf einen düsteren Innenhof gewährte, in dem eine mysteriöse Schneiderpuppe einsam schmachtete, und schließlich kam der Süßwarenverkäufer, ein auf einem winzigen Stuhl an einer Straßenecke sitzender dicker Mann, der seine in kaleidoskopischer Farbenpracht an einem Stock prangenden Waren wie eine Lanze vor sich hielt. Normalerweise ging ich immer auf dem gleichen Weg zurück und hakte diese Stationen im Geiste ab, wenn ich an ihnen vorbeikam, aber an diesem Tag entschied ich mich dafür, einen anderen Weg zu nehmen. Nachdem ich einige Straßen entlanggegangen war, merkte ich, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich schämte mich zu sehr, um nach dem Weg zu fragen, und so wanderte ich, eher verblüfft als verängstigt, für eine wie mir schien sehr lange Zeit umher.
Ich weiß nicht mehr genau, warum ich an diesem Tag einen neuen Weg ausprobiert habe. Vielleicht, weil ich auf der Suche nach neuen Erfahrungen, nach Spuren unbekannter Mysterien war, wie in den Geschichten von Sherlock Holmes, die ich damals gerade für mich entdeckt hatte. Ich wollte durch mein messerscharfes Kombinieren der Geschichte hinter dem ramponierten Gehstock des Doktors nachspüren, wollte herausfinden, dass die Fußspuren im Matsch von einem um sein Leben rennenden Mann stammten. Ich wollte wissen, aus welchem geheimnisvollen Grund jener Mann dort einen schwarzen Bart trug, der ohne Zweifel falsch war. »Die Welt ist erfüllt von wahrscheinlichen Dingen, die zufällig von niemandem bemerkt werden«, hatte schon mein Lehrmeister Sherlock Holmes gesagt.
Ich erinnere mich an ein Gefühl aufkommender wohliger Erregung, als mir klar wurde, dass ich dabei war, mich in ein Abenteuer zu verstricken, das zwar anders war als die in meinen Büchern, aber doch etwas von der gleichen Spannung hatte. Ich war von dem gleichen intensiven Wunsch durchdrungen, herauszufinden, wie es weitergehen würde, ohne dass ich in der Lage gewesen wäre (oder es mir auch nur gewünscht hätte), vorhersagen zu können, was alles noch geschehen könnte. Ich fühlte mich, als befände ich mich in einem Buch, auf dem Weg zur letzten Seite. Doch was genau suchte ich? Vielleicht war gerade das der Augenblick, in dem ich zum ersten Mal die Zukunft als einen Ort wahrnahm, in dem die losen Fäden aller denkbaren Geschichten zusammenlaufen.
Doch letztlich geschah rein gar nichts. Nach einigem Herumirren fand ich mich plötzlich in meinem vertrauten Viertel wieder. Und als mein Zuhause schließlich wieder in Sicht kam, war ich enttäuscht.
»[…] wir halten verschiedene Fäden in der Hand, und der ein oder andere davon wird uns hoffentlich zum Ziel führen. Wir verlieren vielleicht Zeit, wenn wir der falschen Fährte folgen, aber früher oder später kommen wir doch auf den richtigen Weg.«
Sir Arthur Conan Doyle, Der Hund von Baskerville
Das Wort Neugierde ist doppeldeutig. Das große etymologische Wörterbuch des Spanischen von Covarrubias aus dem Jahre 1611 definiert den »Neugierigen« (»curioso« im Spanischen und Italienischen) als jemanden, der sich einer Sache mit besonders großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt widmet. Das daraus abgeleitetete Wort »curiosidad« (im Italienischen »curiosità«, »Neugierde« auf Deutsch) beschreibt der große spanische Lexikograph folgendermaßen: »Eine neugierige Person fragt sich immerzu: ›Warum ist das so und dies so?‹« Später hat Roger Chartier darauf hingewiesen, dass diese Definition Covarrubias selbst wohl nicht ganz zufriedengestellt hat, weshalb er in einem zwischen 1611 und 1612 geschriebenen Nachtrag (der nie publiziert wurde) spezifizierte, »curioso« habe »eine positive und eine negative Bedeutung. Positiv insofern eine neugierige Person eine Sache mit Achtung behandelt, negativ hingegen, weil diese Person sich auch darum bemühen mag, solchen Dingen auf den Grund zu gehen, die verborgen, uns nicht vorbehalten und nicht von Bedeutung sind.« Darauf lässt er ein lateinisches Zitat aus einem apokryphen Bibeltext des Jesus Sirach folgen: »Suche nicht zu ergründen, was dir zu wunderbar ist, untersuche nicht, was dir verhüllt ist. Was dir zugewiesen ist, magst du durchforschen, doch das Verborgene hast du nicht nötig.« (3:21–22) Damit, schreibt Chartier, folge Covarrubias der in der Bibel und der patristischen Tradition wiederholt geäußerten Einschätzung, Neugierde könne sich auch als ein sündhaftes Streben nach verbotenem Wissen äußern.[21] Dante war sich dieser zwiespältigen Natur der Neugierde wohl bewusst.
Einen Großteil, wenn nicht die ganze Commedia, schrieb Dante im Exil. Man kann seine poetische Beschreibung einer Jenseitsreise daher auch als Kommentar zu seinem erzwungenen Pilgerleben auf Erden lesen. Angetrieben wird er dabei von seiner Neugierde, die ihn, nach der Definition Covarrubias’, die Dinge mit großer »Aufmerksamkeit« betrachten lässt, in ihm aber auch den Wunsch weckt, zu erfahren, was »verborgen, uns nicht vorbehalten« ist; einer Neugierde auf etwas, das noch jenseits alles sprachlich Fassbaren liegt. In den zahlreichen Dialogen mit seinen jenseitigen Führern (Vergil, Beatrice und dem heiligen Bernhard) und mit den verdammten und gesegneten Seelen, die er auf seiner Reise trifft, überlässt sich Dante vollauf seiner Neugierde. Sie leitet ihn zu dem unsagbaren, jenseits aller Beschreibung gelegenen Ziel seiner Reise. Doch selbst wenn er uns versichert, dass die Antworten auf seine brennendsten Fragen von keiner menschlichen Zunge gegeben werden können, so ist die Sprache doch immer noch das eigentliche Instrument, durch das seine Neugierde voranschreitet. Und dieses Instrument können auch wir benutzen. In unserer eigenen Lektüre der Commedia kann Dante damit die Rolle einer »Hebamme« unserer Gedanken einnehmen. Genau wie Sokrates, der seine eigene Rolle bei der Suche nach der Wahrheit bekanntlich als die eines Geburtshelfers beschrieben hat.[22] Die Commedia erlaubt uns, unsere eigenen Fragen zu gebären.
Dante starb am 13. oder 14. September 1321 im Exil in Ravenna, nachdem er in den letzten Versen seiner Commedia seine Vision eines ewigen göttlichen Lichtes zu Papier gebracht hatte. Er wurde 56 Jahre alt. Giovanni Boccaccio erzählt, dass Dante schon einige Zeit vor seiner Verbannung aus Florenz mit der Niederschrift der Commedia begonnen hatte und leider gezwungen war, die ersten sieben Gesänge des Inferno dort zurückzulassen. Als später ein Unbekannter in Dantes verlassenes Haus eindrang, um dort nach einem Dokument zu suchen, fand er diese Gesänge und las sie voller Bewunderung, ohne zu wissen, so Boccaccio, dass sie von Dante waren. Er brachte sie einem florentinischen Dichter »von einigem Ruhm«, der natürlich erriet, dass dieses Werk nur von Dante stammen konnte, und es ihm nachschickte. Dante hielt sich zu dieser Zeit am Hof des Moroello Malaspina in Lunigiana auf. Boccaccio berichtet weiter, dass die Gesänge dann ihren Weg in Malaspinas Hände fanden, der sie ebenfalls las und Dante inständig darum bat, dieses so herrlich begonnene Werk wieder aufzunehmen. Dante fügte sich und setzte seine Arbeit mit dem achten Gesang fort, den er mit den Worten beginnen lässt: »Ich fahre fort und sage, daß noch ehe …«[23] So zumindest erzählt es die Legende.
Außergewöhnliche Werke der Literatur verlangen scheinbar auch außergewöhnliche Geschichten über ihre Entstehung. So wurden, um die schier unbegreifliche Vollkommenheit der Ilias und der Odyssee zu erklären, geradezu magisch verklärte Biographien über ihren phantomhaften Autor Homer geschrieben. Auch Vergil wurde wahlweise zu einem Nekromanten oder einem Herold des Christentums stilisiert, weil seine Leser sich einfach nicht vorstellen konnten, dass die Aeneis von einem normalen Sterblichen geschrieben sein konnte. Gemäß dieser Logik musste die Vollendung eines Meisterwerks natürlich noch außergewöhnlicher sein als sein Beginn. Daher berichtet Boccaccio weiter, dass Dante im Laufe der Arbeit an der Commedia damit begann, die bereits vollendeten Teile an seinen Patron Cangrande della Scala in Paketen von sechs bis acht Gesängen zu verschicken. Cangrande kam auf diese Weise sukzessive in den Lesegenuss des gesamten Werks, bis auf die letzten dreizehn Gesänge des Paradiso, die ihm noch fehlten, als Dante verschied. Nach Dantes Tod durchforsteten seine Söhne und Schüler seine Papiere, um zu schauen, ob er die fehlenden Gesänge nicht vielleicht doch noch vollendet hatte. Da sie aber nichts fanden, schreibt Boccaccio, »grollten [sie], daß Gott ihn nicht wenigstens so lange der Welt gelassen hatte, daß er den kleinen Rest seines Werkes hätte beenden können«. Doch eines Nachts hatte Jacopo, der drittgeborene Sohn Dantes, einen Traum. Im Traum erschien ihm sein Vater, gehüllt in blendend weiße Kleider. Von seinem Gesicht ging ein ungewöhnliches Licht aus. Jacopo fragte ihn, ob er noch lebe, und Dante antwortete, ja, er lebe noch, jedoch habe er nun das wahre Leben und nicht mehr das irdische. Dann fragte Jacopo ihn, ob er seine Commedia vollendet hätte. »Ja«, gab Dante zur Antwort, »ich habe sie vollendet«, und führte Jacopo in sein ehemaliges Schlafzimmer, wo er mit der Hand eine bestimmte Stelle an der Wand berührte und verkündete: »Da ist, was ihr so lange gesucht habt.« Als Jacopo daraufhin erwachte, schnappte er sich einen von Dantes Schülern, und gemeinsam entdeckten sie hinter einem aufgehängten Stück Stoff eine Nische, in der sich einige vermoderte Papiere befanden, die sich als die fehlenden Gesänge entpuppten. Sie schrieben die Verse ab und schickten sie, wie es Dantes Gewohnheit gewesen war, an Cangrande. »Also«, schließt Boccaccio diese Episode, »ist das Werk, das während vieler Jahre zusammengestellt wurde, zur Vollendung gekommen.«[24]
Diese von Boccaccio überlieferte Geschichte, die heute mehr als eine auf Bewunderung fußende Legende denn als tatsächliche Wiedergabe der geschichtlichen Ereignisse gilt, verleiht der Entstehungsgeschichte des vielleicht größten Gedichts aller Zeiten die angemessene magische Aura. Und trotzdem reichen in den Augen der Leser selbst die abrupte Unterbrechung und die spektakuläre Enthüllung nicht aus, um die Entstehung dieses Meisterwerks gänzlich zu erklären. Die Literaturgeschichte ist reich an solchen Beispielen, in denen es verzweifelten Schriftstellern trotz allen Widrigkeiten gelungen ist, Unnachahmliches zu leisten. Ovid hat seine Klagelieder in dem Höllenloch Tomis geschrieben, Boethius schrieb seinen Trost der Philosophie im Gefängnis, der von Tuberkulose geplagte Keats arbeitete bis kurz vor seinem Tod an seinen letzten Gedichten, und Kafka schrieb Die Verwandlung im engen Hausflur seiner Eltern – womit sie alle eindrucksvoll das Vorurteil widerlegten, dass ein Schriftsteller nur unter äußerst günstigen Umständen Großes zu leisten imstande sei. Dantes Geschichte ist sogar noch spezieller.
Das erste Porträt von Dante, das jemals in einem gedruckten Buch erschien: ein von Hand kolorierter Holzschnitt aus Lo amoroso Convivio di Dante (Venedig 1521).
(Mit freundlicher Genehmigung von Livio Ambrogio)
Im späten 13. Jahrhundert war die Toskana in zwei politische Fraktionen gespalten: die papsttreuen Guelfen und die Ghibellinen, die der Krone treu waren. 1260 besiegten die Ghibellinen die Guelfen bei der Schlacht von Montaperti. Ein paar Jahre später konnten die Guelfen die Macht zurückgewinnen und vertrieben die Ghibellinen aus Florenz. Ab 1270 wurde die Stadt komplett von den Guelfen regiert. Sie herrschten während Dantes gesamter Lebenszeit über die Stadt. Kurz nachdem Dante 1265 geboren wurde, spalteten sich die Guelfen in eine weiße und eine schwarze Fraktion, wobei es diesmal nicht um eine politische Haltung, sondern um Familienzugehörigkeit ging. Die herrschende weiße Fraktion schickte am 7. Mai 1300 eine Gesandtschaft nach San Gimignano, zu der auch Dante gehörte. Einen Monat später wurde er zu einem der sechs Prioren von Florenz gewählt. Dante war der Ansicht, dass Staat und Kirche klar getrennt sein sollten, und wandte sich deswegen gegen die politischen Ambitionen des Papstes Bonifatius VIII. Aus diesem Grund wurde Dante, nachdem er im Herbst 1301 mit einer florentinischen Gesellschaft nach Rom gereist war, befohlen, am Hof des Papstes zu bleiben, während die übrigen Gesandten nach Florenz zurückberufen wurden. In Dantes Abwesenheit marschierte nun am 1. November der landlose französische Prinz Charles de Valois (den Dante im Verdacht hatte, ein Büttel von Bonifatius zu sein) in Florenz ein, angeblich um den Frieden wiederherzustellen, tatsächlich aber, um einer Gruppe exilierter Schwarzer Guelfen Eintritt in die Stadt zu verschaffen. Unter ihrem Anführer Corso Donati plünderten die Schwarzen Guelfen die Stadt fünf Tage lang, ermordeten zahlreiche Florentiner und vertrieben die Weißen Guelfen. Mit der Zeit wurden die Weißen Guelfen als Partner der Ghibellinen denunziert, und das Priorat der Schwarzen Guelfen wurde installiert. Im Januar 1302 wurde Dante, der sich offenbar noch immer in Rom aufhielt, vom Priorat zum Verbannten erklärt. Als er sich weigerte, das bei dieser Verurteilung festgesetzte Strafgeld zu bezahlen, wurde die zweijährige Verbannung in ein neues Urteil umgewandelt, nach dem er, falls er je wieder nach Florenz zurückkäme, bei lebendigem Leib verbrannt werden sollte. Sein gesamter Besitz wurde konfisziert.
Dante verbrachte die ersten Jahre seines Exils in Forlì und ab 1303 in Verona, wo er bis zum Tod des Fürsten Bartolomeo della Scala am 7. März 1304 blieb. Weil der neue Fürst von Verona, Alboino della Scala, ihm nicht gewogen war, womöglich auch, weil Dante glaubte, die Gunst des neuen Papstes Benedikt XI. erlangen zu können, kehrte er daraufhin in die Toskana zurück, wahrscheinlich nach Arezzo. Von seinen Aufenthaltsorten in den nun folgenden Jahren haben wir nur unzureichende Kenntnisse. Es könnte ihn nach Treviso verschlagen haben, auch Lunigiana, Lucca, Padua und Venedig könnten Zwischenstopps gewesen sein. 1309 oder 1310 könnte er eine Reise nach Paris unternommen haben. Sicher ist jedenfalls, dass Dante 1312 nach Verona zurückkehrte. Ein Jahr zuvor war Cangrande della Scala zum alleinigen Herrscher der Stadt aufgestiegen, unter dessen Protektion Dante bis 1317 lebte. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Dante in Ravenna, am Hof des Guido Novello da Polenta.
In Ermangelung eindeutig datierbarer Dokumente veranschlagt die Danteforschung den Beginn der Niederschrift des Inferno zwischen 1304 und 1306. Das Purgatorio begann Dante wahrscheinlich 1313 und das Paradiso um 1316. Aber eine genaue Datierung ist vielleicht weniger wichtig als der frappierende Umstand, dass Dante die Commedia während einer zwanzig Jahre andauernden Wanderschaft geschrieben hat, die ihn in mehr als zehn unterschiedliche Städte führte, fern von seiner Bibliothek, seinem Schreibtisch, seinen Papieren und Notizen, seinen persönlichen Talismanen und all den kleinen, unerlässlichen Nippsachen, mit denen jeder Schriftsteller sein Arbeitszimmer ausstaffiert. In ungewohnten Räumlichkeiten, mitten unter Menschen, denen er allzeit zu höflicher Dankbarkeit und Aufmerksamkeit verpflichtet war, an Orten, die nicht sein Zuhause waren, und ihm deshalb wenig Privatsphäre ließen, war er abhängig von sozialen Verpflichtungen und musste sich entgegen seines stolzen Charakters den gesellschaftlichen Konventionen eilfertig beugen. Dante wird wohl jeden Tag darum gekämpft haben, auch nur ein paar kurze Momente der Abgeschiedenheit und Ruhe zu finden, in denen er schreiben konnte. Weil ihm seine eigenen Bücher, die er vermutlich in all den Jahren mit unzähligen Kommentaren und Bemerkungen versehen hatte, nicht zur Verfügung standen, musste er sich auf die Bibliothek seiner Erinnerung verlassen, die zwar allem Anschein nach sehr großzügig ausgestattet war (wie die unzähligen literarischen, naturwissenschaftlichen, theologischen und philosophischen Anspielungen in der Commedia verdeutlichen), jedoch zwangsläufig dem zunehmenden Nachlassen der Erinnerung ausgesetzt war, das sich mit dem Alter einstellt.
Wie können wir uns seine ersten Skizzen vorstellen? In einem von Boccaccio überlieferten Dokument berichtet ein gewisser Bruder Ilario, »ein bescheidener Mönch aus Corvo«, dass ihn eines Tages ein Reisender in seiner Klause besuchte. Bruder Ilario erkannte den Reisenden sofort, »denn obwohl ich ihn bis zu diesem Tage nie gesehen hatte, so hatte sein Ruhm mich doch schon längst erreicht«. Als er das Interesse des Mönches an ihm bemerkte, zog der Gast »mit freundlicher Miene ein kleines Buch aus seinem Gewand« und ließ ihn einige seiner Verse lesen. Dieser Reisende war natürlich Dante und die Verse der Anfang des Inferno. Sie waren im Jargon der Florentiner Mundart verfasst, doch Dante erzählte dem Mönch, dass er ursprünglich auf Latein hatte schreiben wollen.[25] Wenn Boccaccios Dokument authentisch ist, dann hatte Dante zumindest die ersten Seiten seines Gedichtes mit ins Exil nehmen können. Das wäre schon genug gewesen.
Wir wissen, dass Dante bereits in den ersten Jahren im Exil damit begann, Freunden und Gönnern Abschriften einiger Gesänge zu schicken, die wiederum oft kopiert und an Dritte weitergeben wurden. Der Dichter Cino da Pistoia, ein langjähriger Freund Dantes, baute im August 1313 einige Verse aus zwei Gesängen des Inferno in ein Lied ein, das er zu Ehren des jüngst verstorbenen Königs Heinrich VII. schrieb. 1314, oder auch etwas früher, erwähnt der toskanische Notar Francesco da Barberino die Commedia in seinen Documenti d’amore. Es gibt zahlreiche weitere Belege dafür, dass Dantes Name bekannt war und er für dieses Werk bewundert (aber auch beneidet und verachtet) wurde, lange bevor die Commedia endgültig abgeschlossen war. Kaum zwanzig Jahre nach Dantes Tod berichtet Petrarca, wie selbst des Lesens unkundige Künstler Teile aus dem Gedicht an Weggabelungen und Bühnen vor applaudierenden Stoffhändlern, Wirten und ihren Kunden sowie in kleinen Geschäften und auf Märkten rezitierten.[26] Cino und Cangrande dürften ein fast vollständiges Manuskript des Gedichtes besessen haben, und wir wissen, dass Dantes Sohn Jacopo mit einer Abschrift der Texte aus der Hand seines Vaters arbeitete, um eine einbändige Ausgabe der Commedia für Guido da Polenta anzufertigen. Aber nicht eine einzige Zeile des Gedichtes ist in Dantes eigener Handschrift überliefert. Coluccio Salutati, ein gelehrter Florentiner und Humanist, der einen Teil der Commedia ins Lateinische übersetzte, erinnerte sich daran, in der Kanzlei von Florenz einige mittlerweile verlorene Episteln in Dantes »leicht geneigter Handschrift« gesehen zu haben. Wir können aber nur vermuten, wie seine Handschrift ausgesehen haben mag.[27]
Wie Dante auf die Idee kam, einen Reisebericht über die Unterwelt und das Jenseits zu verfassen, bleibt eine Frage, die wir nicht abschließend beantworten können. Einen Hinweis mag uns die Vita nova geben, ein in 31 Gedichte gegliederter autobiographischer Essay, dessen Bedeutung, Sinn und Entstehungsgrund Dante mit seiner ewigen Liebe zu Beatrice erklärt. Im letzten Kapitel dieses Buches berichtet Dante von einer »wunderbaren Erscheinung«, die ihn den Entschluss habe fassen lassen, in einem Werk »von ihr zu sprechen, wie nie zuvor über eine Frau gesprochen wurde«.[28] Ein weiterer Grund könnte in der allgemeinen Faszination für Sagen und Märchen über Jenseitsreisen liegen, die unter Dantes Zeitgenossen weitverbreitet war. Im 13. Jahrhundert hatten sich diese Geschichten zu einem eigenen blühenden literarischen Genre entwickelt, vermutlich aus der Sorge um das, was uns erwartet, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben, und aus dem Wunsch, verstorbene Angehörige wiederzusehen und von ihnen zu erfahren, ob sie dem schwachen Halt unserer Erinnerung bedürfen, um in der anderen Welt weiterexistieren zu können und ob sich unsere Taten diesseits des Grabes auf das Leben im Jenseits auswirken. Natürlich waren diese Fragen auch damals schon nicht neu. Seitdem der Mensch weit vor Beginn unserer Zeitrechnung angefangen hat, Geschichten zu erzählen, malen wir an den umfangreichen Karten der jenseitigen Welt. Sicherlich waren Dante einige dieser Reiseberichte geläufig. So hat zum Beispiel schon Homer seinen Odysseus auf dessen mühevoller Heimreise nach Ithaka auch das Land der Toten besuchen lassen. Dante, der kein Griechisch verstand, war zumindest mit einer ähnlichen Version eines Abstiegs in den Hades vertraut, nämlich derjenigen, die Vergil in Anlehnung an Homer in seiner Aeneis beschrieb. Und auch der heilige Paulus schrieb in seinem zweiten Brief an die Korinther von einem Mann, der ins Paradies entrückt wurde: »Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen kann.« (12:4) Als im ersten Gesang der Commedia Vergil Dante erscheint und ihm mitteilt, er werde ihn »zu dem ewigen Ort geleiten«, willigt Dante ein, zögert dann aber:
Doch was steig ich hinunter? Wer erlaubt es?
Ich bin Äneas nicht, nicht Paulus bin ich.[29]
Dantes Zeitgenossen hätten diese Verweise verstanden.
Auch mit Ciceros Traum des Scipios und dessen Beschreibung der Himmelssphären sowie den zauberhaften Ereignissen in Ovids Metamorphosen wird der unersättliche Leser Dante vertraut gewesen sein. Die christliche Eschatologie wird sich auch als Inspirationsquelle angeboten haben. So beschreibt zum Beispiel eines der apokryphen Evangelien die Apokalypse des Petrus die Vision eines Kirchenvaters, der die Heiligen in einem duftenden Garten einherschreiten sieht. Und die Apokalypse des Paulus berichtet von einem unermesslichen Abgrund, in den die Seelen gestoßen werden, die sich nicht Gottes Gnade anvertraut haben.[30] Viele weitere Jenseitsreisen und Visionen vom Leben nach dem Tod ließen sich in der seinerzeit weitverbreiteten Sammlung erbaulicher Geschichten wie der Goldenen Legende von Jacobus von Voragine, den anonym publizierten Vitae patrum, den imaginären Reiseberichten der irischen Heiligen Sankt Brendan, Sankt Patrick und König Tungdal, den mystischen Visionen des Peter Damian, des Richard von Sankt Viktor oder des Gioachim von Fiore nachlesen. Eine weitere Quelle könnten auch die islamischen Chroniken von diversen Himmelsreisen gewesen sein. Zum Beispiel das andalusische Libro della Scala oder Buch von der Leiter, das die Geschichte von Mohammeds Himmelfahrt erzählt. (Wir werden später auf die islamischen Einflüsse in der Commedia zurückkommen.) Für jedes neue literarische Unternehmen existiert bereits ein Modell, und unsere Bibliotheken erinnern uns ständig daran, dass es absolute Originalität in der Literatur nicht gibt.
Das früheste literarische Zeugnis Dantes, von dem wir wissen, sind ein paar Verse, die er 1283 schrieb, als er achtzehn Jahre alt war. Sie wurden später in die Vita nova aufgenommen. Das letzte Zeugnis seines Wirkens ist ein philosophischer Text, Questio de aqua et terra (Abhandlung über die Erde und das Wasser), den er am 20. Januar 1320, also weniger als zwei Jahre vor seinem Tod, öffentlich vortrug.
Die Vita nova wurde vor dem Jahre 1294 fertiggestellt. Der Titel verweist auf den Sinnspruch Incipit Vita Nova (»Hier beginnt das neue Leben«). Dieses neue Leben begann für Dante in einem Moment, der sich tief in das Buch seiner Erinnerungen einprägte. Mit der magischen ersten Begegnung zwischen Dante und Beatrice. Er war damals neun und Beatrice acht Jahre alt. Seit diesem Tag liebte er Beatrice. Deshalb bilden die Liebesbriefe, mit denen er ihre Zuneigung gewinnen wollte, das Gerüst seiner Vita nova. Das Buch präsentiert sich als eine ununterbrochene Suche, als Versuch, Antworten auf Fragen zu finden, die Dante sich in den unerwiderten Liebesgedichten stellt, befeuert von einer Neugierde, die, wie Dante schreibt, »dem obersten Gemach, wohin all die Geister der Sinne ihre Wahrnehmung leiten«,[31] entstammt.
Dantes letztes Werk, die Questio de aqua et terra, ist eine philosophische Abhandlung über naturwissenschaftliche Fragestellungen im Stil der seinerzeit populären »Dispute«. In der Einführung schreibt er: »Da ich seit meiner Kindheit unaufhörlich in Liebe zur Wahrheit genährt wurde, ertrug ich es nicht, die erwähnte Frage unerörtert zu lassen, sondern hielt es für angebracht, diesbezüglich das Wahre aufzuzeigen, nicht ohne die Gegenargumente aufzulösen – aus Liebe zur Wahrheit wie auch aus Abscheu vor der Falschheit.«[32] Das dringende Bedürfnis, Fragen zu stellen, begegnet uns also in Dantes erstem und in seinem letzten Text. Zwischen diesen beiden liegt die unermessliche Landschaft von Dantes größtem Meisterwerk: die Commedia. Auch sie ist das Ergebnis des drängenden Strebens eines neugierigen Mannes.
In der patristischen Tradition kann die Neugierde zwei Formen annehmen: Die Neugierde kann sich als vanitas äußern, welche die Babylonier dazu verleitete, zu glauben, sie könnten einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, und sie kann sich als umiltà äußern, die in aller Bescheidenheit nur so viel von der göttlichen Wahrheit erfahren will, wie wir auch verstehen können, damit, wie es der heilige Bernhard im letzten Gesang der Commedia für Dante erbittet, »das allerhöchste Glück sich ihm enthülle«. Dante zitiert in seinem Gastmahl den Pythagoras als lobenswertes Beispiel für diese umiltà, weil seine Neugierde einzig in der »Liebe zur Weisheit« bestanden habe, und sie daher bei ihm »nicht ein Ausdruck der Überheblichkeit, sondern der Demut ist«.[33]
Obwohl Gelehrte wie Bonaventura, Siger de Brabant und Boethius einen starken Einfluss auf Dantes Denken hatten, muss man doch vor allen anderen Thomas von Aquin als seinen maître à penser nennen: Was Dantes Commedia für seine neugierigen Leser bedeutet, das war Aquins Werk für Dante. Als Dante von Beatrice in die Sonnensphäre des Himmels geleitet wird, also an den Ort, wo nach dem Tod die Weisen weilen, wird er von zwölf gesegneten Seelen empfangen, die ihn, untermalt von einer himmlischen Musik, dreimal umkreisen, bis sich schließlich eine der Seelen aus dem Reigen löst und zu Dante spricht. Es ist die Seele des Thomas von Aquin, die ihm erklärt, nun, da die wahre Liebe in Dante entzündet sei, müssten Thomas selbst und die anderen Weisen ihm aufgrund eben dieser auch in ihnen wirkenden Liebe zur Wahrheit seine Fragen beantworten. Thomas von Aquin hatte gemäß der Lehre des Aristoteles behauptet, das Wissen um das absolut Gute sei so erhaben, dass die auserwählten Seelen, die es erfahren durften, diesen Moment des puren Glücks niemals wieder vergessen könnten und folglich immer den Wunsch in sich tragen müssten, in diesen Zustand des Wissens zurückzukehren. Dantes »Durst« nach Wissen, wie es Thomas’ Seele hier formuliert, muss also gestillt werden. Denn es sei unvorstellbar, auf dieses Bedürfnis Dantes nicht zu antworten, und genauso ein Ding des Unmöglichen wie »Wasser, das zum Meer nicht strömen wollte«.[34]
Thomas von Aquin wurde als Kind eines noblen Geschlechts in Roccasecca geboren. Seine weitverzweigte Familie hatte verwandtschaftliche Verbindungen zu einem Großteil der europäischen Aristokratie: Der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs war sein Vetter. Mit fünf Jahren begann er seine Studien in dem berühmten Benediktinerkloster von Monte Cassino. Er muss ein Kind mit starkem Willen gewesen sein, denn es wird erzählt, dass seine ersten Worte im Kloster, nachdem er tagelang im Unterricht nur geschwiegen hatte, aus der mit plötzlicher Heftigkeit an den Lehrer gerichteten Frage bestand: »Was ist Gott?«[35] Im Alter von fünfzehn Jahren ließen ihn seine von den ewigen politischen Intrigen im Kloster angewiderten Eltern an die kurz zuvor gegründete Universität von Neapel versetzen, wo er seine ihn ein Leben lang beschäftigenden Studien über Aristoteles und seine Arbeit an den Kommentaren zu dessen Werk begann. Während seiner Studienzeit, wahrscheinlich gegen 1244, trat er dem noch jungen Dominikanerorden bei. Das mit diesem Schritt verbundene Vorhaben, fortan das Leben eines Bettelmönchs zu führen, versetzte seine aristokratische Familie in Panik. Sie ließen ihn entführen und hielten ihn ein Jahr lang gefangen, in der Hoffnung, er würde seinen Entschluss überdenken. Thomas ließ sich aber nicht beirren und übersiedelte nach seiner Freilassung nach Köln, wo er unter Albertus Magnus studierte. Den Rest seines Lebens verbrachte er lehrend, predigend und schreibend in Italien und Frankreich.
Thomas war ein großer, schwerer Mann, der sich eher langsam und behäbig bewegte, was ihm den Spitznamen »stummer Ochse« einbrachte. Er lehnte alle ihm angetragenen Ämter ab, unabhängig davon, ob die Angebote vom Hof oder einer Abtei kamen. Über alle Maßen liebte er die Bücher und das Lesen. Als er einmal gefragt wurde, wofür er Gott am meisten dankbar sei, antwortete er: »Ich habe jede Seite verstanden, die ich jemals gelesen habe.«[36] Er glaubte fest an die Vernunft als probatestes Mittel zur Erlangung von Wahrheit. Der Philosophie seines Vorbilds Aristoteles folgend, versuchte er sich über die großen theologischen Fragen mit Hilfe ausgefeilter Syllogismen klarzuwerden. Für dieses Unterfangen wurde er drei Jahre nach seinem Tod durch den Bischof von Paris verdammt, der der Meinung war, die Allmacht Gottes könne auf die Haarspaltereien der griechischen Logik verzichten.
Das Hauptwerk des Thomas von Aquin ist die Summa Theologica, eine umfangreiche Studie über die grundlegenden Fragen der Theologie. In seinem Vorwort schreibt Thomas, »ein Lehrer der katholischen Wahrheit hat nicht nur die Aufgabe, die Fortgeschrittenen tiefer in die Wissenschaft einzuführen; er soll sich […] auch dem Unterricht der Anfänger widmen«.[37] Thomas war sich der Notwendigkeit einer klaren und systematischen Darstellung des christlichen Denkens bewusst und benutzte die erst kürzlich wiederentdeckten und ins Lateinische übersetzten Schriften des Aristoteles, um einen theoretischen Rahmen zu schaffen, der all die einander widersprechenden fundamentalen christlichen Glaubenssätze und kanonischen Schriften – von der Bibel über die Bücher des heiligen Augustinus bis hin zu den Theologen seiner eigenen Epoche – umschließen sollte. Bis wenige Monate vor seinem Tod 1274 arbeitete Thomas unermüdlich an seiner Summa. Dante, der zu diesem Zeitpunkt zarte neun Jahre alt war, hat vielleicht einige der Schüler des Thomas an der Universität von Paris getroffen, wenn er tatsächlich (wie es die Legende behauptet) die Stadt als junger Mann besucht hat. Ob nun durch die Unterweisungen von Thomas’ Schülern oder durch eigene Lektüre: Es ist sicher, dass Dante die Lehren des Thomas sehr genau kannte, denn er machte sich dessen theologische Kartographie genauso zu eigen, wie er etwa auch auf die Erfindung der Ersten Person Singular als Erzählinstanz durch Augustinus zurückgriff, um von seiner Lebensreise zu berichten. Und ganz sicher waren ihm auch beider Ansichten über die Natur der menschlichen Wissbegierde bekannt.
Der Anfang allen Fragens liegt für Thomas in dem berühmten Satz des Aristoteles begründet: »Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.« Auf diesen Satz bezieht sich Thomas ein ums andere Mal in seinen Schriften. Thomas nennt drei Gründe, warum es uns nach Wissen verlangt. Als ersten Grund führt er an, dass jedes Ding seiner Natur gemäß nach Perfektion strebe. Angewandt auf den Menschen bedeutet dieser Satz, dass er sich seiner eigenen Natur vollumfänglich bewusst werden will und nicht bei der bloßen Befähigung, dieses Bewusstsein theoretisch erreichen zu können, stehen bleiben will. Dazu muss er Wissen über die Welt erlangen. Zweitens drängt es jedes Ding von Natur aus danach, sich in den ihm angemessen Zustand zu begeben: So, wie das Feuer Wärme abstrahlen und schwere Gegenstände hinabfallen müssen, ist der Mensch dazu bestimmt, zu begreifen und deshalb auch geschaffen, um zu wissen. Drittens strebt alles danach, zu seinem inneren Bewegungsgrund, seinem Prinzip zurückzukehren. Dieser Drang drückt sich im Nachvollzug der idealsten aller vorstellbaren Form aus: der Kreisbahn. Nur durch das Erkennen der Wahrheit kann das Ziel dieses Strebens erreicht werden, nur durch den Verstand kann der Kreis geschlossen werden und wir zu unserer wesenhaften Bestimmung gelangen. Deshalb, schlussfolgert Thomas, ist alles im Streben nach der höchsten Wahrheit errungene Wissen auch gut.[38]
Thomas weist darauf hin, dass Augustinus in einer Art Appendix aus nachträglichen Berichtigungen zu einem Großteil seines Gesamtwerks mit dem Titel Überarbeitungen notierte, »mehr Dinge werden gesucht als gefunden, und von denjenigen Dingen, die gefunden werden, bestätigen sich nur wenige«. Daraus spricht Augustinus’ Überzeugung, dass dem Verstand enge Grenzen gesetzt sind. Thomas merkt an, indem er eine andere Stelle des überaus produktiven Autors der Bekenntnisse zitiert, dass Augustinus davor gewarnt habe, eine zu rücksichtslose Neugierde, die alles und jeden in Zweifel zieht, könne die Gelehrten zur Sünde des Hochmuts verführen und damit die stets auch dem Gebot der Maßhaltung verpflichtete Suche nach der Wahrheit in ein schlechtes Licht rücken. »Es gibt Leute, die das Tugendleben aufgeben, und nicht mehr wissen, was Gott ist«, schrieb Augustinus. »Daraus entsteht ein solcher Hochmut, daß sie den Himmel, über den sie so oft disputieren, bereits zu bewohnen scheinen.«[39] Dante war sich dessen bewusst, dass er sich der Sünde des Hochmutes schuldig gemacht hatte (eben jene Sünde, für die er, wie ihm gesagt wird, nach seinem Tod ins Purgatorio zurückkehren wird), und er wird wohl diese Passage im Hinterkopf behalten haben, als er das Paradies betrat.
Thomas seinerseits griff die Bedenken des Augustinus auf und argumentierte, der Hochmut sei nur die erste von vier möglichen Verirrungen der menschlichen Neugierde. Die zweite bestehe in einem übermäßigen Interesse an geringfügigen Dingen, wie der Lektüre von populärer Literatur oder dem durch unwürdige Lehrer erteilten Unterricht.[40] Die dritte tritt dann auf, wenn wir die Dinge dieser Welt losgelöst von ihrem Schöpfer betrachten; die vierte und letzte schließlich, wenn wir das, was jenseits unserer eigenen intellektuellen Kapazität liegt, studieren wollen. Doch Thomas verdammt diese vier Formen der fehlgeleiteten Neugierde nur deshalb, weil sie von dem eigentlichen, höheren Antrieb zur Erforschung der Welt ablenken. Damit stimmt er mit Bernhard von Clairvaux überein, der ein Jahrhundert zuvor geschrieben hatte: »Es gibt nämlich Menschen, die nur wissen wollen, um zu wissen: das ist beschämende Neugierde.« Bereits vier Jahrhunderte vor Clairvaux hatte Alkuin von York die Neugierde etwas wohlwollender definiert: »Du liebst das Wissen, um Gott zu gefallen, um der Reinheit deiner Seele willen, um die Wahrheit zu kennen, und um ihrer selber willen.«[41]
Die Neugierde wirkt wie eine umgekehrte Gravitationskraft, denn je höher wir streben, je mehr wir fragen, desto größer wird unser Wissen von der Welt und von uns selbst: Die Neugierde lässt uns wachsen. Nach Dantes Überzeugung, der darin Thomas und Aristoteles folgt, werden wir von einem tiefen Wunsch nach dem Guten oder dem scheinbar Guten angetrieben. D.h., wir streben nach dem Guten oder zumindest dem, was wir für das Gute halten. Etwas in unserer Vorstellungskraft bedeutet uns, dass etwas gut ist, und unsere Fähigkeit, Fragen zu stellen, treibt uns dann immer weiter auf dieses Etwas zu, weil wir intuitiv ein Gefühl für den Nutzen und die Gefährlichkeit der uns umgebenden Dinge entwickeln. In anderen Fällen werden wir einfach dadurch schon zu dem letzten und unsagbar höchsten Guten hingeführt, weil wir etwas nicht verstehen und einen Grund dafür verlangen, so wie wir für alles in diesem unergründlichen Universum einen Grund verlangen. (Ich habe diese Erfahrung beim Lesen oft selbst gemacht, zum Beispiel wenn ich mich zusammen mit Dr. Watson über eine Kerze wundere, die in finsterster Nacht mitten in einem Moor brennt, oder wenn ich mich gemeinsam mit meinem Lehrmeister Holmes frage, warum einer von Sir Henry Baskervilles neuen Stiefeln aus dem Hotel Northumberland entwendet wurde.)
Im archetypischen Mythos ist die Suche nach dem Guten immer ein unendlicher Prozess, weil eine vorläufig zufriedenstellende Beantwortung einer Frage immer nur zu der nächsten Frage führt. Und so weiter bis ins Unendliche. Für den Gläubigen sind das Gute und Gott ein und dasselbe. Die Heiligen haben es erreicht, wenn sie nichts mehr begehren. Im Hinduismus, Jainismus, Buddhismus und Sikhismus heißt dieser Zustand moksha oder Nirwana, in dem man »ausgeblasen ist« (wie eine Kerze). Im buddhistischen Kontext ist damit ein Zustand der unerschütterlichen Stille des Geistes gemeint, in dem die Feuer der Leidenschaft, der Abneigung und der Täuschung verloschen sind und ein mit Worten nicht mehr fassbarer Zustand der unendlichen Gelassenheit erreicht wurde. Bei Dante »endet die Reise«, wie es einer der größten Gelehrten des 20. Jahrhunderts, Bruno Nardi, ausgedrückt hat, »in einem Zustand der vollkommenen Ruhe, in dem die Begierde verschwunden ist« und »ein perfekter Gleichklang zwischen menschlichem und göttlichem Willen herrscht«.[42]