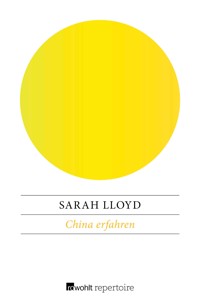9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Indien ist Sarah Lloyd zwei Jahre geblieben. Die Liebe war da im Spiel: zu der Landschaft, den alten Mustern des dörflichen Kunsthandwerks (für die kaum ein Inder mehr einen Blick hat) – und zu Jungli, einem Sikh; Außenseiter auch er in seiner Gruppe. Gemeinsam erproben sie, wie viele kulturelle Barrieren starke Zuneigung überwinden kann – und wo sie schließlich scheitern muß. Sarah Lloyd hat dabei zwei Jahre lang das traditionellste Frauenleben geführt und seine unerwarteten Freiheiten erkundet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sarah Lloyd
Eine indische Liebe
Aus dem Englischen von Karin Petersen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
In Indien ist Sarah Lloyd zwei Jahre geblieben. Die Liebe war da im Spiel: zu der Landschaft, den alten Mustern des dörflichen Kunsthandwerks (für die kaum ein Inder mehr einen Blick hat) – und zu Jungli, einem Sikh; Außenseiter auch er in seiner Gruppe. Gemeinsam erproben sie, wie viele kulturelle Barrieren starke Zuneigung überwinden kann – und wo sie schließlich scheitern muß. Sarah Lloyd hat dabei zwei Jahre lang das traditionellste Frauenleben geführt und seine unerwarteten Freiheiten erkundet.
Über Sarah Lloyd
Sarah Lloyd ist eine Landschaftsarchitektin, die sich seit ihrer englischen Schulzeit nie länger als ein Jahr an einem Ort aufgehalten hat – das Reisen um die Welt ist ihre Leidenschaft.
Sie arbeitet da, wo sie sich gerade aufhält.
Inhaltsübersicht
Für Jungli, der nicht verstehen konnte, worum es geht
«Was schreibst du da jetzt?»
«Über unser Leben hier in der Hütte.»
«Was heißt denn die Stelle da?» (Er zeigt darauf.) «Sie beschreibt, wie du mich mitgenommen hast, damit ich die Schlange vor Sitarams Laden sehen konnte.»
«Wen soll das denn interessieren?»
«Vielleicht gibt es einige Menschen, die das interessiert.»
«Na, dann müssen die nicht ganz dicht im Kopf sein. Ich habe dir schon mal gesagt, daß du nur gutes Papier verschwendest.»
Vorweg
Er saß mit gekreuzten Beinen auf einer braunen Decke. Er hatte ein kraftvolles Gesicht, auf dem sich alles sofort abzeichnete: die hohe Stirn, die lange Nase, der feingeschwungene Mund und die mandelfarbene Haut; aber es war ein Gesicht, von dem Traurigkeit ausging. Auf dem Kopf trug er einen hohen Turm aus blauen Turbanen. Über seiner aquamarinblauen Tunika hatte er eine orangene Stoffbahn um die Taille gebunden, und eine zweite hing über seine linke Schulter. Vor ihm lag ein Schwert.
Ich war drei Tage lang im Zug gereist und hatte Nordindien vom äußersten Westen in Gujerat bis zum östlich gelegenen Kalkutta durchquert. Die Landschaft war nicht sehr aufregend gewesen und meine Reisebegleitung auch nicht. Ich saß eingeklemmt zwischen einem Haufen langweiliger Leute, die alle nörgelten, wie langweilig doch die anderen alle seien. Ein kleines Mädchen fand mich so langweilig (ich las die ganze Zeit in einem Buch über die Geschichte der Sikhs), daß sie mir einen harten Klaps gab, um mich aufzuwecken. Ich gab ihr einen Klaps zurück, und ihr Vater lachte. Danach fielen wir alle zurück in die kollektive Langweile, bis die üppig bewässerte Landschaft Bengalens anzeigte, daß wir uns Kalkutta näherten.
Es war wunderbar, den Zug endlich verlassen zu können und wieder in das vertraute Chaos und das elektrisch geladene Leben der Bazare einzutauchen. Es war schön, von Menschen, die mich aus dem Gurdwara – dem Tempel der Sikhs – kannten, mit einem breiten Lächeln begrüßt zu werden. Und da war Jungli, auf seiner Decke sitzend, mit dem langen schwarzen Bart des zehnten Gurus der Sikhs und den Augen eines Buddhas, die noch den letzten Winkel durchleuchteten.
Jungli war ein Nihang, freiwilliges Mitglied einer lose organisierten religiösen Armee, die von den Sikhs unterhalten wurde, um ihren Glauben zu verteidigen. Die Kleidung, die er trug, die Gesetze, denen er folgte, und die Ideale, nach denen er lebte, hatten sich in den drei Jahrhunderten ihres Bestehens nicht verändert.
Ich durchlief zu dieser Zeit gerade eine Phase von Mildtätigkeit gegenüber den Nihangs. Viele von ihnen waren arm und hatten kein Zuhause; soweit ich wußte, waren sie von der Großzügigkeit anderer abhängig. Obwohl die meisten gewöhnlichen Sikhs ihnen weder Respekt noch Freundlichkeit entgegenbrachten, dachte ich, daß sie darauf eingestellt waren, ihr Leben für die Verteidigung ihres Glaubens zu geben. Ich kaufte Milch, Süßigkeiten und Früchte für Jungli.
Morgens reichte er mir schweigend eine flache Eisenschale; eine der vollkommensten Gegenstände, die ich je gesehen hatte. Ich nahm sie und trank daraus. Der Tee war grau, und er schmeckte nach Eisen und dem Rauch von Holzkohle.
Gurdwaras stehen Menschen aller Glaubensrichtungen offen. Seit mehr als vier Jahrhunderten haben sie ihre Gastfreundschaft umsonst angeboten, haben einfache Schlaf- und Waschmöglichkeiten bereitgestellt und zwei einfache Mahlzeiten pro Tag. Als ich zwei Monate zuvor nachts mit dem Flugzeug in Assam ankam, war dieser Gurdwara der erste, in dem ich wohnte. Ich war über die Howrah-Brücke in die Bazarstraßen gegangen und hatte hin und wieder jemanden gefragt: «Wo ist der Gurdwara?» Verständnislose Blicke. Kein Englisch. «Wo ist der Gurdwara?»
«Entschuldigen Sie, aber ich verstehe Ihr Englisch nicht.»
«Aber das ist doch ein indisches Wort! Gurdwara. Der Sikh-Tempel.»
«Ach so, Sie meinen Gurdwara! Hier gibt es keinen Gurdwara.»
Und wieder: «Wo ist der Gurdwara?»
«Gehen Sie geradeaus weiter. Dann fragen Sie noch mal.»
«Wo ist der Gurdwara?»
«Soweit ich weiß, ist einer in der Nähe des Viktoria-Denkmals beim Krankenhaus. Sie müssen die Straßenbahn nehmen.»
Aber andere Leute meinten wieder, daß er irgendwo im Bazarviertel sein müsse. Ich erwischte einen Sikh-Taxifahrer. Der mußte es doch wissen.
«Wo ist der Gurdwara?»
Schulterzucken. Nicht religiös. Nicht interessiert.
Nach und nach wurde die Spur heißer und die Antworten erfolgversprechender. «Halten Sie sich auf dieser Seite und gehen Sie geradeaus.» Aber ich verfehlte ihn immer noch, weil zur Straße hin nur ein schlichter weißer Türeingang inmitten des belebten Bazars lag, zwischen Läden, Verkaufsständen und Straßenhändlern, und das täuschte, obwohl der Gurdwara tatsächlich ein großes, achtstöckiges Gebäude war. Später lernte ich, den Türeingang zu finden, indem ich mich an eine große Reklametafel für Gwalior-Kleidung hielt, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite prangte. Ich entdeckte später auch, daß es diese Gwalior-Anzeigen überall in Indien gab; das heißt außer in Gwalior, wo etwas anderes in Mode war.
Im Türeingang stand ein Mann mit einem blauen Turban, der einen langen Speer in der Hand hielt. «Gurdwara?» fragte ich, und er zeigte auf ein Treppenhaus. Im ersten Stock war ein großer, völlig leerer Raum, von dem ich annahm, daß er der Arbeitsraum sei, und darüber lag eine Galerie. Im dritten Stock fand ich ein Büro, geschlossen. Ich setzte mich hin und wartete.
«Haben Sie Zimmer frei?» fragte ich, als sich ein magerer Mann, ebenfalls mit blauem Turban, neben mir verkörperte.
Kein Englisch, aber soweit ich verstand, auch keine freien Zimmer. Ich setzte mich wieder hin. Ich hatte den ganzen Morgen damit verbracht, diesen Gurdwara zu suchen. Aber dann erschien ein kleines Mädchen und winkte mir, und ich folgte ihm drei weitere Treppenaufgänge hinauf an einer Schule und einem Eßzimmer vorbei bis in den sechsten Stock.
Das war genau das, was ich mir erhofft hatte: ein großer Gemeinschaftsraum, ringsherum Fenster und davor auf Leinen die Wäsche der Leute. Der Fußboden war mit Pandschab Daris, gewebten Baumwollmatten, ausgelegt. Und das war auch schon alles. Jeder suchte sich seinen Platz und ließ sich darauf nieder, das Gepäck gegen die Wand gestellt. Einige Männer rekelten sich auf den Daris und schwätzten in Gruppen, während andere auf ihren Bettplätzen schnarchten oder ihren Turban neu banden. In einer Ecke schienen eine junge bengalische Mutter und ihre Kinder ihr Camp für immer aufgeschlagen zu haben. Sie kochten gerade ihr Mittagessen.
Als es Abend wurde, kamen immer mehr Menschen herauf. Auch um zehn und elf Uhr nachts kamen immer noch welche. Die meisten von ihnen waren Geschäftsleute mit Aktenkoffern (die sie als Kopfkissen benutzten), die in die Stadt gekommen waren, um etwas zu kaufen oder Kunden zu besuchen. Sie legten sich so hin, wie sie waren, in voller Kleidung, und fegten den Staub von dem Stückchen Dari, das sie sich ausgesucht hatten, indem sie mit ihrem Handtuch darüberwedelten. Der Turban diente ihnen als Polster gegen die harten Kanten ihrer Aktenkoffer; ihre Schuhe stellten sie ordentlich neben ihre Füße.
Das Licht blieb die ganze Nacht lang voll an, und um zwei oder drei Uhr morgens begann die erste, die andächtigste Truppe, aufzustehen. Sie schlurften durch die Halle zu den Waschbecken in der Ecke (von wo plätschernde, singende und gurgelnde Töne drangen) und kamen zähneklappernd zurück, um ihr Morgengebet zu beginnen. Ihr Murmeln und Singen war durchsetzt vom Schnarchen und den Körpergeräuschen der Geschäftsleute und wurde von den Geräuschen der nächsten Schicht am Waschplatz begleitet. Was ich lernen mußte war, daß Inder zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen können und daß Dunkelheit für sie keine besondere Rolle spielt.
Kalkutta ist und bleibt meine indische Lieblingsstadt. Jeden Tag ging ich an den Ufern des Flusses entlang und beobachtete den Sonnenaufgang über dem Howrah-Bahnhof. Jeden Tag kehrte ich durch dieselben dunklen Seitengassen zurück, in denen jeder Türeingang sich zu einem kleinen Hindu-Altar öffnete, märchenhaft beleuchtet von bunten Ketten aus nackten Glühbirnen, mit all den Götterbildern, die in Girlanden aus gelben Dotterblumen und dem blauen Dunst der Räucherstäbchen schwammen. Jeden Tag brachte ich für Jungli und seine Freunde, Inderjit und Bir, kandierte Früchte mit.
Es war ein kalter Januar. Jungli stand jeden Morgen um vier Uhr auf, nahm sein Bad und kam bibbernd zurück, saß in sein Handtuch eingewickelt und rezitierte bis sechs Uhr seine Gebete. Ich las in der Zwischenzeit Tagore oder stand auf dem Dach, acht Stockwerke hoch über der Mahatma-Gandhi-Straße, und beobachtete die Ziegenherden, die durch die dunklen Hohlwege an den zugedeckten Straßenschläfern vorbei zum Ganges runtertrappelten. Nach dem Tee um sechs Uhr halfen wir das Frühstück vorbereiten, saßen im Kreis auf den Daris, pellten Zwiebeln, enthülsten Ingwer und schnitten Kartoffeln klein, wobei wir uns in Zeichensprache und Kindergarten-Hindu unterhielten und über unsere Mißverständnisse lachten.
Jungli, Inderjit und Bir waren über 2500 Kilometer von Amritsar im Pandschab nach Kalkutta gereist und dabei den Spuren von Birs Bruder gefolgt, der ausgerissen war. Er war mit dem Geld seiner Angehörigen weggelaufen und hatte sich auf den Weg gemacht, das schnelle Leben in Bangkok zu genießen. Mehrmals am Tage gingen sie zu seinem Hotel in der Nähe des Howrah-Bahnhofs und versuchten ihn zu überreden, nach Hause zu Inderjits Schwester, seiner Frau, zurückzukehren. Aber Birs Bruder hatte andere Pläne.
Eines Morgens, als wir gerade Gemüse schnitten, bemerkte ich, wie Inderjit etwas aus seiner Tasche zog und es, in kleine Stücke zerteilt, herumreichte. Er gab mir auch ein Stückchen, und ich schluckte es herunter, wie alle es taten. Ich fragte mich, was das wohl sein könnte, und war entschlossen, es herauszufinden. Als ich eine Stunde später in Chowringee die Straßenbahn verließ, begann sich alles um mich herum zu drehen, und ich betrat eine Moschee, um mich flach auf den Boden zu legen.
«Eine weiße Frau, eine Ungläubige, und liegt auf dem Boden der heiligen Moschee! Steh sofort auf! Komm raus da!»
Eine Ungläubige im Opiumrausch. Das war es.
Zurück im Gurdwara, wo die Zimmerdecke über meinem Kopf merkwürdige Tänze aufführte, fütterte Jungli mich mit Orangenspältchen. Unsere unausgesprochene Zuneigung vertiefte sich. Seine Zärtlichkeit rührte mich, seine Einfachheit und seine schönen Augen. Schönheit raubt mir leicht den gesunden Menschenverstand. Ich versuchte, immun dagegen zu bleiben, versuchte, ihn zu meiden. Ich wußte, daß wir die Grenzen der Religion überschritten, der er zugehörte. Und ich war eine Reisende.
Eine andere Sache war das mit den Haaren.
Nachdem ich mein ganzes Leben lang darum gekämpft hatte, daß meine Haare nicht abgeschnitten wurden, hatte ich sehr viel Sympathie für die Tradition der Sikhs, sich die Haare nicht zu schneiden. Und ich stimmte völlig mit ihnen überein, wenn sie auf die provokativen Fragen von Hindus und Moslems: «Warum schneidet ihr eure Haare nicht?», antworteten: «Die Frage ist nicht, warum wir unsere Haare nicht schneiden, sondern warum ihr eure abschneidet.» Die langen Haare waren zum Teil auch der Grund dafür, daß Hindus und Moslems die Sikhs ablehnten. Sie nahmen es ihnen übel, daß sie anders aussehen mußten als die meisten und daß sie ihre langen Haare auch noch stolz trugen (sie führten das auf Arroganz zurück). Sie mochten es nicht, wie direkt und kompromißlos sich die Sikhs bewegten, wie bestimmt sie waren und daß sie es ablehnten, sich unterkriegen zu lassen. Für sie war all das die reinste Aggression.
Dem Haar der Sikhs bekam es nicht so gut, ein ganzes Leben lang im Turban eingesperrt zu sein und nur zum Waschen und Kämmen befreit zu werden. Die meisten Männer hatten nicht sehr viel Haar, aber gelegentlich habe ich auch einen Mann mit langem und dickem Haar gesehen – einen hatte ich vor mehreren Wochen in einer ganzen Gruppe von Hindus auf den Stufen der Badestätten in Benares getroffen. Pilger schwärmten dort herum, tauchten im heiligen Ganges unter, schlugen nasse Saris auf den Steinen aus und liefen ihren wegflitzenden Kindern hinterher. Mitten unter ihnen saß ein Sikh ganz still für sich und kämmte langsam und bedächtig eine Sturzflut von schwarzen Haaren. Die Hindus trugen weiß und rot, rosa und grün, aber der Sikh trug schwarz, schwarze Hosen und ein schwarzes Hemd. Er war ein Daramaraj, ein Gott des Todes, inmitten eines fröhlich plappernden Lebens. Ich war wie gebannt. Ich konnte meine Augen so wenig von ihm lösen wie die verzauberten Seeleute die ihren vom Meermädchen auf dem Stein.
Er kam mit seinem Kämmen zu Ende und löste sich wie ein unwirklicher Schatten in der Menge auf. Ich fragte mich, wie ich jemals wieder ohne ihn leben sollte.
Und nun wieder das gleiche.
Jeden Morgen nach dem gemeinsamen Tee stellte Jungli vor sich auf der Decke einen kleinen Spiegel auf und kämmte sein Haar. Er brauchte eine halbe Stunde dafür. Ich beobachtete ihn heimlich, wie er die fünf Stoffbahnen seines Turbans, die für einen Nihang Pflicht waren, abwickelte, und ich befürchtete, eine geheime, intime Verrichtung zu stören. Er beugte sich vor und band sein Haar auf, das wie ein Wasserfall über den Boden floß. Rot schimmerte in seiner Schwärze, wenn er es beim Kämmen entwirrte, und es glänzte bläulich, wenn es in seiner ganzen Fülle das Licht auffing. Ich tat so, als ob ich in meinem Buch läse. Er rieb es mit Kokosöl ein und kämmte es noch einmal mit langen Strichen vom Nacken abwärts, zwirbelte es zu einem Strang zusammen und band es zu einem doppelten Knoten auf seinem Kopf. Er nahm jedes Stück des Turbanstoffes, zog es entlang einer diagonalen Achse straff und rollte die Bahnen zur Mitte hin auf. Dann hielt er die vorderen Enden zwischen seinen Zähnen fest, ruckte mit dem Kopf wie ein Vogel hin und her, um den wichtigsten Teil im Spiegel sehen zu können, und wickelte die Bahn weich und symmetrisch um seinen Kopf, wobei er die freien Enden nach jeder Umdrehung wie eine schlaffe Riesenschlange entrollte.
An meinem fünften Tag in Kalkutta nahmen mich Jungli, Inderjit und Bir mit auf eine Besichtigungstour. Wir nahmen die Straßenbahn durch Kalkutta bis Kalighat und spazierten durch enge, schmutzige Gassen zu Kali Mandir, einem großen Hindu-Tempel zu Ehren der Göttin Kali errichtet. Ich sah, wie viele Ziegen herumliefen, bemerkte Blut auf dem Fußboden und wollte wieder raus aus dem Tempel. Aber die anderen sahen interessiert zu. Als ich den Hieb einer Axt hörte und das dumpfe Aufschlagen eines Ziegenkopfes auf dem Boden, ging ich ohne die anderen weg.
«Warum sprechen die Hindus das eine Tier heilig und köpfen das andere?» Ich versuchte, sie danach zu fragen, als sie mich wieder einholten, aber mein Hindi reichte dafür nicht aus, und sie verstanden nichts. Ich sprach kein Pandschabi, und Jungli konnte kein Wort Englisch.
«Reg dich nicht auf», war in etwa, was sie sagten, als sie bemerkten, daß ich aus irgendeinem Grund die Sache mit den Ziegen nicht gutheißen konnte. «Wir gehen jetzt weiter und schauen uns etwas anderes an.»
Wir gingen die Straße entlang und stießen auf ein sehr häßliches modernes Gebäude. Es sah aus wie ein Krematorium. «Was ist das?» fragte ich. Ich verstand zwei Worte aus ihrer Antwort: «Elektrisches Programm.» Es war ein Krematorium.
Hindus und Sikhs verbrennen ihre Toten auf großen offenen Reisigfeuern. Krematorien sind eine Neuerung in Indien, und es gibt sie nun, wenn auch nicht allgemein gebilligt, in den Städten, wo es an Feuerholz mangelt. Wir haben Glück, sagten sie, gerade findet eine Totenzeremonie statt. Ein altersschwacher Körper, spärlich mit einem Tuch bedeckt, wurde von den schluchzenden Anverwandten, deren Leid schlimmer anzusehen war als der Anblick des toten Körpers, mit Ghee (flüssiger Butter) gewaschen und mit Sandelholz besprenkelt. Jungli und Bir hatten schon früher Krematorien gesehen und blieben hinter uns stehen, während Inderjit und ich in der ersten Reihe unter den Verwandten standen und mit einer morbiden Faszination zusahen.
Sie hatten eine merkwürdige Auffassung von Besichtigungstouren, die drei.
Am Ende der Woche wurde es Zeit für mich weiterzureisen, ich war bereits zu lange geblieben. Jungli, Inderjit und Bir gaben sich geschlagen und wollten nach Amritsar zurückkehren, ich wollte den Zug nach Bangladesh nehmen. Wir gingen zur Straße runter und eilten zum Hotel, um eine letzte Attacke auf Birs widerspenstigen Bruder zu starten. Inderjit und Bir gingen vor uns. Mitten im Gewühl auf der Howrah-Brücke, wo die Straßenbahnen quietschten, Marktbuden knarrten, Karrenfahrer fluchten, Rikscha-Fahrer sich zubrüllten, Motoren knatterten, Bettler jammerten, Hupen tröteten, Räder ratterten und Füße trappelten, sagte Jungli: «Ich liebe dich.» Ich sah ihn an. Ich hatte gar nicht gewußt, daß er überhaupt Englisch konnte. Die Worte klangen unwirklich. Dann verschluckte ihn die Menge.
Am nächsten Morgen begleitete er mich zum Saldah-Bahnhof.
«Wann kommst du nach Amritsar?» fragte er mich wieder und wieder, während wir auf meinen Zug warteten. Er hatte genug Zeit dazu, denn wir warteten auf dem falschen Bahnsteig.
«Vielleicht in einem Monat», sagte ich zögernd. Wenn ich reise, folge ich keiner festgelegten Route, und es fiel mir schwer, solche Fragen zu beantworten. Ich sagte ihm, er solle Gott lieben und mich vergessen, denn ebenso wie ich Kalkutta verließ, würde ich eines Tages auch Amritsar verlassen. Gott dagegen reise nie ab.
Als mein Zug schließlich abfuhr, berührten wir uns nicht einmal mit den Händen. Ich schaute ihm nach, wie er da auf dem langsam sich entfernenden Bahnsteig stand, eine einsame Figur in Blau, die ein Schwert in der Hand hielt, verschwindend klein unter dem riesigen viktorianischen Hallendach des Saldah-Bahnhofs. Zwei Stunden später erreichte ich Bangladesh.
Erster Teil Das Dorf
1 Ankunft
Mitte März kam ich nach Amritsar. Schon eine Stunde vor der Ankunft des Zuges um fünf Uhr morgens war ich aufgestanden und bereit zum Aussteigen, und dann nahm ich gleich eine Rikscha durch die dunklen, verschlafenen Straßen zum Goldenen Tempel, statt wie sonst die Morgendämmerung abzuwarten. Ich zog die Schuhe aus und ging die Stufen hinunter. Der Tempel schimmerte hell inmitten eines dunklen Wassertanks. Ich spazierte herum, während die Morgendämmerung ihr rosa Licht über die Dächer goß. Über allem lag eine Stimmung von überwältigender Friedlichkeit.
Die nächsten zwei Tage machte ich mir den Rhythmus des Goldenen Tempels zu eigen und schlief auf dem Dach eines der Nachbarhäuser. Auf die religiöse Stille des frühen Morgens folgte das lebhafte Treiben eines buntgemischten Völkchens von Sikhs – umherziehende Nihangs, bäuerliche Pilger und elegante Paraden von angesehenen Städtern, Scharen von aufgeputzten Dorfmädchen im Sonntagsgefieder. Der Goldene Tempel war eine Arena, die Menschen betraten, um gesehen und bewundert zu werden. Seine schwarzweißen Marmorgänge und kühl überdachten Bogengänge, seine märchenhaften goldenen Spiegelungen auf dem grünbraunen Wasser und seine Weitläufigkeit verlieh den Besuchern für kurze Zeit den Schein von Eleganz und großer Welt.
Unter den Spaziergängern waren Andächtige, die täglich kamen und das Wasser säumten, um ein heilendes Bad zu nehmen, die anderen Pilgern den Staub von den Füßen wischten und ihnen die Stirn mit heiligem Balsam bestrichen, die sich am Eingang zum Heiligsten unter golden gewölbten Kuppeln verbeugten und dem heiligen Granth, der heiligen Schrift der Sikhs, ihre Ehrfurcht und Untergebung bekundeten. Sie saßen und lauschten den Hymnen ihrer Gurus, sangen zu den Klängen der alten Ragas, die ruhigen Gesichter nach oben gewendet.
Plötzlich durchfuhr es mich: Ich mußte Jungli finden. Ganz gleich, wie spät es war – es war später Nachmittag und eigentlich nicht die Zeit, um sich auf die Suche nach einer ungenauen und abgelegenen Adresse zu machen, die mit Kinderschrift auf ein altes Stück Papier geschrieben worden war:
Nam Pritam Singh Nam des Vaters Beant Singh Amarkot Distrikt Amritsar
Hatte er nicht erzählt, daß zehntausend Menschen in seinem Dorf wohnten? Und sicher hießen sie alle mit Nachnamen Singh.
Während ich in einem ratternden, heißen Blechbus aus Amritsar herausfuhr, fragte ich mich träge, wenn auch nicht sehr ernsthaft und lange, wie all meine Unternehmungen wohl ausgehen mochten. Ich hatte keine bestimmten Pläne. Mein Leben war bisher immer so verlaufen – die Zukunft eine prächtige Leere voller Raum und Möglichkeiten, nicht länger voraussehbar als für die nächsten vierzehn Tage. Arbeit und Orte und Freundschaften spielten sich in begrenzten Zeitabschnitten ab, begannen und endeten sauber abgegrenzt und mehr oder weniger unabhängig voneinander. Der Hauptstrang meines Lebens hatte bisher aus Teilzeitunterricht an drei verschiedenen Londoner Hochschulen bestanden, aus Mitarbeit in einem halben Dutzend verschiedener Kommitees, aus der Redaktionsarbeit für meine professionelle Zeitschrift, aus der Neuanlage von Teilen eines alten Parks und Auseinandersetzungen mit den örtlichen Behörden; sehr viel Arbeit, sehr viel Spaß, aber keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Während ich in Junglis Dorf fuhr, begann und endete meine Gegenwart mit der Gesellschaft einiger verwahrloster Sikhs im Bus und der flachen grünen Landschaft mit unreifen Weizenfeldern und niedrigen Lehmhäusern, die draußen vor den Fensterscheiben vorbeischlingerte; Orte und Realitäten, die von meinem alten Londoner Leben äonenweit entfernt waren. Meine Zukunft enthielt Pakistan – vielleicht – und Kaschmir – wahrscheinlich – und einen Ort, der kilometer- und tageweit von allem entfernt hoch und abgelegen in den Bergen lag, Leh genannt. Jungli kam darin nicht vor.
In einer kleinen Stadt, die um eine Kreuzung herumgebaut war, stieg ich aus und nahm mir für die letzten fünfzehn Kilometer eine Tonga, eine kleine Ponykutsche. Ein halbes Dutzend älterer Männer in weißen, gewebten Lungis kletterten mit mir auf den Wagen. Einer von ihnen hatte einen Kassettenrecorder und spielte die alten Sikh-Weisen. Während wir langsam durch die üppig grüne Landschaft trappelten, begleitet von der Musik der alten, feierlichen Ragas, und eine honigfarbene Sonne am Horizont tropfte, überschwemmte mich eine Welle von Euphorie, wie ein unbewußtes Wiedererkennen, das alles, was mir auf dieser kleinen Reise begegnete, meinen früheren Vorstellungen vom indischen Flachland entsprach.
Vier Jahre später erinnerte ich mich bewußt. Irgend etwas rührte die Erinnerung auf, die damals meine Euphorie ausgelöst hatte, und schließlich wurde mir klar, was mich nach Indien hatte fahren lassen. Es war ein Bild, die flüchtige Einstellung in einem Dokumentarfilm. Das Bild einer großen weißgekleideten Gestalt, die eine Straße entlangging. Vielleicht ein Sadhu, ein Asket; ein Mann mit sehnsüchtigen Augen. Eine schnurgerade Landstraße in einer flachen grünen Landschaft. Füße, die den Staub aufwirbelten. Musik, die Melancholie verströmte; kein Ziel. Ich war nach Indien gefahren, um dieses Bild einzuholen.
Und das hier war Indien! Und das Dorf, das ich nach einer weiteren Stunde erreichte, war auch Indien, bot mir den ersten Eindruck des ländlichen Lebens im wirklichen Indien, um dessentwillen ich meine Reise angetreten hatte. Doch im Augenblick hatte ich gar keinen Blick dafür. Ich wollte nur Jungli sehen.
Aber er war nicht zu Hause. Seine Familie war da: Mataji, seine Mutter, und Pitaji, sein Vater, und viele andere Menschen, die aus den Nachbarhäusern zusammenliefen. Wo war er? Vielleicht bei Inderjit in Amritsar, sagten sie mir (jemand, der Englisch sprach und vom Ende der kleinen Gasse geholt wurde, übersetzte). Aber da solltest du nicht hingehen. Übernachte hier, und Pitaji wird ihn morgen früh suchen gehen.
Mataji zündete ein Feuer an und setzte Teewasser auf. Ich war umgeben von Menschen. Ich wußte nur, daß ich Jungli finden mußte.
Ich konnte einfach nicht bleiben. Ich kehrte an die Straße zurück und brachte das erste Fahrzeug zum Anhalten, das vorbeikam. Es war ein Motorroller. Ich hievte mich seitwärts auf den Rücksitz, hielt meine Tasche zwischen den Zähnen fest und klammerte mich mit beiden Händen an den Reservereifen. Mein Verhalten war unverzeihlich, und ich fand mich ziemlich undankbar.
An der großen Kreuzung hielt ich einen Lkw nach Amritsar an, immer noch viel zu ungeduldig, um auf die Busse zu warten. Dann nahm ich eine Rikscha zum Bahnhof, wo ich nach einer weiteren suchte, die mich zu Inderjit bringen sollte, der draußen vor der Stadt in einem kleinen Gurdwara in den Feldern wohnte. Inzwischen war es schon dunkel geworden, und keiner der Rikscha-Wallahs war von meinem Vorhaben begeistert. Sie wüßten gar nicht, wo das ist, sagten sie, aber auf jeden Fall sei es gefährlich da draußen. Es war eine lange Strecke auf unbeleuchteten Straßen, und wir könnten überfallen werden. Der Rikscha-Wallah, der mich schließlich fuhr, bestand darauf, daß zur Sicherheit sein Kollege in einer leeren Rikscha mitfuhr, und ich mußte sie beide bezahlen; eine einmalige Luxusausgabe.
Kilometerweit fuhren wir auf Straßen, die von pechschwarzen Bäumen gesäumt wurden, und es wurde spät. Meine Fahrer hatten wirklich Angst. Es kam ihnen verrückt vor, immer weiter zu fahren, während alle Welt zu Bett ging, aber ich genoß die Fahrt. Wir bogen ab und holperten auf einem ausgefahrenen Karrenweg über die Felder, dann stieg ich aus und ging zu Fuß weiter. Nicht der Schimmer eines Lichts. Ziemlich verrückt. Aber schließlich wurde hinter einigen Bäumen ein kleiner Gurdwara sichtbar, wie ein Turm gebaut. Eine Gruppe von Menschen saß um ein Feuer, und einer von ihnen kam auf mich zu, ein großer junger Mann in orangefarbener Tunika, mit einem hübschen Gesicht und einem lose fallenden Bart. «Sarah Lloyd?» forschte er. Und ich wußte, daß alles in Ordnung war.
Der Mann, der mich begrüßt hatte, war Inderjits Bruder. Weder Jungli noch Inderjit und Bir waren hier. Ich konnte nicht herausfinden, wo sie eigentlich waren, aber ich hatte alles getan, was ich tun konnte, und es war an der Zeit, daß ich mich zufriedengab. Wir saßen im Feuerschein und tranken heiße Milch. Ich hatte das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein.
Aber ich konnte nicht schlafen. Ich teilte den Raum, der mir zugewiesen worden war, mit Inderjits Frau und seiner Schwester. Er war hell erleuchtet und stank nach Ungeziefer. Horden von Moskitos schwirrten herum, und mein Bettzeug war feucht. Ratten jagten sich auf den Bodenbrettern, stießen scheppernd an Becher und warfen Teller herunter. Ich ging raus und beobachtete die Morgendämmerung, ein schmuddeliges Orange über den flachen, mistgedüngten Feldern, gerahmt von einem Wäldchen aus großen, ulmenähnlichen Shisham-Bäumen. In dem stillen, dunklen Gurdwara rezitierte Inderjits Bruder seine Morgengebete. Halb singend, halb sprechend hallte seine Stimme von den leeren Wänden wider, als sei sie nicht von dieser Welt. Der Klang gehörte zu unbegrenzten Lüften und weiten Räumen, rein und schwerelos.
Als die Sonne aufging, kam Bir und brachte mich über die Felder zu seiner Familie, einer Familie von Brüdern und noch mehr Brüdern und ihren unzähligen Frauen und Kindern, in einer Umgebung, die sie mit Kühen und Hühnern, Büffeln und Strohschobern teilten. Alle waren beschäftigt mit Melken, Kochen oder dem Bauen von Lehmwänden. Dahinter lagen Klee- und Weizenfelder.
Dann kam Inderjit mit dem Fahrrad über das flache Land geflogen, das er in einem Warenhaus in Amritsar neu gekauft hatte (wie ich später erfuhr). Er und Bir spannten mich für eine lange Tagestour durch die Gurdwaras und die Ersatztteillager der Stadt ein. Alles schön und gut, aber wo war Jungli? Ich kehrte in das Haus zurück, auf dessen Dach ich geschlafen hatte, und sagte zu Inderjit, daß ich morgen wiederkommen würde. Vielleicht hatte ihn bis dahin jemand gefunden.
Am nächsten Tag wurde ich von einem Tabla-Spieler zum Essen eingeladen, der vergleichende Studien zu Christentum und Sikhismus betrieb. Ich ging mit, um mit ihm darüber zu sprechen. Aber er wollte gar nicht darüber reden, o nein, er wollte mich heiraten und all das übliche alte Gerümpel. Ich flüchtete mich zum Goldenen Tempel und spazierte um den Wassertank herum, als plötzlich Jungli neben mir stand und mich mit Worten überschüttete, von denen ich nur die Hälfte verstand. «Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Ich suche dich schon seit zwei Tagen. Zwei ganze Tage! Ich bin ins Dorf gefahren und wieder nach Amritsar zurück, raus zu Inderjit, wieder nach Amritsar, noch mal ins Dorf und zurück nach Amritsar. Zwei Tage habe ich nach dir gesucht! Wo warst du denn bloß?» Soviel konnte ich verstehen. Ich lächelte. Die Art, wie es ihm nach sieben Wochen gar nicht einfiel, mich zu begrüßen, gefiel mir. Es war gut, ihn endlich zu sehen.
Den Rest des Tages verbrachten wir damit, Tee zu trinken, mein Gepäck zu holen und in dem Haus zwischen den Spinnereien herumzusitzen, wo Jungli gewohnt hatte, ein ländliches Haus mit einem Garten und zwei Schuppen, die sich diagonal gegenüberstanden. Zwei Schwestern schliefen in dem einen Schuppen, ihr Bruder, Jungli und ich im anderen. Durch die Hälfte unseres Schuppens sah man den offenen Himmel, und ein unverputztes Rohr lief an einer Wand entlang. Am Morgen machte Jungli mit mir eine Besichtigungstour. Ich hatte ein paar Worte Pandschabi gelernt, aber nicht genug, um verstehen zu können, wohin wir wollten. Doch trotz der fehlenden Worte unterhielten wir uns den ganzen Tag lang. Die Sprache war kein Problem; ohne die Worte verstehen zu können, tauschten wir uns aus.
Wir nahmen einen Bus, der aus Amritsar rausfuhr, und setzten beim Aussteigen unsere Füße auf grüne, duftende Feldwege. Die schmalen Grasränder und Bewässerungsgräben waren übersät mit Blumen und sahen aus wie ein flämischer Wandteppich voll englischer Wildblumen: Malven, Honigklee, Wolfsmilch und Taubnessel, Knöterich und Disteln, fette Henne, Klee und Wicken und mannigblättrige Butterblumen. Und der Himmel war voller Vögel: Lerchen und Tümmler-Tauben, indische Kuckucke und Bienenspechte und Wolken von Staren. Ich traute meinen Augen kaum – welche Frische und Schönheit und Stille nach Wochen inmitten von Menschenmengen, Staub und Krankheiten und dem Kampf um Zugplätze. Nichts hätte ich jetzt mehr genießen können. Wir wurden auf Traktoren mitgenommen, badeten in den heiligen Wassertanks der Gurdwaras, die wir besuchten, und saßen in Gärten voller Kornblumen und Dotterblumen. Das heilige Blau und Orange der Sikhs, die Farben von Junglis Kleidern.
Der letzte Gurdwara lag in der Nähe von Junglis Dorf. Diesmal war ich wach genug, um meine Umgebung genau zu betrachten und mir anzuschauen, wo ich hinging.
Die Landschaft, die wir auf dem Weg zum Dorf durchquerten, erinnerte mich an die flacheren Landstriche in Südengland, wo einige Heckenbüsche überlebt hatten, die Hecken selbst aber verschwunden waren. Es war eine Landschaft ohne Unterschlüpfe, dem Horizont zu geöffnet, nur in kleinen Details wechselnd und nicht durch Grenzmarkierungen zerstückelt. Wir kamen durch Dörfer, die aus Lehm gebaut waren. Von der Straße abgerückt, präsentierten sie dem vorbeifahrenden Verkehr niedrige weiße Mauern, wie um sich anzubieten, während die dahinterliegenden Felder wie Zufluchtsstätten waren. Als ich vor mehreren Monaten nach Delhi gekommen war, war ich über eine ähnliche Landschaft geflogen, deren Dörfer, fast kreisförmig, wie die krustigen Flechten auf der Rinde eines glattstämmigen Baumes das cremeweiße und grüne Flickwerk der Felder regelmäßig durchsetzten. Es sah aus, als wäre ein Schachbrett mit dem Hammer auseinandergeschlagen und leicht durchgemischt worden, wobei die Ecken und unregelmäßigen Stückchen der mattweißen und grünen Vierecke durcheinandergeraten waren.
Dann erkannte ich weit hinten den Umriß von Junglis Dorf. Eng zusammengedrängt auf einem kleinen Hügel, wurde es von den fortlaufenden Ringen der Häuser geformt, zu Ruinen zerfallen und sich auf dem Schutt des alten Dorfes wieder aufbauend, schaute es über das flache Ackerland, von dem die Existenz der meisten seiner Bewohner noch immer abhängig war. Aus der Entfernung – wie wir es jetzt sahen – und vor allem mit der auf- oder untergehenden Sonne im Rücken, wirkte es wie ein kubistisches Gemälde oder wie eine Festung, aus Steinblöcken gebaut. Dieser Effekt wurde verstärkt durch das abrupte Abbrechen der Felder und das enge Zusammenstehen der zwei- oder dreistöckigen Häuser aus gebrannten Ziegelsteinen auf der Spitze des Hügels und durch die einstöckigen Lehmhäuser, die in einem flach geweiteten Ring um die Ecken liefen. Wenige Bäume durchbrachen die Silhouette der treppenförmigen Dächer, und es gab keinerlei Anzeichen für das Netzwerk aus Gäßchen, die im Dorf selbst die kleinen, halböffentlichen Plätze verbanden.
Wir verließen unsere Tonga in einiger Entfernung vom Dorf (die Straße lief um das Dorf herum, vom Ort durch einen breiten Streifen bebautes Ackerland getrennt) neben einer weiten Fläche Ödland. Mehrere holprige Wege liefen in das Dorf hinein und um es herum, teilten sich in ein Nebensystem von engen Gassen, die durch Mauern aus Lehm begrenzt wurden. Sie liefen im Zickzack zwischen den angrenzenden Hausgrundstücken hin und her und mündeten im Dorfzentrum.
Hier lebten die oberen, die landbesitzenden Kasten. Hier um die Ecke lebte auch Mataji. Sie erwartete uns. Vor ihr lagen Zwiebeln, grüner Ingwer und dreißig oder vierzig Knoblauchzehen, eine Pfanne mit Wasser, ein Teighügel, ein rundes Brett und eine Nudelrolle. Reisig und getrocknete Kuhfladen steckten hinter ihrem Herd. Mataji war eine gute Köchin, wie ich entdecken sollte, besser als die meisten anderen. Sie hatte ein natürliches Gespür für das Ausbalancieren von Gewürzen und sparte nicht an Zutaten. Mataji verwendete nicht scharfen roten Chili anstelle der milden, aromatischen Mischung aus Kumin, Koriander, Pfeffer und schwarzem Kardamon, auf Säcken getrocknet und im Mörser zerstoßen, womit sie die Eier und das Linsengericht Dal – das beste Dal, das ich je gegessen hatte – würzte, die wir an diesem Abend aßen.
Wir aßen beim Licht einer Paraffinlampe und schliefen in einem Zimmer am Ende des Gartens. Jungli hatte bestimmt, daß wir dort schlafen würden, und niemand hatte ihm widersprochen. Er schlief am einen Ende des Zimmers, ich am anderen. Mataji und Pitaji schliefen im Garten. Moskitos sirrten, die Blätter raschelten im Wind, und der Mond schien durch die offene Tür.
Ich kann mich nicht daran erinnern, Junglis Haus wie eine Fremde betreten zu haben. Vielleicht, weil ich niemals wie eine behandelt wurde, sondern man ging davon aus, daß ich das Leben im Dorf gewohnt sei. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, daß ich mir selbst die Zeit vertreiben konnte, was ich nach all dem Getue und Geschnatter sehr genoß, bei dem jeder sich ein Bein ausriß, Familienalben herbeischleppte und in das Imponiergehabe verfiel, das ich von den städtischen Indern der Mittelschicht gewohnt war. Vielleicht auch, weil ich das Wohnen in ländlichen Häusern der Dritten Welt von Aufenthalten in anderen Ländern kannte. Aber vielleicht auch, weil der Baustil in diesem Teil Indiens so menschlich war, so heimelig, geradezu wie nach den Grundsätzen von Rudolf Steiner, mit kaum einer einzigen geraden Linie und keiner störenden scharfen Ecke in der Unregelmäßigkeit der Lehmwände. Und vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, daß ich in Junglis Haus war, und mit meiner Überzeugung, daß mich etwas mit Jungli verband. Und vielleicht – was am wahrscheinlichsten war – verdankte ich es den Umständen meiner Ankunft, der ersten Ankunft, als ich das Haus vor lauter Menschen nicht sehen konnte, mich nicht lange genug aufhielt, um alles betrachten zu können, und nur darauf aus war, Jungli zu finden, und der zweiten, als es bereits zu dunkel war, um etwas sehen zu können.
Als ich also am dritten Morgen in einem Haus erwachte, das ich nie zuvor gesehen hatte, war ich keine Fremde mehr. Ich fühlte mich zu Hause und mit der Welt in Frieden. Jungli und ich brachen im Morgengrauen zu einem langen Spaziergang durch die blassen, taunassen Felder auf und balancierten auf den schmalen Erdwällen, die die Anbauflächen voneinander abgrenzten. Die Menschen waren schon bei der Arbeit, führten ihr Pflüge, fluchten mit ihren Ochsen herum und hockten auf den Pflugbäumen, die die schwere Erde zermalmten und den Boden in feines Ackerland verwandelten. Alles war vollkommen – der klare, frühe Morgen, der Duft des feuchten Weizens, die Blumen am Wegrand, und der Himmel war gesprenkelt mit Vögeln: blaue Vögel, grüne Vögel, schwarze Vögel, weiße Vögel, Bülbüls, Wiedehopfe, so viele verschiedene Vögel. Wir waren glücklich in all dem Neuen, Frischen, glücklich auf eine einfache, ungezwungene, kompromißlose Art, wie wir es nie wieder erleben sollten.
Da ich die indischen Traditionen respektierte, achtete ich darauf, jeden Körperkontakt mit Jungli zu vermeiden und tat auch nichts, um ihn zu provozieren. Zugleich war aber schon in diesen ersten Tagen etwas Ausschließliches in unserer Freundschaft, wie es sonst nur in sehr viel länger andauernden Freundschaften zu finden ist. Junglis Gefühle hatten eine solche Kraft, daß sie mich ganz subtil und unsichtbar forderten. Er schien nicht daran zu zweifeln, daß sie mit gleicher Stärke erwidert wurden, als ob die Liebe ganz automatisch in dem Menschen, dem seine Zuneigung galt, eine entsprechende Antwort finden müsse. Ich fühlte mich sehr zu Jungli hingezogen, aber während seine Gefühle blind und grenzenlos waren, konnte ich meine Gefühle für ihn mit Vernunft betrachten. Und sie waren begrenzt. Jungli zog mich an, weil er anders war als alle, die ich bis jetzt gekannt hatte. Ich wurde angelockt durch die Kultur, in die er hineingeboren worden war, und die Bewegung der Nihangs, zu der er gehörte. Ich war interessiert an den Sikhs und ihrem Glauben. Junglis Zärtlichkeit rührte mich, seine Einfachheit, seine religiöse Hingabe, seine Direktheit und die Traurigkeit in seinen Augen. Das war alles, was ich von ihm wußte. Und zu diesem Zeitpunkt war das auch genug. Ich analysierte nicht weiter, was mit mir geschah, ich ließ es einfach geschehen.
Nach einer Woche, in der wir jeden Tag vierundzwanzig Stunden lang zusammen waren, wurde unsere Beziehung körperlich. Es war unvermeidbar. Ich hatte versucht, dem vorzubeugen, denn neben allen anderen Umständen verbot vor allem Junglis Religion Sexualität außerhalb der Ehe. «Du bist getauft worden», ermahnte ich ihn in meinem stockenden, grammatisch falschen Pandschabi. «Es geht nicht.» Ich respektierte den Glauben der Sikhs und ihren Moralkodex, der vorsieht, daß man Frauen wie Schwestern behandelt. «Ach, auf eine oder zwei kommt es nicht an», antwortete er leichthin.
Seine Leichtherzigkeit täuschte. Als er meinen Arm berührte, schüchtern und etwas hölzern, als sei ich eine Göttin oder noch etwas Höheres, wußte ich, daß es das erste Mal in seinem Leben war. Ich war einunddreißig, und er war etwa so alt wie ich.
2 Wohnen
Den ersten Hinweis darauf, daß ich nach Hause kommen würde, hatte ich bei meinem Abflug vom Flughafen Heathrow erhalten, wo ich in eine Gruppe von Indern geraten war. Der sofortige Effekt: Ich lächelte und entspannte mich. Das hätte mir in englischer Gesellschaft niemals passieren können; im Gegenteil, ich kann in eine Gaststätte, ein Restaurant oder einen Supermarkt gehen und mich überwältigend einsam fühlen wie eine Ausländerin.
Eine Handvoll Filme waren meine Einführung für Indien. Ich kannte keine Inder, ich hatte nichts gelesen. Wenn man ein Land mit einem Minimum an Voreinstellungen betritt, heißt das, daß man es nur mittels der eigenen Erfahrungen erforscht.
Es war kein reiner Zufall, daß ich dann in einer Sikh-Gemeinde lebte. Schon wenige Tage nach meiner Ankunft in Indien fühlte ich mich zu den Sikhs hingezogen; überall wo ich war, suchte ich ihre Gesellschaft, und immer wenn ich in Schwierigkeiten war, waren sie es, die mir heraushalfen. Sie ließen mich nur selten im Stich. Sie waren männlich in einem Land, dessen Männer zur Verweiblichung neigten, sie waren stolz und würdig, furchtlos und bestimmt, mitfühlend und warmherzig, abenteuerlich und unternehmungslustig, selbstsicher und anpassungsfähig: All das, was ich mochte und bewunderte und selbst gern sein wollte. Jungli verkörperte mehr oder weniger all das, er war der Archetyp eines Sikhs. Ich lernte ihn in- und auswendig kennen, seinen Charakter, seine Stimmungen, seine Gedanken. Er war die Seele meines Indiens.
Jungli war nicht sein richtiger Name. Innerhalb der Familien riefen die Menschen sich gegenseitig bei liebevollen Spitznamen; nicht unbedingt kürzere Namen, aber weniger förmlich in der Bedeutung. Junglis Name war Pahari, was soviel heißt wie «der Mann auf dem Hügel». Aber das war der Name, den Mataji ihm gab. Ich kümmerte mich nicht um seinen richtigen Namen, Pritam («Warum nicht?» fragte er gekränkt. «Das solltest du aber, er bedeutet ‹Geliebter›»), und da es für mich unschicklich war, ihn so zu nennen, führte ich einen neuen Spitznamen ein: Jungli. Unkompliziert, harmlos. Das meinte ich als Kompliment.
Mataji war eine ehrfurchtgebietende Frau. So sehr ich sie auch achtete, ihre Aufrichtigkeit, ihren Fleiß und ihren hohen Standard, was Sauberkeit und moralisches Verhalten betraf, versuchte ich doch bald, ihr möglichst aus dem Weg zu gehen. Sie hatte eine grobe, bevormundende Art, mit einem zu sprechen, und die Angewohnheit, andere zu verletzen. Weil sie dachte, es würde mir helfen zu verstehen, was sie mir sagte, schrie sie, wie manche Leute ihre Stimme erheben, wenn sie mit Blinden sprechen, und meine Angst, nichts zu verstehen, ließ mich immer nur begriffsstutziger werden, auch wenn derselbe unverständliche Satz dann noch einmal lauter geschrien wurde. Jungli erklärte mir dann in einer einfacheren Sprache, was sie meinte. Bei meiner Kommunikation mit Mataji während der Monate, die ich im Dorf lebte, schaltete Jungli sich fast immer als Dolmetscher ein.
Pitaji verärgerte niemals einen Menschen. Er war ein taktvoller und toleranter Mann Anfang siebzig, dessen Gegenwart nichts von einem forderte. Die Dinge, die er zu tun hatte, erledigte er still für sich und gab dabei zu verstehen, daß jeder die Freiheit hatte, sein Leben auf seine Art zu gestalten und zu leben. Ich mochte und respektierte ihn.
Jungli sprach selten mit Pitaji. Sie schien nichts gemein zu haben. Pitaji war groß und dünn, hatte strähniges weißes Haar und ein angenehmes, wenn auch nicht bemerkenswertes Gesicht. Vom Temperament her waren er und Jungli genau entgegengesetzt, und ich staunte über ihre Unterschiedlichkeit. Pitaji war ein scheuer Mann, und er sprach nicht mit mir. Ich glaube, er hätte auch gar nicht gewußt, was er zu mir sagen sollte. Ich wandte mich auch nicht an ihn.
Die ersten paar Tage war es schwierig für mich zu verstehen, was eigentlich vor sich ging. Ich stellte mir die Fragen selbst – nach meiner Anwesenheit im Haus, meinem Status als Junglis Freundin, den ziemlich seltsamen Beziehungen zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern, dem Verhalten, das sie von mir erwarteten –, aber ich mußte mich damit abfinden, keine Antwort zu finden. Mein Pandschabi war nicht gut genug, um solche Themen mit Jungli besprechen zu können, und in der Familie sprach niemand auch nur etwas Englisch. Aber es schien auch nicht so wichtig zu sein. Jungli hatte eine unendliche Geduld, mir Dinge wieder und wieder und dann noch einmal auf andere Art zu erklären, bis ich verstand, worum es ging.
Bevor ich in das Dorf gekommen war, hatte ich ein Buch erworben, einen ‹Einführungskurs in das gesprochene Pandschabi›, aus dem ich einige wesentliche Wörter und Sätze gelernt hatte. Zuerst schien die Pandschab-Sprache ziemlich einfach zu sein, mit vielen Wörtern, die dem Hindi ähnelten und einer simpleren Schreibweise. Aber ich mußte meine Meinung bald ändern. Unter den Kapitelüberschriften waren solche wie «Spezifizierung und Aufzählung», «Wechselbeziehungen und Wiedererkennen», «Verdopplung vergangener Ereignisse», und «Unvermögen und Andeutung». Das Alphabet enthielt vier n, vier d und vier t. Eines der d klang wie ein t, wenn es zu Beginn eines Wortes stand, wodurch es lästigerweise fünf d wurden. Die Wörter für die Zahlen ließen in ihrer Reihenfolge keinerlei logisches System erkennen und waren von eins bis hundert alle verschieden. Eine Wort-für-Wort-Übersetzung funktionierte einfach nicht. Abgesehen von verschiedenen Wörterbüchern, die widersprüchliche Bedeutungen für ein Wort angaben, konnte ein einziger Pandschab-Ausdruck auf englisch mehrere Bedeutungen haben und umgekehrt auch. Das Pandschab-Wort ‹bahut› konnte benutzt werden, um ‹sehr›, ‹viel›, ‹zu viel› oder ‹gerade genug› auszudrücken; andrerseits hatte die Sprache aber wieder ganz spezielle Begriffe für ‹die Frau des jüngeren Bruders des Vaters des Ehemanns›, ‹die Teile der Mohrrübe, wo sich die Wurzeln und die Blätter bilden› und ‹das dicke Ende eines Stocks›; die wollten alle gelernt sein.
Nach und nach lernte ich sie auch, aber meine ersten Erfahrungen im Haus und im Dorf bestanden vor allem aus sinnlichen Eindrücken. Ich schaute, roch, berührte, lauschte, aber ich lebte in meiner eigenen Welt.
Mataji und Pitaji wohnten in einem kleinen Lehmhaus. Der Hof sah aus wie eine überbevölkerte Ausgabe des Londoner Zoos für Kinder: außer der Familie hausten darin drei stramme Büffel, eine Kuh, ein Kalb, zwei Hunde, ein Huhn, ein Zwerghahn und ein Esel. Die Kuh und ihr Kälbchen gemahnten mich immer an einen Fehler, den ich begangen hatte: Ich hatte ganz unbedacht erzählt, daß die Menschen in England keine Büffelmilch trinken würden, und bald nach meiner Ankunft tauchten die beiden auf. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und schwor mir, daß ich in Zukunft niemals mehr sagen würde, daß ich etwas mochte oder gewohnt war, was nicht auch unmittelbar vorhanden war.
Die traditionellen Dorfhäuser wie das von Pitaji sind so gebaut, daß sie Hitze, Kälte und Eindringlinge abwehren. Ihre dicken, fensterlosen Wände aus Lehm, die flachen Dächer und die abgerundeten Mauern drücken auf bewundernswerte Art ihre organische Verbundenheit mit dem Land aus, auf dem sie stehen. Wie bei den meisten Wohnstätten der Jats im Dorf, fand sich auf Pitajis Grundstück ein mit Dung ausgelegter Hof von unregelmäßiger Form, zwei kleine Räume, eine Küche und eine eingezäunte Kochnische, ein Büffelstall und ein Hühnerhaus. In der Mitte des Grundstücks stand ein persischer Fliederbaum, dessen tiefgrünes Laubdach ein schattiges Spitzenmuster auf den hellen Boden darunter warf. Smaragdgrüne Sittiche schaukelten auf seinen Zweigen.
Jungli schämte sich ein bißchen für sein ländliches Kachcha-(einheimisch)Haus. Er wollte, daß ich allen Komfort hatte, an den ich gewöhnt war. Er selbst zog Kachcha-Häuser vor, ebenso wie Pitaji. Mir ginge es auch so, versicherte ich ihm. Ich fand das Haus einfach reizend. Sanfte Farben und weich gerundete Mauern von einer einfachen Schönheit. Was das Leben betraf, das ich gewohnt war, wie immer es auch ausgesehen hatte – es wäre für mich das Letzte gewesen, was ich mir von einem Pandschab-Dorf erwartete oder erhoffte. Die meisten Dörfler, die einmal die «Zivilisation» gesehen hatten, wollten für sich selbst das gleiche: Pakka – im westlichen Stil gebaute Häuser mit viel Zement, verglasten Fenstern, eingebauten Wandregalen und anderen nutzlosen, luxuriösen Prestigegegenständen, die in den Dörfern selbst niemals hergestellt oder für notwendig befunden worden waren.
Kachcha-Häuser sahen immer gleich aus, ob sie nun zwei oder zweihundert Jahre alt waren. Auf den ersten Blick konnte man das nicht erkennen, bis man sich die Dachsparren ansah, die mit zunehmendem Alter schwarz wurden, oder die Türen, die früher aus kleinen Holztafeln, mit Kupfernägeln beschlagen, gebaut wurden. Pitajis Haus war relativ neu. Er hatte sich mit seinem Zimmermann beraten, um zu entscheiden, wo die Zimmer, die Küche und der Kuhstall stehen sollten und wo der beste Platz für die Pumpe war. Zwei Maurer wurden angestellt, um die breiten Hauswände von der Dicke sonnengetrockneter Lehmziegel zu errichten, und der Zimmermann baute das Dach: Zuerst die Balken, dann Dachlatten, dann eine Schicht Stroh (aus «Erianthes munja», einem hohen Gras, das an Feld- und Straßenrändern angebaut wird) und als letztes eine dicke Decke aus Lehm mit hervorstehenden Rändern. Die Küche und den Kuhstall baute Pitaji selbst, und Mataji verputzte mit Hilfe zweier Mazbi (Menschen einer niederen Kaste, die den Sikh-Glauben angenommen haben) die Mauern, die den Kochplatz umgaben und verzierte sie mit Ornamenten und Skulpturen. Nicht nur der Lehm, sondern auch alles Bauholz und das Stroh für das Dach kamen von Pitajis eigenem Land. Es war ganz Pitajis Haus, er hatte es wachsen lassen.
Auf zwei Ebenen gebaut, um sich der Hangschräge anzupassen, beherbergte der niedrigere Teil des Grundstücks die Küche, die Pumpe und die Tiere, während der obere Teil für die Schlafräume genutzt wurde. Die Küche war der dekorativste Teil des Ganzen, mit unglasierter Töpferware und blank poliertem Kupfergeschirr auf eingelassenen Wandbrettern, runden Nischen und allen Lebensmitteln, die gerade vorhanden waren – sehr viele waren es nie –, in kleinen Behältern mit geschnitzten Holztüren. Daneben war die kleine Nische, in der Mataji kochte, vom oberen Garten durch eine taillenhohe, breite Lehmmauer abgetrennt. Zur Außenseite hin war diese Wand in einem an Spitze erinnernden Muster durchbrochen. Die Muster dafür waren in jedem Haushalt andere. Kraftvoll und doch elegant, enthielten sie oft stilisierte Formen von Tieren und Vögeln, entweder als Relief oder als freistehende Skulpturen. Mataji hatte eine merkwürdige Tierfigur geschaffen, einen symbolischen Wächter, der für Sicherheit und Wohlstand sorgte. In der einen Ecke der Kochnische war ein kleiner Lehmherd so aufgestellt worden, daß er während der Kochzeiten immer im Schatten lag; drei weitere solcher Herde standen auf dem Gelände, so angeordnet, daß mindestens einer von ihnen immer im Schatten lag.
Im oberen Teil des Grundstücks lagen die Schlafbereiche, kleine Räume ohne Ventilatoren, die durch schwere Ketten und Vorhängeschlösser gesichert waren. Die geglätteten Wände mit den leicht gerundeten Ecken waren dünn mit blaß aquamarinblauer und orangener Farbe gestrichen, die den Verputz aus Lehm und gehäckseltem Stroh durchscheinen ließ. In einem der beiden Räume stand ein Getreidebehälter auf Beinen, aus Lehm gebaut und mit einem Reliefmuster aus Vögeln und Blättern verziert, eine Festung gegen Ratten und Diebe, die einem Safe entsprach, da sie den Besitz der Familie in Form von Weizen enthielt.
Mataji und Pitaji besaßen wenig, aber umgeben von Familien, die noch weniger hatten als sie, war alles, was sie besaßen, von Wert. Verschlossene Stahltruhen, nach der Größe gestapelt, standen in dem Raum mit dem Weizentresor, zwischen je zwei Truhen ein abgenutztes, rostbeflecktes Stück Stoff. Die besten Kleider wurden darin verwahrt, die Alltagskleider hingen an Nägeln von den Wänden. In den verbleibenden Platz waren die Charpoys geklemmt, die indischen Betten mit Holzrahmen und seilgeflochtener Liegefläche.
Der andere Raum, in dem Jungli und ich schliefen, war für Besucher vorgesehen. In ihm standen zwei Charpoys, ein kleiner Tisch und zwei halb zerbrochene Stühle mit Sitzflächen aus Plastikschnur, auf denen nie jemand saß; Statussymbole, Zeichen für westliche Zivilisation. Die Wände boten eine Dauerausstellung von Bildern, Fotografien und Kalendern, zehn- bis fünfzehnmal mehr, als in einem englischen Wohnraum von gleicher Größe zu finden wären, mit einem entwaffnend kindlichen Sinn für Ordnung zusammengestellt. Die oberste Reihe thronte auf einer Schiene, dreißig Grad von der Wand weggekippt; Spatzen hatten dahinter ihre Nester gebaut. Darunter hingen weitere Reihen und Gruppen von Hochzeits-, Schul- und Armeefotos und religiöse Drucke in Tuschkastenfarben.
Ich zählte in diesem Raum 23 Kalender von 1979. Keiner kümmerte sich darum, welches Datum wir gerade hatten, aber Kalender waren billig und dekorativ. Alle zeigten religiöse Szenen und darunter auch den Hindu-Gott Krishna, freizügig und gesellig dargestellt, mit Milchmägden flirtend, und auch die Moschee von Mekka und der ans Kreuz genagelte Christus hingen da. Auf den Sikh-Bildern waren die Gurus porträtiert und grausame Szenen ihrer Geschichte festgehalten: blutige Schlachtszenen, auf Speere gespießte Säuglinge, abgetrennte Köpfe und Gliedmaßen, und Männer, die in Kesseln mit Öl kochten oder der Länge nach durchgesägt waren. Ich versuchte so zu tun, als gäbe es diese Kalender gar nicht, aber Jungli machte mich immer wieder auf die eine oder andere Horrorszene aufmerksam und erzählte dabei voller Stolz von den stoischen Heldentaten der Sikhs.
Noch weitere Bilder standen in Stahlrahmen herum, baumelten von Nägeln an den Regalen herunter und, wenn sonst kein Platz mehr war, auch vom Türrahmen. Dazwischen steckten Plastikblumen, denen Blätter fehlten, behäbige Friedenstauben aus Plastik, eine Sammlung unbenutzter Teetassen, Spielzeug und Steingut für besondere Anlässe.
Das einzige, was im Haus bewundert werden mußte, waren die Familienfotos. Die exquisiten Erbstücke hatten keinen wirklichen Wert, ihr einziges Verdienst lag in ihrer fortdauernden Nutzlosigkeit. Durch meine Bewunderung alter Türen und Bretter rief ich viel Belustigung hervor, und auch durch meine Gewohnheit, herumzugehen und alles mögliche minutenlang sorgfältig zu betrachten, wobei meine Hände über die handgehämmerten, tönenden Metalltöpfe streichen wollten, über Schalen und Becher, und dem einheimischen Handwerk applaudierten; ebenso komisch fand man, daß ich die täglich anfallenden Arbeiten mit Faszination verfolgte. Für die Dorfbewohner war ein Haus eben ein Haus, eine Unterkunft und kaum mehr. Weil die Häuser im Dorf und deren Einrichtungen fast alle gleich aussahen, waren ihre Bewohner gar nicht weiter interessiert daran oder stolz darauf, und weil sie kaum wußten, daß westliche Häuser sich von den ihren überhaupt unterschieden, fühlten sie sich angenehm überrascht, wenn nicht gar geschmeichelt, durch mein offensichtliches Entzücken.
Der schönste und nach westlichen Maßstäben wertvollste Gegenstand, den Mataji und Pitaji besaßen, stand fast völlig unter Stroh verschüttet in einem außerhalb gelegenen Gebäude am Ende der Gasse gegenüber dem öffentlichen Dunglagerplatz. Es war ein Schrank aus Akazienholz, mit der Zeit ganz schwarz geworden, ungefähr 1,20 m mal 0,70 m groß, der auf kurzen, gewölbten Beinen stand. Die Seiten und die Tür waren aus kleinen, gekerbten Holzquadraten gefertigt, mit großen Kupfernägeln befestigt, jedes leicht verschieden vom anderen. Alles an diesem Schrank war eine Augenweide: Die Maserung und die Farbe des Holzes, die handgefertigten Beschläge, die Unregelmäßigkeit und Individualität jedes einzelnen Teils. Ich fragte, wie alt er sei. «Ach, bestimmt über hundert Jahre», sagte Mataji leichthin. Die meisten ihrer Nachbarn hatten ähnliche Schränke.
Soweit ich das beurteilen konnte, gab es im Haus keinen Platz für diesen Schrank, aber da man ihn dazu benutzen konnte, während der Hitzeperiode die Baumwolldecken zu lagern, wurde er nicht ausrangiert. Wenn die Decken im November dann wieder gebraucht wurden, hatten die Wasserbüffel den Großteil des Strohs gefressen, und der Zugang zum Schrank war wieder frei: eine bestechende Logik. Mir gefiel es, wie wenig Aufhebens sie um Wertgegenstände ihres eigenen kulturellen Erbes machten – alles wurde benutzt, auch die schweren, altertümlichen handgeschmiedeten Metallgegenstände, auch die bestickten Bettdecken, die nicht mehr hergestellt wurden –, aber mich verblüffte der Respekt, den sie dem billigen und häßlichen Steingut und den imitierten Kristallgläsern aus meiner Kultur entgegenbrachten. Sie hatten einen Ehrenplatz im schönsten Zimmer, wo sie Staub und trockene Mistflocken fingen zwischen anderen billigen und kitschigen Monumenten des modernen maschinellen Kunstgewerbes und aus dem Westen importierten schlechten Geschmacks. Sie wurden nicht benutzt, und niemand warf jemals einen Blick darauf: das wichtigste war, daß es sie gab.
Mataji und Pitaji hatten einen Knecht namens Fikan.
Von einer anständigen Jat-Familie wurde erwartet, daß sie einen Bediensteten hatte, und Mataji betrachtete ihre Familie als sehr anständig. Fikan war ein Hindu-Junge aus einer niederen Kaste; er war zwanzig Jahre alt und lebte seit fünf Jahren im Haus. Er schlief getrennt von der Familie, schlich still herum und sprach nur, wenn er dazu aufgefordert wurde. Ich nahm seine Anwesenheit kaum wahr.
Ungefähr 600 Kilometer weit weg in Uttar Pradesh hatte Fikan eine Frau und ein Kind. Er schickte ihnen den größten Teil seines monatlichen Einkommens von umgerechnet 33DM; einmal im Jahr ging er auf Heimaturlaub. Seine Frau lebte inzwischen mehr schlecht als recht, indem sie Steine für den Straßenbau schlug. Ich war oft an Kolonnen solcher Arbeiter vorbeigefahren, die am Straßenrand hockten und Steine in immer kleinere Stücke schlugen. Sie hämmerten den ganzen Tag lang und zu jeder Jahreszeit, und sie lebten in behelfsmäßigen Hütten aus Säcken und Asphalttonnen am Straßenrand.
Fikans Los war besser als das seiner Frau und laut Jungli, auch besser als das der meisten anderen Bediensteten, die in Jat-Familien arbeiteten. Die anderen kauften ihren Dienern nicht so gute Kleider, wie Mataji es tat, und gaben ihnen auch nicht das gleiche Essen, das die Familie aß. Die anderen gaben ihnen nur Gepökeltes zu ihren Chapatis oder verdünnte Buttermilch mit Salz und grünem Chili. Und die anderen ließen ihre Knechte den ganzen Tag lang hart auf dem Feld arbeiten. Fikans Pflichten waren leicht – vier Tiere den Tag über weiden lassen und morgens und abends tränken, das Abendfutter vom Feld holen und durch die Häckselmaschine laufen lassen und verschiedene Botengänge erledigen. In den Nachmittagspausen schwätzte er mit seinen Kumpanen (Hindu-Jungen, die in anderen Jat-Haushalten arbeiteten), zerbröselte Kannabis mit einem Mörser und trank es in Salzwasser. Das war sein einziges Vergnügen.
Kurz nach meiner Ankunft brach die Hitzeperiode an. Ich war monatelang in Indien gewesen und hatte oft gefroren, aber mir war es nie zu heiß gewesen. Jetzt brach die Hitze mit Macht ein. Erde und Himmel wurden fahl und riesig, die Vegetation verschwand, die Tümpel trockneten aus, und der graue Schlamm brach auf und bekam Risse. Ich konnte auf dem Dungboden des Hofs nicht mehr barfuß laufen, den eisernen Pumpenschwengel nicht mehr berühren oder meine Hand in einen Eimer Wasser tauchen, der in der Sonne stehengeblieben war.
Jeder Tag war wie ein Sonntag. Die täglichen Arbeiten verliefen in einem langsamen, trägen Rhythmus. Jede Arbeit hatte ihren eigenen Platz und ihre eigene Tageszeit und wurde mit sorgfältiger Gründlichkeit erledigt, wie die Sitte es verlangte. Die Dörfler waren niemals in Eile, weil die Zeit für sie keinen Preis hatte und man nirgendwo schnell hinkommen mußte. Und außerdem war es zu heiß.
Die Familie stand beim esten Licht der spatzenzwitschernden Dämmerung auf, durch das ruhelose Hin und Her der Tiere im Stall geweckt. Wenn Mataji von ihrer Morgentoilette an der Latrine zurückkehrte, und es schon fast Tag war, zündete sie das Herdfeuer und machte Tee. Pitaji war ihr gefolgt, und während sie die Töpfe vom Abend zuvor mit der Asche von gestern und einer Handvoll Stroh scheuerte, wusch er sich unter der Pumpe und sprach dann, im Schneidersitz auf seinem Charpoy sitzend, das Morgengebet. Fikan melkte die Büffel und führte sie auf das Weideland, und Matajis Putzfrau, eine dunkelhäutige Mazbi-Frau aus den ärmeren Wohngebieten am Dorfrand (wo oft fünfzig oder sechzig Menschen ein Haus wie das von Pitaji bewohnten) vermischten den frischen Stalldung der Nacht mit gehäckseltem Stroh, schlug ihn in schöne, runde, flache Fladen und stapelte sie zum Trocknen auf den Mauersims, wo sie wie Schokoladentropfen auf dicken Stücken von Walnußkuchen aussahen. Mataji setzte die frische Milch auf ein kleines Feuer, um Joghurt zu machen und schlug Butter in einem Tonkrug.
Jetzt wand sich die Putzfrau wie eine Krabbe durch alle Räume und den Garten, wedelte mit einem wenig wirkungsvollen Wisch aus Stroh in den entlegenen Ecken unter den Charpoys herum und sortierte, was sie zusammenkehrten, sorgsam in Brennmaterial, Futter und Staub für Pitajis Komposthaufen auf dem öffentlichen Dungplatz. Alles, was nicht für einen speziellen Zweck genutzt wurde, konnte noch für etwas anderes gebraucht werden. Und Mataji gierte jeder Konservenbüchse hinterher. Wenn die Sonne über die großen Dächer der Goldschmiedhäuser im Osten kroch und die grauen Schatten in die Mauern jagte, begann Mataji mit der Zubereitung der Morgenmahlzeit. Jetzt, während das Gemüse geschnitten wurde, war die Zeit der Besucher, für die Einteilung der Tagesarbeit auf dem Feld, für Betteln und Borgen, Schwätzen und Hausieren. Jeden Tag kamen sie: Freunde, Nachbarn, Verwandte, Kastenangehörige, Feldarbeiter, Gemüsefahrer, Lieferanten, Sadhus und Schlangenbeschwörer, Bettler und die Armen des Dorfes. Pflichtbewußt, aber halbherzig bot Mataji ihren Besuchern Tee an. «Wir fühlen uns hier wie zu Hause», wurde protestiert. «Laß dich nicht stören.» Hätte sie auch nicht, wenn sie es hätte vermeiden können, aber die Sitte zwang sie, ihre Einladung mehrere Male zu wiederholen, und jedesmal mit größerer Überzeugungskraft.
Es gab zwei Mahlzeiten in Pitajis Haus, gegen neun Uhr morgens und abends um acht, damit man die Mittagshitze vermied. Beide Mahlzeiten bestanden aus Chapatis mit einer kleinen Schale Dal oder Sabzi (rohes oder mit Curry gewürztem Gemüse), wenn etwas da war; wenn Gäste kamen, gab es immer beides und vielleicht sogar Raita (rohes oder halbgekochtes Gemüse in scharf gewürztem Joghurt). In ärmeren Haushalten, wie dem von Matajis Putzfrau, aß man selten Gemüse und lebte von Chapatis oder Reis einmal am Tag, mit Buttermilch oder wäßrigem Dal versetzt.
Zu den Mahlzeiten setzte man sich nie förmlich gemeinsam nieder. Die Familienmitglieder aßen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Plätzen, je nachdem, wann sie Hunger hatten und wo es ihnen am bequemsten war. Die meisten Menschen saßen am liebsten im Schneidersitz auf einem Charpoy, balancierten ihr Essen vor sich auf dem Laken und aßen allein. Unterhaltungen, oder noch schlimmer, Lesen während des Essens galten als schlechte Manieren und zeugten von mangelndem Respekt für das Essen: wenn jemand sprechen wollte, hatte er den ganzen Tag lang Zeit dafür.
Die Gäste wurden zuerst bedient, dann folgten die Männer und die Ältesten. Jungli und ich aßen zusammen drinnen, um von den Nachbarn nicht gesehen zu werden. Mataji aß als letzte. Nachdem sie ihre Gäste und ihre Familie, ihren Dienstboten und ihre Hunde versorgt hatte (von einem der beiden glaubte sie, daß er in seiner früheren Inkarnation eine Sadhu gewesen sei, weil er jeden Dienstag fastete), hockte sie auf der niedrigen Planke in ihrer Kochnische oder thronte oben auf dem Dach des Hühnerhauses, um die warme Morgenbrise zu genießen.