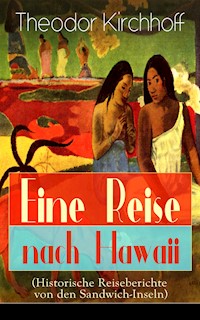
Eine Reise nach Hawaii (Historische Reiseberichte von den Sandwich-Inseln) E-Book
Theodor Kirchhoff
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieses eBook: "Eine Reise nach Hawaii (Historische Reiseberichte von den Sandwich-Inseln)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Theodor Kirchhoff (1828-1899) war ein deutsch-amerikanischer Schriftsteller. Mit seinem Bruder Christian veröffentlichte er die Bücher Lieder des Krieges und der Liebe und Adelpha. Später schrieb er Reisebilder und Skizzen aus Amerika, Balladen und neue Gedichte, Kalifornische Kulturbilder, Eine Reise nach Hawaii und die episch-lyrische Dichtung "Ein Auswandererleben". Aus dem Buch: "In allen englischen Reisebüchern steht der etwa sieben englische Meilen (11 km) von Honolulu entfernte Pali (der Abgrund) als die größte Sehenswürdigkeit dieser Stadt verzeichnet. Infolge jener Anzeige haben die John Bulls, welche sich auf der Durchreise zwischen San Francisco und Sydney meistens nur einen halben Tag in Honolulu aufhalten, nichts eiligeres zu thun, als, gleich nachdem sie ihren Fuß auf den Boden der Insel Oahu gesetzt, in einem Wagen nach dem Pali zu kutschieren, ohne die Hauptstadt des Kanakenreiches nur eines Blickes zu würdigen. Selbstverständlich zog es auch mich wie mit magnetischer Kraft nach dem Pali."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Reise nach Hawaii (Historische Reiseberichte von den Sandwich-Inseln)
Inhaltsverzeichnis
1890.
Hawaii.
Den Tropen nahe liegst du da, Hawaii, lichtumflossen. Du Schmuck von Polynesia, Dem Ocean entsprossen. Am sonnigen Gestade glänzt Das Meer mit blauen Wogen, Die Bergesstirnen sind bekränzt Von Iris' Farbenbogen.
Die laue Luft rauscht durch das Grün, Warm strömt herab der Regen, Und Blumen allerorten blühn In Gärten und Gehegen. Es schmücken Männer sich und Fraun Das Haupt, die Brust mit Kränzen, Daraus die Rosen leuchtend schaun Und wilde Blumen glänzen.
Auf Mauna Loa's Gipfel weht Von seiner eis'gen Warte, Wenn blutrot er im Feuer steht, Des Inselreichs Standarte; Und unablässig wogt empor Die Glut an Kraterwänden Aus Kilauea's Höllenthor Von Pele's Flammenhänden.
Hier Waldesgrün und Blumenrain, Und ringsum Palmenbäume, Und Lebenslust und Sonnenschein, Musik und heitre Träume; Dort in der Erde tiefem Schoß Der Lava roter Schrecken, Bereit, mit donnerndem Getos' Den Riesenleib zu recken.
So prangst du, schönes Inselland, Voll goldnen Lichts und Wonne, –
Vorwort.
Unsere Zeit ist so schnell lebend, daß mancher, in dessen Hände dies Buch gelangt, sagen wird, es sei diese Schilderung einer Reise nach dem schönen Inselland in der Südsee bereits veraltet. Im Reiche Kalakauas geht die Uhr des Fortschritts aber viel langsamer, als in Europa oder in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo zwei Jahre heute fast so viel bedeuten wie vor hundert Jahren zwei Menschenalter. Die biederen Insulaner sehen das Menschendasein gern von der gemütlichen Seite an, und wem das Glück zuteil wird, auch einmal seinen Fuß auf jenes Stück sonniger Erde zu setzen, dem werden diese Federzeichnungen von Land und Leuten in Hawaii wohl kaum verblaßt erscheinen.
Vom Ufer des blauen Léman sende ich diese Blätter in die weite Welt. Beim Betrachten des Dent du Midi in seinem silbernen Kleide und der idyllischen Umgebungen des Genfer Sees habe ich oft an mich die Frage gestellt, wem wohl der Preis der Schönheit gebühre, der herrlichen Schweiz oder der in meiner Erinnerung hier wieder neu aufgelebten sonnigen Inselwelt Hawaiis: eine müßige Frage, weil die Schönheit beider eigener Art ist.
Für solche, denen es nicht vergönnt ist über die Meere zu wandern und den Glanz fremder Zonen zu schauen, wurden diese Blätter geschrieben. Sie erbitten sich als Wegweiser nach einem der schönsten, noch wenig bekannten Erdenflecke einen wohlwollenden Empfang.
Montreux, im Mai 1890.
Theodor Kirchhoff
Erstes Kapitel.
Mit dem Dampfer Australia von San Francisco nach Honolulu. – Die »Oceanic«-Dampfschiffslinie. – Trennung von der civilisierten Welt. – Ein einsames Meer. – Der Mühlenteich. – Tropische Lüfte. – Privatstühle auf dem Verdeck. – Die Hospitalabgabe. – Die Insel Oahu. – Koko Head und Diamond Head. – Ankunft in Honolulu.
Am 7. Dezember 1887 fuhr ich auf dem stattlichen Dampfer Australia durch das goldene Thor hinaus in den großen westlichen Ocean, um dem Reiche Kalakauas einen Besuch abzustatten. Seit vielen Jahren hatte ich mich nach dieser Reise gesehnt. Ich empfand es als eine gerechte Anklage, daß mir, einem alten Californier, der fast jeden Winkel der gesegneten Küstenländer am Stillen Meere, von Panamá bis nach British Columbia, wiederholt besucht hatte, das »Paradies des Pacific«, welches doch eigentlich zu uns gehören sollte, nur ein geographischer Begriff geblieben sei. Drüben im Westen, nur etwa 2000 Seemeilen entfernt, lag der größte thätige Vulkan der Erde mit seinem blutroten tobenden Lavasee; Palmen, Tropenhaine, Zuckerpflanzungen, dunkeläugige Kanakamädchen, einen kaffeebraunen König, Aussätzige u.s.w. gab es dort zu sehn; liebenswürdige Landsleute, die in Honolulu und auf den »Inseln« wie Gott in Frankreich lebten, hatten mich schon öfters zu Besuch eingeladen. In der That, es war eine Schande, daß ich, dem durchaus nichts im Wege stand, die Welt nach Herzenslust zu durchstreifen, erst jetzt diese für meine Begriffe sehr kleine Reise unternahm. Aber so ist der Mensch! Das, was ihm am nächsten liegt, beachtet er am wenigsten, wie es z. B. Tausende in San Francisco giebt, denen die Naturwunder Kaliforniens nur aus Bildern und aus Anzeigen der Eisenbahngesellschaften bekannt geworden sind.
Der eiserne Schraubendampfer Australia, ein Schiff von 1715 Tonnen Gehalt, ist der sogenannte »local steamer« zwischen San Francisco und Honolulu, der jeden Monat einmal die Verbindung zwischen jenen Plätzen herstellt, während seine ebenfalls in Honolulu anlegenden Schwesterschiffe Zealandia, Alameda und Mariposa über Samoa und Aukland bis nach Sydney fahren. Die im Jahre 1875 am Clyde gebaute Australia, welche zur Zeit meiner Reise unter hawaiischer Flagge fuhr, jetzt aber das Sternenbanner trägt, gehört wie die anderen vorhin genannten Dampfschiffe dem berühmten californischen Zuckerkönige Claus Spreckels. Mitunter berühren die chinesischen Dampfer Honolulu, und sogenannte »tramp steamers« (Dampfschiffe, die keine bestimmte Linie innehalten) laufen dort ab und zu an. Auch werden Postsachen und Reisende gelegentlich von den Zucker-Schonern befördert. Die regelmäßige Verbindung zwischen San Francisco und den Sandwichinseln beschränkt sich aber auf die oben genannten vier Dampfer. Eine Fahrkarte, die Beköstigung eingeschlossen, von San Francisco nach Honolulu und zurück, gültig für drei Monate, kostet in der ersten Kajüte 125 Dollars.
Als wir in die endlose Weite des Oceans hinausfuhren, regte sich in mir ein berechtigtes Gefühl der Unzufriedenheit, weil ich zwei oder gar drei Wochen lang (bis der nächste Dampfer von San Francisco in Honolulu anlangen würde) die übliche Morgenzeitung mit Nachrichten aus aller Herren Ländern beim Frühkaffee entbehren mußte. Was konnte nicht alles während dieser Zeit auf unserem Planeten vorfallen? Es ist gewiß keine Kleinigkeit, vierzehn Tage lang darüber im Unklaren zu bleiben, ob der neue Weltkrieg zuerst in Bulgarien oder in der Champagne ausbrechen wird. Alle meine herrlichen Schlachtpläne mußten dabei vollständig wertlos werden! Sehr vernünftig verfuhr ein vor Jahren in Reykjavik in Island wohnender Deutscher, wo damals nur ein einziger Dampfer in zwölf Monaten aus Kopenhagen eintraf. Unser Landsmann erhielt bei dieser Gelegenheit jedesmal den ganzen letzten Jahrgang der Kölnischen Zeitung und las jeden Morgen beim Kaffee oder Isländischen Thee allemal die dem Datum entsprechende vorjährige Nummer der Kölnischen – war also genau ein Jahr in der Tagesgeschichte zurück. Auf der Australia gab es nur Frank Leslies'- und Harper's Wochenblatt zu lesen, deren neueste Nachrichten und nicht gerade Rafaelische Bilder mir nicht einmal den vorjährigen Jahrgang der Kölnischen zu ersetzen vermochten. Nur die jenen Blättern angehefteten Vulkan-Anzeigen fesselten mich durch ihren mir ganz neuen Inhalt.
Die Dampferfahrt war recht einförmig. Nicht ein bischen Seekrankheit stellte sich bei mir ein, um die Langeweile zu vertreiben, obgleich sich die Australia durchaus nicht immer im Gleichgewicht über die Wogenhügel dahin bewegte. Stürme, die mitunter auch das Stille Meer gewaltig aufrütteln, ereigneten sich während unserer Reise gar keine. Ich sehnte mich ordentlich nach einer luftigen Brise; aber der alte Okeanos stand damals mit Boreas und seinen Genossen augenscheinlich auf dem besten Fuß und wurde von diesen gar nicht in seinem Schlafe gestört. Das tierische Leben beschränkte sich auf einige große Seevögel mit langen scharfzugespitzten schwarzen Flügeln, von der Schiffsmannschaft Molly Hawks genannt, die uns unermüdet tagaus, tagein auf unserer Reise begleiteten. Wie diese Vögel es möglich machten, ohne wahrzunehmenden Flügelschlag halbstundenlang hin und her zu kreisen, in der Luft auf und ab zu steigen und oft dicht über die Wogen hinzugleiten, blieb mir lange Zeit ein Rätsel. Ein mitreisender irischer Naturforscher belehrte mich endlich zu meiner Freude, indem er mir mitteilte, daß sich die Molly Hawks lediglich durch ihren Geisteswillen (power of mind) fortbewegen. Welch eine Aussicht für zukünftige Reisende, wenn diese bei erstarktem Willen auf ihrem Koffer durch die Luft von San Francisco nach Honolulu reiten können, und das leidige Fahrgeld von 125 Dollars alsdann ein überwundener Standpunkt sein wird! Daß ich zu früh auf die Welt gekommen war, mußte ich bei diesem Gedanken schmerzlich empfinden. – Der Ocean zeigte so wenige Bewohner wie das Luftmeer. Walfische, nach denen wir oft ausschauten, bekamen wir gar keine zu Gesicht, kein Hai ließ sich blicken, und nur einmal erfreute uns eine Schar lustiger Delphine durch ihre unnachahmlichen Purzelbäume. Nie sah ich eine einsamere See. Ein einziges Segelschiff zog während unserer Reise in weiter Ferne an uns vorüber.
Sechshundert Seemeilen vom goldenen Thor gelangten wir in den sogenannten Mühlenteich(mill pond), der sich bis in die Nähe der Sandwichinseln erstreckt. Die See wird dort nur selten von Winden aufgeregt und liegt fast bewegungslos da; daher der Name. Die Witterung wurde jetzt merklich wärmer, das Meer nahm eine tiefblaue Färbung an. Als wir uns dem Wendekreise des Krebses näherten, kamen leichte Sommerkleider zum Vorschein, viele Mitreisende, namentlich Damen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen hatte, erschienen auf dem Verdeck mit abgehärmten Gesichtszügen und suchten ihre Stühle. Viele Reisende auf diesen Dampfern pflegen nämlich ihren eigenen Stuhl mitzunehmen, weil solche außerhalb der Kajüten nicht vorhanden sind. Die verschiedenen Sorten von Klappstühlen, Hängestühlen, Schlafstühlen, Ausziehstühlen u.s.w., welche man auf diesen Schiffen zu sehen bekommt, würden einen Möbelhändler in Entzücken versetzen. Die wunderbarsten Stühle sind allemal das Eigentum eines Engländers und kommen aus der Werkstatt eines Yankees. Jeder reisende John Bull schleppt seinen eigenen Stuhl von einem Ende der Erde nach dem anderen mit sich. Wehe dem, der sich unberufen auf einem solchen Privatstuhl niederläßt. Mit den Worten »if you please, Sir!« wird ihm bald seine Stuhlarmut klar gemacht, und der rechtmäßige Eigentümer läßt sich auf dem bequemen Sessel nieder, in welchem jener eben noch mit sinnigen Betrachtungen auf das unendliche Meer hinausschaute, oder sich in einen Räuberroman vertieft hatte. Daß die Engländer die seltsamsten Reiseanzüge tragen, wird jedem, der aus seinen heimischen vier Wänden einmal herausgekommen ist, nichts Neues sein. Aber praktisch sind unsere Vettern aus Altengland immer, sei es frühmorgens, wenn sie in weißen Flanellanzügen mit dem Riesenschwamm in der Hand ins Bad gehn, sei es bei Tage, wenn sie ihre karierten Joppen, ihre Pumphosen und Troddelmützen zur Schau tragen.
Das Verdeck war jetzt stets voll von Reisenden beiderlei Geschlechts, die entweder spazieren gingen oder Romane lasen, oder mit Bleigewichten nach dem Strich warfen, und sich in ähnlichen geistreichen Spielen ergingen. In der Kajüte wurde das Klavier von den schlechtesten Spielerinnen fast unausgesetzt gemißhandelt. Mitunter wurde dort, oder nach Dunkelwerden auf dem oberen Verdeck getanzt. Der funkelnde Sternenhimmel diente in letzterem Falle zur Beleuchtung, die laue Tropenluft fächelte die Wangen der Schönen, während die Maschine stampfte und der Dampfer rastlos weiter eilte. Im Rauchzimmer drehte sich die Unterhaltung beim Whist und Pokerspiel meistens um Leprosie, worüber der lustige Schiffsarzt uns gern Aufklärung verschaffte. Mehrere Mitreisende wären gern umgekehrt, als sie von der großen Gefahr des Aussatzes erfuhren, der sie in Honolulu ausgesetzt sein würden, wo diese ekelhafte Krankheit häufig von den Kranken auf die Gesunden durch die Moskitos übertragen wird.
Am sechsten Tage unserer Meerfahrt wurde die Hospital-Abgabe von zwei Dollars von jedem Reisenden eingefordert. Ich erfuhr, daß mich das Bezahlen dieser Abgabe durchaus nicht zu einem freien Unterkommen im Krankenhause in Honolulu berechtigte, daß dieselbe vielmehr ein bequemes Einkommen der hawaiischen Regierung ist, welche damit den Fremden einen Teil der Kosten für den Staatshaushalt auferlegt.
Die See ward jetzt unruhig und Scharen von Möwen umschwebten das Schiff, ein Beweis, daß Land in der Nähe war. Am Vormittage des 14. Dezembers stiegen blaue Wolken, die Berge der Sandwichinseln, aus dem Ocean empor. Bald darauf erhoben sich die beiden 1206 und 644 Fuß hohen grünen Bergkuppen von Koko Head auf der Insel Oahu (Oáchu)1 aus dem Meere und wurden mit Jubel begrüßt. Dann erschien der malerische, langgestreckte alte Kraterwall Diamond Head als überaus prächtige Landmarke des Hafens von Honolulu. Eine lange Berglinie, mit Schluchten, zahlreichen Gipfeln und schwarz-braunen Felszacken, auf welcher in dunklen Wolkenzügen ein doppelter Regenbogen leuchtete, schloß sich daran an, grüne Thäler erstreckten sich vom Gebirge bis ans Meer, am Strande lag ein Kokospalmenhain, die Landschaft war weit und breit mit grünen Bäumen bedeckt, zwischen denen zahlreiche weiße Wohnhäuser hervorlugten; davor breitete sich der blaue Meeresspiegel aus – ein wundervolles Bild!
Die Stadt Honolulu mit dem Punch-Bowl-Berge im Hintergrunde, die wie in einem großen Park dalag, der von Schiffen belebte Hafen mit seinen Landungsbrücken und Lagerhäusern, traten jetzt rasch näher heran. Ein von Kanaken gerudertes Boot brachte den Lotsen an Bord. Die braunen Ruderer, kräftige, muskulöse Gestalten, konnten als tüchtige Seeleute recht gut den Vergleich mit der Mannschaft der beiden Böte aushalten, welche bald darauf das im Hafen liegende englische Kriegsschiff Caroline und der V. St. Kriegsdampfer Vandalia nach der Australia sandten, um die für ihre Schiffe bestimmten Postsäcke in Empfang zu nehmen. Die Vandalen waren den Briten sowohl an Aussehen als an Seemannskunst augenscheinlich überlegen, was die auf das Sternenbanner schwörenden Reisenden der Australia mit Stolz erfüllte.
Nachdem ein Gesundheitsbeamter die in Reih und Glied aufmarschierten Reisenden oberflächlich betrachtet hatte, um festzustellen, ob nicht dieser oder jener unter uns mit den schwarzen Blattern behaftet sei, und dieser Punkt zur Zufriedenheit erledigt war, hinderte den Dampfer nichts mehr daran, in den Hafen einzulaufen. Innerhalb des Korallenriffs empfingen uns mehrere junge Kanaken, die aus einem Boote ins Meer sprangen und wie die Enten um unser Schiff herum schwammen. Wir warfen kleine Münzen in das Wasser, welche von den untertauchenden braunen Gesellen ohne Mühe erhascht wurden. Während die Männer unter den Reisenden dies zweifelhafte Vergnügen, ihr Geld fortzuwerfen, bald einstellten, fuhren mehrere englische, wissenschaftlich veranlagte Damen, die ihre Kenntnisse über den Körperbau der Kanaken bereichern wollten, noch eine Zeitlang eifrig damit fort, ihre Nickels in das Meer zu werfen. Im Hafen lagen die V. St. Kriegsschiffe Vandalia, Juniata und Mohican und der britische Kriegsdampfer Caroline friedlich nebeneinander. Bald hatten wir die von Menschen und Fuhrwerken förmlich wimmelnde Landungsbrücke erreicht, an welcher unser gutes Schiff nach einer Fahrt von 2100 Seemeilen, die genau sieben Tage gedauert hatte, wohlbehalten anlegte. Die braunen Zöllner waren außerordentlich zuvorkommend gegen die Reisenden und erlaubten denselben, den gastlichen Boden des Königreichs Hawaii zu betreten, ohne zuvor das Handgepäck einer kritischen Musterung zu unterwerfen. Mich zwischen blumenbehängten Kanaken und einem wahren Völkergemisch der Inselbewohner hindurch drängend, erhaschte ich bald einen der vielen Einspänner und fuhr schnell durch die Stadt nach dem Hawaiian Hotel, wo ich ein vortreffliches Unterkommen fand.
1. Die Insel Oahu, auf welcher Honolulu, die Hauptstadt des hawaiischen Königreichs, liegt, ist ungefähr 150 Q Kilometer größer, als die Insel Rügen.
Zweites Kapitel.
Allgemeine Notizen über die Sandwichinseln. – Statistisches. – Eine gemischte Bevölkerung. – Das Aussterben der Eingeborenen. – Der Volksstamm der Kanaken. – Schulcensus.
Ehe ich mit der Beschreibung des Königreichs Hawaii beginne und das interessante Leben in jenem entlegenen Tropenlande zu schildern versuche, will ich einige übersichtliche statistische Notizen voranschicken, um dem Leser einen Begriff von der geographischen Lage, der Größe und den Bevölkerungsverhältnissen des Inselreichs zu geben.
Die Sandwichinseln (von den Bewohnern gewöhnlich Hawaiian Kingdom oder kurzweg The Islands, amtlich Hawaiinei genannt) liegen zwischen 18° 50' bis 22° 20' nördl. Breite und zwischen 154° 53' bis 160° 15' westl. Länge von Greenwich, auf der Straße der Postdampfer, die von San Francisco nach Australien fahren. Die Entfernung von Honolulu nach San Francisco beträgt 2100, nach Aukland 3810, nach Sydney 4484 Seemeilen. Die Gruppe besteht aus acht größeren und vier kleineren Inseln, welche letztere aber nur als Felsklippen gelten können. Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Stellenweise liegen Korallenriffe in geringer Entfernung vom Ufer; aber es sind die Korallenbildungen hier weit beschränkter, als in den Inselgruppen südlich vom Äquator. Sieben von den Hauptinseln sind bewohnt (Kahoolawe wurde vor einigen Jahren von seinen Bewohnern verlassen). Nur die vier größeren Inseln Hawaii, Maui, Oahu und Kauai haben eine Bedeutung für Handel und Ackerbau; auf den übrigen Inseln wird fast nur Viehzucht betrieben. Ungefähr 1/20 der Oberfläche des Königreichs, die auf 4 Millionen Acker geschätzt wird, ist kulturfähig.
Die Sandwichinseln wurden aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 1542 zuerst von Juan de Gaetano, der den spanischen General Lopes Villalobos als Schiffsführer begleitete, während einer Reise von Neu-Spanien (Chile) nach den Molukken entdeckt und als »Königsinseln« (las islas del rey) bezeichnet, die 900 Leguas, ungefähr 2000 Seemeilen, von der mexikanischen Küste lägen.
Die Entdeckung ging aber ganz in Vergessenheit über, bis Kapitän Cook die Inseln am 18. Januar 1778 während einer Reise durch die Südsee nach Oregon in den Schiffen Resolute und Discovery zum zweiten Mal entdeckte und Sandwich Islands taufte. Außer den Nachrichten über die Königsinseln deutet noch sonst manches darauf hin, daß die Spanier lange vor Cook diese Inseln auf ihren Seefahrten zwischen den Philippinen und Panamá, besucht haben. Die Helme, welche die alten Häuptlinge trugen, sahen genau so aus, als wären sie nach spanischem Muster angefertigt worden; manche Waffenstücke, altes Eisen (auf den Hawaiischen Inseln kommen gar keine Metalle vor) und andere Gegenstände scheinen spanischen Ursprungs zu sein.
Das folgende Verzeichnis giebt die Größe der verschiedenen Inseln an, die höchste Bodenerhebung, welche sie über dem Meeresspiegel erreichen, und die Zahl ihrer Bewohner:
engl. Miles
Bevölkerung
Höchste Bodenerhebung:
(27. Dezember 1884)
in engl. Fuß
in Meter
Hawaii
4210
24991
13805
4200
Maui
760
15970
10032
3059
Oahu
600
28068
4032
1229
Kani
590
8035
4800
1463
Molokai
270 }
3500
1067
Lanai
150 }
2614
3000
915
Niihau
97 }
800
244
Kahoolawe
63 }
1450
442
6740
2
80578
Die Stadt Honolulu hatte am 17. Dezember 1866 eine Bevölkerung von 13 521 Köpfen. Am 27. Dezember 1884 zählte die Stadt 20487 Einwohner, die sich nach Nationalitäten folgendermaßen verteilen:
Eingeborene (Kanaken
40014
Mischlinge (
half cast
)
4218
Chinesen
17937
Amerikaner
2066
Kinder, die in Hawaii von Ausländern geboren wurden
2040
Japaner
116
Norweger
362
Briten
1282
Portugiesen (von den Azoren und der Insel Madeira).
9377
Deutsche
1600
Franzosen
192
Andere Weiße
418
Polynesier
956
80578
Die Stadt Honolulu hatte am 17. Dezember 1866 eine Bevölkerung von 13 521 Köpfen. Am 27. Dezember 1884 zählte die Stadt 20487 Einwohner, die sich nach Nationalitäten folgendermaßen verteilen:
Eingeborene (Kanaken)
9013
Deutsche
433
Mischlinge
2706
Franzosen
126
Chinesen
5225
Norweger
106
Amerikaner
1164
Polynesier
115
Briten
791
Japaner
48
Portugiesen
570
Andere Fremde (Neger u. s. w.)
190
Zusammen
20487 Einwohner.
Die obigen Zusammenstellungen sind aber, namentlich in Bezug auf die Fremdenbevölkerung, einer stetigen Veränderung unterworfen. Die Zahl der Japaner, von denen es nach dem Census von 1884 nur 116 im hawaiischen Königreiche gab, hat sich z. B. bis 1890 durch Zuwanderung auf ungefähr 8500 Köpfe vermehrt. Die Chinesen und Portugiesen sind auch zahlreicher geworden, während die eingeborene ungemischte Bevölkerung in schnellem Rückgang begriffen ist. Wie rasch die Zahl der letzteren abgenommen hat, wird das folgende Übersichtsverzeichnis veranschaulichen:
Census
Gesamt-bevölkerung
Fremde
(kaukasischer Abstammung)
Chinesen
Mischlinge
Eingeborene
1823
142 050
142 050
1832
130 313
130 313
1836
108 579
108 579
1853
73 138
2 119
71 019
1860
69 800
2 816
66 984
1866
62 959
2 968
1 206
1 660
57 125
1872
56 897
4 247
1 938
2 487
48 225
1878
57 985
4 581
5 916
3 420
44 088
1884
80 578
18 407
17 939
4 218
40 014
Am 30. Juni 1887 schätzte man die Einwohnerzahl der Sandwichinseln, mit Berücksichtigung der Eingewanderten, Abgereisten, Geburten und Todesfälle, die den letzten Census entsprechend abänderten, auf 84 574. Im Mai 1890 wurde die Bevölkerung des Königreichs auf rund 92 000 Seelen angegeben, davon Eingeborene und Mischlinge zusammen 45 000; Weiße (unter ihnen 3000 Amerikaner und 1500 Deutsche) 7000; Portugiesen 12 000; Chinesen 19 000; Japaner 8500; Südseeinsulaner 500. Die Einwohnerzahl von Honolulu hat sich seit 1885 nur um ein Geringes vermehrt.
Die Hauptursachen der entsetzlichen Abnahme der Bevölkerung der Kanaken sind Blattern, Masern, Aussatz, sittenloses Leben der Weiber, Vernachlässigung der Kinder durch die Mütter, ungezügelte Vergnügungssucht, und namentlich der zerstörende Einfluß der Zivilisation der Weißen auf alle Naturvölker. Die ersten weißen Ansiedler waren ein außerordentlich wüstes Volk. Abenteurer, rohe Seeleute, entflohene Sträflinge bildeten die Mehrzahl derselben. Ihrer lockeren Moral und ihrem schlechten Beispiel ist es in hohem Maße zuzuschreiben, daß die eingeborene Rasse so schnell ausstirbt. Unter dieser haben außerdem Epidemien schrecklich aufgeräumt. 1804 starben viele Tausende an einer auf den Inseln wütenden Pest. In Waikiki (einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Honolulu) wurden an einem Tage 300 Tote begraben! 1853 starben mehr als 8000 Menschen an Syphilis und Pocken. 1849 und 1850 rafften die Masern Tausende hin. Kapitän Cook schätzte die Bevölkerung der Sandwichinseln auf 400 000; wahrscheinlich zu hoch, weil er sich durch die vielen Neugierigen, die von allen Inseln herbeigeeilt waren, um die Schiffe zu sehen, täuschen ließ. Aber alle alten Seefahrer veranschlagten die Bevölkerung auf Hunderttausende, wenn auch bedeutend niedriger als Cook. Heute, nach hundert Jahren, sind nur noch 40 000 übriggeblieben! Daß das gänzliche Aussterben der Kanaken nur eine Frage der Zeit ist, muß jedem einleuchten, der die obigen Zahlen aufmerksam gelesen hat.
Besonders traurig ist dies, weil der Volksstamm der Kanaken den meisten Naturvölkern sowohl geistig als körperlich weit voransteht. Die Bewohner von Tahiti, Tonga und Samoa und die Maoris auf Neu-Seeland, welche letzteren mit Erfolg ein Menschenalter lang gegen die Engländer kämpften, gehören zu derselben Rasse. Die Eingeborenen der Sandwichinseln haben sich die neuere Kultur – leider auch deren Laster! – mit Ausnahme einiger nationaler Eigentümlichkeiten, namentlich in Nahrung und Gewohnheiten, erstaunlich schnell angeeignet. Sie kleiden sich wie die Weißen. Ihre Kinder schicken sie freiwillig zur Schule, wo jene die englische Sprache schnell bemeistern; im Parlament zeichnen sie sich als Redner aus; die Gebildeteren unter ihnen wissen so gut in der Politik Bescheid wie irgend ein Yankee; als Seeleute und verwegene Reiter haben sie eine Berühmtheit erlangt. Sie schwärmen für Musik; ihre Vorliebe für Blumen hat etwas Kindliches, das außerordentlich angenehm berührt; sie besitzen einen Schatz von alten Helden- und Göttersagen, worauf jedes Volk der Welt stolz sein könnte. Daß ein solcher Volksstamm nicht die sittliche Kraft besitzt, sich der von den Weißen erlernten Laster zu erwehren, ist tief zu bedauern. Schon der Besuch der Schulen beweist, wie viel Tüchtiges in den Kanaken steckt. Im Jahre 1886 wurden im Königreiche Hawaii 172 Schulen mit 300 Lehrern von 9016 Schülern besucht, die sich nach Nationalitäten folgendermaßen verteilen:
Hawaiier
5881
Portugiesen
1185
Mischlinge
1042
Norweger
55
Amerikaner
300
Chinesen
130
Engländer
191
Südsee-Insulaner
24
Deutsche
175
Japaner
33
zusammen 9016 Schüler, und zwar 5060 Knaben und 3956 Mädchen. 44 000 Kanaken und Mischlinge sandten also nahezu 7000 Kinder in die Schulen; 20 000 Chinesen nur 130 Kinder! – Der Census-Superintendent macht dazu die Bemerkung, daß volle 80 % der eingeborenen hawaiischen Bevölkerung (d. h. solche, die das 6. Lebensjahr überschritten haben) Schulbildung genossen haben. 2/3 der Schüler werden nur in der englischen Sprache unterrichtet, 1/3 in Hawaiisch; der englische Unterricht ist in rascher Zunahme begriffen. Die für höhere Lehrzweige eingerichteten »Colleges« stehen fast alle unter der Leitung geistlicher Lehrer, namentlich katholischer Priester. Diese vorzüglichen Lehranstalten würden auch in alten Kulturländern ein hohes Ansehen genießen.
Drittes Kapitel.
Ein Königreich mit zwei Gasthäusern. – Das Hawaiian Hotel. – Erste Eindrücke in Honolulu. – Der Gegenseitigkeitsvertrag und seine Folgen. – Amerikanischer Einfluß und Gepflogenheiten. – Ein Paradies für Droschkenkutscher. – Straßenverkehr und Völkergemisch. – Léis-Kränze. – »Aloha!« – John Chinaman. – Das Musikchor des Herrn Berger. – Konzert in Queen Emma´s Square. – Kanaka-Reiterinnen.
Der Fremde, welcher eine Vergnügungsreise nach den Sandwichinseln unternommen hat, findet im Bereiche der Inseln nur zwei gute Gasthäuser, das allen vernünftigen Ansprüchen genügende Volcano-House auf der Insel Hawaii und das vorzügliche Hawaiian-Hotel in Honolulu. Wer sich längere Zeit in dieser Stadt aufhält, wird sich vielleicht ein möbliertes Zimmer mieten, ist aber alsdann auf die Restaurants angewiesen, die von zweifelhafter Güte sind. Die kleineren Kosthäuser sind nicht zu empfehlen. Will ein Reisender die Zuckerpflanzungen besuchen, oder Ausflüge nach den verschiedenen Inseln unternehmen, so ist er ausschließlich auf die Gastfreundschaft der Pflanzer angewiesen. Gasthäuser giebt es dort nicht. Die chinesischen Kosthäuser und Herbergen in einigen kleineren Plätzen verdienen nicht den Namen Gasthäuser und sind für einen civilisierten Menschen abscheulich. Es soll nun allerdings den von aller Welt abgeschlossen lebenden Pflanzern der Besuch eines gebildeten Europäers oder Amerikaners in früheren Jahren meistens recht angenehm gewesen sein. Die Gastfreundschaft der Pflanzer wurde aber nicht selten so mißbraucht, daß ein Fremdenbesuch ihnen heutzutage nur in Ausnahmefällen erwünscht ist. Seit von den sehr schreiblustigen Fremden, welche mit äußerster Gastfreundschaft aufgenommen wurden, insbesondere von Amerikanern, oft die entstellendsten Berichte über Hawaii in den Zeitungen veröffentlicht werden, sehn sowohl die Bürger Honolulus als die Pflanzer sich den hereingeschneiten Ausländer, der vielleicht Reisebriefe für ein Wochenblatt in Hangtown in Californien oder für eine Zeitung in Pike County in Missouri liefert, erst etwas genauer an, ehe sie ihn in ihre Familienkreise einführen, oder ihm ihre Gastfreundschaft anbieten. Scheint seine Bekanntschaft wünschenswert zu sein, so kann er sich auch heute noch gewiß nicht über einen kalten Empfang beklagen.
Das nach amerikanischem Vorbild eingerichtete und geleitete Hawaiian Hotel, ein ansehnliches von zwei übereinander liegenden breiten Verandas umgebenes Gebäude aus »Concrete« (durch Cement verkittete zerschlagene Lava- und Korallensteine), ist das Hauptquartier aller Fremden, welche Honolulu besuchen. Da die Unsitte der Trinkgelder noch nicht nach Hawaii gedrungen ist, so kann man den Preis von drei Dollars den Tag für Wohnung und Beköstigung nebst freien Bädern in diesem vorzüglichen Gasthof nicht hoch nennen. Bei Tisch werden meistens californische Weine getrunken. In der Vorhalle hängen große blutrote Vulkanbilder, Landkarten der Inseln, Photographien hawaiischer Naturschönheiten u. s. w. Die Landkarten werden oft von Reisenden beschaut, die ihre geographischen Kenntnisse bereichern wollen, während die blutigen Vulkanbilder an Dantes Hölle erinnern. Im untern Raum des Gasthauses befinden sich kleine Spielzimmer, ein großer Billardsaal und ein prächtiger, ganz nach amerikanischem Muster eingerichteter Trinkstand (bar). Zu jeder Stunde des Tages und bis spät in die Nacht hinein findet man dort durstige Seelen und eifrige Spieler, welche sich bemühen, die Zeit auf anständige Weise tot zu schlagen. Abends ist in jenen Räumen oft ein dichtes Gedränge. Da man hier, wie allerwärts auf den Inseln, wo die gerichtliche Erlaubnis für den Ausschank (license) 1000 Dollars das Jahr beträgt, nicht für weniger als ¼ Dollar seinen Durst zu löschen vermag, (selbst ein kleines Glas Bier macht keine Ausnahme!) so regnet es an der »Bar«, die eine förmliche Silbermine ist, von größeren Silbermünzen – hawaiisches oder amerikanisches Geld. Kein Gentleman wird so knauserig sein, wenn er sich in dem riesigen, von vergoldetem Schnitzwerk und Säulen überreich eingefaßten Spiegel betrachtet, ohne Mittrinker ein Labsal hinter die Binde zu gießen. Das unter den Inselbewohnern arg eingerissene Traktieren würde jeder californischen Minenstadt zur Ehre gereichen.
Die Aussicht von einer der vorderen Verandas des Gasthauses ist außerordentlich malerisch. Tamarinden, Pfefferbäume, Bananen, Palmen und Mangos, eine große mit Schoten behängte Algeroba (Johannisbrotbaum) und fremdartiges Strauchwerk bilden ganz in der Nähe einen reizenden Park, aus welchem munteres Vogelgezwitscher erschallt. Daneben befindet sich ein vielbesuchter Rasenplatz für Lawn-Tennis-Spieler. Jenseits des Gartens liegt eine hohe, weißgetünchte Steinmauer, die den Raum einschließt, auf welchem der Königspalast steht. Eine Anzahl niedlicher Häuschen, die zum Gasthof gehören, liegen in der Nähe desselben. Von den Verandas an der Rückseite des Gebäudes gewahrt man in nicht weiter Entfernung die nackten, steilen Abhänge des alten Punch-Bowl-Kraters, hinter demselben eine meistens mit Wolken bedeckte und oft mit einem Regenbogen geschmückte vielgipflige Bergkette, den 2013 Fuß hohen Tantalus (Puu Ohia) und den 2447 Fuß hohen Olympus oberhalb des Manoathales. Im Vordergrunde des Bildes prangt ein reicher tropischer Pflanzenwuchs. Herrlich ist die Rundschau aus einem oben auf dem Gebäude stehenden kleinen Glashause (cupola). Zu Füßen liegt die Stadt, wie in einem Park, und ringsum breiten sich das Gebirge, malerische grüne Triften und Thäler, Landsitze, der Hafen und das blaue Meer aus.
Auf einer der breiten Verandas zur Zeit der Passatwinde in einem bequemen Schaukelstuhl zu sitzen, den blauen Rauch einer echten Habana emporzuringeln, sich von den weichen Lüften fächeln zu lassen, in die fremdartige Umgebung hinauszuschauen und die Insassen der jeden Augenblick anlangenden oder abfahrenden hübschen Einspänner zu mustern, ist ein beneidenswerter Zeitvertreib. Und wenn bei allen diesen Genüssen noch die Tonflut des trefflichen hawaiischen Orchesters von Queen Emma's Square herüberschallt, wenn vielleicht des Abends eine Tanzgesellschaft sich im Gasthause versammelt hat, die vielen großen bunten Papierlaternen reihenweise an den Verandas hängen, die elektrischen Glühlampen an den Säulen und zwischen dem Laub der Bäume und in den bunten und roten Blättern der Sträucher im tropischen Park glänzen, wenn Honolulus bräunliche und weiße Schönen – wahre junonische Gestalten! – in leichten hellen Gewändern und geschmückt mit den prächtigsten Rosen, sich einstellen, das braune niedere Volk, auf den Kieswegen dicht geschart, der Freude zuschaut, der König selber in bürgerlicher Kleidung erscheint, die Fremden sich vorstellen läßt und mit ihnen plaudert, so befindet man sich dort wie in einer neuen Welt.
Honolulu ist während der Tageszeit ein sehr lebendiger Ort. Der Verkehr beginnt aber erst nach neun Uhr morgens, da die Kaufleute hier selten zu einer früheren Stunde ihre Geschäftshäuser und Läden öffnen. Die Hauptstraßen sind den Tag über voll von Fuhrwerken und Menschen. Nach Dunkelwerden dagegen wähnt man bei der schlechten Straßenbeleuchtung, namentlich in den Seitengassen, wo die Häuser sehr zerstreut stehn, sich in einer weitläufig gebauten Vorstadt zu befinden. Sonntags herrscht in Honolulu die Stille des Kirchhofs. Die vielen Schänken und alle Geschäftshäuser sind geschlossen; nur die Kirchen erfreuen sich eines lebhaften Besuchs. Die »Bar« im Hawaiian Hotel ist am Tage des Herrn nur durch ein niedriges viereckiges Loch vom Keller aus zu erreichen, da die dorthin führenden Thüren sonntags alle verriegelt sind. Die Geschäftsstraßen und viele Nebenstraßen in der inneren Stadt sind schmal und auch nicht immer nach dem Lineal ausgelegt. Die neuen, außerhalb des Geschäftsteils liegenden Straßen, an denen die Wohnhäuser stehn, sind dagegen breit und gerade. Es befinden sich in der Stadt große Lagerhäuser und Kaufläden, eine Eisengießerei, mehrere Maschinenwerkstätten, Holzhöfe, zwei Banken, zahlreiche Kirchen und Schulen und stattliche Regierungsgebäude.
Die Bauart der Häuser an den Geschäftsstraßen ist ganz amerikanisch. Die vornehmeren Wohnhäuser sind im Villenstil erbaut, und fast alle aus Holz. Beim Bau der Geschäftshäuser, Kirchen und öffentlichen Gebäude haben Ziegel, Korallen- und Lavasteine vielfach Verwendung gefunden. Das Holz wird vom Puget Sund und aus Oregon und Kalifornien eingeführt, die Ziegel werden in San Francisco angefertigt, weil es auf den Sandwichinseln keinen dafür passenden Lehmboden giebt. Die alten Grashütten der Eingeborenen sieht man heute nur noch in entlegenen Plätzen auf dem Lande. Sie werden auch von dort durch die billig herzustellenden Holzhäuser schnell verdrängt.
Durch den Zollvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und dem Königreiche Hawaii sind die Handelsbeziehungen des letzteren Reiches zu Amerika derartige geworden, daß man die Sandwichinseln heute, fast eine amerikanische Kolonie nennen kann. Aber jener Gegenseitigkeitsvertrag(reciprocity treaty),





























