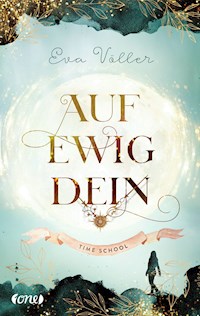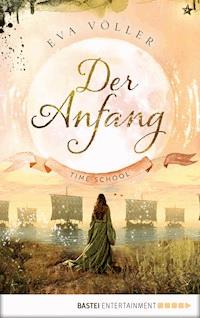9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Ruhrpott-Saga
- Sprache: Deutsch
Ruhrpott, 1968: Flowerpower, Studentenbewegung, Arbeitskampf. Als Bärbel nach dem Medizinstudium in ihre Heimatstadt Essen zurückkehrt, spiegelt sich die Zerrissenheit der Gesellschaft auch in ihrer eigenen Familie wider: Die Schwester und ihr Schwager kämpfen mit privaten und beruflichen Schwierigkeiten, für die es keine Lösung zu geben scheint, und ihr Bruder setzt mit politischen Aktionen seine Zukunft aufs Spiel. Doch vor dem größten Problem steht Bärbel selbst, als sie den Mann wiedersieht, den sie früher für die Liebe ihres Lebens hielt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungTEIL 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6TEIL 2Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12TEIL 3Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17TEIL 4Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22NachwortÜber dieses Buch
Band 3 der Reihe »Die Ruhrpott-Saga«
Ruhrpott, 1968: Flowerpower, Studentenbewegung, Arbeitskampf. Als Bärbel nach dem Medizinstudium in ihre Heimatstadt Essen zurückkehrt, spiegelt sich die Zerrissenheit der Gesellschaft auch in ihrer eigenen Familie wider: Die Schwester und ihr Schwager kämpfen mit privaten und beruflichen Schwierigkeiten, für die es keine Lösung zu geben scheint, und ihr Bruder setzt mit politischen Aktionen seine Zukunft aufs Spiel. Doch vor dem größten Problem steht Bärbel selbst, als sie den Mann wiedersieht, den sie früher für die Liebe ihres Lebens hielt …
Über die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.«
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
E V A V Ö L L E R
EineSehnsucht nachmorgen
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
unter Verwendung von Illustrationen von © ullstein bild/ullsteinbild.de; © shutterstock.com: Chris Hoff | Bildagentur Zoonar GmbH | Ruud Morijn Photographer | Everett Collection
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0740-4
luebbe.de
lesejury.de
Für Rosalie
T E I L 1
Kapitel 1
Schneematsch spritzte hoch und durchnässte Bärbels Mantel vom Kragen bis zum Saum. Mit einem empörten Aufschrei sprang sie zurück und blickte dem davonbrausenden Wagen nach. Einen Moment lang hatte sie geglaubt, er würde anhalten, doch dann hatte der Fahrer Gas gegeben und war weitergefahren. Möglicherweise auf Veranlassung der neben ihm sitzenden Frau, von der Bärbel einen kurzen, aber erkennbar giftigen Blick aufgefangen hatte. Als hätte sie es sich ausgesucht, am Silvesterabend hier am Straßenrand herumzustehen, durchgefroren und mit einem abgebrochenen Stiefelabsatz in der Hand.
Beim nächsten Fahrzeug, das die Abfahrt nach Essen ansteuerte, hatte sie mehr Glück. Der Wagen hielt neben ihr an, und die Beifahrertür wurde aufgestoßen.
Der Fahrer hatte sich vorgebeugt und blickte sie erwartungsvoll an. »Wie viel?«, fragte er, während er sie auf eindeutige Weise musterte.
Bärbel schlug kommentarlos die Autotür zu und wandte sich wütend ab. Der abgewiesene Fahrer schien nicht weniger entrüstet zu sein als sie. Er fuhr mit durchdrehenden Reifen davon, und Bärbel wurde von einer weiteren Ladung Schneematsch getroffen. Sie fluchte.
Anschließend musste sie geschlagene zehn Minuten warten, bis wieder ein Wagen anhielt. Diesmal war es ein ziemlich verbeulter Kleinlaster, aber er wurde sofort langsamer, als Bärbel den Daumen raushielt. Mit quietschenden Bremsen kam er auf der Standspur zum Stehen. Auf der Ladefläche geriet einiges von dem Altmetall, das dort aufgestapelt war, in Bewegung. Scheppernd rutschten diverse alte und verbogene Eisenteile hin und her, und durch die Ladeklappe rieselte etwas Rost in den frisch gefallenen Schnee.
Anscheinend ein Klüngelskerl, wie man die Schrottsammler hier im Ruhrgebiet nannte. Bärbel erinnerte sich, wie begeistert sie früher als Kind losgestürmt war, sobald draußen das unverwechselbare Dudeln ertönte und der Pritschenwagen vorbeigetuckert kam. Es war immer ein faszinierendes Ereignis gewesen, wenn in der Nachbarschaft das Gerümpel abgeholt wurde, lauter Kram, der so alt und unbrauchbar war, dass sogar die ärmeren Leute nichts mehr damit anfangen konnten.
Der Fahrer des Pritschenwagens reckte sich über den Beifahrersitz und machte ihr die Tür auf. »Nach Essen rein?«
Bärbel nickte und betrachtete ihn verstohlen. Er war ein verhutzeltes Männlein von mindestens siebzig und sah nicht so aus, als hätte er ähnliche Absichten wie der Idiot von vorhin.
»Können Sie mich ein Stück mitnehmen?«
»Klar. Wenn et Sie nich stört, dat et ein bissken eng und dreckich hier drin is.«
»Keine Spur«, erklärte Bärbel. Sie war heilfroh, endlich aus der Kälte zu kommen. Ihre Beine fühlten sich mittlerweile wie Eiszapfen an. Die grobmaschige Netzstrumpfhose war definitiv nicht die passende Bekleidung für einen verschneiten Winterabend.
Entschlossen quetschte sie sich zusammen mit ihrem Koffer auf die Beifahrerseite. Eine Rückbank gab es nicht. Sie bugsierte das sperrige Ding zwischen sich und den Fahrer und machte sich so klein wie möglich. Trotzdem musste sie noch eine Weile herumruckeln, bis sie die Wagentür schließen konnte.
»Wie kommen Sie denn überhaupt mit sonnem großen Koffer anne B eins?«, fragte der Klüngelskerl, während er den Wagen wieder startete. Der erste Gang knarrte protestierend beim Einlegen.
»Ich war mit dem Auto unterwegs und hatte eine Panne.«
»Wo steht Ihr Wagen denn getz?«
»Ein Stück weiter dahinten, auf einem Parkplatz. Ich bin die letzten zwei Kilometer bis zur Abfahrt gelaufen.«
Der Fahrer reckte den Kopf, um einen genaueren Blick auf sie zu erhaschen. Bärbel hatte den Koffer halb auf den Schoß gezogen, und dabei war ihr Mantel hochgerutscht. Normalerweise reichte er ihr bis zu den Knöcheln. Darunter trug sie immer noch das in grellen Farben gemusterte Minikleid und die kniehohen weißen Lackstiefel sowie besagte Netzstrumpfhose. Sie hatte sich schon am Nachmittag für die Silvesterparty zurechtgemacht, zu der sie mit Gerhard hatte gehen wollen. Die Sachen hatte sie zur Arbeit mitgenommen und sie gleich nach Dienstschluss im Umkleideraum der Klinik angezogen. So hatte sie nicht extra noch einmal zu ihrer Wohnung fahren müssen.
Der Klüngelskerl starrte ungeniert auf ihre Beine. »Bisse überhaupt schon volljährig? Wissen deine Eltern, wo du dich spätabends rumtreibst?« Stirnrunzelnd fragte er weiter: »Bisse etwa von zu Hause abgehauen?«
Sein Tonfall schwankte zwischen Missbilligung und Besorgnis. Bärbel seufzte innerlich, weil sie wenig Lust hatte, ihre Situation zu erklären, aber zugleich war sie erleichtert, weil sein Interesse an ihr nur väterlicher Natur zu sein schien.
»Ich bin viel älter, als ich aussehe, schon sechsundzwanzig«, sagte sie wahrheitsgemäß. Scherzhaft fügte sie hinzu: »Soll ich Ihnen meinen Ausweis zeigen?«
Das schien der Klüngelskerl nicht für nötig zu halten. Er ging wieder zum Sie über.
»Wo wollen Sie denn eigentlich genau hin?«, erkundigte er sich.
»Nach Fischlaken.«
»In Fischlaken hab ich früher auch oft meine Runden gedreht!« Es klang eine Spur sentimental. »Is aber gut und gerne zwanzig Jahre her.«
»Ich erinnere mich«, sagte Bärbel. »Als Kinder sind wir da immer hinter Ihrem Wagen hergerannt.«
»Ach wat! Dat gibbet doch nich! Wat is die Welt doch klein!« Er dachte kurz nach. »Damals hatte ich noch en anderes Auto.«
Bärbel zuckte mit den Schultern. Sein einstiges Auto war ihr genauso gammelig und verbeult vorgekommen wie das heutige, sie hätte beim besten Willen keinen Unterschied feststellen können.
»Sie stammen aber nich hier ausse Gegend, oder?«, fragte der Klüngelskerl.
»Nein, ich bin in Berlin geboren und erst zum Kriegsende in Essen gelandet.«
»Kommen Sie da getz gerade her? Aus Berlin?«
»Nein, aus Hamburg.« Bärbel erspähte eine Telefonzelle. »Da drüben können Sie mich rauslassen. Ich rufe meine Schwester an, die kann mich dann hier abholen.«
»Quatsch, ich bring Sie dat Stücksken noch. Ich muss nach Kettwig, dat is ja bloß ein kurzer Schlenker nach Fischlaken.«
Bärbel wollte protestieren, doch er war schon weitergefahren.
»Und in Hamburg? Wat haben Sie da gemacht?«, wollte er wissen.
Mein Leben ruiniert, dachte Bärbel.
»Gearbeitet«, sagte sie.
Das schien erst recht seine Neugier zu wecken.
»Als wat denn?«
Bärbel war versucht, ihm irgendwas vorzulügen, damit er Ruhe gab, denn wenn sie die Wahrheit sagte, würde es unweigerlich zu weiteren Fragen kommen. Sobald die Leute erfuhren, welchen Beruf sie ausübte, erntete sie regelmäßig ungläubige Blicke.
»Ich bin Ärztin«, sagte sie. »Im ersten Berufsjahr«, ergänzte sie, in dem Bestreben, es weniger hochtrabend klingen zu lassen. Dennoch schien er es kaum fassen zu können.
»Ne richtige Ärztin? Eine Frau Doktor? So mit weißem Kittel?«, vergewisserte er sich. Ehrfurcht lag in seiner Stimme.
Bärbel nickte leicht verlegen. Es war ihr zuwider, in irgendeiner Weise Eindruck zu schinden, deshalb mochte sie diese Art von Gesprächen nicht.
»Haben Sie in Hamburg eine eigene Praxis?«
»Nein, ich arbeite im Krankenhaus. In der Chirurgie.«
Dass sie nie wieder einen Fuß in die Eppendorfer Klinik setzen würde, erwähnte sie lieber nicht.
»Hamburg – dat is weit weg«, sagte der Klüngelskerl. Sein Bedürfnis, das Gespräch in Gang zu halten, schien nicht nachzulassen. »Wat hat Sie denn dahingezogen?«
»Ich wollte mal aus dem Ruhrpott raus.«
Auch das war nicht wirklich die Wahrheit. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie nie von hier weggehen müssen.
Der Klüngelskerl wollte die Konversation nicht abreißen lassen. »Wie is dat denn da oben im Norden so?«
Bärbel gab die erstbeste Antwort, die ihr in den Sinn kam. »Kalt und windig.«
Der Klüngelskerl lachte und ließ dabei ein paar braune Zahnstümpfe sehen. »Dat kricht man hier im Ruhrpott auch geboten. Und den Dreck vonne Schlote noch obendrauf.«
Bärbel lachte pflichtschuldigst mit. »Ja, der Kohlenstaub bleibt uns hier in der Gegend wohl noch eine Weile erhalten, auch wenn immer mehr Zechen schließen.«
Danach verstummte sie, und zu ihrer Erleichterung hörte der Klüngelskerl auf, sie über ihr Leben auszufragen. Stattdessen fing er an, von sich selbst zu erzählen. Warum er am Silvesterabend noch unterwegs war, wo doch alle anderen Leute längst ins neue Jahr reinfeierten (er hatte sich den Metallschrott aus einer großen Haushaltsauflösung sichern können, das durfte er sich nicht entgehen lassen), und dass im letzten Jahr seine Frau gestorben war. Unterleibskrebs, die Ärzte hatten alles versucht, leider vergeblich. Seine jüngste Tochter, die genauso alt war wie Bärbel, stand kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, vielleicht kam es sogar schon morgen auf die Welt, er konnte es kaum erwarten. Endlich ein Enkelkind, darauf freute der Klüngelskerl sich unendlich, und der einzige Wermutstropfen bestand darin, dass seine Frau das nicht mehr erleben durfte. Sie hatten noch zwei ältere Töchter gehabt, Zwillinge, aber die waren als kleine Mädchen gestorben. Beide innerhalb von acht Tagen, an Polio, wie er Bärbel berichtete, mit einer Stimme, aus der immer noch der alte Schmerz herausklang.
Spontan bekundete sie ihr Mitgefühl. Unwillkürlich erinnerte sie sich an die frühen Fünfzigerjahre, als diese furchtbare Seuche noch ungebremst über das Land hinweggezogen war. Einmal, da war sie elf oder zwölf gewesen, hatte man deswegen sogar die Freibäder am Baldeneysee den Sommer über dichtgemacht, aus Sorge, dass die Menschen sich im Wasser ansteckten. Zahlreiche Kinder waren damals an der Krankheit gestorben, und von denen, die sie überlebt hatten, waren viele als Folge gelähmt. Vereinzelt gab es immer noch Fälle, obwohl mittlerweile flächendeckend gegen Poliomyelitis geimpft wurde. Der Slogan der Vorsorgekampagne war in aller Munde – Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Trotzdem ließ immer noch längst nicht jeder seine Sprösslinge impfen, abgesehen von der Pockenimpfung, die war Pflicht.
Sie fuhren durch Bredeney, und Bärbel betrachtete durch das trübe Seitenfenster die vertrauten Straßenzüge der Stadt, in der sie sich früher immer heimisch gefühlt hatte. Bis zu dem Tag, als alles in Stücke gebrochen war.
Hastig verbannte sie die Erinnerungen aus ihren Gedanken und versuchte stattdessen, die Schneeflocken zu zählen. Aber die wurden immer zahlreicher, denn unversehens hatte heftiges Schneetreiben eingesetzt. Die altersschwachen Scheibenwischer kämpften mühsam dagegen an, und der Klüngelskerl streckte den Kopf übers Lenkrad, als könnte er so besser die Straße erkennen, deren Begrenzung im dürftigen Lichtkegel der Scheinwerfer kaum noch zu sehen war. Bärbel verkniff sich die Frage, ob er nicht lieber seine Brille aufsetzen wolle; falls er überhaupt eine besaß, taugte die wahrscheinlich bloß zum Lesen. Als sie den steilen Bredeneyer Berg hinunterfuhren, reduzierte er zum Glück die Geschwindigkeit so weit, dass die Gefahr, auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen zu geraten, nicht mehr ganz so groß war.
Von der Brücke aus, die in Werden über die Ruhr führte, waren es nur noch ein paar Minuten Fahrt bis nach Fischlaken. So gesehen war es tatsächlich bloß ein kurzer Schlenker für den Klüngelskerl. Bis Mitternacht dauerte es noch eine gute Stunde. Er würde früh genug bei seiner Tochter und seinem Schwiegersohn in Kettwig eintreffen, um mit ihnen auf das neue Jahr anzustoßen.
Bärbel wies ihm den Weg. Während er in die Straße einbog, in der sie aufgewachsen war, wurde ihr ein wenig mulmig zumute, denn sie würde gleich unangemeldet ins Haus platzen. Als sie am Nachmittag in Hamburg aufgebrochen war, hatte sie einfach nur heimgewollt. Wahllos hatte sie ihren Koffer vollgestopft und war losgefahren, als wäre der Teufel hinter ihr her. Inge und die anderen würden aus allen Wolken fallen, auch wenn Bärbel nicht daran zweifelte, dass sie sich unbändig über ihre unverhoffte Heimkehr freuen würden. Sie war ewig nicht zu Hause gewesen, das letzte Mal vor gut sechs Monaten. Seither hatte sie zwar fast wöchentlich mit der Familie telefoniert, und ihre Schwester und ihr Schwager hatten sie im Laufe des vergangenen Jahres auch zweimal in Hamburg besucht, einmal anlässlich ihrer Approbation und das zweite Mal zur Promotionsfeier. Doch ihr Vater und ihr Bruder Jakob waren nicht dabei gewesen. Sie hatten angenommen, dass sie ohnehin bald wieder auf Urlaub heimkäme, so wie schon während des Studiums, da hatte sie sich ja auch regelmäßig zu Hause blicken lassen.
Doch in der Folgezeit hatte es einfach nicht klappen wollen. Größtenteils wegen der vielen anstrengenden Dienste in der Klinik, aber auch wegen Gerhard, der sie in ihrer Freizeit häufig in Beschlag genommen hatte.
Es gab noch einen dritten Grund, doch über den dachte Bärbel nur ungern nach.
Immerhin hatte sie ursprünglich vorgehabt, wenigstens Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Bei der Gelegenheit hätte sie anschließend auch gleich mit ihren Geschwistern Geburtstag feiern können – ihren eigenen und den von Inge und Jakob. Sie hatten alle drei in der letzten Dezemberwoche Geburtstag. Aber dann hatte man sie in der Klinik gebeten, über die Festtage eine Vertretung zu übernehmen. Sie hatte zugestimmt, weil sich sonst keiner gefunden hatte. Und weil sie wusste, dass sie daheim in Fischlaken unweigerlich dem dritten Grund begegnen würde.
»Oh, bitte anhalten, wir sind schon da!« Bärbel wurde schlagartig aus ihren düsteren Gedanken gerissen. Um ein Haar wäre der Pritschenwagen am Ziel vorbeigefahren. Der Klüngelskerl hielt an, und sie bedankte sich herzlich bei ihm.
»Sie waren meine Rettung!«
»Dat hab ich doch gern gemacht«, wehrte er ab.
Sie bestand darauf, dass er ihr seine Adresse nannte, weil sie ihm eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen wollte, worauf er meinte, dass das wirklich nicht nötig sei und ob sie sich stattdessen mal eben seine rechte Hand ansehen könne.
»Die Finger schlafen nachts ein«, sagte er. »Immer die ersten drei, wie ne Schwurhand. Und dann tut dat richtig weh. Wat kann dat sein?«
Über ihren Koffer hinweg streckte er ihr seine Rechte hin. Bärbel untersuchte sie, so gut es bei der schwachen Innenbeleuchtung des Wagens eben ging. Er hatte Arthrose in den Fingergelenken, aber das war für sein Alter nicht ungewöhnlich. Der Daumenballen war leicht atrophiert, ganz so, wie sie es nach seiner Schilderung bereits vermutet hatte. Sie bog sein Handgelenk nach innen.
»Tut das weh?«
Er überlegte kurz, doch dann setzten auch schon die Schmerzen ein. »Aua, ja.«
»Und das?« Sie klopfte an der Innenseite des Handgelenks auf die Nervenbahn.
»Hm, ja, wie tausend Ameisen.«
»Höchstwahrscheinlich ein Karpaltunnelsyndrom«, sagte sie.
»Wat is dat?«
»Eine Einengung der Nerven. Man kann es operieren, aber oft hilft schon eine Handschiene, die man nachts trägt. Haben Sie auch tagsüber Beschwerden?«
»Kaum.«
»Dann lassen Sie sich am besten von Ihrem Hausarzt eine Schiene verordnen.«
»Können Sie mir nich einfach eben eine aufschreiben?«
Sie lächelte ein wenig schief. »Ich habe keinen Rezeptblock.«
»Dann sollten Sie sich so wat aber mal schleunigst besorgen. So ne tüchtige Frau Doktor wie Sie!«
Sie lachte. »Ich bin erst Assistenzärztin, so schnell schießen die Preußen nicht.«
»Ach wat. Sie werden et noch allen zeigen!« Er wünschte ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr, und nachdem sie ihren Koffer auf die Straße gewuchtet und die Autotür zugeworfen hatte, winkte er ihr zum Abschied zu.
Klappernd und rumpelnd fuhr der kleine Laster anschließend davon, und Bärbel blieb für einen Augenblick stehen und schaute ihm nach, tief in alte Erinnerungen versunken.
*
Durch den dicht fallenden Schnee kam ein Mann näher und blieb vor dem Nachbarhaus stehen, nur ein paar Schritte von ihr entfernt.
Sie wusste sofort, dass er es war, obwohl sie sein Gesicht unter der dunklen Wintermütze nicht genau erkennen konnte. Jede Linie seiner Gestalt war ihr so vertraut wie ihr eigener Körper. Na klar, dachte sie in einer Aufwallung von hilflosem Sarkasmus. Kaum setzte sie nach so langer Zeit wieder einen Fuß in die Gegend, war er der erste Mensch, der ihr über den Weg laufen musste!
Andererseits – was hatte sie denn erwartet, wie lange es bis dahin dauern würde? Er wohnte ja jetzt wieder hier. Direkt nebenan.
Nur mit Mühe widerstand sie dem Impuls, einfach wortlos ins Haus zu laufen. Den Schlüssel hatte sie schon griffbereit in der Hand.
»Hallo Bärbel«, sagte er. Seine Stimme klang rau, vielleicht ein bisschen tiefer als damals. Sie hatte in all den Jahren kein einziges Wort aus seinem Mund gehört. Er war schon früh von zu Hause ausgezogen, im selben Jahr wie sie, und wenn er danach seinen Vater und seinen Bruder überhaupt noch besucht hatte, war das nie während ihrer Anwesenheit geschehen. Irgendwie hatte er immer herausgefunden, wann sie nach Hause kam. Dann hatte er sich jedes Mal ferngehalten. Nur einmal nicht, vor gut vier Jahren, da war sie unangemeldet aufgetaucht, so wie heute. Es war ein heißer Sommertag gewesen, und er hatte nebenan im Garten den Zaun repariert, unbekleidet bis auf ein Paar verwaschene Shorts. Sie hatte ihn zwei oder drei Herzschläge lang wie gebannt angestarrt, und als er aufblickte, war sie auf der Stelle durch die Kellertür ins Haus zurückgerannt, in der Hoffnung, dass er sie nicht bemerkt hatte.
Die Flucht anzutreten kam diesmal allerdings nicht infrage. Sie musste endlich anfangen, erwachsen mit der Situation umzugehen.
»Guten Abend, Klaus. Lange nicht gesehen.« Sie räusperte sich und deutete auf das Nachbarhaus, das deutlich breiter und moderner aussah als bei ihrem letzten Besuch. Klaus hatte den Sommer über alles sanieren und einen Anbau errichten lassen, ganz ähnlich wie seinerzeit Johannes und Inge. »Ist schön geworden, euer Haus.«
»Ja, ist eine Menge Platz dazugekommen. Ich wohne jetzt wieder hier. In den beiden oberen Etagen.«
Bärbel nickte. »Hab ich gehört.«
Und natürlich wusste sie auch, dass er nicht allein dort eingezogen war, sondern mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Er hatte vor gut drei Jahren geheiratet, und das Kind war nur vier Monate später auf die Welt gekommen. Inge hatte es ihr erzählt, auch wenn es sie eine Menge Überwindung gekostet hatte. Ihre Schwester war schon immer eine Art Löwenmutter gewesen, sie ertrug es nicht, wenn die Gefühle ihrer jüngeren Geschwister verletzt wurden.
»Feierst du nicht Silvester?«, fragte sie in unverbindlichem Ton.
»Doch. Klar. War nur gerade Zigaretten holen.«
»Ach, du rauchst?«
»Sind nicht für mich«, meinte er wortkarg. Dann deutete er auf ihren Koffer. »Bleibst du länger?«
»Eine Weile auf jeden Fall.«
Einen Moment schien es ihr, als würde er es gern genauer wissen wollen, aber er nickte nur.
»Dann will ich mal reingehen«, sagte Bärbel.
»Ja, ich auch.« Er ging zu seiner Haustür. »Bis dann. Und guten Rutsch.«
»Danke, dir auch.«
Bärbel atmete auf. Na also, das war doch gar nicht so schwer gewesen. Erleichtert über den unkomplizierten Verlauf des Gesprächs setzte sie sich in Bewegung. Wegen des abgebrochenen Absatzes musste sie humpeln.
Klaus war abrupt stehen geblieben. »Bist du verletzt?« Eilig kam er näher. »Was ist mit deinem Bein passiert?«
»Nichts weiter, nur ein abgebrochener Absatz.«
»Ach so.« Er war jetzt nur noch drei Schritte von ihr entfernt, höchstens vier. Sie konnte trotz des Schneetreibens sein Gesicht erkennen, und mit einem Mal fühlte es sich so an, als würde eine Faust ihr Herz zusammendrücken. Er sah noch fast so aus wie früher. Die Gesichtszüge etwas kantiger, der Bartschatten dunkler, die Brauen eine Spur dichter. Aber sonst hatte er sich nicht verändert.
Er blickte sie unverwandt an. »War das vorhin eigentlich der Klüngelskerl, der dich hier abgesetzt hat?«
»Sag bloß, du hast den wiedererkannt?«, entfuhr es Bärbel.
»Nein, aber sein Auto.«
»Er hat gesagt, er hätte ein anderes als früher.«
Klaus lachte. »Die Ladefläche war voller Eisenschrott. Es kann nur der Klüngelskerl gewesen sein. Irgendeiner, egal welcher.«
Sein Lachen ging ihr durch und durch. Mit einem Mal war er wieder der Junge von früher.
Sie schüttelte den Kopf. »Es war nicht irgendein Klüngelskerl, sondern unser Klüngelskerl. Der, der damals hier rumgefahren ist. Er hat’s mir erzählt.« Sie hielt inne und erwiderte seinen Blick, ehe sie leise fragte: »Weißt du noch, wie wir immer hinter dem hergerannt sind?«
In ihrer Frage lag alles. Die Erinnerung an die verschworene Freundschaft ihrer Kindheit, an die endlosen goldenen Sommertage, die sie zusammen verbracht hatten, im Wald und unten im Hespertal. Die übermütigen Schlittenfahrten im Winter, auf den schneebedeckten Hängen am Ortsrand. Und später die Liebe, die aus dieser Freundschaft erwachsen war und von der sie beide einst geschworen hatten, dass sie niemals aufhören würde.
Klaus gab keine Antwort, doch Bärbel glaubte, einen Anflug von Verzweiflung in seinen Zügen wahrzunehmen. Eine Sekunde später verschloss sich sein Gesicht.
»Natürlich weiß ich das noch«, sagte er. Seine Miene wirkte seltsam ausdruckslos. »Ich habe nichts vergessen.« Er nickte ihr zu. »Mach’s gut, Bärbel. Man sieht sich.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging zurück nach nebenan.
*
Tief durchatmend schloss sie die Haustür auf. Sie hatte dieses erste zufällige Zusammentreffen gut gemeistert, fand sie. Zwar nicht ganz so souverän, wie sie es sich gewünscht hätte – die Frage, ob er sich noch an den Klüngelskerl erinnerte, hätte sie sich schenken können –, aber dafür war sie diejenige gewesen, die den Ton ihrer Unterhaltung bestimmt und damit die Richtung vorgegeben hatte, wie es künftig ablaufen würde. Knapp, gleichmütig und nichtssagend. Sie würde ihm bei weiteren Begegnungen gegenübertreten können wie den anderen Nachbarn auch, und keine Sekunde lang würde sie sich anmerken lassen, dass er ihr damals das Herz gebrochen hatte. Kummer und Leid von einst waren längst überwunden. Ebenso wie die nachfolgende Wut, die sich im Laufe der Zeit in bitteren Groll verwandelt hatte. Aber auch dieses Gefühl war irgendwann vergangen. Geblieben war nur jenes Unbehagen, das sie davor zurückscheuen ließ, mit ihm zusammenzutreffen. Dabei kamen einfach zu viele Erinnerungen hoch. Genau das hatte ihr in den letzten Monaten die Heimfahrten verleidet. Es war absolut nachvollziehbar, dass sie sich solche Unannehmlichkeiten vom Hals halten wollte.
Doch auch damit würde sie fertigwerden. Schließlich war das mit ihnen beiden lange her, und sie war kein Teenager mehr.
Sie musste sich die Begegnung mit ihm nur wie eine Art Impfung vorstellen, überlegte sie in spontaner Anknüpfung an ihre Gedanken vorhin während der Fahrt. Wie einen wiederholten Kontakt mit einem abgeschwächten Virus. Man wurde davon nicht krank, sondern immun.
Im Haus war Musik zu hören, sie kam aus dem Wohnzimmer. Bärbel klopfte kurz und öffnete die Tür zu dem Raum, der vor vielen Jahren einmal Oma Mines gute Stube gewesen war. Es war niemand da, obwohl das Radio lief.
Flüchtig registrierte Bärbel die neue Stereoanlage, zeitgemäß und modern wie das ganze Zimmer.
Durch den Anbau war der Raum jetzt fast doppelt so groß wie früher. Inge und Johannes hatten ihn ganz nach ihrem Geschmack eingerichtet, mit deckenhohen, zum Bersten vollen Bücherregalen, bequemen Sesseln, einem breiten Sofa und einer schönen alten Anrichte, die sie von Oma Mines Mobiliar behalten und aufgearbeitet hatten.
Unvorstellbar, dass hier damals nach dem Krieg, als das Zimmer nur halb so groß gewesen war, ganze Familien zwangseinquartiert worden waren. Bärbel hatte als Kind noch etliche von ihnen kommen und gehen sehen, und später dann die Bergleute, die jeweils zu zweit oder zu dritt für kleines Geld bei Oma Mine logiert hatten.
Bärbel ging den Flur entlang zur Küche. Auch die war gründlich modernisiert worden und viel geräumiger als früher. Den alten Spülstein und den Kohleherd gab es nicht mehr, und die gemütliche kleine Eckbank sowie Oma Mines Tisch mit der ewig gleichen Wachstuchdecke waren einer schicken neuen Einbauküche gewichen. Johannes und Inge hatten die Trennwand zum Nachbarraum herausreißen lassen, Oma Mines einstigem Schlafzimmer, das nun direkt an die offene Küche angrenzte und in ein Esszimmer mit herrlichem Blick in den Garten verwandelt worden war. Von dort gelangte man durch eine Verbindungstür in einen weiteren Raum, der durch den Anbau hinzugekommen war. In diesem Zimmer hatte vor drei Jahren Claire Sieber ihre Zelte aufgeschlagen, eine entfernte Cousine von Bärbels Vater Karl, die von allen nur Tante Clärchen genannt wurde. Nach Mines Tod hatte sie hier ein neues Heim gefunden. Ihr Mann war ebenfalls in jenem Jahr verstorben, und das bisschen Witwenrente, das ihr zur Verfügung stand, war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Da hatte es gut gepasst, dass Inge und Johannes gerade dringend eine Haushälterin gesucht hatten, die sich tagsüber auch um Jakob kümmerte.
Aber auch Tante Clärchen war heute Abend offenbar ausgeflogen.
Bärbel ging zurück in den Flur und weiter zur Treppe, die nach oben zu den Schlafräumen führte.
»Hallo, niemand zu Hause?«, rief sie.
Keine Reaktion. Anscheinend war wirklich keiner da. Etwas enttäuscht schleppte sie ihren Koffer die Treppe hoch und schaute nacheinander in alle Räume. Das Zimmer ihres Vaters war verlassen, und auch im Schlafzimmer von Inge und Johannes sowie im angrenzenden Bad, das einst eine kleine Küche gewesen war, hielt sich niemand auf.
Bärbel stieg die Treppe zur Dachetage hoch. Aus den beiden ehemaligen Mansardenkämmerchen war ein einziger großer Raum entstanden, in dem jetzt ihr Bruder sein Reich hatte. Doch auch er war nicht da, obwohl in seinem Zimmer das Licht brannte.
In einer Mischung aus Wehmut und Belustigung schaute Bärbel sich in Jakobs Zimmer um. Es sah wie üblich chaotisch aus, mit Socken unterm Bett, getragener Wäsche in den Ecken und diversen Büchern, die überall aufgeschlagen herumlagen, eine seltsam anmutende Sammlung aus Abenteuerromanen und Fachbüchern. Jakob konnte sich nicht nur mit Hingabe in Karl May vertiefen, sondern auch in komplizierte Abhandlungen über irgendwelche algebraischen Theoreme. Er hatte schon sehr früh eine ungewöhnliche Begabung für die Mathematik gezeigt, und obwohl er erst sechzehn war, korrespondierte er bereits mit namhaften Wissenschaftlern. Daneben hatte er ein ausgeprägtes Interesse für gesellschaftspolitische Themen entwickelt, er las Marx und Engels, Adorno und Horkheimer und vertrat die Meinung, dass jeder klar denkende Mensch aktiv daran mitarbeiten müsse, die Welt zu verbessern.
Auf einem Tischchen stand ein Schachbrett, die Figuren in einer kniffligen Pattaufstellung. Auch das war eine von Jakobs Vorlieben – er spielte gern bekannte Partien nach und suchte dabei nach raffinierten Varianten.
Auf dem Fußboden hatte er ein weiteres Strategiespiel aufgebaut, es nannte sich Risiko, und er versuchte ständig, jemanden aus der Familie zu überreden, gegen ihn anzutreten. Jeder musste mal dran glauben, aber es machte keinen richtigen Spaß, weil Jakob immer gewann. Folglich spielte er es meist mit sich selbst, ähnlich wie beim Schach.
Bärbel trug ihren Koffer nach nebenan in ihr eigenes Zimmer. Dieser Raum war ebenfalls durch den Anbau hinzugekommen.
In den ganzen Jahren seit ihrem Auszug hatte sich hier nichts verändert, obwohl sie das Zimmer während ihrer Schulzeit nur noch für wenige Monate bewohnt hatte. Als der Anbau erstellt worden war, hatte sie schon kurz vorm Abitur gestanden, und gleich danach war sie zum Studium nach Norddeutschland gezogen. Trotzdem hatten Inge und Johannes alles so belassen wie früher – ein hübsches Mädchenzimmer mit Schleiflackmöbeln, Flokati-Brücke vorm Bett und einer mit bunten Schnörkeln selbst bemalten kleinen Schminkkommode. Nicht zu vergessen die Poster an den Dachschrägen, von Stars, für die sie damals geschwärmt hatte.
Bärbel zog den Mantel aus und hängte ihn zum Trocknen auf einen Bügel, dann klappte sie ihren Koffer auf und holte ein Paar bequeme Slipper heraus, die sie gegen die Stiefel tauschte. In Gedanken versunken ging sie wieder nach unten. In diesem Moment wurde die Haustür aufgesperrt, und Inge kam herein.
Bei Bärbels Anblick entwich ihr ein Überraschungsschrei.
»Bärbel! Wo kommst du denn auf einmal her?«
»Aus Hamburg«, gab Bärbel grinsend zurück.
»Sag bloß.« Inge strahlte über das ganze Gesicht. Sie breitete die Arme aus, und Bärbel umschlang ihre ältere Schwester in inniger Zuneigung. In diesem Augenblick war sie einfach nur glücklich, wieder zu Hause zu sein. Alle Probleme schienen mit einem Mal weit weg.
Auch ihr Schwager Johannes betrat das Haus. »Na, so was. Je später der Abend!« Sein markantes Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. »Du bist mir vielleicht eine! Schneist hier herein, ohne Bescheid zu sagen! Aber wenigstens gerade noch rechtzeitig, um mit uns aufs neue Jahr anzustoßen!« Er umarmte Bärbel ebenfalls voller Herzlichkeit.
»Wo wart ihr denn?«, wollte sie wissen. »Im ganzen Haus ist Festbeleuchtung, und das Radio läuft auch.«
»Gegenüber bei Stan und Renate«, antwortete Inge. »Die veranstalten eine kleine Silvesterfeier. Papa und Tante Clärchen sind auch drüben. Am besten kommst du gleich mit uns rüber, die werden Augen machen! Papa kriegt sich bestimmt nicht mehr ein vor Freude, dass du da bist!«
»Ist Jakob auch dort?«
»Nein, er wollte mit Freunden feiern«, sagte Inge. »Und weil er als Letzter gegangen ist, hat der zerstreute Herr Professor wohl mal wieder vergessen, das Licht und das Radio auszumachen. Deswegen sind wir auch hier – um nachzuschauen, ob er nicht noch zusätzlich für den nächstbesten Einbrecher die Haustür offen gelassen hat.« Vergnügt schloss sie: »Und dabei finden wir dich!« Ein Ausdruck unverhüllter Begeisterung stand auf ihrem hübschen Gesicht. Bärbel sog ihren Anblick in sich auf. Wie immer sah ihre große Schwester umwerfend aus, mit ihren kurz geschnittenen blonden Haaren, den strahlend hellen Augen und einem Lächeln, um das so manche Hollywoodschönheit sie beneiden konnte. Sie brauchte keine besondere Aufmachung, um den Betrachter in Bann zu schlagen. An diesem Abend trug sie ein geblümtes, tunikaähnliches Kleid, das sie selbst genäht hatte. Es war kurz genug, um ihre schönen schlanken Beine zu zeigen, doch anders als bei Bärbel endete es nicht zwei Handbreit über dem Knie, sondern nur eine. Inge ging durchaus mit der Mode, aber sie kleidete sich ein wenig zurückhaltender als ihre jüngere Schwester. Das lag allerdings nicht unbedingt an dem Altersunterschied von sechs Jahren, sondern daran, dass Bärbel sich schon von jeher gern etwas frecher angezogen hatte.
Inge ist jetzt fast so alt wie Mama damals bei ihrem Tod, durchfuhr es Bärbel. Sofort erschrak sie über diesen verstörenden Gedanken. Wieso war ihr das jetzt in den Sinn gekommen, ausgerechnet bei diesem glücklichen Wiedersehen?
Vielleicht, weil niemand aus der Familie ihr so nahestand wie ihre Schwester und Bärbel es nicht hätte ertragen können, wenn ihr das genommen würde. Und weil der Verlust ihrer Mutter immer noch bis in die Tiefen ihrer Seele wehtat, sogar noch nach sechzehn Jahren.
»Noch mal nachträglich alles Gute zum Geburtstag«, sagte sie, in dem hastigen Bemühen, die traurigen Erinnerungen zu vertreiben.
»Danke gleichfalls«, erwiderte Inge.
Sie hatten einander zu Weihnachten Pakete geschickt und dabei auch gleich die gegenseitigen Geburtstagsgeschenke mit dazugelegt, nette und nützliche Kleinigkeiten wie Parfüm, Romanlektüre und ein bisschen Modeschmuck, und natürlich hatten sie einander auch telefonisch gratuliert. Aber das hatte keine liebevolle Umarmung ersetzen können.
»Dein Wagen steht gar nicht draußen«, bemerkte Johannes. »Bist du mit dem Zug gekommen?«
»Nein, mit dem Auto, aber ich hatte kurz vor Essen eine Panne und hab es gerade noch auf den nächsten Parkplatz geschafft. Das letzte Stück bin ich per Anhalter gefahren.«
»Wir hätten dich doch abholen können!«, meinte Inge, sichtlich betroffen, als das Wort Anhalter fiel. »Wieso hast du dir keine Telefonzelle gesucht und uns angerufen?« Gleich darauf schüttelte sie den Kopf. »Ach nein, wir waren ja gar nicht zu Hause.«
»Was für eine Panne?«, erkundigte sich Johannes.
»Der Motor hat den Geist aufgegeben. Ich schätze, ich habe Öl verloren.«
»Wir fahren gleich morgen zusammen hin, dann sehe ich es mir an. Notfalls schleppe ich dich mit meinem Wagen ab.« Johannes blickte auf seine Armbanduhr. »Kurz vor Mitternacht. Die warten drüben sicher schon mit dem Sekt auf uns.«
»Ja, lass uns rübergehen.« Inge hakte sich bei Bärbel ein. »Ich freu mich so! Neunzehnhundertachtundsechzig – das neue Jahr fängt wirklich großartig an!«
Dem hätte Bärbel gern mit demselben Enthusiasmus zugestimmt. Dummerweise sprachen gewichtige Argumente dagegen. Sie hatte keine Stelle mehr, ihre Beziehung mit dem beliebtesten Oberarzt Hamburgs war in die Brüche gegangen, ihr Auto war hinüber, und ihr neuer Nachbar war der Mann, den sie früher für die Liebe ihres Lebens gehalten hatte.
Aber an all das wollte sie heute Nacht verdammt noch mal nicht mehr denken. Sie lächelte ihre Schwester und ihren Schwager an, fest entschlossen, nur gute Stimmung zu verbreiten, ganz egal, mit wie vielen Gläsern Sekt sie nachhelfen musste.
Irgendwie würde das Leben schon weitergehen.
Kapitel 2
Der Lärm der Silvesterböller hatte Sabine aufgeweckt. Das Kind kam im Nachthemd ins Wohnzimmer, wo die Erwachsenen gerade aufs neue Jahr angestoßen hatten und jetzt in fröhlicher Runde beisammenstanden.
»Ist so laut, Mami!« Das kleine Mädchen lief zu ihrer Mutter und streckte die Ärmchen aus. Annettes Lächeln wirkte leicht bemüht. Sie hob ihre Tochter hoch, stellte sie aber sofort wieder ab.
»Himmel, du hast dich ja schon wieder nass gemacht!« Naserümpfend wandte sie sich an die Besucher. »Eigentlich ist sie längst sauber. Ich weiß auch nicht, wieso sie zwischendurch immer noch ins Bett macht.«
Sabine, von allen nur Bienchen genannt, fing an zu weinen, und sofort war Klaus da und nahm seine Tochter auf den Arm. Er ging mit der Kleinen nach oben ins Kinderzimmer und zog ihr ein sauberes Unterhöschen und ein frisches Nachthemd an. Dabei murmelte er tröstende Worte vor sich hin und trug sie anschließend noch eine Weile herum. Das Köpfchen an seine Schulter geschmiegt, fragte sie mit ihrer dünnen kleinen Stimme: »Ist Mami böse auf mich?«
»Quatsch«, widersprach er sofort. »Mami hat dich doch lieb!«
Klaus äußerte es mit großer Überzeugungskraft, ganz so, als gäbe es keinerlei Zweifel daran.
Er sagte sich immer wieder, dass Annette keine schlechte Mutter war, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man ihr für ein bestimmtes Verhalten schwere Vorwürfe hätte machen können. Es lag einfach an ihrem sprunghaften Wesen, dass sie anderen Menschen nicht mit einer gleichbleibend verlässlichen Herzlichkeit gegenübertreten konnte. In der einen Sekunde konnte sie überströmen vor Zärtlichkeit, dann schnappte sie sich das Kind und drückte und herzte es mit Inbrunst, während sie in der nächsten übelgelaunt und ablehnend reagierte, sobald die Kleine sich nur blicken ließ.
Annette schien es als persönlichen Angriff zu empfinden, dass ihre Tochter nicht in allen Belangen so perfekt war, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Ein äußerlich so vollkommenes Wesen, das aussah wie ein blondlockiger kleiner Engel und mit seinen knapp drei Jahren weit besser sprechen konnte als die meisten anderen gleichaltrigen Kinder – wieso weigerte sich so ein Kind, endlich sauber zu werden?
Es war ein ständiger, zermürbender Kleinkrieg, ausgetragen sowohl zwischen Annette und dem Kind als auch zwischen Annette und Klaus. Er war derjenige, der stets Partei für seine Tochter ergriff, der besänftigend dazwischenging, wenn Annette sich wieder einmal über die durchnässte Nachtwäsche oder uringetränkte Bettlaken aufregte. Immer wieder wies er darauf hin, dass es doch einfacher sei, dem Kind weiterhin für die Nacht eine Windel anzulegen, aber Annette hielt das für blanken Unsinn – schließlich sei das Kind schon vor einem halben Jahr wochenlang trocken gewesen, auch nachts. Es gebe überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum sie plötzlich wieder ins Bett machte, und man dürfe ihr das nicht einfach durchgehen lassen.
Bienchen war in seinen Armen eingeschlafen, aus dem kleinen Körper war jegliche Anspannung gewichen. Vorsichtig legte Klaus die Kleine in ihr Bettchen, nicht ohne zuvor kurz mit einer Hand Decke und Laken abzutasten. Nur ein bisschen feucht, nicht so schlimm, dass man das Bett frisch beziehen musste. Er deckte seine Tochter zu und strich ihr zärtlich über das weiche Haar. Anschließend blieb er noch eine Weile neben dem Kinderbett stehen. Er verspürte wenig Lust, wieder nach unten zu gehen, obwohl die Party, so jedenfalls die einhellige Meinung der Gäste, ein voller Erfolg war. Alles war bisher genauso abgelaufen, wie Annette es sich vorgestellt hatte, von der Zusammensetzung des kalten Büfetts über die Auswahl der Getränke bis hin zu den Schallplatten, die im Laufe des Abends aufgelegt worden waren.
Es wurde sogar ausgiebig getanzt, sie hatten extra das halbe Wohnzimmer dafür freigeräumt. Die Stimmung war ohne Frage glänzend, doch Klaus fühlte sich mehr oder weniger fehl am Platze. Dieses Gefühl hatte er auch schon vor dem Eintreffen der Gäste gehabt, was vermutlich daran lag, dass er einen Teil der Leute vor dem heutigen Tag noch nie gesehen hatte. Annette hatte wieder mal spontan ein paar neue Bekannte eingeladen. Eine der Frauen hatte sie beim Friseur kennengelernt, eine andere bei der Gymnastik, und prompt hatte sie beide gebeten, zu ihrer Silvesterfeier zu kommen, natürlich mit den dazugehörigen Ehemännern. Außerdem waren noch drei andere Paare erschienen, die Annette bereits zu ihrer Geburtstagsparty im November eingeladen und offenbar für würdig befunden hatte, ein weiteres Mal mit dabei zu sein. Wahrscheinlich würden sie bei der nächsten oder übernächsten Feier durch andere, neuere Bekannte ersetzt werden, so war es bisher immer gewesen. Am interessantesten waren für Annette stets die Leute, denen sie gerade erst begegnet war, aber nach ein paar Monaten erschienen sie ihr allesamt wieder öde und langweilig.
Natürlich gab es auch einen angestammten Kreis von Leuten, die regelmäßig erschienen, etwa Klaus’ Kompagnon Herbert Schlatt, ebenso zwei Jugendfreunde aus dem Fußballverein und deren Ehefrauen. Oder sein Bruder Wolfgang und sein Vater Fritz, schließlich wohnten die beiden hier mit im Haus, auch wenn Annette immer nach Wegen suchte, sich wenigstens Fritz vom Hals zu halten. Sie hatte ihren Schwiegervater noch nie sonderlich gut leiden können, und sie sah nicht ein, warum sie ihn öfter als unbedingt nötig um sich haben sollte.
Klaus ging seufzend wieder nach unten und gesellte sich zu den anderen. Die Party war in vollem Gange. Annette tanzte mit einem der Besucher zu einem Song der Beatles. Mit versunkenem Gesichtsausdruck bewegte sie sich im Takt der Musik und schwang dabei ihr schulterlanges Haar von einer Seite zur anderen. Unter dem locker fallenden, mit Batikmustern überzogenen Minikleid wippten ihre Brüste. Wenn man genauer hinschaute, konnte man sehen, dass sie keinen BH trug.
Der Mann, der mit ihr zu All You Need Is Love tanzte, starrte sie an, als wollte er sie fressen. Falls seine Frau daran Anstoß nahm, merkte man davon zumindest nichts. Klaus wusste nicht mal, zu welcher der anwesenden Schnattergänse der Kerl überhaupt gehörte. Und es interessierte ihn auch nicht. Er vermutete schon seit einer ganzen Weile, dass Annette fremdging. Ihr unbeständiger Charakter, ihre flatterhafte Art – früher oder später begriff jeder, der näher mit ihr zu tun hatte, dass sie wie ein Schmetterling war, immer auf der Suche nach der nächsten Blüte.
Noch war es nur eine nagende Ahnung, dass sie in fremden Revieren wilderte. Allerdings hatte Klaus sich bislang auch nicht besonders angestrengt, ihr auf die Schliche zu kommen. Vielleicht, weil er es gar nicht so genau wissen wollte. Schließlich waren sie erst vor drei Monaten zusammen in das nagelneu umgebaute Haus eingezogen, nach außen hin die perfekte, glückliche Familie.
Es ging ihnen gut, sie mussten nichts entbehren. Er war Juniorchef und Teilhaber eines aufstrebenden, florierenden Elektrounternehmens. Sie konnten zum Sommerurlaub nach Italien reisen, mit dem Flugzeug wohlgemerkt, nicht in den kilometerlangen Autokolonnen, die sich zur Ferienzeit südwärts wälzten. Annette konnte sich Kleidung und Schuhe nach ihrem Geschmack kaufen, auch wenn sie sich manchmal darüber beschwerte, wie wenig man doch für die paar Mark bekäme, die sie zur freien Verfügung hatte.
Auf den Gedanken, dass es auch eine Kehrseite dieser glänzenden Medaille gab, würde so schnell sicher niemand kommen.
Klaus holte zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, eine für Herbert und eine für sich selbst. Sein Kompagnon hielt nicht viel von Sekt oder Bowle, und auch Klaus trank lieber Bier.
Gegen seinen Willen musste er an eine frühere Silvesternacht zurückdenken. Vor genau neun Jahren hatte er nebenan mit Bärbel in der Küche ihrer Oma gesessen, bei Kartoffelsalat und Knackwürstchen, und Oma Mine hatte ihnen dazu Sekt eingeschenkt. Klaus hatte das Gesöff damals schon zu süß und zu klebrig gefunden, doch er hatte es brav ausgetrunken, denn für ihn zählte allein, bei Bärbel zu sein. Der rußige alte Kohleofen in der Ecke hatte vor sich hin gebullert, und sie hatten einander erzählt, was sie sich für das kommende Jahr wünschten.
Einen Plattenspieler, hatte er gesagt, ihm war nichts Besseres eingefallen. Bärbel hatte ihn zurechtgewiesen. Das sei doch kein richtiger Neujahrswunsch! Aber was hätte er sagen sollen? Dass er verrückt nach ihr war und sich nichts sehnlicher wünschte, als sie küssen und umarmen zu dürfen? Mit sechzehn verkniff man sich solche Wahrheiten lieber.
Herbert prostete ihm mit der offenen Bierflasche zu. »Alles in Ordnung?«
»Klar. Wieso?«
»Weil du dauernd Löcher inne Luft starrst. Woran denksse die ganze Zeit?«
»An nichts Besonderes«, behauptete Klaus.
In Wirklichkeit konnte er seit Mitternacht kaum an etwas anderes denken als an Bärbel. Seit ihrem plötzlichen Auftauchen kreisten seine Gedanken die meiste Zeit nur um sie. Er fragte sich, ob er noch bei klarem Verstand war, weil ihm die Begegnung derartig den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Verdammt noch mal, die Sache mit ihr lag ewig zurück!
Herbert betrachtete ihn. »Ist et wegen ihr?«
Klaus zuckte zusammen, er fühlte sich ertappt. Doch Herbert wies mit dem Kinn auf Annette, die immer noch mit dem fremden Mann tanzte.
»Was? Nein, Quatsch«, entgegnete Klaus. »Sie tanzt doch bloß.«
»Aber nicht mit dir. Wer ist der Kerl eigentlich?«
»Keine Ahnung. Einer von ihren neuen Bekannten.«
»Sie hat ziemlich oft neue Bekannte.«
»Das ist so ihre Art.«
»Ich weiß. Und dir geht dat am Arsch vorbei, oder wat?«
Klaus zuckte nur gleichgültig mit den Schultern. »Es zieht wie Hechtsuppe hier«, sagte er zu Herbert. »Ich geh mal eben runter, die Haustür zumachen.«
Er ging die Treppe hinunter ins Erdgeschoss, das von seinem Vater und seinem Bruder bewohnt wurde. Wolfgang stand draußen vorm Haus und zündete Böller, so wie er es in jeder Silvesternacht tat. Es gehörte zu den Ritualen, die er sich vermutlich nie abgewöhnen würde. Wolfgang war vierundzwanzig, bloß ein gutes Jahr jünger als er selbst, aber Klaus kam es manchmal so vor, als sei sein Bruder immer noch der unreife, verschlossene Halbwüchsige, der er damals gewesen war, als ihre Mutter gestorben war. So richtig verkraftet hatte er ihren plötzlichen Tod wohl nie, jedenfalls nicht so gut wie Klaus, der in jenem bewegten Jahr die beste nur denkbare Ablenkung von seiner Trauer gehabt hatte – die himmelstürmende, erste große Liebe.
Einen Augenblick lang blieb Klaus in der offenen Haustür stehen und betrachtete seinen jüngeren Bruder, für den die Zeit stehen geblieben zu sein schien. Wolfgang arbeitete immer noch unter Tage auf Pörtingsiepen, dort, wo seit Generationen alle Männer der Familie ihr Geld verdient hatten, auch Klaus. Wer einmal da einfuhr, blieb meist ewig dort hängen. Außer, man wurde rausgeworfen, weil man zu oft besoffen zur Schicht aufkreuzte, so wie sein Vater Fritz. Oder weil man sich umbrachte, wie sein älterer Bruder Manfred.
Es hatte aufgehört zu schneien, die Nacht war wieder sternenklar. Im Licht der Straßenlaternen waren die Vorgärten der Siedlung von einem bläulich weißen Schimmer überzogen. Mehrere Nachbarn waren aus ihren Häusern gekommen und tauschten Neujahrsgrüße aus. Es wurde geredet und gelacht.
Stan Kowalski und seine Frau Renate winkten ihm von der anderen Straßenseite aus zu. »Alles Gute im neuen Jahr!«, rief Stan.
»Danke gleichfalls«, rief Klaus zurück. Mit Stan Kowalski verband ihn nicht nur eine langjährige gute Nachbarschaft, sondern auch die gemeinsame Zeit auf dem Pütt. Stan war damals sein oberster Vorgesetzter gewesen, und als Klaus nach der Ausbildung zum Elektrohauer beschlossen hatte, die Arbeit auf der Zeche hinter sich zu lassen, hatte Stan ihm den Kontakt zu Herbert vermittelt. Klaus verdankte ihm einiges.
Im nächsten Moment erstarrte er – Bärbel kam aus dem Haus der Kowalskis, gefolgt von ihrer Schwester Inge und ihrem Schwager Johannes. Ihr Vater Karl stand schon draußen, ebenso wie Claire Sieber, eine entfernte Verwandte, die seit Oma Mines Tod nebenan den Haushalt führte. Nur Bärbels Bruder Jakob war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich feierte er woanders.
Klaus gab sich einen Ruck und winkte den Nachbarn mit aufgesetzter Leutseligkeit zu.
»Frohes neues Jahr!«, rief er.
Sie winkten alle zurück, auch Bärbel.
Sein Herz fing an zu hämmern, und er hasste sich, weil er so auf sie reagierte. Ihr Auftauchen hätte ihm nichts ausmachen dürfen. Verflucht noch mal, er war kein Junge mehr, sondern ein seit Jahren verheirateter Familienvater! Doch er konnte nicht aufhören, sie anzustarren, genauso wie vorhin bei ihrer Ankunft. Ihr welliges helles Haar, das ausdrucksstarke, ebenmäßige Gesicht. Und die endlos langen, traumhaften Beine. Sie war viel zu dünn angezogen mit dieser lächerlich weitmaschigen Netzstrumpfhose und dem kurzen Kleid. Auch die Schuhe hielten bestimmt keine Kälte ab. Statt der Stiefel trug sie jetzt flache Slipper, die eher was für den Sommer oder fürs Haus waren, aber völlig ungeeignet in einer verschneiten Nacht wie dieser. Sie würde sich noch die Blase verkühlen, wenn sie länger hier draußen herumstand, das sollte sie eigentlich wissen. Wozu war sie Ärztin geworden, wenn sie nicht mal richtig auf sich selbst aufpassen konnte?
Immerhin hatte sie eine dick gefütterte Steppjacke an, auch wenn auf den ersten Blick erkennbar war, dass die nicht ihr gehörte, denn sie war ihr viel zu groß. Vermutlich hatte sie sich die Jacke bei Renate Kowalski geborgt, die ein paar Kleidergrößen mehr hatte.
Klaus’ Vater gesellte sich zu ihm. Im Laufe des Abends war Fritz Rabe nur einmal kurz in die obere Etage gekommen, um Klaus und Annette ein gutes neues Jahr zu wünschen, aber nicht nur Annettes entnervte Blicke hatten ihn rasch wieder vertrieben. Die lärmende, weinselige Partylaune der Gäste hatte ihn abgeschreckt. Klaus’ Vater rührte seit etlichen Jahren keinen Alkohol mehr an, und er sah nicht gern zu, wenn andere sich hemmungslos betranken.
»Dat Bärbel is wieder da«, sagte Fritz ohne Umschweife.
»Hab ich gesehen«, erwiderte Klaus.
»Is getz fertich mit dem Studieren, sacht der Karl. Ne richtige Ärztin, die kranke Leute operiert und so. Inne Klinik.«
»Ich weiß.«
Wolfgang hatte alle Böller aufgebraucht und kam zurück zum Haus. Er blies sich in die kalten Hände und stampfte mit den Füßen, um sich aufzuwärmen. »Hast du schon gesehen? Die Bärbel ist wieder da.«
»Ich bin nicht blind«, gab Klaus leicht gereizt zurück.
»Dat Bärbel fährt nich wieder zurück nach Hamburg«, verkündete Fritz. Dabei ließ er Klaus nicht aus den Augen. In seinem Blick lag eine erwartungsvolle Neugier. Er lauerte geradezu auf die Reaktion seines Sohnes. Klaus versuchte gar nicht erst, den Desinteressierten zu mimen, es hätte sowieso nicht geklappt.
»Was meinst du damit?«, wollte er wissen.
»Dat dat Bärbel getz hierbleibt. In Essen.« Ein Hauch von Genugtuung zeigte sich in Fritz’ von zahlreichen Falten zerfurchtem Gesicht.
»Woher willst du das wissen?«
»Dat hat ihr Vatter mir erzählt, gerade eben erst.«
»Der Karl redet viel, wenn der Tag lang ist.«
»Es stimmt aber«, mischte Wolfgang sich ein. »Ich stand daneben, als der Karl das gesagt hat.«
Um ein Haar hätte Klaus eingewandt, dass Bärbels Vater nur selten wirklich wusste, was er so daherredete. Seit der schweren Schädelverletzung, die er im Krieg erlitten hatte, befand sich Karl Wagner auf dem geistigen Niveau eines kleinen Kindes.
Doch das zu erwähnen versagte Klaus sich lieber. Es widerstrebte ihm, auf Karls Behinderung herumzureiten, dafür mochte er den armen alten Knaben viel zu sehr. »Und was ist mit Bärbels Arbeit in Hamburg?«, fragte er stattdessen.
»Dat is vorbei«, sagte Fritz. »Hat ihr da kein Spaß mehr gemacht. Sie will da nich mehr hin und bleibt getz ganz hier. Direkt nebenan, so wie früher.«
Klaus war sicher, dass mehr dahinterstecken musste, aber die grundlegende Aussage, dass Bärbel nicht mehr nach Hamburg zurückkehren wollte, klang nicht so, als wäre sie erfunden. Im Gegenteil, es würde auch den riesigen Koffer erklären, mit dem sie angerückt war. Niemand, der wie sonst bloß für ein paar Tage bleiben wollte, brauchte so viel Gepäck.
»Wat sagst du denn dazu?«, erkundigte sich Fritz. »Wie findest du dat?«
»Wie soll ich das schon finden?« Diesmal gelang es Klaus, seine Stimme gleichgültig klingen zu lassen. »Ist doch ihre Privatsache.«
Wolfgang entwich ein höhnisch klingendes Lachen. »Vielleicht braucht sie wieder mal einen richtigen Kerl. So einen wie dich.«
Klaus hätte ihm am liebsten eine runtergehauen. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, warum sein Bruder sich in der letzten Zeit so ruppig benahm. Seit Klaus mit Annette und Sabine ins gemeinsame Elternhaus eingezogen war, fuhr sein Bruder bei jeder Gelegenheit die Stacheln aus.
Offenen Streit gab es allerdings so gut wie nie zwischen ihnen. Anderenfalls hätte Klaus garantiert die Finger von dem Haus gelassen und lieber auf einem eigenen Grundstück gebaut, obwohl das mindestens dreimal so viel gekostet hätte und er dafür noch etliche Jahre hätte sparen müssen. Wenn man mit Verwandten unter einem Dach lebte, musste der Familienfrieden stimmen. In dieser Hinsicht hatte er früher genug mitgemacht. Der Alkohol hatte seinen Vater einst in einen widerwärtigen Tyrannen verwandelt, der Frau und Kinder verprügelte, wenn ihm der Schnaps ausging. Mittlerweile war Fritz schon lange trocken und wieder der Mensch aus Klaus’ früher Kindheit – manchmal ein bisschen stur und brummig, aber in der Regel zugänglich und gutmütig.
Mit Wolfgang war Klaus hingegen immer schon ganz gut klargekommen, er hatte keine Ahnung, was neuerdings mit ihm los war.
»Wäre natürlich auch möglich, dass sie’s dir endlich heimzahlen will«, sagte sein Bruder sarkastisch.
»Wovon zum Teufel redest du da?«, fragte Klaus irritiert.
»Davon, dass du sie damals abserviert hast. Einfach so weggeschmissen. Wie ne Tüte Müll. Ich würd’s dir gönnen. Dass es dir jemand heimzahlt, meine ich.«
»Quatsch doch nicht so einen Scheiß«, versetzte Klaus grob. Er hatte genug von der Unterhaltung. Ohne ein weiteres Wort ließ er seinen Bruder und seinen Vater stehen und ging wieder nach oben zu der Party.
Kapitel 3
Der stellvertretende Klinikdirektor war ein umgänglicher Mensch Ende fünfzig, der Bärbel freundlich empfing und ihr mit einigen launigen Bemerkungen die Angst vor dem Vorstellungsgespräch nahm. Er redete über das Wetter, das jetzt, Mitte Januar, immer noch ziemlich aufs Gemüt drückte, sowie über die viele Arbeit, die kein Ende nehmen wollte, weil die Leute um diese Jahreszeit ganz besonders oft krank wurden. Oder sich irgendetwas brachen, weil sie nicht besser aufpassten. Der ärztliche Leiter des Krankenhauses, ein gewisser Professor Schröder, kurierte beispielsweise gerade zu Hause einen Beinbruch aus, den er sich beim Skifahren zugezogen hatte, weshalb es nun seinem Stellvertreter zufiel, der Bewerberin auf den Zahn zu fühlen. Praktischerweise war Dr. Meyer, der die Unterredung mit Bärbel führte, zugleich auch der Chef der Chirurgie, also ihr künftiger Vorgesetzter – sofern sie die Stelle bekam.
Er schien sich vor allem dafür zu interessieren, warum sie unbedingt von Hamburg nach Essen wechseln wollte.
»Ich meine – Hamburg!«, sagte er. »Eine Großstadt mit hanseatischem Flair! Und die Klinik in Eppendorf kann sich sehen lassen, nach allem, was man so hört.«
»Essen hat auch Flair, finde ich. Zwar nicht hanseatisch, aber …« Bärbel suchte angestrengt nach einem passenden Wort. »Hier gibt es viel Lokalkolorit«, schloss sie lahm.
»Ja, und das ist ziemlich schwarz, durch den ganzen Kohlenstaub«, ergänzte Dr. Meyer vergnügt lächelnd. »Aber wenn man hier aufgewachsen ist, sieht selbst der Dreck auf den Straßen heimatlich aus. Geht mir ja auch so.« Er studierte die vor ihm liegenden Bewerbungsunterlagen. »Sie haben unter Dr. Gerhard Assendorf gearbeitet, wie ich sehe. Ein herausragender Kollege, hat schon viel publiziert. Wird sicher nicht mehr lange dauern, bis ihn der Ruf einer Uni ereilt.«
»Ja«, stimmte Bärbel einsilbig zu.
»Und Ihr Zeugnis ist geradezu phänomenal«, fuhr Dr. Meyer bewundernd fort. Er zog einen Bogen Papier aus der Mappe und fuhr mit dem Finger über die Zeilen, als müsste er sich vergewissern, dass die Lobeshymne wirklich dort stand.
Bärbel biss die Zähne zusammen. Das verdammte Zeugnis hätte sie am liebsten verbrannt, denn auch wenn es der Chefarzt der Station unterschrieben hatte, wusste sie, dass jedes Wort aus Gerhards Feder stammte. Er hatte es ihr Anfang des Monats eigenhändig per Post zugeschickt. Als Beweis dafür, was du mir bedeutest, hatte er mit seiner unleserlichen Handschrift auf einem beiliegenden Zettel notiert. Ergänzt um ein Auf bald.
Mit einem Zeugnis, geschweige denn einem von dieser Sorte, hatte sie nie und nimmer gerechnet. Sie hatte nach ihrer Flucht aus Hamburg einfach schriftlich bei der Klinik gekündigt und sich anschließend tot gestellt, obwohl sie genau wusste, dass sie eine Kündigungsfrist hätte einhalten müssen. In dem von Gerhard verfassten Zeugnis war dieses Fehlverhalten außen vor geblieben.
Falls er sich davon erhoffte, dass sie sich aus lauter Dankbarkeit bei ihm meldete oder gar reumütig zu ihm zurückgekrochen kam, täuschte er sich gewaltig. Es gab nichts, womit er sein schäbiges Verhalten ihr gegenüber wiedergutmachen konnte.
Ein paar Tage lang hatte sie erwogen, das Zeugnis einfach kommentarlos zurückzuschicken, aber dann hatte sie beschlossen, es als eine Art Schmerzensgeld zu betrachten. Sie wäre verrückt gewesen, darauf zu verzichten, denn mit einem Arbeitszeugnis wie diesem hatte sie sehr viel bessere Einstellungschancen als ein frisch approbierter Kollege.
Die Formulierungen, die Gerhard sich ausgedacht hatte, mochten stellenweise ziemlich dick aufgetragen sein; trotzdem konnte sie ohne schlechtes Gewissen von sich sagen, dass sie in Hamburg verdammt gute Arbeit geleistet hatte. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hatte sie alles gegeben. Nein, sogar mehr – wo mancher männliche Kollege sich zu hundert Prozent eingesetzt hatte, war sie mit zweihundert angetreten. Einfach nur, damit man sie für voll nahm.
Dr. Meyer legte endlich das Zeugnis zur Seite und blätterte die anderen Dokumente durch, die sie als beglaubigte Kopien eingereicht hatte.
»Hm, ausgezeichnetes Abitur, beste Examensnoten, Promotion summa cum laude – ich kann nur staunen, Fräulein Wagner!«
Da war es wieder. Dieses verhasste, verniedlichende Fräulein, mit dem einer erwachsenen und selbstständigen Frau permanent das Gefühl vermittelt wurde, im Leben noch nichts erreicht zu haben. Bärbel konnte sich kaum erinnern, wie oft sie in den letzten Jahren den Wunsch unterdrückt hatte, eine andere Anrede zu fordern.
In ihrer Anfangszeit in der Eppendorfer Klinik hatte sie es einmal gewagt – bei einer Oberschwester, deren herablassende Art nur von ihrer Neigung zum Damenbart übertroffen worden war. Die hatte es geschafft, in einem Stationsbericht von kaum drei Minuten etwa ein Dutzend Mal ein Fräulein Doktor einzuflechten.
»Frau Doktor, bitte«, hatte Bärbel schließlich entnervt verlangt.
»Ach, haben Sie geheiratet?«, war die Antwort gewesen, worauf Bärbel ein wenig patzig zurückgegeben hatte, dass sie keinen Mann brauche, um eine Frau Doktor zu sein. Und dass bei den Krankenschwestern ja auch niemand zwischen Frau und Fräulein unterscheide, die hießen einfach Schwester Beate oder Oberschwester Luise.
Sie hätte sich diese Belehrung besser verkniffen, denn mit einer Oberschwester sollten es sich unerfahrene Assistenzärzte lieber nicht verscherzen, damit schoss man sich bloß selbst ins Knie. Das war nur eine Erkenntnis unter vielen, die Bärbel bereits kurz nach ihrem Berufseinstieg gewonnen hatte. Bei ihrer neuen Stelle würde sie bestimmt einige Fehler vermeiden. Sofern man sie hier überhaupt haben wollte.
»Sie wären nicht die erste Chirurgin in unserem Haus«, setzte ihr Gegenüber das Gespräch fort. »Allerdings ist noch keine lange geblieben.«
Bärbel schluckte. Ihr war klar, worauf er anspielte.
Es gab immer noch sehr wenige Frauen unter den Krankenhausärzten, und wenn doch mal eine auftauchte, verschwand sie meist schnell wieder von der Bildfläche, um zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, die sie dann regelmäßig daran hinderten, in den Beruf zurückzukehren.
»Ich werde garantiert nicht heiraten«, platzte Bärbel heraus. »Davon halte ich überhaupt nichts.«
Das veranlasste Dr. Meyer dazu, die Brauen hochzuziehen. »Das hier ist ein katholisches Haus, wie Sie wissen. Menschen, die in wilder Gemeinschaft zusammenleben, womöglich in Kommunen …« Er sprach das Wort aus, als handle es sich um eine ansteckende Krankheit, und Bärbel beeilte sich, ihre letzte Äußerung zu relativieren.
»Nein, nein, eine wilde Ehe kommt für mich auch nicht in Betracht!«, beteuerte sie. »Die Ehe als solche ist großartig, eine überaus … äh, wichtige Institution! Zum Beispiel meine Schwester … Sie geht mit meinem Schwager durch dick und dünn, und die beiden sind verliebt wie am ersten Tag. Ich selber will bloß deshalb nicht heiraten, weil die Männer alle so … Ich meine, weil ich … äh, keinen Mann kenne, mit dem ich mir eine Ehe vorstellen könnte. Außerdem ist mir meine Arbeit wichtiger als irgendwelche Männerbekanntschaften. Sehr viel wichtiger«, betonte sie abschließend.
Dr. Meyer grinste verhalten, und jetzt erst begriff sie, dass er sie hochgenommen hatte. Wenn auch nur ein bisschen, wie sich bei seinen nächsten Worten zeigte. »Die Klinik steht unter kirchlicher Trägerschaft, wir müssen gewisse konfessionelle Vorgaben beachten«, erklärte er sachlich. Er sah sie prüfend an. »Haben Sie sich eigentlich auch bei der Konkurrenz beworben?«
Bärbel nickte verlegen. In Essen gab es eine Reihe von Krankenhäusern.
»Na, dann sollten wir wohl direkt Nägel mit Köpfen machen, bevor Sie uns noch durch die Lappen gehen«, meinte er. Er reichte ihr über den Schreibtisch hinweg die Hand. »Willkommen an Bord!«
*
Dr. Meyer ließ es sich nicht nehmen, sie gleich im Anschluss persönlich herumzuführen und den Beschäftigten des Krankenhauses vorzustellen, und als er zwischendurch zu einem Notfall gerufen wurde, beauftragte er eine der Krankenschwestern, den Rest des Rundgangs zu übernehmen.
»Schwester Elke, seien Sie doch so gut«, sagte er. »Fräulein Wagner ist unsere neue Assistenzärztin, sie fängt am ersten Februar bei uns in der Chirurgie an.«
»Klar. Kommen Sie nur mit, Frau Doktor.«
Sie hatte wirklich Frau gesagt. Es war Musik in Bärbels Ohren, diese Schwester war ihr augenblicklich sympathisch. Sie war ungefähr in Bärbels Alter. Ihr rotblondes Haar war fransig kurz geschnitten, und ihre Nase war von Sommersprossen übersät. Die leicht schräg stehenden grünen Augen verliehen ihrem aparten Gesicht einen katzenhaften Ausdruck.
Sie ging mit Bärbel durch die einzelnen Abteilungen der Klinik, die aus einem mehrgliedrigen Komplex alter und neuer Gebäudeteile in unterschiedlichen Baustilen bestand. Bärbel war überrascht von der modernen Ausstattung, auch wenn es neben der Chirurgie und Unfallchirurgie sowie der Inneren Medizin keine weiteren Fachabteilungen gab. Die Geburtshilfe unterstand dem Chefarzt der Chirurgie, und zusätzliche Behandlungen wurden von Belegärzten durchgeführt, etwa die Hals-Nasen-Ohren-Operationen.
Bärbel besichtigte die Röntgenanlage und die OP-Räume, die Etagen mit den Krankenzimmern, die Kreißsäle, die Säuglingsstation und schließlich auch die Wirtschaftsräume, darunter die Küche, ein großer, steril wirkender Raum mit blank gescheuerten Arbeitsflächen und einem gewaltigen Dampfkessel.
Natürlich gab es auch ein Ärztezimmer, aber Elke erklärte, dass Bärbel stattdessen lieber den Umkleide- und Ruheraum der Krankenschwestern nutzen solle, so wie es auch ihre – bisher nur sehr vereinzelt in Erscheinung getretenen – Vorgängerinnen gehandhabt hatten.
In der Krankenpflege der Klinik waren immer noch zahlreiche Ordensschwestern beschäftigt, auf den ersten Blick erkennbar an ihrem strengen Habit mit den gestärkten Flügelhauben. Bärbel wurde freundlich von allen begrüßt und willkommen geheißen.
»Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier bei uns, Frau Doktor Wagner«, sagte Schwester Elke.
Sosehr Bärbel diese Anrede auch mochte – es fühlte sich komisch an, wenn sie von einer Gleichaltrigen kam, die sie selbst im Gegenzug beim Vornamen nennen sollte.
»Sagen Sie doch einfach Bärbel zu mir«, schlug sie vor. Spontan fügte sie hinzu: »Von mir aus können wir uns auch duzen.«
Schwester Elke hob lächelnd die Schultern. »Sehr gerne.«
Sie unterhielten sich noch eine Weile und merkten dabei, wie gut sie sich verstanden. Spontan beschlossen sie, bald mal privat was zusammen zu unternehmen. Elke ging gern aus, und weil sie momentan keinen Freund hatte, war ihr Bedürfnis nach abendlicher Unterhaltung in der letzten Zeit ein wenig zu kurz gekommen. Dass es Bärbel ebenso erging, war eine weitere Gemeinsamkeit in ihrer neu geschlossenen Bekanntschaft. Sie tauschten ihre Telefonnummern aus und verabschiedeten sich in bester Stimmung.
Geradezu beschwingt trat Bärbel anschließend den Heimweg an. Sie war zu Fuß gekommen, weil ihr Käfer erst noch repariert werden musste. Johannes hatte ihn mit einem Kumpel, der was von Autos verstand, provisorisch wieder flottgemacht, aber es mussten noch ein paar Teile ausgewechselt werden.
Im Geiste ging sie noch einmal das Vorstellungsgespräch durch. Alles war viel besser gelaufen, als sie es sich erhofft hatte!
Doch je weiter sie ausschritt, desto rascher verflüchtigte sich ihre gerade noch so gute Laune, denn der vertraute Heimweg weckte zu viele Erinnerungen. Es war ihr alter Schulweg.