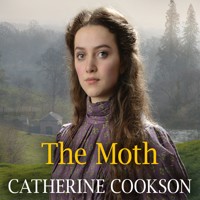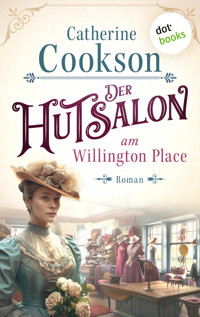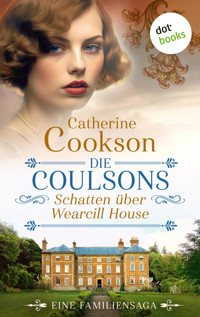6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Als Matthew Wallingham blind aus dem Krieg heimkehrt, fehlt ihm jeder Lebensmut. Erst die Liebe der Krankenschwester Liz gibt ihm die Kraft, sein Schicksal zu akzeptieren. Doch Matthews missgünstiger Bruder Rodney und Liz' brutaler Ex-Verlobter machen ein gemeinsames Glück scheinbar unmöglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Ähnliche
CATHERINE COOKSON
EINE WICHTIGE
BEGEGNUNG
Roman
Aus dem Englischen
von Elisabeth Shulte-Randt
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Als Matthew Wallingham von den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs nach England zurückkehrt, ist er ohne Hoffnung: Der ausgezeichnete Kriegsheld ist durch eine Verletzung erblindet. Erst der Krankenschwester Liz gelingt es, durch Mitgefühl und Zuneigung seinen Lebensmut wieder zu wecken. Auf dem Landsitz seiner Eltern reagiert Matthews mißgünstiger Bruder Rodney kühl auf die Rückkehr seines Bruders. Er hatte die Farm während des Krieges bewirtschaftet und fürchtet nun, die Leitung an Matthew abgeben zu müssen. Während der Konflikt zwischen den Brüdern schwelt, muß Liz um ihr Leben bangen. Seitdem sie ihre Verlobung mit dem brutalen Mike, zu der sie ihre Eltern gedrängt hatten, aufgelöst hat, sinnt dieser auf Rache …
Die Autorin
Catherine Cookson, 1906 in Nordengland geboren, wuchs als uneheliche Tochter in ärmlichen Verhältnissen auf. Schon im Alter von 16 Jahren begann sie, Kurzgeschichten zu verfassen. Mit ihren 90 Romanen wurde sie eine der beliebtesten Autorinnen Großbritanniens, deren Werke mittlerweile in zahlreichen Sprachen veröffentlicht werden. Aufgrund ihres großen Erfolgs wurde Catherine Cookson 1993 der Titel »Dame of the British Empire« verliehen.
HEYNE ALLGEMEINE REIHE Band-Nr. 01/13426
Die Originalausgabe A HOUSE DIVIDED erschien 1999 bei Bantam Press
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Redaktion: Verlagsbüro Oliver Neumann
Deutsche Erstausgabe 11/2001 Copyright © The Trustees of the Catherine Cookson Charitable Trusts 1999 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München Umschlagillustration: Franco Accornero/Agentur Schlück
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
1
Elizabeth Duckworth ging still und mit raschen Schritten durch den schwach beleuchteten Korridor. Sie hatte vier geschlossene Türen hinter sich gelassen und steuerte auf die letzte der sieben Türen zu, als diese jäh aufgerissen wurde. Eine männliche Gestalt im Morgenmantel trat heraus und kam auf sie zu. Der Patient trug einen Kopfverband, der ein Auge verdeckte; das Lid des anderen Auges blinzelte heftig. Er wandte den Kopf in ihre Richtung und sagte: »Zu Ihnen wollte ich gerade, Ducks … ich meine, Schwester. Es sieht so aus, als bräuchte der Captain jemanden. Was ich damit sagen will …«
»Ja, schon gut.« Die Nachtschwester schob ihn sanft zur Seite. »Sie hätten läuten sollen, Lieutenant.«
»Aber er scheint es zu bemerken, wenn ich das tue, und dann knurrt er mich immer an.«
»Hat er gesprochen?«
»Nein, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Nur diese Geräusche.«
Die Schwester öffnete die Zimmertür am Ende des Korridors. Dabei fasste sie den verletzten Lieutenant am Arm und stützte ihn. »Sie sollten nicht aufstehen. Das habe ich Ihnen doch schon oft gesagt.«
»Mit mir ist alles in Ordnung. Ich wünschte, ihm ginge es nur halb so gut wie mir.«
»Legen Sie sich wieder ins Bett. Ich kümmere mich um ihn. Möchten Sie etwas zu trinken?«
»Danke. Vielleicht später.«
Eilig trat sie an das hinterste Bett. Verblüfft stellte sie fest, dass sich der hochgewachsene Patient das Laken über den Kopf gezogen hatte. Er zitterte am ganzen Körper und schluchzte heftig, so dass das Bett wackelte.
In gewisser Weise war sie froh über den Anblick, der sich ihr bot. Normalerweise fand sie den Captain Nacht für Nacht aufrecht im Bett sitzend vor, in eine Dunkelheit hinausstarrend, mit der er sich nicht abfinden konnte … nicht abfinden wollte. Seit dem heftigen Zornausbruch, bei dem man sein lautes Toben und die wüsten Beschimpfungen durch das halbe Krankenhaus hatte hören können, reagierte er auf keine Ansprache mehr. Sogar gegenüber seiner Mutter und anderen Familienmitgliedern gab er durch nichts zu erkennen, dass er wusste, wer ihn besuchte.
Was geschehen wäre, wenn er hätte aufstehen können, blieb offen. Die Granatsplitter, durch die er erblindet war, hatten an der linken Körperseite auch die Haut aufgerissen und einen Teil der Muskulatur am Unterschenkel und an der Hüfte geschädigt. Eigentlich gehörte er in die chirurgische Abteilung, aber auf Grund seines unberechenbaren Verhaltens ließ man ihn lieber auf der Wachstation, in der Nähe von Lieutenant Fulton, obwohl der Captain sich nach seinem Wutanfall sogar weigerte, seinen Freund zu erkennen.
Schwester Duckworth wusste, dass erwogen wurde, ihn in die psychiatrische Abteilung zu verlegen, sobald die Heilung genügend fortgeschritten war. Jetzt erkannte sie vor allem eines: Der arme Teufel brauchte dringend Hilfe.
Sanft berührte sie seine Schulter und versuchte, das Laken wegzuziehen. Für eine Sekunde verharrte Matthew Wallingham reglos, dann vergrub er den Kopf noch tiefer unter dem Bettzeug.
Schwester Duckworth nahm vorsichtig auf der Bettkante Platz. Sie streckte die Hand nach dem zerzausten, dichten Haarschopf aus, der unter dem Laken hervorlugte, und strich sanft darüber. »So ist es gut. Das ist das Beste, das Sie tun können. Weinen Sie sich aus. Außer mir und Ihrem Freund ist keiner hier. Keine Sorge. Niemand wird es erfahren.«
Sie machte eine kleine Pause und biss sich auf die Lippe. Davor hatten alle Angst – dass jemand erfuhr, dass sie seelisch nicht mit ihrer Verletzung fertig wurden.
»Alles wird gut. Alles wird gut.« Ihre Hand lag wieder am oberen Saum des Lakens. Jetzt konnte sie das Bettzeug ein Stück zurückschlagen, so dass sein Gesicht zum Vorschein kam. Ein unversehrtes Gesicht ohne die geringsten Verletzungsspuren. An der Hinterseite des Schädels hatte er eine tiefe Schnittwunde erlitten, aber die war verheilt. Um die Narbe herum begann bereits das Haar nachzuwachsen.
Im schwach grünen Dämmerlicht der Wandlampe über seinem Bett sah sie, wie er das Kopfkissen packte und sich eine Kissenecke in den Mund schob.
Als sie die Hand über seine Faust legte und ihm sanft das Kissen entzog, war das Schluchzen lauter zu hören. Rasch beugte sie ihr Gesicht zu ihm und flüsterte: »Ja, so ist es gut. Ja … Ich bin bei Ihnen.«
Sie legte den Arm um seine Schultern. Er zuckte zusammen, stützte sich auf einen Ellenbogen und rollte sich zur Seite. Im nächsten Moment hatte er beide Arme um sie geschlungen und sein Gesicht an ihren Hals geschmiegt.
Schwester Duckworth fürchtete, von der Bettkante zu rutschen, doch sein Griff hielt sie fest. Dann wurde ihr bewusst, wie auch sie die Arme um ihn schlang, seinen Rücken tätschelte und flüsterte: »Ruhig.. ganz ruhig. Nicht mehr weinen. Das war genug … Jetzt wird alles gut. Bald sind Sie über den Berg. Ganz bestimmt.«
»Oh, Mutter.« Er umschlang sie noch fester. Sein feuchtes Gesicht streifte ihr Kinn und sie spürte die Bewegungen seiner Lippen an ihrem Mund. »Ich habe geträumt«, sagte er. »Es war ein Traum. Zuerst dachte ich nur, ich würde träumen, dann wusste ich es. Oh, Mutter! Es tut mir Leid … es tut mir Leid … ich meine …«
»Alles in Ordnung. Ich weiß, was Sie meinen. Heute Abend bin ich Ihre Mutter.«
»Nein … nein … was ich brauche …«
»Bitte! Seien Sie jetzt vernünftig und hören Sie mir zu. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rufe ich die Oberschwester – was das bedeutet, wissen Sie. Sie verpasst Ihnen eine Spritze. Und ich bekomme auch einen Pieks, nur auf andere Weise. Verlassen Sie sich drauf.« Sie lachte leise und tätschelte seine nahe Wange. »Oder Sie nehmen zwei Schlaftabletten. Aber aufgepasst, ich kenne Ihren Trick. Sie behalten die Tabletten unter der Zunge. Habe ich Recht? Nein, nein, leugnen nützt nichts. Ich habe die Tabletten in Ihrem Bett gefunden.«
Das Schluchzen hatte aufgehört, auch das Weinen. Er hob den Kopf, atmete mehrmals tief ein, hielt sie aber immer noch fest. Sie löste ihre Arme und senkte ihn langsam und sanft auf das Kopfkissen zurück, umfasste für einen Augenblick sein Gesicht und blickte in die blinden Augen. »Also, Schlaftabletten?«
Er antwortete mit keiner Regung, aber als sie aufstehen wollte, hörte sie, wie er etwas sagte. Sie beugte den Kopf noch einmal zu ihm herab. »Was haben Sie gesagt?«
»Es tut mir Leid.«
»Mein lieber Junge, Sie haben keinen Grund, sich bei mir zu entschuldigen. Aber ich sage Ihnen etwas. Sie haben die Kurve gekriegt. Jetzt geht es aufwärts. Sie werden sehen.«
Sie machte eine Pause. Ihre Gedanken rasten. Sie werden sehen, hatte sie gesagt. Überlegten Menschen niemals, was sie redeten? Sie werden sehen … jetzt geht es aufwärts. Aufwärts – aber wohin? Sie hatte sein Gesicht gehalten, ihn an sich gepresst. Er hatte sie für seine Mutter gehalten – wenn auch nur für einen kurzen Moment – und sie hatte »Junge« zu ihm gesagt. Sie war vierundzwanzig Jahre alt und hatte »Junge« zu ihm gesagt!
»Machen Sie den Mund auf und versuchen Sie nicht wieder Ihren Zungentrick bei mir. Ich halte Ihnen sonst die Nase zu.«
Dann war es erledigt. Die kleine Schachtel, in der sie die Schlaftabletten aufbewahrte, steckte wieder in der Tasche ihrer Schwesterntracht. Sie blickte auf ihn hinunter. Er hatte den Kopf zur Seite geneigt, von ihr weg, und sagte ruhig: »Bitte melden Sie’s nicht.«
»Ich hatte nicht die Absicht, irgendetwas zu melden. Bis auf die Tatsache, dass Sie nicht vor ein Uhr eingeschlafen sind.«
»Wie heißen Sie?« Er flüsterte die Frage, und sie brauchte einige Sekunden, bis sie antwortete:
»In diesen erhabenen Hallen werde ich gewöhnlich Ducks oder Ducky genannt … Das heißt, wenn die Stationsschwester nicht in der Nähe ist. Aber meine Geburtsurkunde lautet auf Elizabeth Jane Ducksworth. Den Namen Elizabeth mag ich nicht besonders, genauso wenig Jane; aber ich habe nichts dagegen, wenn meine Familie und meine Freunde Liz zu mir sagen.«
Wieder folgte eine Pause. »Wie alt sind Sie?«
»Wie alt?« Ihre Stimme klang überrascht. »Manche behaupten, ich wäre über fünfzig, aber das stimmt nicht. Ich bin knapp neunundvierzig.« Als sie den Satz beendet hatte, streckte sie einen Arm zu dem Bett auf der linken Seite aus. Von dort kam ein Geräusch, das wie ein Schluckauf klang. Sie sprach weiter: »Jetzt haben Sie einen Eindruck von mir. Ich bin das, was Sie eine mütterliche Erscheinung nennen würden. Und jetzt müssen Sie schlafen. Ich sehe morgen noch einmal nach Ihnen, bevor mein Dienst zu Ende ist – das heißt, falls Sie dann wach sind. Gute Nacht.« Sie zog das Laken über seine Schultern und gestattete es sich, den Finger für einen Moment auf seine Wange zu legen.
Dann wich sie leise zurück. Sie beugte sich über das andere Bett und flüsterte: »Belassen Sie es dabei. Verstanden?«
»Ja, Ducks«, antwortete die Stimme, ebenso leise flüsternd. »Aber könnte ich auch ein bisschen mütterliche Zuwendung von Ihnen erhalten?«
Sie antwortete, indem sie sich aufrichtete, dem Lieutenant einen scherzhaften Klaps auf die Wange versetzte und sagte: »Schlafen Sie jetzt. Gute Nacht.«
»Nacht, Ducky.« Er sprach den Namen leise und zärtlich aus.
2
Drei Wochen später saß Matthew aufrecht im Bett. Der Krankenpfleger war eben mit seiner Arbeit fertig geworden – er hatte ihn gewaschen, rasiert und das Haar gekämmt. Jetzt, wie immer seit einigen Tagen, saß Matthew im Bett und wartete. Dann kam sie. Er konnte sie riechen. Sie hatte einen besonderen Duft, mit einer warmen, unbestimmbaren Note. An ihrer sanften Ausstrahlung dagegen war nichts, das sich als unbestimmbar bezeichnen ließ. Er wusste nicht, wie er ohne sie hätte weiterleben sollen, vor allem nachts. Dabei hatte sie ihn nie wieder in den Armen gewiegt wie bei diesem einen Mal. Aber ihre Hand war immer da gewesen. Er konnte sie halten; manchmal umklammerte er sie auch, wenn sie nach einem Alptraum kam, um ihn zu beruhigen.
Nun war sie wieder da. Er hörte, wie sie mit dem neuen, Patienten sprach. Er war erst gestern eingeliefert worden.
Jetzt sprach sie mit Jerry. Lachte mit ihm. Jerry wurde heute entlassen. Wie er Jerry vermissen würde! Ja … Jerry wusste so viel über ihn und er über Jerry. Noch ein Dritter wusste Bescheid. Fox. Corporal Charlie Fox. Er musste herausfinden, wo Charlie war, denn ohne den alten Foxy wäre heute keiner von ihnen hier.
Sie ging weiter. Er kannte ihre Schritte.
»Guten Morgen. Du liebe Güte! Wie elegant Sie aussehen. Der Schlafanzug ist neu. Blau steht Ihnen.«
»Welche Farbe hat Ihre Bluse?« Er wusste, dass ihr Dienst gleich beendet war und sie Zivilkleidung trug. Aber warum, fragte er sich, konnte er nicht freundlich mit ihr sprechen? Warum schlug er ihr gegenüber immer diesen rüden Ton an? Sie war so lieb zu ihm gewesen und er sah in ihr keine ältere Frau. Dazu klang ihre Stimme zu hell, war ihr Gang zu federnd. Sie brachte Leichtigkeit und Helle mit sich, Licht …
Etwas in ihm hängte sich an dem letzten Wort fest und ein Teil seines Verstandes schrie: Licht … Licht … Licht. Es war wie bei Jerry, wenn dieser ständig sagte: »Sie sehen, was ich meine.« Matthew wusste, Jerry wollte nur höflich sein, aber der Satz störte ihn. Sie sehen, was ich meine. Wenn er nur sehen könnte, wovon die anderen sprachen.
»Heute kommt Ihre Familie zu Besuch. Und, wie ich gehört habe, sollen Sie Ihre Krücken ausprobieren. Als Nächstes erhalten sie zwei Gehstöcke, dann nur noch einen. Und schließlich …« Ihre Stimme brach ab. Liz Duckworth fragte sich, was sie da redete. Sie fühlte sich entsetzlich und konnte nicht einmal einen vernünftigen Grund dafür angeben. Sonst war sie jedes Mal überglücklich, wenn ihr Nachtdienst zu Ende ging. Aber sie wusste, er hatte sich ihr in gewisser Weise anvertraut. Dabei war sie gewarnt worden – die Stationsschwester hatte alle Pflegerinnen ermahnt. Sie hörte noch ihre Stimme: »Passen Sie auf sich auf. Sie könnten sich zu einem Verwundeten hingezogen fühlen. Das kommt immer wieder vor, besonders, wenn die Männer blind sind. Dann erwachen alle albernen Instinkte der Jugend und Sie sehen sich als rettenden Engel. Aber lassen Sie sich gesagt sein, Sie verlieren unweigerlich Ihre Flügel, sobald Sie einen von ihnen heiraten. Blinde können ein ausgesprochen besitzergreifendes Verhalten entwickeln. Sie müssen schon sehr stark und unabhängig sein. Sonst werden Sie vollkommen vereinnahmt und der Mann saugt das Leben aus Ihnen heraus.«
Sie erinnerte sich auch daran, was die Schwester am Schluss gesagt hatte: »Ich weiß, einige von Ihnen werden aus diesem Zimmer gehen und denken: ›Diese hartherzige Kuh.‹ Aber ich spreche aus zwanzigjähriger Berufserfahrung. Für seine Gefühle kann niemand etwas. Doch ich sagen Ihnen: Bedenken Sie die Folgen, bevor Sie Ihrem Herzen freien Lauf lassen.«
Elizabeth lachte leise. »Ich muss gehen. Abschied nehmen ist mir ein Gräuel. Halten Sie sich tapfer. Das sagte meine alte Tante immer.«
»Was reden Sie da? Abschied nehmen? Sie verlassen uns?«
»Ich hatte Nachtdienst. Drei lange Monate. Das war mehr als genug. Natürlich, es gab wöchentliche Freischichten, aber man wusste immer, man musste bald wieder zurück.«
»Und der Nachtdienst hat Ihnen nicht gefallen?«
»Nicht sonderlich.«
Sie sah den Ausdruck in seinem Gesicht. »Nur in manchen Fällen, wenn ich helfen konnte.«
»Wohin gehen Sie jetzt?«
»Sie meinen, jetzt gleich? Oh, ich habe eine Woche frei; dann wechsle ich in die Tagesschicht. Vorher fahre ich nach Hause.«
Seine Hand umgriff die eiserne Bettkante. Als sie seine Finger davon lösen wollte, umklammerte er ihre Hand. Dann fragte er leise: »Wie groß sind Sie?«
»Zu groß. Fast einsachtzig.«
Es folgte eine Pause. Er bewegte seine Hand über ihren Fingern, als wollte er sie massieren. »Sagen Sie, sind Sie wirklich neunundvierzig?«
Jetzt lachte sie, mit diesem Laut, den er so gut kannte. »Schlimmer. Ich habe noch ein Jahr zugelegt. Letzte Woche war mein Geburtstag.« Sie entzog ihm ihre Hand. »Jetzt muss ich gehen. Die Tagesschicht macht schon ihre Runde, aber ich dachte, ich sage noch Lebewohl und wünsche Ihnen alles Gute.«
Seine Stimme hatte ihren rauen Klang verloren. Sie war leise und warm. »Ich werde Sie vermissen … Ducks.«
»So nennen Sie mich zum ersten Mal«, antwortete sie, leise und ungezwungen lachend. »Jetzt weiß ich, dass Sie wirklich auf dem Weg der Besserung sind.«
»Ich … möchte Ihnen danken und weiß nicht, wie.«
»Das können Sie nur auf eine Weise: Kommen Sie so bald wie möglich wieder auf die Beine und bauen Sie sich ein neues Leben auf.« Ihre Stimme wurde ernst. »Das meine ich wirklich. Sie haben so viel, für das Sie leben können. Aber jetzt muss ich gehen.« Sie stockte leicht. »Auf Wiedersehen, Captain.«
Sie musste ihm gewaltsam ihre Hand entziehen. Dann war sie fort. Er blieb allein zurück, hatte nur die Überdecke, die er mit beiden Händen fasste … O Gott! Da war die Szene wieder, deutlich sichtbar vor seinen Augen. Er hielt ihn dicht an sich gepresst, den toten Körper ohne Kopf …
Er war in der Hölle. Sie alle waren in der Hölle. Warum? Warum jetzt? Sie hatten den Senio überquert und lagen jetzt am Saterno. Die Zweite Neuseeland-Division hatte bereits auf die andere Seite übergesetzt, aber sie waren auf eine Nachhut der Deutschen gestoßen, die eisern die Brücke verteidigte. Den ganzen Winter über hatten sie auf den Hügeln vergeblich gegen diese Mistkerle gekämpft, aber jetzt, in der Ebene, besserte sich die Lage. Reste aus verschiedenen Kompanien hatten sich ihnen angeschlossen. Einige Kameraden stammten aus dem Nordosten Englands und er hatte sich über den vertrauten Klang ihrer Stimmen gefreut. Eine Weile lagerten sie in der Ebene. Foxy hatte sich als guter Beschaffer erwiesen. Dann war da Jerry Fulton. Oh, ja, Jerry. Diese beiden, Fox und Jerry, hatten verhindert, dass er durchdrehte. Aber der kopflose Körper in seinen Armen, jetzt war er wieder da. Und überall um ihn herum nur Tote. Ein Leichenfeld. Das Blut hatte die Hügel getränkt. Deutsches Blut, amerikanisches Blut, italienisches Blut, britisches Blut. Sicher, auch britisches Blut. Jetzt rann es über ihn hinweg. Gehörte das Blut Ferguson? O Gott! Hatten die verfluchten Deutschen Ferguson umgebracht? Ferguson, den er nie gemocht hatte? Er warf den Torso weg, konnte aber nicht sehen, wohin er fiel. Der Panzer brannte lichterloh, aber er sah ihn nicht. Er spürte nur die Hitze. Sein Kopf war dumpf. Jetzt rannte er los, über Körper stolpernd. Er stürzte und konnte den Fall nicht aufhalten. Mit einer Hand umklammerte er sein Gewehr, mit der anderen eine Granate. Er war von Lärm umgeben. Der Lärm machte ihn taub. Wo war er? Es herrschte eine tiefschwarze Dunkelheit. Vorher war es nicht dunkel gewesen. Worte gellten in seinem Kopf: Nein! Nein! … Der Gedanke brachte ihn wieder auf die Beine und er rannte weiter. Er musste weg von hier. Weg von der Brücke. Sie hatten die Brücke verloren. Warum hatten Sie nicht vorausgeahnt, dass die Deutschen dort warten würden? Er merkte wieder, dass er ein Gewehr und eine Handgranate bei sich trug. Was nützte ihm das Gewehr, wenn er nicht sehen konnte? Die Brücke war verloren, alle waren tot. Die Brücke. Er hob den Arm und schleuderte die Handgranate. In dem Moment spürte er, wie er an beiden Seiten gepackt und mit dem Gesicht nach unten in den Schlamm geworfen wurde. Eine Stimme brüllte in sein Ohr: »Aufhören! Aufhören!« Er erkannte die Stimme. Sie gehörte Jerry Fulton. Dann kam eine andere Stimme, die auch bekannt klang. Die Stimme von Fox. Er befahl ihm, mit dem Schreien aufzuhören. Nicht er schrie, es waren die Geräusche des Sperrfeuers. Fulton rief: »Wenn das Sperrfeuer aufhört, wird er unsere Position verraten, Sir.«
Was war nur los mit ihm? Was war los mit ihnen allen? Er schrie nicht; sein Mund war voller Blut und Schlamm. Er wollte schlucken, erstickte aber fast. Warum waren sie im Fluss? Sie zerrten ihn am Ufer entlang und würden ihn ertränken. Zur Hölle mit ihnen, das ließ er nicht zu. Er würde auf seine Weise sterben.
Seine Arme bewegten sich wild in alle Richtungen. Er schlug auf die Männer ein, die ihn gefangen hielten. Ja, er wehrte sich. Trotzdem zogen sie ihn hügelaufwärts. Warum spürte er seinen Kopf nicht? Er hatte ihn verloren, wie Ferguson – oder wer das gewesen war. Sein Verstand gab ihm keine Antwort, denn in diesem Moment fühlte er sich, als würde er in den Himmel gehoben. Er wusste, sein Körper war nur noch halb …
Hatte er es gleich herausgefunden oder begriff er es erst später, als sie nicht aufhörten, Nadeln in den Körperteil zu stechen, von dem er glaubte, dass er nicht mehr vorhanden war? Da hatte er um sich geschlagen und sie angebrüllt – die Stimmen, die sagten: »Sie sollten ihn woanders unterbringen. Wir können nicht schlafen.« Sie waren Dummköpfe, alles Dummköpfe. In der Hölle schlief niemand. Wer in der Hölle war, hatte zu arbeiten. Jeder stand für sich allein. Sag ihnen, dass du kein Feigling bist. Du bist nicht weggelaufen. Aber das war eine andere Geschichte. Er konnte nicht sprechen, nur schreien … und dann war seine Mutter gekommen und hatte ihn fest gehalten.
»Alles in Ordnung mit Ihnen, Matthew?«
Matthew blinzelte mit seinen blinden Augen. »Ja«, antwortete er. »Alles in Ordnung. Ich … wollte mit Ihnen reden, Jerry. Sie werden heute entlassen, wie ich gehört habe.«
»Ja, das habe ich Ihnen gesagt.«
»Ich werde Sie vermissen.«
»Und ich Sie. Aber Sie machen große Fortschritte. Erstaunliche Fortschritte. Ihre Familie ist so glücklich darüber.«
»Jerry?«
»Ja?«
»Wie sieht Schwester Duckworth aus?«
Jerry biss sich fest auf die Unterlippe und sog sie nach innen. »Diese Frage ist schwierig zu beantworten.«
»Warum? Was ist daran so schwierig?«
»Weil … Na ja, sie ist nicht so, wie Sie denken. Ich meine … Sie … In der Nacht, als Sie Ihre Krise hatten, hat sie so getan, als wäre sie Ihre Mutter. Anschließend tat sie in ihrer hilfreichen Art weiterhin so, als wäre sie eine ältere Frau.«
Es entstand eine Pause. »Und das stimmt nicht?«, fragte Matthew schließlich.
Jerrys Lachen war eindeutig. »Nein«, sagte er. »Das stimmt nicht, Matthew. Sie ist vierundzwanzig.«
»Wie bitte?«
»Ich sagte, sie ist vierundzwanzig Jahre alt.«
»Und als Nächstes behaupten Sie, sie wäre eine langbeinige Blondine«, sagte Matthew gereizt.
»Nein. Sie ist zwar langbeinig, aber nicht blond. Sie hat braunes Haar und ein hübsches Gesicht, das zu ihrem Wesen passt.«
»Warum zum Teufel konnten Sie mir das nicht früher sagen?«
Jerry neigte sich dem zornigen Gesicht zu. »Sie hätte sich weniger hingebungsvoll um Sie gekümmert. Deswegen. Wären sie im Bilde gewesen, hätte sie Sie nie in den Armen gehalten und gewiegt, in dieser einen Nacht. Und auch später hätte sie Ihnen wohl kaum über das Haar gestrichen und Ihre Hand gehalten. Sie konnte das nur tun, weil Sie glaubten, sie wäre eine Frau im mittleren Alter. Sie dachten sogar, sie wäre Ihre Mutter. Haben Sie das vergessen? In Ihrer Verwirrung nach dem Alptraum oder wie man das nennen soll haben Sie ›Mutter‹ zu ihr gesagt. Sie sieht zu gut aus, um sich ihrem wahren Alter entsprechend zu geben, besonders bei Burschen wie uns, die nach Mitgefühl lechzen. Sie wissen selbst, dass wir so sind.«
Matthew presste die Zähnen zusammen. »Ich habe einen Vollidioten aus mir gemacht.«
Jerry antwortete: »Allerdings. Aber nur vor Ihnen und vor mir.«
»Ich habe meiner Familie von einer mütterlichen Krankenschwester erzählt. Meine Mutter hat sogar angekündigt, sie würde ihr schreiben. Eines weiß ich bestimmt: Sollte herauskommen, wer meine mütterliche Krankenschwester in Wirklichkeit ist, wird meine Familie verdammt viel zu lachen haben.«
Jerry unterbrach seinen selbstmitleidigen Ausbruch: »Ich sage Ihnen was, Kamerad. In jener Nacht hat sie Ihnen den Verstand gerettet, denn Sie waren drauf und dran, wieder in der Versenkung zu verschwinden. Obwohl Sie alles hinausgeschrien hatten, waren Sie in einem entsetzlichen Zustand, und das wochenlang. Die Ärzte wollten Sie in eine Spezialabteilung verlegen, aber dann war sie für Sie da. Ich weiß, das ging nur, weil Sie in ihr eine ältere Frau sahen. Hätte sie sich nur halb so viel um andere Patienten gekümmert, wäre sie von ihnen lebendig aufgefressen worden. Ich sage Ihnen noch mal, Sie sollten dankbar sein … Übrigens, ich habe mich vor einer Weile von Charlie Fox verabschiedet. Er will vorbeikommen und Sie besuchen. Ist Ihnen das recht?«
»Ja. Ich würde ihn gern wieder sehen … Aber nun zu Ihnen. Was haben Sie jetzt vor?«
»Oh, ich kehre zurück, woher ich gekommen bin. Der alte Beeching hat mir meine Stelle frei gehalten. Ich war das letzte Jahr vor dem Krieg in der Buchhaltung beschäftigt. Mir wurde versprochen, dass ich in der Firma bleiben könne, und er hat Wort gehalten. Ich bekomme ein eigenes Büro und eines Tages, sagen wir in zwanzig Jahren« – er lachte –, »werde ich vielleicht Teilhaber.«
Sie schwiegen einen Moment lang. Schließlich fragte Matthew ruhig: »Können Sie mit dem einen Auge gut sehen?«
»Ja, wenn ich eine Brille trage. Dann sehe ich sehr gut. Ohne Brille dagegen, das ist ein anderes Paar Stiefel. Ich erkenne alles nur undeutlich, wie durch einen Nebelschleier.«
»Das andere Auge … was ist damit passiert?«
»Man hat mir ein Glasauge eingesetzt. Sie behaupten, es würde vollkommen natürlich wirken. Aber ich muss mich nur im Spiegel betrachten … Wissen Sie, Matthew, dass Sie Glück hatten, kann ich nicht sagen. Das liegt mir fern. Dazu ist Ihre Lage zu ernst. Aber trotzdem, Ihr Gesicht hat keinen Kratzer abgekriegt. Niemand würde auch nur im Traum darauf kommen, dass Sie blind bist. Und wissen Sie was? Nach allem, was ich gehört habe, besteht die Möglichkeit, dass Ihre Sehfähigkeit zurückkehrt, wenn …«
»Oh, schweigen Sie, Mann! Sie sollten wissen, dass Sie besser nicht auf diese Weise mit mir reden. Meine Sehkraft ist beim Teufel.«
»Ach was. Sie haben Ihre Augen. Nur die Nervenverbindungen sind unterbrochen oder so ähnlich, sagen die Ärzte.«
»Ja – oder so ähnlich. Und jetzt Schluss damit.« Der Klang seiner Stimme änderte sich. »Ich sag’s noch mal, Jerry, Sie werden mir fehlen.«
»Und Sie mir, Matthew. Ich werde nie vergessen, wie anständig Sie zu mir waren, als ich das erste Mal … den ›Salon ‹ betrat. Weiter hinten in den Linien hatte ich schon von Ihnen gehört. Ein Teufelskerl seien Sie, meinten einige. An dem Tag, als ich beinahe in Ihr Zelt gefallen bin, kam Ihre Hand heraus und Sie haben mich gestützt. Dann haben Sie meine Hand geschüttelt und gesagt: ›Nur herein in den Salon. ‹ Diese Begrüßung und Ihre Haltung mir gegenüber in der anschließenden Zeit haben mir geholfen, weniger auf Lieutenant Ferguson zu achten, der den Second Leutnant mit Missachtung strafte, weil dieser weder in Eton, Harrow, Oxford noch in Cambridge studiert hatte, dafür aber aus der gleichen Stadt wie er stammte. Es heißt, der Krieg habe den Snobismus ausgerottet. Ich glaube, er hat alles Mögliche zerstört, aber nicht die Wichtigtuerei gewisser Leute. Ich war zum zweiten Mal in seine Kompanie abkommandiert. Er wusste also über mich Bescheid. Von Anfang an habe ich nicht seine Sprache gesprochen. Als ich ihn an jenem Tag sah, bekam ich einen Riesenschreck, sage ich Ihnen, aber Sie haben mir durch die schwierige Zeit geholfen. Dafür bin ich Ihnen ewig zu Dank verpflichtet.«
Matthew wollte antworten: »Reden Sie nicht solchen Unfug. Sie wissen, Sie haben alles zurückgezahlt, was Sie mir schuldig zu sein glaubten – in dieser einen Nacht, die weder Sie, Fox noch ich jemals vergessen werden … aus gutem Grund.« Stattdessen streckte er eine Hand aus.
Jerry nahm sie und sagte: »Ich finde heraus, wohin Sie geschickt werden. Sie kriegen bald eine Berufsausbildung verpasst. Was auch kommt, ich melde mich.«
»Danke, Jerry. Es heißt, ich bekäme einen Monat Urlaub, sobald ich auf Krücken gehen kann. Warum besuchen Sie mich nicht auf ein Wochenende? Es ist nicht allzu weit von Carlisle. Schreiben Sie sich die Adresse auf: The Beavors, Little Fellburn. Das Gut liegt ungefähr fünf Kilometer außerhalb der Stadt. Sie nehmen den Zug von Carlisle nach Newcastle, mit Anschluss in Fellburn. Dann bringt Sie ein Bus über die Hauptstraße bis Manor Grove. Dort steigen Sie aus. Ein Fußmarsch von fünf Minuten auf dem Treidelpfad und Sie stehen direkt vor unserem Tor. Sie können es nicht verpassen. Zu dem Anwesen gehört auch eine Farm, aber das Haupthaus liegt etwas entfernt. Vielleicht finden Sie es sehenswert; der Bau ist etwas ungewöhlich. Ich bin sicher, dass Sie von meiner Familie mit offenen Armen empfangen werden. Meine Mutter haben Sie bereits erobert, das spüre ich.«
»Sie hat mich erobert. Sie ist eine wunderbare Frau.«
»Und mein Vater hat sich mit Ihnen unterhalten. Das war ein Ereignis. Seit er krank ist, kann er Fremde nicht mehr ertragen. Ich weiß nicht, wie er den Weg ins Krankenhaus überhaupt geschafft hat, denn er weigert sich, seinen Rollstuhl zu benutzen.«
»Ich habe ihn als höchst angenehmen Menschen empfunden. Sehr freundlich. Woran leidet er?«
»Multiple Sklerose. Bei ihm ist die Krankheit erst sehr spät ausgebrochen; deshalb verläuft sie langsamer, sagen die Ärzte. Trotzdem, es ist furchtbar für ihn und Mutter. Er war immer so rege, so voller Leben. Mein Vater hat auch in der Armee gedient, müssen Sie wissen.«
»Nein! Auch in der Armee?«
»Ja. Er war Colonel. Deshalb musste ich in seine Fußstapfen treten. Ich wollte nicht, aber dann ist William, mein ältester Bruder, nach Amerika ausgewandert. Einfach so. Eines Tages war er verschwunden. Er hat nur einen Brief hinterlassen. In Amerika hat er einen Autohandel aufgezogen und das Geschäft läuft gut. Zwischen meinem ältesten Bruder und mir sind fünf Jahre Altersunterschied. Bevor er William verlor, schien mein Vater mich überhaupt nicht zu bemerken. Dann traf ihn in dieser Zeit auch noch seine Krankheit. Also hieß es für mich Sandhurst und nicht Oxford. Das war ein Fehler.«
»Nein, war es nicht«, wandte Jerry ein. »Bestimmt nicht. Sie waren ein ausgezeichneter Offizier. Und Sie haben vier Jahre durchgehalten … mehr oder weniger bis zum Ende, als wir alle Pech hatten. In der ganzen Zeit waren Sie nur einmal auf Urlaub, wenn ich mich recht entsinne.«
»Aus guten Grund, Jerry. Ich wusste, wenn ich erst wieder zu Hause bin, kehre ich nicht zurück.«
Die Worte kamen leise und langsam aus seinem Mund. Jerry wartete eine Weile, bevor er antwortete: »Den meisten von uns erging es ähnlich. Mir auf jeden Fall. Ich war manchmal starr vor Angst und meine schlimmste Befürchtung war, dass die Männer was merken könnten.«
Matthew sagte nichts. Jerry versuchte, freundlich zu sein, wie immer. Er wollte ihn vergessen lassen, wie er mit dem Gewehr wild in der Gegend herumgefuchtelt hatte. »Leben Sie wohl, Jerry.«
»Auf Wiedersehen, Matthew. Wir sehen uns bald wieder.« Er wollte hinzufügen: »Halten Sie die Ohren steif«, aber solche Dinge sagte man nicht zu einem Burschen wie Matthew Wallingham. Lieutnant Ferguson hätte geschnarrt: »Albernes Geschwätz zehrt an meinen Nerven.«
Oh, zur Hölle mit den Erinnerungen an alle Fergusons dieser Welt! Er hatte die Sache hinter sich, er war frei. Jetzt musste er nur seine Arbeit wieder aufnehmen, ein nettes Mädchen finden, heiraten und eine Familie gründen. Er wünschte sich eine Familie, einen Ort, wohin er gehörte. Seine Eltern waren gestorben, als er sieben Jahre alt war. Eine Tante und ein Onkel hatten ihn aufgezogen, freundliche gute Leute, gottesfürchtig und fromm, aber sie waren keine Familie. Jetzt kam er wieder nach Hause. Der Captain hier, der hatte eine Familie, alles wunderbare Menschen. Sein Vater, seine Mutter, sein jüngerer Bruder und zwei Schwestern. Wie er gehört hatte, sollte es auch eine Großmutter geben, über die alle lachten und die offenbar der Schrecken der Familie war. Ja, eine richtige Familie hatte immer einen alten Drachen. Und nun gab es auch noch einen Bruder in Amerika. Wie er Matthew beneidete. Er hielt auf seinem Weg durch den Korridor an. Beneidete er Matthew tatsächlich? Lieber Gott, nein! Keine Familie der Welt war eine Entschädigung für den Verlust des Augenlichts.
3
Ohne den Anbau auf der linken Seite – von einem Bungalow nur durch die beiden, wie riesige Augen hervortretenden Mansardenfenster unterschieden – wäre das Haus ein langweiliges Rechteck gewesen. Die Fenster lagen beinahe vollständig unter Clematis montana rubra verborgen, die an der Hauswand emporkletterten und sich auf dem Hauptgebäude und in Richtung des Daches mit den zahlreichen Ornamentschornsteinen ausbreiteten. Dort hatte man dem Wuchern offensichtlich Einhalt geboten, denn das riesige Schieferdach von The Beavors war frei von Bewuchs, ebenso der Doppelkamin an der rechten Hausseite.
Das Haupthaus war aus Steinen errichtet – große Felsblöcke, von denen jeder Einzelne behauen worden war, bevor er seinen Platz fand. Das Ergebnis war eine hell und warm wirkende Fassade, die wie das Dach nicht von Kletterpflanzen überzogen war. Eine niedrige, mit Steinplatten gepflasterte Terrasse säumte das Haus in seiner ganzen Länge. Die Terrasse lag auf gleicher Höhe wie der tiefgrüne Rasen; daher gab es kein Geländer und keine Stufen. An der Stirnseite des Hauses, jenseits des Rasens, befanden sich sorgfältig gepflegte Blumenrabatten.
Das Erdgeschoss hatte sechs große Fenster mit abgeschrägten Simsen; die Eingangstür war exakt in der Mitte eingefügt. Sie bestand aus dunklem Eichenholz, verstärkt durch sechs eiserne Angeln, die sich über die ganze Breite erstreckten. Im oberen Stockwerk gab es acht Fenster; vier davon glichen den unteren, der Rest war kleiner und schlichter. Weitere Fenster waren an dieser Hausseite nicht zu sehen.
Zur Stirnseite führte kein Zufahrsweg; man hätte höchstens ein Fahrrad schieben können. Jenseits der rechten Seite des Hauses erstreckte sich ein großes Gelände mit Stallungen. Drei Pferdeboxen gehörten dazu und ein scheunenähnliches Gebäude, durch dessen Eingang zwei Kutschen nebeneinander gepasst hätten, wäre der davor liegende Hof für Fahrzeuge erreichbar gewesen. Aber die Zufahrt gab es nicht mehr. Sie war hundert Meter vor dem Haus unterbrochen worden. Ein zweirädriger Einspänner und die restlichen Fahrzeuge standen in einem Schuppen auf der Farm.
Es war ein frostiger Novembermorgen und das Land lag unter einer Raureifschicht, aber im Haus war gut geheizt. In der Halle brannte ein offenes Holzfeuer. Vermischt mit den Kochdünsten aus der Küche stieg die Hitze zum ersten Treppenabsatz hinauf, wo Matthew für einen Augenblick stehen blieb und vorsichtig tastend den Fuß auf die erste Stufe setzte.
Er hatte drei Stufen nach unten geschafft, als ihn der Klang von Klavierakkorden innehalten ließ. Den Kopf nach unten in die Richtung der Tür geneigt, aus der die Töne kamen, blieb er erneut stehen.
Dann wurde aus den Akkorden ein kleiner Triller. Matthew hastete förmlich den Rest der breiten Treppe hinunter. Unten angekommen, nahm er seinen Stock in die rechte Hand und streckte suchend die linke aus. Auf diese Weise arbeitete er sich zu einem Korridor voran, hin zu der ersten Tür. Er stieß sie auf. »Was machen Sie mit dem Ding, Tommy?«
Ein kleiner Mann mit sehr kurzen Beinen und einem riesigen Schädel drehte sich zu ihm. »Was glauben Sie denn, Mr. Matthew? Ich stimme das Klavier.«
»Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben?«
»Die alte« – er ruckte den gewaltigen Kopf nach hinten – »die alte Dame drüben. ›Machen Sie sich an die Arbeit‹, hat sie gesagt. ›Ganz gleich, was er davon hält.‹ Und genau das tue ich.«
»Sie können gleich wieder aufhören, da ich nicht beabsichtige, das Klavier anzurühren. Das habe ich ihr auch gesagt.«
»Oh, sie erwähnte, Sie hätten etwas in der Richtung gesagt. Aber glauben Sie, die alte Dame kümmert sich darum, was Sie sagen? Sie oder sonst jemand? Hat sie das jemals gekümmert?« Er schlug zwei Tasten an. »Ob Sie drauf spielen oder nicht, es ist eine Schande, dieses Instrument verkommen zu lassen. Vor fünf Monaten habe ich zum letzten Mal Hand daran gelegt.«
»Dann können Sie jetzt damit aufhören. Gehen Sie.«
»Nicht mit mir, Mr. Matthew. Ich würde mich nicht mehr zu der alten Herrin über die Schwelle trauen. Sie ist eine gute Kundin. Nicht viele Leute lassen ihr Klavier zweimal im Jahr stimmen. Aber sie benutzt es auch. Und wie! Im Krieg, jedes Mal, wenn ein Schiff gesunken ist, hat sie darauf herumgehämmert und Wagner gespielt. Wären Sie da gewesen, hätten Sie sie bis in die Stadt hören können, vom Dorf ganz zu schweigen. Ich glaube, in ihrem ganzen Leben hat sie kein leises Stück gespielt. Sie hätte in einer Schlagzeuggruppe mitspielen sollen. Mich hätte es nicht gewundert, wäre sie mit einer dieser Konstruktionen durch die Gegend gezogen, bei denen man ein Dutzend Instrumente auf einmal bedienen kann. Hände und Füße angeschnallt, und dann Wummtata!« Er ließ die Finger über die Tasten gleiten. Als Matthew näher trat, sagte er ruhig: »Wissen Sie, Mr. Matthew, und das meine ich erst, Ihnen täte es mächtig wohl, wenn Sie wieder damit anfangen würden. Sie waren gut. Ja, wirklich. Vielleicht war ihr Spiel nicht konzertreif, aber immer noch hervorragend. Sie hatten ein Gefühl für das Instrument. Warum versuchen Sie es nicht wieder?«
Matthew sprach ebenfalls ruhig. »Es hat keinen Zweck, Tommy. Nach Gehör konnte ich noch nie sonderlich gut spielen.«
»Sie müssen nur wieder anfangen. Dann kommt alles von ganz allein wieder. Bestimmt. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Art Tatum. Er ist blind wie eine Fledermaus. Aber Rachmaninow sagte von ihm, flinkere Finger am Klavier hätte er noch nie gehört. Das Klavierspielen würde Ihnen eine sinnvolle Beschäftigung bieten, etwas, das sie fordert. Auch wenn Sie behindert sind, wollen Sie doch nicht für den Rest Ihres Lebens das eingestrichene C spielen, oder?«
Er hämmerte auf das C in der Mitte der Tastatur. »Wissen Sie, ich habe von den Tonleitern viel über das Leben gelernt. Oft denke ich, die Hälfte der Menschheit weiß nicht einmal, dass sie geboren ist. Die Leute blicken nie in sich selbst hinein – und wenn doch, dann nur, um jemand anderen zu beneiden, der mehr Geld verdient oder im Leben besser vorankommt. Auf den Gedanken, dass sie mit etwas Anstrengung mehr oder weniger das Gleiche hätten erreichen können, kommen sie nicht. Zugegeben, viele hatten schlechte Ausgangsbedingungen, wie ich. Wissen Sie, was sie mit mir vorhatten, als ich zehn Jahre alt war? Sie wollten mich in ein Heim für geistig Zurückgebliebene stecken, weil ich nicht lesen konnte. Mein eigener Vater! Aber ich hatte eine Tante, die besaß ein Klavier – ein uraltes Ding mit durchbrochener Vorderseite und grünem Flanell. Wenn ein Instrument einen Klavierstimmer brauchte, dann dieses. Offensichtlich hatte ich seit frühesten Kindertagen, immer wenn wir meine Tante besuchten, in die Tasten gegriffen und ihnen ein paar Töne entlockt. Diese Tante sagte zu meinen Eltern: ›Behaltet den Jungen zu Hause. Dann zahle ich ihm die Klavierstunden.‹ Also durfte ich bei meiner Familie bleiben. Was man Familie nannte. Zusammen mit meinen vier Brüdern und zwei Schwestern hatten wir die Hölle. Da sagt man, die Deutschen wären grausam! Manchmal muss man nicht weit blicken. Es genügt, sich die eigene Familie anzusehen. Wenigestens bekam meine Tante Ethel ihren Willen und bald habe ich in einer Band gespielt. Na ja, für zwei Schilling und Sixpence den Abend. Die Hölle ging für mich weiter. Ich war ein eigenartiger kleiner Kerl, Sie verstehen. Kein Komödiant, sonst hätte ich ein Vermögen gemacht. Ich konnte keine Witze erzählen und die Leute zum Lachen bringen. Wenn doch jemand lachte, bin ich tausend Tode gestorben. Trotzdem, die mittlere Tonlage habe ich hinter mir gelassen. Ganz nach oben, zum hohen C, würde ich nie kommen. Das wusste ich immer. Aber die Band habe ich verlassen. Ich war entschlossen, einen richtigen Beruf zu erlernen. Obwohl ich kein guter Pianist war, habe ich das Klavier geliebt. Ich liebte das Instrument um seiner selbst willen.
Eines Tages endlich kam meine Chance. Ich durfte in der Fabrik, in der ich arbeitete, beim Bau eines Klaviers mithelfen. Damals wohnte ich bereits bei meiner Tante, schon seit ein paar Jahren, aber ich hatte sechs Jahre in der Fabrik hinter mir, als es hieß: ›Ein Paderewski werden Sie nie, aber Sie lieben das verflixte Ding, als wäre es ihr Baby. Warum kümmern Sie sich nicht auch um die Babys anderer Leute und werden Klavierstimmer?‹
Offen gesagt, konnte ich mir das nicht vorstellen; dann befolgte ich den Rat doch. Seit meinem ersten Hausbesuch als Klavierstimmer habe ich die Menschen kennen gelernt, diejenigen ganz unten beim tiefen C, die beim hohen C und die vielen Mittelmäßigen beim eingestrichenen C.«
»Gut, Tommy. Rechnen Sie mich zu den Mittelmäßigen. Denn ich werde nicht auf diesem Instrument spielen«, sagte Matthew ernst.
»Das weiß man nie, Mr. Matthew. Sie können nicht den ganzen Tag herumsitzen und nichts tun. Die Armee wird Ihnen irgendwo eine Arbeit vermitteln, nehme ich an. Das machen die Behörden immer so.«
»Nicht in meinem Fall. Ich bleibe hier auf der Farm und lerne, wie man Kühe melkt.«
»Klar, das ist ein Anfang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie damit zufrieden sind.«
»Nein? Warum nicht?«
»Weil ich weiß, wie Sie waren, bevor das passierte. Sie hatten große Ziele und waren dauernd unterwegs – wie Mr. William, bevor er in die Staaten ging. Aber genug jetzt. Wenn ich mit den Familiengeschichten anfange, finde ich kein Ende mehr. Ich muss weiter.«
Matthew ging aus dem Zimmer, tatsächlich mit einem Gefühl von Heiterkeit. Es war lange her, seit er vor sich hin gelacht hatte. Tommy war ein komischer Kauz – mit seinem eingestrichenen C. Nun gut, dann gehörte er zu den Mittelmäßigen. Das Leben hatte ihm nichts Besonderes mehr zu bieten. Er würde dieses Haus und dieses Grundstück nicht wieder verlassen. Die Arbeit auf der Farm würde in Zukunft sein Lebensinhalt sein, das musste er akzeptieren. Mehr hatte er nicht zu erwarten. Seine Tage würden ruhig und friedvoll verlaufen.
Er durchschritt den Korridor bis zum Ende und trat in eine kleine Halle, von der vier Türen abgingen. Hier stellte er sich in die Mitte und rief: »Wo bist du?«
»Im Salon«, drang eine Stimme zu ihm.
Mit ausgestreckter Hand tastete er sich, noch immer unsicher, zu der Tür neben dem Eingang zum Wintergarten. Er öffnete sie und sagte: »Du bist früh auf.«
»Nein. Du bist spät. Es ist viertel vor zehn.« Dann hörte er, dass sie zu jemandem sprach, der neben ihr stand. »Nimm das Tablett, Mary. Und klappere nicht damit. Man könnte glauben, du wirst alt.«
Ein »Ha!« war die Antwort. Die ältere Frau kam mit dem Tablett an ihm vorbei und er bemerkte in normalem Tonfall: »Sie war schon immer dankbar für jede gute Tat, nicht wahr, Mary?«
»Sie sagen es, Mr. Matthew. Daran ändert sich nie was.«
Die grobe Stimme sagte scharf: »Setz dich, Matthew! Und behaupte nicht, ich hätte eine Ahnung, weshalb du gekommen bist. Ah, übrigens, Tommy wird das Klavier weiterhin alle sechs Monate stimmen. Dieses Mal ist er früh dran. Sag, was willst du mit deiner Zeit anfangen? Herumsitzen und Däumchen drehen?«
»Nein, Granan. Das habe ich dir bereits gesagt. Ich habe es allen gesagt. Ich möchte einen Versuch machen und die Arbeit auf der Farm lernen.«
»Verfluchte Landwirtschaft! Du wolltest Lehrer werden, bevor der Krieg losging, Lehrer für Geschichte und Klavier. Das mag eine voreilige Wahl gewesen sein, aber eine Wahl war es. Verfluchte Armee! Weiß der Kuckuck, warum ich in eine Offiziersfamilie geheiratet habe. Das werde ich nie begreifen! Aber da ich nun mal dazu gehöre, habe ich dafür gesorgt, dass alle wissen, was ich von der Sache halte. Dein lieber Großvater« – sie lachte plötzlich ihr tiefes, beinahe männliches Lachen – »dein Großvater hat jedes Mal vor Angst gezittert, wenn ein Salonabend bevorstand. Er pflegte zu sagen, lieber stünde er einem Bataillon von lauter Kriegsdienstverweigerern gegenüber. Aber das sage ich dir, die Männer haben mich geliebt; die Frauen hassten meinen Schneid, auch wenn sie Entschuldigungen für mich fanden, da ich nicht aus einer Offiziersfamilie stammte. Und was geschah, als dein Vater auf die Welt kam? Er wurde bei der Armee eingetragen, bevor er getauft war.
Jahre später hat dein Urgroßvater Bertie deinen Bruder William mit Champagner getauft. Goss dem Kind das Zeug einfach über den Kopf. Wieder ein armes Opfer, das lernen sollte, anderen den Schädel einzuschlagen. Und was machte William? Weißt du, Matthew« – ihre Stimme wurde weich und ruhig –, »nicht einmal seine Mutter ahnt etwas davon. An dem Tag, als William von zu Hause fortging und nur einen Zettel hinterließ, auf dem stand, er werde nicht in die Armee eintreten, sondern in die Staaten auswandern, bin ich in dieses Zimmer gegangen und habe Tränen gelacht, denn ich mag William. Mit William konnte ich reden wie … na, wie mit dir. William und du, ihr seid euch sehr ähnlich. Rodney ist derjenige, der aus der Art schlägt.« Ihre Stimme wurde kalt. »Er ist Bauer, ein überzeugter Landwirt. Ich weiß nicht, was er getan hätte, wäre er eingezogen worden. Durch seine Arbeit hat er einen Beitrag geleistet, die Nation zu ernähren, ganz allein auf sich gestellt – und jetzt glaubt er, alles hier wäre sein heiligster Besitz. Die Farm auf jeden Fall. Er kann von nichts anderem mehr reden. Ich sage dir etwas, Matthew.« Sie streckte die Hand aus; Matthew nahm die knochigen Finger und umfasste sie, während seine Großmutter weitersprach. »Ganz gleich, wie er sich verhält, er ist nicht erfreut darüber, dass du die Leitung übernehmen willst.«
Mit einer Stimme wie ein Peitschenknall erwiderte er: »Ich will die Leitung nicht übernehmen, Granan. Das wäre das Letzte, wonach mir der Sinn steht. Ich will nur für ihn arbeiten. Er soll mir beibringen, was ich zu tun habe.«
»Du bist jetzt der Älteste, Matthew. Vergiss nicht, eines Tages wirst du für The Beavors verantwortlich sein. Alles hier wird dir gehören und es ist ein schöner, kleiner Besitz. Im ganzen Umkreis gibt es keinen besseren. Gut, Richard kann noch lange leben. Seine MS ist ziemlich spät ausgebrochen; deswegen schreitet die Krankheit langsam voran, wie es heißt. Zwei, drei oder vielleicht sogar zehn Jahre bleiben ihm sicher noch. Wie du ist er ein Sturkopf und gibt nicht so leicht auf.«
»O Granan!« Matthew schüttelte den Kopf über seine alte Großmutter. »Ich habe aufgegeben. Schon vor einer ganzen Weile. Weißt du … es ist nicht zu glauben! Tommy hat mir gesagt, wo ich stehe. Er hat diese Theorie, über das Klavier und die verschiedenen Stufen des Lebens.«
»Ja, ich weiß. Das eingestrichene C. Wo hat er dich eingeordnet? Sag nur nicht, bei der Mittelmäßigkeit, weil du mit dem Klavierspielen aufgehört hast.«
»Genau da.«
»Trotzdem, Tommy ist ein weiser Mensch. Er stammt aus Bog’s End, musst du wissen, draußen vor der Stadt. Aber aufgewachsen ist er hauptsächlich auf dem Land, im Dorf unten. Seine Eltern taugten nicht viel. Sie sind mittlerweile beide tot, wie ich gehört habe. Zu schade, dass sie nicht früher gestorben sind. Aber seine Tante hat bis vor fünf oder sechs Jahren gelebt. Damals war er um die vierzig. Und stell dir vor, jetzt ist er verheiratet.«
»Verheiratet? Davon wusste ich nichts.«
»Nein. Wie auch. Die Hochzeit war ungefähr zu der Zeit, als du nach Übersee gingst. Sie ist eine nette, kleine Person, eine Witwe, etwas jünger als er. Seit er sie hat, ist er ein anderer Mensch geworden. Früher bekam man kein Wort aus ihm heraus. Jetzt redet er wie ein Wasserfall.«
»Das höre ich gern«, sagte Matthew leise. »Er tat mir immer Leid, weil er irgendwie einsam war.«
»Ja, er war einsam. Einsamkeit ist eine furchtbare Sache. Wie ein Bandwurm, der einen bei lebendigem Leib auffrisst. Auf jeden Fall ist seine Einsamkeit verschwunden. Man könnte meinen, die Frau hatte eine Wirkung wie eine Prise Riechsalz unter seiner Nase.« Granans Lachen war ein tiefes Rumpeln. »Ein guter Vergleich, findest du nicht auch?«
Matthew stand auf. Er lachte mit seiner Großmutter und beugte sich zu ihr. »Nein, Granan. Das war kein guter Vergleich, sondern ein Beispiel für wenig damenhafte Grobheit. Mir tun die Damen Leid, die dich früher in deinem Salon ertragen mussten.«
»So bin ich eben, mein Junge.« Sie tätschelte seinen Arm. »Nein, früher war ich so. Heute nicht mehr. Nach meiner Rückkehr aus Indien habe ich einige dieser Damen wiedergetroffen. Sie waren viel schlimmer als ich. Aus Indien waren sie daran gewöhnt, ständig von einer riesigen Dienerschaft umgeben zu sein, so dass sie. ihre Dienstboten hier wie Sklaven behandelten. Und ihre Tugend! Ich kann dir Geschichten erzählen …«
»Darauf wette ich. Und ich nehme dich beim Wort, sobald es schneit und ich nicht nach draußen kann.«
Er ging zur Tür. Sie hielt ihn mit sanfter Stimme zurück: »Noch eine Minute, Matthew.« Als er sich umdrehte, sagte sie: »Ich mache mir Sorgen um dich. Du sitzt viel zu oft oben in deinem Zimmer. Was mit dir geschehen ist, ist geschehen; nichts kann das ändern. Wenn du darüber reden willst, weißt du, zu wem du kommen kannst. Es wäre besser, wenn du dir die Sache von der Seele redest, statt ständig darüber nachzugrübeln. Betrachte mich als diese alte Nachtschwester, die, wie Lucille sagt, so gut zu dir war. Lucille meint sogar, sie hätte dich dem Leben wiedergegeben.«
»Das könnte stimmen. Sie hat mich ins Leben zurückgeholt. Aber es gibt eine Überraschung für dich. Ihre Rolle könntest du auf keinen Fall spielen, nicht in deinem Alter. Stell dir vor, sie hat mich getäuscht. Sie war nicht die, für die ich sie gehalten habe: die ältere Krankenschwester um die fünfzig, Typ Mutter. Stell dir vor, wie ich mich fühlte, als Jerry Fulton kurz vor meiner Entlassung damit herausrückte, dass meine Retterin, wenn man sie so nennen soll, keine mütterliche Gestalt war, sondern eine langbeinige Schönheit von vierundzwanzig Jahren. Braunes Haar, braune Augen, wunderbare Haut, wenn ich seiner Beschreibung glauben kann. Du kannst dir denken, wie ich mir vorkam.«
»Wie denn?«
»Wie ein Vollidiot.«
Sie schnippte seine Hand von sich weg. »Du bist ein Vollidiot. Sie muss etwas für dich empfunden haben, wenn sie sich mit dieser Hingabe um dich gekümmert und vorgetäuscht hat, eine andere zu sein.«
»Im Krankenhaus wurde mir erklärt, die männlichen Patienten hätten sie lebendig aufgefressen, wäre sie zu allen so freundlich gewesen. Ich konnte sie nicht sehen; das war der Unterschied.«
Die alte Dame lehnte sich in ihren Sessel zurück. »Wie heißt sie?«, fragte sie ruhig.
»Ducks.«
»Was?«, kam laut zurück.
»Ihr Name ist Elizabeth Ducksworth, aber im Krankenhaus nannten wir sie Ducks.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Nach dem, was ich zuletzt über sie gehört habe, arbeitet sie am entgegengesetzten Ende des Krankenhauses im Tagdienst. Anscheinend rät man den Schwestern davon ab, ehemalige Patienten zu besuchen, vor allem die blinden oder fast blinden. Es geht dabei um Gefühle«, sagte er und betonte das letzte Wort.
»Na sowas! Weiß deine Mutter davon, ich meine, dass diese Schwester keine ältere Frau war?«
»Keine Ahnung. Ich habe mit ihr nicht über dieses Thema gesprochen.«
»Ich bin die Erste, der du davon erzählst?«
»Ja.«
»Danke, mein Lieber. Hast du ihre Adresse?«
»Nein, und ich will sie auch nicht. Was kann ich ihr schon bieten?«
»Hinaus mit dir! Geh schon! Hinaus!«
Die Stimme klang wieder rau und grob. Mit einem wehmütigen Lächeln verließ Matthew den Raum.
4
»Warum setzt du dich nicht für eine Minute hin und unterhältst dich mit mir, Lucille?«, fragte Colonel Wallingham.
»Ich rede den ganzen Abend mit dir, mein Lieber«, sagte seine Frau, »und manchmal noch die halbe Nacht. Aber es gibt viel zu tun. Die Köchin hat dafür gesorgt, dass Rosie heute Morgen in Tränen ausgebrochen ist. Sie vergisst, wie glücklich wir uns schätzen können, Rosie zu haben. Die wenigsten Sechzehnjährigen mögen heutzutage noch als Dienstmädchen arbeiten. Dabei ist Rosie manchmal eine solche Hilfe für Mary und Bella.«
»Was gibt es denn zu tun?«
»Beispielsweise sind zwei zusätzliche Schlafzimmer herzurichten. Vergiss nicht, deine beiden Töchter mit ihren Ehemännern kommen zu Besuch, mit zwei Enkelkindern. Ich werde Rodney bitten müssen, in Granans Flügel zu übernachten, denn die Kinder brauchen ein eigenes Zimmer. Das wird Granan nicht passen, aber die Kinder kann ich nicht zu ihr schicken. Sie duldet sie nicht. Obwohl sie selbst so viel Lärm macht, kann sie den Krach von anderen nicht ertragen.« Sie stupste ihren Ehemann, der in einem tiefen Lehnsessel neben dem Feuer saß, an der Schulter und fügte lachend hinzu: »Wie auch immer, wir haben Gesellschaft und das wird dir gefallen.«
»Ach, mach, dass du hinauskommst.«
Sie beugte sich über ihn, küsste seine Braue und sagte: »Ich bin zurück, sobald ich kann, mein Lieber. Und noch etwas. Ich mache mir Sorgen wegen Matthew. Er ist so schweigsam. Manchmal sitzt er eine geschlagene halbe Stunde da, ohne den Mund aufzumachen. Wenn man den Krieg erwähnt oder eine Bemerkung in dieser Richtung macht, steht er auf und verlässt das Zimmer. Verstehst du das?«
»Ja, Lucille. Das verstehe ich. In gewisser Weise jedenfalls.«
»Weißt du, er wollte nie Offizier werden. Es war nicht seine eigene Entscheidung damals; er hat deinen Willen erfüllt. Jetzt musst du zu deiner Schuld stehen.«
»Das werde und will ich nicht. Er war ein erwachsener Mann.«
»Das war er nicht. Nicht wirklich. Er war kaum den Kinderschuhen entwachsen. Weißt du was?« Sie begann zu lachen. »Manchmal fühle ich mich wie Granan. Sie sagt, in dieser ›verdammten Offizierssippe‹ sei sie nur gelandet, weil sie die älteste von fünf Töchtern war. Damals konnte ein Mädchen, das nicht heiratete, sich ebenso gut die Kugel geben. Sie dachte, es wäre besser, anderen diesen Ausweg zu überlassen, und dein Vater, das weißt du selbst, war verrückt nach dem Soldatenleben. Noch lange, nachdem er in den Ruhestand getreten war, glaubte er, das Kommandieren nicht lassen zu können. Erinnerst du dich, wie er vom obersten Treppenabsatz brüllte: ›ANN-EE! ANN-EE! Angetreten, Frau! Wird’s bald?‹? Granan fragte dann: ›Was willst du?‹ und er sagte, genau wie du: ›Mit dir reden.‹«
»Aber du musst zugeben, ich bin höflicher als Granan. Ihre Antwort lautete nicht selten: ›Zum Teufel mit dir. Und nimm ein paar von deinen Gewehren mit.‹« Ruhig sagte er: »Ich bin nicht wie er, oder? Nicht so übel, meine ich.«
»Nein, Richard, so bist du nicht.« Sie beugte sich wieder zu ihm und sagte laut: »Manchmal bist du schlimmer.« Dann eilte sie aus dem Zimmer. Ihr Lachen ließ ihn schmunzeln.
Um sechzehn Uhr kehrte Matthew von einem Besuch bei seinem Colonel zurück. Peter Carter begleitete ihn. In der Armee war Carter Mr. Wallinghams Offiziersbursche gewesen. Als der vorzeitig den Dienst quittierte, weil bei ihm Multiple Sklerose festgestellt wurde, bat Peter ebenfalls um seine Entlassung, damit er ihm weiter dienen konnte. Sich zusätzlich um den jungen Mr. Matthew zu kümmern bedeutete für ihn keine Last, obwohl die Aufgabe manchmal schwierig war. Der junge Mann wollte keine Hilfe annehmen und versuchte, in allem möglichst allein zurechtzukommen, außer wenn er The Beavors verließ. Das Gut selbst kannte er wie seine Westentasche. Nachdem Colonel Wallingham zu Bett gebracht war, brauchte er nachts bislang selten Unterstützung. Peter konnte oben im Haus in seinen Wohnräumen bleiben, die bequem und großzügig ausgestattet waren. Er hatte zwei Lieblingsbeschäftigungen, die ihm beim Colonel zugute kamen: Er spielte ausgezeichnet Schach und liebte Kreuzworträtsel. Die Interessen des jungen Herrn gingen in eine ähnliche Richtung. Das erleichterte ihr Zusammensein; obwohl sich Mr. Matthew im Schachspiel bislang gegenüber seinem Vater und auch Peter im Nachteil befand, da jeder Zug mündlich angekündigt werden musste. Dafür besaß er bei den Kreuzworträtseln einen riesigen Vorsprung vor Peter und seinem Vater. Die meisten Lösungsworte fielen ihm sofort ein. An einem Tag schafften sie die Rätsel aus vier Zeitungen. Außerdem kamen einmal in der Woche die Männer zweier benachbarter Familien vorbei – den McArthurs und den Hendersons –, um einen Vierer im Bridge zu bilden. Natürlich mussten sie besondere Karten benutzen und Matthew entwickelte sich bereits zum Experten …
Bella öffnete den beiden Männern die Vordertür. »Was für ein Tag! Schnupfenwetter, und jetzt fällt auch noch Schnee vom Himmel.«
»Sie erwarten nicht, dass er hinauffällt, Bella. Oder?«
»Ach, Sie, Peter!« Um ein Haar hätte sie ihn mit »Mr. Peter« angeredet, denn die Herrschaft behandelte ihn wie ein Familienmitglied. In der Küche sagte man allerdings, er gehöre nicht wirklich dazu. Er sei seit der Zeit vor dem Krieg lediglich der Leibbursche des Colonels und nichts Besseres als die Burschen, die draußen arbeiteten. Aber er war freundlich und allgemein beliebt.
»Sie sehen verfroren aus, Mr. Matthew.«
»Das bin ich, Bella. Sie wissen, was das bedeutet.«
»Ja, Mr. Matthew. Eine Kanne heißen Tee.«
»Getroffen, Bella.« Er senkte verschwörerisch die Stimme. »Sagen Sie der Köchin, sie soll einen Schuss von ihrer Medizin hineingeben, falls die Flasche noch nicht leer ist.«
Bella antwortete mit einem hellen Kichern. »Das mache ich, Mr. Matthew. Sie können sich drauf verlassen.«
»Und merken Sie sich, was sie antwortet.«
»Oh, da bist du ja, mein Lieber.« Lucille betrat die Eingangshalle. »Du siehst verfroren aus. Und Sie auch, Peter.«
»Das wurde bereits bemerkt, Mutter. Für Abhilfe wird gesorgt. Bella hat ihre Anweisungen und kümmert sich um heißen Tee … mit einem Schuss Medizin von der Köchin«, fügte er leise hinzu.
»Nein!«
»Doch, gnädige Frau«, schaltete sich Peter ein. »Das hebt sie wieder aufs hohe Ross – und dann fällt das Abendessen aus.«
Peter ging zur Treppe, beladen mit Matthews Mantel, Hut und Schal, während Lucille ihren Sohn zum Salon führte. Seine Hand streifte die Nadeln des Weihnachtsbaums neben der Tür. Er blieb stehen. »Der ist schon im Haus?«
»Ja. Ich bin sicher, wir bekommen zu Weihnachten Schnee. Wahrscheinlich schon früher. Den Baum nass ins Haus zu bringen ist mehr als lästig.«
Im Salon war es wärmer als in der Halle. Matthew konnte das Feuer riechen, vermischt mit dem Zigarrenduft seines Vaters. Richards Stimme drang zu ihm: »Aha, da bist du wieder. Hast du den Colonel angetroffen?«
»Ja, Vater. Ich habe den Colonel angetroffen.«
»Wie geht es ihm?«
»Oh, wie immer. Er war höflich, diplomatisch, freundlich – und geistlos.«
»Du bist zu streng mit ihm, Matthew. Ein bisschen langweilig ist er, das gebe ich zu. Aber er versteht seine Sache. Er war ein guter Soldat. Das ist er noch immer. Obwohl er nächsten Monat in Pension geht, wie ich erfahren habe.«
»Ja, das erwähnte er. Und mir schien, er geht mit tiefem Bedauern.«
»Was sagte er noch, mein Lieber? Welchen Vorschlag hat er dir gemacht?«
»Ach, Mutter, er sagt das Gleiche wie die anderen auch. Ich soll mir eine Beschäftigung suchen. Jetzt habe ich Auswahl. Ich kann mich zum Chiropraktiker ausbilden lassen. Und dann wartet das Klavier.« Lachend fügte er hinzu: »Tommy hätte dabei sein sollen, als er über dieses Thema sprach. Er wusste noch, dass ich in der Offiziersmesse Tanzmusik improvisiert habe. Das war gleich nach meinem Eintritt in die Einheit. Und er fragte, ob ich nicht wieder mit dem Klavierspielen anfangen wollte. Ganz ernsthaft, als Pianist. Viele Männer täten das. Und stell dir vor, er meinte, ich könnte auch Psychiater werden. Die nötigen seelischen Erfahrungen besäße ich. ›Um verrückter zu werden als meine eigenen Patienten‹, konnte ich mir als Entgegnung nicht verkneifen. Er antwortete steif, Menschen mit einem Kriegstrauma seien nicht verrückt, sondern gerieten nur für eine Zeit lang aus dem Gleichgewicht. Am Schluss habe ich mich herzlich bei ihm bedankt und ihm mitgeteilt, ich hätte meine Nische bereits gefunden. Ich würde Landwirtschaft lernen.« »Was hat er dazu gesagt?«, fragte Lucille ruhig.
Sie musste lange auf eine Antwort warten. »›Ich glaube, das wird Ihnen größerere Schwierigkeiten bereiten, als jeder der anderen drei Wege.‹«
»Da gebe ich ihm vollkommen Recht.« Sein Vater sprach mit lauter Stimme. »Du vergisst, dass du mit Tieren zu tun hast. Die treten nicht zur Seite, wenn sie dich kommen sehen. Auch der Bulle nicht. Eher begrüßt er dich mit seinen Hörnern.«
»Für diese Fälle werden wir eine Lösung finden müssen. Oh, da kommt der Tee. Dem Himmel sei Dank.« Matthew hörte, wie das Tablett auf den Tisch gestellt wurde. »Sind Sie das, Bella?« fragte er.
»Ja, Mr. Matthew«, war die Antwort.
»Haben Sie der Köchin die Botschaft überbracht?«
»Na ja …« Bella schwieg. Dann warf sie ihrer Herrin einen Blick zu. »Ich glaube nicht, dass es klug wäre, die ganze Antwort zu wiederholen, Mr. Matthew. Am Schluss meinte sie, teilen würde sie gern, aber Sie müssten ihr die Spezialmedizin in der Küche selbst zeigen.«
Alle lachten, auch Bella. Noch immer kichernd, ging das Hausmädchen zur Tür. Unterwegs murmelte sie: »Ihr Schlafzimmer hat sie nicht zur Durchsuchung frei gegeben, Sir.«
Das Zwischenspiel hatte die Stimmung aufgehellt. »Wir können über die Sache scherzen«, sagte Lucille, noch immer erheitert, »aber sie zerstört sich mit ihrer angeblichen Medizin irgendwann die Leber, wenn es nicht bereits zu spät ist.«