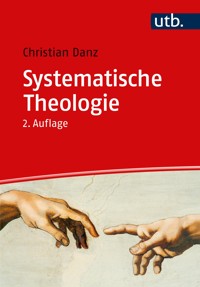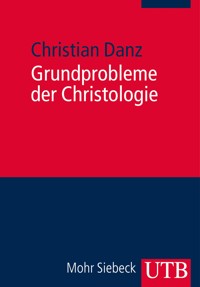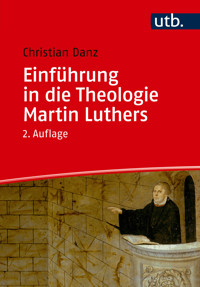
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Christian Danz verknüpft hier die werkgeschichtliche Entwicklung von Luthers Theologie mit einer systematischen Darstellung seiner Hauptthemen. So werden Herausbildung und Ausgestaltung seiner Theologie dargestellt als auch grundlegende Themenstellungen vor dem Hintergrund ihrer konkreten Anlässe erörtert. Ein Literaturverzeichnis führt in die wichtigsten Quellen, Hilfsmittel sowie die Sekundärliteratur ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christian Danz
Einführung in die Theologie Martin Luthers
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: Cranach / Altar Wittenberg, Stadtkirche © akg-images
2., durchgesehene Auflage 2025
1. Auflage 2013 (WBG)
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564074
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6407
ISBN 978-3-8252-6407-9 (Print)
ISBN 978-3-1234-5678-9 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Da die Einführung in die Theologie Martin Luthers seit längerem vergriffen ist, wurde eine neue Auflage nötig. In dieser habe ich ihre Gliederung sowie Intention beibehalten. Es geht um eine elementare Einführung in zentrale theologische Themen des Reformators vor dem Hintergrund der werkgeschichtlichen Entwicklung seiner Theologie. Auf eine systematische Zusammenschau der einzelnen Elemente seiner Theologie wurde verzichtet, auch wenn mit dem sich aus seinem neuen Bußverständnis entwickelnden Glaubensbegriff sowie der theologia crucis Motive benannt werden, die sich durch Luthers Erörterung diverser theologischer Problemstellungen ziehen. Überarbeitet habe ich den gesamten Text dieser Einführung, manchen Gedankengang präzisiert sowie Ergänzungen vorgenommen und neuere Forschungsliteratur eingearbeitet, die seit der Erstauflage erschienen ist. Natürlich konnte nicht die gesamte, kaum noch zu überschauende Lutherliteratur berücksichtigt werden.
Meine erste Beschäftigung mit dem Reformator verdanke ich der Vorlesung ‚Die Theologie Martin Luthers‘, die Martin Seils im Wintersemester 1989/90 an der Theologischen Fakultät der Universität Jena gehalten hat, sowie der von ihm angebotenen Luther-Arbeitsgemeinschaft. Während der Niederschrift dieser Einführung stand mir seine Lutherdeutung vor Augen. Martin Seils starb am 18. Juli 2024. Ihm sei die neue Auflage gewidmet.
Ohne Unterstützung wäre auch dieser Band nicht zustande gekommen. MA Andreas Burri, Ing. Mag. Michael Horvath sowie Dr. Thomas Scheiwiller danke ich für Hilfen bei der Anfertigung des Manuskripts und Herrn Noah Charim (alle Wien) für die Erstellung der Register. Zu danken habe ich ebenfalls meiner Frau Uta-Marina Danz für alle ihre Hilfe sowie manchen Vorschlag zur Vereinfachung von komplexen Gedankenkonstruktionen. Herrn Stefan Selbmann vom Verlag Narr Francke Attempto Tübingen danke ich für die Aufnahme des Buches in das Verlagsprogramm sowie die bewährt sehr gute Zusammenarbeit bei seiner Herstellung.
Wien, im Oktober 2024 Christian Danz
Vorwort zur ersten Auflage
Die Theologie Martin Luthers stellt zweifellos für den Protestantismus einen fundamentalen Bezugspunkt dar. Deren Bedeutung erstreckt sich indes nicht allein auf die protestantische Frömmigkeit, sondern die Reformation ist eines derjenigen geschichtlichen Ereignisse mit weitreichenden kulturellen Folgen. Der Band Einführung in die Theologie Martin Luthers erkundet grundlegende Themen und Fragestellungen des Reformators sowohl vor dem Hintergrund der werkgeschichtlichen Entwicklung seiner Theologie als auch in einer systematischen Perspektive. Ausgehend von Luthers neuem Verständnis des christlichen Glaubens werden die Herausbildung und Ausgestaltung seines theologischen Denkens dargestellt und zentrale Themenstellungen wie seine Gottesanschauung, sein Christusbild oder sein Verständnis des Menschen beleuchtet.
Danken möchte ich an erster Stelle meiner Frau Uta-Marina Danz. Ohne ihre vielfältige Unterstützung und Hilfe wäre der vorliegende Band nicht zustande gekommen. Mein Dank gilt Herrn stud. theol. Alexander Schubach (Wien) für seine Korrekturarbeiten und die Erstellung der Register sowie der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft für die Aufnahme dieses Bandes in ihr Verlagsprogramm und die äußerst konstruktive Zusammenarbeit.
Wien, im Februar 2013 Christian Danz
1Einleitung
1.1Methodische Probleme der Lutherdeutung
Hegels ReformationsdeutungReformationReformationsdeutungIn seinen zwischen 1822 und 1831 mehrfach gehaltenen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie identifizierte Georg Wilhelm Friedrich HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770–1831) in der Reformation Martin Luthers die „Hauptrevolution“, in der „aus der unendlichen Entzweiung […] der Geist zum Bewußtsein der Versöhnung seiner selbst kam“.1 Die Reformation kommt hier als dasjenige weltgeschichtliche Ereignis in den Blick, mit dem das Zeitalter der Subjektivität und der Freiheit des Individuums anhebt.2 Auch die Gestalt Luthers trägt für Hegel durch und durch die Züge der Neuzeit, welche das dunkle Mittelalter weit hinter sich lasse. Eine solche Deutung des Reformators, der er selbst Vorschub geleistet hat, findet sich freilich nicht nur bei HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich, sie ist geradezu signifikant für den Protestantismus des 19. Jahrhunderts.3 Den Beginn der Moderne machten protestantische Intellektuelle an der Reformation fest, so dass sie ihre eigene Gegenwart in unmittelbarer Kontinuität mit der Reformation sehen konnten.
Ernst Troeltsch Differenzierter fällt das Urteil von Ernst TroeltschTroeltsch, Ernst (1865–1923) zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. In seiner großen Studie über Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit von 1906 unterscheidet er zwischen dem Alt- und dem NeuprotestantismusAlt- und Neuprotestantismus und ordnet sowohl Luther als auch den Protestantismus des 16. und 17. Jahrhunderts dem Mittelalter zu. Erst mit der Aufklärung beginne die Neuzeit und sei, entgegen allem Pathos, mit dem protestantische Theoretiker die Moderne als unmittelbare Folge der Reformation herausstellen, jedenfalls was die Reformation betrifft, eine Wirkung wider Willen gewesen. Die Stiefkinder der Reformation, die Täufer und Spiritualisten, von den Reformationskirchen in die neue Welt vertrieben und von dort rückwirkend auf die alte Welt, haben die Aufklärung hervorgebracht und mit ihr eine völlig neue Form des Protestantismus und seiner Theologie.4 Der Neuprotestantismus stehe Spiritualisten wie Sebastian FranckFranck, Sebastian (1499–1542/43) näher als Luther, welcher für Troeltsch noch völlig in die mittelalterliche Einheitskultur gehört.5
Die Deutung und geistesgeschichtliche Einordnung Luthers ist, wie die genannten Beispiele zeigen, äußerst kontrovers und vor allem voraussetzungsreich. Das betrifft zum Beispiel schon die umstrittene Frage nach dem sogenannten reformatorischen Durchbruch LuthersReformationreformatorischer Durchbruch Luthers, also dem Zeitpunkt, an dem er zu seiner neuen Deutung des Christentums durchgedrungen ist. War er bereits 1514 evangelisch, wie die sogenannten Frühdatierer behaupten, oder ist seine grundlegende Entdeckung erst 1518 anzusetzen, so dass er noch römisch-katholisch war, als er am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Tür der Schlosskapelle in Wittenberg hämmerte? Sowohl für die Früh- als auch für die Spätdatierung der reformatorischen Entdeckung gibt es gute Argumente. Ihre Plausibilität und Überzeugungskraft hängt indes davon ab, was man genauer unter ‚reformatorisch‘ versteht. Je nach dem Vorverständnis fällt dann auch die Datierung des reformatorischen DurchbruchsReformationreformatorischer Durchbruch Luthers aus. Schon hier wird ein methodisches Problem der Deutung der Theologie Luthers deutlich, welches keineswegs nur die Frage nach dem Zeitpunkt der reformatorischen Wende betrifft. Es tangiert ebenso die geistesgeschichtliche Einordnung der Reformation im Ganzen als auch den Werdegang des Wittenberger Theologen sowie die Interpretation seiner Theologie insgesamt.6
Luther selbst hat seine Theologie nicht in Form eines theologischen Kompendiums oder gar einer Dogmatik vorgelegt. Seine Schriften sind fast ausschließlich Gelegenheitsschriften und verdanken sich jeweils konkreten Anlässen. In den zahllosen Debatten, in denen er zur Feder greift, verschiebt und verändert sich naturgemäß auch seine eigene Position. Schon die frühen Vorlesungen repräsentieren eine äußerst komplexe Entwicklung, die anschaulich macht, wie der junge Wittenberger Professor um eine eigene Position ringt. In den innerreformatorischen Streitigkeiten der 1520er und 1530er Jahre unterliegt seine Haltung gegenüber bestimmten Themen einem Wandel. Hiermit ist das methodische Folgeproblem verbunden, wie die Theologie Luthers am sinnvollsten dargestellt werden kann. Zwei Möglichkeiten werden in der Lutherforschung hauptsächlich in den Blick genommen: eine systematisch-theologische und eine historisch-genetische Darstellung der Theologie Luthers.7
systematisch-theologische Darstellungen Nimmt man Gesamtdarstellungen des Werks des Reformators zur Hand, dann stellt man fest, dass systematisch-theologische Rekonstruktionen überwiegen. Bereits die erste große Deutung von Luthers Theologie aus dem 19. Jahrhundert von Theodosius HarnackHarnack, Theodosius (1816–1889) mit dem Titel Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre, die 1862–1886 erschien, ist systematisch-theologisch aufgebaut.8 Sie war ungemein folgenreich. Die Theologie Luthers wird von HarnackHarnack, Theodosius in Form einer Dogmatik dargestellt: die verstreuten und in unterschiedlichen Debattenkontexten stehenden Äußerungen des Wittenberger Theologen werden den entsprechenden Locis der Dogmatik zugeordnet. Im 20. Jahrhundert wurde dieses Verfahren von Erich SeebergSeeberg, Erich (1888–1945),9 Friedrich GogartenGogarten, Friedrich (1887–1967)10 und Paul AlthausAlthaus, Paul (1888–1966) angewandt.11 AlthausAlthaus, Paul beispielsweise setzt in seiner Theologie Martin Luthers mit dem Problem der Gotteserkenntnis ein, also mit einem klassischen Thema der Prolegomena der Dogmatik, und geht dann zu der materialen Dogmatik über, indem er von der Gotteslehre über Anthropologie, Christologie, Ekklesiologie bis hin zur Eschatologie Luthers Aussagen einordnet und systematisiert. Bei einem systematischen Darstellungsverfahren von Luthers Theologie wird allerdings nicht nur eine gegenwärtige Anordnung des dogmatischen Stoffs auf ihn übergestülpt, sondern auch die werkgeschichtliche Entwicklung von dessen Denken ausgeblendet. Emanuel HirschHirsch, Emanuel (1888–1972) bemerkt in einer Besprechung von Erich SeebergsSeeberg, Erich 1940 erschienener Schrift Grundzüge der Theologie Luthers nicht zu Unrecht,12 „eine Darstellung von Luthers Theologie als ein gegliedertes Ganzes“ sei eine Aufgabe, die bisher – Seeberg nicht ausgenommen – „noch keinem geglückt ist“.13
historisch-genetische Darstellungen Im Gegensatz zur systematisch-theologischen Darstellung der Theologie des Reformators ist die historisch-genetische werkgeschichtlich orientiert. Die Entwicklung des Denkens von Luther wird in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und auf eine systematische Zusammenschau verzichtet. Einem solchen werkgeschichtlichen Verfahren sind die Lutherstudien Karl HollsHoll, Karl (1866–1926) und Emanuel HirschsHirsch, Emanuel14 verpflichtet. HollHoll, Karl führt in seinem Buch Luther von 1921 Einzelaspekte von Luthers Theologie in einer an den Quellen ausgewiesenen genetischen Perspektive vor.15 Martin BrechtBrecht, Martin (1932–2021) hat es in seiner großen dreibändigen Lutherbiographie unternommen, die Entwicklung des Reformators von den Anfängen bis zur Entfaltung des reformatorischen Programms in einem breiten geistesgeschichtlichen und politisch-gesellschaftlichen Rahmen nachzuzeichnen.16 Man muss allerdings sagen, auch eine werkgeschichtliche und biographische Darstellung des Œuvres des Reformators kommt nicht ohne steuernde Kategorien aus. Die Einheit eines Werks oder einer Biographie, das zeigen zum Beispiel die Ausführungen von Brecht, liegt nicht einfach vor, sondern sie ist in einem hohen Maße eine Konstruktion, deren Einheitsprinzipien alles andere als selbstverständlich sind. Man braucht nur eine ältere römisch-katholische Lutherbiographie neben die von Brecht zu legen, um zu sehen, wie eigene Interessen sowie Überzeugungen die Anordnung und Interpretation des historischen Stoffs prägen. An den oben bereits erwähnten höchst unterschiedlichen Einordnungen der Reformation durch HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich und TroeltschTroeltsch, Ernst wurde das in Frage stehende Problem bereits sichtbar.
Weder eine Darstellung der Theologie Luthers noch die von anderen historischen Begebenheiten und Ereignissen kann gegenwartsbezogene Interessen ausschalten. Der Versuch, das vergangene Geschehen so nachzuzeichnen, wie es wirklich gewesen ist, stellt eine Abstraktion dar, die verkennt, dass man sich geschichtlichen Gestalten nur aus der jeweils eigenen Gegenwart zuwenden kann. Lutherdarstellungen sind gegenwärtige Konstruktionen, die an dessen Texten und an der geistes- und religionsgeschichtlichen Entwicklung überprüft werden müssen und selbst schon in der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Reformators stehen.17
Um den methodischen Schwierigkeiten einer angemessenen Rekonstruktion der Theologie Luthers Rechnung zu tragen, hatte Bernhard LohseLohse, Bernhard (1928–1997) den Versuch unternommen, die werkgeschichtliche Entwicklung des Denkens des Reformators mit einer systematischen Zusammenschau der Hauptpunkte von dessen Theologie zu verzahnen.18 Im ersten Teil seiner Studie geht er der Entwicklung des Wittenberger Theologen im Horizont wichtiger zeitgenössischer theologischer Traditionen, grundlegender Stationen seines Werdegangs sowie den Kontroversen nach, die für die Herausbildung seines theologischen Denkens relevant waren. Der systematischen Zusammenschau von Luthers Theologie ist der zweite Teil gewidmet. Er ist an dem Aufbau einer theologischen Dogmatik orientiert.
Die vorliegende Einführung in die Theologie des Reformators stellt zunächst Grundzüge seines Denkens in einer werkgeschichtlichen Perspektive dar und entfaltet sodann vor diesem Hintergrund dessen zentrale Themenfelder. Auf eine systematische Zusammenschau von Luthers Theologie wird verzichtet, auch wenn mit dem Bußgedanken sowie der theologia crucis‚theologia crucis‘ (Kreuzestheologie) Motive benannt werden, denen eine Schlüsselfunktion für sein theologisches Denken zukommen.
1.2Zum Stand der LutherforschungLutherforschung
Interpretationen der Theologie des Reformators sowie seines Werdegangs sind immer auch ein Ausdruck der jeweiligen Zeit, in der sie geschrieben wurden. Insofern spiegeln sie ausnahmslos zeitgenössische theologische Optionen wider.1 Das ist auch nicht überraschend, als die Auseinandersetzungen mit der Gestalt des Reformators in einem hohen Maße der Selbstverständigung des Protestantismus über seine eigene Identität dienen. Auch da, wo wie bei TroeltschTroeltsch, Ernst der Abstand zwischen der Zeit Luthers und der eigenen Gegenwart in den Vordergrund rückt, geht es um das protestantische Selbstverständnis.
Anfänge der Lutherforschung In der lutherischen Theologie des 16. und 17. Jahrhunderts ist der Wittenberger Reformator zwar die zentrale Bezugsgestalt, aber zu einer historischen Erforschung seines Werks kommt es freilich noch nicht.2 Erste Ansätze hierzu bilden sich im Zeitalter der Aufklärung heraus. Der Hallenser Theologe Johann Salomo SemlerSemler, Johann Salomo (1725–1791) unterscheidet zwischen Luther sowie der altlutherischen Theologie und knüpft auf der Grundlage seiner historischen Theologie an das Schriftverständnis des Reformators an.3 Geradezu im Sinne eines Vorreiters der Aufklärung bezieht sich Gotthold Ephraim LessingLessing, Gotthold Ephraim (1729–1781) auf den Wittenberger. Er habe die Menschheit vom Joch der Tradition befreit, nun müsse es aber darum gehen, „uns von dem unerträglichern Joche des Buchstabens“ zu erlösen. „Wer bringt uns endlich ein Christentum, wie du [sc. Martin Luther] es itzt lehren würdest; wie Christus es selbst lehren würde!“4
Im Streit um seine Versöhnungslehre beruft sich der Erlanger Theologe Johann Christian Konrad von HofmannHofmann, Johann Christian Konrad von (1810–1877) gegenüber seinen Widersachern ausdrücklich auf Unterschiede zwischen Luther und dem AltprotestantismusAltprotestantismus.5 Damit wird von ihm methodisch die Differenz zwischen dem Wittenberger Reformator und seinen Nachfolgern in die Debatte eingeführt. Die Lutherdarstellung von Theodosius HarnackHarnack, Theodosius, welche die Versöhnungslehre in den Fokus rückt, wendet sich gegen von HofmannHofmann, Johann Christian Konrad von. Eine Deutung der Theologie des Reformators, welche zwischen diesem und dem dogmatischen Lehrbegriff seiner Epigonen unterscheidet, arbeitet der Göttinger Theologe Albrecht RitschlRitschl, Albrecht (1822–1889) in seinem Hauptwerk Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung aus.6 Ambivalent fällt das Urteil Adolf von Harnacks (1851–1930) in seiner Dogmengeschichte aus. Zwar habe der Wittenberger Reformator ähnlich wie zuvor AugustinAugustin (354–430) die Innerlichkeit in der Religion (wieder-)entdeckt, aber zugleich das dogmatische Christentum der Alten Kirche wiederbelebt. „Derselbe Mann, der das Evangelium von Jesu Christo aus dem Kirchenthum und dem Moralismus befreit hat, hat seine Geltung in den Formen der altkatholischen Theologie verstärkt, ja diesen Formen nach Jahrhunderte langer Quiescirung erst wieder Sinn und Bedeutung für den Glauben verliehen.“7
Karl Holl Als Begründer der Lutherforschung im wissenschaftlichen Sinne darf der Berliner Kirchenhistoriker Karl HollHoll, Karl gelten. 1921 legte er unter dem Titel Luther eine Sammlung von Aufsätzen über die Theologie des Reformators vor, die eine breite Wirkung erzielte und nach wie vor zu den Standardwerken der Forschung gehört.8 Die gedankliche Dichte von HollsHoll, Karl Lutherbuch resultiert aus einer Verknüpfung von historischer Rekonstruktion und systematischem Interesse. Die Rückbesinnung auf Luther dient der Steuerung der eigenen, als krisenhaft erfahrenen Gegenwart. HollsHoll, Karl Studien sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zunächst arbeitet er die systematische Problemstellung Luthers heraus. Im Zentrum seiner Theologie stehe die RechtfertigungslehreRechtfertigungslehre. Mit hoher methodischer Präzision rekonstruiert der Berliner Kirchenhistoriker das Werden von Luthers Verständnis der Rechtfertigung des Menschen durch Gott anhand der frühen Texte, insbesondere der frühen Vorlesungen. Dabei verknüpft HollHoll, Karl in seiner Deutung der Rechtfertigungslehre eine Erfahrungsdimension mit einer theozentrischen Perspektive. Der Mensch erfährt sich als der Gemeinschaft mit Gott völlig unwürdig. Dass Gott aber den Menschen anerkennt und Gemeinschaft mit ihm stiftet, sei die Erfahrung der Rechtfertigung. Der Ort des Gottesverhältnisses ist für HollHoll, Karl das Gewissen des Menschen. Luthers Religion sei deshalb, wie Holl der Theologie des 20. Jahrhunderts einschärfte, in ihrem Kern eine sittlich bestimmte Gewissensreligion.9
Für seine Deutung der Theologie des Reformators kommen HollHoll, Karl zwei wichtige Ergebnisse der vorangegangenen Forschung zugute: Einmal die seit 1883 erscheinende kritische Gesamtausgabe der Werke Luthers. Durch die Weimarer Ausgabe erhielt die LutherforschungLutherforschung eine methodischen Standards genügende Textgrundlage. Zweitens wurden Luthers frühe Vorlesungen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt. Seine Römerbriefvorlesung von 1515/16 veröffentlichte Johannes FickerFicker, Johannes (1861–1944) im Jahre 1908.10 Dadurch wurden der Forschung Texte zugänglich, die in den früheren Jahrhunderten unbekannt waren und die es nun erlaubten, die Entwicklung der Theologie Luthers von seinen Anfängen an zu rekonstruieren. Holl ist der erste, der die neuen Quellen auswertet und zur Deutung von dessen Theologie heranzieht.
Holl-Schule Die weitere Lutherforschung hat der Berliner Kirchenhistoriker entscheidend geprägt und die Themen vorgegeben, die im 20. Jahrhundert bearbeitet wurden. In den Untersuchungen von HollHoll, Karl und seinen zahlreichen Schülern11 – Emanuel HirschHirsch, Emanuel, Hanns RückertRückert, Hanns (1901–1974), Heinrich BornkammBornkamm, Heinrich (1901–1977)12 – trat für die Folgezeit der junge Luther in den Mittelpunkt des Interesses.13 Zahlreiche Studien zu dessen Theologie und zur Frage des reformatorischen Durchbruchs erschienen in den 1920er und 1930er Jahren, so zum Beispiel die Untersuchung Die Anfänge von Luthers Christologie nach der 1. Psalmenvorlesung des Hirsch-Schülers Erich VogelsangVogelsang, Erich (1904–1944), die nach wie vor als ein Standardwerk einzustufen ist.14
Lutherforschung nach dem Zweiten Weltkrieg Die Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte an die Resultate von HollHoll, Karl und seiner Schule an, nahm jedoch auch Modifikationen an dem von ihm geprägten Lutherbild vor. In der Kritik an HollsHoll, Karl pointierter These von der Gewissensreligion LuthersGewissenLuthers Religion als Gewissensreligion (Holl) spiegelt sich allerdings auch die theologische Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wider. Hinzu kommt, dass sich die Holl-Schule durch ihre Nähe zum Nationalsozialismus diskreditiert hatte. Unter dem Einfluss der Theologie Karl BarthsBarth, Karl (1886–1968), die nach dem Zweiten Weltkrieg zur dominierenden Universitätstheologie an den deutschsprachigen theologischen Fakultäten avancierte, und ihrer Betonung des Wortes Gottes sowie des strikten Gegensatzes von Gott und Welt verfiel HollsHoll, Karl Verständnis der Gewissensreligion Luthers der Kritik. Von theologischem Zeitkolorit sind zahlreiche der Lutherdeutungen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Am deutlichsten ist das in der Studie von Ernst BizerBizer, Ernst (1904–1975) der Fall, die 1958 unter dem Titel Fides ex auditu erschien.15 Bizer untersucht die theologische Entwicklung des jungen Luther von der ersten bis zur zweiten Psalmenvorlesung. Im Unterschied zu HollHoll, Karl setzt er den reformatorischen DurchbruchReformationreformatorischer Durchbruch Luthers nicht schon in der ersten Psalmenvorlesung an, sondern erst 1518. Zwar spreche Luther bereits in den Dictata super Psalterium von der iustitia Dei als einer Gabe Gottes, aber diese frühe Deutung der Gerechtigkeit GottesGerechtigkeit Gottes (‚iustitia Dei‘) stehe, wie BizerBizer, Ernst zu zeigen versucht, noch ganz im Horizont einer dem Mittelalter verbundenen DemutstheologieDemutstheologie Luthers. Deshalb sei das Verständnis der Rechtfertigung bei dem jungen Luther noch vorreformatorisch, genauer eine Form monastischer Humilitas-Theologie.16 Grundlegend für BizersBizer, Ernst Interpretation von Luthers Entdeckung ist die Annahme, unter dem eigentlich Reformatorischen sei das Wort Gottes als Gnadenmittel zu verstehen.17 Diese Deutung des Reformatorischen trägt deutlich Spuren der Wort-Gottes-Theologie Karl BarthsBarth, Karl. Eine Verbindung der Theologie Luthers mit der Barths arbeitete auch der junge Wilfried JoestJoest, Wilfried in seiner Dissertation Gesetz und Freiheit. Das Problem des tertius usus legis bei Luther und die neutestamentliche Parainese aus dem Jahre 1951 aus.18
Gerhard Ebeling Die LutherforschungLutherforschung der 1960er und 1970er Jahre hat mit Ausläufern bis heute darum gestritten, ob die reformatorische Entdeckung früh oder spät zu datieren sei. Entscheidende Impulse erhielt die Diskussion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem durch Gerhard Ebeling (1912–2001).19 Seine Untersuchungen lassen sich in ihrer Bedeutung nur mitEbeling, Gerhard denen von Karl HollHoll, Karl vergleichen. Wie der Berliner Kirchenhistoriker verbindet der Tübinger und Züricher Theologe einen historischen Zugriff auf Luther mit einer systematischen Fragestellung. Im Unterschied zu HollHoll, Karl, der die Rechtfertigung und den Gewissensbegriff ins Zentrum der Theologie Luthers gerückt hatte, tritt bei Ebeling die Lehre von der Schrift in den Blickpunkt. Wegweisende Untersuchungen zur Herausbildung von Luthers Schriftverständnis und seiner Hermeneutik legte er neben systematischen Darstellungen vor allem zum Verhältnis von Gesetz und Evangelium vor.20
römisch-katholische Lutherforschung Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich auch eine wissenschaftliche römisch-katholische Lutherforschung etabliert. Sie rückte von der traditionellen Polemik gegenüber Luther ab, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Friedrich Heinrich Suso DenifleDenifle, Friedrich Heinrich Suso (1844–1905)21 und Hartmann GrisarGrisar, Hartmann (1845–1932) zu finden ist,22 und versucht, vor dem Hintergrund breiter Quellenforschung ein Lutherbild zu zeichnen, das jedoch auch in den 1960er und 1970er Jahren noch eine unverkennbar römisch-katholische Färbung trägt. Zu nennen sind insbesondere Joseph LortzLortz, Joseph (1887–1975),23 Erwin IserlohIserloh, Erwin (1915–1996)24 und Otto Hermann PeschPesch, Otto Hermann (1931–2014).25 Sie gehen allesamt davon aus, dass die spätmittelalterliche Theologie und Frömmigkeit, welche Luther bekämpft hatte, gar nicht wirklich katholisch gewesen sei. Das heißt, seine Kritik an der spätmittelalterlichen Kirche wird als berechtigt anerkannt. Der Reformator sei, so die von den genannten Autoren gezogene Konsequenz, dem wirklichen und wahren Katholizismus enger verbunden, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Spaltung der Kirchen in Folge der Reformation sei mithin auf historische Kontingenzen zurückzuführen, habe aber keinen Anhalt an den theologischen Kernthemen. Hinter solchen Lutherbildern, das wird schnell deutlich, steht eine bestimmte Auffassung von Ökumene, welche die Differenzen zwischen Protestantismus und römischem Katholizismus als überholt verstehen möchte. Nun, da die Missstände in der Katholischen Kirche beseitigt seien, stehe auch einer Vereinigung beider Kirchen nichts mehr im Wege.
Natürlich ist Lutherforschung keine deutsche Angelegenheit. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es in den skandinavischen Ländern intensive Forschungen zu dem Reformator, die durchaus eigene Akzente setzen.26 Zu nennen sind insbesondere finnische Untersuchungen, die den Gedanken der theosis (Vergöttlichung) ins Zentrum der Theologie Luthers rücken.27 In der Gegenwart ist, wie bei vielen anderen Themen auch, die Lutherforschung international geworden.28
Haupttendenzen der neueren Forschung Die neuere Forschung zu Luther ist dadurch ausgezeichnet, dass sie das Werk des Reformators stärker in seinen geistes-, mentalitäts- und sozialgeschichtlichen Horizont rückt und vor ihm versteht. Sechs Haupttendenzen der gegenwärtigen Debatte zeichnen sich ab.29 Zunächst wird Luther wesentlich stärker, als es früher der Fall war, in den Gesamtkontext der Wittenberger UniversitätWittenberger Universitätsreform gerückt. Themen wie Luther und Philipp MelanchthonMelanchthon (Schwarzerdt), Philipp (1497–1560),30 Johann von StaupitzStaupitz, Johann von (1468–1524),31 Nikolas von AmsdorfAmsdorf(f), Nikolaus von (1483–1565),32 Justus JonasJonas, Justus (1493–1555)33 oder Georg RörerRörer, Georg (1492–1557)34 treten in den Blickpunkt der Forschung. Sodann hat sich die Forschung in den letzten Jahren intensiv dem späten Luther zugewandt. In der LutherforschungLutherforschung im Anschluss an HollHoll, Karl wurden primär der junge Luther und sein Werdegang hin zum reformatorischen Durchbruch untersucht. Auch heute noch hat das Spätwerk Luthers keine so große Aufmerksamkeit erfahren. Dabei geht es vor allem um Fragen des Übergangs von der Theologie des späten Luther zur Theologie des alten Luthertums, also um Fragen, die mit der Konfessionalisierung in einem Zusammenhang stehen und höchst kontrovers diskutiert werden.35 Drittens fragt die gegenwärtige Forschung nach den geistigen Wurzeln des jungen Luther. Während Deutungen in den Bahnen der Theologien Albrecht RitschlsRitschl, Albrecht und Karl BarthsBarth, Karl die Frage nach dem Einfluss der spätmittelalterlichen Mystik auf das Werk des Reformators weitgehend marginalisiert hatten, ist diesem Hintergrund in den letzten Jahren stärker nachgegangen worden.36 Eine vierte Tendenz der gegenwärtigen Lutherforschung liegt in der Auseinandersetzung mit der Gesamtdeutung Luthers durch EbelingEbeling, Gerhard. Ebeling hatte in einer Vielzahl von Einzelveröffentlichungen ein aus den Quellen erarbeitetes Lutherbild von eindrucksvoller Geschlossenheit vorgelegt.37 In sein Lutherbild lassen sich jedoch zahlreiche von der neueren Forschung herausgearbeitete Aspekte, wie die Bedeutung der Mystik, nur sehr schwer eintragen. Fünftens fragt man nach der Rolle Luthers für die Bekenntnisbildung innerhalb der evangelischen Kirchen.38 Und schließlich hat sich die Forschung sechstens wesentlich stärker als bisher Luthers Stellung zu von ihm abweichenden Positionen zugewandt. Untersucht wird nicht nur sein Verhältnis zu Thomas MüntzerMüntzer, Thomas und dem Bauernkrieg,39 sondern auch seine höchst problematischen Aussagen zum Judentum40 und zum Islam.41
1.3Literatur zum Lutherstudium
1.3.1Quellen
Weimarer Ausgabe Die Weimarer Ausgabe (WA) bildet die Textgrundlage für alle wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk des Reformators. Sie ist in vier Abteilungen untergliedert: die erste Abteilung enthält die Schriften Luthers, von denen 73 Bände erschienen sind. In der zweiten Abteilung, von der 6 Bände vorliegen, werden die Tischreden Luthers überliefert. Seine Bibelübersetzungen finden sich in der Abteilung drei: Deutsche Bibel. Sie umfasst 12 Bände. Der umfangreiche Briefwechsel des Reformators ist in der Abteilung vier ediert. Es liegen 18 Bände vor.
D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883ff.
Schriften, Bd. 1–73, Weimar 1883–2009. (= WA)
Tischreden, Bd. 1–6, Weimar 1912–1921 (= WA. TR)
Deutsche Bibel, Bd. 1–12, Weimar 1906ff. (= WA. DB)
Briefwechsel, Bd. 1–18, Weimar 1930ff. (= WA. B)
Die Weimarer Ausgabe trat an die Stelle von älteren Ausgaben der Werke des Reformators.1 Eine erste Edition mit deutschen Lutherschriften erschien bereits 1539 und die erste Ausgabe mit den lateinischen Schriften 1545. Die für das 19. Jahrhundert maßgebliche Edition der Werke des Reformators ist die Erlanger Ausgabe. Sie wurde zwischen 1826 und 1857 veröffentlicht. Eine zweite Auflage wurde 1862 in Angriff genommen, aber 1885 abgebrochen, da inzwischen die ersten Bände der Weimarer Ausgabe vorlagen.
Die Editionsprinzipien, welche den ab 1883 publizierten ersten Bänden der Weimarer Ausgabe zugrunde lagen, sind inzwischen überholt, so dass einige frühe Texte wie die erste Psalmenvorlesung neu ediert werden mussten. Diese Neueditionen erscheinen seit 1981 in dem Archiv zur Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers (AWA).
Archiv zur Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers. Texte und Untersuchungen, hrsg. im Auftrag der Kommission zur Herausgabe der Werke Martin Luthers, Köln 1981ff. (= AWA)
Bonner Ausgabe Wissenschaftlichen Maßstäben genügt die von Otto ClemenClemen, Otto (1871–1946) seit 1912 herausgegebene Studienausgabe der Werke Luthers. Sie erschien zunächst in vier Bänden, wurde dann um weitere vier Bände erweitert und mehrfach aufgelegt. Diese sogenannte Bonner Ausgabe (BoA) bietet in chronologischer Reihenfolge grundlegende Texte des Reformators.
Martin Luther, Werke in Auswahl, 8 Bde., hrsg. v. O. Clemen, Bonn 1912ff. ND Berlin 1955ff. (= BoA)
Studienausgaben Einen historisch-kritischen Textbestand, der den überarbeiteten Editionsprinzipien der Weimarer Ausgabe entspricht, bietet die sechsbändige Studienausgabe (StA) von Hans-Ulrich DeliusDelius, Hans-Ulrich (geb. 1930). Die Werke Luthers stellt die Ausgabe in einer chronologischen Reihenfolge dar.
Martin Luther, Studienausgabe, 6 Bde., hrsg. v.H.-U. Delius, Berlin 1980–1999. (= StA)
Als Lesehilfe für das Studium der lateinischen Schriften Luthers dient die dreibändige Lateinisch-deutsche Studienausgabe (Lat.-dt. StA). Die von Wilfried HärleHärle, Wilfried (geb. 1941), Johannes SchillingSchilling, Johannes (geb. 1951), Günther WartenbergWartenberg, Günther (1943–2007) unter Mitarbeit von Michael BeyerBeyer, Michael (geb. 1952) veranstaltete Ausgabe ist thematisch ausgerichtet und präsentiert wichtige lateinische Texte Luthers in deutscher Übersetzung. Der in der Ausgabe wiedergegebene lateinische Text der Schriften Luthers entspricht allerdings nicht den historisch-kritischen Standards, wie er für die Weimarer Ausgabe oder die Studienausgabe konstitutiv ist.
Martin Luther, Lateinisch-deutsche Studienausgabe, 3 Bde., hrsg. v. W. Härle/J. Schilling/G. Wartenberg, Leipzig 2006–2009. (= Lat.-dt. StA)
Die Deutsch-deutsche Studienausgabe (Dt.-dt. StA) der Schriften Luthers bildet das Seitenstück zur Lateinisch-deutschen Studienausgabe. Sie bringt grundlegende mittelhochdeutsche Texte des Reformators zusammen mit einer modernisierten deutschen Fassung. Ihre drei Bände sind thematisch untergliedert und ordnen in den Bänden die Schriften Luthers chronologisch. Herausgegeben ist die Ausgabe von Johannes SchillingSchilling, Johannes in Zusammenarbeit mit Albrecht BeutelBeutel, Albrecht (geb. 1957), Dietrich KorschKorsch, Dietrich (geb. 1949), Notger SlenczkaSlenczka, Notger (geb. 1960) und Hellmut ZschochZschoch, Hellmut (geb. 1957).
Martin Luther, Deutsch-deutsche Studienausgabe, 3 Bde., hrsg. v.J. Schilling mit A. Beutel/D. Korsch/N. Slenczka/H. Zschoch, Leipzig 2012–2016. (= Dt.-dt. StA)
Eine Übersetzung grundlegender Texte Luthers, angefangen von den frühen Vorlesungen bis hin zum Spätwerk bringt die nach 1945 begonnene und von Kurt AlandAland, Kurt (1915–1994) herausgegebene Ausgabe Luther Deutsch (LD). Die zehnbändige Leseausgabe wurde mehrfach aufgelegt und ist seit 2002 als CD-Rom erhältlich.
Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, 10 Bde., hrsg. v. K. Aland, Göttingen 41991. (= LD)
Eine kommentierte Auswahl von zentralen Texten des Reformators liegt in der von Hans Heinrich BorcherdtBorcherdt, Hans Heinrich (1887–1964) besorgten sogenannten Münchner Ausgabe (MA) vor. Von ihr erschienen zunächst sechs Bände und sieben Ergänzungsbände (MAE), die mehrfach nachgedruckt worden sind.
Martin Luther, Ausgewählte Werke, 6 Bde., hrsg. v. H.H. Borcherdt, München 21938. (= MA)
Martin Luther, Ausgewählte Werke. Ergänzungsreihe, 7 Bde., hrsg. v. H.H. Borcherdt, München 21934ff. (= MAE)
Die von Karin BornkammBornkamm, Karin (1928–2016) und Gerhard EbelingEbeling, Gerhard herausgegebenen sechs Bände mit Ausgewählten Schriften (AS) Luthers sind eine geeignete Leseausgabe, um sich mit den mittelhochdeutschen Schriften des Reformators vertraut zu machen. Wissenschaftlichen Ansprüchen genügt diese thematisch angelegte Ausgabe nicht.
Martin Luther, Ausgewählte Schriften, 6 Bde., hrsg. v. K. Bornkamm/G. Ebeling, Frankfurt a. M. 1982. (= AS)
1.3.2Hilfsmittel und Sekundärliteratur
Hilfsmittel Unentbehrliche Hilfsmittel, um sich mit der kaum noch zu überschauenden Literatur zu Martin Luther sowie dem Diskussionsstand vertraut zu machen, stellen das von Albrecht BeutelBeutel, Albrecht herausgegebene Luther Handbuch sowie das Hilfsbuch zum Lutherstudium von Kurt AlandAland, Kurt dar. Das thematisch angeordnete Luther Handbuch bietet eine einführende und grundlegende Orientierung über den geistesgeschichtlichen Hintergrund des Denkens von Luther, Kontroversen, theologische Themenfelder sowie Literatur und die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte seiner Theologie. Das Hilfsbuch ermöglicht eine Orientierung bei der Erschließung der Schriften Luthers. Über Grundbegriffe der Theologie des Reformators informiert der Band Martin Luthers theologische Grundbegriffe. Von „Abendmahl“ bis „Zweifel“Abendmahl von Reinhold Rieger (geb. 1956). Eine fortlaufende Bibliographie mit internationaler Forschungsliteratur zu Luther ist in dem 1926 begründeten Lutherjahrbuch (LuJ) zugänglich. Neben einer systematischen Erfassung der Sekundärliteratur bietet das Lutherjahrbuch Spezialbeiträge zu diversen Forschungsthemen.
K. Aland, Hilfsbuch zum Lutherstudium, Witten 41996.
A. Beutel (Hrsg.), Luther Handbuch, Tübingen 2005.
Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung, hrsg. im Auftrag der Luther-Gesellschaft, Göttingen 1926ff. (= LuJ)
R. Rieger, Martin Luthers theologische Grundbegriffe. Von „Abendmahl“ bis „Zweifel“, Tübingen 2017.
Einführungen Werkgeschichtliche Einführungen in das Leben des Reformators ermöglichen eine erste Zuordnung von Texten und zentralen Begriffen in den zeitgenössischen Debatten. Zugleich erschließen sie bestimmte Grundthemen von dessen Theologie im biographischen Kontext. Wichtige neuere Einführungen in das Denken Luthers stammen von Albrecht BeutelBeutel, Albrecht, Dietrich KorschKorsch, Dietrich und Volker LeppinLeppin, Volker (geb. 1966), grundlegende ältere von Reinhard SchwarzSchwarz, Reinhard (1929–2022) und Gerhard EbelingEbeling, Gerhard.
A. Beutel, Martin Luther. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung, Leipzig 22006.
G. Ebeling, Luther. Einführung in sein Denken, Tübingen 1964.
D. Korsch, Martin Luther. Eine Einführung, Tübingen 22007.
V. Leppin, Martin Luther, Darmstadt 2006.
R. Schwarz, Luther, Göttingen 32004.
Gesamtdarstellungen Gesamtdarstellungen der Theologie Martin Luthers zeigen eine systematische Zusammenschau seines Denkens. Wichtige neuere liegen vor aus der Feder von Bernhard LohseLohse, Bernhard und Hans-Martin BarthBarth, Hans Martin (geb. 1939). Während LohseLohse, Bernhard das Denken des Reformators zugleich werkegeschichtlich und systematisch darstellt, orientiert sich BarthBarth, Hans Martin an Hauptthemen von dessen Theologie. Einen guten Überblick über Grundthemen der Theologie des Wittenbergers bietet nach wie vor die Arbeit von Paul AlthausAlthaus, Paul.
P. Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 21963.
H.-M. Barth, Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009.
B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995.
2Der junge Luther und die Herausbildung der reformatorischen Entdeckung
Die Entwicklung von Luthers Denken in seiner Frühzeit stand bislang im Fokus der Forschung. Im 20. Jahrhundert wurden lange Kontroversen darüber geführt, wann der Reformator zu seiner neuen Deutung des christlichen Glaubens gelangt sei: zu Beginn seiner Wittenberger akademischen Lehrtätigkeit um 1512 oder erst gegen Ende des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts. Luther selbst nannte sein neues Verständnis der Gerechtigkeit Gottes – der iustitia DeiGerechtigkeit Gottes (‚iustitia Dei‘)– als den entscheidenden Wendepunkt. Was versteht er unter iustitia Dei, und wie unterscheidet sie sich von dem mittelalterlichen Gebrauch des Begriffs? Die in der Debatte vorgebrachten Argumente für oder wider eine Früh- beziehungsweise Spätdatierung der reformatorischen Entdeckung werden im Folgenden vorgestellt. Zunächst ist jedoch Luthers Werdegang vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Frömmigkeit und Theologie bis zur Übernahme seiner Wittenberger Professur 1513 zu skizzieren.
2.1Studium und Eintritt ins Kloster
Luthers Familie Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren und am folgenden Tag auf den Namen des Tagesheiligen, Martin, getauft. Sozial gesehen entstammt er einem Aufsteigermilieu, das im 15. Jahrhundert durch die beginnende Industrialisierung möglich war.1 Sein Vater Hans LuderLuder, Hans (1449–1530) ist Nachkomme einer Bauernfamilie, war allerdings aufgrund des thüringischen Erbrechts als ältester Sohn vom väterlichen Erbe ausgeschlossen. Aus diesem Grund zog die Familie Luder nach Mansfeld, wo es der Vater im örtlichen Kupferbergbau zu einer ansehnlichen Stellung brachte und sich im Bürgertum etablieren konnte. Die Mutter Luthers, MargareteLuder, Margarete, geb. Lindemann, geborene Lindemann (1459–1531), kam aus bürgerlichen Verhältnissen in Eisenach. Die Änderung des Familiennamens Luder in Luther geht auf den Reformator zurück, und sie steht im Zusammenhang mit seiner Kritik an der Bußpraxis im Spätmittelalter. In Anlehnung an das griechische Wort eleutherios, der Freie, hat er 1517 seinen Namen in ‚Luther‘ umgeformt.2 Martin Luthers Familie ist, so kann man sagen, aus dem Bauernstand in das Bürgertum aufgestiegen. Dieser Umstand prägte seinen weiteren Lebensweg.
Die Zeugnisse über das Leben in Luthers Elternhaus sind spärlich. Vermutlich war die Erziehung streng: von den Kindern wurde strikter Gehorsam erwartet. Das entspricht dem üblichen Erziehungsrahmen im späten Mittelalter. Erik H. EriksonErikson, Erik H. (1902–1994) hat versucht, die religiöse und theologische Entwicklung Luthers und seines Gottesbildes tiefenpsychologisch aus einem Vaterkonflikt zu erklären.3 Allerdings sind die Quellen für solch eine weitreichende Deutung nicht aussagekräftig genug. Auch die Religiosität in seinem Elternhaus scheint sich in den normalen Bahnen des spätmittelalterlichen kirchlichen Lebens bewegt zu haben. Besondere Auffälligkeiten sind in den Zeugnissen nicht überliefert.
Schulbildung Um sich im Bürgertum zu etablieren, wurde der junge Martin von seinem Vater dafür auserkoren, die Schule zu besuchen. Die Schulausbildung, welche der Vorbereitung auf das Studium an der Universität diente, musste sich die Familie hart erarbeiten. Luther war sich dessen zeitlebens bewusst. Er besuchte zunächst von 1490 bis 1497 die Mansfelder Stadtschule, von 1497 bis 1498 die Schule in Magdeburg und von 1498 bis 1501 die Schule in Eisenach. Mit dem Übergang in die Magdeburger Schule verließ er mit 14 Jahren das Elternhaus und wohnte in einer Art Schülerwohnheim. Es wurde von den ‚Brüdern vom gemeinsamen Leben‘ getragen, einer aus den Niederlanden kommenden und der devotio moderna‚devotio moderna‘ nahestehenden Frömmigkeitsbewegung.4 In Eisenach wurde Luther von Verwandten der Mutter aufgenommen.
Die ersten 18 Jahre von Luthers Leben verliefen durchweg ohne Besonderheiten. Seine Familie förderte ihn, um sich im aufstrebenden Bürgertum zu behaupten. Voraussetzung hierfür ist Bildung. Neben den klassischen Trivialfächern, Grammatik, Rhetorik und Logik, wurde er in Musik, klassischer Literatur und Latein unterwiesen. Hinzu kommt die Bekanntschaft mit unterschiedlichen Strömungen spätmittelalterlicher Religiosität.
Nominalismus 1501 hatte er das Lateinschulniveau und damit die Voraussetzung für das Universitätsstudium erreicht und ging an die Universität Erfurt, die 1392 gegründet wurde und um 1500 als eine bedeutende Stätte des NominalismusNominalismus und des aufblühenden HumanismusHumanismus galt.5 Der Nominalismus oder die via moderna ist eine wichtige Richtung spätmittelalterlicher Theologie und Philosophie und geht auf Johannes Duns ScotusJohannes Duns Scotus (um 1270–1308) und Wilhelm von OckhamWilhelm von Ockham (1285–1349) zurück. Beide versuchen, eine neue Antwort auf die Frage zu geben, ob Allgemeinbegriffen, zum Beispiel ‚Mensch‘, Realität zukommt.6 Theologen und Philosophen wie ThomasThomas von Aquin von Aquin (um 1225–1274), die der via antiqua zugehörten, behaupteten im Anschluss an PlatonsPlaton (427–347 v. Chr.) Ideenlehre die Realität der Allgemeinbegriffe oder Universalien. Für die via moderna‚via moderna‘ – ‚via antiqua‘ hingegen existiert nur das Einzelne, allgemeine Begriffe sind bloße Nomen. Im Unterschied zum Thomismus wird im Nominalismus auch das Verhältnis von Vernunft und Glaube neu bestimmt. Das schlägt sich insbesondere in der Fassung des Gottesgedankens nieder, und zwar mit weitreichenden Folgen für die GnadenlehreGnademittelalterliche Gnadenlehre. Thomas von Aquin Thomas von AquinThomas von Aquin hatte vor dem Hintergrund seiner AristotelesAristoteles-Rezeption eine Synthese von Vernunft und Glaube vorgelegt und den Intellekt als zentrale Bestimmung Gottes verstanden. Wenn Gott handelt, dann ist er in seinem Wirken an eine Ordnung gebunden, nämlich die Ideen beziehungsweise Gedanken Gottes, die ewig und unveränderlich sind. Im späten Mittelalter wurde die von Thomas ausgearbeitete Synthese fraglich. Sein Gottesbegriff schien die Allmacht Gottes zu gefährden. Wenn Gott nur nach einer in seinem Wesen begründeten Ordnung handeln kann, dann, so der Einwand, sei seine Allmacht beschränkt. Bereits wenige Jahre nach dem Tod von ThomasThomas von Aquin wurden 1277 von dem Pariser Bischof Stephan TempierTempier, Stephan (gest. 1279) 219 theologische und philosophische Sätze verurteilt, welche die göttliche Allmacht einschränkten. Darunter war auch die von Thomas in der Summa theologiae ausgesprochene These von der Einzigkeit dieser Welt.
Im Unterschied zu ThomasThomas von Aquin von Aquin stellt der NominalismusNominalismus den Willen in das Zentrum der Bestimmung Gottes. Gott ist wesentlich Wille. Damit ist die Behauptung verknüpft, dass er in seinem Handeln an keine ihm bereits vorgegebene Ordnung gebunden ist. Auch für den Nominalismus handelt Gott nach einer Ordnung, aber sie ist von ihm selbst gesetzt und kann folglich von ihm jederzeit wieder geändert werden. In diesem Sinne unterscheiden sowohl Duns ScotusJohannes Duns Scotus als auch Wilhelm von OckhamWilhelm von Ockham zwischen einer potentia Dei absoluta et ordinata potentia Dei absoluta und einer potentia Dei ordinataNominalismus‚potentia dei absoluta‘ – ‚potentia dei ordinata‘‚potentia dei absoluta‘ – ‚potentia dei ordinata‘Nominalismus.7 Mit jener Unterscheidung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott nach einer von ihm selbst gesetzten Ordnung handelt (ordinata), diese jedoch in seiner Macht steht (absoluta). Die Unterscheidung betont also die Freiheit Gottes in seinem Handeln.
mittelalterliche GnadenlehreGnademittelalterliche GnadenlehreDurch den spätmittelalterlichen Nominalismus wird das Gott-Welt-Verhältnis neu justiert, so dass von einer gegebenen Ordnung nicht mehr umstandslos auf Gott und seine Gesinnung zurückgeschlossen werden kann. Er erscheint dadurch freilich als ein Willkürgott. Denn jetzt kann gesagt werden: was Gott hervorbringt, ist allein aus dem Grund gut, weil es von ihm hervorgebracht wurde. Die Freiheit Gottes und die Kontingenz der Welt werden ins Absolute gesteigert. Durch die Unterstreichung der Freiheit Gottes wird auch die einmal gesetzte Heilsordnung mit ihrem Zentrum in der Offenbarung in Jesus Christus ungewiss. Gott kann jede von ihm gesetzte Heilsordnung jederzeit durch eine andere ersetzen. Das hat Konsequenzen für die Ausgestaltung der Gnadenlehre. Akzeptationstheorie Von Duns ScotusJohannes Duns Scotus wird sie zur AkzeptationstheorieGnadeAkzeptationstheorieAkzeptationstheorieGnade (acceptatio divina) ausgebaut.8 Der Mensch, der der Gnade teilhaftig werden will, kann und muss für die spätmittelalterliche Theologie und Frömmigkeit einen Beitrag hierzu leisten. Er disponiert sich selbst für das Heil, da er die Kraft zum facere quod in se est (zu tun, was in ihm ist) hat. Zwar kann der Mensch nicht das Vollverdienst, das meritum de condigno, erreichen, aber soviel in ihm liegt, soll er anstreben. Ein meritum de congruo (Verdienst nach Billigkeit) darf ihm nicht abgesprochen werden. Für die ockhamistische Gnadenlehre kann der Mensch aus eigener Kraft Gott über alles lieben, und auch eine wahre Reue (contritio) im Unterschied zur attritio (Zerknirschung, Furchtreue) sei ihm möglich.9 Gemäß der potentia ordinata müsste der Mensch damit den Lohn der Seligkeit verdienen. Aber Gott ist nicht an den von ihm faktisch gesetzten Heilsweg gebunden. Auch derjenige, der sich nicht ausreichend für den Empfang der Gnade disponiert hat, wie PaulusPaulus, Apostel, als er die Christen verfolgte, kann von Gott bekehrt werden. Gott lässt sich von niemandem zwingen, die Leistung der höchsten Liebe zu ihm auch als ein vollgültiges Verdienst anzuerkennen. Er kann es so halten und das meritum de congruo akzeptieren (acceptatio) und es damit zwar nicht seinem Inhalt, wohl aber seiner Geltung nach verändern, das heißt, zum meritum de condigno machen. Es bleibt jedoch seinem freien Ermessen vorbehalten, ob er die Leistungen eines Menschen akzeptiert oder nicht. Durch die spätmittelalterliche Akzeptationslehre und ihre Voraussetzungen in der Freiheit und absoluten Allmacht Gottes kommt eine große Unsicherheit in die GnadenlehreGnademittelalterliche Gnadenlehre hinein. Das Heil des Menschen wird ungewiss.
Studium in Erfurt Als Luther 1501 an der Erfurter Universität mit dem philosophischen Grundstudium an der Artistenfakultät begann, lernte er den spätmittelalterlichen NominalismusNominalismus durch seine beiden Lehrer Jodokus TrutfetterTrutfetter, Jodokus (ca. 1460–1519) und Bartholomäus ArnoldiArnoldi, Bartholomäus von (aus) Usingen von Usingen (1462–1532) in einer gemäßigten, durch Gabriel BielBiel, Gabriel (gegen 1410–1495) vermittelten Form kennen. Für die weitere Entwicklung Luthers ist dieser nominalistische Hintergrund prägend geblieben. So steht die Kritik an der Leistung der Vernunft, die sich bei ihm durchgehend findet, durchaus in Kontinuität mit dem Nominalismus von Duns ScotusJohannes Duns Scotus und OckhamWilhelm von Ockham. Freilich setzt der Reformator vor diesem Hintergrund völlig neue Akzente, die den spätmittelalterlichen Nominalismus hinter sich lassen.
Das philosophische Grundstudium an der Artistenfakultät war im mittelalterlichen Wissenschaftsbetrieb die Voraussetzung für das Studium der Theologie, der Jurisprudenz und der Medizin. Die sieben freien Künste, die septem artes liberales, bildeten die theoretische Grundlage des Studiums an den übrigen Fakultäten. Sie umfassten Grammatik, Logik, Rhetorik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie. Nach vier Jahren hatte Luther 1505 das philosophische Grundstudium mit dem Magister Artium als Zweitbester seines Jahrgangs abgeschlossen. Mit dem Erwerb des wissenschaftlichen Rüstzeugs konnte das Hauptstudium beginnen. Nach dem Wunsch seines Vaters sollte es Jurisprudenz sein.
Gewitter bei Stotternheim Im Frühjahr 1505 begann Luther mit dem Studium der Jurisprudenz, und zugleich lehrte er, entsprechend den Gepflogenheiten des damaligen Lehrbetriebs, an der Artistenfakultät. In der zweiten Semesterhälfte unterbrach er sein Studium und reiste ins heimische Mansfeld. Der genaue Grund dieser ungewöhnlichen Studienunterbrechung ist nicht mehr erkennbar. Vermutet wird, dass der Vater ihn nach Mansfeld beordert habe, um ihm den Plan einer reichen Heirat zu unterbreiten.10 Wie auch immer, bekannt ist nur, dass Luther auf der Rückreise von Mansfeld am 2. Juli 1505 bei Stotternheim in ein Gewitter geriet. Ein in seiner Nähe einschlagender Blitz versetzte ihn in Todesangst, und er suchte Hilfe bei einer Heiligen: „Hilff du, S. Anna, ich wil ein monch werden!“11 Bereits 15 Tage später, am 17. Juli 1505 geht Luther ins Kloster.
Im 21. Jahrhundert mag dieser Schritt befremdlich erscheinen. In ihm spielen spätmittelalterliche Frömmigkeit und individuelle Entwicklung Luthers ineinander. Der erste Bericht über das Stotternheimer Gewitter mit der Nennung der Heiligen Anna, einer gerade erst in Mode gekommenen Heiligen, stammt aus dem Jahre 1539, also 34 Jahre nach der Begebenheit bei Stotternheim.12 Das gilt auch für andere autobiographische Rückblicke auf seine frühe Zeit als Mönch und seine eigene Entwicklung. Sie sind deutlich von dem Interesse geprägt, eine kontinuierliche Entwicklung vom Mönch zum Reformator zu gestalten. Konstruktion und historischer Ablauf greifen ununterscheidbar ineinander.13 Selbstverständlich markiert der Eintritt ins Kloster einen Bruch in der Entwicklung des jungen Luther, freilich einen solchen, der vor dem Hintergrund der damaligen Frömmigkeit verständlich ist.
mittelalterliche Sakramentsfrömmigkeit Das Leben des Menschen im späten Mittelalter war von Religion durchdrungen. Sie und ihre soziale Institution, die Kirche, prägten und strukturierten das Leben eines Menschen von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Das ist die Funktion der kirchlichen Sakramente.14 Einige der sieben Sakramente beziehen sich direkt auf die entscheidenden Phasen im menschlichen Leben. Das Sakrament der TaufeTaufe steht am Anfang des Lebens, die Firmung am Übergang zum Erwachsenenalter, das Sakrament der Eheschließung an einem weiteren wichtigen Wendepunkt und schließlich die Krankensalbung am Ende des Lebens. Diese vier Sakramente versehen prägnante Stationen des Lebens mit einer religiösen Deutung und können nur einmal empfangen werden, anders als die drei weiteren Sakramente der BußeBußespätmittelalterliches Bußsakrament, der Eucharistie und der Priesterweihe. Buße und Eucharistie haben ihren Fokus in den Verwerfungen des Lebens und müssen daher wiederholt angeeignet werden können. Mit dem Sakrament der Taufe ist zwar grundsätzlich einem jeden Menschen das Heil eröffnet, aber auf jedem Lebensweg kommt es zu Abweichungen vom Heil, die eine erneute Heilszuwendung nötig machen. Das geschieht in der Buße, durch die Verfehlungen in der Lebensführung vergeben werden. Durch sie wird der Mensch für die Eucharistie vorbereitet, welche ihm das von Christus erworbene Heil vermittelt.15 Das Sakrament der Priesterweihe schließlich schafft gewissermaßen die Voraussetzung für den regelgerechten Gebrauch der Sakramente. Es begründet den geistlichen Stand und entspricht dem Ehesakrament, welches dem weltlichen Stand zugeordnet ist.
Buße, Tod und letztes Gericht Eine besondere Rolle nimmt in dem sakramentalen System der mittelalterlichen Kirche die Buße ein, in der die Verfehlungen des Menschen zum Thema werden. In ihr geht es um eine sittlich-ethische Selbstprüfung des Menschen und mithin um die Frage, ob der Mensch mit seinem Leben vor Gott bestehen könneLetztes GerichtGewissen. Kann der Mensch nicht bestehen, so muss er fürchten, der ewigen Seligkeit verlustig zu werden. Diese Zuspitzung der religiösen Lebensdeutung steht im Hintergrund von Luthers Gelübde, angesichts des drohenden eigenen Todes Mönch zu werden. Es ist freilich nicht der Tod als solcher, der Luther zu einem Bruch mit seiner bisherigen Existenz führte. Für den mittelalterlichen Menschen stellt der Tod nichts Außergewöhnliches dar, wohl aber der plötzliche Tod, der einen Menschen im Hinblick auf sein ewiges Schicksal unvorbereitet trifft. Mit seiner Erfahrung ist die drohende Alternative von ewiger Seligkeit oder Verdammnis verbunden. Sie lässt aber auch Luthers Entschluss, Mönch zu werden, im spätmittelalterlichen religiösen Kontext verständlich erscheinen. Denn was liegt angesichts der über einem schwebenden Ungewissheit, ob man selbst würdig ist, vor Gott in seinem Gericht bestehen zu können, näher, als ein Leben in dem Stand zu führen, der stellvertretend für die große Masse den strengen Willen Gottes lebt.16
So sehr sich Luthers Schritt in den religiösen Welthorizont der Zeit einfügt, so stellt er dennoch einen Einschnitt in sein bisheriges Leben sowie die Karrierepläne des Vaters für seinen Sohn dar. Inwieweit diese individuelle Konfliktlage in den Schritt des Sohnes von der weltlichen zur klösterlichen Existenz hineinspielt, lässt sich aufgrund der Quellen nicht mehr genauer rekonstruieren. Gleichwohl kann man sagen, dass Luthers Gang ins Kloster als Versuch verstanden werden kann, „durch einen Bruch in der bisherigen Kontinuität des Lebens – und um den Preis eines längeren Zerwürfnisses mit dem Vater – eine höhere Konstanz, nämlich die Beständigkeit des Lebens vor Gott, zu gewinnen“.17
Kloster und Studium der Theologie Luther trat am 17. Juli 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein.18 Warum er dieses Kloster wählte, kann nur noch vermutet werden. In jedem Fall gehörten die Augustiner-Eremiten zu den rigoroseren Orden. Das Leben im Kloster war streng geregelt: Strukturiert durch Stundengebete verbanden sich Leben und religiöse Reflexion. Seinen eigenen, späteren Selbstzeugnissen zufolge nahm Luther seine monastische Existenz sehr ernst.19 Im Kloster hat er allerdings sowohl als Mönch als auch in wissenschaftlicher Hinsicht Karriere gemacht. 1506 legte er sein Mönchsgelübde ab. Von der Klosterleitung wurde die intellektuelle Begabung des jungen Mönchs erkannt, und man bestimmte ihn dazu, Priester zu werden und Theologie zu studieren. Am 3. April 1507 wurde er im Erfurter Dom zum Priester geweiht, und am 2. Mai 1507 fand die Primiz, die erste Messe statt. Für das Priesteramt war ein Theologiestudium nicht erforderlich. Erst im Anschluss an die Weihe zum Priester begann Luther mit dem Studium der Theologie in seinem Orden. Seine theologischen Lehrer waren Johannes NatinNatin, Johannes (gest. 1529), Leonard HeutlebHeutleb, Leonard und Georg LyserLyser, Georg.
Zur Fortsetzung seiner Studien wurde Luther 1508 von seinem Orden an die Universität Wittenberg geschickt. Am 9. März 1509 erlangte er in Wittenberg den untersten akademischen Grad, den eines Baccalaureus biblicus. Mit ihm verband sich für ihn die Aufgabe, die biblischen Bücher auszulegen.
Im Herbst des Jahres 1509 begann Luther nun wieder in Erfurt mit der Ausbildung zum Baccalaureus sententiarum. Dieser Grad der akademischen Ausbildung umfasste eine Kommentierung der Sentenzen des Petrus LombardusPetrus Lombardus (ca. 1095–1160), des einflussreichsten dogmatischen Lehrbuchs im Mittelalter. Jeder Studierende der Theologie hatte das Werk des Lombarden während seines Studiums kommentierend in einem Zeitraum von zwei Jahren auszulegen. Luther tat es im Studienjahr 1509/10. Seine Randbemerkungen, mit denen er sich auf die Vorlesung vorbereitete, sind noch erhalten.20 Der junge Luther kann hier bereits auf die zentrale Rolle der Heiligen Schrift für die Theologie hinweisen:
„Auch wenn viele berühmte Gelehrte so denken, so haben sie dennoch für sich keine Schrift, sondern allein menschliche Vernunftüberlegungen. Ich aber habe für diese Meinung einen Schriftbeleg, dass die Seele das Abbild Gottes sei. Daher sage ich mit dem Apostel: ‚Wenn ein Engel vom Himmel‘, das heißt, ein Gelehrter in der Kirche, ‚anderes gelehrt hat, sei er verworfen‘.“21
Allerdings wird man solche Aussagen auch nicht überbewerten können. Sie stehen vollständig im Kontext der zeitgenössischen spätmittelalterlichen Theologie. Luther ist hier noch von der Übereinstimmung von Schrift und Kirchenlehre überzeugt.
Professor in Wittenberg Am 18./19. Oktober 1512 wurde Luther in Wittenberg unter dem Vorsitz von Andreas BodensteinKarlstadt, Andreas, eigentl. A. Bodenstein aus Karlstadt (1486–1541) zum Doktor der Theologie promoviert und erhielt den höchsten akademischen Titel. Noch im selben Jahr ist er Nachfolger seines Ordensoberen Johannes von StaupitzStaupitz, Johann von auf dessen Wittenberger Professur für Theologie geworden. Staupitz spielte, wie von der Forschung seit einigen Jahren betont wird, für den Werdegang des jungen Luther eine entscheidende Rolle.22 Als Beichtvater Luthers wies er den mit Anfechtungen ringenden jungen Mönch auf ein Verständnis Christi als barmherzigen Retter hin. Dass Luther sein vormaliges Bild von dem strengen, unnachgiebigen Richter Christus überwinden konnte, ein daraus resultierendes neues Bußverständnis gewann23 sowie die Bekanntschaft mit der Mystik machte,24 verdankt er vor allem seinem Wittenberger Beichtvater.
Die Wittenberger Universität wurde erst im Jahre 1502 gegründet und ist eine ganz persönliche Schöpfung von FriedrichFriedrich III., der Weise, Kurfürst von Sachsen dem Weisen (1463–1525).25 Der Gründung diente die Tübinger Universität als Muster, und StaupitzStaupitz, Johann von war neben Georg SpalatinSpalatin(us), Georg (1484–1545), dem kursächsischen Hofkaplan und Prinzenerzieher, einer der Hauptberater des sächsischen Kurfürsten. Zwei Wittenberger Bettelorden waren jeweils mit der Wahrnehmung einer theologischen Professur betraut. StaupitzStaupitz, Johann von hatte für die Augustiner-Eremiten eine der theologischen Professuren inne, und er, der Luthers Begabung frühzeitig erkannte, baute ihn als seinen Nachfolger auf. 1513 nahm Luther seine Vorlesungstätigkeit auf, und sie galt einem Thema, das ihm durch seine monastische Prägung überaus vertraut war: dem Psalter. Luther hatte somit zwar nicht, wie es sein Vater wollte, als Jurist Karriere gemacht, wohl aber als Mönch und als Wissenschaftler.
2.2Der Streit um die Datierung des reformatorischen DurchbruchsReformationreformatorischer Durchbruch Luthers
Die Forschung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war infolge neuer Quellen mehrheitlich zu der Auffassung gelangt, dass Luther bereits in seiner ersten Psalmenvorlesung von 1513 bis 1515 ein Verständnis der Gerechtigkeit GottesGerechtigkeit Gottes (‚iustitia Dei‘) gewonnen hatte, welches sich von der überlieferten Lehrtradition grundlegend unterschied. Einer Frühdatierung der reformatorischen Erkenntnis hatte Ernst BizerBizer, Ernst in seinem Buch Fides ex auditu von 1958 energisch widersprochen. Er war der Meinung, Luther sei erst 1518 oder gar 1519 zu seiner neuen Einsicht gekommen. Die Debatte darüber, ob Luther bereits in den Dictata super Psalterium