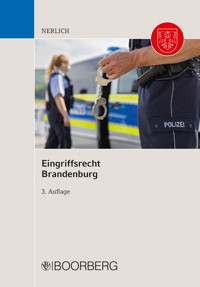
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Standardmaßnahmen der Polizei in Brandenburg Die aktualisierte und ergänzte Neuauflage knüpft an die erfolgreichen Vorauflagen an. Das Lehrbuch vermittelt das notwendige Grundlagenwissen zum Eingriffsrecht Brandenburgs. Der Autor erläutert dabei die sogenannten Standardmaßnahmen, die der Polizei im Rahmen des Ersten Angriffs zur Verfügung stehen: Identitätsfeststellung Prüfung von Berechtigungsscheinen Befragung und Vernehmung Datenerhebung mittels sog. Bodycams Erkennungsdienstliche Maßnahmen Vorladung und Vorführung Sicherstellung und Beschlagnahme Durchsuchung Körperliche Untersuchung Platzverweis und Aufenthaltsverbot Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot Freiheitsentziehende Maßnahmen Zusätzlich zu den Erläuterungen der Standardmaßnahmen enthält das Lehrbuch kompakte Ausführungen zu den jeweils betroffenen Grundrechten. Gegenstand des gefahrenabwehrrechtlichen Teils ist das Polizeigesetz des Landes Brandenburg. Bezugnahmen auf Lehrbücher oder Kommentierungen zu Polizeigesetzen anderer Länder oder des Bundes erfolgen sinngemäß. Soweit landes- bzw. bundesrechtliche Besonderheiten bestehen, wird darauf hingewiesen. Schneller lernen mit Beispielen Beispiele und Grafiken erleichtern das Verständnis der Materie. Das Werk ist praxisorientiert, es genügt aber auch wissenschaftlichen Ansprüchen und ermöglicht die vertiefte Beschäftigung mit dem Eingriffsrecht. Mit weiterführenden Hinweisen Der Verfasser verweist in den Fußnoten auf weiterführende Literatur und nimmt Stellung zu fachlichen Kontroversen. Das Lehrbuch eignet sich daher auch als Hilfsmittel für Haus- und Seminararbeiten. Für Polizeiausbildung und Polizeistudium Es unterstützt insbesondere die Auszubildenden bzw. Studierenden des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes, ebenso wie Studierende der Rechtswissenschaften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eingriffsrecht Brandenburg
Grundlagenwissen
Dr. Viktor Nerlich
Professor für Recht an der Hochschuleder Sächsischen Polizei (FH)
3., aktualisierte und ergänzte Auflage, 2024
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
3. Auflage, 2024
Print-ISBN 978-3-415-07478-1
EPUB-ISBN 978-3-415-07685-3
© 2020 Richard Boorberg Verlag
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Nutzung sämtlicher Inhalte für das Text- und Data Mining ist ausschließlich dem Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG vorbehalten. Der Verlag untersagt eine Vervielfältigung gemäß § 44b Abs. 2 UrhG ausdrücklich.
Titelfoto: © PropCop Effects – stock.adobe.com
eBook-Umsetzung: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 StuttgartStuttgart | München | Hannover | Berlin |Weimar | Dresden
www.boorberg.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Kapitel 1 Grundlagen des Eingriffsrechts
I. Begriff und Bedeutung des Eingriffsrechts
1. Recht und Rechtsordnung
2. Eingriffsrecht
II. Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei
1. Die Zuständigkeit der Polizei für die Gefahrenabwehr
2. Die Zuständigkeit der Polizei für die Verfolgung von Straftaten
3. Aufgaben der Polizei für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
4. Doppelfunktionales Handeln der Polizei
5. Schutz privater Rechte durch die Polizei
6. Vollzugshilfe
7. Abwehr von Gefahren des Terrorismus
III. Adressaten polizeilicher Maßnahmen
1. Adressaten polizeilicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
2. Adressaten repressiver Maßnahmen der Polizei
IV. Die wichtigsten Handlungsgrundsätze der Polizei
1. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
2. Ermessen
3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
V. Handlungsmittel der Polizei
1. Verwaltungsakte und Realakte
2. Der Verwaltungsakt
3. Handlungsmittel der Polizei bei der Strafverfolgung
VI. Rechtsgrundlagen für polizeiliche Eingriffe
1. Aufgabennormen und Befugnisnormen
2. Generalklauseln und Spezialbefugnisse
Kapitel 2 Identitätsfeststellung
I. Bedeutung und Ziel der Identitätsfeststellung
II. Die Identitätsfeststellung zur Strafverfolgung
1. Die Identitätsfeststellung des Verdächtigen
2. Die Identitätsfeststellung des Nichtverdächtigen
III. Die Identitätsfeststellung zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
IV. Die Identitätsfeststellung zur Gefahrenabwehr
1. Zweck und Rechtsgrundlagen
2. Tatbestandliche Voraussetzung für die Identitätsfeststellung zur Gefahrenabwehr
3. Rechtsfolgen: Maßnahmen zur Identitätsfeststellung
4. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
V. Die von der Identitätsfeststellung betroffenen Grundrechte
Kapitel 3 Prüfung von Berechtigungsscheinen
Kapitel 4 Befragung und Vernehmung
I. Begriff, Abgrenzungen und betroffene Grundrechte
II. Die Befragung zur Gefahrenabwehr
1. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
2. Rechtsfolgen: Befugnisse aus § 11 BbgPolG
3. Befragung in der Schleierfahndung und zur Terrorabwehr
III. Die Vernehmung zur Strafverfolgung
1. Die Vernehmung des Beschuldigten
2. Die Vernehmung des Zeugen
IV. Die Vernehmung zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Kapitel 5 Datenerhebung mittels sogen. Bodycams
Kapitel 6 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
I. Überblick, Abgrenzungen und betroffene Grundrechte
II. Die erkennungsdienstliche Behandlung nach der Strafprozessordnung
1. Die ED-Behandlung gemäß § 81b Abs. 1 Alt. 1 StPO
2. Die präventive ED-Behandlung nach § 81b Abs. 1 Alt. 2 StPO
3. Rechtsfolge von § 81b Abs. 1 StPO
4. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
III. Die erkennungsdienstliche Behandlung nach dem Polizeigesetz
1. Tatbestandliche Voraussetzungen
2. Rechtsfolge: Zulässige Maßnahmen
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
Kapitel 7 Vorladung und Vorführung
I. Die Vorladung
II. Die Vorführung
Kapitel 8 Sicherstellung und Beschlagnahme
I. Überblick, Rechtsgrundlagen und Grundrechte
II. Die Sicherstellung zur Gefahrenabwehr
1. Tatbestandliche Voraussetzungen
2. Rechtsfolge: Vollzug der Sicherstellung
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
III. Die Sicherstellung und Beschlagnahme von Beweismitteln
1. Überblick
2. Tatbestandliche Voraussetzungen
3. Begrenzungen der Beschlagnahmebefugnis (Beschlagnahmeverbote)
4. Rechtsfolgen und Befugnisse
5. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
IV. Die Beschlagnahme von Einziehungsgegenständen
1. Bedeutung, Rechtsgrundlage und Abgrenzungen
2. Tatbestandliche Voraussetzungen
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
V. Die Sicherstellung von Führerscheinen
1. Überblick
2. Tatbestandliche Voraussetzungen
3. Rechtsfolge
4. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
Kapitel 9 Durchsuchung
I. Begriff, Rechtsgrundlagen und Grundrechte
II. Die Durchsuchung zur Gefahrenabwehr
1. Die Durchsuchung von Personen
2. Die Durchsuchung von Sachen
3. Betreten und Durchsuchen von Wohnungen
III. Die Durchsuchung nach dem Strafprozessrecht
1. Die Systematik des strafprozessualen Durchsuchungsrechts
2. Die Tatbestandsvoraussetzungen für die Durchsuchung zur Strafverfolgung
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
IV. Der Umgang mit Zufallsfunden
Kapitel 10 Körperliche Untersuchung
I. Begriff, Abgrenzungen und Rechtsgrundlagen
II. Die körperliche Untersuchung des Beschuldigten
1. Die tatbestandlichen Voraussetzungen
2. Rechtsfolge: Maßnahmen zur Untersuchung
3. Die Befugnis zur Anordnung der Untersuchung
4. Durchführungsbefugnis sowie weitere besondere Form- und Verfahrensvorschriften
5. Verhältnismäßigkeit
III. Die körperliche Untersuchung anderer Personen
1. Die tatbestandlichen Voraussetzungen
2. Rechtsfolgen
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
IV. Die körperliche Untersuchung im Bußgeldverfahren
V. Die von der körperlichen Untersuchung betroffenen Grundrechte
Kapitel 11 Platzverweis und Aufenthaltsverbot
I. Begriff und Abgrenzungen
II. Der Platzverweis zur Gefahrenabwehr
1. Rechtsnatur und tatbestandliche Voraussetzungen
2. Rechtsfolge
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
4. Die Durchsetzung des Platzverweises
III. Das Aufenthaltsverbot
1. Formelle Rechtmäßigkeit und tatbestandliche Voraussetzungen
2. Rechtsfolge
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
4. Die Durchsetzung des Aufenthaltsverbots
IV. Der Platzverweis zur Strafverfolgung
1. Begriff und Abgrenzungen
2. Formelle Rechtmäßigkeit und tatbestandliche Voraussetzungen
3. Rechtsfolge
4. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
Kapitel 12 Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot
I. Einführung
II. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
1. Formelle Rechtmäßigkeit
2. Tatbestandliche Voraussetzungen
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
III. Rechtsfolge
IV. Durchsetzung von Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot
V. Weitere Maßnahmen zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt
1. Das Verbringungsangebot
2. Das Kontakt- und Näherungsverbot
3. Verhaltensauflagen
4. Weitere Maßnahmen zum Opferschutz
Kapitel 13 Freiheitsentziehende Maßnahmen
I. Freiheitsentziehung und Freiheitsbeschränkung
II. Die Gewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr
1. Begriff und Rechtsgrundlagen
2. Tatbestandliche Voraussetzungen der Gewahrsamnahme
3. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
III. Die vorläufige Festnahme
1. Allgemeines
2. Tatbestandsvoraussetzungen der vorläufigen Festnahme nach § 127 Abs. 1 StPO
3. Tatbestandsvoraussetzungen der vorläufigen Festnahme nach § 127 Abs. 2 StPO
4. Besondere Form- und Verfahrensvorschriften
IV. Die Hauptverhandlungshaft nach § 127b StPO
V. Die Sicherheitsleistung
1. Allgemeines und Abgrenzungen
2. Die Sicherheitsleistung nach § 127a StPO
3. Die Sicherheitsleistung nach § 132 StPO
VI. Die Verhaftung
Kapitel 14 Zwang
I. Einführung
II. Zwangsanwendung zur Gefahrenabwehr
1. Überblick
2. Die formelle Rechtmäßigkeit des Zwangs zur Gefahrenabwehr
3. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Zwangs zur Gefahrenabwehr
4. Die Rechtsfolge von § 53 BbgPolG
5. Weitere Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
III. Zwangsanwendung in der Strafverfolgung und im Bußgeldverfahren
IV. Die vom Zwang betroffenen Grundrechte
Anhang: Schematische Übersicht zum Verwaltungsverfahren
Stichwortverzeichnis
Anmerkungen
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Register
Vorwort zur 3. Auflage
Für die dritte Auflage des vorliegenden Buches wurden zahlreiche Aktualisierungen, Korrekturen und Ergänzungen eingearbeitet. Einige Änderungen beruhen auf Hinweisen aus dem Kreis der Leser, wofür ich herzlich danken möchte. Anliegen und Konzeption des Werks sind demgegenüber unverändert. Das Lehrbuch dient – wie im Vorwort zur Erstauflage beschrieben – vorrangig der Vermittlung des eingriffsrechtlichen Grundlagenwissens, also jener Standardmaßnahmen, die die Polizei im Rahmen des ersten Angriffs regelmäßig ergreift. Daneben sollen die Nachweise im Anmerkungsapparat das vertiefende Studium erleichtern und ggf. als Hilfsmittel für Haus- oder Abschlussarbeiten dienen. Für die einzelfallbezogene Anwendung des Fachwissens liegt zusätzlich seit Kurzem mein Buch „Fälle und Lösungen zum Eingriffsrecht Brandenburg“ vor.
Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind weiterhin ausdrücklich erwünscht und erbeten. Zuvor aber wünsche ich den Lesern viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit den Grundlagen des Eingriffsrechts.
Viktor Nerlich
Berlin, im Mai 2024
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
andere(r) Ansicht
ABl.
Amtsblatt
Abs.
Absatz
a. E.
am Ende
Alt.
Alternative
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
ASOG
Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin
BayPAG
Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei
BbgPolG
Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg
BbgVerf
Verfassung des Landes Brandenburg
Bd.
Band
BeckOK PolR Bbg
Beck’scher Online-Kommentar Polizei- und Ordnungsrecht Brandenburg
BeckRS
Beck Rechtsprechung
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BPolG
Gesetz über die Bundespolizei
bspw.
beispielsweise
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts
bzw.
beziehungsweise
ED
erkennungsdienstlich(e)
EGGVG
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
Einl.
Einleitung
f.; ff.
folgende (Seite); fortfolgende (Seiten)
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FeV
Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)
GewSchG
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz)
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf.
gegebenenfalls
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
h. M.
herrschende Meinung
HS
Halbsatz
HSOG
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
IDF
Identitätsfeststellung
i. e. S.
im engen Sinne
IRG
Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
i. S.
im Sinne
i. V.
in Verbindung
i. W.
im Wesentlichen
JGG
Jugendgerichtsgesetz
JMBl.
Justizministerialblatt
Kap.
Kapitel
Kfz
Kraftfahrzeug
KK-OWiG
Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
LImSchG
[brandenburgisches] Landesimmissionsschutzgesetz
lit.
Buchstabe
LKV
Landes- und Kommunalverwaltung (Zeitschrift)
Ls.
Leitsatz
LT-Drs.
Drucksache des Landtags von Brandenburg
LVwG SH
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
LWaldG
Waldgesetz des Landes Brandenburg
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
NRW
Nordrhein-Westfalen
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR
Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechungs-Report
OBG
[brandenburgisches] Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
O-Nr.
Ordnungsnummer
OWi
Ordnungswidrigkeit(en)
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAG TH
Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei
POG RP
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz
PolG BW
Polizeigesetz Baden-Württemberg
PolG NRW
Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
RiStBV
Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren
Rn.
Randnummer
S.
Seite
SDÜ
Schengener Durchführungsübereinkommen
s. o.
siehe oben
sogen.
sogenannte/-n/-r/-s
SOG LSA
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
SOG M-V
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
str.
streitig
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVO
Straßenverkehrs-Ordnung
s. u.
siehe unten
u. a.
unter anderem
u. a. m.
und anderes mehr
Urt.
Urteil
usw.
und so weiter
u. U.
unter Umständen
UZwG
Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes
VG
Verwaltungsgericht
vgl.
vergleiche
VVBbgPolG
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Polizeigesetz
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
WaffG
Waffengesetz
WdP
Wörterbuch der Polizei
WÜK
Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen
z. B.
zum Beispiel
Ziff.
Ziffer
z. T.
zum Teil
Literaturverzeichnis
Bäcker/Denninger/Graulich (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts. Gefahrenabwehr – Strafverfolgung – Rechtsschutz, 7. Aufl., München 2021
Basten, Privatrecht in der polizeilichen Praxis, Stuttgart 2014
Benfer/Bialon, Rechtseingriffe von Polizei und Staatsanwaltschaft. Voraussetzungen und Grenzen, 4. Aufl., München 2010
Berner/Köhler/Käß, [Bayerisches] Polizeiaufgabengesetz. Handkommentar, 20. Aufl., Heidelberg u. a. 2010
Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, 15. Aufl., Heidelberg 2020
Bialon/Springer, Eingriffsrecht. Eine praxisorientierte Darstellung, 7. Aufl., München 2022
v. Brünneck/Haack, Verfassungsrecht, in: Bauer/Peine (Hrsg.), Landesrecht Brandenburg. Studienbuch, 3. Aufl., Baden-Baden 2017, S. 37–77
Bumke/Voßkuhle, Casebook Verfassungsrecht, 7. Aufl., Tübingen 2015
Drewes/Malmberg/Wagner/Walter, Bundespolizeigesetz (BPolG), Zwangsanwendung nach Bundesrecht (VwVG/UZwG) mit Erläuterungen, 6. Aufl., Stuttgart 2019
Ebert/Seel/Joel, Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG). Kommentar, 8. Aufl., Wiesbaden 2019
Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. Kommentar, 70. Aufl., München 2023
Fredrich, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 13. Aufl., Stuttgart 2021
Gatzke/Averdiek-Gröner, Häusliche Gewalt, Hilden 2016
Göhler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 18. Aufl., München 2021
Häde, Polizei- und Ordnungsrecht, in: Bauer/Peine (Hrsg.), Landesrecht Brandenburg. Studienbuch, 3. Aufl., Baden-Baden 2017, S. 205–256
Hartmann/Schmidt, Strafprozessrecht. Grundzüge des Strafverfahrens, 7. Aufl., Grasberg b. Bremen 2018
Hilgendorf, dtv-Atlas Recht, Band 1: Grundlagen, Staatsrecht, Strafrecht, 3. Aufl., München 2012
Honnacker/Beinhofer/Hauser, Polizeiaufgabengesetz – PAG. Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei mit Erläuterungen, 20. Aufl., Stuttgart 2014
Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, 10. Aufl., München 2023
Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, 17. Aufl., München 2022
Keller, Häusliche Gewalt, Stalking und Gewaltschutzgesetz. Leitfaden für polizeiliches Handeln, 2. Aufl., Stuttgart 2016
Kingreen/Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II, 38. Aufl., Heidelberg 2022
Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht mit Versammlungsrecht, 12. Aufl., München 2022
Kirchhoff, Das Brandenburgische Polizeigesetz 2019 (BbgPolG). Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen, in: Polizei-Fachhandbuch Extra, Hilden 2019
Knape/Schönrock, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht für Berlin. Kommentar für Ausbildung und Praxis, 11. Aufl., Hilden 2016
Kopp/Schenke/Hug/Ruthig/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, 25. Aufl., München 2019
Kopp/Ramsauer/Tegethoff/Wysk, Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, 20. Aufl., München 2019
Kramer, Grundlagen des Strafverfahrensrechts. Ermittlung und Verfahren, 9. Aufl., Stuttgart 2021
Krenberger/Krumm, Kommentar zum Ordnungswidrigkeitengesetz, 7. Aufl., München 2022
Lisken/Denninger (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts. Gefahrenabwehr – Strafverfolgung – Rechtsschutz, 6. Aufl., München 2018
Martell, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt – SOG LSA – mit Erläuterungen, 5. Aufl., Stuttgart 2018
Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl., München 2020
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, 66. Aufl., München 2023
Mitsch (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 5. Aufl., München 2018
Möllers (Hrsg.), Wörterbuch der Polizei, 3. Aufl., München 2018
Möstl/Fickenscher, Beck’scher Online-Kommentar Polizei- und Ordnungsrecht Brandenburg, 3. Edition, 01.05.2024, München 2024
Nerlich, Fälle und Lösungen zum Eingriffsrecht Brandenburg, Stuttgart 2023
Neuwirth, Polizeilicher Schusswaffengebrauch gegen Personen nach Bundesrecht unter Einbeziehung landesrechtlicher Regelungen, 2. Aufl., Hilden 2006
Niehörster, Brandenburgisches Polizeigesetz. Erläuterung für Praxis und Ausbildung, 2. Aufl., Stuttgart 2003
Nimtz/Thiel, Eingriffsrecht Nordrhein-Westfalen. Polizeiliche Maßnahmen, Prüfungsschemata, Definitionen, 2. Aufl., Hilden 2020
Osterlitz, Eingriffsrecht im Polizeidienst, 2 Bände, 16. Aufl., Witten 2021
Pewestorf/Söllner/Tölle, Polizei- und Ordnungsrecht. Kommentar, 3. Aufl., Köln 2022
Pohl-Zahn, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, in: v. Brünneck/Peine (Hrsg.), Staats- und Verwaltungsrecht für Brandenburg, Baden-Baden 2004, S. 261–309
Roggan, Brandenburgische Polizeirechtsnovelle von 2019 – Erläuterungen und Würdigung aus verfassungsrechtlicher Perspektive, in: LKV 2019, S. 241–249
Roos/Lenz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz – POG – mit Erläuterungen, 5. Aufl., Stuttgart 2018
Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht. Ein Studienbuch, 30. Aufl., München 2022
Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Aufl., Heidelberg 2023
Schenke/Graulich/Ruthig (Hrsg.), Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl., München 2019
Schmidbauer/Steiner, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz und Bayerisches Polizeiorganisationsgesetz. Kommentar, 6. Aufl., München 2023
Schmidt, Polizei- und Ordnungsrecht sowie Grundzüge des Versammlungsrechts und des Verwaltungsvollstreckungsrechts, 22. Aufl., Grasberg bei Bremen 2022
Steinhorst, Polizei- und Ordnungsrecht in Brandenburg. Grundstrukturen, Übersichten, Fälle und Lösungen, Berlin 2010
Tegtmeyer/Vahle, Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen mit Erläuterungen, 13. Aufl., Stuttgart 2022
Kapitel 1Grundlagen des Eingriffsrechts
I.Begriff und Bedeutung des Eingriffsrechts
1.Recht und Rechtsordnung
„Recht“ ist der Oberbegriff für ein System von Regeln zur Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, dessen prägendes Merkmal darin besteht, dass es notfalls zwangsweise durch staatliche Organe durchgesetzt werden kann. Darin unterscheidet sich das Recht von anderen Ordnungssystemen, die ebenfalls berechenbares wie verlässliches Verhalten herbeiführen wollen und die jeder einzelne aus der Familie oder aus sozialen Gruppen kennt, nämlich Moral und Sitten bzw. Gebräuche.[1] Das Recht ergibt sich aus einer Vielzahl von Normen, den sogen. Rechtsquellen:[2]
Die Normen des geschriebenen Rechts stehen in einer besonderen Hierarchie zueinander, die aus der obigen Übersicht hervorgeht. Danach genießt das Recht, das von Organen der Europäischen Union erlassen wird, Anwendungsvorrang gegenüber dem Recht der Mitgliedsstaaten. Innerhalb Deutschlands haben die Normen des Bundes gegenüber jenen der Länder Geltungsvorrang (Art. 31 GG). Zwischen dem Grundgesetz und den förmlichen Bundesgesetzen stehen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, die aus dem Völkergewohnheitsrecht und den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts bestehen (Art. 25 GG).[3] Sie spielen im Eingriffsrecht insbesondere dann eine Rolle, wenn die Polizei es mit Diplomaten oder ausländischen Gesandten oder mit Beschuldigten zu tun hat, die eine ausländische Staatsangehörigkeit haben.
Die Gesamtheit des Rechts wird Rechtsordnung genannt, die sich in das öffentliche Recht einerseits und in das Privatrecht (Zivilrecht) andererseits teilt. Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen des einzelnen zum Staat und den übrigen Trägern öffentlicher (hoheitlicher) Gewalt sowie das Verhältnis der einzelnen Hoheitsträger untereinander. Wichtige Beispiele für das öffentliche Recht sind das Staatsrecht und das Verwaltungsrecht, zu dem u. a. das Beamtenrecht, das Polizeirecht oder das Steuerrecht zählen. Auch das Strafrecht und alle Prozessrechte, wie z. B. die Verwaltungsgerichts- oder Strafprozessordnung, zählen hierzu. Prägendes, wenn auch nicht ausschließliches Kennzeichen des öffentlichen Rechts ist das zwischen dem Bürger und dem Staat bestehende Über- und Unterordnungsverhältnis, das in den Befugnissen der Polizei besonders anschaulich zum Ausdruck kommt. Das Privatrecht regelt demgegenüber Rechtsbeziehungen auf der Ebene der Gleichordnung. Hier gibt es grundsätzlich keine Über- und Unterordnung.[4] Auch das Privatrecht ist vielfältig gegliedert: Das allgemeine Privatrecht, das auch bürgerliches Recht genannt wird, gilt für jedermann. Es ist zu weiten Teilen im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und bildet die Grundlage für „das tägliche Leben“ des Einzelnen, z. B. Vertragsrecht, Familienrecht, Erbrecht oder Eigentum und Besitz. Sonderprivatrechte gelten hingegen nur für bestimmte Bereiche und deren Angehörige, so z. B. das Arbeitsrecht, das die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelt, oder das Handelsrecht als das Recht der Kaufleute und Handelsgeschäfte.[5]
2.Eingriffsrecht
2.1Definition und Inhalt des Eingriffsrechts
„Eingriffsrecht“ ist die Summe aller Rechtsnormen, die die Aufgaben und Befugnisse der Polizei zum Einschreiten gegenüber dem Bürger beinhalten. Eingriffsrecht ist kein eigenes rechtswissenschaftliches Fachgebiet wie bspw. Verfassungs-, Verwaltungs- oder Strafrecht, sondern die Bezeichnung für ein Lehrfach, das aus den Bedürfnissen des Unterrichts für Polizeianwärter entstanden ist und rechtsgebietsübergreifend die Aufgaben und Eingriffsbefugnisse der Polizei „unter einem Dach“ zusammenfasst. Aus didaktisch-praktischen Gründen ist das verständlich und sinnvoll. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Teilgebiete des Eingriffsrechts insbesondere in verschiedenen Bereichen der Rechtswissenschaft angesiedelt sind, auf unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen beruhen und jeweils anderen Rechtswegen folgen.[6] In ihrer täglichen Arbeit muss sich die Polizei deshalb jederzeit vergegenwärtigen, auf welcher gesetzlichen Grundlage ihre jeweilige Maßnahme beruht bzw. welchem Ziel ihr Handeln dient: Prävention oder Repression, d. h. Gefahrenabwehr oder Verfolgung von Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten.[7] Zwar haben viele Eingriffe aus dem Polizei- und Strafverfahrensrecht die gleiche Bezeichnung; ihre Voraussetzungen folgen aber unterschiedlichen Normen mit verschiedenen Tatbestandsmerkmalen (vgl. z. B. § 12 BbgPolG mit § 163b StPO). Für manche Eingriffe gibt es Rechtsgrundlagen zudem nur im Polizeigesetz (z. B. die Wohnungsverweisung gemäß § 16a BbgPolG) oder nur in der Strafprozessordnung (z. B. die körperliche Untersuchung gemäß § 81a und § 81c StPO).[8] Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Maßnahme kommt es daher darauf an, ob sie zu Zwecken der Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfolgt.
2.2„Polizei“
Der Begriff „Polizei“ hat verschiedene Bedeutungen: Zunächst ist damit eine bestimmte staatliche Tätigkeit gemeint: die Abwehr und Beseitigung von Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung (Gefahrenabwehr). Man spricht auch von Polizei im materiellen Sinne, ohne dass damit gesagt wird, wer diese Tätigkeit ausübt. Wenn in diesem Lehrbuch aber von „Polizei“ die Rede ist, so ist damit stets die Behörde bzw. Tätigkeit der Vollzugspolizei gemeint, die in Brandenburg gemäß § 72 Abs. 1 BbgPolG dem Polizeipräsidium zugewiesen ist (Polizei im institutionellen/organisatorischen Sinne).[9] Die Aufgaben des Polizeipräsidiums ergeben sich aus § 78 BbgPolG, und sie umfassen viel mehr als nur die Gefahrenabwehr. Der Begriff der Polizei im institutionellen Sinne und jener der Polizei im materiellen Sinne sind also nur teilweise deckungsgleich. Hinzu kommt, dass das Polizeipräsidium nicht die einzige Behörde in Brandenburg ist, die die Aufgabe der Gefahrenabwehr wahrzunehmen hat. Es teilt sich diese Kompetenz vielmehr mit den Ordnungs- und Sonderordnungsbehörden (vgl. § 1 OBG). Polizei und Ordnungsbehörden arbeiten aufgrund verschiedener Rechtsgrundlagen: insbesondere Ordnungsbehördengesetz bzw. Polizeigesetz. Beide Gesetze ähneln sich aber in weiten Teilen.[10]
2.3Strafverfahrensrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
Strafverfahrens- bzw. Strafprozessrecht ist der Inbegriff derjenigen Normen, die dazu dienen, in einem rechtlich geordneten Verfahren zu ermitteln, ob eine strafbare Handlung vorliegt, und – falls dem so ist – eine strafbare Handlung zu ahnden. Es dient der Durchsetzung des materiellen Strafrechts und ermöglicht der Idee nach, den durch die Straftat gestörten Rechtsfrieden wiederherzustellen. Zugleich zieht es den Strafverfolgungsbehörden und damit auch der Polizei Grenzen hinsichtlich ihrer Eingriffsrechte, da Straftaten nur auf rechtsstaatlichem Wege und nicht um jeden Preis aufgeklärt und verfolgt werden sollen.[11]Beteiligte des Strafverfahrens sind
–
das Subjekt des Verfahrens: Verdächtiger, Beschuldigter, Angeschuldigter und Angeklagter;
–
die Verteidigung: in der Regel Rechtsanwälte als Wahl- oder Pflichtverteidiger;
–
die Anklagebehörde: Staatsanwaltschaft oder Amtsanwaltschaft;
–
die Polizei;
–
das Gericht, und zwar als Organ der Gerichtsverhandlung selbst sowie als Ermittlungs- bzw. Untersuchungsrichter;
–
Verletzte; Zeugen; Sachverständige.
Anders als beim Polizeirecht, dessen Ziel die Verhinderung und Beseitigung von Gefahren für polizeiliche Schutzgüter (also u. a. auch die Verhütung und Beendigung von Straftaten) ist, geht es dem Strafverfahrensrecht um die Ahndung begangener Straftaten. Ähnlich liegt es auch beim Ordnungswidrigkeitenrecht, das starke Bezüge zum Strafprozessrecht aufweist, indem sich die Verfahrensnormen und Eingriffsbefugnisse zur Aufklärung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten grundsätzlich aus der Strafprozessordnung ergeben (§ 46 Abs. 1; § 46 Abs. 2; § 53 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 OWiG). Allerdings geht es im Ordnungswidrigkeitenrecht lediglich um die Verfolgung von Rechtsverstößen unterhalb der Kriminalität („Bagatelldelinquenz“); es sanktioniert die Verletzung öffentlich-rechtlicher Pflichten, ohne die Handlung als sozialschädlich i. S. des Strafrechts zu stigmatisieren. Man spricht daher bisweilen nicht ohne Grund von „Verwaltungsunrecht“.[12] Die meisten Ordnungswidrigkeiten sind über eine Vielzahl von Gesetzen aus dem Bereich des Verwaltungsrechts verteilt, meist an deren Ende. Beispiele sind das Straßenverkehrsrecht (§ 49 StVO i. V. mit § 24 StVG), das Waffenrecht (§ 53 WaffG) oder das Forstrecht (§ 37 LWaldG). Nur wenige Tatbestände sind im zentralen Ordnungswidrigkeitengesetz geregelt.
II.Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei
Die Aufgaben der Polizei ergeben sich aus § 1 BbgPolG. Danach ist die Polizei in jeweils verschiedenem Umfang zuständig für
–
die Gefahrenabwehr,
–
den Schutz privater Rechte,
–
die Vollzugshilfe zugunsten anderer Behörden,
–
andere, der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragene Aufgaben.
1.Die Zuständigkeit der Polizei für die Gefahrenabwehr
Zur Übung
Nerlich, Fälle und Lösungen, S. 27 ff. (Fälle 1–4)
1.1Polizei und Ordnungsbehörden
Gemäß § 1 Abs. 1 BbgPolG hat die Polizei die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Gefahrenabwehr besteht aus drei Teilbereichen, nämlich:
–
der klassischen Gefahrenabwehr, d. h. der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BbgPolG);
–
der vorbeugenden Bekämpfung bzw. Verhütung von Straftaten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 BbgPolG);
[13]
–
der Vorbereitung auf künftige Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BbgPolG), womit vor allem die Vorhaltung von Daten, die Bereitstellung von Geräten und die Planung von Einsätzen gemeint ist.
Zu beachten ist jedoch, dass – von der vorbeugenden Bekämpfung (Verhütung) von Straftaten und der Vorbereitung für künftige Gefahrenfälle abgesehen – die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr grundsätzlich nur insoweit zuständig ist, als die Abwehr der Gefahr durch die originär zuständige Ordnungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint (§ 2 Satz 1 BbgPolG). Die Polizei „konkurriert“ also im Bereich der Gefahrenabwehr z. T. mit den Ordnungsbehörden. Sie hat dann lediglich das Recht des ersten Zugriffs und wird subsidiär aufgrund einer Eil- oder Eilfallkompetenz tätig.[14] Nur in wenigen Bereichen ist die Polizei aufgrund gesetzlicher Zuweisung für die Gefahrenabwehr auch originär zuständig. Es handelt sich insbesondere um
–
den Bereich des Straßenverkehrs und Wasserstraßenverkehrs gemäß § 1 Abs. 4 i. V. mit § 78 Abs. 2 BbgPolG;
[15]
–
den Bereich des Waffenrechts nach § 1 Abs. 4 BbgPolG i. V. mit § 1 Abs. 1 und Abs. 4 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur Durchführung des Waffengesetzes (DVO WaffG);
[16]
–
den Bereich des Versammlungsrechts nach § 1 Abs. 4 BbgPolG i. V. mit § 1 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz (ZustVO VersamG).
[17]
Es ist also stets zu prüfen, ob die Polizei originär oder subsidiär gefahrenabwehrend tätig wird. Handelt sie subsidiär, hat sie die jeweils zuständige Ordnungsbehörde unverzüglich über ihren Zugriff zu unterrichten (§ 2 Satz 2 BbgPolG). Unabhängig davon aber, ob die Polizei subsidiär oder originär gefahrenabwehrend tätig wird, muss tatbestandlich stets eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BbgPolG).
1.2Die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
Die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ist das polizeiliche Schutzgut; nur ihr können Gefahren drohen. Zur öffentlichen Sicherheit zählen:[18]
–
die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung,
–
die subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen,
–
der Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates, seiner Einrichtungen und Veranstaltungen.
[19]
Als Inbegriff der öffentlichen Sicherheit ist regelmäßig zuerst die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung zu prüfen. Denn fast alle Handlungen, die die Polizei zum Einschreiten berechtigen, beruhen auf einer Verletzung des geltenden Rechts und damit auf einer Verletzung der Rechtsordnung. Rechtsordnung meint die Gesamtheit des oben erläuterten geltenden Rechts. Wann immer also gegen Rechtsnormen verstoßen wird oder dies droht, ist die öffentliche Sicherheit in Gestalt der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung gestört bzw. gefährdet. Besonders augenfällig wird dies bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.[20] Legales Handeln kann demgegenüber die öffentliche Sicherheit nicht verletzen, denn rechtmäßiges Verhalten ist ja gerade zugelassen und gerechtfertigt.[21] Zu beachten ist aber, dass die Polizei grundsätzlich nur für die Verletzung des öffentlichen Rechts zuständig ist, während ihr der Schutz des Privatrechts, das natürlich auch zur Rechtsordnung gehört, nur unter den Voraussetzungen von § 1 Abs. 2 BbgPolG obliegt. Wird aber neben dem privaten Recht zugleich eine Norm des öffentlichen Rechts, z. B. ein Strafgesetz verletzt, entfällt diese Einschränkung.[22]
Beispiel 1
F bittet die beiden Polizeibeamten A und B aufgeregt, ihren soeben aus der gemeinsamen Wohnung ausziehenden Freund M daran zu hindern, den ihr gehörenden Kühlschrank ohne ihr Einverständnis mitzunehmen. Neben der Verletzung des Privatrechts kommt ein strafrechtlich relevantes Verhalten, also die Verletzung des öffentlichen Rechts, in Betracht. Die Beamten sind gemäß § 1 Abs. 1 BbgPolG zuständig.
Beispiel 2
L spricht die beiden Polizeibeamten C und D an und bittet sie, seine gerade ausziehende Freundin V daran zu hindern, den Fernseher mitzunehmen. Der gehöre zwar ihr, aber sie habe ihm, dem L, erst gestern versprochen, ihm den Fernseher für ein Jahr unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. Auch hier liegt eine Rechtsverletzung vor, jedoch nicht des öffentlichen Rechts. Nach dem Vortrag von L möchte V nämlich offenbar einen Leihvertrag im Sinne des § 598 BGB nicht erfüllen. Deswegen ist die Polizei lediglich nach § 1 Abs. 2 BbgPolG zuständig. Anders wäre es freilich, wenn insbesondere Hinweise auf strafbares Verhalten der V vorlägen.
Zu den subjektiven Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen zählen insbesondere Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum und Ehre.[23] Meist werden sie durch Rechtsverletzungen bedroht bzw. geschädigt. In einem solchen Fall liegt dann aber eine Störung der öffentlichen Sicherheit in Gestalt der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung vor, z. B. drohende Tötung (u. a. § 212 StGB), bevorstehender Diebstahl (§ 242 StGB), andauernde Körperverletzung (u. a. § 223 StGB), unzulässiger Lärm (z. B. §§ 9, 10 LImSchG). Warum zählt man dann aber die subjektiven Rechte zur öffentlichen Sicherheit? Der Grund hierfür liegt darin, dass Individualrechtsgüter wie Leib, Leben oder Freiheit auch durch Ereignisse bedroht oder beschädigt werden können, die nicht mit Rechtsverletzungen einhergehen, nämlich insbesondere durch Naturkatastrophen wie Stürme, Hochwasser oder Lawinen. Ähnlich liegt es in Fällen von Selbstgefährdung oder Selbsttötung. Soweit sie von einem freien Willen getragen sind, können sie als Ausdruck grundrechtlich geschützter Selbstbestimmung keine Gefahr oder Störung der öffentlichen Sicherheit darstellen. Anders liegt es nur, wenn es an der Freiverantwortlichkeit fehlt oder durch die Selbstgefährdung bzw. den Suizid Dritte in Mitleidenschaft gezogen werden (z. B. Suizid durch Aufdrehen des Gashahns im Mietshaus).[24]
Die dritte Fallgruppe der öffentlichen Sicherheit schützt den Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates, seiner Einrichtungen und Veranstaltungen. Bestand des Staates meint die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit Deutschlands; Einrichtungen des Staates sind insbesondere seine Organe, Behörden, Körperschaften oder Einrichtungen wie Schulen, Museen oder Schwimmbäder; unter Veranstaltungen des Staates versteht man u. a. die staatliche Tätigkeit sowie Staatsempfänge oder Gelöbnisse bzw. Vereidigungen.[25] Wiederum ist in diesen Fällen vorrangig die Verletzung der Rechtsordnung zu prüfen. Das zeigt sich anschaulich an der Behinderung polizeilicher Einsätze, die die Polizei mittels eines Platzverweises unterbinden kann (§ 16 BbgPolG). Differenziert zu betrachten ist im Vergleich dazu die Warnung vor polizeilichen Geschwindigkeitskontrollen.[26] Zweifelhaft ist vor dem Hintergrund von Art. 5 und Art. 8 GG, ob öffentliche Kritik am Staat seine Einrichtungen oder Veranstaltungen verletzen könnte (z. B. Störung von öffentlichen Gelöbnissen).[27] Soweit ein Verstoß gegen Rechtsnormen nicht festgestellt werden kann, ist es in allen diesen Fällen schwierig, eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit zu bejahen. Als Faustregel gilt daher: Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit wegen Beeinträchtigung des Staates bzw. seiner Einrichtungen sind eher restriktiv anzunehmen, es sei denn, konkrete Normverstöße liegen vor.[28]
Ist die öffentliche Sicherheit nicht betroffen, muss geprüft werden, ob die öffentliche Ordnung verletzt wird. Öffentliche Ordnung ist die Summe der ungeschriebenen Normen, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als unentbehrliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens angesehen wird.[29] Gemeint ist also ein Verstoß gegen außerrechtliche Normen. Denn rechtswidriges Verhalten berührt die öffentliche Sicherheit in Gestalt der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung. Was aber nicht gesetzlich verboten ist, ist grundsätzlich erlaubt. Daher ist die Zahl der Anwendungsbeispiele für eine Verletzung der öffentlichen Ordnung gering und zudem als polizeiliches Schutzgut bzw. Voraussetzung für polizeiliche Maßnahmen umstritten.[30] Ungeachtet dessen setzt ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung voraus, dass
–
es bezüglich des fraglichen Verhaltens eine außerrechtliche Sozialnorm gibt,
–
diese für das geordnete Zusammenleben unentbehrlich, ein Verstoß hiergegen dem Einzelnen also unzumutbar ist und
–
das fragliche Verhalten öffentlich, also wahrnehmbar ist und gegen diese Sozialnorm verstößt.
[31]
1.3Der Begriff der Gefahr
Gefahr ist neben der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung das zweite Tatbestandsmerkmal von § 1 Abs. 1 BbgPolG. Gefahr kommt in verschiedenen Formen vor. Unter einer konkreten Gefahr, die u. a. für Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 BbgPolG vorliegen muss, ist eine Sachlage oder ein Verhalten zu verstehen, die bzw. das im Einzelfall, d. h. „hier und jetzt“, tatsächlich oder jedenfalls aus der Ex-ante-Sicht des gewissenhaft und besonnen handelnden Beamten bei verständiger Würdigung in naher, d. h. überschaubarer Zukunft bei ungehindertem Geschehensablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die öffentliche Sicherheit oder Ordnung schädigen wird.[32] Im Gegensatz dazu ist die abstrakte Gefahr eine mögliche, d. h. gedachte Sachlage oder Verhaltensweise ohne Bezug zu einem konkreten Einzelfall, die nach allgemeiner Lebenserfahrung oder aufgrund fachkundiger Erkenntnisse typischerweise die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts in sich birgt. Sie liegt vor, wenn eine generell-abstrakte Betrachtung eines bestimmten Verhaltens oder Zustands zu dem Schluss führt, dass bei ihnen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden zu erwarten ist, ohne dass in diesem Moment eine Gefahr im Einzelfall vorliegen müsste. Sie genügt gemäß § 1 Abs. 1 BbgPolG für die Bejahung der Zuständigkeit der Polizei.[33] Darüber hinaus verwendet das Polizeigesetz folgende weitere Gefahrenbegriffe:[34]
–
eine
gemeine Gefahr
ist eine konkrete Gefahr, die dann vorliegt, wenn einer Vielzahl von Personen ein Schaden an Leib oder Leben oder bedeutenden Sachenwerten droht (z. B. bei Naturkatastrophen, Großbränden oder anderen Havarien);
–
eine
gegenwärtige Gefahr
ist eine konkrete Gefahr, die dann vorliegt, wenn der Schaden an der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar, d. h. in allernächster Zeit bevorsteht oder bereits eingetreten ist und andauert (im letztgenannten Fall spricht man auch von einer Störung);
–
eine
erhebliche Gefahr
ist eine konkrete Gefahr, die bedeutende Rechtsgüter wie Leib, Leben, Freiheit, erhebliche Vermögenswerte (ab etwa 500,- Euro) oder den Bestand des Staates zu schädigen droht; sie deckt sich weitgehend mit der
dringenden Gefahr
, die ebenfalls eine konkrete Gefahr für ein wichtiges Rechtsgut ist;
[35]
–
Gefahr im Verzug
liegt vor, wenn zur Schadensverhinderung das sofortige Eingreifen der unzuständigen Behörde erforderlich ist, weil ein Tätigwerden der an sich zuständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.
[36]
–
Neuerdings hat in die Polizeigesetzgebung die
drohende Gefahr
Eingang gefunden. Der Sache nach kennt auch das brandenburgische Polizeigesetz diese Gefahr, auch wenn es sie (anders als z. B. Art. 11 Abs. 3 BayPAG) begrifflich so nicht bezeichnet.
[37]
Es handelt sich bei ihr um eine Sachlage, bei der entweder bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat nach § 28a Abs. 1 BbgPolG begehen wird, oder das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, sie werde innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat nach § 28a Abs. 1 BbgPolG begehen (vgl. § 28b Abs. 3 und § 28c Abs. 1 BbgPolG).
[38]
Ist die Gefahr oder Störung beendet, bleibt für Maßnahmen aufgrund des Polizeirechts regelmäßig kein Raum mehr. Eine beendete Rechtsverletzung kann aber ggf. als Ordnungswidrigkeit oder Straftat verfolgbar sein, wofür die Polizei jedoch aufgrund anderer Vorschriften zuständig ist.
Beispiel
A geht in die B-Bank mit dem Vorsatz, sie zu überfallen. Bis zum Beginn des Tatversuchs i. S. des § 22 StGB liegt polizeirechtlich eine konkrete Gefahr in Form einer drohenden Rechtsverletzung (z. B. § 255 StGB) vor. Maßnahmen hiergegen ergeben sich aus dem Polizeigesetz. Mit dem Versuch schlägt die Gefahr in eine Störung um, denn die Rechtsverletzung ist eingetreten und dauert an. Maßnahmen hiergegen ergeben sich ebenfalls aus dem Polizeigesetz (Gefahrenabwehr in Form der Störungsbeseitigung). Nach dem Überfall (Beendigung der Straftat) ist die Störung in Form der Rechtsverletzung abgeschlossen. Sie muss nun als begangene Straftat aufgeklärt und verfolgt werden, was auf der Grundlage des Strafverfahrensrechts erfolgt. Erschöpft sich die Handlung im strafbaren Versuch, können bereits zu diesem Zeitpunkt strafverfolgende Maßnahmen ergriffen werden. (Unabhängig davon können gleichzeitig noch andere Gefahren bzw. Störungen vorliegen wie bspw. verletzte oder gefesselte Personen. Maßnahmen hiergegen sind wiederum präventiv bzw., wenn es um Strafverfolgung geht, repressiv.)
Zur Gefahr gehört auch die Anscheinsgefahr. Diese liegt vor, wenn sich am Ende zwar herausstellt, dass eine Gefahr tatsächlich gar nicht vorlag, der drohende Schadenseintritt aber aufgrund einer verständigen und vertretbaren Prognose eines gewissenhaft und besonnen handelnden Polizeibeamten angenommen wurde. Unter diesen Voraussetzungen liegt eine „echte“ Gefahr i. S. des Polizeigesetzes vor, sodass Maßnahmen aufgrund einer Anscheinsgefahr rechtmäßig sind. Das ergibt sich direkt aus dem oben definierten Begriff der konkreten Gefahr.[39]
Beispiel
M steht in den Abendstunden vor dem Geschäft des Juweliers J und blickt durch die Schaufensterscheibe angespannt in den Ladenraum. Seine Hände sind in der Tasche und scheinen einen größeren Gegenstand zu greifen. Plötzlich läuft er auf den Laden zu. Polizist P hat alles beobachtet und hält ihn an, weil er davon ausgeht, M wolle den Juwelier überfallen. Tatsächlich wollte M nur seine Freundin F in Empfang nehmen, die gerade aus dem Geschäft kam.
Im Gegensatz dazu liegt eine Schein- oder Putativgefahr vor, wenn eine Gefahrenlage allein in der subjektiven Vorstellung des Beamten bestand, also objektiv kein Anlass vorlag, von einem drohenden Schaden für polizeiliche Schutzgüter auszugehen. Die Scheingefahr ist daher keine Gefahr und kann deshalb nicht zur Grundlage für polizeiliche Maßnahmen gemacht werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Polizei schuldhaft gehandelt hat. Zu fragen ist lediglich, ob ein gleichsam objektivierter Beamter aufgrund der Umstände von einer Gefahr ausgehen konnte.[40]
2.Die Zuständigkeit der Polizei für die Verfolgung von Straftaten
Zur Übung
Nerlich, Fälle und Lösungen, S. 27 f. und S. 36 f. (Fall 1 und Fall 5)
Die Zuständigkeit der Polizei für die Verfolgung von Straftaten ergibt sich aus § 1 Abs. 4; § 78 Abs. 1 BbgPolG i. V. mit § 161 Abs. 1 oder § 163 Abs. 1 StPO. Gemäß § 163 Abs. 1 StPO haben die Behörden und Beamten des Polizeidienstes Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub duldenden Anordnungen zu treffen, um eine Verdunkelung der Sache zu verhüten. Diese Norm kommt in Betracht, wenn die Polizei – wie regelmäßig der Fall – im Rahmen des ersten Zugriffs, also aufgrund eigener Kenntniserlangung strafverfolgend tätig wird.[41] Sie hat danach unverzüglich die Staatsanwaltschaft zu informieren (§ 163 Abs. 2 Satz 1 StPO), wenn nicht wegen schleuniger Vornahme richterlicher Untersuchungshandlungen die Übersendung an das Amtsgericht notwendig ist (§ 163 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gemäß § 161 Abs. 1 StPO sind die Behörden und Beamten des Polizeidienstes darüber hinaus verpflichtet, auf Ersuchen oder im Auftrag der Staatsanwaltschaft strafverfolgend tätig zu werden (Tätigkeit aufgrund Weisung oder im Auftrag der Staatsanwaltschaft). Das ist insbesondere möglich, wenn die Staatsanwaltschaft vor der Polizei Kenntnis von einer Straftat erlangt. Zur Verfolgung von Straftaten ist die Polizei verpflichtet (Legalitätsprinzip); ihre Befugnisse hierbei ergeben sich aus der Strafprozessordnung.
2.1Straftat und Tatverdacht
Tatbestandliche Voraussetzung für die Verfolgung von Straftaten ist das Vorliegen eines Anfangsverdachts einer Straftat. Unter einer Straftat versteht man die tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Handlung, die ein Gesetz mit Strafe bedroht.[42] Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass eine Straftat begangen wurde (§ 152 Abs. 2 StPO). In der Regel ergibt sich der Anfangsverdacht aus Strafanzeigen, Zeugenaussagen, Spuren oder eigenen Wahrnehmungen der Polizeibeamten. Aufgrund dessen muss es nach kriminalistischer Erfahrung möglich erscheinen, dass eine verfolgbare Tat begangen wurde, selbst wenn der Verdachtsgrad insoweit noch gering sein mag. Lediglich bloße Vermutungen, dass eine Straftat geschehen sei, genügen nicht.[43]
Der Anfangsverdacht kann sich zu einem dringenden oder hinreichenden Tatverdacht verdichten. Dringender Tatverdacht ist Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehls. Er liegt vor, wenn nach dem Stand der Ermittlungen die hohe, d. h. überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Beschuldigte die Straftat als Täter oder Teilnehmer begangen hat.[44]Hinreichender Tatverdacht, der für die Eröffnung der Hauptverhandlung vorliegen muss, ist dann zu bejahen, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch.[45]Mangelnder Tatverdacht führt hingegen zur Einstellung des Strafverfahrens (§ 170 Abs. 2 StPO).
2.2Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
Während sich § 161 und § 163 StPO an die Behörden und Beamten des Polizeidienstes, also an alle Polizisten richten, setzen zahlreiche Eingriffsbefugnisse der Strafprozessordnung voraus, dass sie von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Wer das ist, ergibt sich aus § 152 GVG in Verbindung mit einer entsprechenden Rechtsverordnung des brandenburgischen Justizministers.[46] Bei jeder Maßnahme ist genau zu prüfen, ob sie von allen Angehörigen des Polizeidienstes oder nur von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft angeordnet werden dürfen.[47]
3.Aufgaben der Polizei für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Zur Übung
Nerlich, Fälle und Lösungen, S. 33 ff. (Fall 3)
Neben der Strafverfolgung ist die Polizei noch für die Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten zuständig. Diese Aufgabe nimmt sie entweder originär oder subsidiär oder auf Ersuchen der originär zuständigen Behörde wahr.
3.1Subsidiäre und originäre Zuständigkeit
Grundsätzlich hat die Polizei alle Ordnungswidrigkeiten zu erforschen, wenn sie davon Kenntnis erlangt. Diese Aufgabe ergibt sich aus § 1 Abs. 4; § 78 Abs. 1 BbgPolG i. V. mit § 53 Abs. 1 Satz 1 OWiG. Sie hat dabei die gleichen Rechte wie bei der Strafverfolgung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 OWiG). Allerdings ist ihre Zuständigkeit insoweit auf den ersten Zugriff, also auf feststellende und verfahrenssichernde Maßnahmen beschränkt. Man spricht wiederum von Eilkompetenz oder subsidiärer Zuständigkeit, und man nennt die Polizei in diesem Fall auch Ermittlungs- oder Feststellungsbehörde. Nach dem ersten Zugriff muss sie gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 OWiG die originär zuständige Verwaltungsbehörde i. S. des § 35 OWiG unverzüglich informieren. Diese wird auch Ahndungs- oder Verfolgungsbehörde genannt. Der Ahndungs-/Verfolgungsbehörde obliegt der weitere Verfahrensgang; sie kann das Verfahren einstellen oder einen Bußgeldbescheid erlassen. Dabei hat sie grundsätzlich dieselben Rechte wie die Staatsanwaltschaft und ist „Herrin des Verfahrens“ (§ 46 Abs. 2 OWiG). Aus diesem Grund kann sie sich auch im weiteren Verlauf des Bußgeldverfahrens der Polizei bedienen, indem sie sie gemäß § 46 Abs. 1 OWiG i. V. mit § 161 Satz 2 StPO zur Vornahme von Ermittlungshandlungen bindend ersucht.[48]
In wenigen Ausnahmefällen ist die Polizei aber auch selbst die Verfolgungs- bzw. Ahndungsbehörde, z. B.:[49]
–
im Bereich bestimmter Ordnungswidrigkeiten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden nach dem Dritten Teil des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, nach dem Passgesetz und nach dem Personalausweisgesetz (Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung – OWiZustV);
[50]
–
im Bereich des Straßenverkehrsrechts gemäß § 78 Abs. 1 Satz 2 BbgPolG und § 26 Abs. 1 StVG i. V. mit § 1 der brandenburgischen Rechtsverordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung – VOWiZustV);
[51]
–
für den Bereich des Waffenrechts gemäß § 4 der oben bereits genannten brandenburgischen Rechtsverordnung zur Durchführung des Waffengesetzes (DVO WaffG);
[52]
–
im Bereich des Versammlungsrechts gemäß §§ 1 f. der oben bereits genannten brandenburgischen Rechtsverordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz (ZustVO VersamG).
[53]
3.2Voraussetzungen für die Zuständigkeit wegen Ordnungswidrigkeiten
Begrifflich ist unter einer Ordnungswidrigkeit die rechtswidrige und vorwerfbare Handlung zu verstehen, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt (§ 1 Abs. 1 OWiG). Damit die Polizei tätig wird, müssen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung einer Ordnungswidrigkeit, also ein entsprechender Anfangsverdacht vorliegen (§ 152 Abs. 2 StPO i. V. mit § 46 Abs. 1 OWiG).[54] Da es sich nicht um Straftaten handelt, wird das Verfahren nicht gegen einen Beschuldigten, sondern gegen den Betroffenen geführt.[55] Anders als im Strafrecht wird auch nicht zwischen Täterschaft und Teilnahme unterschieden, sondern mehrere Beteiligte einer Ordnungswidrigkeit als „Einheitstäter“ verfolgt (§ 14 OWiG). Lediglich bei der Bußgeldbemessung wägt die Behörde ab, welches Gewicht jedem Beteiligten bei der Verwirklichung der Ordnungswidrigkeit zukommt. Ein weiterer Unterschied zur Strafverfolgung besteht darin, dass Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nicht dem Legalitäts-, sondern dem Opportunitätsprinzip unterliegen, d. h. nach pflichtgemäßem Ermessen geführt und eingestellt werden können (§ 47 Abs. 1 OWiG).[56]
4.Doppelfunktionales Handeln der Polizei
Oftmals dient eine Maßnahme der Polizei sowohl der Abwehr bzw. Beseitigung einer Gefahr bzw. Störung als auch der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Beispiele hierfür sind die Sicherstellung von Drogen oder das Anhalten eines mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Pkw. In beiden Fällen verfolgt die Polizei mit einer Maßnahme zwei Ziele: Zum einen wehrt sie Gefahren für die öffentliche Sicherheit ab, indem sie die verbotenen Rauschmittel durch Sicherstellung „aus dem Verkehr zieht“ bzw. die zu schnelle, insoweit also illegale Fahrt des Pkw stoppt. Zum anderen dienen die Maßnahmen der Verfolgung von Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten, indem die Drogen als Beweismittel beschlagnahmt bzw. der Pkw-Fahrer für Ermittlungsmaßnahmen angehalten wird. Überschneiden sich die polizeilichen Zielrichtungen, spricht man von Gemengelagen bzw. doppelfunktionalen Maßnahmen.[57] Kennzeichnend für sie ist, dass sie sowohl auf eine polizeigesetzliche als auch strafverfahrensrechtliche Befugnisnorm gestützt werden können, sich aber nicht eindeutig dem Polizeirecht oder dem Strafverfahrensrecht zuordnen lassen.[58] Fraglich ist in solchen Fällen daher, welches Recht Anwendung findet bzw. welcher Maßnahme der Vorrang einzuräumen ist. Das ist schon aus Gründen des Rechtsschutzes erforderlich, denn Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden von den Verwaltungsgerichten, Maßnahmen zur Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfolgung von den ordentlichen Gerichten überprüft. Darüber hinaus unterliegen manche strafprozessuale Eingriffe strengeren Anforderungen; so dürfen bspw. die Personen- und die Sachdurchsuchung grundsätzlich nur vom Richter angeordnet werden (§ 105 Abs. 1 StPO), während die gefahrenabwehrende Durchsuchung von Personen und Sachen keiner richterlichen Mitwirkung bedarf. Für die Abgrenzung werden verschiedene Meinungen vertreten: Der Bundesgerichtshof ist der Auffassung, dass die Polizei wählen kann, worauf sie ihre Maßnahme stützt, wenn sowohl die polizeigesetzliche als auch die strafprozessuale Rechtsgrundlage einschlägig ist und die Polizei zumindest auch das jeweilige Ziel der angewandten Norm verfolgt.[59]Demgegenüber wird wohl noch überwiegend vertreten, dass der Schwerpunkt der Maßnahme aufgrund einer objektiven Betrachtung des Gesamteindrucks entscheidend sei, wobei im Zweifel, insbesondere bei Gefahren für Leib oder Leben, der Gefahrenabwehr höheres Gewicht eingeräumt wird als der Strafverfolgung.[60]
5.Schutz privater Rechte durch die Polizei
Zur Übung
Nerlich, Fälle und Lösungen, S. 21 ff. (Fall 2)
Neben der Gefahrenabwehr und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten obliegt der Polizei auch der Schutz privater Rechte – gemäß § 1 Abs. 2 BbgPolG allerdings nur, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde. Die Polizei ist also insoweit nur subsidiär zuständig. In erster Linie muss der Bürger seine privatrechtlichen Ansprüche auf dem Zivilrechtsweg durchsetzen. Private Rechte sind alle durch das bürgerliche Recht begründeten Rechte, d. h. alle privatrechtlichen Ansprüche und Forderungen, z. B. aus Verträgen, aus Eigentum und Besitz oder aus unerlaubten Handlungen wie etwa einem Verkehrsunfall. Weil die Polizei nur hilfsweise zum Schutz privater Rechte tätig werden darf, muss sie sich auf Maßnahmen beschränken, die den Anspruch des einzelnen lediglich sichern. Als Maßnahmen kommen in Betracht:[61]
–
Identitätsfeststellung (§ 12 Abs. 1 Nr. 7 BbgPolG)
–
Sicherstellung (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BbgPolG)
–
Befragung (vgl. § 11 Abs. 1 BbgPolG)
–
Gewahrsamnahme (§ 17 Abs. 1 Nr. 5 BbgPolG)
Geht jedoch die Verletzung privater Rechte mit einer Verletzung des öffentlichen Rechts, namentlich des Strafrechts einher, ist die öffentliche Sicherheit in Gestalt der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung gestört, sodass die Polizei nach § 1 Abs. 1 BbgPolG zuständig ist.[62]
6.Vollzugshilfe
Gemäß § 1 Abs. 3 BbgPolG leistet die Polizei anderen Behörden Vollzugshilfe. Ungeachtet der Frage, ob es sich dabei um einen gesteigerten Fall der Amtshilfe (zu der die Polizei gemäß § 1 Abs. 4 BbgPolG i. V. mit § 4 Abs. 1 VwVfG verpflichtet ist)[63] oder um ein eigenständiges Rechtsinstitut handelt, versteht man unter Vollzugshilfe die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch die Polizei im Dienst einer anderen Behörde, weil diese nicht über die erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder die Maßnahme nicht auf andere Weise selbst durchsetzen kann.[64] Bei der Vollzugshilfe hat die Polizei die §§ 50–52 BbgPolG zu beachten. Aus diesen Normen ergeben sich auch die Verfahrensregeln und Verantwortlichkeiten der beteiligten Behörden.
7.Abwehr von Gefahren des Terrorismus
Gemäß § 28a Abs. 1 Satz 1 BbgPolG hat die Polizei seit April 2019 als Konkretisierung und Ergänzung von § 1 Abs. 1 BbgPolG die Aufgabe, Gefahren des Terrorismus abzuwehren.[65] Darunter versteht man die drohende Begehung von Straftaten, die in § 129a Abs. 1 und Abs. 2 StGB genannt sind und die dazu bestimmt sind, entweder die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern oder eine Behörde oder internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates, eines Landes oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen und die durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat, ein Land oder eine internationale Organisation erheblich schädigen können (§ 28a Abs. 1 Satz 2 BbgPolG). Bei Wahrnehmung dieser Aufgabe muss die Polizei evtl. bestehende Zuständigkeiten des Bundes oder anderer Länder prüfen, diese dann unverzüglich benachrichtigen und die Aufgabe ggf. an sie abgeben; andernfalls erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach Absprache (§ 28a Abs. 2 BbgPolG). Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Gesetzgeber der Polizei unbeschadet der übrigen Maßnahmen (vgl. § 28a Abs. 4 BbgPolG)[66] je nach Voraussetzung verschiedene Befugnisse verliehen:[67]
–
Recht zum Anhalten und Befragen sowie zur Identitätsfeststellung und Inaugenscheinnahme mitgeführter Sachen (§ 28b Abs. 1 und Abs. 2 BbgPolG)
[68]
–
Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen (§ 28b Abs. 3 BbgPolG)
–
Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung, zur verdeckten Registrierung oder zur gezielten Kontrolle i. S. des Art. 99 SDÜ (§ 28b Abs. 4 BbgPolG)
–
Automatisierte Erhebung von Kfz-Kennzeichen (§ 28b Abs. 5 BbgPolG)
–
Aufenthaltsvorgabe (§ 28c Abs. 1 BbgPolG)
–
Kontaktverbot (§ 28c Abs. 2 BbgPolG)
–
Gewahrsamnahme (§ 28d BbgPolG)
Übersicht 1 Die wichtigsten Aufgaben der Polizei
III.Adressaten polizeilicher Maßnahmen
1.Adressaten polizeilicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Bei jeder Maßnahme der Polizei stellt sich die Frage, wer ihr Adressat ist. Die Pflicht des Bürgers, Handlungen zur Gefahrenabwehr vorzunehmen oder zu dulden, wird Verantwortlichkeit oder Polizeipflichtigkeit genannt.
1.1Handlungsstörer: Verantwortlichkeit für eigenes Handeln
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind grundsätzlich gegen denjenigen zu richten, der die Gefahr verursacht hat (§ 5 Abs. 1 BbgPolG).[69] Er wird auch als Handlungs- oder Verhaltensstörer bezeichnet. Ob diese Person schuldhaft gehandelt hat, ist unerheblich, weswegen auch Kinder Adressaten polizeilicher Maßnahmen sein können, wenn sie Gefahren verursachen.[70] Polizeipflichtigkeit darf also nicht mit Strafmündigkeit verwechselt werden.
Handlungsstörung kann auf zweierlei Weise geschehen: Zum einen kann – und das dürfte der Regelfall in der polizeilichen Praxis sein – der Handlungsstörer eine Gefahr unmittelbar verursachen: Sein Verhalten stellt die zeitlich letzte Handlung vor der Gefahr bzw. Störung dar, z. B. die Missachtung von Verkehrsregeln, das brandverursachende Zündeln im Wald, der trunkene Schläger im Wirtshaus. Zum anderen kann ein Verhalten aber auch lediglich mittelbar gefahrverursachend sein, z. B. eine reißerische Schaufensterreklame, die zu einem erheblichen Menschenauflauf auf dem Bürgersteig und auf der Fahrbahn führt, oder ein Rockkonzert, bei dem es zu Ausschreitungen kommt.[71] Von Interesse ist ein solches mittelbares Verhalten allerdings grundsätzlich nur, wenn es für sich gesehen legal ist.[72]





























