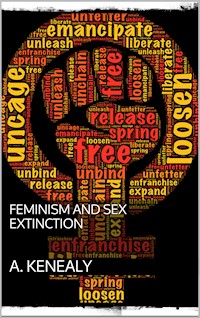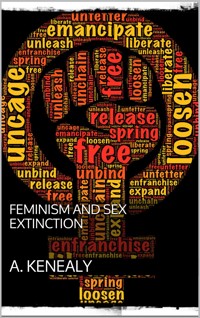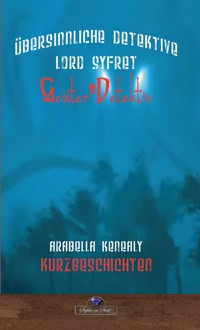
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Übersinnliche Detektive
- Sprache: Deutsch
1893 schrieb sie Dr. Janet of Harley Street, die erfolgreich war. Die Hauptfigur ist eine Ärztin, die eine jüngere Frau adoptiert, die aus einer unglücklichen Ehe flieht. In den Jahren 1896-1897 schrieb Kenealy eine Reihe von Geschichten über Lord Syfret. Syfret war ein Aristokrat, der in erschreckende und manchmal übernatürliche Situationen verwickelt wurde. Eine der Syfret-Geschichten war eine gotische Kurzgeschichte mit dem Titel "Ein schöner Vampir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Übersinnliche Detektive 13
Arabella Kenealy
Einige Erfahrungen von Lord Syfret
Saphir im Stahl
Übersinnliche Detektive 13
e-book 252
Arabella Kenealy - Einige Erfahrungen von Lord Syfret
Erstveröffentlichung: The Lord Seyfret Stories (1896)
Erscheinungstermin: 01.07.2024
© Verlag Saphir im Stahl
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Lektorat: Peter Heller
Übersetzung: Tanya Bröse-Kronz
Vertrieb: neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Übersinnliche Detektive 13
Arabella Kenealy
Einige Erfahrungen von Lord Syfret
Saphir im Stahl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Stronheims Not
Der Wolf und der Storch
Simkins Villa
In einer grausamen Falle
Prinz Ranjichatterjees Rache
Ein hübscher Vampir
Eine Sühne
Vorwort
Mit vierzig hatte ich alle Dinge des zivilisierten Lebens ausgereizt. Ich besaß Gesundheit, Wohlstand und sozialen Status, dennoch wusste ich, dass wenn ich mir nicht einen neuen Zeitvertreib suchen würde, Suizid meine letzte Erfahrung werden würde. Ich machte mir keine Gedanken darüber, ob Selbstmord gerechtfertigt wäre oder nicht. Ich war gelangweilt, und ich war nicht gewillt, länger gelangweilt zu sein. Beim Durchsuchen meiner mentalen Ressourcen stieß ich auf eine Ader, die mir auf passende Weise ausgearbeitet, gefallen würde. Ich machte mich daran, mich mit ihr zu beschäftigen. Und habe dies bisher erfolgreich getan. Das Leben ist wieder erträglich, bisweilen sogar aufregend.
Die Ader ist ein unersättliches und aufsaugendes Interesse – Neugier – nennen Sie es, wie Sie wollen – für das Leben anderer Leute. Fiktion hat keine Anziehungskraft für mich. Ich bin mit immer bewusst, dass Ihre Charaktere nichts als Schreibertinte sind. Und ich mag meine Seiten der Geschichte noch feucht mit der Tinte des Lebens. Ich treffe einen Mann oder eine Frau, deren Erscheinung oder Zustand mich bewegt. Durch den Aufwand einer kleinen Raffiniertheit, Ärgers oder Zufall fällt mir die Geschichte dieser Person in die Hände. Unterstützt durch gut ausgebildete Agenten, deren Job es ist, das Schicksal dieser Personen, die meine Neugier erregt haben, zu beschatten, bin in der Lage, ihre Geschichten wie ein Buch zu lesen. Und, ich schwöre, ein paar Romanzen entstanden im Interesse einiger, deren Spuren ich folgen konnten. Mir mag das Recht, ins Leben meiner Mitmenschen zu schauen, verwehrt werden. Ich selbst habe es nie in Frage gestellt. Es ist so unterhaltsam für mich. Das reicht meiner Moral, es gutzuheißen.
Es ist mir gelungen, ein paar der Geschichten, auf die ich gestoßen bin, aufzuzeichnen. Ich behaupte nicht, dass sie das Interesse anderer im gleichen Maße wie meines wecken werden, der ich sie in der Schmiede des Lebens habe entstehen sehen. Dennoch werden sie der Unterhaltung dienen. Wie schon gesagt, mein Beweggrund ist rein psychologisch, oder, wenn Sie einen simpleren Ausdruck vorziehen, vorlaute Neugier. Ob eine Sache richtig oder falsch ist, da mische ich mich nicht ein.
Stronheims Not
Ich suchte meinen Freund, den Kurator der Münzen und Medaillen am Britischen Museum, auf. Wir waren Studienfreunde gewesen und hielten nicht viel von Förmlichkeiten.
„Ich bin noch für etwa eine Stunde beschäftigt“, sagte er, als wir uns die Hände schüttelten. Er zeigte auf einen Stoß Medaillen, bis zur Unkenntlichkeit getrübt und beschädigt. „Ich komme langsam zu Ende mit ihnen. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommen würdest. Dann essen wir zusammen zu Mittag. Oder, wenn du lieber bleiben willst, gebe ich dir einen seltenen alten Folianten um dich darin zu vertiefen.“
„Ich werde bleiben“, antwortete ich. „Ich mag diesen modrigen Geruch der Antiquitäten.“
Der Kurator lächelte.
„Wenn du ihn so oft und lange ertragen müsstest wie ich“, antwortete er, „würdest du Sauerstoff vermutlich vorziehen.“
Fünf Minuten später trat ein Wärter herein.
„Ein Gentleman möchte Sie sehen, Sir.“
Der Kurator schaute unmutig durch seine Brille auf. Er las die Karte, die ihm gereicht wurde.
„Haben Sie ihm gesagt, dass ich beschäftigt bin?“
„Ich sagte es ihm, Sir. Er sagte, es sei dringend. Es hat etwas mit der Hierator-Münze zu tun.“
„Ah!“
Der Kurator legte seine Vergrößerungsgläser nieder. Wenn es einen weichen Fleck in seinem Herzen gab, dann hatte die Hierator-Münze diesen getroffen. Es war ein erlesenes Exemplar, das kürzlich der Sammlung, für die er verantwortlich war, zugefügt worden war. Ihre Geschichte war hinreichend abstrus, um seine Fähigkeiten hinsichtlich Klassifikation beim Einschätzen, nicht zu verwirren, dennoch war sie so gut erhalten, das klassische Avers so ausgefallen und klar, dass sogar ein Laie der numismatischen Kunst, wie ich selbst, ihr seine Bewunderung nicht versagen kann. Abgesehen von ihrer wundervollen Verarbeitung wurde ihr Wert von der Tatsache bestimmt, dass sie einer Epoche angehörte, über die es nur wenige Zeugnisse gab. Überdies war sie ein so einzigartiges Exemplar, dass die Existenz einer anderen Münze ihrer Art nicht bekannt war. Die Times hatte ihr eine komplette Kolumne gewidmet, eine Kolumne, die ein wahres Denkmal für die Überlieferung war. Ihr geschätzter Wert in harter Währung variierte von 50 bis 2000 Pfund. Wahrscheinlich war sie etwa 1000 wert, aber die Verwaltung des Museums, in deren Besitz sie gelangt war, hegte nicht das geringste Interesse, sich von ihr zu trennen. Für sie war sie unschätzbar, da sie eine Serie komplettierte, die lange unvollständig war.
Der Kurator sah nervös aus. Die Herkunft der Münze war nicht hinreichend geklärt, und wie er mir erzählte, wurde er nicht selten von Alpträumen geweckt, dass irgendjemand auftauchen würde, um seine Besitzrechte geltend zu machen.
„Ich möchte den Gentleman empfangen“, sagte er.
Er schob den Stapel aus vermoderndem Silber und Bronze vor sich in eine Schublade, die er sorgfältig abschloss. Dann wechselte er die Brille und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, seine Augen mit einer nervösen Falte zwischen den Brauen auf die Tür gerichtet.
„Ich wünschte, ich könnte mich hinsichtlich dieser Hierator sicher fühlen“, bemerkte er.
Der Aufseher erschien bald darauf und geleitete einen großgewachsenen, schlanken, nachlässig gekleideten Mann herein. Dieser verbeugte sich steif und formell. Er war offensichtlich ein Ausländer.
„Herr Stronheim,“ las der Kurator von der Visitenkarte ab und erwiderte die Verbeugung, „was kann ich für Sie tun, Sir?“
Es mag ein Vorurteil auf Grund der Hierator-Münze gewesen sein, aber ich hatte den Verdacht, dass er das Aussehen des Mannes nicht mochte. Sein Gesicht war schmal und scharf geschnitten und sein Blick schweifte nervös – fast verdächtig – im Raum umher.
„Sir, ich bin Ihnen verpflichtet“, antwortete der Fremde mit nur leichtem deutschem Akzent und einer recht angenehmen Stimme. „Ich habe einen Brief für Sie von Professor von Brau aus Berlin. Ich nahm mir heraus, ihn persönlich zu überbringen.“
„Von Brau, von Brau?“ wiederholte der Kurator zweifelnd, „kenn ich ihn?“
Stronheim schien verblüfft.
„Ich verstand ihn so, als wären Sie Freunde – langjährige Freunde. Ist es Doktor Keith Bernard, dessen Ehre ich habe, mit ihm zu sprechen?“
„Ja, ich bin Dr. Bernard. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich den Brief lesen. Bitte setzen Sie sich.“
Der Besucher setzte sich. Sein Gesicht wirkte aufgeregt. Sein Blick wanderte immer noch verstohlen im Raum herum. Der Kurator beobachtete ihn während des Lesens von Zeit zu Zeit über seine Brille hinweg. Wie ich später erfuhr, war es ein kurzer Vorstellungsbrief. Professor von Brau, von einer medizinischen Fakultät aus schreibend, rief sich Dr. Keith Bernard selbst in Erinnerung, den er einige Jahre zuvor auf einem Antiquaren-Kongress getroffen hatte. Er bat darum, ihm Herrn Stronheim vorstellen zu dürfen, einen Gentleman, mit dem er selbst nur flüchtig bekannt war, der ihm jedoch wärmstens von Freunden empfohlen worden war. Es gab da eine kleine Angelegenheit, in der er es als Ehre für sich selbst und als persönliche Höflichkeit sehen würde, wenn Dr. Keith Bernard Herrn Stronheim behilflich wäre.
„Erinnern Sie sich jetzt an den Professor?“, fragte Stronheim.
Der Kurator schüttelte den Kopf.
„Man trifft so viele Herren auf den Konferenzen – ich fürchte, ich kann mich momentan nicht an Ihren Freund erinnern.“
Der Deutsche lehnte sich in seinem Stuhl vor. „Darf ich dennoch hoffen ...“, begann er hastig.
Er hielt sofort inne. Der Kurator bemerkte, dass seine Hand auf der Stuhllehne zitterte. Es erschien ihm, so wie auch mir, dass der Mann kein Frühstück gehabt hatte.
„Ich habe die Reise nicht grundlos unternommen ...“, begann Stronheim erneut. Sein zusammengekniffenes Gesicht ließ ahnen, zu welchem Preis.
„Ich würde mich glücklich schätzen“, antwortete mein Freund höflich, „wenn ich Ihnen irgendwie helfen könnte. Ich fürchte, wenn es eine Stelle ist, die Sie suchen ...“
Stronheim schüttelte den Kopf. „Das ist es nicht“, sagte er. „Sie sind sehr gütig. Das ist es nicht, aber die Angelegenheit ist von großer Bedeutung für mich.“
Der Kurator deutete mit einer Geste an, dass er erwartete, Herrn Stronheims eigentliches Anliegen zu hören.
„Sie haben hier eine Münze ...“
„Die Hierator“, unterbrach Bernard.
„Die Hierator. Hätte ich die Erlaubnis sie zu sehen?“
Der Kurator behielt seinen Blick auf den anderen fixiert. Dieser war offensichtlich ein Antragssteller.
„Die Hierator ist im Münzensaal Nr. III für die Öffentlichkeit ausgestellt, in der mittleren Vitrine auf der Fensterseite,“ sagte er kurz angebunden und fügte hinzu: „Wenn Sie es wünschen, werde ich jemanden mitschicken, der Sie ihnen zeigt.“
„Sir, Sie meinen es gut, aber ich wünsche mehr. Ich bitte um das Privileg, sie näher zu untersuchen – sie in meiner Hand zu halten.“
Die Bitte war ungewöhnlich. Bernard betrachtete ihn von oben bis unten. Sicher, seine Referenzen rechtfertigten noch nicht, großes Vertrauen in ihn zu setzen. Er wirkte heruntergekommen und unbehaglich, und seine Stiefel, obwohl sie anständig geschwärzt waren, waren zerschlissen. In England sind wir geneigt dazu, uns leichthin ein Urteil über einen Mann mit zerschlissenen Schuhen zu bilden, vor allem, wenn wir Grund haben zu bezweifeln, dass er gefrühstückt hatte. Außerdem konnte ich sehen, dass mein Freund eifersüchtig über seine Hierator-Münze wachte.
„Diese Bitte ist sehr ungewöhnlich“, wendete er ein, „darf ich die Sache hinterfragen?“
Stronheim wich der Frage aus.
„Ich wünsche, Sie nur für einen Moment in meinen Händen zu halten.“
„Sie werden sicher Ihre Beweggründe erklären.“
„Verzeihen Sie mir. Ich muss Sie bitten mir zu erlauben, diese zurückzuhalten.“
Bernard versteifte sich. Offensichtlich wollte man seinem Schatz nichts Gutes.
„Ich fürchte, Sir“, sagte er gefasst, aber entschlossen, „Ich fürchte, dann kann ich Ihrem Ersuchen nicht nachkommen.“
Der Deutsche machte eine Geste des Protests.
„Sir“, rief er aus, „sie werden mir doch sicherlich nicht misstrauen – wenn könnten Sie mich verdächtigen?“
„Ihr Ersuchen ist ungewöhnlich, und Sie nennen mir keine Begründung.“
Stronheim fuhr mit der Hand zu seinem Kehlkopf und wendete sich ab. Die Finger der anderen Hand umklammerten heftig die Armlehne. Nach einer Minute dreht er sich wieder um.
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wichtig diese Angelegenheit für mich ist,“ sagte er stockend. „Meine Zukunft – die Zukunft von anderen – hängt davon ab.“
Mein Freund hatte noch andere warme Flecken in seinem Herzen, abgesehen von dem, der von der Hierator-Münze belegt wurde. Ich sah ihn weich werden.
„Nun gut“, sagte er freundlich, „wenn Sie so besorgt sind, sollen Sie sie sehen.“
„Ich auch?“ formte ich mit meinen Lippen. Er stimmte lächelnd zu.
Er setzte sein samtenes Scheitelkäppchen auf und unterbrach das überschwängliche kehlige Dankeschön des Teutonen mit einem britisch-höflichen ‚Keineswegs, keineswegs‘. Er führte uns durch die Lobby und verschiedene Stufen hinauf zum Saal Nr. III für Münzen und Medaillen.
Die Wände des großen Raumes waren mit Glasvitrinen gesäumt und diese erstreckten sich auch über seine gesamte Fläche, nur schmale Gänge waren gelassen worden, um die Besucher hindurchzulassen. Er war offensichtlich leer, aber schon einen Moment später gesellte sich ein Wächter respektvoll zu uns, der seinen Schlagstock bei sich trug.
Wir gingen rasch durch die schmalen Gänge, die Vitrinen, gefüllt mit grünen und stockfleckig aussehenden Schätzen, schienen uns mit einer grabesähnlichen Stille zu verschlingen. Niemand war dort außer ein paar Personen, die sich für die Münzen interessierten.
Der Kurator blieb vor einer der Vitrinen stehen – ich glaube, er hätte auch im Stockfinsteren seinen Weg hierher gefunden – worin in der Mitte auf dem Samteinschlag einer hübschen Schatulle die Hierator-Münze ruhte. Eine Inschrift darunter gab ihre Daten an und einen kurzen Abriss ihrer Geschichte.
Bernard, für einen Moment nicht an die möglichen Absichten des Fremden bezüglich seines Schatzes denkend, deutete mit Stolz auf sie.
„Da ist sie“, sagte er lächelnd, „da ist sie – die wertvollste Münze in unserer Sammlung.“
Der Deutsche starrte sie mit gierigen Augen an. Er drückte das Gesicht fest gegen das Glas und betrachtete sie eingehend. Da war ein seltsames Leuchten auf seinem Gesicht.
Der Kurator beobachtete ihn, wie ich es tat. Was war sein Motiv? Seine Augen fixierten sich auf die Münze wie auf einen langersehnten Preis.
Er streckte eine blasse, langfingrige Hand danach aus. „Lassen Sie sie mich untersuchen“, brach es heiser aus ihm heraus.
Ich dachte, Bernard bereute seine Zustimmung. Aber er war ein Mann, der sein Wort hielt. Er steckte einen Schlüssel in die Vitrinentür. Der Wächter, den Schlagstock in der Hand, stand daneben. Er musterte den Fremden wachsam, offensichtlich mochte er sein Aussehen nicht. Möglicherweise hatte auch er den Verdacht, dass der Fremde kein Frühstück gehabt hatte.
Bernard nahm die Lederschatulle aus der Vitrine und hielt sie einen Moment in seiner Hand. Er schaute mit Freude und Leibe auf deren Inhalt. Dann reichte er sie dem Deutschen.
Stronheim verbeugte sich, als er seine zitternden Finger danach ausstreckte. Seine Augen verschlangen jede Gravur und Prägung auf der Münze. Er beugte sich mit kreidebleichem Gesicht darüber. Bald verlor er das Bewusstsein für alles andere drum herum. Er sah nicht den respektvollen, halbfragenden Blick, den der Aufseher dem Kurator zuwarf, noch wie der Kurator ihn selbst musterte. Er legte einen Finger an die Münze mit der Absicht, sie aus der Schatulle zu nehmen.
„Habe ich die Erlaubnis?“, fragte er.
Bernard nickte. Sein Gesicht war ernst. Sicherlich vermutete er, dass dies der rechtmäßige Besitzer der Hierator-Münze war. Nur jemand, in dessen Besitz sie gewesen war, könnte sie so lieben, wie dieser Mann es offensichtlich tat. Der Deutsche nahm sie heraus und legte die leere Schatulle auf der Nachbarvitrine ab.
In diesem Moment stolperte ein Mann, der den Raum gerade vom anderen Ende her betrat, plötzlich und nach drei rumpelnden Schritten, um seine Balance wiederzufinden, und einem lauten heiseren Schrei, fiel er der Länge nach auf den Boden. Wir alle drehten uns instinktiv herum. Es gab ein Geräusch, wie wenn Metall über Holz kratzt, und klimpert, einen unterdrückten Aufschrei, und der Deutsche war auf Händen und Knien und sucht den Boden mit seinen langen blassen Fingern ab.
„Ich schreckte zusammen und habe sie fallen lassen“, erklärte er zitternd.
Wir hatten uns nur für eine Sekunde herumgedreht. Als ich meinen Blick von dem gestürzten Mann am Ende des Raumes zurückwandte, dachte ich, dass ich etwas fallen und dann verschwinden sah. Im nächsten Moment war auch Bernard auf seinen Knien. Ein paar umhergleitende Blicke und wenige Handwische zeigten ihm, dass die Münze verschwunden war. Und wenn sie da sein sollte, würde es Zeit brauchen, sie zu finden. Er wandte seine Augen von Stronheims Gesicht ab, beugte sich blass und nervös über den Boden, instinktiv in Richtung der Gestalt des Mannes, der nun wieder aufrecht gerade den Raum verließ. Etwas an dessen Aussehen, zusammen mit der Erinnerung an seinen heiseren Aufschrei, schien ihn zu beeindrucken. Er flüsterte dem Aufseher zu. Ein Moment später klangen dessen Schritte laut und hohl durch den Raum. Er folgte dem Fremden durch den hinteren Ausgang.
Bernard krempelte verstohlen einen Jackett-Ärmel hoch, im Geiste seine Stärke mit der seines Widersachers vergleichend. Er schaute mich mit einem grimmigen Ausdruck an.
„Sir, wie kann ich Ihnen mein Bedauern ausdrücken“, entschuldigte sich der Deutsche, immer noch eifrig mit Augen und Händen suchend. „Das war unverzeihlich. Aber ich fühle mich heute nicht wohl. Der Sturz des Mannes hat mich aus dem Konzept gebracht. Ich habe die Hierator fallen lassen. Sie muss weit gerollt sein.“
Da lag eine seltsame Freude in seiner Stimme. Verborgen durch seine gebeugte Haltung lächelte er heimlich. Er suchte mit Sorgfalt, aber die Nervosität von vor ein paar Minuten war aus seinem Gesicht gewichen.
„Sie werden lachen, Mann“, murmelte der Kurator daneben in Wut, „Aber Ihre Probleme beginnen gerade erst. Engländer lassen sich nicht so leicht zum Narren halten.“
Der Aufseher kehrte zurück. Er nickte auf den fragenden Blick seines Vorgesetzten hin. Dann ging auch er auf Hände und Knie herunter, offensichtlich suchend, aber sein Blick wanderte offenkundig nach und nach zu den Taschen des Deutschen, als ob er spekulieren wollte, in welcher sich im Moment die Hierator verbarg.
Stronheim wurde nervös. Er begann fieberhaft zu suchen und mit einem gewissen Grad von wilder Ziellosigkeit. Er rückte seine Brille vor und zurück. Seine Gesichtszüge arbeiteten. Dann zügelte er sich selbst und suchte mehr methodisch. Er zog ein Taschenmesser heraus. Wir behielten ihn im Auge. Er öffnete eine Klinge und fuhr damit fort, sie jeweils für sechs bis acht Fuß durch die Fugen der Holzdielen zu ziehen. Er untersuchte jede Fuge in dem Gang, in dem wir standen, ohne Erfolg. „Mein Gott!“, sagte er mit leerem Tonfall, sich für einen Moment streckend, um den Schmerz aus dem Rücken zu bekommen. Mit verhärmtem Gesicht begann er ein paar Schritte weiter und arbeitete sich langsam über den Boden, die Messerklinge eifrig durch die Fugen ziehend, seine Ohren gespitzt, seine Finger nach dem Klimpern von Metall suchend, als ob sein Leben davon abhinge. Er führte dieses Manöver einige Yards in jede Richtung im Raum aus.
Als er erfolglos blieb, zitterten seine Hände sichtlich. Der Kurator und der Aufseher hatten sich wieder aufgerichtet. Sie beobachteten ihn mit missbilligenden Gesichtern, Gesichtern, die von wachsendem Ärger über das sprachen, was auf sie wie eine Farce wirkte.
Der Deutsche, versunken in seine Anstrengungen, zollte ihnen keine Beachtung. Bernard drehte sich um, machte die Tür zu der Vitrine, aus der die Hierator-Münze entnommen worden war, und schloss sie ab.
Eine Gruppe Kinder eilte lärmend durch den Raum – die Gruppe entdeckend, ein Mann auf Händen und Knien – die kurzen Fußtritte der jüngeren Kinder die der Älteren vervielfältigend, während sie trippelnd mit ihnen mitzuhalten versuchten. Der Aufseher wies sie zurecht. Sie hielten Abstand, enttäuscht, aber atemlos flüsternd und mit aufgerissenen Augen beobachtend.
„Mein Gott!“, rief der Deutsche erneut aus, als zum Ende einer Reihe Fugen kam, ohne etwas gefunden zu haben. Der Schweiß stand dicht auf seiner Stirn. Er schaute zu uns auf, wie wir ihn beobachteten.
„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, schrie er. „Sie fiel herunter. Ich sah sie auf den Boden treffen und wegrollen, und dann war sie weg. Ich könnte schwören, sie ist nicht weiter als bis hierher gerollt.“ Er deutete mit einem zerschlissenen Stiefel auf eine Stelle.
Der Kurator und der Aufseher schauten auf den Stiefel. Eine Uhr schlug zwölf. Stronheim stand auf.
„Wenn Sie es erlauben,“ wandte er sich an Bernard, „werde ich in einer Stunde zurückkehren und suchen, bis ich sie gefunden habe. Verschließen Sie den Raum und ich werde jeden Quadratzentimeter sorgfältig durchsuchen. Ich habe um Viertel nach zwölf einen Termin im Konsulat, aber ich werde sofort zurückkehren.“
Der Aufseher brach in Lachen aus.
Der Kurator sah ihn streng an.
„Ungeheuerlich!“, sagte er. „Denken Sie, ich würde Ihnen erlauben, diesen Ort zu verlassen, bis die Münze gefunden ist? Hat es irgendeinen Sinn, diese Farce fortzuführen?“
Stronheim starrte ihn an. „Himmel!“ protestierte er, „verdächtigen Sie mich etwa, dass ich sie gestohlen habe?“
Bernard machte eine ungeduldige Bewegung.
„Die Münze muss gefunden werden, bevor Sie gehen,“ wiederholte er knapp.
„Und ich muss meinen Termin beim Konsul platzen lassen, Sir?“
„Zweifellos.“
Der Deutsche wischte sich hilflos über die Stirn.
„Was für ein Unglücksrabe bin ich doch“, murmelte er, „und gerade wo es so gut lief. Sir, ich beschwöre Sie – Sir, ich bin ein Mann von Rang und Bildung, ich versichere Ihnen ...“
Bernard unterbrach ihn.
„Ich habe keine Anklage gemacht. Ich verlange nur die Münze. Ein paar Minuten sind vergangen, seit Sie in Ihren Händen war. Wo ist sie jetzt?“
„Auf dem Boden, Sir, mit Sicherheit irgendwo auf dem Boden. Sie muss gefunden werden.“
„Mit Sicherheit“, antwortete mein Freund, „muss sie gefunden werden.“
Der Deutsche sank erneut auf Hände und Knie.
Die Kinder beobachteten ihn atemlos aus der Ferne. Auch sie ließen ihre Augen angestrengt über den Boden wandern. Diese Szene war für sie absolut interessant. Wonach suchte der Mann auf dem Boden so aufgeregt? Und würde er es finden? Und wenn er es nicht fand, was würde passieren? Dies war tausend Mal unterhaltsamer als alte Pennies und vermoderte Dinger in Glaskästen.
Der Deutsche stand wieder auf. „Ich habe versagt,“ gab er zu und breitete seine Hände in einer verzweifelten Geste aus. Er schaute zu dem durch Nebel verdunkelten Fenster. „Es gibt nur wenig Licht“, bemängelte er.
„Es wird meine unerfreuliche Pflicht sein, Sie zu durchsuchen“, sagte der Kurator, „es sei denn, die Münze käme augenblicklich zum Vorschein. Ich habe genug Zeit verschwendet.“
Dennoch schien der Mann ihm leidzutun, so wie mir. Er war offensichtlich eine kultivierte Person trotz seiner schlechten Verfassung.
Stronheim zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag erhalten. „Durchsuchen?“ wiederholte er mit hohler Stimme.
„Durchsuchen,“ wiederholte er überwältigt. Er stützte sich auf eine Ecke einer Kommode. Er keuchte, als ob er ein Rennen gelaufen wäre. Der Kurator beobachtete ihn. Warum sollte er sich von der Ankündigung, durchsucht zu werden, so bedroht fühlen, wenn er die Münze nicht hatte? Wenn er unschuldig wäre, würde er sicherlich der Untersuchung zustimmen. Man konnte nur einen Schluss daraus ziehen.
„Das ist unser routinemäßiges Vorgehen“, sagte er knapp.
Der Deutsche zitterte krampfhaft. Der Aufseher blickte ihn verächtlich an. Er schaute ungeduldig zu seinem Vorgesetzten. Was sollte das ganze Aufhebens? Warum übergab er ihn nicht einfach der Polizei? Er gewann die Aufmerksamkeit Bernards. Seine Lippen formten ein lautloses Wort. Bernard schüttelte seinen Kopf. Geb dem armen Teufel eine Chance, bedeutete er mitleidig, nur – sein Gesicht verhärtete sich – die Hierator musste gefunden werden.
Der Deutsche riss sich zusammen.
„Ich weigere mich durchsucht zu werden“, heulte er. Er wischte einen Schweißtropfen von seiner Stirn. „Ich weigere mich,“ wiederholte er.
„Warum sollte es Sie stören, wenn Sie unschuldig sind?“
„Warum es mich stören sollte? Es stört mich sehr. Es ist – es ist ...“ er suchte krampfhaft nach einer Ausrede – „Es ist eine Beleidigung. Sie beschuldigen mich, ein Dieb zu sein. Ich komme zu Ihnen als ein Gentleman zum anderen, Sir. Ich bringe einen Vorstellungsbrief von Professor von Brau ...“
„Ich habe keine Alternative“, antwortete der Kurator. Er hatte nun keinen Zweifel mehr an der Schuld des Anderen. Diese Angst vor der Durchsuchung überzeugte ihn mehr als alles andere.
„Ich werde nochmals suchen“, sagte Stronheim verzweifelt, instinktiv den Blick Richtung Tür werfend. Aber der Aufseher verstellte ihm ihn, indem er sich mit ein paar Schritten zwischen diese und den Verdächtigen stellte. Stronheim starrte ihn an, als er verstand. Er machte eine verzweifelte Geste. Dann nahm er einen Stift heraus und markierte eine noch größere Bodenfläche, als er bereits abgesucht hatte, und sein Taschentuch wie einen Staublappen wedelnd wischte er über jeden Quadartzentimeter des Bodens. Er fand nichts.
Kopfschüttelnd murmelte er: „Ich werde mich niemals durchsuchen lassen.“
Er zog eine Box mit Streichhölzern aus der Tasche und zündete ein halbes Dutzend an, dabei ließ er seinen Blick über die Regale wandern. Er fand immer noch nichts.
„Gott im Himmel!“, murmelte er wieder, „sie werden mich niemals durchsuchen.“
Er begann erneut, sein Messer durch die Fugen zu ziehen, diesmal noch weiter. Aber es kam nichts dabei heraus. Er wischte nochmals über den Boden ohne Ergebnis. Er setzte sich auf, bedeckte das Gesicht mit seinen Händen und stöhnte.
„Ich gebe auf,“ jammerte er. „Das Schicksal ist gegen mich. Da steckt der Teufel dahinter.“
„Werden Sie der Durchsuchung zustimmen?“
Er streckte die Handflächen aus. Seine Augen schienen aus seinem Kopf herauszutreten.
„Dann bin ich ein verlorener Mann“, rief er aus.
„Sie rücken besser die Münze heraus“, bemerkte Bernard ruhig.
„Ich habe sie nicht.“ Dennoch wanderte seine Hand instinktiv zu einer Innentasche.
„Wenn Sie nicht nachgeben, muss ich die Polizei rufen.“
Stronheim starrte stumpfsinnig vor sich. „Ich bin ein verlorener Mann“, murmelte er. Er schwankte plötzlich und fiel vornüber auf sein Gesicht. In der darauffolgenden Aufregung kamen die Kinder näher. Sie dachten, er sei tot. Das war in der Tat eine seltene Vormittags-Unterhaltung – einen Mann sterben zu sehen.
„Soll ich ihn ihm ausziehen, Sir?“, fragte der Aufseher, seine Hand am Mantel des Deutschen.
Der Kurator schüttelte den Kopf.
„Sie ist hier in seiner Brusttasche,“ drängte der Mann. „Ich kann sie durch die Kleidung fühlen.“
„Lassens sie es“, sagte der andere. „Machen Sie seinen Kragen auf und öffnen Sie das Fenster.“
Stronheim hatte gerade seine Lippen geöffnet und blinzelte dem Elend entgegen, das ihn in seiner Ohnmacht erwartete, als unter den Kindern eine Unruhe ausbrach.
„Er gehört mir.“
„Nein, ich hab ihn zuerst gesehen.“
„Oh! Du kleiner Lügner, ich sah ihn.“
„Aber ich habe ihn aufgehoben.“
„Gibt ihn mir!“
„Gib sie mir!“
„Ja, gib ihn ihm, er ist mein Bruder.“
Die Stimmen wuchsen zu einem Trubel an. Der Aufseher mischte sich zwischen die Disputanten ein. Zwei waren kurz davor, die Fäuste fliegen zu lassen. Der Mann klopfte ihnen mit seinem Stock auf die Hände.