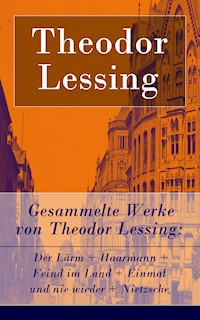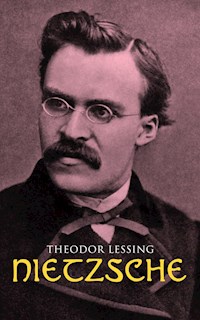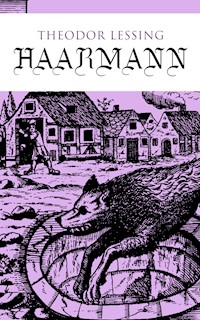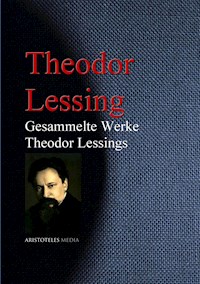Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Einmal und nie wieder: Lebenserinnerungen' wirft Theodor Lessing einen poetischen Blick auf sein Leben, seine Erfahrungen und die Zeit, in der er lebte. Der autobiografische Bericht ist geprägt von einer tiefgründigen Reflexion über das individuelle Dasein und die gesellschaftlichen Strukturen seiner Ära. Lessings literarischer Stil zeichnet sich durch eine klare und prägnante Sprache aus, die den Leser unmittelbar in die Gedankenwelt des Autors einführt. Mit einfühlsamen Worten beschreibt er sowohl die Höhen als auch die Tiefen seines Lebenswegs und schafft damit ein eindringliches Porträt seiner Zeit. Theodor Lessings Einflüsse aus der Philosophie und Literaturgeschichte prägen sein Werk und geben seinen Lebenserinnerungen eine einzigartige literarische Tiefe. Lessing, ein renommierter deutscher Schriftsteller und Philosoph, war bekannt für seine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und seine Suche nach der Wahrheit. In 'Einmal und nie wieder' zeigt er sich als reflektierter Beobachter seiner Zeit und reflektiert über existenzielle Fragen, die auch heute noch von Bedeutung sind. Diese eindrucksvollen Lebenserinnerungen sind ein Muss für jeden, der an literarischer Biografie und philosophischem Denken interessiert ist. Lessings kluge Einsichten und seine poetische Sprache machen dieses Buch zu einem zeitlosen Schatz, der den Leser tief berühren wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einmal und nie wieder: Lebenserinnerungen
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Inhaltsverzeichnis
Am Ende eines Lebens, das manche Länder gesehn, viel Menschliches durchdacht und viele Nöte, innere wie äußere, bestanden hat, am Ende eines tätigen Lebens, mit Narben bedeckt, wie kaum ein zweites, am Ende eines bewährten, erprobten Lebens also, darf ich schwerlich mehr erwarten, daß die Herausgabe von »Denkwürdigkeiten« am persönlichen Schicksal ihres Verfassers oder an den Vorurteilen der Mitwelt etwas ändern werde. Außer daß man vielleicht, mehr als schon zuvor, geneigt sein wird, einen unbequemen Zeitgenossen totzuschweigen und seine Schriften vorsichtiger zu tadeln, unverbindlicher zu loben, falls Lob und Tadel eben unvermeidlich würden.
Aber die Blätter dieses Buches sind nicht für Mitlebende und nicht in Hinblick auf die Gegenwart geschrieben worden. Sondern, wenn ich beim Schreiben je an Leser gedacht habe, so dachte ich an ferne Enkel und Urenkel oder an einen kleinen Kreis von Eingeweihten und Kennern. Wenig aber bekümmerte mich die sogenannte Weltgeschichte, dieser Totentanz der Machtwechselzufälle, dieser Ozean von Blut, Galle, Schweiß und Tränen und am wenigsten die unergründliche Dummheit der deutschen Zeitereignisse, von welchen ich so viele lehrreiche Proben miterlebt und vor Augen gehabt habe: Einen Bildersaal voll von Betrügern und Betrogenen, geltenden Strohpuppen, brüllenden Bullen, hohlen Nichtswissern. Überspannte unmenschliche Gesichter, die an mir, wie einst an den meinem Wege voranschreitenden Meistern, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, keine Vaterlandsschwärmer erzogen haben; haben wir uns doch zu oft schämen müssen, Deutsche zu sein.
Ich warf eine einsame Flaschenpost in das unermeßliche Dunkel. Und selbst wenn sie nicht diejenigen Seelen erreicht haben sollte, für welche sie bestimmt gewesen ist, so darf ich wenigstens mit dem Spruche mich getrösten, den ich meiner Jugend der geliebteste Lehrer mir auf den Weg gab:
»Was du dir selber in dir selbst gewesen, Das hat kein Buch gesagt, kein Freund gelesen.«
Indes auch dann, wenn mein Glaube ein Wahn gewesen sein sollte, der Glaube, daß in hundert Jahren eine neue Jugend auf meinen Spuren wandern und meine Schriften suchen wird, ja wenn meine gesamte geistige Nachlassenschaft spurlos dahinschwinden sollte (»Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen« – »Untergang der Erde am Geist« – »Wertaxiomatik« – »Philosophie als Tat« – »Naturtrilogie«) – nun! so wird das hier vorliegende Buch zum mindesten fortdauern als eine einzigartige Geschichtsquelle für das Leben erfolgreicherer Zeitgenossen: für die Frühzeit von Stefan George, Max Scheler, Georg Simmel, vor allem aber für den Werdegang von Ludwig Klages, dessen Jugendgeschichte ich mitschreiben mußte, wenn ich die meine schreiben wollte.
Wer je den Versuch gemacht hat, die wichtigsten Ereignisse seiner Tage zu Papier zu bringen, der muß mit Verwunderung entdecken, wie ungewiß, ja wie zweifelhaft alle Historik und Biographik ist, die nicht nur das Vergangene nach Lagen und Zuständen aus den Grüften hervorruft, sondern auch verwehte Worte neu tönen macht, ja sogar zu wissen scheint, ob zu jenen Worten von einst der Mond leuchtete oder die Sonne, ob die Amsel sang und welcher Wind die Rosenhecken durchwühlte; indes doch schon die einfache Selbstbeobachtung klar zeigt, daß wo immer wir erleiden und erleben, wir überhaupt nicht von Umwelt und Begleitumständen wissen, daß aber, indem wir beobachten und Wahrnehmungen feststellen, wir schon aus dem Element des Erlebens herausgetreten sind, weil ein Ergriffener nicht begreift und weil niemand zugleich sein kann die Harfe, darauf die Natur spielt und der Künstler, der die Harfe meistert. Ich habe diese Denkwürdigkeiten im Laufe von zwanzig Jahren (1912 bis 1932) dreimal vollständig neu geschrieben. Und habe dreimal sie vernichtet, immer in dem selben selbstquälerischen Zweifel, nicht unpersönlich, nicht redlich genug verfahren zu können. Sondern entweder übertreibend oder verschönernd oder zu verbittert oder zu eitel, zu feige, zu rachsüchtig, zu herzensträge, zu befangen ins Allzumenschliche. Ich habe immer wieder gezweifelt, ob ein Mensch je über sich selber klar und wahr, ja ob er auch nur wahrhaftig zu denken vermag. Denn die schönsten der uns bekannten Eigenlebensgeschichten, die des Plato, Xenophon, Augustinus, Dantes Vita Nuova, Goethes Wahrheit und Dichtung, Nietzsches Ecce Homo, Hebbels Tagebücher, Rousseaus Konfessionen, die Geständnisse August Strindbergs, Leo Trotzkis »Mein Leben« –, sind sie nicht allesamt Schöpfungen eines Mythos? Ja, wenn ich wirklich, wie es in der Gegenwart beliebt ist, schonungslos mich selber entblößen könnte, wäre das von Wert für mich oder für irgendwen? Ist es nicht wichtiger, Leben zu dichten als zu beichten?
Es war aber nicht nur die Scheu vor Selbstpreisgabe, was mich jahrelang schwanken ließ, ob ich recht daran täte, die allzu nahen Erinnerungen ganz oder teilweise fremden Blicken preiszugeben. Nein! Eine lästigere Zweifelsfrage war die folgende.
Hat der Schriftsteller das Recht, Herzen und Taten jener Personen zu entblößen, die seinem Leben schicksalsmäßig verbunden waren? Darf er in ein fremdes Bereich eingreifen, wo er unmöglich mehr gerecht sein kann?
Aber just dieses schmerzlichste aller Bedenken wurde entscheidend, ja wurde allein entscheidend für den Vorsatz, diese Blätter zu veröffentlichen. Schrecklicher nämlich konnte keine Vorstellung quälen, wie die folgende:
»Hier ist ein Schriftsteller, der nie einen Satz anonym veröffentlicht hat, keinen je, den er nicht Auge in Auge, Mensch zu Mensch voll zu vertreten den Wunsch und Willen hatte. Und nun nach seinem Tode erscheinen ›Erinnerungen‹ und erregen den Verdacht: dieser Mann will, nachdem er vom Schauplatz des Lebens abgetreten ist, doch noch Recht behalten, Schlappen schönfärben, Irrwege rechtfertigen, hat vor der Nachwelt sorgsam Staat gemacht, hat aus dem Grabe sich an denen gerächt, die ihn einst gequält oder verunrechtet haben.« – Nein! Ich will Gerichtstag halten über mich und ehrlich meine Überzeugung vertreten, so lange ich das noch kann. Will den natürlichen Rückschlag des Lebens leiden, so lange ich das noch muß.
Das erste Buch, welches der Zwanzigjährige 1892 in die Welt sandte, begann mit einigen kindlichen Versen, die ich an dieser Stelle noch einmal wiederholen will.
»Mein Deutschland, ob ich dich liebe, Die Worte sagen es nicht. Ersieh’s an meinem Liede, Am glühenden Zorngedicht.
Ersieh’s an meinen Witzen, Wahrhaftig, die Witze sind gut, Du lachst, du kannst es nicht ahnen: Ich schrieb mit Lebensblut.
Du bist mir Vater, Mutter, In dir nur wurzelt mein Sein, Wärs mir nicht so ernst, hochheilig, Es könnte so schmerzlich nicht sein.
Denn meines Hassens Pfeile Und meiner Liebe Schaft, Beflügelt ein einziger Glaube: Der Glaube an deine Kraft.
Bluternst ist in meiner Seele Die Flamme der Muse entbrannt. O mein Deutschland, heiliges Deutschland, Ich liebe dich, Heimatland.«
Viele Enttäuschung mußte erlitten werden, ehe diese einfache Liebe erschüttert wurde und Platz machte dem mich heute ganz erfüllenden Ekel vor deutscher Geistigkeit und ihren Führern. Immer schwerer wurde die Last auf den Flügeln; immer seltener der freie Flug. Für die schönen Traumeinblendungen unsrer Jugend tauschten wir ein graues Wissen um graue Wirklichkeit. Für das Traumgold der Phantasie die harten Groschen der Erfahrung. Das letzte Ergebnis aber blieb wie das erste: Alle Worte, Werte und Werke der Menschheit sind wie der Geist selber: Lebenswunde und -genesung in eins. Die Menschen, vor allen andern die Deutschen, hassen den Geist. Sie fühlen, daß er durchaus nur ist: Notausgang einer Hemmung oder Schwächung ihres Lebens. Eines aber wissen sie nicht: »Geist allein kann, wie Achilleus Lanze, die Wunde, die er verursacht, schließen und heilen.«
Im ersten Jahre des Krieges, 1914, diente ich als Arzt in einem Erholungsheim für Offiziere, welches die Bestimmung hatte, hochgeborene und hochgestellte Persönlichkeiten aufzunehmen, die an der Kriegsfront Torheiten begingen, Vorrechte mißbrauchten, Untergebene quälten, aber infolge ihrer bevorzugten Stellung nicht unschädlich gemacht werden konnten. Man beurlaubte sie in diese Erholungsheime. Es waren Narrenhäuser.
In jedem Bett prahlte ein erlauchter Narr, verteilte Reiche, erlöste Volk, verbesserte Menschheit. Nichts hatten sie durchdacht und erblutet, und ihre »Weltanschauung« ließ sich glatt auf die Formel bringen: »Im Frieden großes Maul, im Kriege starke Faust«. Die ganze Welt schien solch ein Narrenhaus geworden zu sein. Dennoch klappte alles vorzüglich. Darum nämlich, weil die unüberbietbar fühllose Sachlichkeit des militärischen Mechanismus all unsern vaterländischen Helden und sogenannt starken Persönlichkeiten glücklicherweise das Denken abnahm. Unsre Tage regelten sich zwangsläufig. Man brauchte nur einen Hebel zu ziehn oder auf einen Knopf zu drücken.
Damals verfestigte sich in mir die folgende letzte Erkenntnis:
»Alles kommt darauf an, in einem Reich erhabener menschlicher Narrheiten solche Sicherungen zu schaffen, welche, der Willkür der Person entzogen, dafür sorgen, daß kein Mensch fürder an dem andern, keiner an sich selbst Schaden anrichtet.«
Längst ist die Gemeinschaft mit den Dämonen zersprengt. Längst meistern und martern einander tausend hochgesteigerte Willkürwillen. Längst ist die Gemeinschaft der Natur amortisiert. Längst martern und meistern einander zahllose selbstgerechte Individualmächte. Die Sicherheit im Unbewußten ist dahin. Wie kann man die Dauben schlagen, ehe das Faß auseinanderfällt?
Die Sphäre der Mathesis, der eherne Fels der Logik und Ethik, ist uns Richte und Pol. Wir erobern sie Schritt um Schritt gemäß der wachsenden Bedrängnis. Denn aller Wert, alles Werk ist Ausgleich.
Anders gesagt: Die Gemeinschaft, je mehr sie zerstückelt, vereinheitet sich als Gesellschaft. Die Nationen retten sich in den übernationalen Staat. Den Reichtum der Landschaften verbürgt die Einerleiheit in Recht und Wirtschaft. Je bindender der Oberbau, um so gelöster mag die Seele schalten. Je anarchischer die Seele, umso rationaler die Maschine.
So bin ich Vorkämpfer für die Genien der Menschheit, weil ich die Dämonen liebe. Die Menschheit wird in Urtiefen, religiöse und völkische, elend versinken, wird wechselweis einander zerfleischen, wenn nicht der alles bindende und schützende Bau des übernationalen Geistes sie vor sich selber rettet. Die Ordnung der Natur ist gestört. Sie kann nur noch gerettet werden durch die »Ordnung Gottes«. Seele nur durch Geist.
Kommunist bin ich und Rationalist geworden kraft des Individualismus. Dank anarchischer und liberaler Zielbilder: Diktator der Vernunft. Es hat eine dichterische Begabung mich zum Logiker, romantische Stimmung zum Sozialisten gemacht. Und ein tiefes Wissen um Politik und Geschichte hat mich mit der Gewißheit erfüllt, daß eben nur Politik von Politik, nur die Geschichte von Geschichte, das heißt von aller Willkür und Zufälligkeit des Nur-Persönlichen, uns erlöst. Ich habe der Meduse furchtlos in die Augen geblickt, der Grauen erregenden Mutter der Dämonen, welcher Theseus, der Geistgott, das Haupt vom Rumpfe schlug, damit aus ihrem dunklen Blute das helle Flügelpferd Pegasus entspränge.
Ich weiß darum, daß diese Erinnerungen nicht nur eigenpersönliche, sondern allgemein gültige Bedeutung haben. Denn es besteht das köstliche Wunder, daß, wer in den innersten Punkt des nur persönlichen, nur einmaligen Gewissens vordringt, damit auch das Allgemeine, Ewiggültige erreicht.
Erstes Buch Vorwelt
Inhaltsverzeichnis
»Und mein Teil ist mehr Als dieses Lebens schlanke Flamme.«
1. Hannover
Inhaltsverzeichnis
»Meine Heimat ist ein düster wolkenverhangenes Land. Dort blüht die Heide, die Birke weht an der Felder nebligem Rand. Zäh ist die Birke, im steinigten Fels sie noch Wurzel faßt, Aber sie trägt das lieblichste Laub und im Frühling den zartesten Bast.«
Zu der Zeit, wo wir als Knaben in ihren Gassen spielten, war die Stadt Hannover eine der freundlichsten Residenzen im deutschen Staatenbunde. Die Stadt, zwischen Wäldern am Flusse Leine, einem Nebenflusse der Aller gelegen, hatte um 1880 etwa achtzigtausend Einwohner, deren Mehrzahl immer noch halb bäurisch lebte. Sie wohnten in Wiesen und Gärten auf einer weiten Feldmark, und die mit dem Kopfe arbeiteten, die Bürger und besonders die sogenannten hübschen Familien bezeichneten die Ackerbauern als »unsre Gartenkosaken« oder wie man gerne sagte als die »Pisen«.
Die Dörfer der Umgebung wie Hainholz, Limmer (wo der grobe Jakobus Sackmann predigte), Vahrenwald, Döhren, Riklingen, List, heute kohlenstaubumwehte, von mühereichen Arbeitsmenschen übervölkerte Industrieviertel, waren damals noch einsam verträumte Waldflecken. Die Altstadt aber, am »Hohen Ufer« der Leine, wonach angeblich die Stadt ihren plattdeutschen Namen Hohenowere erhalten haben soll, schlief, von den alten Wällen umschirmt, mit vielen Türmen hinter vielen Toren.
Die wichtigsten dieser alten Tore waren das Leintor, das Steintor und das Tor des heiligen Aegidius, welcher Heilige in der katholischen Zeit vor der Einführung der Reformation (1533) Schutzpatron war für alle norddeutschen Städte. In Gefahren und Nöten beteten die Bürger zum Stadtheiligen: »O Aegidi, Aegidi«, woran noch heute erinnert ein nur den Hannoveranern eigentümlicher Ausruf beim Anblick feindlicher Dinge: »Gitte gitte«.
Wahrzeichen und Mittelpunkt der Stadt war der Turm der um 1350 vollendeten Marktkirche, aufragend mit breitem Giebelreiter neben dem aus hellen Klinkern und glasierten Ziegeln gebauten backsteingotischen Rathaus.
Um die Stadt im weiten Bogen grünte der dichte Ring von Busch und Wald, genannt die Eilenriede, ursprünglich wohl das Ellern-Ried. Noch heute sind das an dreitausend Morgen Eichen-und Buchen-Bestand. Von drei Seiten wuchs der Wald bis in die Gassen der Stadt und ließ nur an der vierten Seite, nach Süden zu, eine Ebene offen, die sogenannte Masch, ein wasserreiches Wiesen-Flachland, in welchem drei Wasserläufe, von den Harzbergen kommend, genannt Leine, Ihme und Ohe, sich begegnen und an deren blauen Randsäumen Waldhänge und baumreiche Hügel sichtbar werden, genannt der Deister, wohl von Dixter, das heißt Dichtwald.
Die Stammesherzöge der Niedersachsen pflegten von diesem fruchtbaren Gelände zu sagen: »Das Land zwischen Deister und Leine, das ist’s was ich liebe und meine«. Andrerseits aber ging auch das Sprichwort: »Je näger de Deister, um so gröter de Beister«.
Die entferntere Umgebung der Stadt nach Berlin, Köln, Bremen und Hamburg hin, ist keineswegs so anmutig-lieblich wie das waldige Leinetal. Die Landschaft gleitet über in eine ruhige Tiefebene, eine blaurote sandige Heide, welche sich bis zur Küste der Nordsee hinabzieht. Die schwermütigste Landschaft in Deutschland.
In meiner Jugend wurde das Gebiet zwischen Braunschweig, Celle und Lüneburg vielfach ausgeödet und vernutzt durch Hüttenwerke, Kalischächte und Industrieanlagen. Aber wenige Orte dürften so rasch eine ähnlich schlimme Wandlung erfahren haben, wie ich sie in fünfzig Jahren an meiner Heimatstadt beobachten konnte. In meiner Kindheit war sie eine sauberfeine, wenn auch nüchterne Kleinstadt voll bürgerlicher Tüchtigkeit. In meinem Alter: eine lärmerfüllte, von geschäftigen Ameisen wimmelnde Anhäufung profaner Häuser voller Händlertum, Beamtengeist und erfüllt mit der Notdurft harter Arbeit, unjung und die fahlste unsrer Städte.
In der Kindheit meines Vaters dürfte das grüne Nest der Welfen ausgesehen haben so, wie es von Karl Philipp Moritz in seinem Jugendroman »Anton Reiser« geschildert worden ist, ein Städtchen im Busch, mit mancherlei Getier wie Marder, Biber, Luchs und Fuchs und durchsungen von vielen heute ausgestorbenen Vogelarten. Zählte doch der Vogelkenner Paul Leverkühn schon im Jahre 1880 im Bezirk des Arnswaldtschen Gartens, einem Quartier, in welchem heute nur Sperlinge zirpen, zwanzig Singvogelarten, die während unsrer Jugend verschwanden.
Noch zeigen kleine Nachbarstädte: Hameln, Goslar, Göttingen, Hildesheim, Bückeburg jenes gute altertümliche Antlitz. Aber das Wilhelminische Zeitalter verwischte das altväterische Gesicht mit der seelenarmen Gleichförmigkeit der Industrie. Die Bauart, der Lebensstil und sogar die Gesichtszüge der Menschen wurden gleichartig, und die Steine, welche alte Landesgeschichte erzählen, sind allmählich zerbröckelt.
In meine Frühzeit ragte die Überlieferung der welfischen Geschichte. Unter den Bewohnern, die einander kannten, bestand eine Stammesgemeinschaft und fand ihre Symbolik in den Schicksalen des welfischen Herrscherhauses. Und da die Könige von Hannover auch Könige von England waren, so liefen manche Fäden hinüber nach Großbritannien, zumal zur Weltstadt London. »Dem Reisenden« – (so steht es geschrieben in den »Briefen eines in Deutschland reisenden Deutschen«) – »erschien um 1800 die Stadt Hannover fast wie eine britische Kolonie«, denn auf den Schulen waren viele Engländer, weil die Märe ging, daß man in Hannover das reinste und beste Deutsch spräche, und manche Stadtteile, besonders die neuere Calenberger Vorstadt, in welcher die drei bedeutendsten Schriftsteller Leisewitz, Detmold und Feder wohnten, erinnerten an Altlondon, an das Reich Georg des Ersten, Zweiten und Dritten.
Herrenhausen, die Sommerresidenz dieser drei Könige, war auch die Residenz meiner Kindheitsträume. Nahe dem nach dem Muster von Versailles im Stile Le Nôtres angelegten Heckengarten, einem barocken Park voller Wasserkünste, steifer Taxuswände und Berninischer Statuen, zwischen denen Leibnitz den Hofherren in Allongeperücken und den Hofdamen in Reifröcken Vorträge gehalten hat über die »Vortrefflichkeit der Welt«, nahe diesem höfischen Garten stand ein behäbiges Bauernhaus, daran meine ersten Erinnerungen geknüpft sind. Die immer herabgelassenen, geheimnisvoll blauen Rolläden des Schlosses, der Marstall mit den berühmten apfelfarbenen Isabellen, der vergoldete Prunkwagen, das Mausoleum des Königs Ernst August, neben dem ein Bienenstand sich befand, an welchem vorbeizugehen mir verboten war, die Azaleen und Rhododendren im »Paradiese« des Berggartens, das alles hat in die ersten Träume meiner Kindheit eingewirkt.
Es gab noch manche Spuren der alten Kultur, gegen welche die späteren Häufungen von Bauten, Tafelbildern und Denkmalen in der Zeit nach 1870, unter der Herrschaft Preußens, nur leer anmuten. Da hingen an vergessenen Stätten einzelne Gemälde von Lawrence, Gainsborough, vom jüngeren Holbein. Da gab es auf verwilderten Friedhöfen wunderschöne Merkwürdigkeiten. Das Grab Alis, des riesigen Türken und das der »vornehmen Dame, die an zu enger Schnürbrust verstarb«, sowie das berühmte Grab auf dem Gartenkirchhofe, das durch ein Birkenbäumchen geöffnete Grab, an dessen schwerem vom Baum emporgehobenen Steine die Inschrift stand: »Dieses auf ewig gekaufte Grab darf nie geöffnet werden«. Dicht daneben das Grab der Lotte Kaestner, »Goethes Lotte«. Dann auf dem Nikolaikirchhofe neben der Kreuzkirche, im Dorfe Wilkenburg und sonst noch mancherorts Epitaphe von Jeremias Sütel und Peter Köster. Damals war noch die ganze Altstadt an der Leine, Kleinvenedig genannt, ein blumen-und epheuumranktes Mittelalter, gleich Hildesheim und Braunschweig. Und mit den Blumen rankte Legende an den Steinen empor. Ich wußte, ich weiß noch heute, wer vor hundert Jahren in diesen Häusern gelebt hat; ich fühlte mich einverwoben in mein Volk.
Aber als ich nun heranwuchs und begann, über mich und meine Umwelt zu denken, da begann auch der schmerzhafte Vorgang des Entfremdens, und ich erkannte schon in jungen Jahren, daß viele frische Quellen des Geistes und des Gemütes gleich der meinen in Land und Stadt Hannover aufgesprudelt waren, ohne daß der schwere breite Menschenschlag je den Wunsch gehabt hätte, aus all den herrlichen Quellen zu trinken. Und so erschien dem Heranreifenden die Heimat wie eine fest geschlossene, ja feindlich geballte Faust, welche sich niemals öffnen würde, weder um mütterlich zu schenken noch auch nur, um von ihrem gebewilligsten Sohne eine Gabe zu nehmen.
Viele gleich mir hatten hier geatmet, Künstler, Denker und Gelehrte, – ich ging sehnsüchtig ihren Spuren nach –, aber immer lebten sie in Hannover ungekannt oder zufällig. Es war nicht recht begreiflich, warum sie gerade in dieser Landschaft wurzeln mußten, warum sie nicht allenfalls auch eine andere schöne Stadt Deutschlands sich zum Wirkungskreis hätten auswählen können. Das breite Volk ließ sich seine Denker und Dichter eben nur gefallen, so wie die wechselnden Regierungsbeamten oder wie die anbefohlenen Garnison-Kommandeure. Hier war gut hausen für alte verdiente Generale: Scharnhorst, Caprivi, Waldersee, Hindenburg oder für die politischen Größen: Justus Möser, Stüve, Windthorst, Bennigsen, Miquel und Karl Peters. Aber die Singvögel blieben einen Sommer lang, dann entflohn sie vor den herben Schlehen.
Die stumpfe Gleichgültigkeit der niedersächsischen Bevölkerung gegen den Geist trat besonders zu Tage am Leben der beiden stärksten Genien, die in Hannover das Bildungswesen zu organisieren versuchten: Albrecht von Haller und Gottfried Wilhelm Leibniz.
Hätte nicht eine Provinz, welche geistige Größe zu nützen weiß, einem Manne gleich Haller, der die Anatomie, Physiologie und Biologie von heute begründete, jede Hilfe gewähren, jede Erleichterung schaffen müssen? Statt dessen ließ man ihn ziehen, wie denn eigentlich alle Geister von höherem Range nur vorübergehend im hannoverschen Lande gelebt haben und es wieder verließen, wenn anderswo sich die bessere Wirkungsmöglichkeit bot. In den Gedichten des alten Johann Heinrich Voss fand ich merkwürdige Strophen, die von einem Besuche Vossens in Hannover, ich glaube im Jahre 1780, erzählen. Er kommt aus dem Lande Hadeln. Er nennt die Stadt Hannover »die Stadt der feineren Cherusker«. Er kommt zugereist mit dem Wunsche, das Grab Leibnizens zu besuchen, als das Grab des größten Genius, der in Hannover gewirkt hat. Der war im Jahre 1716 verstorben. Und nun erlebt Voss, gleich dem Cicero, der vergeblich nach dem Grab des Archimedes fragt, daß in vierundsechzig seither verstrichenen Jahren der Philosoph und sein Grab vollständig vergessen waren. Kein Mensch in Hannover kann ihm über Leibniz berichten. Schließlich verweist man ihn an einen neunzig Jahre alten Juden, welcher den Leibniz noch persönlich gekannt habe. Das war der Mathematiker Rafael Levy. Der führt Voss in die Neustädter Kirche zu einer Stelle, an der man hundert Jahre später in der Tat die Reste Leibnizens gefunden hat und welche heute gekennzeichnet ist durch einen Stein mit der Inschrift: »Ossa Leibnizii«. Es ist mir gelungen, das Grab dieses Mathematikers Levy zu finden. Es befindet sich auf dem Bergfriedhofe der Juden an der Christuskirche. Er war Lehrling im Bankhause meines Großonkels Simon und wurde durch einen Zufall mit Leibniz bekannt. Als Leibniz auf seinem Morgenspaziergang an einem Neubau vorüberkam (es war das Eckhaus am Postkamp nahe dem Klagesmarkte), da fiel ihm ein Knabe auf, der sich mit den Maurern herumstritt und geometrische Figuren in den Sand zeichnete. Leibniz blieb stehen und hörte, daß der Jüngling den Maurern einen statischen Fehler nachwies, wobei er ein sicheres geometrisches Wissen zeigte. Der Philosoph erkundigte sich nach dem Namen des jungen Menschen, und da er hörte, daß er ein Banklehrling sei, so ging er alsbald zu dessen Chef und erbot sich, den begabten Lehrling in Mathematik zu unterrichten. Er fand an diesem Schüler so viel Gefallen, daß er ihn schließlich zu sich nahm in das große Haus an der Schmiedestraße, welches heute das sehenswürdigste Gebäude der Stadt ist, über dessen schönem Renaissance-Portal ein einziges stolzes Wort prangt: »Posteritati«. Dort blieb Levy bis zum Tode Leibnizens. Der hatte die Gunst des Hofes verloren. Dem Volke war er immer fremd geblieben. Das Volk sah in ihm den leibhaftigen »Gottseibeiuns« und nannte ihn den Herrn von Glöbenix. Er starb völlig vereinsamt. In seinem letzten Lebensjahre arbeitete er mit Levy an der Erfindung einer Rechenmaschine. Levy war der einzige, der bei dem sterbenden Leibniz weilte und ihn zu Grabe trug, so wie im benachbarten Braunschweig auch der unwürdig gestellte Gotthold Ephraim in den Armen eines Juden starb. Es war recht komisch, als man um 1890 in Hannover entdeckte, daß man zwar nach Leibniz eine Straße, einen Platz und eine Keksfabrik benannt und ihm ein Denkmal errichtet, aber seinen Namen fälschlich »Leibnitz« geschrieben habe. Um jene Zeit wurde der Sarg Leibnizens in der Gruft unter der Neustädter Kirche herausgefunden, und zwar war er kenntlich durch blaue Farbe und an dem Bilde einer Spirale, welches ihm aufgemalt war. Was bedeutet die Spirale? Ich habe dafür die folgende Erklärung. Sie war für Leibniz das Symbol des Entstehens und Vergehens (evolutio und involutio), indem, je nach dem Standpunkt der Betrachtung, sie gleichzeitig uns vor Augen bringt das aus unsichtbarem Punkte, der »Monade«, herausrollende und das aus seiner Entfaltung im Räume wieder ins mütterliche Dunkel zurückrollende Leben. Die Stadt Hannover ist ein wichtiger Knoten-und Durchgangs-Punkt im deutschen Reiche. Jeder Deutsche ist wohl einmal durch Hannover gereist. Viele haben für kurze oder lange Zeit hier Aufenthalt genommen, aber nur wenige haben zwischen den nüchternen Rübenfeldern gleich mir ein langes Leben verbracht.
Daß in Hannover die beiden Brüder Friedrich und August Wilhelm Schlegel geboren wurden und mithin die deutsche Romantik hier ihr Mutterhaus hatte, übrigens das ödeste Haus der Stadt, daß der Dramatiker Leisewitz, der Dramaturg Klingemann, der Schauspieler Iffland, die Theatermaler Ramberg, Pape, Gay, die Dichter Grabbe und Griepenkerl, die Sänger Niemann und Schott, die Schauspieler Devrient und Grunert hier oder in der nahen Umgebung gelebt haben und mithin die deutsche Theatergeschichte in Hannover einen Mittelpunkt hat, all das ist ebenso zufällig, wie es Zufall ist, daß in meinen Tagen die Dichter Frank Wedekind, Otto Erich Hartleben, Karl Henckell, Börries v. Münchhausen, Wilhelm Meyer-Förster in Hannover geboren wurden und die selbe schreckliche Schule wie ich besucht haben. Und Zufall ist es, daß Händel, Spohr, Brahms, Joseph Joachim, Hans von Bülow mehrere Jahre und daß Heinrich Marschner fast sein Leben lang in Hannover Musik machten. Und Zufall ist es, daß die besten deutschen Meister, Arnold Böcklin und Anselm Feuerbach während eines schlimmen Jahres, und daß die Koken, Oesterley, Breling und Kaulbach, die Rechberg und Ramberg, daß Otto Gleichmann, der Meister der Angst, während ihres ganzen Lebens in Hannover Bilder malten. Und Zufall ist es, daß Emil Edel, ein liebenswerter Lyriker, daß Otto Kugelmann, der Freund von Karl Marx, daß Bruno und Edgar Baur, die Philosophen, daß August Niemann, zu Unrecht vergessen, daß Friedrich Spielhagen und Georg von Ompteda, Julius Rodenberg, Franz Dingelstedt, daß Gustav Kastropp, der Epiker, daß die Schriftstellerinnen Golo Raimund, Leo Hildeck, Emilie Vely, Klara Eysell, daß der enthusiastische Eugen Kühnemann, die edle Heloise v. Beaulieu aus Hannover kommen oder in Hannover gelebt haben, daß die Tänzerin Mary Wigman, die Schauspielerin Lucie Höflich, der geniale Musiker Walter Gieseking aus Hannover kommen. Keiner, keine, selbst nicht die Heimatdichter Wilhelm Raabe, Wilhelm Busch, Hermann Löns fühlten sich ganz hierhergehörig. Lichtenberg, der klügste unter allen, klagte ewig über seines Geistes Vereinsamung. Bürger, der genialische unter allen, litt tiefe Einsamkeit. Zimmermann schrieb sein schmerzlich schönes Buch über die Einsamkeit. Sogar die vielen kleinen Sterne: Kaestner, der lieber in Italien weilte, Brandes, Knigge, Mädler, der verdienstvolle Pertz, der mutige Oppermann funkelten nur verloren im Dunkel. Wie aber kann man die Geschichte der Landschaft anders in sich aufnehmen, als dadurch, daß man teilhat an dem Leben der wenigen, in denen sie Sprache gewann und welche die Kunde ihrer Erdenpilgerschaft hinterlassen in Dichtungen, Bildern, Musik oder Werken des Denkens?
Indem ich der Hinterlassenschaft solcher Männer und Frauen freudig nachging, wo immer ich konnte als der Hinterlassenschaft von meinesgleichen, da sah ich, daß so viele in Hannover zu meinem eigenen Schicksale verdammt waren: gar nicht gebraucht und schon bei Lebzeiten kaltgestellt und übergangen zu sein. In diesem nordischen Hain schlug die Frühnachtigall der deutschen Lyrik, Christoph Hölty; aber als man lange nach seinem Tode dem in Krankheit und Not Umgekommenen schließlich ein Denkmal zu errichten beschloß, da wußte niemand, wo das Grab des Frühvollendeten zu suchen sei. Vergebens war ich bemüht, eine Spur des 1821 im hohen Alter in Hannover verstorbenen, einst weit bekannten Philosophen Johann Gottfried Feder aufzufinden; er hat originelle Aufzeichnungen aus dem alten Hannover hinterlassen, zum Beispiel ein Gedicht in lateinischen Hexametern auf den Georgengarten, welcher damals der Walmodensche Garten hieß. Aber alle und alles wurde vergessen.
Vergebens war ich bemüht, eine Spur der Mathematikerfamilie Herschel zu finden. Obwohl von der genialen Karoline ein Straßenname und eine Gedenktafel zeugen, hat doch niemand je ihrem Leben nachgefragt. Und so erging es mancheinem, mancheiner.
Man scheint in meiner Heimat anzunehmen, es sei etwas getan, wenn man alles schöpferische Leben ehrenhalber, schandenhalber, wahllos und ohne Unterscheidungsvermögen in die Lexika der Bildung und in die Lehrbücher des Wissens hineinstopft, eine Straße nach ihnen benennt, ein von keinem gelesenes Täfelchen zuguterletzt doch anhaftet an Geburtshaus oder Sterbehaus, und, wie sie zu Lebzeiten Steine des Anstoßes waren, auch nach dem Tode steinerne Verkehrshindernisse aus ihnen macht oder Lehrbuchparagraphen. Das ist die selbe Art Schuld-Entlastung, wie wenn man nach Verbrechen, an denen die Gemeinschaft eine Mitschuld trägt, ein Sühnekapellchen stiftet.
Mein Leben ist nun freilich keineswegs das des Baumes in der Wüste, der Blume im Abgrund gewesen, aber es war – und das ist vielleicht bitterer – das Leben eines Musikschöpfers, der sich mit Geben von Klavierstunden verbraucht oder das eines Malers, der immer nach monumentalen Wänden begehrt und dem man bestenfalls den Auftrag gibt, die heimatlichen Zäune zu streichen.
Ludwig Klages, Albrecht Schäffer, mit mir in Hannover aufgewachsen, waren klug und flogen frühzeitig davon, aber mein Schicksal war es, bleiben zu müssen, wo meine Gräber waren. Mit dem tüchtigsten Maler, der mit mir in Hannover aufwuchs, Ernst Oppler, tauschte ich kurz vor seinem Tode Erinnerungen und wir fanden für unsre Stadt die folgende Formel: »Sie ist ein Paradies der Mittelstädte, des Mittelstandes, der Bemittelten und jeder Mittelmäßigkeit«.
Herder, Karl Philipp Moritz und Hamann, heute als drei der wichtigsten Deutschen geltend, haben zu ihren Lebzeiten alle drei sich beim Magistrate der Stadt beworben um die Stelle des – Schuldirektors am städtischen Gymnasium, dem selben, auf welchem ich zwölf furchtbare Jahre erlitten habe und sind alle drei vom Oberbürgermeister und Senat »abschlägig beschieden worden«. Solcher Tatbestand sollte in der Geschichte einer deutschen Stadt nie vergessen werden.
In meinen Anlagen seßhaft und auf Treue gestellt, erwuchs ich aus einer Scholle, die sich mir versagt hat. Ich haßte die mit Träne und Bitternis von früh auf gesättigte Erde, an die ich doch mit der Wurzel verhaftet blieb. Und so wurde mein Verhängnis, daß so oft und so weit auch ich zu entfliehen suchte, ich immer wieder auf einem Umwege, und meist mir selber unbewußt, an der Küste meiner Jugend gelandet bin, ja sogar in dem selben Bezirke, in den selben nüchternen Straßen, so daß eigentlich mein Leben in der Südstadt Hannovers vergangen ist in der Hildesheimer Straße, Stolzestraße, in Kirchrode, in Anderten, immer in den »Elendsbezirken« der Stadt, dort, wo die Blinden, die Verwahrlosten, die Krüppel, die Kranken und die Alten hausen, wo die Tiere geschlachtet und die Kinder gebessert werden, dort, wo die von drei Seiten mit Wald umgrenzte Stadt einen Blick ins Weite und Ferne zuläßt. Dort saß ich ein halbes Jahrhundert, immer voll Fernweh, immer auf eine Berufung, einen Widerhall, eine Lehrkanzel und zuletzt, bescheidener geworden, auf ein heldenhaftes Ende hoffend, immer weiter an den Rand der Stadt gedrückt, aber doch in dem Bannkreise festgehalten, darin ich geboren und hundertmal gestorben bin, ein Nichtangenommener, berufen aber nicht auserwählt, ein Nichtdazugehörender, obwohl die Steine der Stadt nur für mich gelebt haben.
2. Ahnen
Inhaltsverzeichnis
»Denn ich bin vom Stamm, der schon lang seine Früchte getragen, Wir glühten einst groß, doch verglühten zu windig bewegt, Verkannte Wandrer, an Ufer der Fremde verschlagen, Und auch nicht ein Schüler bleibt, der unsre Gräber pflegt.«
Der Mädchenname meiner Mutter, Adele Ahrweiler, deutet auf eine freundliche Kreisstadt an der Ahr, weithin bekannt durch fröhlichen Weinbau. Ein Zweig der Familie nannte sich Bleichert. So heißt ein hellrötlicher Wein, der auf steilen Schieferbergen im Ahrtale reift.
Es waren kleine Leute an Rhein und Main; sie fristeten ihr Leben mit Ackerwirtschaft, so weit die den Juden gestattet war, und mit Korn-, Vieh-oder Weinhandel. Es ist wenig über diese Vorfahren in Erfahrung zu bringen, weil erst um 1800, auf Verfügung Napoleons, die Juden in den Rheinlanden Familiennamen erhielten; bis dahin führten sie hebräische Namen.
Die Gemeinden am Rhein und Main waren alt. In Köln und Trier, sicher aber in Worms und Mainz, saßen schon zur Römerzeit Juden. Die Häuser des Ghetto trugen Bilder und Abzeichen, wie Schiff und Kahn, Wolf und Bär, Traube und Spieß. In vielen Fällen wurde der durch ein Schild kenntlich gemachte Name des Hauses einfach auf die Familien übertragen, welche das Haus bewohnten, und so bekamen sie denn Namen wie Gans, Hirsch, Lamm, Fuchs, Ochs und Kuh. In andern Fällen wählte die Familie den Namen des Ortes, wo die Voreltern begraben lagen und woher sie stammten.
Als meine Urgroßeltern den Namen Ahrweiler annahmen, da wohnten sie bereits im benachbarten Koblenz; dort betrieben sie um 1800 eine Metzgerei, welche nachweislich durch drei Generationen in der selben Familie blieb. Das Handwerk des Schlächters, des rituellen Schlächters, konnte in den alten Gemeinden nur von strenggläubigen Männern ausgeübt werden. Daher ist wohl anzunehmen, daß diese Vorfahren fromme Leute gewesen sind, obwohl schon mein Großvater, welcher reich geworden als Bankherr in Düsseldorf lebte, nicht mehr der jüdischen Gemeinde angehörte. Zur Zeit meiner Geburt (1872) lebte noch der Vater des Großvaters als Metzger in Koblenz, ein bäurischer Mann, der weder schreiben noch lesen konnte und das Vieh eigenhändig auf die Märkte trieb. Wenn ich recht berichtet bin, so hatte er vierzehn Kinder, von denen mein Großvater Leopold das letztgeborene war. Gekannt habe ich von den vielen Kindern nur eine Großtante, welche, unverheiratet und hochbetagt, im Hause des Großvaters wohnte. Gehört habe ich von dem ältesten Bruder, welcher als einziger von den Kindern bessere Bildung erhielt, als Badearzt in Neuenahr und Kreuznach wirkte und 1860 als Medizinalrat verstorben ist. Mein Großvater wünschte zu studieren, aber weil der älteste Bruder zum Studium bestimmt ward, mußten die andern Söhne minder kostspielige Berufe ergreifen. Der Großvater erlernte das Bankfach; zwanzig Jahre alt wurde er in Düsseldorf Buchhalter in der Bankfirma Gebrüder Wolf, welche in der Bolkerstraße 53 unterstandete; meine Mutter und Heinrich Heine wurden im gleichen Hause geboren.
Zu Anfang seiner Zwanzigerjahre war der Großvater ein hoch aufgeschossener hagerer Jüngling mit stark knochigen Gesichtszügen, großer energisch vorspringender Nase, weichem bräunlichen Haar und schwärmerischen, braunen Augen. Da er anfällig auf der Brust war, so verbrachte er viele Sommer in Davos. Er war eine wunderliche Mischung von Schwärmer und Rechner, ein nüchterner Geschäftsmann, aber insgeheim weich und begeisterungsfähig. Sein Leben war reich an Glücksfällen. Der Inhaber des Geschäfts, in dem er arbeitete, war ein betagter Hagestolz, dem eine etwa vierzigjährige Nichte die Wirtschaft führte, ein unschönes, derbes, schon verblühendes Mädchen, namens Sophie Meyer. Sie verliebte sich in den um zwanzig Jahre jüngeren Buchhalter, woraus, wie die erhaltenen Briefe bezeugen, ein gefühlsseliges Verhältnis sich entspann; sie schrieben einander Briefe im Stile des »Werther« über Naturfreuden, gelesene Bücher, bescheidene Reisen, und der Großvater, der ein nicht unbedeutendes dichterisches Talent hatte, schickte seiner Gönnerin Gedichte und kleine Dramen. Da der Onkel Wolf die Heirat seiner Nichte mit dem Buchhalter nicht erlauben wollte, so floh schließlich das tatkräftige Mädchen mit dem jungen Manne nach Schottland, wo man damals unschwer die bürgerliche Trauung erlangen konnte. Sie wurden getraut von dem bekannten Schmied in Greetna Green, und der zürnende Onkel mußte sich drein ergeben. Er soll froh gewesen sein, als die Ausreißer, ohne die er nicht leben mochte, wieder zurückkamen. Er zog sich dann bald aufs Altenteil zurück und machte den neuen Neffen zu seinem Nachfolger. Der führte die Firma schließlich unter seinem eigenen Namen und brachte sie dank mancher Glücksfälle zu erstaunlicher Höhe.
Es kam der siegreiche deutsch-französische Krieg. Es kamen die Gründerjahre. Der Großvater war jetzt Hausbankier der Fürsten Hohenzollern. Die Bank befand sich in einem Patrizierhaus an der Kanalstraße. Ein Bach, genannt die Düssel, floß am Hause vorbei. Jenseits des Baches lief die schöne stille Königsallee. Einige Schritte weiter begannen die Promenaden des Hofgartens. In dem weißen Hause, das überstopft mit altertümlichem Hausgestühl, Ölbildern, Kupferstichen, Stahlstichen, Büchern, Gobelins, kostbaren Porzellanen und Teppichen mehr einem Museum glich als einem Wohnhause, habe ich einen Teil der frühen Kindheit verlebt.
Der Großvater besaß ein Vermögen von etwa drei Millionen Mark, war also für jene Tage ein sehr reicher Mann. Er wurde nach dem Tode seiner Frau, mit der er zwanzig Jahre lang die zärtlichste Ehe geführt hatte, zum Sonderling. Er bekümmerte sich nur noch wenig um Geldgeschäfte, kümmerte sich auch kaum um seine Umgebung, sondern lebte in Sammlerinteressen oder für seine schöngeistigen Neigungen. Da er erst im Alter seinen Hunger nach geistigen Freuden stillen konnte, so blieb er immer ein unkritischer Dilettant; er sammelte eine altmodische Bücherei und eine Fülle von Autographen, unter welchen später wichtige Urschriften entdeckt wurden, so von Erich Schmidt die Urfassung von Bürgers Ballade »Leonore«. Ferner besaß der Großvater eine beträchtliche Gemäldegalerie. Er schrieb bis zu seinem Lebensende im achtzigsten Jahre (1898) viele Gedichte und Dramen, wovon Einiges sich erhalten hat.
Er hatte alle Fehler eines Emporkömmlings, der befangen in den Vorurteilen des damals allmächtig werdenden bürgerlichen Mittelstandes, seine Herkunft aus Handwerk und Proletariat vergessen hat und vergessen machen möchte. Er legte großen Wert auf seinen Verkehr mit Künstlern und in Adelskreisen. Die Maler Hasenclever, Preyer und Böker und der Dichter Friedrich von Uechtritz waren die nächsten Freunde des Hauses. Gern zeigte er sich auf den Wegen im Hofgarten in Gesellschaft glänzender Offiziere, ließ sich im Schmuck des Hohenzollernschen Hausordens fotografieren, kurz war behaftet mit komischen Eitelkeiten, die allzu bescheiden waren. Seine Kinder wurden, wie viele Kinder aus reichen Häusern, zugleich verwöhnt und vernachlässigt, sie lernten nur oberflächlich, aber stellten gleichwohl große Ansprüche, und da die Familie aus kleinen Verhältnissen durch das Geld emporgekommen war, so wurde Geldbesitz zum Wertmesser für den Rang und das Ansehen in der bürgerlichen Gesellschaft.
So lebte der alte Herr das Leben eines gesättigten Großbürgers, dessen oberster, fast geheiligter Grundsatz lautet: »Nur kein Kapital anbrechen«. Sein Augenmerk war, das Erworbene zusammenzuhalten; mehr erstrebte er nicht und wurde darüber ungerecht und bequem.
Er hatte eine kindliche Gabe, alles was sein Behagen stören oder ihn vor unangenehme Gedanken oder starke Entscheidungen stellen konnte, sich mit Diplomatie vom Leibe zu halten. Er sagte zu keiner Sache je ein unbedingtes Ja oder Nein, sondern ließ alles in der Schwebe, wich aus und gebrauchte gerne Redewendungen, wie: »Ei, ei, das nenne ich wunderlich«. »Ja, das sind wieder so neumodische Sächelche.« »Ja, ja, alles hat zwei Seiten.« »Leutchen, Leutchen, das will überlegt sein.« Gewöhnlich verliefen Familienangelegenheiten folgendermaßen:
Großvater tat zunächst so, wie wenn er den Redenden nicht verstände. »Wie? Was meinst du? Nu, was wieder? Sprich doch lauter! Ich höre nicht gut.« Auf diese Weise zwang er den, der Bitte oder Anliegen hatte, zunächst zwei-oder dreimal dieselbe Sache vorzutragen. Währenddessen überlegte er sich, was er antworten und wie er ausweichen könne. Sah er aber keinen Ausweg, dann schlug er entsetzt die Hände zusammen und sagte: »Neumodische Sachen! Ungefangene Fische! Wills mir in Ruh überlegen.« Damit lief er hinaus und war nicht mehr zu erreichen. Er forderte, daß in seiner Gegenwart immer nur Angenehmes und Liebenswürdiges gesprochen werde. Er nannte das »Goethesche Lebensweisheit«. Er mochte nichts Häßliches sehn oder hören. Worte wie »Krankheit«, »Sterben«, »Tod« durften in seiner Gegenwart nicht ausgesprochen werden. Todesfälle aus seiner Generation wurden ihm verschwiegen. Nie ging er zu Beerdigungen, nie in ein Krankenzimmer. War ein Familienmitglied auch nur erkältet, dann kam es in Quarantäne in das oberste Stockwerk des großen Hauses. Der Hausherr kam nie dorthin; man mochte sich wochenlang dort vom Personal verpflegen lassen, aber vor dem Hausherrn durfte man nur dann auftauchen, wenn man fröhlich war und gesund. Zumeist saß der alte Herr im hintersten Hofzimmer des Parterre zwischen alten Folianten; er saß in einem rotplüschenen Sessel und studierte durch ein mächtiges Vergrößerungsglas die Dichter des vergangenen Jahrhunderts. Während der Sommermonate zog er in sein Landhaus nach Heidelberg. Das war eine an der Straße nach Neuenheim am Neckarfluß gelegene Bergvilla, mit einem großen, terrassenförmig ansteigenden Garten, darin Granaten, Edelkastanie und Wein wuchs. Der alte Herr war immer bedacht auf »Reputation«. Jeden Abend, jahraus, jahrein, ging er in den »Verein« und trank dort eine Flasche Rheinwein. Der »Verein« war ein Klub alter Würdebären; auf deren Meinungen legte er am meisten Wert.
In seinen letzten Lebensjahren hatte er die Schrulle, alles zu vergolden. Er band die Bücher seiner Bibliothek in vergoldete Pappen. Er vergoldete eigenhändig die Beine der Stühle und die Lehne seines Bettes. Wenn er in guter Laune war, dann lud er mich zu einem Glase Wein und begann seine Gedichte und Dramen vorzulesen; er hatte gern, daß ich ihn durch Ausrufe der Bewunderung unterbrach, geschah das nicht, so machte er Pausen und sah mich so lange fragend an, bis ich »Herrlich« sagte. Kam eine Stelle, die er für gut hielt und ich schwieg, dann sagte er sicher: »Warum redest du nichts?« Dann mußte ich »Herrlich« sagen. Doch das tiefste Zeichen seiner Zuneigung war, wenn er von seiner »in Gott ruhenden Sophie« zu sprechen begann.
Er hatte nicht die mindeste Ahnung von Liebesgeschichten und sah das Verhältnis von Frau und Mann mit den Augen eines romantischen Jünglings der Wertherzeit. Nie in seinem Leben hat er eine andere Frau erkannt, als seine Sophie, die weder schön war, noch jung und nach der Geburt von fünf Kindern einem Krebsleiden verfiel. Sie wurde jahrelang im Rollwägelchen gefahren, und er wachte eifersüchtig darüber, daß kein anderer als er selber die Geliebte in der Königsallee spazieren fahre. – Als sich ein junger Mann aus wohlhabendem Hause um meine Schwester bewarb, da zog der Großvater Erkundigungen ein nach dem Vorleben des Bewerbers. Dann sagte er, daß die Verbindung mit einem solchen Schurken unmöglich sei. Als ich ihn bat, mir zu sagen, was denn der Jüngling verbrochen habe, da schwankte er lange, ob er das Erfahrene aussprechen könne. Dann nahm er mir das Versprechen ab, nie davon zu reden und flüsterte schließlich mit dem Ausdruck des Ekels und Entsetzens mir leise ins Ohr: »Denke nur, der Lump hatte eine Maitresse.«
Meine Mutter, am 5. März 1848 geboren, war das älteste Kind. Dann kam eine Tochter Antonie, gestorben 1920 als Gattin des Fabrikanten Friedberg in Berlin. Dann Clara, gestorben 1925 in Hamburg als Gattin des Großkaufmannes Calmsohn. Zu viert der Sohn Otto, vom Vater verwöhnt und vergöttert. Er wurde Kunstmaler, Schüler Otto Strützels in München. Er malte hunderte hübscher Landschaften und starb 1906 in Berlin, fünfzig Jahre alt. Zu fünft endlich Maria, welche kindisch und zeitlebens mit wunderlichen Schrullen behaftet blieb. Sie lebte unverheiratet, nachdem alle Geschwister ausgeflogen waren, in einem großen Hause als Haupterbin des Vaters unter den hinterlassenen Kunstsammlungen mit einer ebenso wunderlichen Gesellschafterin, verschroben und grillenhaft, erfüllt von beständiger Angst vor Stecknadeln, Glassplittern, Katzen und vergifteten Speisen, womit sie sich und andern das Leben schwer machte.
Als 1868 die Mutter starb, war die älteste Tochter Adele zwanzig Jahre alt.
Während ich von den Vorfahren meiner Mutter mangels jeglicher Familienforschung nur dieses Wenige ermitteln konnte, vermag ich von den Ahnen von Vaters Seite manches Gesicherte festzustellen, nicht freilich in männlicher Linie, deren Kunde schon bei dem Großvater erlischt, wohl aber im Verfolgen der Linie meiner Großmutter.
Wenn die Angaben in Büchern und Briefen keinen Irrtum enthalten, so stammte mein Urgroßvater vaterseits aus der Grafschaft Hoya. Und zwar soll er eine an der Hunte gelegene Ackerwirtschaft geführt und mit Vieh gehandelt haben; er wird in alten Papieren bezeichnet als »der Schutzjude Leiser (Eliesar) aus Hoya«. Er selber nannte sich Levy und soll aus dem priesterlichen Stamme der Leviten gekommen sein. Dieser Urgroßvater soll zweimal verheiratet gewesen sein. Mündliche Überlieferung berichtet, er habe nach dem Tode seiner Frau die christliche Magd bei sich behalten und ein Kind von ihr als das seine legitimiert. Welcher Sohn das gewesen ist, läßt sich nicht feststellen. Mein genealogisches Wissen endet bei drei Söhnen dieses Levy, von denen der älteste Alexander den Namen Leiser beibehielt aber in Leser umwandelte. Ich weiß nicht, ob dieser Leser schon Christ war oder später die Taufe nahm oder ob erst seine Kinder getauft wurden. Ich entsinne mich nur einiger Vettern und Kusinen dieses Namens, die um 1900 in Hannover wohnten; eine davon wurde Gattin eines Ministerialdirektors namens Adolf Matthias, welcher durch pädagogische Schriften (»Wie erziehen wir unsern Sohn Benjamin?«) sich bekannt machte.
Der zweite der drei Brüder, mein Großvater, führte zum Gedächtnis an seinen Vater den Vornamen Levy und schrieb den Familiennamen nicht Lessing, sondern abwechselnd Leshing oder Lehsing. Das Wort dürfte wendischen oder slavischen Ursprungs sein und zurückgehen auf die Silbe less oder löss, wie sie erhalten ist in Ortsnamen wie Unterlüss oder Lössgrund und ursprünglich Wald oder Förster bedeutet. Ganz sicher läßt sich feststellen, daß dieser Namenswechsel zurückzuführen ist auf das Erscheinen von Gotthold Ephraim Lessings Drama »Nathan der Weise«, auf dessen Fürsprache zugunsten der Juden und auf die Befreiung, welche diese Fürsprache hervorrief. Aus Dankbarkeit für dies hohe Lied der Duldung nahmen damals mehrere jüdische Familien in Preußen, Hannover und Bayern den Namen Lessing an. Der dritte und jüngste Bruder endlich behielt zum Andenken an den Herkunftsort Hoya den Namen Heuer oder Hoyer, ein Name, der in Hannover häufig ist.
Sicher weiß ich, daß mein Vatersvater Frühling 1803 mit einem Talerstück, das ich noch bewahre, von Hoya nach Hannover kam, ins Haus seines Onkels Heilbronn aufgenommen wurde und alsbald vom Kurfürsten Erlaubnis bekam, ein kleines Lotterie-Geschäft aufzutun in der Residenzstadt, die unter dreißigtausend Einwohnern etwa dreihundert Juden hatte. Er heiratete seine Kusine, kaufte ein (noch heute vorhandenes) Haus an der Bäckerstraße und hatte dreizehn Kinder, von denen mein Vater das jüngste war.
Ein zuverlässiges Werk »Geschichte der Familie Lessing« verzeichnet sämtliche Personen, die von Jakobus, dem jüngeren Bruder Gotthold Ephraims stammen. Es ist selbstverständlich, daß die jüdischen Familien, die seit etwa 1800 den Namen führen (und nach Siebmachers »Deutscher Wappenkunde« drei ineinander geschlungene Ringe als Familienwappen annahmen), nicht mit Gotthold Ephraim blutsverwandt sein können. Aber der folgende Umstand stiftete genealogische Verwirrung.
Die sogenannte Emanzipation der Juden, also ihre »bürgerliche Gleichberechtigung«, führte zu Massenübertritten; so trat ein großer Teil der Judenschaft Berlins zur evangelischen Kirche über, darunter auch die Verwandten meiner Großeltern, Personen, welche ebenfalls den Namen Lessing trugen. Es läßt sich daher, wenn heute der Name auftaucht, oft nicht mehr feststellen, ob eine jüdische oder germanische Abkunft dahintersteht, ja, es wäre sogar möglich, daß zwischen den jüdischen oder christlichen oder neuchristlichen Namensträgern eine Blutmischung stattgefunden hat.
Ich besitze einige Bücher von Personen, die angeblich mit mir blutsverwandt waren, ohne daß ich doch Grad und Art dieser Verwandtschaft noch festzustellen vermöchte. Zunächst eine Reihe medizinisch-pharmakologischer Werke, darunter eine umfangreiche »Materia Medika« vom Jahre 1859 von einem Michael Benedikt Lessing in Berlin, welcher auch eine Biographie des Parazelsus schrieb und Ehrenbürger der Stadt Salzburg gewesen ist. Ferner besitze ich eine vierbändige »Lehre vom Menschen« aus dem Jahre 1832 von Carl Friedrich Lessing, Kanzler des Standesherrlichen Gerichtes in Polnisch-Wartemberg, welcher als »der ehrliche Lessing« ein bekannter Jurist war und einundzwanzig Kinder hinterließ.
Von meinem Großvater Leiser Levy Lessing bewahre ich ein altes Petschaft zum Siegeln von Briefen, welches als Wappen drei ineinander verschlungene Ringe zeigt, was wohl eine Anspielung sein soll auf die Erzählung von den drei Ringen, mit welcher Nathan der Weise den Sultan Saladin belehrt. Es gab in der Familie meines Großvaters ein Exemplar von »Nathan der Weise«, welches eine eigenhändige Widmung Gotthold Ephraims enthielt.
An meinen Großvater erinnere ich mich als an einen alten Mann zwischen dem achtzigsten und neunzigsten Lebensjahr, groß, dürr, hager, mit langen weißen Haaren und Bart. Er gestikulierte und sprach unruhig aufgeregt; ich hatte große Furcht vor ihm. 1879 starb er im Stephansstift, einem Altersheim bei Hannover; sein Grab auf dem jüdischen Friedhof an der Strangriede ist noch erhalten. Meine Großmutter Täubchen war die Kusine ihres Mannes. Sie war kräftig und groß, blauäugig, blond, von sehr zarter Haut, hatte ein tüchtiges und frohes aber ganz und gar unschwärmerisches Gesicht, ein wenig ähnlich dem der lächelnden Mona Lisa. Sie war eine fromme Jüdin, opferte bei der Verheiratung ihr Haupthaar und trug den Scheitel und das Kopftuch, wie es unter den Frommen Sitte war. Sie schrieb nur hebräische Schrift. Ihre Herkunft läßt sich zurückverfolgen bis zum Jahre 1750, wo sie endet bei einem Talmudgelehrten in Halberstadt, einem Rabbi David Federschneider. Sie wurde in späteren Jahren Therese genannt, wonach ich Theodor heiße und stammte aus einer Gelehrtenfamilie namens Heilbronn. Von ihrem Großvater Aron Heilbronn, Sohn des Simon aus Heilbronn, ist auf dem alten Bergfriedhof in Hannover noch der Grabstein erhalten. Die Inschrift, welche den 3. Juni 1775 als Todestag verzeichnet, lautet in deutscher Übersetzung so:
»Finsternis und Todesschatten haben sich über uns gesenkt. Laß auf den Höhen Klagelieder anstimmen, Gemeinde. Erhebe schluchzend Deine Stimme, daß so viel Schönheit in die Erde gesenkt wurde. Darob verfinstere die Sonne, und der Mond lasse nicht mehr strahlen sein Licht.«
Der Sohn des also Besungenen und jung Verstorbenen hieß nach seinem Großvater Simon Heilbronn und heiratete ein junges Mädchen namens Sarah Simon, Tochter eines der reichsten Männer in ganz Deutschland, des hannoverschen Hofbankiers Ezechiel Simon, in dessen Bankhaus Anselm Rotschild, der Begründer der Gelddynastie, welcher den Lehrherrn später weit überflügelte, als Kommis gelernt hat. Aus dieser Ehe ging als die älteste von vier Geschwistern meine Großmutter hervor. An ihren Großvater Ezechiel erinnert in Hannover noch heute ein nach ihm benannter Platz mit einem Schmuckbrunnen.
Ich will nun noch einige Daten über die Eltern und Voreltern dieser Großmutter Täubchen-Therese festhalten. Das Grab ihres Vaters ließ sich nicht mehr finden; wohl aber ließen sich Gräber ihrer Geschwister nachweisen. Da ist zunächst das Grab einer kleinen Schwester Edel, die als ein Kind von zehn Jahren verstarb und sodann das Grab einer unverheiratet gebliebenen jüngeren Schwester Jeanette; sie wurde Tante Nette genannt und mein Vater nahm bei ihr als junger Arzt im Jahre 1860 seine erste Wohnung. Das Grab dieser Jeanette Heilbronn liegt unmittelbar neben dem meiner Großmutter auf der höchsten Spitze des Friedhofs, in welchem, da der Raum zu klein wurde und der Judengemeinde kein neuer Raum zur Bestattung ihrer Toten zugewiesen wurde, so, wie auf dem alten Friedhof in Prag, immer das folgende Geschlecht über den Resten des vergangenen gebettet wurde, bis aus dem Friedhofe ein Berg ward. Es ist dies das letzte Grab gewesen, welches auf dem alten Friedhof angelegt wurde und zugleich das erste, welches im Gegensatz zu den anderen Gräbern eine Inschrift in deutschen Lettern trägt. Wenn ich unter der Tränenweide auf dieser Bergspitze stand, so hatte ich das Bewußtsein, die letzte Blüte dieser aller zu sein.
Ein Bruder meiner Großmutter hieß Aron; er selbst wie seine Kinder wurden früh getauft und gaben einer Reihe protestantischer Pastoren das Leben. Er war ein mächtiger Mann, ihm gehörte das ganze Terrain zwischen Hannover und dem Dorfe Döhren, wo heute der Engesohder Friedhof sich befindet. Er lebte meist in London. Übrigens waren die Geschwister der Großmutter alle blonder blauäugiger Typ und von dem ortsansässigen niedersächsischen Schlage kaum verschieden, obwohl die Abkunft von beiden Eltern her, sicher rein jüdisch war.
Die Geschichte und Vorfahrenschaft der Familie Simon, also der großmütterlichen Eltern und Voreltern, ließ sich leicht zurückverfolgen, weil es die versessenste Welfenfamilie Hannovers war, welche mit dem englisch-hannoverschen Königshause emporkam und mit ihm unterging. Diese Familie erfuhr jähen Wechsel von Erfolg und Mißgeschick und zeugte Menschen von merkwürdigem Schicksal.
Ezechiel Simon, der Bankier der englischen Könige, soll inmitten seines Reichtums immer schwermütig gewesen sein. Er vergiftete sich am Passahfest 1839, worauf sein Sohn Israel, also der Onkel meiner Großmutter, welcher den Titel Oberkommerzrat führte, das Geschäft und Vermögen seines Vaters erbte. Er vermehrte seine Hausmacht, indem er Henriette Berend heiratete, die Tochter des polnischen Residenten, der neben den Simon zweitmächtigsten Judenfamilie Hannovers. Der Sohn aus dieser Ehe hieß Eduard und wurde Spielgefährte des Kronprinzen, des 1920 gestorbenen Herzogs von Cumberland. Alte Leute in Hannover erinnern sich noch, wie die beiden Jünglinge allmorgendlich auf milchweißen Pferden die lange Lindenallee nach Herrenhausen hinunter ritten. Dieser im Überfluß aufgewachsene Eduard ist bettelarm gestorben.
Als 1866 Hannover preußisch gemacht wurde, da tat Israel Simon, als der damals reichste Mann im Lande, den Schwur nicht zu rasten, bis das Königreich Georg des Fünften wiederhergestellt sei. Er folgte dem Könige in die Verbannung und stellte ihm sein Geld zur Verfügung. Zunächst wurde mit dem Gelde die sogenannte Welfenlegion angeworben, erst in Paris, sodann in Algier; mit ihrer Hilfe sollte dem blinden Könige sein verlorenes Reich wiedererobert werden. Dies Unternehmen mißlang, und das Gold Simons bereicherte schlechte Ratgeber und dunkle Ehrenmänner. Später versuchte Simon im Interesse Hannovers andere Länder zu finanzieren. Er kämpfte aus einem krankhaften Hasse gegen die Vormacht Preußens, welche doch allmählich über ganz Deutschland hin mächtig ward und die kleinen Länder des alten deutschen Bundesstaates verschluckte. Schließlich verlor Simon sein Letztes durch die betrügerischen Bankgründungen eines merkwürdigen Abenteurers, namens Klindworth, der den weltunkundigen blinden König betrog und ausbeutete. Übrigens ist die Tochter Agnes dieses Dunkelmanns die Geliebte Ferdinand Lassalles gewesen. Als alles Geld verloren war, fiel Simon beim Könige in Ungnade. Er endete wie sein Vater durch Selbstmord. Sein Geschlecht hat sich, wenn ich nicht irre, nur in seiner Tochter Paula fortgepflanzt, welche den Bankier und Mathematiker Wolfskehl in Darmstadt, den Stifter des eine Million betragenden sogenannten Fermat-Preises der Universität Göttingen, heiratete. Von ihr stammt ab der Dichter Karl Wolfskehl in München. Dagegen hat ein anderer Sohn des alten Ezechiel eine weit verzweigte deutsche Juristenfamilie hinterlassen, alle getauft und in hohen Würden. Ich entsinne mich, von einem dieser Nachkommen ein Buch »Gedanken eines Juden« gelesen zu haben, in welchem er den Massenübertritt der Juden zu den beiden christlichen Kirchen anempfahl.
Meine Urgroßmutter war, wie sich aus diesen Nachforschungen ergab, die mittelste von drei Töchtern. Ihre älteste Schwester hieß Schönchen Jochebed, ihre jüngere Schwester hieß Bune. Schönchen heiratete einen Engländer. Einer ihrer Söhne wurde Bischof der englischen Hochkirche. Bune heiratete einen Talmudgelehrten (Joel Blumental aus Höxter) und bekam einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn Meyer Blumenthal, hannoverscher Kommerzrat, war einer der kauzigsten Menschen, deren ich mich entsinne. Er wohnte fünfzig Jahre lang Ecke Bahnhof-und Georgstraße und lebte genau nach der Uhr. Zweimal am Tage spazierte er im Gehrock und hohem Zylinder den Georgenwall hinunter bis zum Ägidientor. Sein alter Diener Haller schritt, in Livrée gekleidet, ehrfurchtsvoll hinter ihm drein, auf seinen Armen die Bologneser Hündchen Chéri und Susi tragend. Der Spaziergang zweimal am Tage wurde unternommen, »damit die Hunde frische Luft bekommen«. Der alte Herr Rat konnte nicht mehr lesen, hatte wohl auch niemals richtig lesen gelernt. Eine Zeitlang mußte ich täglich ihm die Inserate aus dem »Hannoverschen Tageblatt« vorlesen. Dafür durfte ich abends ins Theater. Er war nämlich, weil das alle vornehmen Leute taten, »aufs Hoftheater abonniert« und zwar »Fremdenloge erster Rang, Platz eins«. Ein halbes Jahrhundert hindurch. Aber es geschah nur selten, daß er das Billett benutzte. Als ich Student der Medizin wurde, mußte ich ihn in meinen Ferien elektrisieren. Meinem Vater, den er in der Erinnerung alter Zeit stets als heranwachsenden Knaben betrachtete, war es zu langweilig, für den alten Herrn den kleinen »Ruhmkorffschen Schlittenapparat« in Ordnung zu bringen. Darum mußte ich es tun, und weil ich es sorgsam machte, durfte ich mir ein Honorar ausbitten und wählte die Gesamtausgabe der Schriften Arthur Schopenhauers. Der Alte hielt das für ein medizinisches Lehrbuch und gestattete, daß ich auf seine Kosten es kaufe. Es blieb meine beste Heilquelle für Lebenszeit. – Dieser alte Blumenthal hatte eine Schwester namens Zipora, das heißt Sofie, die mit einem aus Rußland zugewanderten Schriftgelehrten namens Leiser Rosenthal verheiratet war, einem Manne, der seiner ungeheuren hebräischen Gelehrsamkeit wegen von der Gemeinde erhalten wurde und lebenslang in der Synagoge wohnte, wo er Tag und Nacht Talmud studierte, während seine Frau riesige Ofenschirme stickte. Der Sohn dieser beiden, Baron George von Rosenthal, wurde einer der mächtigsten Männer in Holland. Er wohnte in Amsterdam an der Heerengracht. Von ihm und seiner Schwester Nanni, die einen Chemieprofessor Cohen geheiratet hatte, erhielt ich 1910 diese Daten. Durch sie erhielt ich auch den Stammbaum meiner Vorfahren. Er führt auf den im Jahre 1758 gestorbenen Michael David, der eine noch heute blühende Gelehrtenstiftung begründete und der Gemeinde die Synagoge baute. Durch ihn bin ich mit den Vorfahren Heinrich Heines blutsverwandt, denn der Stamm dieses Ältervater Michael David führt durch eine weitverzweigte Familie namens Düsseldorf auf eine Familie namens Hameln. Meine Stammutter Jente Hameln
3. Mein Vater
Inhaltsverzeichnis
Er wurde am 16. April 1838 geboren, als letzter eines Kinderdutzend, von denen sechs am Leben blieben. Sein Vater war zur Zeit der Geburt fünfzig Jahre alt und hatte ein Bankgeschäft in der Altstadt. Als der kleine Sigmund in die Schule kam, waren die älteren Geschwister schon aus der Schule entlassen. Die Mutter und die drei erwachsenen Schwestern verhätschelten den immer fröhlichen Knaben. Er war, wie die Mutter, blond, hell und blauäugig, hatte feine zarte Haut und schmale geschickte Hände; er war nicht groß, aber stämmig und von strammer Haltung.
Auf dem Lyzeum der Stadt, heute Ratsgymnasium genannt, hat der Junge seine Ausbildung empfangen durch damals weit gerühmte Lehrer, wie den ersten Entzifferern babylonischer Keilschriften, Hermann Grotefend und die Gräzisten Ludolf Ahrens und Rafael Kühner. Er war bei Lehrern und Mitschülern beliebt und trug den Scherznamen: »Außenminister«. Als er dreizehn Jahre alt, in den jüdischen Männerbund aufgenommen wurde, da wählte der Landesrabbiner Meyer für ihn den folgenden Konfirmationsspruch: »Augen hast Du, welche sehen; Ohren hast Du, welche hören, Hände hast Du, welche greifen. Der Herr hat Dir Alles gegeben.«
Sein nächster Freund auf der Schule und später auf der Universität war der Sohn des hannoverschen Polizeipräsidenten Fritz Grahn. Dieser wurde später Lehrer an derselben Schule, die sie gemeinsam besuchten und die auch ich von 1878-92 besucht habe. Grahn, der Peiniger meiner Jugend, hat an ihr etwa fünfzig Jahre lang gewirkt und ist 1927 neunzig Jahre alt, gestorben. Beide Jünglinge waren eigenwillige Ichmenschen. Wichtigtuer und Bedrücker. Grahn herzenskälter, mein Vater warmblütiger. Gemeinsam bezogen sie 1856 die Universität Göttingen, der eine um Altphilologie, der andere um Medizin zu studieren.
Im Jahre 1859 feierte die Studentenschaft den hundertjährigen Geburtstag Friedrich Schillers. Sie veranstaltete eine Aufführung von Schillers »Wallenstein«. Mein Vater spielte den Wallenstein, seine Freunde Grahn, Höpfner und Dörries mimten die Generale. Im Museum der Stadt Göttingen hat sich ein Theaterzettel dieser Aufführung erhalten; auch findet sie sich erwähnt in den Theatererinnerungen des Schauspielers Carl Sontag. Sie brachte meinen Vater vor einen Scheideweg. Man wurde auf seine starke theatralische Begabung aufmerksam. Das Hoftheater in Kassel machte ihm ein Vertragsangebot. Daß er es ausschlug und vorzog, Mediziner zu bleiben, wurde ihm von seinen Lehrern hoch angerechnet. Ihr Wohlwollen, zumal das der Professoren Hasse und Baum, machte es möglich, daß der erst dreiundzwanzigjährige das Staatsexamen bestand. Seine Doktordissertation trägt den Titel »Beiträge zur Histologie der Hühnerknochen«. Er redet in dieser Abhandlung, als habe er von früh auf am Mikroskope gesessen und gedenke weiterhin daran zu sitzen. Aber er hat nach Abfassung dieser Dissertation zwar noch viele Hühner gegessen, sicherlich aber niemals wieder ihre Gewebe durchs Mikroskop betrachtet. Er hatte fröhliche Semester verlebt in Würzburg, Berlin, Prag und Wien, beendete 1862 in Göttingen seine Studien und ließ sich in Hannover als Arzt nieder, Burgstraße 3, gegenüber dem Leineschloß.
Schon in den ersten Monaten seiner Tätigkeit hatte er das Glück, durch eine gelungene Kur Aufsehen zu erregen. Sie erfolgte an einem Fabrikanten namens Küster, welcher durch ein Jahrzehnt bettlägerig gewesen war und über seine Heilung ein Buch herausgab. Man wurde aufmerksam auf den jungen Arzt. Bei einer Erkrankung des Kronprinzen wurde er ins Schloß geholt. Er hat später mit Spott erzählt, wie er sich fortan eine feudale Praxis zu gründen wußte. Sein Diener Schorse Borchers und dessen Frau Gesine, (sie besorgten seinen Haushalt) – wurden abends in die Stadt geschickt in alle Lokale, wo Gesellschaften und Feste gegeben wurden. Sie mußten herumfragen, ob der Doktor Lessing unter den Anwesenden sei. Ein Fürst oder mindestens ein Baron benötige eilige Hilfe. Er erreichte, daß man in der kleinen Residenz sich an den Namen gewöhnte und ihn mit einigem Nimbus umgab. Als er in Aufnahme gekommen war, mietete er eine Etage an der Bahnhofstraße im Mittelpunkt der Stadt und verlebte eine gute Zeit, bis ein schweres Familienunglück hereinbrach im selben Jahre, wo das Königreich Hannover zu bestehen aufhörte.
Während des Krieges 1866 war das Bankgeschäft des alten Lessing in Zahlungsschwierigkeiten geraten, und der Alte war gezwungen, eine Kollekte Lotterielose bei seinem Onkel, dem Hofbankier Ezechiel Simon zu lombardieren. Während der Zeit dieses Lombards war eines der Lose mit einem Gewinn herausgekommen, und da gerade dieses Los nicht verkauft worden war, so entstand, als das Bankhaus Simon aufgelöst wurde und der Inhaber mit dem entthronten König nach Wien übersiedelte, ein wunderlicher Rechtsstreit. Er war vergleichbar dem folgenden Falle: Ein Bauer, der nicht zahlen kann, stellte seine Kuh beim Nachbar unter und läßt sie sich von ihm beleihen. Während der Pfandzeit aber wirft die Kuh ein Kalb, und als der Bauer die Kuh zurückholt, da gibt der Nachbar zwar das Muttertier heraus, beansprucht aber das Kalb für sich selber.