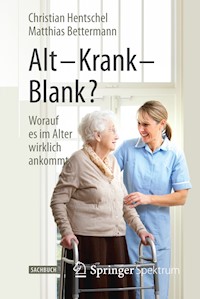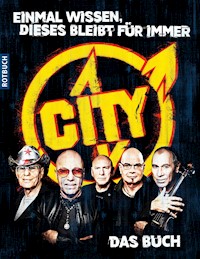
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotbuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Casablanca«, »Der King vom Prenzlauer Berg«, »Unter der Haut«, »Glastraum«, »Wand an Wand«, »Berlin (z. B. Susann)«, »Amerika«, »Flieg ich durch die Welt«, »Tamara« und nicht zuletzt »Am Fenster« – die Songs dieser Band lesen sich wie deutsche Rockgeschichte. Sie werden als Institution, Rocklegende und Kultband gehandelt. Die Rede ist von CITY, die 2022 ihren 50. Geburtstag feiern. 50 Jahre CITY – das sind nicht nur über 15 Millionen verkaufte Tonträger und etwa 2500 Konzerte: CITY. Das Buch erzählt detailliert und sehr unterhaltsam die komplette Bandgeschichte – von den Anfängen mit einem bulgarischen Sänger, der nach Schweden flüchtet, und dem Jahrhunderthit »Am Fenster« über einen Rockpalast-Auftritt vor dem Mauerfall sowie Goldene Schallplatten in der BRD und Griechenland bis hin zum Kultalbum Casablanca und zu den Highlights der letzten Jahre. Toni Krahl, Fritz Puppel, Georgi Gogow und Manfred Hennig, die am 30. Dezember 2022 ihr allerletztes Konzert als CIT Y spielen, lassen fünf Rock-'n'-Roll-Dekaden Revue passieren und geben so manches Geheimnis preis. Zudem erinnern sie an den im Mai 2020 verstorbenen CITY-Schlagzeuger Klaus Selmke. Einmal wissen, dieses bleibt für immer ist Rockgeschichte pur – ein Muss nicht nur für CITY-Fans!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Hentschel
Einmal wissen, dieses bleibt für immer
ROtbuch Verlag
50 Jahre in 50 Runden
(Bild: Dirk Schmidt)
1
Schlagzeuger Klaus Selmke bei einem Konzert im Jahr 2019 (Bild: Dana Barthel / look-of-life)
V. l. n. r.: Keyboarder Manfred Hennig, Bassist und Violinist Georgi »Joro« Gogow, Sänger Toni Krahl und Gitarrist Fritz Puppel verkünden im September 2021 ihren Abschied zum Ende des kommenden Jahrgangs. Doch die Geschichte hier beginnt 50 Jahre früher … (Bild: Dana Barthel / look-of-life)
Noch keine wirkliche Runde, eher eine Vorrunde.
Ostberlin in der ersten Hälfte der 1960er Jahre. Der Teenager FRITZPUPPEL verbringt die Nachmittage nach der Schule in einem Jugendclub. Er hängt dort mit seinem Kumpel Dieter Birr ab, den später alle »Maschine« nennen. Beide spielen Gitarre, aber noch mehr fachsimpeln sie über das Instrument:
»Kannste schon C-Dur?«
»Logo, sogar schon G-Dur!«
»Echt? Zeig mal …«
Auch alle anderen Gespräche kreisen ausschließlich um Musik:
»Schon ›Love Me Do‹ von den Beatles gehört?«
»Klar, schon auf Tonband – vom RIAS mitgeschnitten!«
»Und ›Wonderful Land‹ von The Shadows?«
»Jo! Kommt gleich danach.«
Bekanntermaßen werden die beiden den Rock-’n’-Roll-Virus nie wieder los – bis heute. Und als sie zwanzig Jahre jung sind, gründen sie gemeinsam eine Band. Die Lunics. Die Schreibweise variiert, manchmal schreiben sie »Luniks«. Ihr größter Erfolg: ein Konzert im Kreiskulturhaus Berlin-Treptow. Das ist die Beat-Hochburg. Die Leute stehen bis sonst wohin, um hereinzukommen. Aber es bleibt ein kurzes Kapitel. Im Mai 1965 werden Fritz und Maschine zur Armee einberufen. Obwohl beide nach anderthalb Jahren gleichzeitig zurückkehren, bleiben die Lunics Geschichte. Damals bedauerlich, aber für die Annalen des Deutschrocks gut. Denn nur so können einige Zeit später die Puhdys und CITY entstehen.
Auch KLAUSSELMKE möchte Gitarrist werden. Er ist siebzehn Jahre alt, als er die Idee hat. Bei einer Fahrt zu einem Ernteeinsatz trifft er auf einen, der Schlagzeug spielt, und einen weiteren, der Gitarre klampft. Wie cool. Klaus möchte das auch. Doch die Schulband, bei der er sich meldet, hat schon drei Gitarristen. Aber eben keinen Drummer. Seine Entscheidung ist pragmatisch – und eine mit Zukunft.
Nicht nur im Twistkeller Berlin-Treptow weltberühmt: The Lunics1964 – mit CITY-Gründer Fritz Puppel (2. v. r.). Links neben ihm: der spätere Puhdys-Kopf Dieter »Maschine« Birr. 1965 war es aus mit der Beatsensation, Fritz und Maschine mussten zur Armee.
Pragmatismus steht ebenso für GEORGIGOGOWs Weg zur Bassgitarre. Denn eigentlich hat der gebürtige Bulgare Geige studiert. 1971 kommt er in die DDR, zuerst in die Nähe von Erfurt, nach Gotha, wo eine Tanzkapelle Ersatz benötigt. Dann locken ihn die Nontschew-Brüder nach Berlin. Die Bulgaren bespielen die exklusivsten Bars und genießen beinahe Kultstatus in der Tanzmusikszene. Doch ihr Bassist wird krank. Eine Chance für Georgi, den alle »Joro« nennen. Das Problem: Er hat noch nie Bass gespielt. Dennoch: Das Casting, das damals noch nicht so heißt, entscheidet er für sich.
Lange Haare tragen und Gitarre spielen – das wäre der Zeitgeist in den 1960ern gewesen, behauptet TONIKRAHL. Und so ist er bereits als Oberschüler in einer Band zu sichten. Wurzel minus 4 heißt sie. Wurzel aus minus vier ist nicht lösbar. Genauso wie sich die Band nicht auflösen lässt. Doch das eine ist Mathematik, und das andere ist das Leben. Die Kleinen heißt seine nächste Band.
Die erste Halbzeit von 50 Jahren CITY wurde von zwei Besetzungen geprägt – die der 1970er mit dem Geiger und Bassisten Georgi Gogow und die der 1980er mit Keyboarder Manfred Hennig. Pünktlich zur zweiten Halbzeit wurden beide Ären zusammengeführt. V. l. n. r.: Klaus Selmke, Fritz Puppel, Toni Krahl, Georgi Gogow und Manfred Hennig (Bild: Andreas Weihs / AWPress)
Zahnarzt oder Musiker? In MANFREDHENNIGs Brust schlagen anfangs zwei Herzen. Längst ist das Studium der Stomatologie angefangen, doch Bandkollegen überreden ihn zum Wechsel an die Musikschule in Berlin-Friedrichshain. Der Keyboarder von Neue Generation willigt ein und wird schließlich Profimusiker. Beispielsweise bei Pond.
Was alle fünf Musiker zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Dass sie nur wenig später mit CITY Musikgeschichte schreiben werden. Dass sie einer Band angehören werden, die weit mehr als ein paar schnelle Hits liefert. Eine, der es gelingt, am Zahn der Zeit zu sein und dennoch zeitlos zu agieren. Der es gelingt, aus der kleinen DDR heraus auchinternational aufhorchen zu lassen. – Einmal wissen, dieses bleibt für immer.
2
Herbst 1971. Die Puhdys haben gerade »Türen öffnen sich zur Stadt« und die Klaus Renft Combo »Wer die Rose ehrt« im Rundfunkstudio inder Berliner Nalepastraße aufgenommen, und in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, wird der 42 Tonnen schwere Karl-Marx-Bronze-Kopf (»Dor Nischl«) eingeweiht.
Fritz Puppel denkt indessen darüber nach, eine neue Band zu gründen. Dabei hat er gut zu tun. Er ist ein gefragter Studiomusiker. Ob eine neue Nummer von Frank Schöbel oder der Soundtrack eines Fernsehfilms, ein Gitarrist wird immer gebraucht. Bei Fritz ist auf der Habenseite, dass er über erstklassiges Equipment verfügt sowie nach Noten spielen kann – beides keine Selbstverständlichkeit.
Auch live ist er zur Stelle, wenn Ersatz gesucht wird. Er spielt als Gitarrist in keiner festen Band, gleichwohl fühlt es sich so an, in jeder Band gespielt zu haben. Selbst in der Band des Jazzmusikers Klaus Lenz, den er sehr bewundert, fühlt es sich wie ein Aushilfsjob an. War ja auch so, nirgends Herzblut. Fritz will aber die Musik mit Ernsthaftigkeit betreiben. Was so viel bedeutet, nicht an der eigenen Band vorbeizukommen.
Zuerst kümmert er sich ums Musikequipment. Was hier nach einem lässigen Gang ins nächste Fachgeschäft klingt, ist in Wirklichkeit ein schwieriges Unterfangen. Wenn es noch im Rahmen der Legalität ist, dann am äußeren Rand. Fritz trifft einen stadtbekannten Equipment-Dealer. Der rechnet kurz hoch, was alles gebraucht wird, und zieht mit der Kohle, die Fritz selbst und nicht von seiner Tante hat, wie er später in Interviews erzählt, los. Dann passiert eine ganze Weile nichts. Als das Gefühl immer mulmiger wird, folgt die Erlösung. Der Besorger hat alles zusammen und liefert. Es kann losgehen.
Derweil hat sich Fritz in der Szene nach Musikern umgehört. Durch die vielen Einsätze als Sub – so nennt man heute unter Musikern die Aushilfen – kennt er praktisch jeden. Als er schließlich Klaus Selmke fragt, sind sie schon zu zweit. Klaus spielt zu der Zeit bei Team 66 und bringt seinen Bandkollegen, den Organisten Klaus Witte, zur noch namenlosen Formation mit. Eine gute Wahl. Denn der ehemalige Team 66-Bandleader hat nicht nur einige Kontakte zu Veranstaltern, sondern auch ein Fahrzeug, eine Anhängerkupplung und eine Gesangsanlage.
Die Band Wurzel minus 4 im Jahr 1968 mit gleich zwei späteren CITY-Sängern: Frank Pfeifer (vorn) war erster CITY-Sänger, links hinter ihm an der Gitarre Toni Krahl – seit 1975 am Frontmikro von CITY.
Als Bassist wird schließlich Ingo Döring und als Sänger Frank Pfeifer verpflichtet. Ebenso kluge Entscheidungen. Letzterer hat echte Entertainer-Qualitäten und Ingo viele Ideen. Beispielsweise auch die Idee zum Bandnamen. Bei einer Probe soll jeder einen Namensvorschlag auf einen Zettel schreiben. Der Bassist schreibt »City«. Das gefällt allen. Es hat so etwas Urbanes, klingt lebendig, nach Großstadt, und es ist ein englischer Begriff, der überall auf der Welt verstanden wird. Demokratisch wird abgestimmt, dass an »City« noch »Band« herangehangen wird.
3
Bandgründer Fritz im 50. CITY-Jahr (Bild: Michael Petersohn)
FRITZPUPPELwird am 2. November 1944 geboren und wächst in einer großbürgerlichen Familie auf. Dem Großvater, der auch Fritz Puppel heißt, und später dem Vater gehören bis zur Enteignung 1953 in der DDR die in Berlin ansässigen FRIPU-Werke (»FRIPU« steht für Fritz Puppel), in denen Haushaltsgeräte wie Küchenwaagen, Brotschneidemaschinen, Reiben und Bohnenschnippler hergestellt werden. Als Fritz nach dem Ende der achten Klasse auf die Mittelschule wechseln will und es ihm verwehrt wird, besucht er ein Gymnasium in Westberlin. Das ist möglich – bis zum Mauerbau 1961. Doch da hat Fritz gerade erst die elfte Klasse hinter sich.
Seine Mutter besorgt ihm eine Lehrstelle als Werkzeugmacher, was nicht so blöd wird, wie anfangs vermutet. Und er darf ein bisschen später zur Abendschule gehen, um das Abitur fertig zu machen. Als er das in der Tasche hat, beginnt Fritz an der Berliner Humboldt-Universität ein Studium: Lehrer für Polytechnik. Eigentlich möchte Fritz lieber Biologie studieren, jedoch bei der Ausbildung müsse es etwas Technisches werden, heißt es. Ein Kumpel rät ihm zum Werklehrer, da bleibe Zeit für die Musik.
Seltenes Bild von Fritz: als Zwanzigjähriger mit Bass
So besucht er zeitgleich, also während des Studiums, die Musikschule Friedrichshain. Nachdem er seinen Abschluss hat, heuert er auch hier als Pädagoge an: als Gitarrenlehrer. Dass er überhaupt zur Gitarre gekommen ist, hat mit Mietschulden zu tun. Nicht mit seinen eigenen. Seine Tante hat einen Untermieter, der den Mietnomaden salonfähig machen will. Doch die Schwester von Fritz’ Vater reagiert kreativ: Der Untermieter, der Gitarre spielt, muss dem vierzehnjährigen Fritz sein Instrument zur Verfügung stellen und obendrein Musikunterricht erteilen.
Als »Pappe« ist die Zulassung zum öffentlichen Spielen eines Instruments in die Geschichte des Ostrocks eingegangen: hier ein kleines, ganz sicher unvollständiges Sammelsurium aus der Ausweis-Schatzkiste von Fritz.
Unverkennbar Fritz, auch wenn er nicht in die Kamera schaut – hier bei der Rock-Legenden-Tour 2018 beim Konzert in Neubrandenburg (Bild: Dana Barthel / look-of-life)
Nach dem Lehrerstudium arbeitet Fritz zunächst tatsächlich in dem Beruf. Als er 1971 kündigen will, löst er ein mittelschweres Erdbeben aus. Denn wer so ein Studium abgeschlossen hat, muss auch im entsprechenden Job bleiben. Wo kommt man denn sonst hin? Da lässt man mal einen studieren, der nie bei den Pionieren und nie in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) war – und dann so etwas! Am Ende des Gerangels wird der Abtrünnige aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Sein Chef, also der Schuldirektor, schenkt ihm zum Abschied ein Buch. Es steht bis heute bei Fritz und heißt: Aufstand der Träumer.
Fritz gründet schließlich CITY. Für die nächsten 50 Jahre ist die Band – natürlich neben der Familie – Lebensmittelpunkt und -elixier. Als die Band Halbzeit feiert, wechseln die CITY-Gespräche von »Wein, Weib und Gesang« zu Rückenschmerzen und anderen Wehwehchen. »Ein Ding der Unmöglichkeit«, findet Fritz und entdeckt für sich das Laufen. 2002 läuft er seinen ersten Marathon, und bis heute joggt er mindestens fünfmal pro Woche. Lediglich die ohne Leine herumstreunenden Hunde nerven. Das war schon immer so, selbst beim allerersten CITY-Konzert.
4
Hirschgarten ist zwar noch Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, aber irgendwie auch schon ganz weit draußen. Die Siedlung liegt im Stadtbezirk Köpenick und fristet ein bisschen ein Schattendasein. Man kennt halt das Zentrum von Köpenick in der Nähe des gleichnamigen S-Bahnhofs sowie die damals heruntergekommene Altstadt. Und natürlich die Ortsteile Friedrichshagen und Rahnsdorf – mit Wasser und Wald, überdies mit den Öffis gut zu erreichen. Für einige ist Köpenick ein Hoffnungsschimmer in Sachen Wohnraum; Anfang der 1970er Jahre entsteht hier das Neubaugebiet »Allende-Viertel«.
Die frühere Villenkolonie Hirschgarten liegt unweit davon und bleibt von alldem, was drum herum passiert, unberührt. Allerdings führen die Wege unzähliger Ostberliner und Ostberlinerinnen zwischen sechzehn und meinetwegen dreißig Jahren regelmäßig in das verschlafene Viertel. Denn nur fünf Fußminuten vom S-Bahnhof Hirschgarten entfernt ist das Klubhaus »Arthur Becker« zu finden. Ein Mekka der (Live-)Musik. Bereits seit den 1950ern. Hier wird geschwoft, getanzt, geraucht und gesoffen. Auf der Bühne des »ABC«, wie man das Haus später in Anlehnung an »Arthur-Becker-Club« nennt, kann man schon vorab bewundern, was nur kurze Zeit danach im ganzen Land angesagt sein wird. Wer es also halbwegs ernst mit der Musik meint, kommt am Jugendclub in Hirschgarten nicht vorbei.
Für CITY ist es gar die Location des allerersten Auftritts. Eine Gage gibt es für die Musiker aber nicht. Die neugegründete Band kann in den Tagen zuvor hier kostenlos proben, dafür gibt sie als Dankeschön ein Konzert. Die Proben sind anstrengend, insbesondere wenn abends der Hausmeister zum Abschließen kommt. Der hat stets einen herumlaufenden Deutschen Schäferhund dabei, der sich sehr für die jungen Männer auf der Bühne interessiert. »Der tut nix«, ruft sein Herrchen, aber nichts Genaues weiß man nicht … Fritz denkt, wenn der Köter ihn in die Hand beißt, war es das mit dem allerersten Konzert der CITYBAND vor Publikum.
Es ist der 4. Februar 1972. Ein ganz gewöhnlicher Freitag in Ostberlin. Der frühere Bundeskanzler Ludwig Erhard wird an diesem Tag fünfundsiebzig Jahre alt, und Alice Cooper, der in diesem Jahr mit »School’s Out« noch Weltruhm erlangt, feiert seinen vierundzwanzigsten Geburtstag. Im fernen Japan eröffnet Kaiser Hirohito einen Tag zuvor die Olympischen Winterspiele. Die DDR schickt zweiundvierzig Athleten nach Sapporo, zehn Tage später reist das Team mit vier Gold-, drei Silber- und sieben Bronzemedaillen als zweiterfolgreichste Nation wieder zurück.
Früh am Morgen sind noch Minusgrade, bis zum Nachmittag klettert das Thermometer bis drei Grad plus herauf. Aber das ist draußen, drinnen im Club brennt die Luft. Der »ABC« ist rappelvoll. Und das Publikum feiert die CITYBAND. Die Musiker sind nicht wirklich überrascht, dass sie gut ankommen, denn sie liefern genau das, was die Leute erwarten. CITY – und alle anderen Bands des Ostens – haben eine Stellvertreterfunktion. Es ist klar wie Kloßbrühe, dass die Konzertbesucher vermutlich nie Deep Purple, die Rolling Stones oder Carlos Santana (na gut, der schaffte es fünfzehn Jahre später in den Palast der Republik) zwischen Rostock und Suhl live erleben werden. In diese Bresche springen also die einheimischen Kapellen und covern alles, was die internationalen Hitparaden hergeben.
CITY1972 in den Urbesetzungen
Nichts anderes machen CITY. Und sie machen ihre Sache gut. Sänger Frank ist ein echtes Frontschwein. Wie ein Wahnsinniger schlägt er auf die Bongos, nach zehn Minuten bluten ihm die Hände. Egal: The Show must go on. Pfeifer singt die Songs nicht, er lebt sie. Er interpretiert nicht Mick Jagger, er ist Mick Jagger. In der Garderobe spricht er mit seinen Bandkollegen im englischen Kauderwelsch. Dabei beherrscht er die Sprache überhaupt nicht. Doch was will man als Ostberliner Jagger machen?
Auch in der DDR Usus: Ein Musiker braucht ebenso buchhalterische Fähigkeiten. Hier die Abrechnung vom Gründungsmonat Februar 1972. Der erste CITY-Auftritt am 4. Februar ist nicht aufgelistet, denn der war gagenfrei.
Neben dem »ABC«-Start ist noch ein weiteres Konzert aus der Zeit der Anfänge von CITY in bester Erinnerung geblieben. Bassist Ingo hat die Veranstaltung an Land gezogen, die in einem Gasthaus in der Nähe von Dresden stattfindet. Samstagabend ist Tanz und am Folgetag eine Sonntagsmatinee. Doch da schläft das Dorf noch, aber der Wirt ist mit seiner kompletten Familie da. Die kleine Tochter hat auch einen Musikwunsch, den sie am Bühnenrand kundtut: »Spielt mal ›Wandernde Möhre‹!« Nach ewigem Rätseln kommt die Band darauf, das Mädchen meint »Guantanamera«. Bis heute ist die »Wandernde Möhre« ein Running Gag unter den Musikern. Dabei war es nicht der letzte außergewöhnliche Titelwunsch. Jahre später, in der BRD bei einem Fest der DKP, eilen die Genossen zu CITY und fragen, ob sie auch den »Marsch der sowjetischen Fliegerkosmonauten« spielen können. Dann doch lieber: »Wandernde Möhre«.
Wer auf der Bühne zu Mick Jagger mutiert, darf auch seine eigene Karte haben: Frank Pfeifer, CITY-Sänger von 1972 bis Ende 1973 und einmal 2007 als Gast bei einem Jubiläumskonzert.
5
Aus CITYBAND ist CITYROCKBANDBERLIN geworden. Es ist nicht nur ein Bandname. Es ist eine Ansage. Eine Ansage, die dem potentiellen Klubhaus- vulgo Rockhöhlenbesucher unmissverständlich klarmacht: Hier kommt der komplette Aufruhr aus der Hauptstadt. Das Publikum auf dem flachen Land – dort geht es vornehmlich hin – soll zittern.
Und es zittert. CITY sind in der Szene angesagt. Das ist klar von Vorteil, denn auch wenn es in diversen Beiträgen zur Geschichte des Ostrocks heißt, dass die Musiker nach ihrer Einstufung bezahlt werden und nicht nach ihrem tatsächlichen Marktwert, ist es zwar nicht falsch, aber eben nur die halbe Wahrheit. Kein Klubhausleiter und kein Saalwirt buchen eine Band, die nicht bei den Leuten ankommt. Und falls doch, dann nur versehentlich.
Frühe Autogrammkarte mit Kühen. Das hat bis heute was.
Insofern funktionieren die Bands nach den Regeln der Marktwirtschaft. Wer nicht interessant ist und/oder bei den Leuten »verkackt«, erkennt es in seinem Terminkalender. Zudem wird bei den Einstufungen getrickst. Eine Band, die den Saal füllt, obwohl sie nur eine sehr »honorargünstige« Einstufung besitzt, schreibt noch ein paar nie stattgefundene Proben hinzu. Oder schummelt bei der Fahrtkostenabrechnung.
Ebenso wird die 60/40-Reglementierung aus den Angeln gehoben. Vorgeschrieben ist, dass 60 Prozent der »aufgeführten Lieder« aus dem »sozialistischen Wirtschaftsgebiet« stammen. Doch Prozentrechnung ist so eine Sache …
Alles keine Erfindungen von CITY, sondern gängige Praxis in der gesamten Szene. So also auch bei ihnen. Wenn CITY aus dieser Zeit etwas gelernt haben, dann das: dass man nie Selbstzufriedenheit an den Tag legen kann, dass man nie langweilig werden darf, dass man an den Fans dranbleiben muss. Ein Credo, das CITY bis zur 50. Runde beherzigen.
Was wird denn heute gespielt? – Eine Original-Setlist aus den Anfangsjahren
6
CITY-Mitbegründer und -Schlagzeuger Klaus Selmke. Hier in Zwickau bei den Rock Legenden 2018 (Bild: Dana Barthel / look-of-life)
KLAUSSELMKEwird 1950 geboren und wächst in Berlin-Schöneweide auf. Er macht nach zehn Jahren Schule eine Lehre zum Elektromechaniker und holt an der Abendschule das Abi nach.
Schon mit zwanzig hat Klaus einen vermeintlichen Traumjob. Zumindest einen heißbegehrten, weil es von diesem nicht so viele gibt und man eigentlich auch ein abgeschlossenes Studium vorweisen muss. Doch Klaus hat zufällig Connections. In Form einer Bekannten, deren Ex-Mann ein leitender Redakteur beim Berliner Rundfunk ist. Der vermittelt Klaus ein Vorstellungsgespräch, und offenbar überzeugt er dort. Der spätere CITY-Schlagzeuger bekommt eine Festanstellung als Musikredakteur beim Radio in der Nalepastraße.
Zeitgleich will der Zwanzigjährige auf die Musikschule Friedrichshain. Nicht so einfach, denn Klaus kommt weder aus einer musikalischen Familie, noch hat er als Kind irgendwo Instrumentenunterricht gehabt. Dass ihn Musik begeistert und er Schlagzeug spielen will, ist ihm erst drei Jahre zuvor eingefallen. Allerdings zieht sich sein konsequentes Handeln wie ein roter Faden durch sein Leben. Wenn er etwas anpackt, dann richtig. Und so besteht Klaus die Eignungsprüfung für die Friedrichshainer Ostrockerschmiede.
Aber er bekommt den Tipp, dass es besser sei, wenn er noch Privatunterricht nehme, sowie eine Adresse eines Lehrers. Das ist der Herr Liebetrau, der Solopauker an der Staatsoper Berlin. Der setzt Klaus erst einmal auf den Topf. Jazz und Rock wird hier eh nicht vermittelt, es geht ums klassische Einmaleins. Und die Stunde kostet 15 Mark; 60 Ostkröten im Monat sind damals eine Menge Holz. Und Liebetrau tröstet: »Das, was du machen willst, bringst du dir dann selbst bei. Das klassische Know-how hilft dabei.«
1971 ruft Fritz bei Klaus an, im Februar des Folgejahres geht es mit CITY los.
Aus dem Fotoalbum von Klaus: als Klein- und Schulkind sowie als Teenager
Getreu seinem Lebensmotto »Wenn, dann richtig« kündigt Klaus beim Rundfunk. Bis 1990 bleibt er Schlagzeuger der Band, kniet sich dann mit eigener Firma in die Werbe- und Grafikschiene rein und kehrt schließlich zwei Jahre später zu CITY zurück.
CITY prägt Klaus nicht nur mit seinem Schlagzeugspiel, sondern auch optisch. Dabei macht er zunächst aus der Not eine Tugend. Da Klaus sehr groß ist, muss er sämtliche Schlagzeugteile entsprechend hochschrauben, wodurch das Drumset instabil wird, oft umkippt oder ein Teil abbricht. Also runter auf die Erde und nicht einmal Schuhe an, jeder Millimeter kann zu viel sein. Das Ganze dann am Bühnenrand positioniert und um neunzig Grad gedreht. Eine Win-win-Situation: Klaus sieht mehr, und das Publikum erblickt mehr Bewegung.
Im Jahr 2015 wird bei Klaus Krebs diagnostiziert, fünf Jahre später – am 22. Mai 2020 – verliert er den Kampf gegen seine Krankheit.
(Bild: Bernd Lammel)
Klaus am CITY-Schlagzeug, 1987 und 2019 (Bild: Dana Barthel / look-of-life)
7
Der römische Komödiendichter Plautus, der etwa 250 bis 184 vor Christus lebte, soll die lateinische Formulierung noˉmen est oˉmen zum geflügelten Wort gemacht haben, in seinem Stück Persa wird es angeblich erstmals verwendet. Es bedeutet: »Der Name ist ein Zeichen«, einfacher: »Der Name deutet schon darauf hin«, am einfachsten: »Der Name ist Programm«. Joro gefällt das Wortspiel und nennt so seine Band, die er 1973 gründet.
Eigentlich ist er gut gebucht als Tanzmusiker in den einschlägigen Bars von Berlin. Beispielsweise tritt er regelmäßig in der Hafenbar in Berlin-Mitte auf. Das hat Kultfaktor. Doch ein einschneidendes Erlebnis lässt ihn seine Position überdenken. Es ist der Jahreswechsel 1972/73. Natürlich hat Joro auch am Silvesterabend eine Verpflichtung, doch er kommt dreißig Minuten zu spät. Es gibt allerdings einen sehr guten Grund dafür: Joro ist Vater geworden, sein Sohn Nick ist auf die Welt gekommen. Logischerweise besucht er ihn und seine Frau im Krankenhaus. Doch den Kapellenleiter interessiert es nicht. Unverständnis ist eine schlechte Basis im bis dato emotionalsten Lebensmoment, und so wird dem fassungslosen Joro klar, dass er mit diesem Menschen in Zukunft nicht mehr auf der Bühne stehen möchte.
Er beschließt mit Traudl Bröckel – seine spätere Frau und die Mutter seines Sohnes –, die sich ums Organisatorische kümmert, eine eigene Band ins Leben zu rufen. Der erste Auftritt findet im Mai 1973 statt. Die Geburtsstunde von Nomen est Omen. Wäre es nicht einfacher gewesen, sich weiterhin als Tanzmusiker zu verdingen? Mit Sicherheit. Doch fünf, sechs Stunden Schlager zum Tanz zu spielen, obwohl man auf Rock und Jazz steht sowie südländische Musik im Blut hat, bedeutet einen Leidensweg.
Emil Bogdanow, Bulgare, aber seit frühester Kindheit schon in der DDR, ist der Sänger von Prinzip. Bald wechselt er zu CITY.
Dagegen ist die Entwicklung des Ostrocks paradiesisch. Alles ist möglich – man muss es nur probieren. Joro verlässt den sicheren Hafen der Tanzmusiker. Doch die neue Band Nomen est Omen am Laufen zu halten, ist ein schwieriges Unterfangen. Denn es stehen mindestens zehn Leute auf der Bühne, davon allein vier Bläser. Schon die Organisation des Transports der Instrumente entpuppt sich als Herausforderung. Zudem nutzen einige bulgarische Musikerkollegen die Band als Sprungbrett, um in den Westen zu gelangen.
Doch das nur am Rande. Vielmehr muss ein Konzert in Plauen erwähnt werden. Nicht nur Nomen est Omen sind da, sondern auch Prinzip – eine Art Frühform der späteren gleichnamigen Hardrockband um Jürgen Matkowitz aus Berlin. Ihr Sänger: Emil Bogdanow. Ebenfalls ein Bulgare. Joro und Emil lernen sich an diesem Abend im Vogtland kennen und schätzen. Dass sie nur ein Jahr später gemeinsam bei CITY spielen, ahnen sie da noch nicht.
8
Emil Bogdanow, Bulgare, aber seit frühester Kindheit schon in der DDR, ist der Sänger von Prinzip. Bald wechselt er zu CITY.
CITY, also die CITYROCKBAND, werden bei den Konzerten gefeiert. Und die Band liefert. CITY bleiben dabei sehr flexibel. Als sie mit Andreas Pieper einen Flötisten verpflichten, sind auch Coverversionen von Jethro Tull und ähnlich gelagerten Bands möglich. Kurzzeitig wird sogar eine Sängerin engagiert, und CITY können mit Gudrun Bartels die großen Hits von Musikerinnen darbieten. Doch bei all dem Applaus, den sie kriegen, wird zumindest den CITY-Gründern Fritz und Klaus immer mehr klar, dass das frenetische Klatschen des Publikums nicht ihnen gilt. Die Zuschauer applaudieren für Deep Purple oder Santana.
CITY sind eben nur die Stellvertreter. Das geht für viele Musiker in Ordnung, doch vor allem Fritz ist es auf Dauer zu wenig, nur die Songs anderer zu spielen, fremde Werke nachzuahmen. Es ist nichts weiter als Kunstfälscherei. Gleichfalls nervig: die englischen Songtexte, die mehr oder weniger phonetisch interpretiert werden. Doch wovon singt man eigentlich? Immer öfter drängt Fritz seine Kollegen, eigene Sachen auszuprobieren. Eigene Kompositionen, eigene Texte. Mit wenig Erfolg. Sie haben schlichtweg keine Lust darauf.