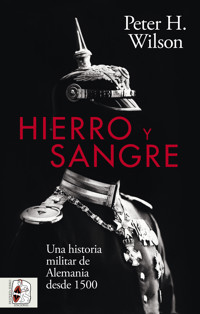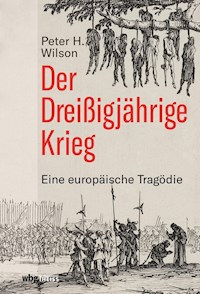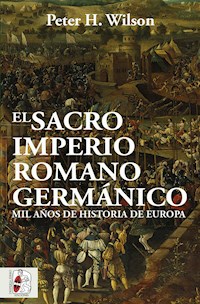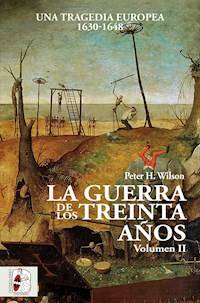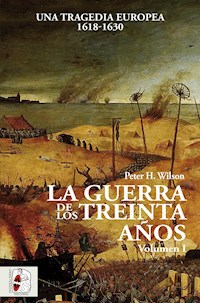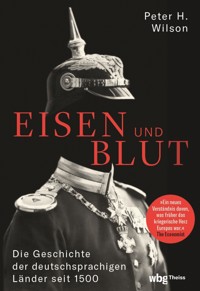
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom kriegerischen Herzen Europas: eine faszinierende Analyse Welchen Einfluss hatte der Militarismus auf die deutsche Geschichte der Neuzeit? Peter H. Wilson fächert in beeindruckender Weise die gesamte Militärgeschichte des deutschsprachigen Raumes der letzten fünf Jahrhunderte auf. Dabei berücksichtigt er nicht nur alle militärischen Aspekte von der Waffenentwicklung bis hin zur Kriegsstrategie, sondern auch Politik, Wirtschaft, Technologie, gesellschaftliche Entwicklungen und die Folgen der Kriege. - Nuanciert und komplex: ein neuer Blick auf die Geschichte Europas - Vom römischen-deutschen Reich zum Nationalstaat: 500 Jahre Militärgeschichte - Die Entwicklung der Kriegsführung an Land, zur See und in der Luft - Kriege, Feldzüge, Generäle und der Militarismus: eine scharfe Analyse für Geschichtsinteressierte - Vom Historiker und Autor des gefeierten Sachbuchs "Der Dreißigjährige Krieg" Wie das Militärische die deutsche Geschichte bestimmt Bismarcks berühmte Rede "Blut und Eisen" zeigt, wie sehr der Militarismus ein integraler Bestandteil der deutschen Geschichte ist. Er prägte die Art und Weise, wie Politik gemacht und Kriege geführt wurden - und das nicht erst seit der Entstehung des deutschen Nationalstaates. Deshalb greift die in vielen Büchern zu Militär und Geschichte gepflegte Verengung des Blicks auf Aufstieg und Fall Preußens und die Zeit von 1914 bis 1945 zu kurz. Peter H. Wilson zeigt in seinem monumentalen Werk, wie wichtig es ist, die deutsche Militärgeschichte in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1928
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die englische Originalausgabe ist 2022 bei Allen Lane / Penguin Random House UK unter dem Titel Iron and Blood. A Military History of the German speaking Peoples since 1500 erschienen.
© 2022, Peter H. Wilson
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.
© der deutschen Ausgabe 2023 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Lektorat: Daphne Schadewaldt, Wiesbaden
Satz: Arnold & Domnick, Leipzig
Umschlagabbildung: Prinz Oscar von Preußen; © akg-images / arkivi
Umschlaggestaltung: Andreas Heilmann, Hamburg, auf Basis der Umschlaggestaltung der
Originalausgabe von Olga Kominek
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4610-0
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4643-8
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4644-5
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
Vorbemerkung zur deutschen Übersetzung
Einleitung
Teil I: Krieg und Frieden – eine schwierige Balance
1. Kriegsherren
2. Wie man ein Heer aufstellt
3. Wie man Soldat wird
Teil II: Krieg als Dauerzustand
4. Das Monster des Krieges bändigen
5. Stehende Heere
6. Von außerordentlichen zu ordentlichen Lasten
Teil III: Die Professionalisierung des Krieges
7. Habsburger und Hohenzollern
8. Die Professionalisierung des Krieges
9. Die Sozialisierung des Militärs
Teil IV: Die Nationalisierung des Krieges
10. Krieg und Nationenbildung
11. Nationen unter Waffen
12. Der Nation dienen
Teil V: Die Demokratisierung des Krieges
13. Demagogen und Demokraten
14. Vom totalen Krieg zum Ende des Krieges?
15. Bürger in Uniform
Ausblick
Anhang
Dank
Abkürzungen
Anmerkungen
Personenregister
Bildnachweis
Für Rosie
Vorbemerkung zur deutschen Übersetzung
In diesem Buch werden der Einfachheit halber die Begriffe „deutsch“ und „Deutschland“ gebraucht, um bestimmte politische Räume und deren Bewohner zu bezeichnen, die Gegenstand dieses Buches sind. Damit soll nicht zugleich gesagt sein, dass die solcherart bezeichneten Gebiete und Menschen zwangsläufig auch deutschsprachig waren oder sich selbst als „deutsch“ verstanden hätten.
Orts- und Personennamen – etwa von Kaisern, Königen und anderen historischen Persönlichkeiten – werden in der Form verwendet, die in der neueren Literatur üblich ist, wobei in ganz Mittel- und Osteuropa in historischen Zusammenhängen oft noch die deutschen Ortsnamen gebräuchlich sind. Das Heilige Römische Reich, das in der hier behandelten Zeit auch den Zusatz „Deutscher Nation“ führte, wird kurz auch als „römisch-deutsches Reich“ oder schlicht als „Reich“ bezeichnet. Fremdsprachige Begriffe sind kursiv gedruckt und werden bei der ersten Verwendung erklärt.
Geldbeträge werden in historischen Währungen angegeben. Während der ersten drei Jahrhunderte des hier betrachteten Zeitraums waren das im Wesentlichen der aus Silber geprägte Taler in Norddeutschland und der Gulden im süddeutschen Raum und in Österreich. Nominell lag der Wechselkurs für einen Taler bei anderthalb Gulden. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde die Mark eingeführt, deren Wert 1873 bei drei Talern lag. In Österreich wurde 1858 in einer Währungsreform ein „Gulden österreichischer Währung“ eingeführt, der aus 100 Neukreuzern bestand, die so viel wert waren wie zuvor 105 Kreuzer. 1892 wurde der Gulden dann durch die Krone abgelöst, wobei eine Krone zwei Gulden entsprach. Der Erste Weltkrieg destabilisierte die deutsche Mark, die 1924 durch die Reichsmark ersetzt wurde. Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 wurde auch dort die Reichsmark eingeführt. Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg brachte die Einführung der Deutschen Mark oder D-Mark in der Bundesrepublik Deutschland und einer eigenen Mark in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Im Jahr 2002 wurde die D-Mark durch den Euro abgelöst. In der Schweiz gab es vor der Einführung des Franken 1798 keine einheitliche Währung, und selbst der Franken hatte erst ab 1850 in allen Kantonen einen einheitlichen Wert.
Einleitung
Eisen und Blut
„[N]icht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen –, sondern durch Eisen und Blut.“1 So sagte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck in seiner berühmten Rede vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses, mit der er am 30. September 1862 seine Zuhörer dazu bewegen wollte, einer Erhöhung des Militärhaushalts zuzustimmen. Die abschließende Formulierung Bismarcks wurde schon damals bald umgekehrt und als Fehlzitat – „Blut und Eisen“ – sprichwörtlich für den deutschen Militarismus, während Bismarck als der „Eiserne Kanzler“ in die Geschichte einging, der den Krieg als einziges Mittel zur Einigung Deutschlands propagiert habe. Bei näherer Betrachtung stellt sich diese Sicht der Dinge jedoch als Karikatur einer wesentlich komplexeren und auch interessanteren Geschichte heraus.
Bismarck hatte seine Ansprache sorgfältig formuliert, um die Abgeordneten für sich zu gewinnen, zumeist Liberale, die sich für die Schaffung eines deutschen Nationalstaats unter parlamentarisch-demokratischer Regierung aussprachen. Der Ministerpräsident wollte ihnen die Realitäten der Machtpolitik in Erinnerung rufen und ihnen vor Augen führen, dass der Einfluss Preußens ganz von seiner militärischen Leistungsfähigkeit abhing – und nicht etwa auf einer ideologischen Führungsrolle beruhte. Bismarck hatte dabei ein Gedicht von Max von Schenkendorf im Sinn, der 1813 als Freiwilliger an den Befreiungskriegen gegen das napoleonische Frankreich teilgenommen hatte. Darin hieß es:
„Denn nur Eisen kann uns retten,
Und erlösen kann nur Blut,
Von der Sünde schweren Ketten,
Von des Bösen Übermut.“2
Wie auch andere Dichtung aus dieser Zeit wurde Schenkendorfs Werk später von den Nationalsozialisten missbraucht, um ihre eigene Ideologie kulturell zu unterfüttern. Der Titel von Schenkendorfs Gedicht, „Das eiserne Kreuz“, bezog sich auf den neuen Verdienstorden, den der damalige preußische König Friedrich Wilhelm III. im selben Jahr gestiftet hatte; liberal gesinnte Offiziere hatten den König dazu gedrängt, sein bisheriges Bündnis mit Frankreich aufzukündigen. Schenkendorf ist in seinem Gedicht zwar darauf bedacht, die Führungsrolle des Königs angemessen zu würdigen, doch verweist er auch auf das Vermächtnis des Deutschen Ordens in Preußen und dessen christliches Erbe. Andere Werke Schenkendorfs sind typische Beispiele für den jugendlich-romantischen Idealismus der damaligen Zeit und in ihrer Formulierung hinreichend vage gehalten, um Anknüpfungspunkte für christliche und sozialdemokratische Verwendungen zu bieten – und in jüngerer Zeit sogar in Werbekampagnen für Autos und Oberbekleidung aufzutauchen.
Bismarcks Karriere stand auf dem Spiel. Er bekleidete das Amt des preußischen Ministerpräsidenten erst seit einer Woche und sollte für den preußischen König die Blockade des Militärhaushalts beenden. Seine Anspielung auf die Revolution von 1848/49 war eine deutliche Spitze gegen die Liberalen, die damals bei der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche die Oberhand gehabt hatten, ohne freilich in ihren ausgiebigen Debatten den einigen deutschen Nationalstaat zustande zu bringen. Dennoch zeigten die Worte des Ministerpräsidenten nicht die gewünschte Wirkung: Die Abgeordneten wiesen Bismarcks Aufforderung, die Militärausgaben zu erhöhen, ab und stürzten Preußen damit in eine Verfassungskrise, aus der es sich erst nach dem Sieg in zwei Kriegen – 1864 gegen Dänemark und 1866 gegen Österreich – sollte befreien können. Als Auftakt der „deutschen Einigungskriege“ führten diese Konflikte zum Zerfall des Deutschen Bundes, aus dem Österreich mit Gewalt verdrängt wurde. Das Vermächtnis dieser Kriege sollte Mitteleuropa noch hundert Jahre lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Bismarcks Rede hatte den preußischen König Wilhelm I. zunächst beunruhigt, musste dieser doch befürchten, sein Ministerpräsident wolle die „deutsche Frage“ mit Gewalt klären. Während der König an seinem späteren Status als nominell oberster Feldherr des Sieges über Frankreich 1870/71 aber durchaus Gefallen fand, hinterließ der Krieg bei vielen Deutschen zwiespältige Gefühle.3
Die „Blut-und-Eisen-Rede“ Bismarcks sowie die vielfältigen Reaktionen hierauf versinnbildlichen das Hauptargument dieses Buches: dass nämlich der Militarismus durchaus ein integraler Bestandteil der deutschen Vergangenheit gewesen ist und auch die Art und Weise geprägt hat, in der Deutschland seine Kriege geführt hat; dass dieser Militarismus jedoch weder ein abschließender Endpunkt war noch das Ergebnis einer einzigen historischen Entwicklungslinie. Auf den folgenden Seiten möchte ich eine verständliche Darstellung der Militärgeschichte des deutschsprachigen Europas im Lauf der letzten fünf Jahrhunderte geben, die ich in den größeren Rahmen der Entwicklungsgeschichte von Krieg und Kriegführung – an Land, zur See und in der Luft – einbetten werde. Am Ende soll deutlich werden, was die deutsche Kriegserfahrung einzigartig macht oder auch verbindet mit der entsprechenden Erfahrung anderswo in Europa oder vielleicht sogar in der übrigen Welt. Durchweg werde ich die Militärgeschichte in ihren weiteren Kontext einbetten und die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung jener Gebiete, die das heutige Deutschland, Österreich und die Schweiz bilden, nicht aus dem Blick verlieren.
Ein deutscher Sonderweg?
Die Militärgeschichte Deutschlands ist ein äußerst populäres Thema, und an Büchern über die Kriege, Feldzüge, Generäle, Waffen und den Militarismus der Deutschen mangelt es nicht. Jedoch befassen die meisten dieser Werke sich bloß mit der Zeit von 1914 bis 1945, und die fast fünfzigjährige Geschichte des Deutschen Reiches vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs rangiert nur unter „ferner liefen“. Und wenn die Zeit vor den 1860er-Jahren überhaupt Erwähnung findet, dann meist als knappe Hinleitung zum „Aufstieg Preußens“, nicht als eigenständiger Teil einer viel längeren Geschichte. Bei den meisten dieser Bücher handelt es sich um (oftmals stark technisch ausgerichtete) Spezialstudien, insbesondere, wenn es um Waffen, Uniformen und Taktik geht. Etliche bewältigen ihren Gegenstand mit Bravour und frischen Einsichten, doch eine beträchtliche Anzahl käut lediglich abgedroschene Interpretationen und (oft ungenaue oder falsche) sachliche Details wieder.
Diese Verengung auf die Epoche der beiden Weltkriege hat die wissenschaftliche Debatte verkümmern lassen und die Militärgeschichte Deutschlands in einem anachronistischen, teleologischen Interpretationsrahmen gleichsam eingefroren, dessen Ursprünge im späten 19. Jahrhundert liegen und dessen endgültige Gestalt sich nach 1945 ausgebildet hat. Teil dieser Sichtweise ist der Mythos von einer spezifisch „deutschen“ Art der Kriegführung, die angeblich durch die geopolitische Lage Deutschlands im Herzen Europas – und also umgeben von feindseligen Nachbarn – bedingt sein soll. Die Deutschen, so eine verbreitete These, hätten sozusagen eine angeborene Neigung zum Angriffskrieg entwickelt, weil sie stets eine Umzingelung durch ihre Nachbarn befürchten mussten und ihren „Lebensraum“ erweitern wollten. Dies wiederum habe eine besonders autoritäre politische Ordnung erzeugt, weil nur ein Machtstaat die nötigen Ressourcen habe mobilisieren können, um die erforderliche Befähigung zum „Erstschlag“ zu schaffen und dauerhaft zu erhalten. Auf operationeller Ebene hätten die Kriege der Deutschen daher auch „Blitzkriege“ sein müssen, in denen schnelle und entscheidende Siege zu erringen waren, bevor die Feinde sich zusammentun und ihre zahlenmäßige Überlegenheit gegen Deutschland zum Tragen bringen konnten. Das deutsche Militär habe deshalb auch technische Perfektion und technologische Überlegenheit angestrebt, um so immerhin einen gewissen Vorteil gegenüber der Übermacht der Feinde zu erlangen. Zu diesem Zweck auch, hört man immer wieder, sei die Führung der deutschen Streitmacht in die Hände professioneller Militärs gelegt worden, die weitgehend unabhängig von politischer Kontrolle operierten, was letztlich fatale Konsequenzen für die deutsche Gesellschaft und den Frieden in Europa gezeitigt habe.4
Diese Interpretation der Geschichte hat sich zur nahezu unerschütterlichen Orthodoxie verfestigt – nicht zuletzt, weil charakteristische Institutionen des deutschen Militärs wie etwa der Generalstab ab den 1870er-Jahren zu weithin imitierten Vorbildern wurden. Immer wieder zog man den Entwicklungsstand in Deutschland als Maßstab heran, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Armeen anderer Länder daran zu messen. Das Beispiel Deutschlands hat seit den 1970er-Jahren auch die Debatte darüber geprägt, ob es eine spezifisch amerikanische Art der Kriegführung gebe (oder geben sollte). Geblendet vom Schein des „Blitzkriegs“ propagierte die US-Regierung unter Bush Anfang der 1990er-Jahre eine neue Art der High-Tech-Kriegführung, einen „modernen Krieg“, der mit wissenschaftlicher Präzision geführt werden und den amerikanischen Streitkräften einen dauerhaften Vorteil gegenüber ihren Widersachern verschaffen sollte. Das chinesische Militär dagegen hat von seiner früheren Bewunderung der deutschen Methoden abgelassen und sieht in deren Versagen 1914 eine dringende Warnung davor, mit nichts als einem Eröffnungszug und ohne strategischen Plan in den Krieg zu ziehen.5
Selbst kritischere, eher links orientierte Historiker haben bislang kaum etwas unternommen, um die skizzierte Sichtweise zu hinterfragen, untermauert diese doch verbreitete Annahmen über die angebliche Militarisierung und „Feudalisierung“ der deutschen Gesellschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts, welche die Voraussetzungen für den Ersten Weltkrieg sowie letztlich auch für Hitler und den Holocaust geschaffen hätten. Gar nicht selten wird in der Forschung ein kultureller Erklärungsansatz vertreten, demzufolge der deutsche Militarismus im preußischen „Blut und Boden“ gewurzelt habe – eine wertemäßige Umkehrung der nationalistischen Sicht desselben Zusammenhangs im 19. Jahrhundert. Je nach Betrachtungsweise war der preußische Adel entweder unterwürfig oder selbstbewusst, stets jedoch skrupellos, und die preußischen Soldaten gewissermaßen „geborene Krieger“ – eine kontroverse Sicht der Dinge, die in jüngerer Zeit von der politischen Rechten als eine mögliche Inspirationsquelle für die heutige Bundeswehr aufgegriffen worden ist.6 Das preußische Militär sei ein isoliertes, in sich geschlossenes System gewesen, doch habe sein soldatisches Ethos die restliche Gesellschaft durchdrungen und deren Werte korrumpiert.7
Es ist an der Zeit, die gleichsam eingefrorene deutsche Militärgeschichte aufzutauen und sie in Einklang mit den modernen Zugriffsweisen zu bringen, wie sie die Geschichtsschreibung sonst auf die deutsche Vergangenheit anwendet. Die Forschungserträge vieler Jahrzehnte haben ein weitaus nuancierteres und komplexeres Bild des deutschsprachigen Europas gezeichnet. Viele dieser Arbeiten verfolgten dabei einen explizit vergleichenden Ansatz und stellten die Frage, ob man die deutsche Entwicklung denn wirklich als einen besonders kriegslüsternen und autoritären „Sonderweg“ beschreiben könne, der sich deutlich vom Rest Europas unterschieden habe.8 Wenn etwas nämlich besonders ist an dem deutschen Fall, dann ist es die Tatsache, dass Deutschland sich sehr viel länger durch dezentrale Strukturen in Militär und Politik ausgezeichnet hat als die meisten anderen Länder Europas. Die gängige Verknüpfung von politischen Strukturen und militärischer Organisation löst sich in Luft auf, wenn wir eingestehen, dass Länder mit starker liberal-demokratischer Tradition – wie etwa Großbritannien und Frankreich – schon früh ein (zentral-)staatliches Gewaltmonopol eingeführt haben, während die deutsche Entwicklung bis in die 1870er-Jahre von politischer Dezentralität und Strategien der kollektiven Sicherheit geprägt blieb.
Insbesondere das gegenwärtige Interesse an der Globalgeschichte und an transnationalen Prozessen wirft die durchaus berechtigte Frage auf, ob es überhaupt noch statthaft und dem Gegenstand angemessen ist, eine „nationale“ Militärgeschichte zu schreiben. Im deutschen Fall stellt sich diese Frage mit besonderer Dringlichkeit, bedenkt man die vergleichsweise junge Geschichte des heutigen Deutschlands als Nationalstaat. Es gibt schlicht keinen überzeugenden Grund, weshalb man die deutsche Militärgeschichte in das Prokrustesbett einer politischen Geografie zwängen sollte, die sich erst nach 1866 herausgebildet hat – bei der deutschen Sozial-, Wirtschafts-, Religions- oder Kulturgeschichte verfährt man ja auch nicht so. Aus diesem Grund wird das vorliegende Buch die Militärgeschichte all jener Teile Mitteleuropas behandeln, die seit dem Beginn der Neuzeit ständig oder zeitweilig von einer deutschsprachigen Obrigkeit beherrscht wurden, womit etwa das Gebiet der heutigen Staaten Deutschland, Österreich und Schweiz gemeint ist.
Dieser breite geografische Zugang wird zudem einen schwerwiegenden Mangel vermeiden helfen, der sich in den wenigen allgemeinen Darstellungen der Militärgeschichte Deutschlands findet: Alle ohne Ausnahme schreiben sie diese Geschichte teleologisch, als die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang Preußens.9 Einzelne Arbeiten wollen sogar noch längere Kontinuitäten aufzeigen, von dem Cheruskerfürsten Arminius, der einst die römischen Legionen schlug, bis hin zu Hitler.10 Die meisten allerdings stutzen die deutsche Geschichte zurecht, indem sie erst in den 1640er-Jahren einsetzen, die gemeinhin – wenn auch unrichtigerweise – als das Jahrzehnt gelten, in dem die preußische Armee „das Licht der Welt erblickte“. So wird die gesamte militärische Vergangenheit Deutschlands durch die Brille der preußischen Erfahrungen betrachtet, während zugleich das Verständnis der preußischen Entwicklung unzureichend bleibt, weil sie nicht in ihrem größeren deutschen und europäischen Zusammenhang gesehen wird.
Die Entwicklung des Militärs als Institution wird als Geschichte einer einzigen preußisch-deutschen Armee dargestellt, dabei hat Preußen vor seiner gewaltsamen Zerschlagung des Deutschen Bundes überhaupt nur zwei Kriege jemals ohne die tätige Mithilfe mindestens eines weiteren deutschen Territoriums geführt, nämlich den „Düsseldorfer Kuhkrieg“ von 1651 gegen Pfalz-Neuburg und seine Intervention gegen die niederländischen „Patrioten“ 1787. Selbst 1866 standen ihm noch sechs kleinere Verbündete zur Seite. Einen Großteil der deutschen Geschichte hindurch wurde militärische Macht also gerade nicht von einem starken Zentralstaat ausgeübt, sondern blieb dezentralisiert und fragmentiert. In der ganzen Zeit des Heiligen Römischen Reiches und auch seiner stärker föderal verfassten Nachfolger von 1806–1813 und 1815–1866 war und blieb Kriegführen eine Gemeinschaftssache. Selbst das Deutsche Reich von 1871–1918 behielt ein Kontingentsystem bei, in dem Bayern, Württemberg und andere Teilstaaten je eigene Armeen unterhielten.
Noch wichtiger ist vielleicht, dass Preußen bis ins späte 19. Jahrhundert noch nicht einmal die führende „deutsche“ Militärmacht war. Bis dahin hatte nämlich die österreichische Habsburgermonarchie stets über die größere Armee verfügt und galt in den Augen vieler im deutschsprachigen Raum, aber auch in ganz Europa weiterhin als das größere militärische Vorbild. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung taten mehr Schweizer als Preußen Armeedienst – und doch ist im geschichtlichen Zusammenhang der „preußische Militarismus“ in aller Munde. Die militärische Dimension der Schweizer und insbesondere der österreichischen Geschichte ist dagegen zu stark vernachlässigt worden.11 Indem wir die Militärgeschichte aus ihrem anachronistischen, nationalistischen Korsett befreien, können wir all diese neuen Perspektiven aufgreifen. Der breitere Zugang wird zeigen, wie Ideen, Praktiken, Institutionen und Technologien nicht nur innerhalb des deutschsprachigen Mitteleuropas wanderten und weitergegeben wurden, sondern auch von dort in andere Teile Europas und der ganzen Welt. Erst wenn wir all diese Punkte hinreichend ausgelotet haben, werden wir entscheiden können, inwiefern man tatsächlich von einem German way of war, einem spezifisch deutschen Zugang zum Krieg also, sprechen kann und was gegebenenfalls seine weiterreichende historische Bedeutung gewesen ist.
Das Vorhaben dieses Buches
Dieses Buch verbindet eine chronologische Gliederung mit einem thematischen Zugriff. Die Chronologie ist unverzichtbar, wenn man langfristige Entwicklungen nachzeichnen will, während eine Fokussierung einzelner Themenbereiche es erlaubt, besonders wichtige Aspekte unseres Gegenstands genauer zu ergründen. Die im Folgenden zugrunde gelegte Chronologie soll ganz bewusst von der etablierten Standarderzählung vom Aufstieg Preußens und seinem anschließenden Niedergang in zwei Weltkriegen abweichen. Natürlich sind diese Kriege wichtig, und entsprechend ausführlich werde ich sie auch behandeln; aber das große Ganze wird doch erst deutlich, wenn der zeitliche Rahmen der Untersuchung nicht nur in die entferntere Vergangenheit auch vor den 1640er-Jahren ausgedehnt wird, sondern auch über die Epochengrenze von 1945 hinaus in Richtung Gegenwart. Das 1990 wiedervereinigte Deutschland hat inzwischen fast dreimal so lange Bestand gehabt wie das Dritte Reich, und die Friedenszeit seit 1945 hält bereits länger an, als das Deutsche Reich von 1871–1945 überhaupt existiert hat. Eine integrierende Gesamtbetrachtung, in der die Militärgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in der Zeit zwischen 1949 und 1990 zusammen mit der Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg in den Blick genommen wird, steht bislang dennoch aus.
Ein großer Vorteil der langfristigen Betrachtungsweise liegt darin, dass sie ein besseres Verständnis all jener Ereignisse ermöglicht, die als Wendepunkte der deutschen Geschichte gelten: Da wären etwa der Westfälische Frieden von 1648, die Thronbesteigung Friedrichs II. im Jahr 1740, die Niederlage der Preußen gegen die Franzosen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 oder ihr Triumph über die Franzosen bei Sedan 1870, die verheerende Niederlage von 1918 und die „Stunde Null“ im Jahr 1945. All diese Ereignisse werden für gewöhnlich besonders hervorgehoben, weil man sie durch die enge Linse der hohen Politik betrachtet. Eine Hauptaufgabe der folgenden Kapitel wird die Prüfung der Frage sein, inwiefern Siege und Niederlagen auf dem Schlachtfeld tatsächlich deutsche Geschichte „geschrieben“ haben. Die Antwort auf diese Frage wird helfen, Militär und Kriege in den Gesamtzusammenhang der deutschen Vergangenheit einzuordnen.
Allzu oft konzentrieren sich die militärhistorischen Darstellungen bisher auf die deutschen Erfolge, zumeist, indem sie die (angeblich oder tatsächlich) höhere Aggressivität oder überlegene Organisation der deutschen Seite hervorheben. Besonders die Institution des Generalstabs sowie diverse Kommando- und Kontrollstrukturen, die Ausdruck eines einzigartigen kriegerischen Genius gewesen sein sollen, werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. In der deutschsprachigen Forschungsliteratur findet sich diese Sichtweise zwar nur noch selten, doch in der angelsächsischen Geschichtswissenschaft ist sie tief verwurzelt. Selbst offene Lobesworte für die preußisch-deutsche Art der Kriegführung sind dort keine Seltenheit.12 Oft brechen die Darstellungen an dem Punkt plötzlich ab, an dem Anfangserfolge in der Schlacht sich zu langwierigen, kostspieligen Abnutzungskriegen auswuchsen, die entweder in eine Pattsituation mündeten (wie etwa für Preußen im Siebenjährigen Krieg) oder in die totale Katastrophe (so in beiden Weltkriegen). Schenkt man jedoch den Niederlagen größere Beachtung, wird schnell deutlich, dass die Besonderheit der preußisch-deutschen Kriegführung zwischen der Mitte des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem darin lag, wie besessen die militärisch Verantwortlichen davon waren, einen schnellen Sieg zu erringen. Was sie im Erfolgsfall dann damit anfangen sollten oder wie sie vorzugehen hatten, wenn der Erfolg vorerst ausblieb, war ihnen vergleichsweise weniger wichtig.13 Der Impuls für diese Herangehensweise lag weniger in dem selbstbewussten Glauben, dass Gewalt zur Erreichung politischer Ziele tauge, sondern eher in der Sorge, sich einen langwierigen Krieg ganz einfach nicht leisten zu können. Tatsächlich gab es zwischen der Sphäre der militärischen Planung und einer etwaigen Gesamtstrategie des deutschen Nationalstaats fast immer eine fatale Diskrepanz, die dazu führte, dass andere, möglicherweise zweckdienlichere Handlungsoptionen unausgelotet blieben.
Vor diesem Hintergrund ist auch die chronologische Gliederung dieses Buches in fünf Teile zu verstehen, die sich mit den unterschiedlichen Formen militärischer Organisation und Praxis befassen, die in dem jeweiligen Jahrhundert vorherrschten, aber auch auf deren Zusammenhang mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen eingehen. Dass wir unsere Chronologie schon im 16. Jahrhundert einsetzen lassen, ermöglicht es uns, die Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz von ihren gemeinsamen Ursprüngen im Heiligen Römischen Reich her nachzuverfolgen – und damit von einer Zeit her, als das Gesicht des Krieges in Europa sich grundlegend veränderte. Zwar hatte es auch im mittelalterlichen Europa nicht an Konflikten gemangelt, doch blieb die Kriegführung damals in der Regel zeitlich wie räumlich eng eingegrenzt. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bildeten sich dann erste Mechanismen zur Mobilisierung und Lenkung militärischer Ressourcen heraus, die kontinuierlicher und koordinierter funktionierten als zuvor. Für die deutsche Geschichte erwies es sich als bedeutsam, dass dies nicht durch die Schaffung eines großen Nationalstaats geschah, sondern auf der Grundlage kollektiv agierender, multilateraler Strukturen. Nicht Zentralisierung, sondern Autonomie sollte bis ins 20. Jahrhundert der entscheidende politische Charakterzug des ganzen deutschsprachigen Raumes bleiben. Nach zwei Weltkriegen erlebte diese Autonomie ein „Comeback“ in modernisierter Form: als der Föderalismus, der in den Verfassungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft fest verankert ist.
Zwischen 1480 und 1520 beschleunigte sich die institutionelle Konsolidierung des Reiches, wozu auch die Schaffung geeigneter Strukturen gehörte, um Soldaten und Gelder für die Kriegführung zu mobilisieren, aber auch Streitigkeiten zwischen den diversen politischen Autoritäten des Reiches beizulegen. Es existierten verschiedene Varianten eines dreistufigen Mobilisierungssystems, in dem ein ausgewähltes Aufgebot junger Männer durch zwei Kategorien von Reservisten unterstützt wurde. Obwohl im Lauf der Jahre zahlreiche Veränderungen im Detail vorgenommen wurden, blieben die Grundzüge dieses Rekrutierungsmodells bis ins 20. Jahrhundert unverändert. Diese frühen Strukturen und die politische Kultur, die sie begünstigten, übten einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die spätere Entwicklung aus, nicht zuletzt, weil sie das Nebeneinander zahlreicher „Kriegsherren“ legitimierten, die alle über das Recht zur Waffengewalt verfügten.
Am anderen Ende der in diesem Buch untersuchten Zeitspanne gewinnen wir neue Perspektiven auf die beiden Weltkriege, wenn wir sie im größeren Zusammenhang des 20. Jahrhunderts betrachten und nicht als ein vermeintlich unabwendbares Resultat stümperhafter Einigungsbestrebungen im Deutschen Kaiserreich zwischen 1871 und 1914. Ein weiterer großer Vorteil des hier gewählten chronologischen Zugangs ist, dass Friedens- wie Kriegszeiten gleichermaßen berücksichtigt werden. Wenn bislang die Frage nach einer speziell deutschen Herangehensweise an Krieg und Kriegführung untersucht worden ist, so lag der Schwerpunkt der Darstellung fast ausschließlich auf dem tatsächlichen Kriegsgeschehen nach Ausbruch der Feindseligkeiten, während die oftmals langen Perioden relativen Friedens – wie 1553–1618, 1815–1848, 1871–1914 oder 1945 bis heute – übersehen wurden. Es ist auch keineswegs so, dass die deutschen Staaten einschließlich Preußens ganz besonders gut für einen Krieg gerüstet gewesen wären. In allen Ländern Europas gab es Planungen für künftige Konflikte, und erst wenn der vermeintliche deutsche Sonderfall in diesen Kontext hineingestellt wird, lässt sich absehen, wie viele der Behauptungen über die angeblich erzmilitaristische deutsche Vergangenheit in Wahrheit deutlich überzogen sind.
Diese Argumentation wird kontrovers aufgenommen werden, weshalb ich eines gleich zu Beginn meines Buches klarstellen möchte: Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, die deutsche Geschichte weißzuwaschen oder das Werk der Vernichtung zu beschönigen, das deutsche Soldaten namentlich im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Wie der damalige Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Ansprache zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2015 feststellte: „Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz.“14 Gleichermaßen soll der vergleichende Ansatz des vorliegenden Buches die deutschen Erfahrungen lediglich kontextualisieren und nicht etwa durch ein plumpes Gegeneinanderaufrechnen von Opferzahlen relativieren, wie es im „Historikerstreit“ der 1980er-Jahre mitunter geschehen ist, wenn Vergleiche zwischen Hitler, Stalin und Pol Pot angestellt wurden. Außerdem sei noch angemerkt, dass ich das Adjektiv „deutsch“ der Einfachheit halber für alle Teile Europas verwende, die zur damaligen Zeit in Staaten lagen, die eine deutschsprachige Regierung hatten. Das vorliegende Buch wendet sich dezidiert gegen Behauptungen der Art, die Deutschen besäßen ein besonderes „Krieger-Gen“, das auf ihre Bindung an „Blut und Boden“ zurückgehe. Tatsächlich kann eine in dem hier vorgestellten Sinne „deutsche“ Militärgeschichte nur dann sinnvoll geschrieben werden, wenn man die Erfahrungen von Millionen von Menschen berücksichtigt, die andere Muttersprachen hatten. Das gilt nicht nur für die Schweiz und für Österreich-Ungarn, sondern auch für Preußen, wo zu allen Zeiten eine große Zahl von polnisch- und litauischsprachigen Einwohnern lebte.
Jeder der fünf chronologisch geordneten Hauptteile dieses Buches ist in drei Kapitel unterteilt, in denen zentrale Themenbereiche durch die Zeit verfolgt werden sollen, ohne dabei das Erzählen der Geschichte aus dem Blick zu verlieren. Das Eröffnungskapitel in jedem Hauptteil befasst sich in chronologischer Folge mit dem Verhältnis von Krieg und Politik und hierbei insbesondere mit der Frage, warum Kriege geführt wurden und inwiefern die deutsche Geschichte der jeweiligen Epoche „auf dem Schlachtfeld geschrieben“ wurde. Das mittlere Kapitel untersucht die Ausübung von Befehlsgewalt, militärischer Planung und Aufklärung sowie die Frage, auf welche Weise Truppen rekrutiert, organisiert, ausgerüstet und ausgebildet wurden. Am Ende dieser mittleren Kapitel gehe ich jeweils auf die Seekriegführung ein, das entsprechende Kapitel für das 20. Jahrhundert (Kapitel 14) enthält einen zusätzlichen Abschnitt zum Luftkrieg. Das dritte und abschließende Kapitel in jedem Hauptteil ist Fragen zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext gewidmet. Es untersucht die Haltung der Menschen zum Krieg, die Motivation der Soldaten, ihre rechtliche Stellung, ihr Verhältnis zur Gesellschaft als ganzer sowie die demografischen und ökonomischen Auswirkungen des Krieges.
Teil IKrieg und Frieden – eine schwierige Balance
1. Kriegsherren
Militärische Macht und politische Autorität
Im spätmittelalterlichen Europa teilten sich zahlreiche Akteure das Recht zur Gewaltausübung. In den Augen der Historiker des 19. Jahrhunderts mussten solche Zustände als ein gefährliches Durcheinander erscheinen, in dem Raubritter und Provinztyrannen um die Vorherrschaft kämpften. Als fortschrittlich galt dagegen das Aufkommen mächtiger Monarchen – wörtlich „Alleinherrscher“ –, die ganze Staaten unter sich vereinigten. Die von ihnen begründeten Staatsgebilde waren es, die dann ein Monopol der legitimen Gewaltausübung für sich beanspruchten. Zu diesen Gründerfiguren des modernen Verständnisses von staatlicher Gewalt gehören Ludwig XI. in Frankreich, Heinrich VII. in England, Matthias Corvinus in Ungarn sowie Ferdinand von Aragón und Isabella von Kastilien in Spanien. All diesen Herrschern war gemein, dass sie nach langen inneren Kriegen auf den Thron gekommen waren und durch die Schaffung mächtiger „neuer Monarchien“ in die Geschichte eingingen. Die Kartenwerke des 19. Jahrhunderts würdigten dies, indem sie diese Königreiche als solide Farbflächen darstellten, im Kontrast zu dem bunten Flickenteppich des Heiligen Römischen Reiches, der sich im Herzen Europas ausbreitete.
Das Heilige Römische Reich
Die Unterschiede zwischen jenen großen Königreichen und besagtem Flickenteppich aus Kleinstaaten waren eigentlich gar nicht so groß, wie die Landkarten oder großen Narrative vermuten lassen. Dennoch hat die herkömmliche Meinung den wahren Kern, dass es in den Territorien des römisch-deutschen Reiches im Spätmittelalter tatsächlich eine beträchtliche Streuung von (militärischer) Macht gegeben hat. Vom Kaiser an der Spitze bis hinunter zu den Ratsgremien einzelner Städte gab es eine Vielzahl potenzieller „Kriegsherren“. Mit diesem Begriff bezeichne ich eine legitime politische Autorität, die militärische Gewalt ausübt. Der deutsche „Kriegsherr“ hat kaum etwas von dem abwertenden Beiklang seines englischen Gegenstücks, des warlord, der militärische Macht für seine eigenen Zwecke einsetzt, also um politische Autorität zu erlangen und durchzusetzen. Das Nebeneinander so vieler Kriegsherren war zwar ein Charakteristikum des Heiligen Römischen Reiches, aber es war nicht unbedingt ein Nachteil. Vielmehr stand es für eine andere Art der Kriegführung, die wiederum das besondere Wesen des Heiligen Römischen Reiches widerspiegelte, in dem Macht nicht als zentrales Monopol gebündelt, sondern geteilt wurde und auf viele Träger verteilt war.
In allen europäischen Staatswesen des Spätmittelalters traten drei Formen von Gewalt auf: bei der Friedenssicherung nach innen, bei der Verteidigung nach außen und bei der Regulierung kriegerischer Aktivitäten der eigenen Untertanen jenseits der Grenzen.1 Der eigentümliche Charakter der politischen Strukturen im deutschsprachigen Raum sorgte dafür, dass alle drei Punkte anders gehandhabt wurden als bei den Nachbarn im Westen und Süden. Frankreich, Spanien und die italienischen Staaten stellten im Europa des späten 15. Jahrhunderts insofern eine Ausnahme dar, als sie in Friedens- und Kriegszeiten stehende Heere unterhielten. Darin hat man im Verbund mit dem Aufbau von Institutionen und Steuersystemen, die zum Unterhalt solcher Heere vonnöten sind, einen notwendigen Schritt in Richtung des modernen Staates gesehen.2
Tatsächlich mussten christliche Herrscher sich auf erheblichen Widerstand einstellen, wollten sie in Friedenszeiten zum Krieg rüsten. Krieg galt als Ultima Ratio herrschaftlichen Handelns, wenn er nicht gerade gegen die Osmanen oder andere „Ungläubige“ geführt wurde. Dass es einiger Untertanen bedurfte, die im Umgang mit Waffen geschult und entsprechend ausgerüstet waren, mochte man noch akzeptieren; aber der finanzielle Aufwand, den ein Heer von professionellen Soldaten bedeutete, sollte nach allgemeiner Auffassung die absolute Ausnahme bleiben. Unter der Voraussetzung, dass Truppen im Bedarfsfall auch einfach ausgehoben werden konnten, erschien es als reine Verschwendung, ja als ein Affront gegen Gott, wenn man auch in Friedenszeiten noch in Waffen blieb. So gesehen bestand der wahre Unterschied zwischen dem Heiligen Römischen Reich (und auch der Eidgenossenschaft) und vielen anderen Territorien Europas also nicht darin, dass man im Reich an der Aufgabe gescheitert wäre, stehende Heere unter zentraler Kontrolle einzurichten, sondern vielmehr darin, dass es gelang, das spätmittelalterliche Ideal mit für die eigenen Zwecke hinreichender Effizienz in die Praxis umzusetzen.
Während dreier der in diesem Buch behandelten fünf Jahrhunderte bildete das Heilige Römische Reich den politischen Rahmen für das deutschsprachige Mitteleuropa, und die späteren Staaten Deutschland, Österreich und Schweiz gehen alle darauf zurück. „Heilig“ war es, weil es seit dem Jahr 800 als weltliche Schutzmacht der Päpste auftrat, aber auch durch die geistlichen Reichsfürsten, die kollektiv als Reichskirche bezeichnet werden und etwa ein Siebtel des gesamten Reichsterritoriums kontrollierten. „Römisch“ war das Reich kraft seines Anspruchs, eine lückenlose Fortsetzung des Römischen Reiches der Antike darzustellen, und zu diesem „römischen Erbe“ gehörte auch die Ambition, ganz Europa eine Ordnung zu geben.3
Nachdem es sich im Hochmittelalter beträchtlich nach Osten ausgebreitet hatte, schrumpfte das Reich nach 1250 wieder ein wenig, namentlich im Süden und im Westen. Dadurch trat der „deutsche“ Charakter stärker hervor, obschon das Reich sich stets eher politisch als sprachlich oder kulturell definierte. Der Zusatz „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation“ erschien erst im späten 15. Jahrhundert und wurde nie Bestandteil der offiziellen Titulatur. Es war immer klar und allgemein akzeptiert, dass viele Bewohner des Reiches andere Sprachen sprachen als Deutsch. Vor dem Ende des Reiches im Jahr 1806 störte sich daran mit Ausnahme einiger Gelehrter niemand.
Das Heilige Römische Reich war nie ein zentral regiertes Königreich, sondern entwickelte sich im Verlauf mehrerer Phasen, für die ein Wandel in den Beziehungen der Herrschaftselite untereinander kennzeichnend war. Die Unterscheidung zwischen Erb- und Wahlkönigtum wurde in vielen Monarchien irgendwann aufgeweicht, und die meisten europäischen Königreiche hatten unter Instabilität und dynastischen Wechseln zu leiden. Der Wahlcharakter des römisch-deutschen Kaisertums dagegen wurde mit der Zeit immer deutlicher gefasst. Ab 1356 war das Wahlrecht auf sieben Reichsfürsten beschränkt, die den König und Kaiser „küren“ sollten und deshalb als „Kurfürsten“ bezeichnet wurden. Die Zahl der potenziellen Thronkandidaten war in der Regel sogar noch kleiner, und die Gepflogenheit, dass der künftige Herrscher vor seiner Kaiserkrönung zunächst zum „König der Römer“ (rex Romanorum) gewählt wurde, ermöglichte es dem amtierenden Kaiser, seinen Sohn als designierten Nachfolger zu positionieren.
In der Reichspolitik verschränkten sich stets vertikale Beziehungen zwischen (Lehns-)Herren und Gefolgsleuten mit kollektiven, horizontal-assoziativen Elementen. Die beiden Beziehungsdimensionen mussten keineswegs im Gegensatz zueinander stehen, und überhaupt wäre es eine zu starke Vereinfachung, das Beziehungsgeflecht auf einen Dualismus zwischen Kaiser und Reichsfürsten zu reduzieren, die einander in Wahrheit in wechselseitiger Abhängigkeit verbunden waren. Die Fürsten hatten überhaupt kein Interesse daran, den Kaiser zu einer bloßen Galionsfigur zu reduzieren oder sich der kaiserlichen Autorität zu entziehen. Nicht nur waren ihre Territorien in aller Regel zu klein, um eine unabhängige Existenz überhaupt zu ermöglichen, sondern ihr ganzes Selbstwertgefühl beruhte auf ihrem Status als Reichsfürsten, die Rechte und Privilegien innerhalb des so viel größeren Gesamtreiches genossen. Sie mochten im noch so heftigen Streit mit dem Kaiser oder mit ihren Nachbarn liegen: Die Existenzberechtigung des Reiches stellten sie nicht infrage, zumindest bis unmittelbar vor dessen Auflösung. Zudem behielt das Erbe des Heiligen Römischen Reiches auch über dessen formales Ende 1806 hinaus noch eine beträchtliche moralische und sogar juristische Autorität.
Die Macht des Kaisers hing stets von den Umständen ab – und davon, wie gut der jeweilige Inhaber des Amtes mit den vielfältigen Herausforderungen fertigwurde. Im 15. Jahrhundert kam es zur Konsolidierung einer reichsinternen Hierarchie. Diese Verfestigung fand ihren Niederschlag in Dokumenten, die man zur Reichsverfassung zählte. Am Ende ergab sich eine vierstufige Autoritätspyramide mit dem Kaiser an der Spitze. Dieser war der einzige europäische Herrscher, der einen Kaisertitel trug, und war für den Bereich des Heiligen Römischen Reiches der oberste Lehnsherr. Bestimmte Prärogativen (Vorrechte) teilte er sich mit den führenden Fürsten und Städten des Reiches, deren hervorgehobene Stellung sich in ihrem „reichsunmittelbaren“ oder „immediaten“ Status niederschlug. Das bedeutete, dass sie dem Kaiser unmittelbar, ohne vermittelnde Instanz, unterstellt waren. Zusammen bildeten sie die Reichsstände, die berechtigt waren, zum Reichstag zusammenzutreten, wenn ihr Kaiser und Lehnsherr diesen einberief. Der Kaiser war dabei sowohl Monarch als auch selbst Reichsstand, nämlich in seiner Eigenschaft als Herr seiner Erblande. In den Jahren 1500–1512 wurde dann mit den zehn Reichskreisen, in die die meisten Reichsstände inkorporiert wurden, eine weitere, zwischengeschaltete Hierarchiestufe geschaffen. Die Kreise boten ein zusätzliches Forum, um strittige Fragen zu diskutieren, das politische Vorgehen untereinander abzustimmen und um Geldmittel und Truppen für gemeinsame militärische Unternehmungen zu sammeln.4
Die Reichsstände, die sowohl auf der reichsunmittelbaren Ebene als auch auf jener der Reichskreise aktiv waren, erfüllten zugleich auf dritter, „territorialer“ Ebene die Funktion als Herrscher über ihre jeweiligen reichsunmittelbaren Lehen. Obwohl man oft von „den Reichsfürsten“ im Allgemeinen spricht, teilte sich diese Gruppe noch einmal in drei Untergruppen mit unterschiedlichem Rang. Am höchsten standen die Kurfürsten, dann kamen die anderen reichsständischen Territorialherren (zu denen nicht nur Fürsten im engeren Sinne, sondern auch Grafen und einige niedere Herren zählten) und schließlich die Reichsstädte, deren Räte von den stimmberechtigten Bürgern gewählt wurden. Im Lauf des 15. Jahrhunderts trat der Reichstag immer häufiger zusammen, was in der Notwendigkeit begründet lag, Gelder und Truppen zur Abwehr kollektiver Bedrohungen zu organisieren (wie etwa gegen den Aufstand der Hussiten in Böhmen 1419–1434).
Diejenigen reichsunmittelbaren Fürsten und Städte, die diese neuen Verantwortlichkeiten auf sich nahmen, konnten ihren Status als Reichsstände bis 1521 endgültig festigen, während andere, die dies entweder nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten, auf die vierte Hierarchieebene der mittelbaren Reichsangehörigkeit „abrutschten“. Auf dieser niedrigsten Stufe der Reichshierarchie fanden sich mehr als 50.000 adlige Familien, zahlreiche kirchliche Einrichtungen und etwa 1500 Städte im Machtbereich der Reichsstände. In einem Prozess, der spiegelbildlich zu der Entwicklung auf der Reichsebene verlief, sicherten sich viele dieser niederen Autoritäten ein gewisses Maß an Repräsentation in territorialen Ständeversammlungen, den Landständen. Diese berieten dann darüber, wie man gemeinsame Herausforderungen am besten meistern solle, darunter auch die wachsenden Forderungen nach Soldaten und Steuergeldern vonseiten der Reichsobrigkeit.
Die Entstehung der kollektiven Sicherheit
Wie genau das Reich derartige Lasten verteilte, sollte sich als ein Schlüsselfaktor zur Bewahrung seiner komplexen Struktur auch über das Spätmittelalter hinaus erweisen und verhinderte zugleich das Entstehen einer zentralisierten Monarchie. In einer Epoche, in der es alles andere als leicht war, Reichtum zu messen, schien es ausreichend, wenn man den einzelnen Reichsständen jeweils feste Forderungen auferlegte und es ihnen dann überließ, sich um die Erhebung von Steuern oder anderen Beiträgen selbst zu kümmern. Was jeder Reichsstand zu liefern hatte, wurde in Matrikeln festgehalten, von denen die Reichsmatrikel von 1521 die Grundlage für alle späteren Berechnungen bildete.5 Insgesamt 4000 Mann Kavallerie und 20.000 Fußsoldaten verteilten sich nach der Reichsmatrikel auf die verschiedenen Territorien, die diese Truppen entweder selbst ausheben und ausrüsten oder aber einen entsprechenden Geldwert beisteuern mussten. Berechnungsgrundlage hierbei war die Summe, die der Unterhalt des Reichsheeres während eines Monats kostete. Da das Reichsheer ursprünglich einmal als Eskorte für den traditionellen Romzug des Herrschers zur Kaiserkrönung gedacht gewesen war, bezeichnete man die entsprechende Steuerrechnungseinheit als „Römermonat“. Der größte Nachteil dieses Systems war, dass die in der Reichsmatrikel genannten Quoten nur eine Annäherung an die tatsächliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Territorien darstellten. Und wenn sie erst einmal festgeschrieben waren, ließ sich eine Änderung nur sehr schwer durchsetzen – es sei denn natürlich, es handelte sich um eine Senkung der Beiträge. Dennoch konnten die in der Reichsmatrikel festgelegten Beiträge auch in Bruchteilen oder Vielfachen eingetrieben werden, wie die Situation es eben erforderte. Dieses System passte gut zur politischen Kultur des Reiches, und außerdem funktionierte es im Allgemeinen gar nicht schlecht.
Die militärische Autorität war also fragmentiert, nicht monopolisiert. Der Kaiser und die Reichsstände waren alle potenzielle Kriegsherren, und auch das Reich und die Reichskreise konnten bei Bedarf kollektiv als Kriegsherr agieren. Ab 1519 war der Kaiser verpflichtet, die Reichsstände zurate zu ziehen, bevor er im Namen des Reiches in den Krieg zog. Allerdings konnte er dies auch weiterhin auf eigene Faust tun, wenn er dazu auf die Ressourcen seiner ausgedehnten Erblande zurückgriff. Die Reichsstände konnten ebenfalls Heere aufstellen und unterhalten, und auch die Reichskreise wurden durch neue Rechtsetzung bis 1555 in den Stand versetzt, auf eigene Initiative zu handeln, um Reaktionen auf direkte Bedrohungen zu koordinieren, ohne vorher den Kaiser oder den Reichstag um Erlaubnis fragen zu müssen.
Bündnisse boten eine zusätzliche Möglichkeit zur militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit. Die Reichsstände konnten sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammenschließen, doch anders als ihre polnischen oder ungarischen Pendants hatten die deutschen Reichsstände kein verfassungsmäßiges Widerstandsrecht, weshalb jede Verabredung zwischen ihnen, so sie nicht gegen Reichsrecht verstoßen sollte, auf die Erhaltung des Reiches gerichtet sein musste. Das bedeutendste derartige Bündnis war der 1488 geschlossene Schwäbische Bund, der zum Vorbild für spätere Zusammenschlüsse dieser Art wurde. Wenn Kaiser Friedrich III. den Schwäbischen Bund förderte, dann um den Einfluss der Wittelsbacher in Südwestdeutschland einzuschränken, jedoch kam der Bund auch seinem offiziellen Zweck nach und sicherte den Landfrieden. Seine Organisationsform und sein praktisches Vorgehen brachten einen signifikanten Fortschritt für die kollektive Sicherheit auf der Ebene des Reiches.6 Auch die Reichskreise konnten Bündnisse eingehen, die ab dem 17. Jahrhundert als „Kreisassoziationen“ bekannt waren und der Form nach Verteidigungsbündnisse darstellten. Die habsburgischen Erblande waren auf den Österreichischen und den Burgundischen Reichskreis aufgeteilt, die sich beide fast ausschließlich aus habsburgisch beherrschten Territorien zusammensetzten, was es den Habsburgern ermöglichte, die Kreisstruktur nach Belieben für ihre Zwecke einzusetzen.
Die Ausübung von Gewalt im Innern des Reiches wurde durch den „Ewigen Landfrieden“, der auf dem Reichstag in Worms 1495 verkündet wurde, stark eingeschränkt. Dieses Reichsgesetz verbot es den Reichsständen, ihre Konflikte gewaltsam auszutragen. Ähnliche Initiativen hatte es schon zuvor gegeben, doch diesmal zeigte das Gewaltverbot wesentlich stärkere Wirkung, weil mit dem Reichskammergericht zugleich eine neue gerichtliche Instanz geschaffen wurde, die Streitigkeiten auf dem Rechtsweg entscheiden sollte. Die neuen juristischen und institutionellen Strukturen waren noch nicht ganz ausgebildet, als sich in den Jahren ab 1517 die Reformation zu einem bleibenden Schisma in der westlichen Christenheit entwickelte. Seit seinem berühmten Aufeinandertreffen mit Martin Luther beim Reichstag in Worms 1521 ließ sich Kaiser Karl V. in der Reichspolitik von einem Verständnis seiner kaiserlichen Rolle leiten, das den Kaiser als Hüter der weltlichen Ordnung sah und theologische Fragen dem Papst überließ. Die Anhänger Luthers wurden vom Kaiser nicht als Häretiker verfolgt, sondern weil sie Land und Einkünfte an sich brachten, die der katholischen Kirche zustanden, um ihre eigenen kirchlichen Strukturen aufzubauen. Von Anfang an wurde die Auseinandersetzung um die Reformation also dadurch geprägt, dass verschiedene Reichsstände sich in einer Rivalität um den Zugang zu kirchlichen Ressourcen befanden, darunter auch der noch immer beträchtliche Landbesitz der geistlichen Reichsfürsten. Diejenigen Fürsten und Städte, die den neuen Glauben annahmen, erlegten rasch denjenigen ihre Autorität auf, die ebenfalls der neuen Lehre anhingen, und noch radikalere Bewegungen wie etwa die der Wiedertäufer wurden gnadenlos verfolgt. So wurden religiöse Konflikte innerhalb der Reichshierarchie gleichsam nach oben gedrückt, bis auf eine Ebene, auf der theologische Fragen weniger wichtig waren als etwa der rechtmäßige Anspruch auf bestimmte Hoheitsrechte.
Die „Exekution“ oder Vollstreckung von Gerichtsentscheiden, Reichstagsbeschlüssen oder kaiserlichen Dekreten oblag einem damit beauftragten Reichsfürsten, der durch den Kaiser oder die Reichskreise benannt wurde. Die äußerste Strafe war die Reichsacht, durch die der Kaiser einen Übeltäter für „vogelfrei“ erklärte. Damit stand er nicht mehr unter dem Schutz des Reiches und durfte ungestraft getötet werden. Wer eine solche oder andere Strafe vollstreckte, konnte damit rechnen, auf Kosten des Bestraften für seine Mühe belohnt zu werden, was dem ganzen Verfahren größeres Gewicht gab, jedoch auch zu politischen Komplikationen in der Umsetzung führen konnte. Die Reichsacht wurde jedoch eher selten verhängt, und die übliche Antwort der Obrigkeit auf Gewalt waren abgestufte Maßnahmen, die von förmlichen Ermahnungen über gerichtliche Verfügungen und Urteile reichten, bevor schließlich ein oder mehrere Reichsstände damit beauftragt wurden, den Landfrieden wiederherzustellen. Auf allen diesen Stufen gab es die Möglichkeit, Verhandlungen zu führen, woran das allgemeine Verlangen nach Frieden und Konsens deutlich wird, an dem die gesamte politische Kultur des Heiligen Römischen Reiches ausgerichtet war.
Trotz dieser Vollstreckungsmechanismen litt das Reich zu allen Zeiten an einem gewissen „Schwarzfahrerproblem“: Manche Reichsstände drückten sich vor ihren Beiträgen zum Reichsheer und behaupteten – manchmal sogar mit Recht –, dass sie ihr Kontingent aufgrund direkterer Bedrohungen lieber bei sich behalten wollten. Die Habsburger argumentierten immer wieder, dass ihre Truppen, ganz egal wo sie zum Einsatz kamen, ohnehin die Kontingente des Österreichischen und des Burgundischen Reichskreises repräsentierten. Andere wiederum beklagten sich, sie seien zu hoch veranschlagt oder von ihrer Beitragspflicht befreit worden. Doch nur wenige widersetzten sich dem Verfahren generell und aus politischen Gründen, und im Allgemeinen konnte der Umsetzungsgrad gut mithalten mit den tatsächlich eingetriebenen Steuern in den stärker zentralisierten Monarchien.7
Aufgabe der Reichsstände blieb es, sich eine Strategie zur Bereitstellung der von ihnen verlangten Soldaten und Geldmittel zu überlegen. Im 16. Jahrhundert verließ man sich gemeinhin auf die Vasallenpflicht der eigenen Lehnsleute, um Kavallerie und nichtkämpfende Kräfte, etwa für Schanzarbeiten, zu mobilisieren; dazu kam eine Milizinfanterie auf Basis anderer feudaler Verpflichtungen. Die so rekrutierten Truppen wurden jedoch zunehmend durch bezahlte Profis ergänzt. Einige von diesen professionellen Kräften wurden dauerhaft engagiert, doch die meisten wurden nach Bedarf durch Militärunternehmer rekrutiert. Jede Methode hatte ihre Vor- und Nachteile, und es war keinesfalls so, dass Berufssoldaten etwa im Nullkommanichts das feudale Aufgebot ersetzt hätten.
Österreich
Österreich war bereits die europäische Führungsmacht, als die Habsburger Mitte des 15. Jahrhunderts die Luxemburger an der Spitze des Reiches ablösten. Die Familie der Habsburger, die ursprünglich aus der Schweiz stammte, hatte schon seit 1279 über Österreich geherrscht. Um 1358 legten sie sich den einzigartigen, fast schon königlichen Rang von Erzherzögen zu, der ihre Vorrangstellung gegenüber den anderen Fürsten zum Ausdruck bringen sollte. Ihre umfangreichen Besitzungen reichten aus, um den Erfolg der habsburgischen Kandidaten bei künftigen Kaiserwahlen beinahe zu garantieren, aber um die Reichsgeschicke zu lenken, bedurften sie doch der Kooperation der Reichsstände. Dieses Gleichgewicht verschob sich deutlich, nachdem das Netz von Heiratsbündnissen, die Maximilian I. ausgehandelt hatte, Früchte trug: Zwischen 1516 und 1526 erwarben die Habsburger Spanien, Böhmen und ein Drittel Ungarns.8 Zuvor hatte sich Maximilian in den Jahren bis 1493 schon den größten Teil Burgunds gesichert, wodurch das Haus Habsburg mehr als ein Drittel des Reichsterritoriums in seinem unmittelbaren Besitz hatte, von weiterem Landbesitz jenseits der Reichsgrenzen ganz zu schweigen. Diese Verbreiterung der Ressourcenbasis wurde jedoch durch eine entsprechend erhöhte Bedrohung mehr als wettgemacht, insbesondere nachdem Frankreich sich von einer langen Phase von inneren wie äußeren Kriegen erholt und zu alter Stärke zurückgefunden hatte. Zugleich nahmen die osmanischen Türken ihre Eroberung des Balkans wieder auf, die letztlich zum Zusammenbruch Ungarns führte.
Weil sie es darauf abgesehen hatten, eine größere Rolle auf der europäischen Bühne zu spielen, gingen die Habsburger im Reich Kompromisse ein und akzeptierten ein höheres Maß an Integration in die neuen Institutionen, die sich ab den 1490er-Jahren herausbildeten. Im Gegenzug konnten sie erwarten, dass man ihren Anspruch auf die Kaiserwürde anerkennen und ihre Aktivitäten jenseits der Reichsgrenzen – vor allem gegen die Osmanen – unterstützen würde, zumindest ein wenig. Diese neue Balance zwischen Kaiser und Reich wurde erstmals anlässlich der Wahl Karls V. 1519 in einer Wahlkapitulation festgeschrieben, auf die der neue Kaiser von den Kurfürsten verpflichtet wurde. Bei allen folgenden Kaiserwahlen wurde sie im Wesentlichen unverändert übernommen. Karls spanische Besitzungen waren nicht Teil des Reiches (mit Ausnahme der burgundischen und italienischen Territorien, die ohnehin zum Reich gehörten), weshalb er hier schalten und walten und ihre Ressourcen einsetzen konnte, wie es ihm beliebte. Wenn er jedoch die Unterstützung der Reichsstände anfordern wollte, musste er sich zunächst mit den Kurfürsten und dem Reichstag einig werden.
In einer Zeit, in der politischer Erfolg oder Misserfolg noch immer maßgeblich von den persönlichen Beziehungen zwischen Herrscher und lokalen Eliten abhing, lag die Schwierigkeit auf der Hand, ein so riesiges dynastisches Reich zu regieren. Weil Karl V. einsah, dass er nicht überall zugleich sein konnte, setzte er in einzelnen Herrschaftsbereichen Verwandte als seine Stellvertreter ein. Österreich selbst vertraute er 1521 seinem jüngeren Bruder Erzherzog Ferdinand an, der den oft abwesenden König auch in der Regierung des Reiches zunehmend ersetzte.9
Deutschland
Trotz ihrer Größe zählten Österreich, Burgund und Böhmen als je ein einziger Reichsstand. Die Reichsmatrikel von 1521 führt insgesamt 402 Reichsstände auf, darunter 7 Kurfürstentümer, 83 Fürstentümer, 226 Grafschaften, Klöster und sonstige Herrschaften sowie 86 Städte. Dazu kamen noch etwa 1500 Reichsritter, die ihr Lehen unmittelbar vom Kaiser empfangen hatten. Diese Zahlen werden immer wieder angeführt, wenn es darum geht, die „heillose“ Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches zu belegen. Dabei sollten viele der kleineren Reichsstände schon im Verlauf des 16. Jahrhunderts verschwinden, etwa wenn mächtigere Herren ihren Anspruch auf Autonomie beiseitewischten oder wenn sie – wie es gut der Hälfte der 136 geistlichen Reichsstände geschah – von ihren Nachbarn säkularisiert wurden. Zu diesen Nachbarn gehörten übrigens auch einige katholische Territorien wie etwa Österreich. Die Anzahl der politischen Einheiten war letztlich noch einmal kleiner, weil Territorien auch „angehäuft“ werden konnten und ein und dieselbe Familie mitunter über mehrere davon herrschte.
Es ist deshalb zielführender, die politische Landschaft des Heiligen Römischen Reiches unter dem Gesichtspunkt von „Familienkonglomeraten“ zu betrachten, deren Bedeutung in nur sehr wenigen Fällen über das engste Umland hinausging. Die zweitwichtigste Herrscherfamilie nach den Habsburgern waren die Wittelsbacher, die über die Kurpfalz, Bayern, Pfalz-Zweibrücken und weitere Territorien verfügten. Ihr Einfluss wurde allerdings durch ihre Zersplitterung in mehrere Linien geschwächt. Ähnlich erging es den sächsischen Wettinern nach 1485 sowie den Hohenzollern in Brandenburg, die in der Machthierarchie des Reiches abgeschlagen auf dem vierten Platz rangierten. Das galt selbst nach 1618 noch, als sie das Herzogtum Preußen geerbt hatten, den vormaligen Deutschordensstaat, der 1525 säkularisiert und in ein eigenes, außerhalb des Reichsgebiets unter polnischer Oberhoheit befindliches Territorium überführt worden war. Alle vier genannten Familien, einschließlich der Habsburger, hatten diverse jüngere Nebenlinien, die als eine Art von „dynastischer Reserve“ dienten: Sie standen als mögliche Erben bereit, falls die Hauptlinie aussterben sollte; vorerst jedoch waren sie bisweilen schwer unter Kontrolle zu halten.
Die Familie der Welfen in Norddeutschland war sogar noch zersplitterter, wenngleich die Hannoveraner Linie gegen Ende des 17. Jahrhunderts prominent hervortreten sollte. Die herrschenden Dynastien in Hessen, Württemberg, Baden und Nassau belegten zusammen den sechsten Platz der Rangfolge, von dem aus sie sich langsam in der Hierarchie nach oben vorarbeiten sollten, nachdem das Herrschaftsgefüge des Reiches im 18. Jahrhundert in Bewegung geraten war: Österreich und Preußen, die unbestreitbaren Großmächte, zogen davon und ließen Bayern weit hinter sich, das künftig eine Gruppe von Territorien mittlerer Größe anführte. Danach folgte eine größere Zahl von Kleinfürsten und Grafen, wie etwa das Haus Sayn-Wittgenstein, dessen verschiedene Linien zusammengenommen am Ende des 18. Jahrhunderts über ein Territorium von gerade einmal 467 Quadratkilometern Größe mit 16.000 Untertanen herrschten.10 Zusammen sollten die mittleren und kleineren Reichsstände ein „Drittes Deutschland“ neben Österreich und Preußen bilden. Aus dem hier gegebenen Überblick wird bereits deutlich, dass diejenigen Territorien, die den Untergang des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 überlebten und unabhängige Staaten wurden, bereits am Ende des Mittelalters zu den führenden Akteuren in der Reichspolitik zählten. Während die subtilen Verschiebungen in den Beziehungen der diversen fürstlichen Familien untereinander zu dem komplexen und facettenreichen Charakter beigetragen haben, der diese Epoche der deutschen Geschichte auszeichnet, erwiesen sich die breiten Kontinuitätslinien, die diesen Veränderungen zugrunde lagen, doch als überraschend beständig.
Schweiz
Die allmähliche Verfestigung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bewies eindrucksvoll, wie stark das assoziative Element in der Reichspolitik wirken und dabei sogar das Fehlen eines gemeinsamen historischen Erbes ausgleichen konnte. Der französischsprachige Teil der Eidgenossenschaft hatte seine Wurzeln in dem alten Königreich Burgund der Franken und Karolinger, während die deutschsprachigen Teile einmal zu dem Stammesherzogtum Schwaben gehört hatten. Verkompliziert wurde diese sprachliche Trennung durch den Einfluss von Handel und Geografie, die das Gebiet der heutigen Schweiz entlang der Ost-West- wie der Nord-Süd-Achse teilten. Adlige Herren gab es nur wenige, und die meisten von ihnen hatten ihren Lebensmittelpunkt anderswo. Regierung und Verwaltung vor Ort übertrugen sie den Ratsmitgliedern in den Dörfern und Städten ihrer Territorien. Drängende und mühsame Gemeinschaftsaufgaben wie der Unterhalt von Wegen und Gebirgspässen brachten die Dorfbewohner in den gebirgigen Regionen der West- und Zentralschweiz dazu, sich in „Talschaften“ zusammenzuschließen. Die anderen Gegenden der Schweiz waren nach dem üblicheren Muster spätmittelalterlicher Landesherrschaft organisiert und unterstanden adligen Familien oder freien Städten.
Folgt man der gängigen Auffassung, so liegen die Ursprünge der heutigen Schweiz in dem legendären „Rütlischwur“, mit dem die drei Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden im Jahr 1291 ihre Eidgenossenschaft besiegelt haben sollen. Dieser Bund erweiterte sich im Laufe der Zeit und andere Gebiete schlossen sich der Eidgenossenschaft an. Die Begriffe „Konföderation“ und „Kanton“ tauchen allerdings in offiziellen Schriftstücken erst nach 1803 auf. Jede Erweiterung der Eidgenossenschaft war das Ergebnis spezifischer Umstände, und es gab kein übergeordnetes Konzept davon, was die Schweiz sein sollte oder wer zu ihr dazugehören sollte. Der sogenannte Schweizer Befreiungskampf gegen die habsburgische Herrschaft begann 1315 als ein örtlich begrenzter Konflikt um das reiche Kloster Einsiedeln. Die Habsburger, die ihren Namen von der Habichtsburg im heutigen Kanton Aargau erhalten hatten, waren unter den diversen abwesenden Landesherren die mächtigsten. Entsprechend setzten sie sich zur Wehr, um zu verteidigen, was sie als ihre rechtmäßige Herrschaft ansahen, waren jedoch letztlich zu sehr mit ihren anderweitigen Angelegenheiten beschäftigt. Die Reihe von habsburgischen Niederlagen in den Schlachten bei Morgarten (1315), Laupen (1339), Sempach (1386) und Näfels (1388) hatte indes lediglich regionale Bedeutung und war – anders, als der populäre Mythos es will – keineswegs geeignet, den Schweizern bei ihren europäischen Nachbarn ein besonderes militärisches Renommee zu verschaffen.
Die Eidgenossenschaft war nie demokratisch in einem modernen Sinn, sondern blieb stets ihren spätmittelalterlichen Wurzeln treu. Regiert wurde in kommunal verfassten Ratsstrukturen, deren Amtsträger von allen gewählt werden durften, die einen gewissen Besitz vorweisen konnten – ganz ähnlich, wie es auch in vielen deutschen Städten und Dörfern gehandhabt wurde. Während die „Waldstätte“ der gebirgigen Zentralschweiz ländlicher und zugleich egalitärer verfasst waren, wurden die übrigen Kantone von ihrem jeweiligen Hauptort dominiert. Dort gestaltete sich das Regieren allmählich immer patrizischer und oligarchischer, indem die Stadtbürger nach ihren Siegen über die habsburgischen Herren manches von deren Gepflogenheiten übernahmen. Die meisten Kantone erwarben im Laufe der Zeit abhängige Territorien, sogenannte Untertanengebiete, deren Bewohner nicht die gleichen Rechte hatten wie die Bewohner der vollberechtigten Kantone. Viele dieser abhängigen Gebiete wurden in Konflikten erobert, die um Handelswege durch das Gebirge entbrannt waren. So eroberten die Schweizer den Aargau und den Thurgau von den Habsburgern und gaben sich nach 1403 alle Mühe, dem Herzogtum Mailand die fruchtbare Alpensüdseite abzunehmen. Wiederholte Streitigkeiten über die Gerichtsbarkeit in Aargau und Thurgau trugen zum Ausbruch mehrerer Kriege im Inneren der Eidgenossenschaft bei, und erst nach 1798 sollten diese beiden Kantone vollberechtigte Mitglieder der Konföderation werden.
Immer wieder entluden sich die ständigen Spannungen zwischen den Kantonen und ihre vielfache Ungleichstellung in Gewalt.11 Für gewöhnlich blieb es bei Viehdiebstahl und kleineren Übergriffen, doch von Zeit zu Zeit flammten ernsthaftere Auseinandersetzungen auf, so namentlich im „Alten Zürichkrieg“ (1436–1450), der um die Grafschaft Toggenburg geführt wurde. Dieser Krieg, in den sogar Frankreich und die Habsburger mit hineingezogen wurden, war auch die Gelegenheit, bei der die militärischen Qualitäten der Schweizer auffielen. Legendär ist die Schlacht bei St. Jakob an der Birs am 26. August 1444, in der eine 1500 Mann starke Streitmacht unter Berner Führung bis zum letzten Mann gekämpft haben soll. Trotz dieser Niederlage sorgte der letztliche Sieg Berns über Zürich dafür, dass die „Republik Bern“ zum größten und einflussreichsten Kanton der Eidgenossenschaft wurde.
Einmischung von außen brachte die Schweizer dazu, sich in die Auseinandersetzungen einzuschalten, die in den 1460er-Jahren von der Expansion des Herzogtums Burgund an den Oberrhein ausgelöst worden waren. Die überraschenden Triumphe der Eidgenossen bei Murten, Grandson und Nancy in den Jahren 1476/77 setzten dem burgundischen Eroberungsdrang ein Ende und zementierten den Ruf der Schweizer als hervorragende Fußsoldaten. Der Streit über die reiche Beute aus dem Feldzug gegen Burgund löste dann beinahe einen weiteren Bürgerkrieg der Eidgenossen untereinander aus, bevor 1481 schließlich ein gewisser Ausgleich im Inneren erzielt wurde: Die ländlichen Kantone wollten es fortan unterlassen, die Bauern in den Untertanengebieten ihrer eher städtisch geprägten Nachbarkantone gegen diese aufzuwiegeln. Dafür versprachen Letztere, ihre Pläne für eine stärker zentralisierte Föderation aufzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich den drei Gründungsmitgliedern der Eidgenossenschaft noch Zug und Luzern angeschlossen (die ebenfalls zu den Waldstätten zählten), außerdem Bern, Zürich, Glarus, Solothurn und Freiburg (Fribourg). Jeder Kanton hatte zwei Stimmen bei der „Tagsatzung“ genannten Bundesversammlung, die ab 1420 entstand und von 1471 an regelmäßiger zusammentrat. Eine Hauptstadt, eine zentrale Regierung oder eine kodifizierte Verfassung hatte die Eidgenossenschaft jedoch nicht. Die Kantone Neuenburg (Neuchâtel), Wallis und St. Gallen traten der Konföderation als „zugewandte Orte“ bei, also als Verbündete ohne volle Mitglieds- und Vertretungsrechte.
Alle Kantone gingen ursprünglich auf Reichsstädte oder Vogteien des Heiligen Römischen Reiches zurück, und so hätte man sich durchaus vorstellen können, dass sie auf Dauer friedlich mit dem Reich koexistieren würden. Allerdings vergrößerte sich das Konfliktpotenzial mit dem Übergang der Kaiserwürde auf die Habsburger, weil die Konflikte der Schweizer mit der habsburgischen Landesherrschaft nun automatisch einen Konflikt mit dem Reich als Ganzem bedeuteten. Die Spannungen eskalierten, nachdem die Eidgenossen versuchten, ihren Verpflichtungen dem Reich gegenüber zu entgehen, indem sie dem Reichstag fernblieben oder sich schlicht weigerten, die 1495 vereinbarten Summen zu zahlen. Zwei Jahre später gingen sie eine Allianz mit der Republik der Drei Bünde ein, einem Zusammenschluss diverser Gerichtsgemeinden, deren wichtigster der „Graue Bund“ war. Auf diese Weise dehnte die Eidgenossenschaft ihren Einflussbereich bis in den östlichen Alpenraum aus, wo sie die reiche habsburgische Grafschaft Tirol bedrohte.
Kuhschweizer und Sauschwaben
Der spätere Kaiser Maximilian war unterdessen als Sieger aus dem Burgundischen Erbfolgekrieg gegen Frankreich hervorgegangen, den der Tod Karls des Kühnen, des letzten Herzogs von Burgund, 1477 vor Nancy ausgelöst hatte. Maximilian sicherte sich hierauf den Großteil der Besitzungen Karls, darunter auch die Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté), die im Nordwesten an das Gebiet der Eidgenossenschaft angrenzte. Zugleich brachte er mithilfe des Schwäbischen Bundes gerade jene kleineren Städte im südwestdeutschen Raum auf Reichslinie, die den Schweizern als potenzielle Verbündete galten. Seit sich 1494 ein neuerlicher Konflikt mit den Franzosen in Italien abzeichnete, war Maximilian sehr darauf bedacht, sich die Alpenpässe zu sichern. Dass die Eidgenossen, die er als seine Untertanen betrachtete, den habsburgischen Truppen dabei freien Durchzug gewähren würden, setzte der Kaiser voraus.
Im Januar 1499 ging Maximilian, unterstützt vom Schwäbischen Bund, in Graubünden zum Angriff über. Drei Monate später weitete er den Konflikt aus, nachdem die Eidgenossen ein Bündnis mit Frankreich geschlossen hatten. Dadurch wurde der Krieg in Italien, wo der Kaiser, der französische König und die Schweizer bereits gegeneinander kämpften, noch komplizierter. Den Schweizern gelang eine Reihe kleinerer Siege, unter denen vor allem ihr entscheidender Triumph in der Schlacht bei Dornach heraussticht; ein Vorstoß über den Rhein nach Schwaben gelang ihnen jedoch nicht. Im September wurde der Frieden zu Basel geschlossen. Die Eidgenossen erreichten eine Befreiung von den strittigen Reichsabgaben, doch blieb der künftige Umfang und Charakter ihrer Beziehungen zum Reich absichtlich vage gefasst. Unabhängig wurden sie jedenfalls nicht.12 Der sogenannte Schwabenkrieg war kurz, aber brutal gewesen, die verfeindeten Parteien hatten einander als „Kuhschweizer“ beziehungsweise „Sauschwaben“ beschimpft und keine Gefangenen gemacht. Berichte von dritter Seite betonen, wie groß der gegenseitige Hass war, und Hass zeigte sich definitiv auf den Schlachtfeldern des 16. Jahrhunderts, wann immer Schweizer und Deutsche als Gegner aufeinandertrafen. Überbewerten sollte man diesen Gegensatz jedoch nicht: Handel, kulturelle und religiöse Einflüsse verliefen weiter in beide Richtungen, und oft kämpften in ein und demselben Heer Deutsche und Schweizer Seite an Seite.
Im Jahr 1501 ließ sich schließlich auch die Stadt Basel überzeugen, ihre Neutralität aufzugeben und der Eidgenossenschaft beizutreten. Kurz darauf tat Schaffhausen dasselbe, wodurch die Schweizer einen Vorposten am nördlichen Rheinufer gewannen. Als letzter der „dreizehn alten Orte“ schloss sich 1513 Appenzell der Konföderation an. Die Aussicht darauf, dass noch weitere süddeutsche Städte „Schweizer werden“ könnten, war jedoch spätestens in den 1540er-Jahren verflogen: Im Vergleich mit der zänkischen Eidgenossenschaft erschien das Heilige Römische Reich zunehmend als der bessere Garant städtischer Autonomie.13
Landfrieden und fremder Dienst
Mit dem Machtzuwachs der Habsburger sank das Risiko von Konflikten im Inneren des Reiches deutlich, denn es war nun klar, dass keine andere Dynastie stark genug war, den habsburgischen Führungsanspruch anzufechten. Das demonstrierte Maximilian I. überzeugend, als er 1504/05 in den Landshuter Erbfolgekrieg eingriff, um Bayern gegen die Kurpfalz zu unterstützen. Die Pfälzer wurden besiegt und verloren ihren vormals großen Einfluss im südwestdeutschen Raum. So gelang es den Habsburgern, zwischen den rivalisierenden Wittelsbacherlinien ein Gleichgewicht herzustellen. Mit dem schnellen Eingreifen des Schwäbischen Bundes gegen Herzog Ulrich von Württemberg im Jahr 1519 wuchs die habsburgische Macht weiter an. Der Herzog hatte das kurze Interregnum zwischen dem Tod Maximilians I. und der Kaiserwahl Karls V. ausgenutzt, um die Reichsstadt Reutlingen zu überfallen. Ulrich wurde geschlagen und in die Verbannung geschickt, was zeigte, dass die reichseigenen Mechanismen zur Friedenserzwingung selbst dann noch effektiv arbeiteten, wenn es gerade keinen Kaiser gab.
Beide Konflikte wurden mit verhältnismäßig großen Streitmächten geführt, dauerten jedoch nur kurz und stellten allen vor Augen, dass man die Autorität des Kaisers nicht ungestraft herausforderte. Parallel dazu wurde die Kooperation unter den Landesherren enger, wenn es darum ging, lokale Verstöße gegen den Landfrieden zu ahnden. Viele dieser Probleme waren hausgemacht, und die Spannungen entluden sich schließlich im Ritterkrieg (1522/23) in der Pfalz und im Deutschen Bauernkrieg (1524–1526). Obwohl die an dem pfälzischen Aufstand beteiligten Ritter später als „Raubritter“ geschmäht wurden, handelte es sich bei ihnen weder um im Mittelalter verhaftete Reaktionäre noch waren sie besonders habgierig. Vielmehr ergab der Konflikt sich aus der Komplexität der spätmittelalterlichen Lehnsbeziehungen, die dazu führte, dass viele Adlige Lehen mehrerer Herren zugleich hielten. Seit der Verkündung des Ewigen Landfriedens 1495 war es den Fürsten zudem verboten, selbst gegeneinander Krieg zu führen, weshalb sie zuweilen ihre ritterlichen Lehnsleute Stellvertreterkriege mit ihren Nachbarn austragen ließen. Anlässe hierfür gab es angesichts der Vielzahl lokaler Streitigkeiten im ganzen Reich mehr als genug. Für diese Stellvertreterkonflikte berief man sich auf das traditionelle Fehderecht, nach dem die verletzte Partei eine Person benennen durfte, die ihr Genugtuung verschaffen sollte. Manche Ritter bemühten sich indessen, der landesfürstlichen Herrschaftsgewalt ganz zu entgehen, indem sie gewissermaßen die Flucht in die Reichsunmittelbarkeit antraten.14