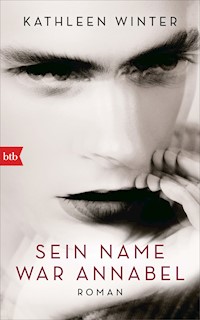9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis.
»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«
Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin und Nummer-1-Bestsellerautorin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern und luzider Sprache schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom bei sich selbst Ankommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«
Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin und Nummer-1-Bestsellerautorin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern und luzider Sprache schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom Bei-sich-selbst-Ankommen.
Zur Autorin
KATHLEEN WINTER ist Journalistin, Romanautorin, verfasst Kurzgeschichten und schreibt Drehbücher für das kanadische Fernsehen. Ihr Debütroman »Annabel« war ein Bestseller in Kanada und ein internationaler Erfolg. Er stand auf der Shortlist der wichtigsten kanadischen Literaturpreise (Giller Prize, Governor General’s Award, CBC Canada Reads) und war nominiert für den Orange Prize for Fiction. Ihr Memoire »Eisgesang« war Finalist für den Hilary Weston Writers Trust Prize for Nonfiction und den RBC Taylor Prize. Kathleen Winter hat lange in St John’s auf Neufundland gelebt. Heute lebt sie in Montreal.
Kathleen Winter
Eisgesang
Meine Reise durch die Nordwestpassage
Aus dem Englischen von Elke Link
Für JD
Inhalt
| Kapitel 1 | Eine Einladung
| Kapitel 2 | Kangerlussuaq
| Kapitel 3 | Die Wikingerbestattung
| Kapitel 4 | Sisimiut
| Kapitel 5 | Kathedralen aus Eis
| Kapitel 6 | Der Kapitän
| Kapitel 7 | Wassermassen
| Kapitel 8 | Annies Puppe
| Kapitel 9 | Emily Carrs Milchrechnung
| Kapitel 10 | Geologie
| Kapitel 11 | Dundas Harbour
| Kapitel 12 | Der weiße Garten
| Kapitel 13 | Beechey Island
| Kapitel 14 | Auf Franklins Spuren
| Kapitel 15 | Ein warmer Faden
| Kapitel 16 | Gjoa Haven
| Kapitel 17 | Jenny Lind Island und Bathurst Inlet
| Kapitel 18 | Die Macht des Gesteins
| Kapitel 19 | Kugluktuk
| Kapitel 20 | Heiliges Land
Dank
Bildteil
»Das Wasser, das Land, der Wind, der Himmel – sie allein besitzen absolute Freiheit.«
BERNADETTE DEAN
»Der Körper ist eine Feder, die über die Tundra weht.«
AAJU PETER
| Kapitel 1 |Eine Einladung
Eine Woche bevor ich die Einladung zu der Reise erhielt, die mich eine längst vergessene Suche wiederaufnehmen lassen sollte, lag ich mit Freundinnen aus dem College auf einem Steg. Es war unser zweites Treffen, nachdem wir dreißig Jahre lang getrennt voneinander unsere Leben gelebt hatten und erwachsen geworden waren. Ich war mittlerweile fünfzig und konnte endlich mit einem gewissen Mitgefühl über die herzzerreißend jungen Gesichter auf den Fotos in unserem Jahrbuch lachen. Wir hatten einander belanglose alte Verletzungen verziehen und betrachteten uns mit Weitblick und Menschlichkeit. So viel Gelächter war ich gar nicht gewöhnt – normalerweise saß ich stundenlang allein in einem Zimmer und schrieb, bis meine Familie zum Abendessen nach Hause kam. Hin und wieder unternahm ich einen Ausflug in die Bibliothek oder traf mich höchstens einmal mit einer Freundin zum Kaffee. Meistens war ich jedoch alleine unterwegs. Und nun war ich hier auf einer Art Stegparty. Ich kam mir vor wie eine Figur in einem Buch der Jugendbuchautorin Judy Blume. Es gab kaltes Bier und Nachos, und der Steg samt der dazugehörigen Hütte, die sich Aloise, mit der ich während des Studiums zusammengewohnt hatte, mit ihrem Mann gebaut hatte, kam mir vor wie ein Stück vom Himmel.
Als ich so dalag, erinnerte ich mich, wie viele Fragen an das Leben ich gehabt hatte, als Aloise und ich uns als Studentinnen eine Mietwohnung über einer Kneipe geteilt hatten, deren pulsierendes buntes Licht zu mir ins Zimmer gedrungen war. Damals spürte ich manchmal, dass sich meine gewohnte Welt veränderte hatte und ich einen Blick auf etwas Schönes, Fremdes erhaschen konnte. Durch diesen kurzen Blick wurden Steine, Äpfel, Straßen und Bäume zu etwas anderem als einem geschichtslosen Chaos: Ich sah die Stadt in eine Art unhörbare Musik oder schillernde Transparenz getaucht, voller rätselhafter Bedeutung. In diesen Momenten gab es nichts Gewöhnliches mehr. Wenn dieser kurze Augenblick vorüberging, wie es stets der Fall war, blieb ich leer zurück. Ich hatte das Gefühl, die Welt hätte versucht zu sprechen. Das gesamte Sein schien aufgeladen von einem leuchtenden Sinn, über den ich unbedingt mehr wissen wollte.
Während meiner Jugend empfand ich durch diese transzendenten Momente immer ein paar Minuten der intensiven Verbundenheit und Zugehörigkeit zu dieser Welt. Es war, als wäre ich ein Fitzelchen verirrter Energie – als würde ich manchmal, für einen kurzen Moment der Glückseligkeit, durch Zufall mit dem Stromkreis verbunden werden, zu dem ich eigentlich die ganze Zeit hätte gehören sollen. Doch dann war ich wieder abgekoppelt, und die vertraute Schwermut kehrte zurück. Die Vision, die ich in diesen intensiven Augenblicken kurz erblickt hatte, war kraftvoll und lebendig, aber sie war auch auf eine rätselhafte Art gefährdet. Etwas sagte mir, dass dieses Leben mit seinen einfachen, liebenswerten Dingen – Kraniche am Horizont beispielsweise, das Licht der Morgendämmerung auf den Flügeln der Möwen oder die Schönheit des Spiels von Licht und Schatten in den Treppenaufgängen der Stadt – dass dieses Leben mehr war, als es zu sein schien, und dass es auf eine Weise gefährdet war, die ich noch nicht verstand. Ich fragte andere, ob sie das Gleiche empfanden, ich las meine Studientexte daraufhin, ob sie mir eine Erklärung liefern konnten, ich suchte auch auf spirituellen Pfaden; aber die einzig wahre Quelle war die natürliche Welt selbst, ihre greifbaren Gegenstände, ihr Licht und ihre Formen.
Ich fand Gesellschaft in Dichtern, die mir die einzigen Menschen zu sein schienen, die mich verstanden. William Wordsworth hatte geschrieben, dass in seiner Jugend die Erde und »jede Alltagssicht« für ihn von Licht umhüllt zu sein schienen, von einer Art »frischem Schein«, verklärend wie in einem Traum. Und als er dann älter wurde, klagte er, dass »nichts die Stunde wiederbringen kann/Da Leuchten durch das Gras, da Glut durch Blumen rann …«. Ich wusste, was er meinte. Nachdem ich von der Universität abgegangen war, ließ diese Wahrnehmung nach, um stattdessen meiner »Nestbauphase«, wie meine Töchter es nennen würden, Platz zu machen. Ich ließ mich auf die Ehe mit einem Mann ein, der hoffte, ich wäre jemand, der ich in Wahrheit nie würde sein können. Er wurde krank und starb nach zwei langen Jahren schwerer Krankheit, und manchmal glaubte ich, er wäre vor lauter Enttäuschung über mich gestorben. Unsere kleine Tochter half mir, nachdem ihr Vater gestorben war, Holz zu schlichten und den Kamin zu säubern, indem sie sich mit einem Eimer darunter stellte und ich von oben auf dem Dach mit einer Drahtbürste den Ruß herausputzte.
Dann lernte ich meinen zweiten Mann kennen. Er war Maurer, Steinmetz, Experte für Kamine – und alles wurde besser. Mit ihm bekam ich eine zweite Tochter und ging ganz darin auf, eine Familie zu gründen. Auch wenn es eine schöne Zeit war, zog sich die alte, geheimnisvolle Vision einer Welt – oder meine verlorene Welt – hinter Suppentöpfen, Tilgungsraten und dem Füttern der Ziegen zurück. Im Stillen verzweifelte ich daran, ob ich jemals wieder einen Zugang zu dieser Welt bekommen würde, die ich gleich unter – oder irgendwie innerhalb – dieser so uninspirierten gefunden hatte.
Aber nun schien sich diese Phase ihrem Ende zu nähern. Wir waren nach Montreal gezogen, die Drahtbürste für den Kamin hatte ich zurückgelassen. Meine Töchter wurden immer unabhängiger, und ich war zu Aloise an den See gefahren, zusammen mit den alten Freundinnen aus meiner Jugend, einer Zeit, in der sich alles nur darum gedreht hatte, was für Möglichkeiten wir hatten. Während ich so in der Sonne lag und die Wellen gegen den Steg plätscherten, wurden mein jüngeres und mein älteres Ich eins.
Ab und an verkündete eine von uns, was sie im Lauf der Jahre gelernt hatte. Denise war es, die sagte: »Ich habe gelernt, jederzeit eine Einladung annehmen zu können, wenn das für mich heißt, dass ich reisen kann. Wenn mich jemand fragt: ›Denise, hast du Lust, in den Rockies Skifahren zu gehen?‹ oder ›Wir wollten uns zu viert Scarlett Johansson am Broadway anschauen, aber Hadley kann jetzt doch nicht mit‹, wisst ihr, was ich dann sage?«
»Nein, Denise«, sagte ich. »Was denn?«
»Meine Sachen sind schon gepackt.«
Ich war beeindruckt.
»Und das ist wirklich so. Bei mir im Wandschrank steht eine gepackte Tasche, mit der ich jederzeit loskann. Sie enthält einen kleinen Kulturbeutel, nur mit dem Allernötigsten, Unterwäsche, ein paar Sachen zum Wechseln. Ich muss noch nicht mal einen Blick hineinwerfen.«
Diese Vorstellung gefiel mir sehr. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, dass es Juli war, ich auf den silbergrauen Brettern von Aloises Steg lag und mich von der Sonne wärmen ließ. Das leise Plätschern der Wellen schläferte mich ein, hin und wieder hörten wir einen Seetaucher, bauschige, weiße Wolken zogen vorüber – und die Idee von Denise faszinierte mich mehr und mehr.
»Das mache ich auch«, sagte ich. »Sobald ich zu Hause bin, packe ich meine Sachen.«
»Du musst es aber auch tun und es nicht nur behaupten.« Denise nahm einen Schluck von ihrem Bier, der Schalk blitzte in ihren Augen – wie vor dreißig Jahren. Sie war immer diejenige gewesen, die einen dazu gebracht hatte, seine Geheimnisse zu verraten, ohne dass sie selbst etwas von sich preisgab. Sie hatte es faustdick hinter den Ohren, und ich spürte, wie ein wenig von ihrer Abenteuerlust auf mich abfärbte, als ich mir vorstellte, wie ich meinen kleinen Koffer packte und ihn in meinem Wandschrank verstaute.
»Stopf bloß nicht zu viel rein«, warnte sie mich. »Nur das, was du unbedingt brauchst. Das ist der Schlüssel. Nimm nicht viel zum Anziehen mit.«
Daran hielt ich mich. Sobald ich wieder zu Hause war, packte ich eine Tasche und prahlte mit meiner Abenteuerbereitschaft. Mein Mann Jean und meine jüngste Tochter Juliette schwiegen, wie so häufig, wenn ich etwas verkündete. Sie kennen mich genau und wissen, dass es das Zusammenleben mit mir ungemein erschwert, wenn sie mich in Frage stellen. Sie sind es gewöhnt, dass ich intuitiv durchs Leben gehe und dass es dabei zu unerklärlichen Wendungen kommen kann. So ist es für mich beispielsweise eine Qual, mich an ein Kochrezept zu halten oder meinen Tag planen zu müssen. Es kann sein, dass ich Feigen in den Eintopf gebe, das Geländer in der U-Bahn hinunterrutsche oder mich auf dem Weg in die Bücherei anders entscheide und in einem Tretboot auf dem Kanal lande. Warum Der Wind in den Weiden lesen, wenn man selbst der Maulwurf oder die Ratte sein kann?
Das neue Reisegepäck war nur ein weiteres Beispiel für meine Sehnsucht nach dem Unvorhergesehenen. Doch selbst ich war überrascht, als wenige Tage später ein Anruf kam und sich meine Reisetasche tatsächlich als nützlich erweisen sollte. Es war an einem Samstagmorgen um sieben Uhr – normalerweise rief mich kein Mensch um diese Zeit an.
»Hättest du denn Interesse«, fragte mich Noah, ein Schriftstellerkollege, »auf einem Schiff durch die Nordwestpassage zu fahren?«
»Die Nordwestpassage?«
»Ja«, sagte er. »Du hast vielleicht gehört, dass russische Eisbrecher manchmal Passagiere mitnehmen. Sie möchten einen Schriftsteller an Bord haben, und ich kann nicht, deshalb würde ich dich vorschlagen. Zuerst wollte ich dich aber fragen, ob das überhaupt etwas für dich wäre.«
Ich dachte an Franklins Gebeine, an die Segel der britischen Entdeckungsreisenden in der Kolonialzeit, an eine weite Tundra und an die Möglichkeit, diese zu erkunden, ein Privileg, das bisher nur Inuit, Männer wie Franklin und Amundsen und ein paar Wissenschaftler gehabt hatten. Ich dachte an die Bleivergiftungen durch die Konserven von Franklins Männern, an Unterwassergräber und an die verlorenen Schiffe namens Erebus, was »Finsternis« bedeutet, und Terror, was das bedeutet, kann man sich ja vorstellen …. Ich dachte an meine eigene Kindheit in England, die voll mit Geschichten über Seereisen gewesen war. Ich dachte an die Abenteuer der Jumblies von Edward Lears, die mit einem Sieb in See stachen. Ich dachte an Königin Victoria und an Jane Franklin, an die Sehnsucht und an die romantischen Gefühle, die meinen Vater dazu veranlasst hatten, nach Kanada auszuwandern. Ich dachte an alle Bücher, die ich über Polarforschung gelesen hatte, über die Versuche weißer Männer und weißer Frauen, den hohen Norden Kanadas zu bereisen.
Ich hatte das Gefühl, Noah lud mich ein, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht als auf die lineare Weise, die wir ihr für hier, für die südliche Welt, beigebracht haben. Der Name »Nordwestpassage« ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht ganz begreifen konnte.
Meine Töchter waren nicht mehr ganz klein und unselbstständig; ich hatte schon ein paar kleinere Reisen unternommen und sie zeitweise ohne Mutter zurückgelassen. Ein Blick auf eine Karte mit der Route, zu der Noah mich eingeladen hatte, setzte meine Fantasie in Gang und ließ Bilder von Eis, Meer und Einsamkeit entstehen. Für eine Schriftstellerin ist die Einsamkeit sehr verlockend. Schon die Namen auf der Karte fesselten mich: Lancastersund, Resolute, Golf von Boothia. In mir wurde etwas in Gang gesetzt, das lange davon geträumt hatte, an diese Orte zu fahren.
Ich dachte über die Reise der Seele zu jeder Art von Grenze nach, physisch und spirituell. Die Nordwestpassage war in meiner Vorstellung der Inbegriff eines Ortes, der so aufregend war, dass ich nie gewagt hätte, mir vorzustellen, ihn jemals zu sehen. Wie oft hatte ich mit meiner Gitarre in der Küche gesessen und die eindringliche Melodie der alten Ballade »Lady Franklin’s Lament« gespielt?
In Baffin’s Bay where the whale fish go
The fate of Franklin no man may know.
The fate of Franklin no man can tell.
Lord Franklin among his seamen do dwell …
»Das Schiff legt am kommenden Samstag ab«, sagte Noah. »Du wirst zwei Wochen unterwegs sein. Mir ist klar, dass das sehr kurzfristig ist …«
Ich konnte dem Sog der Erregung, den ich an diesem Morgen verspürte, unmöglich widerstehen. Denise hatte mich doch erst vor wenigen Tagen auf dem Steg von Aloise auf die ideale Antwort für diese Einladung gestoßen. Und wenn schon ein Mann namens Noah einen auf ein Schiff einlud, sollte man dann nicht auch unverzüglich an Bord gehen?
»Meine Sachen sind schon gepackt«, sagte ich.
Ich versuchte, mich zu erinnern, was ich nach Denises Vorgaben alles in die Tasche gepackt hatte: ein schwarzes Kleid, zwei Garnituren Unterwäsche, ein T-Shirt und eine Jeans. Ich erinnerte mich, gelesen zu haben, dass Franklin und seine Männer sich in einer männlichen Version dieser Ausrüstung aus dem 19. Jahrhundert zu ihrer Reise in den Tod aufgemacht hatten: Knickerbocker, Seidenhemden, Strümpfe. Ich rief mir die mumifizierten Überreste von Franklins Männern vor Augen, die ich in Geschichtsbüchern gesehen hatte, mit ihren konservierten Grimassen, ihren ausgemergelten, vom Todeskampf gezeichneten Gesichtern. Ich beschloss, meinen Freund Ross anzurufen, um ihn zu fragen, was er davon hielt. Ich kenne Ross seit der Highschool in Corner Brook, wo wir mit siebzehn auf den Abfallcontainern hinter der Hauptstraße gesessen, zu der Felswand, die hinter dem Woolworths aufragte, hinaufgesehen und so getan hatten, als wären wir in Neapel. Mittlerweile waren wir beide in Montreal gelandet, eine ganz gute Alternative, wie wir fanden.
»Die Nordwestpassage?«, fragte Ross.
»Ja. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Ich bin natürlich begeistert, aber …«
»Das verstehe ich. Ich verstehe, dass du dir ein wenig Sorgen machst.«
»Immerhin liegt Franklins zur Hälfte aufgefressener Leichnam noch dort oben unter dem Eis.«
»Ja, aber …«
»Von Menschen.«
»Ich weiß, aber du wirst kaum …«
»… vergiftet von Blei, und ich weiß, dass das Eis dort oben schmilzt, aber es ist trotzdem extrem abgelegen – außerhalb von –, ich meine, vieles davon ist immer noch unerforscht, um Himmels willen.«
»Ja, aber die Crew des Schiffs wird doch wohl wissen, was sie tut. Sie würden dort nicht hinfahren, wenn …«
»Schon. Aber man hört doch die ganze Zeit in den Nachrichten …«
»Es ist nachvollziehbar, dass du ein wenig Angst hast. Aber ich glaube nicht, dass es so …«
»Meinst du denn, das geht? Esther ist zwar einundzwanzig, aber Juliette ist doch erst dreizehn.«
»Ja, es ist normal, dass du dir Gedanken um deine Kinder machst. Aber solche Sorgen fühlen sich gerne größer an, als sie tatsächlich sind …«
»Du findest, ich sollte einfach fahren?«
»Na ja, ich glaube, es ist normal, dass du dir diese Fragen stellst. Aber im Ernst, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du es machst?«
An diese finale Frage sollten wir uns später noch erinnern. Aber damals klang sie ganz vernünftig, und die Tatsache, dass er diese Frage stellte, beschwichtigte meine Ängste, wie es nur ein Gespräch mit einem alten Freund kann, selbst wenn es keine richtigen Antworten darauf gibt. Die Anweisungen von Denise missachtend, packte ich also meine Tasche neu und folgte diesmal der Liste des Expeditionsleiters, die besagte, dass ich eine Wollweste und Gummistiefel brauchen könnte und lange Hi-Tech-Unterhosen, die es für Franklin und seine Crew damals noch nicht gegeben hatte. Ihre Unterwäsche hatte von Hand genäht werden müssen, die Männer waren nur ein paar Monate vor der Erfindung der Nähmaschine verschwunden. Ich unterzeichnete das Formular und die Verzichtserklärungen für die Reise; ich lebte in moderneren Zeiten, eine Tatsache, aus der ich ein gewisses Maß an Mut zog. Bei den Formularen und Verzichtserklärungen fand ich auch Fotos der anderen Experten im Team. Mir fiel auf, dass es fast alles Männer waren, die meisten von ihnen trugen typische Forscherbärte. Ich besaß zufällig auch einen Bart aus brauner Wolle, den ich auf einer Zugfahrt mit meiner Mutter gehäkelt hatte – ich ähnelte damit ein bisschen mehr Rasputin als einem Forschungsreisenden, aber seine Schlaufen passten gut um meine Ohren, deshalb packte ich ihn mit ein.
In der Liste kamen keine Musikinstrumente vor, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass es auf Franklins Schiff eine Art Klavier gegeben hatte und dass die Männer vor ihrem Tod versucht hatten, einander auf typisch englische Art aufzuheitern, indem sie während der arktischen Nächte füreinander Pantomimen aufführten, sangen und tanzten. Ich übte seit einiger Zeit auf einer alten deutschen Ziehharmonika und konnte »Lady Franklin’s Lament« spielen, ein paar neufundländische Lieder und die »Varsovienne«, einen alten Volkstanz aus Warschau, den mir Gearóid Ó hAllmhuráin in St. John’s beigebracht hatte. Die Ziehharmonika hatte keinen Kasten, daher nahm ich sie mit zu Canadian Tire und steckte sie dort in eine isolierte Bierkühltasche, die einen Schulterriemen hatte und angeblich wasserdicht war. Wenn ich mich in der Nordwestpassage einsam fühlen oder auf einem Eisberg stranden sollte und alle Hoffnung auf Rettung vergebens war, dann hatte ich zumindest meine Ziehharmonika dabei, die, wie mein Vater gewusst hatte, auch Schifferklavier genannt wurde.
»Du solltest meine alte Helly-Hansen-Regenjacke mitnehmen«, sagte mein Mann, als ich mein dünnes Regenzeug zusammenrollte und in die Tasche stopfte. Seine Jacke war strapazierfähig und sah aus wie die Plane, mit der ich immer das Holz abdeckte.
»Die passt nie und nimmer da rein.«
»Dann zieh sie an.«
»Sie hat ein Loch unter dem Arm.«
»Das ist eine hervorragende Jacke.«
»Und die Tasche ist zerrissen.«
»Warte.« Er ging in den Keller und kam mit einer neuen Rolle Gaffer-Tape zurück, riss ein paar Streifen ab und klebte sie kunstvoll über die Löcher. »So. Jetzt kannst du den Elementen trotzen.«
»Du solltest den Rest der Rolle auch mitnehmen«, meldete sich Juliette zu Wort. Sie steckte sie mir in die Tasche. Die Rolle nahm jetzt mit Abstand den meisten Platz darin ein. Und Juliette sollte recht behalten. In der Nordwestpassage würde unser Schiff und die gesamte Crew jedes Fitzelchen Gaffer-Tape brauchen, das wir in die Finger bekommen konnten.
| Kapitel 2 |Kangerlussuaq
Unser Charterflugzeug startete von Toronto aus. Am Flughafen fiel unsere Gruppe zwischen den gutgekleideten Pendlern mit den stromlinienförmigen Rollkoffern besonders auf: Wir schleppten Seesäcke und Rucksäcke mit zahlreichen Lederriemen, die Ferngläser, Wanderstöcke und Audubon-Vogelführer fixierten. Die bärtigen Männer waren vollzählig erschienen; unser selbsternannter Expeditionsleiter und der Konteradmiral versuchten herauszufinden, wie man das Flughafenpersonal davon überzeugen konnte, dass es richtig und notwendig für uns war, Waffen zu transportieren.
»Die Waffen dienen weniger zum Schutz vor den Wildtieren«, riefen die Waffenträger uns anderen zu, »sie sollen eher dabei helfen, euch auf Linie zu halten, wenn ihr euch in der Tundra nicht anständig benehmt.«
Sicherheitsbeamte wollten mich von meiner Ziehharmonika trennen, aber sie schienen nicht recht zu wissen, was sie damit anfangen sollten. Sie schickten mich zum Sperrgepäck, obwohl die Tasche nur für ein Dutzend Bierdosen gedacht war.
»Wo soll das hingehen?«, fragte mich die Frau hinter dem Röntgenapparat.
»Nach Grönland.«
Unser Ziel war Kangerlussuaq, wo das Schiff auf uns wartete, mit dem wir unsere Reise zurückzulegen sollten. Zunächst die Südwestküste Grönlands hinauf, dann würde es über die Baffin Bay Richtung Pond Inlet gehen, der ersten kanadischen Station. Von hier aus würden wir dann den Eclipse Sound hinauffahren, zwischen der nordwestlichen Spitze der Baffin-Insel und der Bylot-Insel hindurch zum Lancastersund, dem Tor zu Roald Amundsens Nordwestpassage. Wir würden die Passage durchqueren und in Kugluktuk – oder »Coppermine« – von Bord gehen, um dann mit einem Charterflugzeug wieder zurück Richtung Süden zu fliegen. Allein bei dem Gedanken an die Reiseroute stockte mir der Atem.
»Wo ist das?« Die Beamtin hinter dem Röntgenapparat trug Latexhandschuhe und hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie wusste nicht, wo Grönland lag. Sie hatte meine Ziehharmonika in der Hand und würde sie gleich in eine Öffnung in der Wand werfen. Manchmal ist es unbegreiflich, mit welchem Gleichmut manche Menschen Situationen begegnen können, die für andere von so großer Bedeutung sind.
»Grönland«, sagte ich so beherrscht wie möglich, »ist die große, von Eis bedeckte Landmasse nordöstlich von Kanada.«
Wenn Grönland dem Sicherheitspersonal des Flughafens unbekannt war, wie weit entfernt vom bekannten Universum würden dann die Ziele unserer restlichen Reise sein? An Bord des Flugzeugs legte sich eine Art wohliger Frieden über die etwa hundert Passagiere, die von nun an gemeinsam unterwegs sein würden. Wir mussten unser unordentliches, ein wenig verstörendes Äußeres nicht mehr erklären – unsere Expeditionsseesäcke, unsere Hosen mit den vielen Laschen und Extrataschen. Die Passagiere hatten sich um die Bordexperten für ihre jeweiligen Interessensgebiete versammelt. Eine Gruppe Vogelbeobachter drängte sich um den Ornithologen Richard Knapton. Sie verglichen Kameraobjektive und Vogellisten, um festzustellen, wer auf unserer Reise einen Seeadler, einen Sterntaucher oder einen Wassertreter sehen wollte. Eine Gruppe eleganter japanischer Reisender fiel mir auf. Sie waren in Begleitung einer jungen Frau, die alles für sie übersetzte, was uns der Pilot oder unser Expeditionsleiter erklärte. Andere waren in ein Geologie-Bändchen vertieft, das der Bordgeologe Marc St-Onge für uns vorbereitet hatte. Der Historiker Ken McGoogan führte leidenschaftlich aus, dass Franklin die Nordwestpassage überhaupt nicht entdeckt hatte – in Wahrheit sei das ein unerschrockener Schotte namens John Rae gewesen. Kens Frau, die Künstlerin Sheena Fraser McGoogan, hatte Farbstifte und Skizzenhefte für alle dabei, die die Wunder, die wir an Land sehen würden, zeichnen wollten. Außerdem gab es noch einen schüchternen, stillen Anthropologen namens Kenneth Lister sowie Pierre Richard, einen Biologen und Spezialisten für Meeressäuger. Er hatte seine elegante Schwester Elisabeth mitgebracht. Sie wollte endlich einmal das Land sehen, das er so liebte. Viele dieser Bordexperten waren schon zuvor in der Arktis gewesen, aber dennoch war die Aufregung aller zu spüren.
»Ich war schon oft für wissenschaftliche Projekte dort«, erzählte mir Pierre Richard. »Aber wenn man zu Forschungszwecken kommt, ist das etwas anderes als eine Reise wie diese. Da hat man Zeit, herumzulaufen und nachzudenken und sich einfach nur der Liebe für dieses Land hinzugeben.«
Ein paar Plätze weiter verstaute unser Bordmusiker Nathan Rogers seine handgefertigte Gitarre, setzte sich geräuschunterdrückende Kopfhörer auf den rasierten Schädel und versank in seinen eigenen Gedanken. Jemand hatte mir erzählt, dass er der Sohn des verstorbenen Folkmusikers Stan Rogers war, dessen einprägsames Lied »Northwest Passage« viele Passagiere schon auswendig konnten. Ich setzte mich neben Bernadette Dean, eine kanadische Inuk-Frau, die zusammen mit der Grönlandkanadierin Aaju Peter als Kulturbotschafterin an Bord war. Ihnen fiel die Aufgabe zu, uns den Norden aus der Perspektive von Inuit-Frauen näherzubringen. Die hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und durch langejährige Erfahrung die Tiere, Pflanzen und Menschen dort auf zwei Weisen kennengelernt: als Indigene sowie als Besucherinnen. Bernadette schrieb, während unser Flugzeug startete, eifrig in ihr Notizbuch.
Unser Pilot sprach mit einem munteren amerikanischen Akzent. Als wir über Nordquebec flogen, verkündete er über Lautsprecher: »Da, sehen Sie, unter uns … ganz viel Nichts.«
Es gab ein kollektives Erstaunen, das der Pilot wahrscheinlich genoss.
»Das glaubt er wohl«, murmelte Bernadette und blickte von ihrer Arbeit auf. Zwischen den Seiten, die sie dicht beschrieben hatte, spitzten Fotos hervor. Ihre Notizen interessierten mich, und sie merkte, dass ich verstohlen Blicke darauf warf.
»Ich schreibe, um mich von meinem kleinen Enkelkind abzulenken«, sagte sie. »Der Junge oder das Mädchen wird bald geboren, wahrscheinlich noch, während wir auf dieser Expedition sind. Mir wird es schwerfallen, nicht dort zu sein. Das hier sind Notizen über meine Urgroßmutter.«
Bernadette erzählte mir, ihre Urgroßmutter sei die Inuit-Kleidermacherin Shoofly gewesen, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in einen Walfangkapitän aus Boston verliebt, ihm viele ihrer Perlengewänder geschenkt hatte und von ihm nach Amerika mitgenommen worden war. Bernadette hatte Jahre damit verbracht, diesen Bestandteil ihres kulturellen Erbes wieder aufzuspüren.
»In einem Depot habe ich sie schließlich gefunden«, erklärte sie, »im Museum of Natural History in New York City. Ich habe lange gebraucht, um die Verantwortlichen davon zu überzeugen, mir zu erlauben, sie anzusehen. Die Kleider meiner eigenen Urgroßmutter! Schließlich bekam ich ein Zeitfenster von zwei Wochen. Ich sagte zu und fuhr hin – hier, da ist ein Bild davon, wie ich mir die Kleider ansehe.« Sie zeigte mir ein Foto von sich, auf dem man sah, wie sie die Kleidungsstücke im Museum aus einer Schublade nahm. »Das da ist die skandinavische Kuratorin.« Sie deutete auf eine wachsame Gestalt neben ihr. »Sehen Sie nur, wie sie mir auf den Leib gerückt war. Ich musste sogar weiße Handschuhe anziehen.«
»Die Kuratorin wirkt aber besorgt.«
»Die wollten nicht, dass ich die Kleider meiner eigenen Urgroßmutter anfasse. Sehen Sie ihren Namen? Shoofly. Der Walfangkapitän hatte ihn auf ihre Kleider geschrieben.«
»Ich erkenne es.«
»Ich wusste, dass dies noch nicht alle Kleidungsstücke waren. Zu dieser Garnitur gehören noch mehr Teile, und ich wollte von der Kuratorin wissen, wo sie waren. Doch sie traute mir nicht. Sie behauptete, es wäre sonst nichts da. Ich wollte die Sachen aber unbedingt finden und fing deshalb an zu suchen. Ich zog eine Schublade nach der anderen auf, bis ich sie gefunden hatte. Sie wusste noch nicht einmal, was das alles war. Sie hatte keine Ahnung. Ich kam mir wieder vor wie ein Kind mit einer weißen Lehrerin.«
Unser Flieger landete in Kangerlussuaq, wo uns in verdorrten Gräsern und vor den von Schnee bedeckten Felswänden ein alter russischer Bus erwartete, der uns zum Schiff bringen sollte. Die Landschaft erinnerte ein bisschen an das, was ich in Labrador gesehen hatte: hoch aufragende, schartige Felsen vor einem weiten Himmel. Die Pflanzen waren zwergwüchsig, doch die Sonne leuchtete durch die lilafarbenen und weißen Blütenblätter hindurch wie das Licht eines Projektors durch einen Film und ließ jedes Detail erkennen.
Während wir in den Bus stiegen, rief Pierre Richard, der Meeresbiologe, Nathan Rogers zu: »Wir haben noch eine Musikerin an Bord – sie hat eine Ziehharmonika in ihrem Bierkühler!«
Richtige Musiker haben immer eine Menge abfälliger Bemerkungen über Menschen mit Ziehharmonikas parat, und Nathan bildete in dieser Hinsicht keine Ausnahme.
»Dann halte sie bloß von mir fern«, sagte er. »Und wirf die Ziehharmonika über Bord – diese Art von Folter muss man im Keim ersticken.«
Ich wusste, dass Nathans Vater Stan bei einem tragischen Flugzeugunglück ums Leben gekommen war, Nathan musste damals etwa vier Jahre alt gewesen sein. Auf unserer Reise würde Nathan nicht nur den geliebten Song seines Vaters über die Nordwestpassage, sondern auch Lieder aus einem umfangreichen World-Folk-Repertoire und eigene Kompositionen singen. Er würde auch den Inuit-Mädchen aus Pond Inlet beibringen, wie man den mongolischen Kehlkopfgesang am besten lernt, doch davon wusste ich damals in dem russischen Bus noch nichts. Ich wusste nur, dass er mit seinem rasierten Schädel, seinen auffälligen Tätowierungen und beißenden Bemerkungen wirkte wie jemand, um den ich besser einen großen Bogen machen sollte.
Nachdem unser Bus die Klippen von Kangerlussuaq umrundet hatte, sah man unser Schiff in der Bucht. Es trieb so frisch und blau und weiß im Wasser, dass es aussah, als hätte es jemand gebügelt und gestärkt und in eines der dreidimensionalen Pop-up-Bilderbücher gesteckt, die mich als Kind so fasziniert hatten. Schlägt man eines davon auf, springt die Welt aus dem Buch mit ihren verborgenen Nischen und Brücken und Treppen heraus. Hier, in der grönländischen Bucht, lag nun ein Schiff wie aus einem Bilderbuch mit Flaggen, Decks und Bullaugen, das ich lieben und das mir wichtig werden sollte, als wäre es ein lebendiges Wesen.
Ich hatte viele Jahre in Neufundland verbracht, vom Ufer aus Schiffe beobachtet und mir gewünscht mitzufahren. Aus der Ferne sahen sie immer ein wenig wehmütig aus, wie im Traum – wenn sie mit funkelnden Lichtern auf dem Meer trieben, fern und klein. Wie geheimnisvoll sie doch wirkten, als bestünden sie nicht aus fester Materie, sondern aus Gedanken und Geschichten. Als wir jetzt in die Zodiacs stiegen – motorisierte Schlauchboote, die auf den nassen Steinen warteten, bis sie sich stotternd in nichts als Lärm und Gischt verwandelten, die uns durch das unruhige Wasser fuhren –, rückte unser Schiff immer näher und wirkte mit einem Mal gar nicht mehr wie ein Traum, sondern sehr erhaben und kraftvoll. Aus dem Maschinenraum tief im Inneren des Schiffs dröhnte es.
Wie Noah am Telefon erwähnt hatte, waren die allerersten solcher Reisen auf russischen Eisbrechern durchgeführt worden. Aber die Tatsache, dass das Eis im Norden schmolz, brachte mit sich, dass die Schiffe, die durch die Nordwestpassage fuhren, nicht mehr nur nützliche Arbeitstiere sein mussten. Unser Schiff war für die Bedingungen im Eis ausgerüstet, aber es verband Zweckmäßigkeit mit Anmut. Seine Flaggen und Decks wirkten fröhlich. Auf den Hauptdecks gab es mehrere bequem ausgestattete Bereiche mit klaren Linien, die jedermanns Verlangen nach Robustheit befriedigten, aber fast schon an Eleganz grenzten. Im Bugsalon konnte man auf ausladenden Ecksofas sitzen und etwas von der Bar trinken, oder man saß an kleinen Tischen, die um einen Bühnenbereich herum aufgestellt waren, als wäre es ein schwimmendes Kabarett. Mittschiffs gab es noch eine Bar mit Hockern, Sofas und Liederbüchern, die ein kluger Mensch zusammengestellt hatte und die ungefähr jeden Song enthielten, den wir uns wünschen konnten. Der Speiseraum hinten im Schiff war ein luftiger Bereich mit vielen Fenstern, weißen Tischdecken und funkelnden Stielgläsern. Es sollte täglich wechselnde Fünf-Gänge-Menüs geben und dazu ein Büffet mit Unmengen von aufgeschnittenem geräuchertem Saibling, gelben Feigen, die im eigenen Sirup schwammen, Kapern und dänischem Käse, marinierten Paprikaschoten, Oliven und Bergen von frischer Ware, die nordische Lieferanten anlieferten und entlang unserer Route an diversen Küstenstreifen so lange stapelten, bis sie uns nicht mehr erreichen konnte.
»Ein bisschen«, vertraute ich Elisabeth an, die ich mit ihrer stillen, angenehmen Art sympathisch fand, »ein bisschen komme ich mir vor wie die Jumblies.«
»Die Jumblies?«
»Aus dem Nonsensgedicht von Edward Lear.« Das Gedicht des verrückten Engländers gehörte zu meinen Lieblingen, seit ich lesen konnte. »Er hat auch ›Die Eule und das Kätzchen‹ geschrieben. Er hat Limericks geschrieben. Aber am liebsten mag ich die ›Jumblies‹. Sie erschienen nur kurze Zeit nach der gescheiterten Franklin-Expedition: Ihr Kopf ist grün, ihre Hände sind blau/Und sie stachen in See per Sieb – ein wenig wie Franklin, und sie hatten kuriose Verpflegung an Bord, so wie wir – Und vierzig Flaschen Ring-Bo-Rar/Und laiberweis Käs aus Emmental.«
Elisabeth lachte. Ich spürte, dass sie sich geistig gerne in dunkle Bereiche vorwagte – ich hatte das Gefühl, sie wäre jederzeit gegen merkwürdige Ereignisse gefeit und würde in jedem Fall ruhig bleiben. Ich mochte das sehr. Sie war schlank, und sie versuchte, ihre unbändigen Locken unter einem kleinen Barett zu zähmen. Neben ihr wirkte ich ein wenig wie ein steinzeitlicher Trampel, aber daran war ich gewöhnt.
Es war Zeit, hinunter in meine Kabine, Nummer 108, zu gehen. Auf der schmalen Treppe wurde mir bewusst, dass unter dem Hauptdeck alles zunehmend weniger ornamental und einfacher wurde, robuster, je weiter man nach unten kam. Die Luft wurde wärmer, die Wände kamen näher. Die Türen waren klein, manche davon aus Metall, und je weiter ich nach unten ging, desto lauter drang der Lärm aus dem Maschinenraum. Weiter oben hatte ich durch die offenen Türen in die Luxuspassagierkabinen hineinsehen können. Aus ihren großen Fenstern hatte man Blick auf die Baffin Bay. Unten, in meiner eigenen kleinen Kabine angelangt, entdeckte ich kleine Bullaugen, und als ich die Nase an das Glas drückte, lag dort die Meeresoberfläche auf Höhe meines Brustkorbs. Mir machte das alles nichts aus: Ich fand das Dröhnen mit den zugehörigen Vibrationen außerordentlich beruhigend. Ich war ein kleines Tier, das sich ganz eng ans Herz seiner Mutter kuschelte, und gemeinsam machten wir uns auf zur Nordwestpassage – Land der Fabeln, Kanal der Träume.
| Kapitel 3 |Die Wikingerbestattung
Mir gefiel meine Kabine ausnehmend gut. Sie lag in den Eingeweiden des Schiffes, neben einer Tür, auf der die Buchstaben WTD standen – ich sollte später herausfinden, was das bedeutete, und unsicher sein, ob mich das beruhigen oder ob es mir Angst einjagen sollte. Die Kabine war ordentlich, es gab ein Waschbecken und eine Dusche, und die Lampen erlaubten es meiner Kabinengenossin und mir, zu lesen und uns Notizen zu machen, ohne dabei den Schlaf der anderen zu stören. Meine Mitbewohnerin war die junge Leiterin der kleinen japanischen Expedition, sie arbeitete Tag und Nacht als deren Übersetzerin. Wenn wir um halb sieben aufstanden, um frühmorgens zu ankern und einen Ausflug mit dem Zodiac zu machen, dann stand Yoko vor sechs auf. Wenn die Nordlichter ihren Zauber am Himmel vollführten und alle bis Mitternacht wach waren, blieb sie bis weit darüber hinaus auf und schrieb danach noch eine weitere Stunde Berichte auf ihrem Laptop. Alle Mitarbeiter arbeiteten so gewissenhaft, aber sie war immer am längsten wach und stets mit großem Ernst bei der Sache.
Sie war nicht sehr häufig in der Kabine, und so hatte ich sie, als zurückgezogene Schriftstellerin, herrlicherweise meistens für mich allein. Ich konnte in meiner Koje liegen und Ziehharmonika spielen oder auf dem Kissen kniend durch das Bullauge das Wasser betrachten, das nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt war. Es gefiel mir, dass sich mein Körper unter dem Meeresspiegel befand, wenn ich auf dem Boden der Kabine stand. Und wenn das Schiff in Fahrt war, wenn wir den Anker gelichtet hatten und losfuhren, dann genoss ich das Gefühl, dass unter uns kein Land war. Wenn das Schiff sich neigte und die Kabine brummte und mit den Maschinen erzitterte, wenn sich das Meer und die Wolken hinter unserem Bullauge bewegten und das bisschen von Grönland, auf dem wir gestanden hatten, erst zu einem Strich wurde, dann zu einem dünneren Strich und schließlich zu einer Linie aus Träumen in der Ferne, dann wusste ich, dass ich mich in all den Jahren, in denen ich über Stock und Stein und Berg und Tal gewandert war, ohne es zu wissen, nach so etwas gesehnt hatte, wie auf einem Schiff Richtung Baffin Bay zu fahren. Als Sternzeichen Fische war ich jetzt voll und ganz in meinem Element und wünschte mir, meine Reise würde niemals enden.
Eine Kabine im Bauch eines Schiffes hat etwas von einem Mutterschoß, besonders nachts, wenn man in der Koje liegt, bevor der Schlaf kommt. Die Kabine ist so klein, dass es an Land indiskutabel wäre, aber weil darunter der Ozean schaukelt, verspürt man ein ganz ursprüngliches Gefühl, es könnte das Gefühl sein, in Fruchtwasser zu schwimmen, geschützt von den Wänden um dich herum: Das Schiff ist deine Mutter, deren Organe dich halten, es atmet. Schon nach kurzer Zeit konnte ich mir kaum mehr vorstellen, wie es war, an Land zu schlafen.
Vor einiger Zeit hatte es in meinem Leben eine andere Begegnung mit dem Wasser gegeben, bei der ich begonnen hatte zu verstehen, wie das Meer den Aufruhr schwieriger Zeiten an Land einfach fortspülen konnte. Während der Jahre, in denen mein erster Mann krank war, hatte mich eine Schwermut ergriffen, gegen die nichts hatte ankommen können. Ich hatte mich um das kleine Haus am Fuß eines Berges namens Butter Pot gekümmert, in dem wir mit unserer Tochter lebten. Der Berg war oft von Schnee überzuckert, der Mond und die Sterne ließen ihn weiß leuchten. Unter unserem Fenster lief ein Bach vorbei. Sumpffrösche und Einsiedlerdrosseln begleiteten die Musik des Wassers mit lustigen Bassnoten und schickten rätselhafte Refrains – »Carambola! Carondelet!« – über die Wipfel der Tannen und Fichten. Im Juni machten die Bekassinen ein anderes Geräusch: Über dem Sumpf lassen sie sich aus großer Höhe herabfallen, und beim Sturzflug erzeugt die Luft, die durch ihre Schwanzfedern schießt, einen geisterhaften Ton.
Der Ruf der Bekassine war ein Echo unseres traurigen Lebens dort. Es war schön in seiner Einfachheit, doch die Tatsache, dass mein Mann bald sterben würde und unsere Beziehung sich als eine von vielen Enttäuschungen entpuppt hatte, machte alles zunichte. Im Winter fror der Teich hinter unserem Haus zu, und wir gingen im Mondschein eislaufen: Meine letzte Erinnerung an unsere Ehe ist das Bild von James, wie er in dickem Mantel und Pelzmütze über dieses Eis geht. Unsere Tochter und ich liefen Schlittschuh, während er damit rang, alles zurückzulassen, was er liebte, auch wenn ihn schon vieles verlassen hatte, bevor er starb.
Hinter dem Haus machte ich lange Spaziergänge. Ich sang Lieder neben Felsen, denen meine Tochter und ich Namen gaben, anmutige Felsen, die Charakter hatten. Auf einem morastigen Bergpfad hockte ich mich neben Sumpforchideen und bestaunte die Adern in ihren Blütenblättern, und ich lernte die Namen von Pflanzen wie der Clintonia oder des Moosglöckchens, Linnaea borealis. Ich hatte den visionären kurzen Blick auf die Wirklichkeit nicht vergessen, das Gefühl meiner Jugend, dass die gewöhnliche Welt mit ihren Pflanzen, Steinen und Menschen von einer Herrlichkeit durchdrungen wurde, die sich mir nur kurz zeigte, sich dann jedoch gleich wieder zurückzog oder verbarg. In letzter Zeit hatte ich so etwas nicht mehr wahrgenommen, und ich hatte schon befürchtet, dass dieses Gefühl ein Segen der Jugend war, der mit dem Alter verschwand. Als ich jung war, war ich abgestumpften Menschen begegnet, verbitterten und desillusionierten, und ich hatte mir geschworen, nicht so zu werden wie sie. Aber in der Zeit von Armut und Krankheit war es schwierig, nicht die Hoffnung in diese frühe Andeutung von Herrlichkeit zu verlieren, woraus auch immer sie bestanden hatte.
Meine Enttäuschung machte das Zusammenleben mit mir nicht einfach. Ich wusste, dass es Bücher gab, die einen dazu anhielten, dort zu erblühen, wo man gepflanzt wurde, die Bürde eines sterbenden Ehemanns, das schmutzige Geschirr in der Küche und einen Brunnen, der im Januar einfror und im August austrocknete, zu akzeptieren. Aber wo war das Buch, das mir einen Ausweg aus dieser Mühsal zeigte? Immer, wenn ich den häuslichen Pflichten entkommen konnte, lief, rannte, weinte ich auf diesen Pfaden im Wald, bat den Himmel, die Erlen und das Wasser, zu mir zu sprechen und mir diese Andeutung von etwas Majestätischem und Allumfassendem wiederzubringen.
Zwei Tauben mit blutroten Punkten am Hals gurrten unter unserem Fenster. Die Hühner, die ich hielt, bekamen in der Abenddämmerung Besuch von wilden Rebhühnern, die in unseren Birken schliefen. Ein Raufußkauz ließ sich in der Schwarzfichte auf der anderen Seite des Bachs nieder, und es gab Seetaucher. Im Moor verbarg sich eine Entenfamilie, die die örtlichen Jäger aufspüren wollten; jedes Frühjahr gab es neue Entenjunge. Ich lauschte all den Vögeln und dem Wind, und ich nehme an, sie sprachen zu mir, auch wenn ich es damals nicht so empfand. Ich flehte jegliches Leben, das es in der Welt dort draußen geben mochte, jeglichen großen Geist, der dort wohnen mochte, an, mich etwas zu lehren, irgendetwas, nur ein kleines Stückchen Weisheit, Erkenntnis oder Trost. Ich nahm die Andeutung von Geheimnissen wahr, die sich sofort wieder zurückzogen, und bat sie, sich zu zeigen. Doch meine Bitten verhallten ungehört.
Es frustrierte mich, dass das Leben so viel härter geworden war: dass Mutterschaft, Armut und Krankheit zur Folge hatten, dass ich nicht mehr die Energie oder das Vorstellungsvermögen hatte, eine Frage zu stellen, die darüber hinausging, ob meine Hühner Eier für das Abendessen gelegt hatten oder nicht, ob ich die Rohre, die vom Brunnen zum Haus führten, auftauen konnte oder wie lange es dauern würde, bis mein grünes Feuerholz Wärme spendete statt nur Rauch, weshalb bald die ganze Küche voller Qualm war und wir nur noch husteten. Ich hatte eine Gitarre und ein paar Hefte mit Gedichten, und wenn es einen Song gab, der zum Ausdruck brachte, wie ich mich damals, zwischen den Besuchen bei Tafeln und im Krankenhaus, fühlte, dann war es »Hard Times« von Stephen Foster:
’Tis the song, the sigh of the weary,
Hard Times, hard times, come again no more
Many days you have lingered around my cabin door;
Hard times, come again no more.
Jemand hatte unseren Namen an Organisationen weitergegeben, die zu Weihnachten Geschenkkörbe verteilten. Wir bekamen drei Truthähne, aber nichts, was wir dazu essen konnten. Wenn ich meinem zweiten Mann von den Truthähnen erzähle, sagt er: »Warum habt ihr nicht zwei der Truthähne gegen ein bisschen Gemüse und Brot und Kuchen eingetauscht?« Das hört sich eigentlich ziemlich vernünftig an. Doch wir brieten und aßen die drei Truthähne, und als der letzte aufgegessen war, bekamen wir eine Essenseinladung von einer Wohltäterin, die uns nicht gut kannte, die aber gewusst haben musste, dass bei uns zu Hause ein Mann im Sterben lag, und vermutete, dass wir Hunger hatten. Sie lebte alleine und kämpfte noch mit den Überresten ihres eigenen Truthahns. Sie setzte uns Truthahnsuppe vor. Wahrscheinlich glaubt sie heute noch, die Tränen, mit denen ich ihr Tischtuch tränkte, waren Tränen der Dankbarkeit.
Als James starb, hing ein Schleier über allem. Ich hatte das kleine Haus, das wir liebevoll unseren Zigeunerwagen nannten, sehr gemocht, doch es enthielt noch die Schatten, von denen ich mich befreien musste. Das brauchte Zeit. Ich musste mich von Dingen trennen, die sich in verborgenen Winkeln angesammelt hatten. In einer Ecke im Keller fanden sich viele traurige Erinnerungsstücke: Papiere, Bilder und Andenken an James, Kleidungsstücke, die er besonders geliebt hatte. Alles, was ich für so wichtig gehalten hatte, dass ich es für seine Tochter oder seine engsten Freunde oder Verwandten aufheben wollte, hatte ich herausgesucht und verteilt. Aber es gab immer noch Kisten und Kästen, die dunkle und machtvolle Erinnerungen enthielten. Bevor ich dieses Haus verlassen konnte, musste ich etwas damit anfangen.
Christine, die conjointe meines Bruders Michael, wie es in Montreal heißt, sagte: »Eine Wikingerbestattung wäre genau das Richtige für dich.«
»Eine was?«
»Du packst die Sachen zusammen und bringst sie zu mir raus nach Western Bay. Wir bauen ein Floß dafür, ziehen es mit unserem kleinen Boot hinaus in die Bucht und zünden es an. Ich rudere dich.«
Das hatte etwas sehr Endgültiges und Schönes an sich. Ich war einverstanden.
Bei Sonnenuntergang zeigte ich Christine und der kleinen Prozession, die sich versammelt hatte, um alles auf dem Wasser treiben und brennen zu sehen, die letzten Sachen.
»Was ist damit? Das ist seine Wolfspelzmütze.«
»Verbrenn sie.«
»Und das? Die Unabhängigkeitserklärung auf Pergament, er hat sie gemacht, als er sich mit Kalligraphie beschäftigt hat.«
»Die wird schön in Flammen aufgehen.«
»Und seine mittelalterliche Weste?«
»Wirf sie mit auf den Haufen.«
Christine war eine perfekte Bootsführerin. Sie hatte einen Flachmann mit Wodka dabei, den sie zuvor gekühlt hatte. Alle paar Minuten reichte sie ihn mir, und ich trank feierlich einen großen Schluck. Weder ihr Äußeres noch ihr Verhalten verriet auch nur die Spur eines Zweifels an unserem Vorhaben. Sie sah aus, als hätte sie bei Hunderten von Wikingerbestattungen das Boot gerudert. Auch die Zuschauer sahen aus, als würden sie seit Jahrtausenden an solchen Zeremonien teilnehmen – besonders die Kinder, die auf den wilden Gräsern, deren Grün unter dem sich rot färbenden Himmel immer kräftiger wurde, Räder schlugen. Als wir das Floß zum Strand hinunterzogen, hatte sich der Himmel grauviolett gefärbt und die Sterne waren bereits zu erkennen. Christine hatte auch eine Dose Feuerzeugbenzin dabei. Sie schüttete eine ordentliche Portion über James’ Besitztümer, dann stiegen wir in das kleine Boot, und die Zuschauer schoben uns hinaus aufs Wasser.
Es war ein erhebendes Gefühl, auf dem Wasser zu treiben. Ich hatte völliges Vertrauen in Christine, in ihre Fähigkeit, James’ Sachen mit Brandbeschleuniger zu tränken, in ihre Vorliebe für Wodka und in ihr Rudertalent. Jetzt gab es nur noch uns beide, den schweren Himmel über uns und das schöne, plätschernde, wogende Salzwasser. Ich hatte noch nie eine zerstörerische Handlung als so richtig empfunden. Trotz der Dunkelheit erkannten wir immer noch unsere Freunde am Strand – klein allerdings, denn wir waren weit draußen in der Bucht.