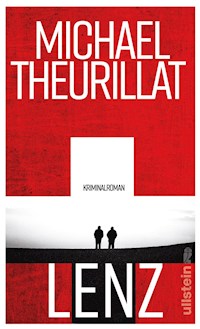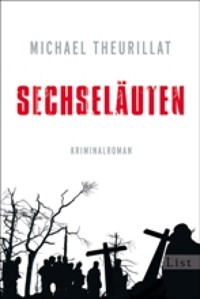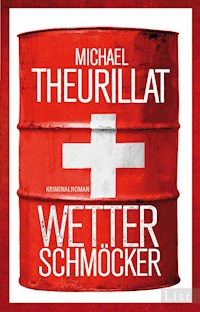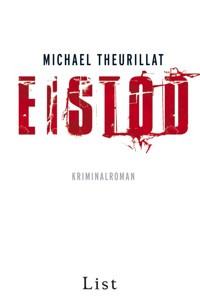
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche in der Limmat, ein verschwundener Assistent und ein Professor unter Mordverdacht. In seinem zweiten Fall gerät Kommissar Eschenbach in einen Sumpf aus Intrigen und tödlichem Ehrgeiz. Hat sein alter Schulfreund biochemische Substanzen zur Folterung islamischer Terroristen entwickelt? Und wem kann Eschenbach selbst in höchsten Polizei- und Politikerkreisen noch trauen? In diesem eisigen Winter wundert sich zunächst niemand, als in Zürich immer mehr Obdachlose erfroren aufgefunden werden. Doch dann entdeckt ein Gerichtsmediziner bei den Toten Reste eines rätselhaften Giftes. Die Ermittlungen führen Kommissar Eschenbach an das Biochemische Institut zu Professor Winter, der als Anwärter auf den Nobelpreis gilt. Hat sein alter Schulfreund tatsächlich etwas mit den Toten zu tun? Eschenbach werden Hinweise zugespielt, dass Winter womöglich biochemische Substanzen zur Folterung islamischer Terroristen entwickelt hat. Und wo steckt Winters Assistent, der plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist? Je weiter Eschenbach mit seinen Nachforschungen in die besseren Kreise vordringt, desto tiefer gerät er in einen Sumpf aus Intrigen, Lügen und Korruption. Nach dem Debüterfolg Im Sommer sterben der zweite atemberaubende Kriminalroman des Schweizer Autors Michael Theurillat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
In diesem eisigen Winter wundert sich zunächst niemand, als in Zürich immer mehr Obdachlose erfroren aufgefunden werden. Doch dann entdeckt ein Gerichtsmediziner bei einem Toten Spuren eines rätselhaften Gifts. Die Ermittlungen führen Kommissar Eschenbach ans Biochemische Institut zu Professor Winter, der als Anwärter auf den Nobelpreis gehandelt wird. Hat sein alter Schulfreund tatsächlich etwas mit den Toten zu tun? Eschenbach werden Hinweise zugespielt – womöglich hat Winter biochemische Substanzen zur Folterung islamistischer Terroristen entwickelt. Und warum ist Winters Assistent plötzlich wie vom Erdboden verschluckt? Je weiter Eschenbach mit seinen Nachforschungen in die besseren Kreise vordringt, desto mehr sieht er sich mit Intrigen, Lügen und Korruption konfrontiert.
Der Autor
Michael Theurillat, geboren 1961 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte und arbeitete jahrelang erfolgreich im Bankgeschäft.
Von Michael Theurillat ist bei uns im Hause bereits erschienen:
Im Sommer sterben Sechseläuten
MICHAEL THEURILLAT
KRIMINALROMAN
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.list-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 1. Auflage September 2008 3. Auflage 2011 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007 / claassen Verlag Umschlaggestaltung: RME Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg (unter Verwendung einer Vorlage von HildenDesign, München) Satz: Franzis print & media GmbH, München eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany eBook ISBN 978-3-8437-0191-4
»Alle Leute lachen, das fällt am meisten auf,denn sonst lacht hier nie jemand.«
Ingeborg Bachmann an Uwe Johnson(anlässlich der Zürcher Seegfrörni 1963)
Prolog
Mit dem November kam der Nebel.
Meret saß in ihrem Lehnstuhl am Fenster und sah auf den See hinaus. Sie konnte das gegenüberliegende Ufer nicht mehr erkennen; das Wasser verlor sich im grauen Nichts. Und weil sie nicht feststellen konnte, dass es irgendwo endete, war aus dem Thunersee plötzlich ein Ozean gewachsen. Es machte Meret Angst.
Sie wusste, dass es für diese Angst eigentlich keinen Anlass gab. Genauso wie es für vieles, das sie beängstigte, keinen Grund gab. Aber das half nichts.
»Wie geht’s dir heute, Mutter?« Der Mann, der ihr gegenübersaß, hatte lange geschwiegen. Jetzt sah er sie an.
»Es geht«, sagte sie. »Nichts Neues.« Der Mann nickte.
»Es fällt bald Schnee«, sagte sie nach einer Weile. »Ich spür’s.«
»Wir waren letzten Sonntag auf dem Männlichen«, sagte er. »Der Himmel war wolkenlos und die Jungfrau glänzte im ersten Schnee wie ein Kommunionskind. Du solltest mal raus aus dem Nebel hier. Wir könnten doch zusammen …«
»Nicht jetzt«, unterbrach sie ihn müde. »Ich weiß, es ist lieb gemeint. Aber ich habe mich an all das gewöhnt. Es ist schon recht.«
»Überleg es dir trotzdem, Mutter.«
»Du weißt, dass ich das nicht mag.«
»Was?«
»Dieses ewige Tu dies, Mach das. Dass man mir sagt, ich soll mich zusammenreißen … und dass es Menschen gibt, denen es noch viel schlechter geht.«
»Natürlich weiß ich es, Mutter … aber ich mach mir eben Sorgen.«
»Das solltest du nicht. Grad du nicht. Nach all den Jahren müsstest du’s eigentlich besser wissen.«
»Ja, natürlich.«
»Kürzlich hat meine Friseurin gesagt, ihr würde es helfen, wenn sie sich während einer schlechten Phase selbst nicht so wichtig nimmt.«
Der Mann seufzte. »Sie hat’s nicht böse gemeint, Mutter. Wie soll sie’s denn wissen? Es ist immer dasselbe: Erklär mal jemandem, der genug zu essen hat, was Hunger ist.«
»Sicher.« Meret sah eine Weile in den Nebel. »Aber es schmerzt trotzdem, wenn mir eine junge Dame unterstellt, ich würde mich in den Mittelpunkt rücken … Dabei halt ich nur nach einem Fleckchen Ausschau, an das ich mich still verkrümeln könnte. Ich nehm überhaupt nichts wichtig, geschweige denn mich. Das ist ja gerade das Problem. Von mir aus könnte es fertig sein, für immer.«
»Hör auf, Mutter!«
»Doch. Und es würde nichts ändern. Jedenfalls nicht für mich. Und seit du mir gesagt hast, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es vielleicht noch Jahre dauern könnte … seither denke ich wieder öfter daran.«
»Wir haben eine andere Lösung gefunden, glaub mir. Es ist bald so weit.«
»Ich glaub dir ja.«
Wieder saßen sie einander schweigend gegenüber. Nach einer Weile streckte der Mann beide Arme nach ihr aus und meinte: »Und bis es so weit ist, könnten wir ja trotzdem einmal in die Berge. Mit der Bahn, von hier aus. Du setzt dich ans Fenster … Es dauert nicht lange, bis wir oben an der Sonne sind.«
Sie schüttelte lange den Kopf. »Ich will hierbleiben. Bitte versteh doch. Hier fühl ich mich sicher.« Und nach einer Pause fügte sie hinzu: »Auch wenn du mich nach Grindelwald fährst, mir Eiger, Mönch und Jungfrau zeigst, wie sie sich in gleißendem Sonnenlicht für die Ewigkeit aufstellen: Ich würde nicht sehen, wie schön sie sind.«
1
»Du hast eine Erkältung, das ist alles«, sagte Christoph Burri, nachdem er Eschenbach gründlich untersucht hatte.
Eschenbach rang sich ein müdes Lächeln ab. Er kannte Burri länger, als er denken konnte. Der Kommissar und der Arzt waren sich zum ersten Mal vor ihrer Geburt begegnet. Getrennt durch die Bauchdecken zweier Mütter, die das Gebären übten: Pressen, Hecheln und die indische Brücke. Einundfünfzig Jahre war das her. Später spielten sie Fußball auf der Fritschi-Wiese, bastelten gemeinsam an ihren Fahrrädern und tauschten Erfahrungen aus; manchmal auch das Mädchen.
»Und schlaf dich mal aus, so richtig, mein ich.«
»Ich könnte den ganzen Tag schlafen, Christoph.« Eschenbach knöpfte sich Hemd und Hose zu, setzte sich auf den Stuhl neben dem Schreibtisch und schlug die Beine übereinander. »Seit Corina ihre Sachen gepackt hat, bin ich nur noch ein halber Mensch.«
»Sie sagt, das wärst du vorher schon gewesen.«
»Vielleicht.« Der Kommissar zuckte die Schultern. »Aber jetzt merke ich es selbst. Der Trott bei uns, das Wetter … ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich aufhören und etwas ganz anderes machen.«
»Was denn?« Der Arzt sah diskret auf die Uhr.
»Theater spielen … Bienen züchten. Wenn ich’s wüsste, dann hätte ich’s vermutlich längst getan.«
»Ich sehe dich schon zwischen Honigtöpfen, in Imkeruniform und mit rauchender Zigarre. Oder als Winnie the Pooh in einer Kindervorstellung im Theater am Hechtplatz.« Burri grinste.
Eschenbach schüttelte den Kopf. Er sah sich als König Lear.
»Es muss ja nicht gleich so was Abgefahrenes sein«, kam es in aufmunterndem Ton. »Geh unter die Leute, ins Museum von mir aus. Schau dir wieder mal die Impressionisten an.«
Eschenbach musste niesen.
»Das ist Medizin für die Seele, glaub mir. So zwischen alten Meistern und jungen Kunststudentinnen …«
Der Kommissar dachte an Elsbeth, eine amour fou während der Skiferien in den Flumser Bergen. Das war nach der Scheidung von Milena, seiner ersten Frau. Jetzt stand er vor der zweiten – eine Runde weiter also.
»Da war doch diese Studentin aus Bern …«, Christoph Burri zwinkerte ihm zu. »Glaub mir, ein Flirt produziert bei uns mehr Testosteron als das ganze Pharmazeugs.«
»Dann liegt es bei mir doch an den Hormonen?«
»Nein. Die Hormonwerte sind okay, für dein Alter.«
»Mein Alter ist auch dein Alter, mein Lieber.« Eschenbach wunderte sich über die Härte in seinem Tonfall.
»Eben. Deshalb sag ich, Flirten hilft.«
Der Kommissar suchte in der Jackentasche nach einem Taschentuch. Wieder musste er niesen. »Ach, was ich dich noch fragen wollte: Nimmt Kathrin eigentlich die Pille?«
»Das solltest du besser wissen als ich, sie ist deine Tochter. Aber wenn du fragst … wir haben es miteinander besprochen.«
»Und?«
»Sie ist fünfzehn, das ist etwas früh. Wenn es irgendwie geht, sollte sie noch warten.« Nach einer Kunstpause fügte er hinzu: »Trotzdem, ich habe ihr vorsorglich ein Rezept ausgestellt.«
Eschenbach schwieg.
»Ich dachte, es ist dir recht, wenn du noch nicht Großvater wirst.« Burri lächelte.
Dem Kommissar gefiel der Gedanke tatsächlich nicht. Auch wenn Kathrin nicht seine leibliche Tochter war; man würde ihn Opa rufen – und das reichte. »Das ist schon okay«, sagte er. Was ihn mehr beschäftigte, war die Frage, wie weit Kathrin in ihrer pubertierenden Neugier schon gegangen war. Gab es einen Freund? Jetzt, da sie nicht mehr im gleichen Haushalt lebten, spürte er die Distanz zwischen ihnen. Sie schmerzte ihn mehr als das Stechen in der Brust und die brennenden Augen.
Er verabschiedete sich von Burri. Als Eschenbach mit Nasentropfen, Grippemitteln und einer Packung Vitamin C in der Manteltasche die Arztpraxis verließ, war es früher Nachmittag.
Es hatte angefangen zu schneien. Dicke Flocken suchten den Weg durch den Nebel und die feuchte Kälte fuhr dem Kommissar bis ins Mark. Beim Römerplatz nahm er die Tram; holpernd und schnäuzend ging es den Berg hinunter bis zum Bellevue. Dort stieg er wieder aus. Die trockene Heizluft im Wageninnern und das Gehuste der anderen hatten ihm den Rest gegeben. Mit heißem Kopf und fröstelnden Gliedern schleppte er sich langsam entlang der Limmat Richtung Rathaus. In Gedanken lag er längst in der Badewanne, mit Mozart und einer Tasse Lindenblütentee. Wird schon besser, dachte er. Da fiepte sein Handy.
Es war alles gelaufen, als der Kommissar am Tatort erschien.
Martin Z. hatte sich vor dem Crazy Girl selbst gerichtet. Zuvor hatte er der Prostituierten Nora K. ein halbes Magazin Kugeln in die Brust gefeuert und dem Türsteher Josef M. einen glatten Lungendurchschuss verpasst. Die Position von Opfer und Täter, beide tot, war sorgfältig markiert worden und die Spuren der Ereignisse, die sich vom Zimmer über Flur und Treppe bis vor das Lokal zogen, ordnungsgemäß fotografiert. Gewebe-, Blut- und Haarproben steckten bereits in Plastiktütchen, und der Krankenwagen war mit Blaulicht Richtung Triemli-Spital unterwegs. Ob der Türsteher durchkommen würde, war ungewiss.
»O du fröhliche«, sagte Eschenbach, nachdem er sich vom Schlamassel ein Bild gemacht hatte. Er zog an seiner Brissago und hustete den Rauch in die kalte Dezemberluft. »Und morgen ist Heiligabend.« Etwas abseits der Hektik sah der Kommissar den Leichenwagen. Er stand quer auf dem Gehsteig. Ein schmächtiger Mann in dunklem Anzug versuchte Schneeketten über das rechte Hinterrad zu ziehen.
Eschenbach ging die paar Schritte zu dem schwarzen Kombi und hörte, wie der Mann fluchte. »Geht’s?«, fragte er.
»Einen Scheißdreck geht’s!« Der Mann rasselte mit den Ketten, stand auf und holte tief Luft: »Erst ficken sie unsere Mädchen, dann schießen sie alles zusammen und am Schluss bekommt jeder einen Staatssarg. Gratis. Zahlen tut hier keiner was.« Nachdem er abermals tief durchgeatmet hatte, kniete er sich wieder neben das Hinterrad. »Scheißausländer«, zischte er. »Alle zusammen Scheiße!«
»Sommerreifen im Winter sind auch Scheiße«, sagte Eschenbach und ging zurück zum Tatort.
2
Es war immer dasselbe Gefühl von Armseligkeit, das Eschenbach beschlich, wenn er an einem Ort stand, an dem Gewalt ein Leben ausgelöscht hatte. Im Crazy Girl war es sichtbar: das Ärmliche, das diesen Plätzen anhaftete. Man würde es später auf den Polizeifotos erkennen können: der abgetretene Filzboden im Flur und der Gilb an den Wänden. Die Glühbirnen, die nackt von der Decke hingen. Das fahle Licht und der Muff.
Eschenbach hatte sich vom diensthabenden Offizier die Personalien des Amokschützen und der Toten geben lassen. Jetzt, an der Bar im Erdgeschoss des Gebäudes, sah er auf das Blatt Papier: Martin Zgraggen, Jahrgang 1963. Darunter stand eine Adresse in Zürich-Höngg. »Von wegen Ausländer«, murmelte er. Sein Haar klebte ihm an der schweißnassen Stirn; er fröstelte. »Kennen Sie die Frau, Nora?«, fragte er das dunkelhäutige Mädchen hinter der Theke. Er deutete mit dem Finger nach oben. Nora K. und ein paar Fragezeichen. Mehr stand nicht auf dem Zettel.
Der Kaffeeautomat fauchte und spritzte heißes Wasser in ein Whiskyglas.
Die junge Frau schüttelte den Kopf.
»Schon lange hier?«, fragte er weiter.
Es kam ein Schulterzucken. Dann nahm sie einen Bierdeckel, legte ihn auf den Holztresen vor Eschenbach und stellte das Glas mit dem Wasser drauf.
»Kein Deutsch?«
Wieder Kopfschütteln.
»Brasil?«
Sie nickte und lächelte.
Eschenbach kramte in der Manteltasche nach den Medikamenten. Fiebersenkend und schmerzstillend stand auf der einen Packung; auf der anderen hieß es: Lindert Husten und fördert den Auswurf. Er tat je eine Tablette ins Glas und rührte. Nachdem er in den Packungsbeilagen etwas über die Nebenwirkungen gelesen hatte, überkam ihn ein leichtes Gefühl von Übel- und Müdigkeit. Während er langsam und in kleinen Schlucken die grellgelbe Flüssigkeit trank, sah er dem Mädchen zu. Sie räumte den Geschirrspüler aus und summte dabei. Mit einem weißen Lappen trocknete sie das Geschirr nach, bevor sie die Gläser ins Regal stellte. Ab und zu warf sie dem Kommissar einen verstohlenen Blick zu. Wenn Eschenbach lächelte, tat sie es auch.
»Pferdepisse«, brummte er, nachdem er den letzten Schluck getrunken und das Glas zurück auf die Holztheke gestellt hatte. Mit einem großen Stofftaschentuch trocknete er sich Mund und Stirn, schnäuzte sich einmal kräftig und glitt vom Barhocker. »Adios«, sagte er.
»Até logo.« Das Mädchen hob die Hand zu einem halbherzigen Winken und sah ihm nach, wie er langsam zum Ausgang ging.
Eschenbach schleppte sich bis zur Badenerstrasse, dort hatte er Glück. Ein Taxi setzte gerade einen Fahrgast ab. Der Kommissar stieg ein.
»Ich bin besetzt«, knurrte der ältere Herr am Steuer.
»Kripo Zürich«, sagte Eschenbach und hielt dem Fahrer seinen Dienstausweis unter die Nase. »Fahren Sie mich bitte zum Paradeplatz!«
»Dann halt«, kam es halblaut. »Ich kann auch nichts dafür.
Bei dem Wetter fährt gerade mal die Hälfte der Belegschaft. Türken und Griechen – die kennen Schnee nur vom Hörensagen.«
»Ja, ich weiß, Sie sind ein Mutiger.«
Der Taxifahrer schwieg.
Eschenbach war, als hätte ihn die Welt wieder. Die letzten Wochen war es ruhig gewesen und nun – erkältet und mit einem Kopf wie ein Bienenstock – hatte er doch noch seinen Weihnachtsmord. Wenigstens würde dieser ihn ablenken und ihm das Gefühl geben, dass er für irgendwas gut war.
Er hörte die Combox auf seinem Handy ab. Die einzige Nachricht war von Christoph Burri. Der Arzt erkundigte sich nach dem Befinden seines Patienten. »Und komm heute Abend doch vorbei – es sind alles interessante Leute … das bringt dich auf andere Gedanken.«
Der Kommissar steckte das Mobiltelefon wieder in die Manteltasche und sah zum Fenster hinaus. Der Schnee verlieh dem Paradeplatz eine Aura von Kälte. Mit hochgezogenen Schultern und Wintermänteln standen die Leute auf der Traminsel und warteten im schummrigen Licht der Abendbeleuchtung. Ungeduldig; mit Kappen und Mützen. Hier und da ein Hauch von Pelz. Das Taxi hatte noch nicht gehalten, da sah der Kommissar den Menschenauflauf vor der Boutique Grieder. Zwei Wagen der städtischen Polizei standen dort und ein Sanitätswagen versperrte einer Tram die Durchfahrt. Eschenbach beglich die Rechnung, stieg aus und überquerte gemächlich den Platz.
Eine kleine, adrette Dame stand in der äußersten Reihe auf Zehenspitzen. Es schien, als überlegte sie einen Moment, ob sie die Einkaufstaschen von Louis Vuitton auf den matschigen Boden stellen sollte. »Was ist hier denn los?«, fragte sie.
»Grieder gibt alles zum halben Preis«, sagte der Kommissar und hustete.
»Das ist ja der Hammer.« Die Frau bedankte sich.
»Gern geschehen.« Eschenbach bahnte sich einen Weg durch die Leute. »Geht’s?«, fragte er, als er endlich einen Polizisten vor sich hatte. »Kann ich helfen?« Der Kommissar zeigte seinen Dienstausweis.
»Nö, alles vorbei«, sagte der Beamte. Er deutete zum Krankenwagen. »Jemand vom Grieder hat angerufen. Hatten einen Stadtstreicher, der neben dem Eingang saß. Einen Weihnachtsbettler eben.«
»Und?«
»Tot«, sagte der Beamte. »Mause. Eingenickt vor seinem Hut mit acht Franken fünfzig drin. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Hm.«
Der Stadtpolizist hob die Schultern. »Ist nicht der erste in diesem Winter.«
»Ach, wirklich?« Eschenbach nahm das Taschentuch und schnäuzte sich.
»Ja, irgendwie traurig«, sagte der Beamte. »Den letzten haben wir auf einer Bank beim Landesmuseum gefunden. Erfroren. Das kalte Wetter gibt ihnen vermutlich den Rest.«
»Herrgott, wir haben doch Schlafstellen.« Eschenbach wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn.
»Wir können sie zum Brunnen führen …« Der Polizist machte eine fahrige Bewegung mit der Hand. »Aber trinken müssen sie schon selbst.«
»Vielleicht, ich weiß es nicht.« Der Beamte schwieg.
Der Kommissar musste sich noch einmal schnäuzen, dann verstaute er das Taschentuch in der Manteltasche.
Unter dem Sandsteinbogen, dort, wo der Tote gelegen hatte, sah er den Filzhut mit dem Kleingeld. Daneben, nass und verdreckt, eine schwarze Trainerjacke von Adidas. Eschenbach kam unweigerlich Kathrin in den Sinn; sie besaß ein ähnliches Modell. Nachdenklich schaute er in die Gesichter der Gaffer.
»Es gibt nichts zu sehen«, rief ein Beamter. Gemeinsam mit einer Kollegin verwies er die Leute hinter das rot-weiße Band der Absperrung.
Die knapp vierzig Stufen hinauf zur Wohnungstür waren für Eschenbach eine Eigernordwand gewesen. Schweißgebadet lag er auf der Couch im Wohnzimmer. Zwei Grog hatte er intus – darin aufgelöst die Tabletten aus Burris Medikamententüte. Zwei Stunden hatte er dagelegen und geschlafen. Der Anrufbeantworter blinkte, es war kurz vor acht. Auf dem Weg ins Bad lauschte Eschenbach Burris Stimme, die vom Band kam: eine erneute Einladung zu seiner Cocktailparty; zur Seasons Opening, wie er es nannte. Von cool drinks und hot chicks war die Rede. Eschenbach duschte.
Ob es die Wunderwirkung chemischer Substanzen war oder nur der Drang, vor sich selbst davonzulaufen; der Kommissar wusste es nicht. Er dachte auch nicht darüber nach, als er kurz vor neun mit einer Flasche Bordeaux unter dem Arm die Wohnung verließ.
»Freut mich, dass du noch kommst.« Christoph Burri trug Jeans und ein weißes Hemd. Die offenen Knöpfe am Hals zeigten solariumgebräunte Haut und den Ansatz eines sportlichen Oberkörpers.
»Ich trage Wasser in die Limmat«, sagte Eschenbach, als er dem Arzt die mitgebrachte Flasche in die Hand drückte.
»Ein Cru Bourgeois aus dem Medoc.« Burri hielt die Flasche auf Augenhöhe.
»Die Grand Crus hast du ja selbst im Keller …« Eschenbach grinste, legte seinen Mantel ab und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Das ist auch der Grund, weshalb ich gekommen bin.«
»Dacht ich’s mir.« Burri lachte.
»Und die hot chicks natürlich.«
»Dann ab in die gute Stube!«
Was Burri salopp als gute Stube bezeichnete, war eine geschmackvoll renovierte Villa im Englischviertel-Quartier. Hohe Decken mit Stuck, helle große Räume mit altem Fischgrat-Parkett. Es war das, was sich Intellektuelle leisteten, wenn sie Geld erbten oder – was seltener der Fall war – es auch verdienten. Bei Christoph Burri wusste Eschenbach nicht genau, zu welcher Gattung er gehörte. Die Zeit, in denen praktizierende Ärzte zu den Großverdienern zählten, war definitiv vorbei. Die galoppierenden Kosten im Gesundheitswesen sorgten dafür, dass die einstigen Götter in Weiß auf menschliche Durchschnittsgrößen schrumpften, jammerten und klagten, wie die Lehrer oder die Handwerker und Polizisten.
Eschenbach ließ sich von einer Angestellten des Catering-Service ein Glas Rotwein geben, schnappte sich von einem Tablett einen Schinkengipfel und musterte die Gäste. Die hot chicks waren mehrheitlich Damen in Eschenbachs Alter. Einige von ihnen schienen die Kleider ihrer Töchter zu tragen: zerschlissene Designerjeans, figurbetonte Tops und um den Hals ein massives Silberkreuz mit Lederriemen.
»Komm, ich stell dir ein paar Leute vor«, sagte Burri und zog den Kommissar am Ärmel. Es folgte die übliche Tortur: Namen, die er sich nicht merken würde, das interessierte Lächeln und die gespielte Freude. Am Ende blieb Eschenbach der Wunsch, sich gehörig zu betrinken.
Die junge Frau, die ihm dabei half, hieß Denise. Sie war Mitte dreißig und als »hübsches Anhängsel« von Kurt Gloor, Vorsteher des Sozialdepartements der Stadt, so bekannt wie ein bunter Hund.
»Und was machen Sie beruflich?«, fragte sie.
»Ich bin Patient«, sagte Eschenbach.
»Tatsächlich?« Sie nippte an ihrem Prosecco.
»Ja, hauptberuflich.«
Einen Moment lang stand sie da und sagte nichts, ohne das Gesicht zu verziehen. Dann lachte sie schallend. Der Prosecco in ihrem Glas schwappte über.
Eschenbach wich einen Schritt zurück. Besoffenes Huhn, dachte er, und als Denise Gloor nicht aufhörte zu lachen, schlenderte er zum Buffet und holte Nachschub. Mit einer halb vollen Flasche italienischen Schaumweins kehrte er zurück, dann schenkte er nach.
Die Frau vom Service eilte mit einem weißen Küchentuch herbei und wischte den Boden auf.
»Endlich kommt Stimmung in die Bude«, sagte Eschenbach leise.
Denise hielt sich die Hand vors Gesicht. Sie hatte schöne Hände und Tränen in den Augen.
Eine halbe Stunde später saßen sie nebeneinander auf der Couch bei einer Flasche Rotwein. Denise erzählte von ihrer Arbeit als Kreditanalystin einer Großbank.
»Eigentlich geben wir nur denen Geld, die es nicht brauchen«, kicherte sie und ließ sich von Eschenbach nochmals Wein einschenken.
»Ich mag Frauen, die trinken.«
Sie gluckste. Dann sprach sie darüber, wie sie Kurt Gloor kennengelernt hatte. Damals, als er noch Finanzchef einer kleinen Firma in Wollishofen war. »Kurt steckt sich Ziele und erreicht sie.« Und nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Ich war auch eines davon.«
»Und wie kommt ein aufstrebender Finanzchef zur Politik? Ich meine, dort landen doch nur die Gestrandeten …«
»Solche wie wir, meinst du?« Denise nahm einen kräftigen Schluck, dann lehnte sie sich an Eschenbachs Schulter. »Ich glaube, die Politik braucht klare Köpfe … Ziele, und eine harte Hand.«
»Vor allem im Sozialdepartement«, witzelte der Kommissar.
»Du wärst zu weich … hast keine Ahnung, was dort alles abgeht. Die Ausländer, die ganzen Kriminellen. Als Kurt in den Stadtrat gewählt wurde, war das Sozialdepartement gerade frei.«
»Ich bin es auch«, sagte Eschenbach und hustete.
»Man muss nehmen, was man kriegt.«
»Eben.«
»Ist noch Wein da?«
Der Kommissar nahm die Flasche, die er zwischen zwei Couchkissen eingeklemmt hatte, und füllte ihr Glas.
»Und du?«
»Ich bin betrunken«, sagte Eschenbach.
»Und? Stört es dich?«
»Nein.«
»Dass ich trinke?«
»Auch nicht.« Der Kommissar schenkte sich ebenfalls ein. Dann sahen sie einander schweigend an und leerten ihre Gläser.
Nach einer Weile legte sie ihren Kopf auf seinen Schoß und zog die Beine an.
»Hauptamtlicher Patient also … das ist ein schöner Beruf«, murmelte sie.
3
An einem abgelegenen Ort nahe dem Dörfchen Heimenschwand im Kanton Bern, etwa zur selben Zeit, in der sich im Crazy Girl in Zürich ein menschliches Drama abspielte, stellte ein junger Mann sein Bike an eine nichtssagende Hauswand.
Vermutlich kommt wieder Schnee, dachte Konrad Schwinn und warf einen Blick auf die Wetterstation neben der Eingangstür. Das Thermometer zeigte minus acht Grad Celsius. Sein dunkler Thermoanzug dampfte. Obwohl er seit seinem Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich regelmäßig Ausdauersport betrieb, schmerzten seine Beine. Er war weiter gefahren, als er ursprünglich wollte, und hatte sich außerhalb des erlaubten Rayons bewegt. Wenn ihn jemand gesehen hatte, waren Schwierigkeiten vorprogrammiert. Das nächste Mal würde er eine Genehmigung für die ausgedehnte Radtour einholen und sich bei der Zentrale entsprechend abmelden. Genau so, wie es die Weisung 7-IV des Kommandos der zweiten Kompanie für Elektronische Kriegsführung, kurz EKF, vorsah.
Schwinn meldete sich beim Kollegen an der Eingangskontrolle zurück, trug Namen, Dienstgrad und Einteilung sowie den Zeitpunkt seiner Rückkehr in das Ausgangsjournal ein, ging in die Mannschaftsräume und stellte sich unter die Dusche. Als Technischer Unteroffizier der EKF-Kompagnie 46/II teilte er sich mit drei gleichrangigen Kollegen einen Viererschlag. Der Mannschaftsraum, der gleich nebenan lag, bot Platz für achtzehn Nasen; zwölf von ihnen hatten in der Zeit über Weihnachten Urlaub.
Die zwei Stunden bis zum Beginn seiner Schicht um sechzehn Uhr verbrachte Schwinn im Aufenthaltsraum. Er las die Weihnachtsausgabe der Neuen Zürcher Zeitung und diskutierte dann mit Korporal Heinz Fässler einen Schaltplan für Richtstrahlantennen.
»Dass du das immer grad so siehst«, sagte Fässler bewundernd und notierte die Anordnung, die ihm sein Kollege vorgeschlagen hatte. »Ich wäre nie draufgekommen.«
»Ich seh’s auch nicht immer … aber mit der Zeit wird man besser.«
»Elender Tiefstapler!«
Beide lachten, standen auf und spielten am Kasten in der Ecke noch eine Partie Flipper.
Es war tatsächlich so, wie Fässler sagte: Egal ob es Schaltpläne, Gleichungen oder scheinbar nicht zusammengehörige Zahlenfolgen waren; Konrad Schwinn erkannte das Muster auf einen Blick, sah den Fehler und hatte die richtige Lösung parat. Seit seiner Kindheit hatte Schwinn eine Affinität zu Zahlen. Seine Eltern – der Vater baute Turbinen für Brown Boveri und die Mutter, eine Inderin, unterrichtete Englisch an der Migros – hatten das, was man später als »Hochbegabung« diagnostizierte, lange nicht bemerkt. Erst als der Junge auffällig geworden war und man seitens der Lehrerschaft gedroht hatte, ihn der Schule zu verweisen, griff der Vater ein. Der Junge wechselte auf die Talenta, ein Zürcher Institut für besonders begabte Kinder. Dort blieb er bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr, bis der Vater als Ingenieur für Ölraffinerien ins Ausland musste und die Familie mitnahm. Zuerst drei Jahre nach Libyen, dann für zwei weitere in den Iran.
Als Konrad Schwinn mit achtzehn zurück in die Schweiz kam und die Aufnahmeprüfung der Eidgenössischen Technischen Hochschule mit links bestand, sprach er, nebst fünf weiteren Sprachen, fließend Arabisch. Vermutlich war es die seltene Kombination von mathematischer und sprachlicher Begabung, die die Einteilung zu dieser kleinen Spezialeinheit ermöglicht hatte. Wie jeder Schweizer musste er Militärdienst leisten und in seiner Vorstellung gab es kaum einen angenehmeren Posten in der Armee als diesen. Die Anlage in Heimenschwand war hochmodern, verfügte über jeglichen technischen Schnickschnack und das Kommando pflegte einen kollegialen Führungsstil. Sie alle waren Mitarbeiter, die man ernst nahm – keine Marionetten. Es wurde nicht befehligt, sondern gefragt; höchstens wurde man gebeten. Und das war für Konrad Schwinn das Wichtigste.
Der einzige Nachteil bestand darin, dass die Einsätze geheim waren, dass niemand über seine Aufgabe sprechen durfte. Doch weil Schwinn auch sonst nur wenig sprach, am wenigsten über sich selbst, empfand er auch das als einen Vorteil. Abgesehen davon würde kaum jemand verstehen, um was es überhaupt ging.
Normalerweise absolvierte Schwinn seine Diensttage im August, wenn ein milder Wind über die Alpenwiesen strich, wenn es nach Heu duftete und das Blöken der Schafe ein Stück ländliche Idylle versprach. Diese Zeit war für den jungen Assistenzprofessor der Biochemie ideal; die Kurse fielen in die Semesterferien und boten eine angenehme Unterbrechung seiner Arbeit am Institut. Anfang Dezember, als erneut ein Marschbefehl kam, vermutete er zunächst einen Fehler. Er rief in Bern an und erkundigte sich beim Verteidigungsdepartement. Es war kein Irrtum. Man wisse sehr wohl, hieß es, dass er bereits im Sommer Dienst getan hatte. Weitere Erklärungen gab es keine.
Pünktlich um vier verließ Schwinn den schlichten Betonbau am Waldrand. Bekleidet mit einem sandfarbenen Anorak, hob er sich nur unmerklich von der winterlichen Umgebung ab. Er stapfte entlang der festgetretenen Spuren durch den Schnee. An seinem Hals baumelte ein Kompass, an der Hüfte ein Beutel mit Fernglas und Digitalkamera. Die Antennenanlage, die man vor drei Monaten installiert hatte, verfügte über eine große Satellitenschüssel mit rund zehn Metern Durchmesser. Unmittelbar davor warteten acht Betonsockel darauf, mit kleineren Parabolantennen bestückt zu werden. Einmal fertiggestellt, würde es ein Prunkstück abgeben, dachte Schwinn. Etwas weiter links standen ältere Metall- und Drahtkonstrukte zum Abfangen von Hochfrequenz-Kommunikation. Schwinn griff zum Kompass. Abwechselnd fixierte er die Antenne und den Spiegel der Bussole. Nach einer Weile notierte er sich einen Zahlenwert.
Eine Stunde später war es bereits dunkel und Punkt sechs saß Schwinn mit fünf seiner Kameraden beim Abendessen.
»Kannst du dieses Ding nicht mal weglegen«, knurrte Tobias Meiendörfer mit halb vollem Mund und deutete mit dem Kinn auf den Laptop. Sie kannten sich von der ETH. Meiendörfer studierte dort Biochemie, als Schwinn bereits Assistent war.
Auf dem Bildschirm war eine rote Linie zu sehen, die sich in westöstlicher Richtung über den europäischen Kontinent legte.
»Nicht schlecht«, murmelte Schwinn und stellte den Teller mit Riz Casimir ab, den er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte. Die Linie zeigte die Ausrichtung der Antenne und zirkelte über die Städte München, Prag, Warschau, Minsk bis nach Moskau.
»Immer noch Kalter Krieg.« Schwinn schmunzelte und rief auf dem Computer einen Bericht ab, den der Nachrichtendienst in den Siebzigerjahren erstellt hatte. »Hier haben wir’s. Seit 1968 laufen die Dinger, das Schweizer Ohr hinter dem Eisernen Vorhang.«
»Soll ich den Flan …« Ein Küchengehilfe wollte das Dessert servieren. Irritiert sah er auf den halb vollen Teller neben dem Laptop. Als weiter nichts geschah, blickte er auf den Bildschirm, räusperte sich und fragte: »Und was bringt das jetzt, wenn man fragen darf?«
»Tauschgeschäfte«, sagte Schwinn trocken. Er sah den Mann aus der Küche an und überlegte, ob er sich die Mühe machen sollte, es ihm zu erklären. »Haben Sie als Kind auch Panini-Bildchen gesammelt, ich meine die Fußballstars, die man in ein Album kleben konnte?«
»Ja, sicher. Ich hab die Alben alle, auch die neuen.«
»Eben.« Schwinn grinste. Er hatte den Mann richtig eingeschätzt. »Und ein paar haben immer gefehlt, nicht wahr?«
»Genau! Maldini zum Beispiel … und Crespo auch. Dafür hatte ich fünf Mal Oliver Kahn. Also Maldini fehlt eigentlich immer noch. Vielleicht könnten wir ja …«
Schwinn unterbrach ihn, bevor der Soldat sein Anliegen ausformuliert hatte. »Haben Sie sich nie gefragt, ob Maldini nicht absichtlich in kleinerer Auflage gedruckt worden ist?«
Verständnislos sah ihn der Mann an.
»Man hat ein paar abgelauschte Gesprächsfetzen aus dem Ostblock und die tauscht man dann mit anderen Geheimdiensten. Bekommt eine Gegenleistung. Geben und Nehmen, das alte Prinzip.«
Die Küchenhilfe schien in Gedanken noch immer bei seinen Bildchen zu sein.
»Und am Schluss fehlt Maldini«, sagte Meiendörfer, der das Gespräch mitverfolgt hatte. Er drückte dem Mann mit der Schürze seinen leeren Teller in die Hand.
»Das war früher, während des Kalten Krieges, das große Spiel der Geheimdienste. Und heute …« Schwinn nahm den Teller mit dem Flan Caramel, trennte mit dem Löffel ein Stück ab und kostete. »Tja, Leute … heute ist es noch genauso. Nur der Vorhang, der ist weg – die ganze Welt wächst zusammen. Die Bösen sind nicht mehr so böse und die Guten weniger gut.« Schwinn zog den Laptop auf die Knie. »Und siehe da … sogar wir haben das gemerkt.« Er startete eine Computeranimation. Der Bildschirm zeigte eine Parabolantenne, die sich langsam um ihre eigene Achse drehte. »Die zielt auf einen Satelliten, der irgendwo über Ostafrika oder dem Indischen Ozean seine Bahnen zieht.« Schwinn aß das letzte Stückchen Flan. Auf dem dunkelblauen Hintergrund des Bildschirms formte sich aus kleinen Wolkenfetzen langsam der Name Onyx.
Jeder der Männer, außer dem Küchenpersonal, wusste, dass die eidgenössischen Räte für den Versuchsbetrieb von Onyx in den letzten fünf Jahren hundert Millionen Franken bewilligt hatten. In kleinen Tranchen oder versteckt in wenig durchsichtigen Finanzgeschäften.
Die Ausbeute der Lauschangriffe, ein gigantischer Wust an Daten, fand via Richtfunk- und Kabelverbindungen den Weg nach Zimmerwald. Dort befand sich das Herzstück des Systems: ein moderner Sicherheitsbau des Nachrichtendienstes, der äußerlich den Eindruck eines lottrigen Bauerngehöfts erweckte und etwas abseits am Waldrand stand. Von Heimenschwand aus konnte der Ort südöstlich von Bern mit dem Auto in einer knappen Stunde erreicht werden. Die Zentrale war an 365 Tagen im Jahr besetzt. Rund vierzig Personen, der größte Teil davon Datenbankspezialisten, werteten die Informationen aus. Der Fokus lag derzeit auf fünftausend Begriffen. Die Mehrheit der Bevölkerung kam im Alltag mit tausend Wörtern aus. Von den ausgewerteten Daten profitierte in erster Linie der Strategische Nachrichtendienst. Der Bundespolizei sowie anderen Polizeidienststellen im Inland stand das System grundsätzlich nicht zur Verfügung. So jedenfalls stand es als Folge des Fichenskandals1 Ende der Achtzigerjahre im neuen Bundesgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit.
Der Anruf aus Zimmerwald erreichte Konrad Schwinn am nächsten Tag, kurz nach halb neun abends. Eine Viertelstunde später saß er auf dem Beifahrersitz eines weißen VW Golf mit Berner Kennzeichen. Der zugeteilte Fahrer war ein bleicher Mann mit schütterem Haar. Er trug eine graue Flanellhose und einen dunklen Pullover.
»Brauchen wieder einmal unsere Hilfe dort, eh?«
»Denke schon«, murmelte Schwinn. Mehr wollte er nicht sagen. Der Mann, mit dem er auf einer abhörsicheren Punkt-Punkt-Verbindung telefoniert hatte, war Divisionär Kurt Heidegger, Zweisternegeneral der Schweizer Armee und Kommandant der Führungsunterstützung Basis, kurz FUB.
Schwinn hatte seine Einsätze beim Militär, die Rekrutenschule und später die Ausbildung zum Technischen Unteroffizier, nie so ganz ernst genommen. Auch die Wiederholungskurse, die er einmal im Jahr absolvierte, waren für ihn eine Art Ferienersatz; bezahlt vom Bund, eine willkommene Unterbrechung des Alltags an der ETH. Er mochte die weichen Hügelketten der Bernischen Voralpen. Sie eigneten sich für ausgedehnte Radtouren und Spaziergänge, bei denen er Sauerstoff tanken und sich in aller Ruhe dem einen oder anderen mathematischen Problem widmen konnte. Die knapp zweihundert Diensttage, die er auf dem Buckel hatte, waren mehr als genug, fand er. Und vermutlich spiegelten sie seinen Vorgesetzten etwas vor, was Schwinn gar nicht war: engagiert. Für den zweiunddreißigjährigen Technischen Unteroffizier waren die Einsätze, die er im Rahmen der Einheiten für Elektronische Kriegsführung leistete, nicht mehr als kleine Spielereien. Fürze im europäischen Wasserglas, und für das globale Sicherheitsdispositiv etwa so relevant wie Heimenschwand fürs vereinigte Europa.
Dass Kurt Heidegger die Dinge anders sah, schien logisch. Mit zweitausend Diensttagen hörte der Spaß auf. Und vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis aus einem Sandkasten eine Weltkugel wird.
Es war das erste Mal, dass man Schwinn gefragt hatte, ob er wirklich Arabisch könne. In Wort und Schrift. Und es war auch das erste Mal, dass ihn das beklemmende Gefühl beschlich, die Sache wäre ernst und die Armeeführung wüsste über seine Personalakte ganz genau Bescheid.
Die Heizung des Wagens lief auf Hochtouren. Schwinn schwitzte; er rieb seine feuchten Hände über Oberschenkel und Knie. Wie der Fahrer trug auch er zivile Kleidung: Jeans und Sweatshirt – darüber einen schwarzen Anorak. Es war eine der wenigen Vorsichtsmaßnahmen, die das Ganze vereinfachte und obendrein noch bequem war. Einen Moment überlegte er, ob er die Jacke mit dem Wollfutter ausziehen sollte.
Zimmerwald war noch nirgends zu sehen, als der Wagen auf eine Nebenstraße abbog und Richtung Wald holperte.
»Hoffentlich haben die geräumt«, murmelte der Fahrer und warf einen Blick auf die Temperaturanzeige. »Minus achtzehn Grad, da möchte ich keine Schneeketten montieren …«
Der Weg durch den Wald wäre auch mit Sommerreifen passierbar gewesen. Der Schnee war zur Seite gepflügt worden und die Menge an Sägespänen auf der Fahrbahn zeigte, dass man von den Fahrkünsten der Besucher nicht viel erwartet hatte. Auf dem kleinen Parkplatz, den man in den Schnee hineingefräst hatte, standen vier Wagen. Drei gehörten dem Militär. Man sah es an Farbe und Modell: weiß oder beige; Kadett oder Golf. Daneben stand ein dunkler Mercedes. Schwinn vermutete einen Regierungsbeamten aus dem Verteidigungsdepartement.
»Ich hätte Sie gern direkt vor die Zentrale gebracht«, sagte der Fahrer und stellte den Wagen zu den anderen. »Wollen halt kein Aufheben machen, um diese Zeit, sonst meinen die Leute im Dorf noch, der Krieg bricht aus.« Nachdem er den Motor abgestellt hatte, angelte er sich von der Sitzbank im Fond einen steifen Militärmantel und eine Gebirgsmütze. »Gehen wir.«
Fünfzehn Minuten lang folgten sie festgetretenen Spuren im Schnee.
4
»Du hättest Kurt Gloor sehen sollen, gestern«, maulte Christoph Burri.
»Hab ich doch!« Eschenbach zog zwei goldgelbe Scheiben aus dem Toaster. »Wie der mit seiner Frau umgeht … dieser Sozialapostel.«
»Sie lag dir zwischen den Beinen.«
»AUF den Beinen! Herrgott noch mal.«
»Ihr wart völlig betrunken!«
»Sein Glück. Sonst hätten wir vielleicht tatsächlich …«
»Eben.«
»DU hast mir gesagt, ich soll unter die Leute.«
»Aber doch nicht so …«
Die beiden Freunde standen frisch geduscht und in weißen Morgenmänteln in Burris modern eingerichteter Küche.
»Zuerst trinkst du mit der Frau meines prominentesten Gastes drei Flaschen Château Angelus und als Dank …« Burri drückte den Hebel der Orangenpresse, dass der Saft spritzte. »Als Dank ludert ihr dann auf meiner Couch rum. Und das vor allen Leuten!«
»Ich dachte, es wären vier gewesen.«
»Was vier?«
»Flaschen, meine ich.«
»Bist du dir überhaupt bewusst, was du angestellt hast … ich meine, die Konsequenzen davon?«
»Ich habe getrunken und geschlafen. In dieser Reihenfolge hat das selten Konsequenzen.«
»Ich meine Gloor.«
»Der wird sich wieder beruhigen.«
»Er ist immerhin Stadtrat.«
»Auch Stadträte beruhigen sich. Glaub mir, er wird sich keine Blöße geben. Gloor ist ein geschliffener Hund. Wie soll er denn in Zürich erfolgreich Sozialpolitik betreiben, wenn er nicht einmal seine eigene Familienpolitik im Griff hat?«
»Du bist ein linker Zyniker.«
»Nein, Christoph.« Der Kommissar biss in eine Scheibe Toast, die er dick mit Butter und Honig bestrichen hatte. »Ich bin ein rechter Optimist. Manchmal Realist und fast immer ein sentimentales Arschloch.«
Sie setzten sich an den großen Eichentisch am Fenster.
»Es hat wieder geschneit«, sagte Eschenbach mit vollem Mund. »Weiße Weihnachten … das hatten wir schon lange nicht mehr.«
Burri stocherte lustlos in einer Schale mit Birchermüsli. »Wer in deinem Alter noch sentimental ist, hat nichts dazugelernt.«
»Ich kann damit leben.«
»Du bist ein Ignorant.«
Der Kommissar studierte das Etikett auf dem Honigglas: »Miele del Ticino … Hast du immer noch diesen Imker aus Intragna?«
»Ja«, kam es mürrisch.
»Christoph, du bist eine Seele von Mensch …« Der Kommissar stand auf und streckte sich. »Dass du einen abgehalfterten Polizisten beherbergst … ehrlich, ich hätte den Heimweg nicht mehr gefunden.«
»Allerdings.«
»Wie ist eigentlich Denise … ich meine Frau Gloor?«
»Zu dritt haben wir sie ins Auto getragen.«
Eschenbach lachte, nahm sich zwei weitere Scheiben aus dem Toaster und setzte sich wieder.
»Ihr Mann kochte innerlich«, sagte Burri finster.
»Selber schuld.« Eschenbach begann gemütlich die Brotscheiben mit Butter und Honig zu bestreichen. »Man sollte seinem Groll Luft machen … sagst du doch immer.«
Burri schwieg.
»Aber als Politiker, da ist das nicht drin … Fressen alles in sich hinein. Keep smiling.«
»Das ist immer auch eine Frage des Anstands«, warf der Arzt ein.
»Eine Frage des Stils, würde ich sagen.« Eschenbach kaute zufrieden und schaute zum Fenster hinaus in den Garten. Auf einem Holzpflock stand ein Vogelhäuschen mit Strohdach. Eine Horde Spatzen stritt sich um das Futter. »Früher hätte man sich duelliert, auf der Sechseläutewiese bei Sonnenaufgang …« Der Kommissar hustete.
»Dann lägest du jetzt dort; mit einem Loch in der Brust.« Burri lächelte giftig.
»Unterschätz mich nicht, Christoph!«
»Du sagst ja selbst, Schießen liegt dir nicht … nur keine Waffen.«
»Meine Wahl ist das Florett!« Eschenbach zog das Honigmesser zwischen seinen Lippen hindurch. »Leicht, elegant und spitz … touchée!«
»Du lebst in der falschen Zeit, mein Lieber!« Burri unterdrückte ein Gähnen.
»Da hast du allerdings recht.«
Eine Weile saßen sie beide da und schwiegen. Leise dudelte das Küchenradio die letzten Takte eines Evergreens, dann folgten die Nachrichten. Es war elf. Eschenbach fragte sich, ob man den Vorfall bei Grieder erwähnen würde. Aber es kam nichts, außer Schnee: »In weiten Teilen der Schweiz schneit es über Weihnachten …«, hieß es am Ende der Wettervorhersage.
Burri stand auf und begann mit dem Abräumen.
»Woher kennst du diesen Gloor eigentlich?« Eschenbach ging zum Kühlschrank und verstaute Butter, Käse und Milch.
»Ich bin als Facharzt im parteilichen Komitee … wir arbeiten gelegentlich zusammen.«
»Du bist in der Politik?« Eschenbach inspizierte den Inhalt des Kühlschranks.
Burri winkte ab. »Es geht um medizinische Fragen, um fachliche Belange in Bereichen der Sozialhygiene …«
»Ein grässliches Wort: Sozialhygiene!«
»Zudem bin ich seit über zehn Jahren als Vertrauensarzt fürs Sozialdepartement tätig.«
»Das wusste ich nicht«, sagte Eschenbach.
»Ein Nebenjob eben …« Burri zögerte einen Moment. »Den Ärzten geht es heute längst nicht mehr so gut wie früher. Der ganze Spardruck … da lebst du auch als Arzt von Beziehungen.«
Eschenbach überlegte, von welchen Beziehungen er selbst lebte. Unweigerlich kamen ihm Corina und Kathrin in den Sinn, und die Tatsache, dass es diese Beziehung nicht mehr gab. »Hm«, sagte er.
Burri drückte auf den Knopf an der Spülmaschine. Beinahe geräuschlos begann sie mit ihrer Arbeit. »Brauchst du noch Kleider?«, fragte er.
»Ich nehme die von gestern.« Gedankenverloren starrte der Kommissar auf die Umrechnungstabelle für Diabetiker am Kühlschrank. »Ich wusste gar nicht, dass du Probleme mit dem Zucker hast.«
»Hab ich auch nicht, wieso?«
»Deswegen.« Mit dem Kinn deutete Eschenbach auf die Liste, auf der die wichtigsten Nahrungsmittel in Broteinheiten angegeben waren. »Ich kenn’s von meinem Vater, als er Altersdiabetes hatte.«
»Ja, die ist auch nicht für mich …« Einen Moment stockte Burri. Dann meinte er: »Meine Mutter war zuckerkrank. Und jedes Mal wenn sie hier übernachtete, musste ich ihr eine solche Tabelle besorgen.«
»Ach so.« Eschenbach wunderte sich. Er war selbst auf der Beerdigung von Helene Burri gewesen, vor fünf oder sechs Jahren. Christoph war nicht der Typ, der altes Zeugs lange aufbewahrte. Außerdem sah die Tabelle neu aus.
»Brauchst du jetzt was zum Anziehen oder nicht?«
»Nein, danke. Wirklich nicht. Ich habe deine Gastfreundschaft schon genug strapaziert.«
Eschenbach ging die Treppe hoch ins Gästezimmer und zog seine Sachen an. Das Hemd hatte dunkle Flecken. Es roch nach Rotwein und Schweiß, und ein wenig nach Denise Gloor.