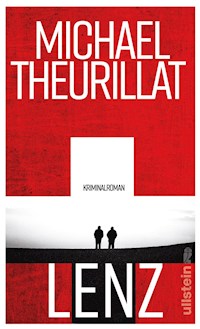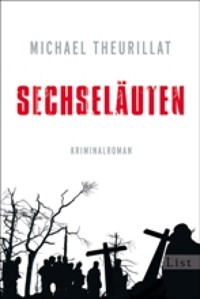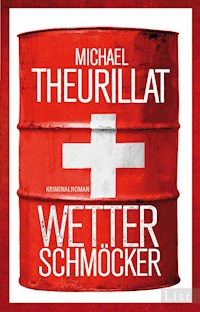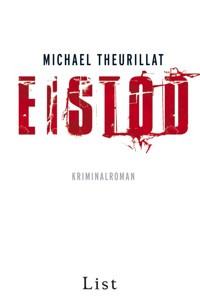13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mordfall auf einem Golfplatz bei Zürich hält Kommissar Eschenbach in drückender Sommerhitze auf Trab.Wer könnte ein Interesse am Tod von Philipp Bettlach haben? Der Banker war außerordentlich beliebt und hatte scheinbar keine Feinde. Bis die Vergangenheit ihn einholte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Als Philipp Bettlach auf einem Golfplatz bei Zürich aus einer Distanz von sechshundert Metern erschossen wird, kann sich diesen Mord niemand erklären. Bettlach, der jüngere Bruder eines einflußreichen Bankiers, war charmant, geistreich und verkehrte in den allerbesten Kreisen. Kommissar Eschenbach, gerade fünfzig geworden, übernimmt den Fall mit wenig Enthusiasmus, die piekfeine Gesellschaft interessiert ihn nicht. Er hat einen Mord am Hals, eine ungeduldige Chefin und Claudio Jagmetti, den unbedarften Praktikanten aus der Polizeischule. Das alles zur Sommerferienzeit, bei vierzig Grad im Schatten. Eschenbach und Jagmetti recherchieren in Schützenkreisen und beim Militär, stöbern in der Vergangenheit des Toten, spüren seine geschiedene Frau auf, die sich über Nacht davonmachte und nach Paris zog. Doch nichts ist, wie es scheint im Mordfall Bettlach: Im Zuge der Ermittlungen fördern die beiden unterschiedlichen Charaktere Eschenbach und Jagmetti ein beklemmendes Familiendrama zutage.
Der Autor
Michael Theurillat, geboren 1961 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte und arbeitete mehrere Jahre im Bankgeschäft. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Zürich; Im Sommer sterben ist sein erster Roman.
Von Michael Theurillat sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Eistod Sechseläuten
Michael Theurillat
Im Sommer sterben
Kriminalroman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.list-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 1. Auflage September 2006 6. Auflage 2010 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 / Claassen Verlag Umschlaggestaltung: RME – Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg (nach einer Vorlage von Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, München–Zürich) Titelabbildung: © Joachim Ellerbrock / Bilderberg Satz: Franzis print & media GmbH, München eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany eBook ISBN 978-3-8437-0188-4
Am schlimmsten:
Nicht im Sommer sterben,
wenn alles hell ist
und die Erde für Spaten leicht.
Gottfried Benn
1
Der Mann, der das Grün betrat und den kleinen weißen Ball aufhob, hatte in seinem Leben noch nie Golf gespielt.
Er trug eine randlose Brille und Handschuhe aus dünnem Latex, wie es sich für einen Polizeibeamten von der Spurensicherung gehörte. Es war das erste Mal, dass er einen Golfball in den Händen hielt. Nachdem er den Fundort mit einem spitzen Holzstück markiert hatte, steckte er den Ball in einen Plastikbeutel.
Es war der einzige Fund an diesem Nachmittag, abgesehen von dem Toten, der hundertfünfzig Meter weiter oben lag.
Der Anruf wegen des toten Golfers erreichte Kommissar Eschenbach kurz nach seiner Mittagspause. Er saß vor einem Berg Akten, den er schon seit Tagen unerledigt vor sich herschob; daneben stand ein Becher mit Espresso. Er hatte ihn vom neu eröffneten Starbucks Café mitgenommen.
»Einfach erschossen, am fünfzehnten Loch«, war die kurze Zusammenfassung von Elisabeth Kobler, der Polizeichefin des Kantons Zürich. »Fahren Sie hin, und schauen Sie sich den Tatort mal an. Ich bin gerade bei Regierungsrätin Sacher, wegen dieser Prügelei am Limmatplatz. Komme vielleicht später noch dazu.«
»Schon gut«, brummte er. »Ich kümmere mich darum.«
Der Espresso schmeckte scheußlich, zu süß, fand er, und der viel zu große Styroporbecher passte dazu wie die Faust aufs Auge.
»Und denken Sie dran, Eschenbach. Es sind alles piekfeine Leute dort. Nobler Club. Vielleicht binden Sie besser eine Krawatte um … und halten Sie es low key.«
»Selbstverständlich.«
»Also, bis später.«
»Bis später«, murmelte er und legte auf.
Low key! In den letzten Wochen war das der Lieblingsausdruck von Kobler gewesen. Seit die Presse wegen ein paar mutmaßlicher Verfehlungen der Polizei Dampf gegen seine Chefin machte, musste alles low key sein.
Es wird schwierig, einen erschossenen Golfer in einem Nobel-Golfclub am Zürichsee low key aussehen zu lassen, dachte er. Und überhaupt gingen ihm diese Anglizismen langsam auf den Geist.
Er öffnete seinen Schrank und nahm die orangefarbene Hermès-Krawatte heraus, die ihm seine Tochter letzten Monat zum Fünfzigsten geschenkt hatte. Er band sie um. »Nobler Club«, dachte er. Als das eine Ende zu lang geriet und über seinen Hosenbund reichte, löste er den Knoten und band sie erneut. Er sah in den Rasierspiegel in der Schranktür und fragte sich, ob ab fünfzig alles anders würde. Schlechter, älter oder grauer – oder alles zusammen.
Als er damals mit achtunddreißig die Leitung der Kripo übernommen hatte, war er der jüngste Chef in der Geschichte der Zürcher Kriminalpolizei gewesen. Inzwischen war sein dunkelbraunes Haar lichter geworden; zumindest in den Ecken, fand er. Dafür hatte er kaum graue. Umgekehrt wäre es ihm lieber gewesen. Eschenbach zog eine Grimasse – dann schloss er die Schranktür.
Seine Dienstwaffe würde er nicht brauchen; wenigstens das nicht. Dann fiel ihm ein, dass sie noch beim Büchsenmacher war, und er gelegentlich dort anrufen sollte. Er hasste das Ding, er überlegte lieber, als dass er schoss. Vielleicht auch deshalb, weil er das eine besser beherrschte als das andere.
Er nahm sein Jackett vom Stuhl, streifte es im Gehen über und verließ sein Büro. Im Gang begegnete er Claudio Jagmetti, dem Praktikanten aus der Polizeischule, der ihm für den Sommer zugeteilt worden war. Er wies ihn an, den korrigierten Bericht auf seinem Schreibtisch neu zu verfassen. Dann ging er die Treppe hinunter in die Tiefgarage und stieg in sein Auto.
Eschenbach fuhr über das Bellevue in Richtung Bürkliplatz. Links lag das Seebecken. Die weißen Segel der Boote reflektierten das Sonnenlicht, und im Hintergrund protzten die Alpen mit ewigem Schnee. Zusammen mit dem tiefblauen Sommerhimmel eine Komposition in Blau und Weiß. Blau-weiß, die Farben von Zürich, dachte er.
Es war Anfang Juli, und schon seit Wochen herrschten Temperaturen wie sonst nur südlich der Alpen. Er lockerte seine Krawatte und nahm sie kurz darauf ganz ab. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. An der nächsten Ampel drehte er sich nach hinten und suchte im Jackett auf der Rückbank seine Brissagos. Eschenbach liebte diese knorrigen Zigarillos aus dem Tessin. Sie halfen ihm beim Denken. Er zündete eine an und dachte an Corina. Sie war mit Kathrin ins Engadin gefahren, in die Wohnung der Schwiegereltern – drei Tage früher als geplant, weil man die Sommerferien vorverlegt und die Schule frühzeitig geschlossen hatte. Und das alles wegen läppischer achtunddreißig Grad im Schatten. Weicheier, allesamt.
Er hatte versprochen, übers Wochenende hochzufahren und sie zu besuchen.
Es war kaum Verkehr auf der Seestraße. Eschenbach kam gut voran und erreichte die Einfahrt zum Golfplatz in zwanzig Minuten.
Platanen säumten den gepflegten Kiesweg, der hinauf zum Clubhaus führte. Eschenbach parkte seinen Volvo neben zwei dunkelblauen Nobelkarossen, stieg aus und bemerkte, dass sein hellblaues Hemd am Körper klebte und völlig durchgeschwitzt war.
Schräg gegenüber bauten zwei ältere Damen in crème-weißen Karos ihre Caddywagen zusammen. Burberry-Look. Er kannte die Marke. Seine Tochter hatte auch eine solche Bluse, auf die sie mächtig stolz war. Ein Geschenk von Corina. Karos sind mega, hatte man ihn aufgeklärt, total krass. Eschenbach fand das Muster lächerlich, irgendwie spießig und erinnerte sich schwach, dass seine Großmutter dieselben Karos auch schon getragen hatte.
Mit der Hand wischte er die Asche weg, die ihm auf seine sandfarbene Hose gefallen war. Die Damen in Karo musterten ihn argwöhnisch. Er grüßte freundlich und schritt – unbeeindruckt von der Arroganz, die ihm hier bereits auf dem Kiesplatz entgegenschlug – die Treppen hoch zum Clubhaus. Die halb gerauchte Brissago steckte er in den Messingbehälter neben dem Eingang.
»Sind Sie Mitglied?«, säuselte die Dame hinter der Rezeption.
»Eschenbach …« Und mit gedämpfter Stimme: »Kripo Zürich.«
Die junge Dame wich erschrocken zurück, fasste sich aber sofort wieder. Eschenbach beugte sich über die glatt lackierte Theke und flüsterte weiter: »Ich komme wegen des toten Golfers.«
»Ja, ich weiß.« Aus dem nasalen Säuseln war ein verschwörerisches Wispern geworden. »Einfach schrecklich. Ich rufe Herrn Aebischer. Das ist unser Clubmanager.«
»Danke, ich warte draußen.«
Eschenbach nahm die kalte Brissago wieder aus dem Messingbehälter, zündete sie erneut an und trat in die Sonne.
Obwohl es hochsommerlich warm war, fröstelte er. War es der Anflug einer Sommergrippe? Oder nur ein Unbehagen, das in ihm aufstieg? Die Golfbags, die vor dem Clubhaus standen, sahen aus wie stille Wachhunde.
Er wartete.
Die Hecken waren fein säuberlich drapiert, und die Wege so exakt in die Landschaft gesetzt, als hätte ihnen ein Geometer den Marsch geblasen. Die Wiese war ein Rasen in eintönigem Grün. Man hatte einen zottigen Bären auf Pudel getrimmt; so jedenfalls kam es Eschenbach vor.
Er zog an seinem Zigarillo.
»Herr Kommissar?« Ein dürrer Herr in blauem Blazer kam in hastigen, kleinen Schritten auf Eschenbach zu. Er stellte sich als der zuständige Manager der Golfanlage vor. In komplizierten Sätzen schilderte er, was sich ereignet hatte. Dass irgendwo da draußen, zwischen zwei Löchern, ein Toter lag, war das Einzige, was sich Eschenbach merken konnte.
Wilde Vermutungen über Querschläger, Militär, Jungschützen und dergleichen mischten sich mit Befürchtungen über mögliche Imageschäden, die nun dem Club, ja dem Golfsport weltweit bevorstünden.
Eschenbach langweilten die Ausführungen. Er sehnte sich nach einem kühlen Bier.
»Gibt es hier vielleicht etwas zu trinken?«
Der Dürre im Blazer, der in seinem Redeschwall unterbrochen wurde, schaute ihn an, als hätte man ihn gerade geohrfeigt.
»Ich hole Ihnen ein Wasser, und dann fahren wir zu Loch 15, zum Toten. Ihre Kollegen arbeiten schon über eine Stunde und rekonstruieren den Fall.«
Der letzte Satz hatte etwas Vorwurfsvolles.
Als Eschenbach seine Ermittlungen auf dem Golfplatz abschloss, war es kurz vor halb zehn. Er fühlte sich ausgelaugt und müde.
Seine Leute hatten die Zufahrt zum Golfplatz gerade noch rechtzeitig abgesperrt, um den Kleinbus von Tele Zürich aufzuhalten, der mit zwei Filmteams angereist war. Die Leute von der Presse reagierten sauer, was er verstehen konnte. Die Autos der Clubmitglieder, die sich durch das Chaos den Heimweg suchten, wurden aufgehalten, Kameras surrten vor getönten Fensterscheiben.
»Wenn Sie nicht Platz machen, fahr ich Sie über den Haufen!«, fauchte ein älterer Herr mit hochrotem Kopf und Stirnglatze durch das spaltbreit geöffnete Fahrerfenster seines Jaguars. Weiter hinten ertönte die Hupe eines Mercedes der S-Klasse.
Einzig die Kühe weideten friedlich hinter dem Elektrozaun und ließen sich durch das Spektakel nicht aus der Ruhe bringen.
Auf der Terrasse des Clubrestaurants, die einen herrlichen Blick auf den Zürichsee und die Glarner Alpen bot, herrschte noch immer reger Betrieb. Eschenbach setzte sich an einen freien Tisch und bestellte ein Bier.
Einige der Gäste musterten ihn verstohlen. Andere wiederum grüßten freundlich oder winkten ihm sogar zu. Man hatte sie über den Vorfall befragt und ihre Namen aufgenommen. Irgendwie schienen sie erleichtert zu sein, dass alles vorbei war.
Die Sensationslust, die in solchen Fällen oft ungehemmt zutage trat und die Polizeiermittlungen erschwerte, war hier diskret unter dem Deckmantel scheinbar nobler Gleichgültigkeit versteckt.
An den Tischen wurde leise getuschelt. Man prophezeite dem Golfsport den Untergang und mutmaßte über Täterschaft und mögliche Motive. Die Clubleitung offerierte fein gekochte Häppchen und Champagner, der in filigranen Gläsern serviert wurde. Es schien, als wolle man für den entstandenen Schaden aufkommen und das Wohlbefinden der Gäste zurückerobern.
Eschenbach fühlte sich fremd. Die Menschen, die hierhin zum Golfspielen kamen, waren in seinen Augen Flüchtlinge. Flüchtlinge aus unterschiedlichsten Ländern und Provenienzen. Die Länder hießen Langeweile, Stress oder Depression. Unglücklichsein. Überlastung. Humorlosigkeit. Lieblosigkeit. Blutarmut. Blutzucker. Herzenskälte. Herzinfarkt. Es gab viele Länder, aus denen es sich zu flüchten lohnte. Länder einer mehr oder weniger traurigen Welt, in der es von Äußerlichkeiten zu viel und von Innerlichkeiten zu wenig gab.
Warum hatte man Philipp Bettlach erschossen? Eschenbach starrte auf den See und wünschte, die Sache wäre vorbei. Ausgestanden. Zu Ende, wie der Tag, der gerade zu Ende ging. Aber er wusste, in Wirklichkeit fing es erst richtig an. Die Befragungen auf dem Präsidium, die Presse und die Lügen jener, die sich zur Tat bekannten, obwohl sie nicht im Geringsten dafür in Frage kamen.
Er bezahlte sein Bier und sah, während er dem Kiesweg folgte und zurück zum Auto ging, gedankenverloren auf den See hinunter. Es würde eine klare Sommernacht geben.
Die heimkehrenden Schiffe waren mit ihren Positionslichtern gut auszumachen. Rot für Backbord, grün für Steuerbord. Eschenbach kannte sich aus. Ab und an, wenn es seine Arbeit erlaubte, fuhr er mit einem kleinen Fischerboot, das ihm ein Freund überließ, auf den See hinaus. Mehr zum Nichtstun als zum Angeln. Das Hantieren mit Nylonschnüren war ihm zu umständlich und der Gebrauch von Köderutensilien wie Blinker, Löffel, Fliegen und dergleichen ein Buch mit sieben Siegeln. Zeitunglesen und Baden – mehr brauchte er nicht. Manchmal lag er einfach nur auf Deck, ließ sich von den Wellen wiegen und sah in den Himmel, wo sich die Wolken jagten.
Auf der Rückfahrt nach Zürich gingen ihm die letzten Stunden auf dem Golfplatz durch den Kopf. Der tote Golfer. Gemäß den Angaben der Clubleitung sechsundfünfzig Jahre alt, Vizedirektor einer Schweizer Bank und bei allen sehr beliebt. Glücklich, geschieden, keine Kinder, keine Feinde. Warum erschießt man solche Leute, fragte er sich. Und warum gerade so?
Der Schuss musste aus einer erheblichen Entfernung abgegeben worden sein, sonst hätte man schon etwas gefunden. Möglicherweise mit einem Spezialgewehr, ausgelegt für große Distanzen.
Die Leute von der Spurensicherung würden ihre Suche am nächsten Morgen bei besseren Lichtverhältnissen wieder aufnehmen müssen. Und wenn bis zu den Alpen hin jeder Grashalm umgedreht werden müsste …
Eschenbach kam ins Grübeln. Die schier endlosen Hügelketten rund um den Golfplatz – ein gigantischer Heuhaufen, und nicht eine einzige Nadel.
Er zog mutlos an seiner Brissago und blies den Rauch in kurzen Stößen durch das geöffnete Fenster in die laue Sommernacht hinaus.
Wenn er in puncto Entfernung des Schützen kaum einen Anhaltspunkt hatte, so musste es doch gelingen, wenigstens in puncto Richtung präziser zu sein. Er musste herausfinden, in welchem Einschusswinkel die Kugel den Kopf durchschlagen hatte. Mehr noch, er musste herausfinden, wie der Golfer gestanden hatte, als die Kugel ihn traf. Wie war die Kopfstellung, die Ausrichtung des Körpers? Zu kompliziert, dachte Eschenbach. Alles unmöglich zu rekonstruieren. Aber genau das musste er herausfinden.
2
Als Eschenbach am nächsten Morgen um halb acht in Richtung Bahnhofstraße ging, war es schon sommerlich warm. Sein Jackett, das er gar nicht erst angezogen hatte, hängte er sich locker über die rechte Schulter.
Die Krisensitzung, von der er gerade kam, gab ihm für den Rest des Tages ein gutes Gefühl. Alles lief jetzt auf Hochtouren. Er kannte die Hektik, die typischerweise nach einem Mord ausbrach. Es war wie ein elektromagnetisches Knistern, das den trägen Polizeiapparat auflud und zum Leuchten brachte.
Mit der hellgrauen Hose, dem frischen hellblauen Hemd, das er ohne Krawatte trug, und der Sonnenbrille sah er aus wie ein italienischer Tourist und nicht wie der Leiter der Mordkommission.
Vielleicht lag es aber einfach nur an der Stadt, in der er arbeitete. In Florenz oder Rom wäre er als Kommissar, vielleicht sogar als Bankdirektor durchgegangen. Hier in Zürich, in der Metropole des Geldes, trugen Bankiers auch im Sommer dunkle Anzüge. Sie taten es mehr aus Überzeugung denn aus Eitelkeit.
Die Kaffeebar in der St. Anna-Straße hatte die Stühle und Tische bereits ins Freie gestellt. Eschenbach setzte sich, streckte die Beine aus und bestellte einen Espresso.
Eine knappe Stunde später, als der Kommissar die Stufen zum Präsidium emporschritt, hatte er sich bereits ein Bild gemacht von dem, was auf ihn zukommen würde.
Von den Beamten am Eingang wurde er freundlich gegrüßt; sie standen mit ausgebreiteten Armen da und versuchten die Kamerateams, Fotografen und Journalisten im Zaum zu halten. Es blitzte und hagelte Fragen. Eschenbach quittierte mit ernster Miene. »Pressekonferenz ist um halb zehn«, rief er. Dann verschwand er im Innern des Präsidiums.
Im dritten Stock herrschte ein heilloses Durcheinander. Auf sämtlichen Leitungen kamen Telefonate herein, Beamte liefen in ungewohnter Eile durch das mit Stellwänden unterteilte Großraumbüro. Eine Skizze des Tatorts hing an einer großen Pinnwand, überall Pappbecher, aus denen Kaffee getrunken wurde.
Mitten in diesem Chaos stand Rosa Mazzoleni. Sie hatte wache, dunkle Augen, eine kräftige Statur und war schon seit über zehn Jahren Eschenbachs Sekretärin. Eine Lesebrille baumelte an einer Goldkette um ihren Hals, und ihr kurzes, schwarzes Haar glänzte. Rosa genoss diese Hektik; es erinnerte sie an ihre Heimatstadt Neapel – an den Straßenverkehr dort und an die Art, wie man südlich der Alpen Geschäfte erledigte.
Als der Kommissar in den dritten Stock kam, machte seine Sekretärin erst gar keine Anstalten, ihn zu begrüßen. Sie zog eine Grimasse, schüttelte ihre rechte Hand, als hätte sie gerade ein viel zu scharfes Gericht gekostet, und deutete mit dem Zeigefinger in Richtung seines Büros. »Sie ist bei Ihnen … ist einfach reingegangen. Jetzt telefoniert sie schon seit einer halben Stunde.«
Durch den Spalt seiner angelehnten Bürotür vernahm Eschenbach die Stimme von Elisabeth Kobler.
»Sie verstehen doch, dass wir so kurz nach der Tat noch keine Aussage über den möglichen Täter machen können.«
Stille.
»Nein, haben wir nicht. Um halb zehn Uhr ist Pressekonferenz. Fertig jetzt«, war der harsche Schlusskommentar seiner Chefin.
Eschenbach öffnete die Tür zu seinem Büro. Sofort nahm Kobler ihre Füße vom Pult und wollte sie wieder in ihre dunkelbraunen College-Schuhe stecken.
»Sie können Ihre Schuhe das nächste Mal ruhig anlassen«, sagte er und grinste.
»Diese informationsgeilen Pressefuzzis!« Kobler war gereizt. »Was soll das, Eschenbach? Sie können mich hier doch nicht hängen lassen. Seit halb acht läutet es Sturm. Ich habe noch keinen Bericht gesehen … und Sie kommen erst jetzt?«
»Eigentlich gibt es noch keine Resultate. Erschossen, möglicherweise mit einem Langdistanzgewehr. Entweder so ein irrer Sniper oder ein Profi.«
»Wie der in Washington, D. C., der dreizehn Personen erschoss? Sie meinen, wir haben auch so einen?«
»Bis jetzt haben wir nur einen Toten. Ich gehe im Moment davon aus, dass es dabei bleibt.«
»Und jetzt, was tun wir?«, fragte Elisabeth Kobler, sichtlich erleichtert, dass keine wichtigen Erkenntnisse vorlagen, von denen sie nichts wusste.
»Dr. Salvisberg schaut sich die Leiche an. Ich denke, dass wir bis heute Mittag mehr wissen. Dann möchte ich mit ihm und einem Golfpro eine Tatnachstellung machen.«
»Mit einem Golf-was?« Kobler hob die Augenbrauen.
»Mit einem Professional … einem Golflehrer.«
»Ich spiele kein Golf.« Sie stand auf.
»Ich auch nicht«, sagte er und reichte seiner Chefin das Jackett, das sie auf einen der Stühle gelegt hatte.
Sie gingen wortlos durch den Korridor und die Treppe hinunter, wo im großen Besprechungszimmer eine hungrige Schar von Medienleuten wartete.
Die Konferenz lief besser als erwartet.
Kobler hielt sich zurück und überließ die Ausführung Eschenbach, der es verstand, mit seiner behäbigen Art aus einem Elefanten eine Mücke zu machen.
»Eine letzte Frage noch, dann ist Schluss für heute«, sagte er und zog einen Zigarillo aus der Jacke. Seit dem 1. Januar herrschte im ganzen Präsidium Rauchverbot; es war klar, dass er rauswollte.
»Rechnen Sie damit, dass der Täter nochmals zuschlägt?« Die Frage kam von einer jungen Journalistin, die für das Zürcher Tagblatt schrieb. Sie schien neu zu sein, denn Eschenbach hatte sie noch nie gesehen.
»Wir gehen im Moment nicht davon aus, obwohl man das natürlich nie mit Sicherheit wissen kann.«
Es kamen noch zwei Fragen, die in dieselbe Richtung zielten, dann winkte Eschenbach ab. Er sah zu Elisabeth Kobler, beide nickten einander zu; das vereinbarte Zeichen. Sie übernahm, dankte und beendete die Medienkonferenz.
»Sie hätten Löwenbändiger werden sollen«, sagte Kobler, als sie draußen im Flur standen. Sie schien sichtlich erleichtert und wieder bei Laune zu sein. »Befürchten Sie wirklich, dass er noch mal schießt?«
»Habe ich das gesagt?«
»Nein, aber gedacht!«, fügte sie leise hinzu und legte ihre Hand auf Eschenbachs Schulter.
»Jetzt hoffe ich nur, dass außer Ihnen niemand mehr meine Gedanken lesen kann. Sonst haben wir einen Serienkiller, bevor nur das Geringste vorliegt.«
»Good luck«, sagte sie noch auf dem Weg zum Ausgang. Dann verließ die Polizeichefin das Gebäude durch die Drehtür.
Eschenbach stieg die Treppe hinauf in den dritten Stock. Rosa Mazzoleni war in ihren Computer so vertieft, dass sie gar nicht merkte, wie er an ihr vorbeihuschte.
Er trat ins Büro, schloss die Tür hinter sich und zündete die Brissago an, die er die ganze Zeit in den Händen gehalten hatte.
Rauchen in Einzelbüros war weder verboten noch erlaubt. Die Regelung dieser Frage ließ auf sich warten. Da zwei Exekutivmitglieder der Regierung starke Raucher waren, war vorerst nichts zu befürchten.
Eschenbach öffnete einen Fensterflügel und blies den Rauch nachdenklich in die schwülwarme Sommerluft. Er durfte keine Zeit verlieren. Auch wenn es ihm zutiefst widerstrebte, jetzt, da die Sonne richtig zu brennen begann; er musste wieder raus auf den Golfplatz.
Er bat Rosa Mazzoleni, in der Gerichtspathologie anzurufen und ihn mit Dr. Salvisberg zu verbinden. Eschenbach zweifelte daran, dass sie ihn erreichen würde. Um diese Zeit war er selten da. Nebenbei hielt er Vorlesungen in forensischer Medizin an der Universität Zürich, korrigierte die Seminararbeiten seiner Studenten oder schrieb Gutachten für das Tropeninstitut, die Pharmaindustrie und für weiß Gott wen noch alles. »Wenn Sie nur Tote um sich herum haben, dann müssen sie etwas tun, um am Leben zu bleiben«, hatte Dr. Salvisberg ihm einmal gesagt.
Rosa Mazzoleni erreichte den Gerichtspathologen sofort und stellte ihn durch.
»Dr. Salvisberg, hier Eschenbach, störe ich?«
»Sie stören nie, im Gegenteil. Ist ja ein dicker Hund, den Sie mir da ins Eisfach gelegt haben.« Er kicherte heiser.
»Spielen Sie Golf?«, wollte der Kommissar wissen.
»Um Gottes willen! Woher die Kraft nehmen, Eschenbach! Ich schneide den ganzen Tag an Leichen herum; und dann der ganze Stress mit diesen Studenten.« Salvisberg seufzte. »Als Dozent werde ich jetzt von meinen Schülern bewertet … stellen Sie sich das vor!«
Eschenbach musste lachen.
»Das ist jetzt der neueste Furz von der Direktion«, fuhr er fort. »Die haben die Diarrhö im Hirn, sage ich Ihnen …« Er wetterte über die Bildungspolitik, die schweizerische und die europäische; schimpfte über die Inkompetenz der Universitätsverwaltung. »Dort hat es mehr tote Hirnmasse als bei mir in der Pathologie.« Dann rundete er das Bild ab mit seiner Version von einer grassierenden, globalen Demenz. Und als handelte es sich um den rettenden Strohhalm, fügte er noch hinzu: »Zum Glück habe ich noch die Gutachten. Die zahlen wenigstens ordentlich.«
»Dann ist ja alles nur halb so schlimm«, witzelte Eschenbach.
»Was heißt hier schlimm … es ist grauenhaft.« Und nach einer kurzen Pause: »Wie sind wir überhaupt darauf gekommen?«
»Golf«, entgegnete Eschenbach.
»Als Stichwort für globale Demenz?« Salvisberg lachte lauthals. »Also, ich gönne mir in meiner Freizeit etwas Besseres.«
»Was ist denn besser als Golf?«, fragte Eschenbach.
»Fischen!«
»Ah, Sie fischen.« Für Eschenbach war alles interessanter als Golf. Aber auf »Fischen« wäre er nie gekommen.
»Jawohl. Fliegenfischen«, erwiderte Salvisberg, der die Irritation seines Gesprächspartners bemerkte. »Kommen Sie doch mal mit. Ich fische schon seit Jahren an der Sihl. Dort ist es schattig und ruhig. Keine Menschenseele.«
»Wie bei Ihnen in der Pathologie. Da ist auch keine Menschenseele mehr.«
Salvisberg kicherte erneut. »Genau. Und keiner reklamiert die schlechte Behandlung.«
»Jetzt mal im Ernst, Salvisberg. Kann man Rückschlüsse darüber ziehen, in welchem Einschusswinkel die Kugel eindrang?«
»So ungefähr kann ich Ihnen das schon zeigen. Nur nicht am Kopf des Toten. Da ist nämlich nicht mehr viel ganz.«
»Verstehe.« Eschenbach verzog den Mund. »Anhand einer Puppe könnte man es aber rekonstruieren?«
»Klar. Kommen Sie vorbei. Am besten bringen Sie gleich ein Modell mit …«
»Sie lachen. Aber genau das habe ich vor. Allerdings kann ich nicht selbst kommen. Claudio Jagmetti, mein Assistent, wird das übernehmen.«
»Ich freue mich.«
»Und bitte, Salvisberg. Verschonen Sie den Jungen. Er kommt frisch von der Polizeischule, und ich wäre froh, wenn er dabeibleibt. Es gibt genug traumatisierte Polizisten.«
»Klar. Ich faxe Ihnen noch den Bericht. Bis bald … und kommen Sie doch einmal fischen. Ich würde mich freuen.«
»Vielleicht … bis bald.«
Eschenbach legte auf und drückte den Knopf der Gegensprechanlage, die ihn mit Frau Mazzoleni verband.
»Schicken Sie mir Jagmetti, wenn Sie ihn finden.«
»Mache ich«, tönte es scherbelnd durch den Lautsprecher. »Wie war es mit der Kobler, Chef?«
»Recht anständig. Ich glaube, sie hat sich gefangen.«
»War ja auch fies, was die Medien in den letzten Monaten über sie geschrieben haben«, scherbelte es weiter.
Eschenbach ließ es dabei bewenden. Er nahm die Unterschriftenmappe, schaute sie kurz durch und zeichnete sie an den entsprechenden Stellen ab. Dann stand er auf, nahm sein Jackett und verließ das Zimmer.
Als Eschenbach den Korridor entlang in Richtung Treppe ging, kam ihm Claudio Jagmetti entgegen.
»Sorry, Chef. War noch beim Zahnarzt.«
»Oh, Sie habe ich völlig vergessen«, sagte der Kommissar. »Kommen Sie mit … und hören Sie um Gottes willen auf mit dem dämlichen Chef.«
Sie gingen wortlos nebeneinander her zum Ausgang. Als sie durch die Drehtür das klimatisierte Präsidium verließen, schlug ihnen die sommerliche Hitze entgegen.
Das Café schräg gegenüber hatte bereits die ersten Mittagsgäste, die es sich im Garten zwischen den Terrakotta-Töpfen gemütlich machten.
Die beiden Polizisten überquerten die Straße und fanden an einem der kleinen grünen Bistrotische Platz. Eschenbach erklärte, dass er den Mord am Golfer nachmittags auf dem Golfplatz nachstellen wolle. »Dazu brauchen wir eine lebensgroße Schaufensterpuppe mit beweglichem Kopf.«
Jagmetti musterte den Kommissar ungläubig.
»Besorgen Sie sich eine Puppe, am besten in einem Kaufhaus, und dann gehen Sie damit zu Salvisberg in die Gerichtsmedizin. Die wissen Bescheid dort, dass Sie kommen.«
»Mache ich«, sagte der junge Polizeischüler, nachdem er alles fein säuberlich auf einem kleinen karierten Block notiert hatte.
»Danach fahren Sie auf den Golfplatz … Golfclub Zürichsee, und organisieren einen Golfpro.«
Jagmetti nickte.
»Wissen Sie, was das ist: ein Golfpro?«, fragte Eschenbach.
»Ein Professional, nehme ich an. Einer, der weiß, wie man Golf spielt«, antwortete Jagmetti, als verstünde er die Frage nicht.
»Genau, ein Golflehrer«, präzisierte der Kommissar. »Der soll uns ab fünfzehn Uhr zur Verfügung stehen.«
»Okay, wird gemacht«, sagte Jagmetti, stolz, dass er als Praktikant in einen so wichtigen Fall eingebunden wurde.
Eschenbach legte das Geld für die Getränke auf den Tisch. Sie standen auf, verließen das Café in Richtung Bahnhofstraße und trennten sich.
Der Kommissar war gespannt, was der junge Mann mit dem doch vage formulierten Auftrag anfangen würde. Beim Gehen kamen ihm Zweifel, ob er sich verständlich genug ausgedrückt hatte. Dass der junge Polizist weder nachgefragt noch Bedenken geäußert hatte, überraschte ihn. Es stand nicht im Einklang mit den Erfahrungen, die er mit Praktikanten in der Vergangenheit gemacht hatte.
3
Die Büros der Zürcher Handelsbank lagen am Rennweg, in einer der schönsten Straßen Zürichs. Der Eingang war links und rechts von Sandsteinsäulen flankiert, eine solide Glastür bot Einblick in die Kundenhalle.
Statt eines Türknaufs fand sich ein bronzener Löwenkopf. In die Höhle des Löwen, dachte Eschenbach, als er den Bronzekopf umfassen und eintreten wollte. Doch die Tür öffnete sich wie von Geisterhand, und ein angenehm kühler Luftstrom empfing ihn.
Der dunkelbraune Holzboden aus geölter Eiche und das weiche Licht, das von den weißen Wänden sanft gespiegelt wurde, gaben dem Raum eine schlichte Eleganz.
Rechts von ihm stand eine fast zwei Meter große Giacometti-Statue auf einem Sockel. Trotz der schlanken Silhouette schien die Bronzeplastik den ganzen Raum zu durchdringen.
Eine mollige blonde Dame, ein lieblicher Kontrast zu Giacomettis Kunstfigur, saß hinter einem Empfangstisch und lächelte.
Das metallene Klicken hinter Eschenbachs Rücken ließ ihn zusammenzucken. Reflexartig drehte er sich um. Er entspannte sich wieder, als er sah, dass es nur die Tür war, die, so geheimnisvoll wie sie sich geöffnet hatte, wieder ins Schloss gefallen war.
»Darf ich Ihnen helfen, Herr …«
Eschenbach drehte sich wieder und ging auf die Dame zu, die immer noch lächelte.
»Eschenbach, Kripo Zürich«, sagte er und zeigte seinen Ausweis. »Dr. Bettlach erwartet mich.«
»Aha.« Sie nahm den Telefonhörer in die Hand und wählte eine interne Nummer. Dann sprach sie kurz mit jemandem am anderen Ende der Leitung und legte wieder auf.
»Kommen Sie mit, Herr Kommissar.« Sie stand auf, begleitete ihn die paar Schritte bis zum Aufzug und hielt eine Magnetkarte vor ein kleines Plexiglasschild. Dann drückte sie den Knopf für die oberste Etage.
Dr. Johannes Bettlach war ein großer hagerer Mann. Sein graues Haar, das er streng nach hinten gekämmt trug, glänzte durch den einfallenden Sonnenschein fast weiß und war länger, als man es bei einem Bankdirektor vermutet hätte. Unter einer mächtigen Stirn saßen, in dunklen Höhlen verborgen, auffallend helle Augen. Seine Gesichtszüge waren streng, aber nicht unfreundlich.
Langsam schritt er durch das Zimmer auf Eschenbach zu.
An den Wänden hing zeitgenössische Kunst im Großformat, hinter dem Schreibtisch zog sich ein übervolles Bücherregal bis unter die Stuckdecke. Die Bücher, der dunkle Holzboden, der Buddha, der – auf einer Zigarrenschachtel thronend – vorübergehend einen Stapel Bücher zu stützen hatte, die Balletttänzerin in Bronze, die in scheinbar schwereloser Pose neben dem Telefonapparat schwebte, entsprachen allesamt nicht dem Bild, das Eschenbach vom Innenleben einer Schweizer Bank hatte.
Der Kommissar kannte die Kreditinstitute, die entlang der Bahnhofstraße residierten; die Marmorhallen mit Absperrungen aus kugelsicherem Glas, und auch die hochflorigen Teppiche in Grau oder Anthrazit, die in den oberen Direktionsetagen dieser Häuser den Boden bildeten für diskrete, distinguierte Lässigkeit. Sie waren ihm bekannt von einigen seiner früheren Ermittlungen. Aber das hier war anders.
Dr. Bettlach nahm mit beiden Händen seine Hand und umschloss sie mit einem leichten Druck. Es waren warme Hände, und trotz der unmittelbaren Intimität der Geste und der Fremdheit des Menschen, der ihn berührte, war sie ihm keineswegs unangenehm.
Er dachte daran, wie er als junger Leutnant der Schweizer Armee brevetiert wurde. Wie ihm sein Schulkommandant, Oberst Nydegger, im Mittelschiff der Kathedrale von Nancy feierlich die Hand gedrückt, ihm tief in die Augen geschaut und gesagt hatte: »Maintenant vous êtes officier de l’armée suisse. Le motto que je vous donne pour votre vie, vie militaire et vie privée, est: Esprit, Ecoute et Elan.«
Es war ein feierlicher Moment gewesen, ein Moment, der für eine lange Zeit in ihm weitergelebt hatte.
Auch le motto, wie die drei »E« in der Offiziersschule genannt wurden, war mit dem Händedruck des Obersten, wie ein Funken gutbürgerlicher Moral, auf die Wertvorstellungen des jungen Offiziers übergegangen. Und jetzt, in dieser merkwürdigen Situation, im Büro dieses Dr. Bettlach, kamen sie ihm wieder in den Sinn.
Eine kurze Weile standen die Männer da. Keiner sagte etwas, bis Dr. Bettlachs leise, zurückhaltende Stimme die Stille brach.
»Wollen wir uns setzen?«
Eschenbach steuerte auf den Ledersessel hin, den Dr. Bettlach ihm zuwies, setzte sich und spürte, wie ihn in dem Moment, als ihn das schwarze Leder aufnahm, eine tiefe Mattheit durchströmte. Er schloss für einen kurzen Moment die Augen. Dann öffnete er sie wieder. »Ich konnte Sie gestern nicht mehr erreichen. Es ist … ich wollte es Ihnen persönlich mitteilen.«
»Erschossen … auf dem Golfplatz.« Dr. Bettlach sah Eschenbach mit seinen hellen Augen an. Dann schweifte sein Blick zum Fenster und hinaus und verlor sich irgendwo zwischen den gegenüberliegenden Hausdächern und Schornsteinen.
Selbst die schmucken Geranien, die in Kästen aus grauem Schiefer an den schmiedeeisernen Gittern der Balkone hingen und in deren zinnoberroten Blüten das Sonnenlicht tanzte, hatten der Traurigkeit des Blicks nichts entgegenzusetzen.
»Ja, so ist es«, sagte Eschenbach langsam.
»Wissen Sie schon, wer es war?«
»Nein. Die Ermittlungen laufen. Wir sind … wir wissen es noch nicht.«
»Philipp war mein Bruder, mein jüngerer Bruder.« Dr. Bettlachs Blick, der für diesen Satz von den Dachgärten zurückkehrte, entfernte sich wieder. »Es ist so traurig, so unermesslich traurig alles«, sprach er weiter. Doch diesmal blieb sein Blick draußen, seine Gedanken weit weg, verloren in den Dachgärten zwischen Geranien, Efeu und Horizont, zwischen der heißen Mittagssonne im Juli und den dunklen Schatten der Trauer.
»Wer könnte ein Interesse haben, Ihren Bruder umzubringen?« Eschenbach rutschte etwas nach vorne, als wolle er die Melancholie, die wie schwarzes Seegras den Raum überwucherte, von sich abschütteln.
»Ich weiß es nicht, Herr Kommissar. Ich weiß es nicht.« Eschenbach lockerte seinen Hemdkragen, öffnete den obersten Knopf und atmete tief ein. Hatte er zugenommen? Seine Stimme war heiser. Er räusperte sich. »Erzählen Sie doch einfach. Wer war Ihr Bruder? Wie war er? Seine Freunde, seine Frau, Familie, Liebschaften. Alles.«
Dr. Bettlach bemerkte Eschenbachs Versuch, die Geister der Schwermut zu verscheuchen und begann, langsam, zuerst stockend, dann immer fließender über seinen Bruder zu sprechen.
Eschenbach unterbrach ihn nur kurz und fragte, ob er sein Diktiergerät benutzen dürfe, was Bettlach durch ein geistesabwesendes Nicken beantwortete. Der Kommissar legte das Gerät auf den Tisch, um sicherzugehen, dass sein Gegenüber es sah.
Während Dr. Bettlach über seinen Bruder sprach, sein Wesen, seine Eigenarten schilderte, wechselte er zuerst nur vereinzelt, dann immer öfter von der traurigen Vergangenheitsform in ein heiteres Präsens. Aus dem »war« wurde ein »ist«; aus dem »hatte« ein »hat«, aus dem »konnte« ein »kann« – und schlussendlich wurde aus dem Toten wieder ein Lebender.
Bettlach sprach beherrscht, in ruhigem, besonnenem Ton. Jedes Wort schien er sorgsam zu wählen, jede Pause saß. Als seine Sekretärin hereinkam, ihm zwei Notizen hinlegte und andeutete, er müsse zurückrufen, schien ihn das nicht im Geringsten zu interessieren. Und als etwas später Espresso und Amaretti serviert wurden, bemerkte er es kaum.
Eschenbach, der zuvor schon einmal die Seite der Kassette im Diktaphon gewechselt hatte, wollte eine neue einlegen. Als er merkte, dass er keine zweite mitgenommen hatte, stellte er das Gerät ab.
»Philipp war aufgeweckt, hatte eine schnelle Auffassungsgabe und ein sonniges Gemüt. Wenn er lachte, dann lag ihm die ganze Welt zu Füßen.« Bettlach trank einen Schluck Kaffee, rührte in seiner Mokkatasse und schwieg eine Weile. »Es ist schwierig, wenn Sie sechzehn Jahre älter sind«, fuhr er fort. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ihn als Baby im Arm gehalten habe. Ein Geschöpf aus einer anderen Welt.« Er lächelte. »Für ihn war der Altersunterschied vermutlich noch schwieriger als für mich; jedenfalls hat er mich damals angeschrien, als wolle er sich partout nicht damit abfinden, dass ich sein älterer Bruder bin.«
Eschenbach schwieg erwartungsvoll.
»Als er klein war, ging das alles noch – aber als er größer wurde und merkte, dass ich vor ihm da war und alles, was er wollte, schon getan hatte, da stemmte er sich eine Zeit lang gegen Mutter und mich. Er brach mit sämtlichen Konventionen; war nächtelang weg – kein Mensch ahnte, wo er sich gerade herumtrieb. Und wenn gegen vier Uhr morgens das Telefon ging, dann wussten wir: Man hatte ihn irgendwo aufgegriffen, weil er betrunken gewesen war, Drogen genommen oder gestohlen hatte. Die Polizeiwachen kannten ihn mit der Zeit, und es war klar, wer ihn holte und für die Schäden aufkam, die er angerichtet hatte.« Johannes Bettlach hielt inne und biss in ein Amaretti, das er sich vom Teller genommen hatte. Kauend erzählte er weiter: »Philipp hatte eine schwierige Zeit damals … und Adele, seine Mutter, natürlich auch«, fügte er hinzu. »Für mich schien es, als hätte er all das nur angezettelt, weil ich es verurteilte und weil ich es selbst nie getan hatte. Es war der hilflose Versuch, früher da zu sein als ich.«
Eschenbach überlegte, ob er es als Bruder auch so sehen würde. Er hatte keine Geschwister.
»Und als ich begann, mich nicht mehr zu ärgern – als mir meine nächtlichen Besuche auf der Polizeiwache nicht mehr peinlich waren, weil sie wie das Benutzen von Zahnseide zu einem Teil meines Alltags wurden –, von diesem Moment an hörte Philipp damit auf. Es hatte den Reiz verloren.« Johannes Bettlach lächelte. »Aber ich denke, das ist normal unter Brüdern, denn später verstanden wir uns wieder und wurden Freunde.«
Die Art, wie Johannes Bettlach über seinen Bruder sprach, war erstaunlich, fand Eschenbach. Es schien ihm weder oberflächlich noch einseitig zu sein. Es war distanziert und dennoch liebevoll, warm und trotzdem hatte es Konturen, Ecken und Kanten. Es war traurig und froh zugleich. Eschenbach war, als spräche eine Mutter über das Kind, das ihr am meisten ans Herz gewachsen war – weil es anders, vielleicht auch schwieriger war als alle anderen.
»Es ist nicht viel, ich weiß. Keine Anhaltspunkte, die Ihnen weiterhelfen …« Bettlach fuhr sich mit der Hand durchs Haar, wandte sich Eschenbach zu und sah ihn mit seinen blauen Augen an.
»Ein Anfang … es ist ein Anfang«, räusperte sich Eschenbach, der über das Gesagte nachdachte. Es war ihm aufgefallen, dass Johannes Bettlach viel über die Kindheit und Jugend seines Bruders erzählt, die letzten Jahre aber kaum erwähnt hatte. Eine Eigenart, die Eschenbach bei alten Menschen immer wieder beobachtete. Philipp Bettlach war laut Bericht sechsundfünfzig, da musste es noch anderes geben als jugendliche Rebellion und Freundschaft.
»Können Sie mir etwas über die familiären Verhältnisse Ihres Bruders sagen? Mit wem lebte er zusammen, hat er Kinder?«
»Nein«, kam es trocken von Bettlach. Und etwas zögerlich: »Verheiratet war er einmal … das ist allerdings schon über zwanzig Jahre her. Eveline hieß sie. Ein nettes Mädchen … aber die beiden passten nicht zueinander. Ein Jahr später waren sie wieder getrennt. Seither lebte er allein.« Wieder zögerte er. Dann fügte er noch hinzu: »Mit wechselnden Bekanntschaften.« Bettlach lächelte. »Aber das ist … das war seine Angelegenheit. Ich hab mich da nicht eingemischt.«
»Und gearbeitet hat er bei Ihnen, hier in der Bank?«, wollte Eschenbach wissen.
»Ja. Er war Leiter der Marketingabteilung und kümmerte sich um unsere ausländischen Kunden. Er war sehr beliebt.«
In diesem Moment klopfte es kurz, die Tür ging auf und die schlanke Dame, die Zettel und Kaffee serviert hatte, stand vor ihnen.
»Herr Trondtheim ist hier und möchte Sie sprechen«, sagte sie zu Bettlach.
»Ich würde noch gerne einen Blick auf Philipps Arbeitsplatz werfen«, sagte Eschenbach. »Und seine engsten Mitarbeiter kennen lernen.«
»Kein Problem. Frau Saladin wird Ihnen alles zeigen.«
Der Kommissar packte sein Diktiergerät in die Seitentasche seiner Jacke und stand auf. »Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, dann können Sie mich jederzeit hier erreichen …« Er gab Johannes Bettlach seine Karte, auf der Adresse und Telefonnummer des Präsidiums vermerkt waren. »Hinten drauf … das ist meine Handynummer«, fügte Eschenbach hinzu.
Johannes Bettlach betrachtete die siebenstellige Nummer, die in schwungvoller Handschrift auf der Rückseite der Karte stand.
»Sie können gleich mit mir nach unten kommen, Herr Kommissar«, sagte die Dame in liebenswürdigem Ton, wobei die Vokale wie gewalzter Kuchenteig endlos in die Breite gingen. Sie hätte den Satz ebenso singen können.
»Von Basel?«, fragte er.
»Hejoo«, sagte sie. »Merkt man es?«
Es war keine Frage – es war ein Triumph.
Der Kommissar drehte sich noch einmal um. Er wollte sich von Bettlach verabschieden.
Dieser hatte das Fenster einen Spaltbreit geöffnet, hielt für einen kurzen Moment inne, die linke Hand in der Hosentasche, die rechte am Fensterknauf. Dann kam er auf den Kommissar zu, streckte ihm seine Hand entgegen, zuerst die rechte, dann auch die linke; und die beiden Männer verabschiedeten sich so, wie sie sich begrüßt hatten.
Eschenbach sah die Altersflecke auf Bettlachs Händen und die Schwermut in seinen Augen. Trotz der Sonne, trotz der Wärme der Geste und der Freundlichkeit der Stimme; er spürte die tiefe Traurigkeit, die von diesem Mann ausging.
Man sah dem Büro an, dass Philipp Bettlach mehr als nur ein Vizedirektor gewesen war. Es war groß und hell, ohne den Eindruck zu erwecken, dass darin jemals richtig gearbeitet worden war. Eschenbach kam die Zeitschrift Schöner Wohnen in den Sinn, und er maß in Gedanken ab, ob sein eigenes Büro zwei oder drei Mal darin Platz gehabt hätte.
»Herr Bettlach hatte die Möbel speziell in Italien anfertigen lassen«, sagte Constanze Rappold.
Eschenbach nickte.
Sie hatte sich als Personal Assistant von Philipp Bettlach vorgestellt. Auf Englisch, mit deutschem Akzent. Wie die beiden anderen Mitarbeiterinnen von Bettlach steckte sie in einem adretten dunkelblauen Kostüm.
»Können Sie mir etwas über seinen Aufgabenbereich sagen?«, fragte der Kommissar. Als Erste hatte er sich Constanze vorgenommen und saß mit ihr am ovalen Besprechungstisch im Chefbüro.
»Ich nehme an, Herr Dr. Bettlach hat Ihnen gesagt, dass wir hier nicht über Kundennamen sprechen dürfen.«
»Ich will keine Namen … ich will lediglich wissen, was die Aufgabe von Herrn Bettlach war.«
»Kunden.«
»Was heißt Kunden?«
»Ich kann … ich darf Ihnen keine Namen sagen.«
»Herrgott!« Eschenbach musste sich zusammenreißen, dass er sie nicht anschrie. War sie wirklich so gottlästerlich dämlich, oder tat sie nur so? »Ich meine, hat er die Kunden betreut, besucht oder akquiriert? Hat er Börsengeschäfte für sie erledigt oder ihre Kinder vom Internat abgeholt? Was weiß ich schon davon … Ich bin Polizist.«
»Alles …«
»Kürzer und allgemeiner geht’s nicht?«
Ihr Mund zuckte; es schien, als wollte sie noch etwas sagen, doch plötzlich schossen ihr Tränen in die Augen. Hemmungslos heulte sie drauflos und verbarg dabei ihr schönes Gesicht in den Händen.
Nach einer Weile beruhigte sie sich wieder. Behutsam steuerte Eschenbach die Unterhaltung an ihr Ende. Die beiden anderen Gespräche, die er der Reihe nach führte, verliefen nicht viel anders. Sie waren verliebt in ihren Chef – alle drei. Vermutlich wären sie für Philipp Bettlach aus dem Fenster gesprungen, in die Limmat, und wenn’s hätte sein müssen auch vom Eiffelturm. Sei es aufgrund des Geldes, das er hatte, seines Lachens oder nur seiner schönen Hände wegen. Jede vergötterte ihn auf ihre ganz spezielle Weise.
Was seine Arbeit betraf, soweit man das, was er tat, als Arbeit bezeichnen konnte, schien er erfolgreich gewesen zu sein und durch seine gewinnende Art allerlei Kundschaft akquiriert zu haben: Erben des alten Geldes genauso wie Leute aus dem Jetset und neureiche Angeber. Philipp war ein Strahlemann gewesen; ein Sonntagskind, wie sie sagten, den jede andere Privatbank in Zürich gerne vor ihren Karren gespannt hätte.
Als Eschenbach durch die geisterhafte Glastür wieder auf den Rennweg trat, drückte ihn die Hitze beinahe zu Boden. Er sah auf die Uhr. Fast vier. Er hatte die Zeit völlig vergessen.
Die Sonne brannte ihm ins Gesicht, der Asphalt unter seinen Füßen fühlte sich an wie ein weicher Teppich. Er dachte an Ozonwerte und daran, dass derzeit von Sport im Freien abgeraten wurde. Eschenbach wusste nicht, warum ihm dabei auch seine Cholesterinwerte wieder einfielen. Dann kamen ihm Jagmetti und die Schaufensterpuppe in den Sinn. Ihm wurde schwindlig.
Er wechselte die Straßenseite, da die andere Seite im Schatten lag. Vorbei an Geschäften mit Schweizer Offiziersmessern, digitalen Wetterstationen, Grußkarten, Kuckucksuhren, Kochschürzen und anderem Schnickschnack marschierte er in Richtung Paradeplatz.
Er schwitzte. An den Schläfen lief es zuerst. Dann vom Haaransatz auf die Stirn und über die Stirn hinaus in die Augen. Es brannte. Da er kein Taschentuch fand, versuchte er es mit dem Ärmel seines Jacketts. Aber Wolle sog schlecht auf.
Warum hatte er überhaupt ein Jackett aus Wolle an? Warum keines aus Leinen oder aus Baumwolle?
Jetzt juckte es auf der Stirne, an der Schläfe und im Nacken. Er kratzte. Die Hand war nass und das Hemd sah aus, als bestünde es aus großen hell- und dunkelblauen Puzzleteilen.
Am Paradeplatz nahm er sich ein Taxi und fuhr zum Golfclub.
4
»Das fünfzehnte Loch ist hier«, sagte die Dame an der Rezeption und deutete mit manikürtem Finger auf einen Mini-Plan mit lauter kleinen grünen Flecken. »Am besten, Sie gehen zu den back nine und kürzen dann zwischen Loch zwölf und Loch dreizehn ab.«
Verständnislos blickte der Kommissar sie an. Dann nahm er den Kartonfetzen, auf den die ganze Clubanlage en miniature gedruckt war, und verließ das Gebäude. In diesem Augenblick fiel ihm ein, dass er sein Jackett auf der Rückbank im Taxi liegen gelassen hatte, samt Diktiergerät und den Aufzeichnungen des Gesprächs mit Johannes Bettlach. Er fluchte leise. Dann griff er hastig die Hosentaschen ab und war erleichtert, dass er wenigstens das Mobiltelefon bei sich hatte.
»Hier ist übrigens Handy-Verbot«, fauchte ihm ein Herr mittleren Alters zu, der mit Golfwägelchen zügig am Kommissar vorbeimarschierte.
»Ja, ja«, erwiderte Eschenbach und suchte weiter Jagmettis Nummer im Speicher. Nach ein paar Schritten verließ er den Kiesweg und schlenderte quer über die Matte auf einen mächtigen Kirschbaum zu. Im Schatten fand er endlich die Nummer auf dem Display und bestätigte. »Eschenbach«, brummte er.
Unter dem dunkelgrünen Blätterdach hingen fette, blauschwarze Kirschen.
»Chef, wo sind Sie?«
»Unter einem Kirschbaum bei den back nine.«
»Auf dem Golfplatz?«
»Ja.«
»Ich komme Sie holen. Wo genau sind Sie?«
»Bei den back nine !«
»Back nine heißen die Löcher zehn bis achtzehn«, kam es von Jagmetti.
»Dann halt unter dem Kirschbaum …« Eschenbach sah sich um. »Bei den Sandlöchern.«
»Sandbunker hat es auf dem ganzen Platz. Ist ein Gebäude in der Nähe … irgendein Merkmal?«
»Etwa hundert Meter vom Eingang entfernt. Ich sehe die Terrasse des Clubhauses … kommen Sie einfach.«
»Okay.«
Der Kommissar sah Claudio Jagmetti von weitem und winkte. »Fahren Sie ruhig bis hierher«, rief er und deutete direkt vor seine Füße. »Das Ding fährt auch auf Gras.«
Jagmetti verließ mit seinem Elektrowagen den Kiesweg und holperte über die Wiese zum Kirschbaum, wo der Kommissar wartete und zustieg.
Sie fuhren denselben Weg zurück, und Eschenbach genoss den Fahrtwind, der ihm das angeklebte Haar von der Stirn löste und trocknete.
»Kommen wir vorwärts?« Der Kommissar musste sich am Dach des Elektrowagens festhalten, als Jagmetti in voller Fahrt den Schotterweg verließ und querfeldein über die Wiese steuerte. Er schien Spaß daran gefunden zu haben.
»Wir fahren jetzt direkt zum fünfzehnten Loch, dort ist alles aufgebaut.«
»Aha«, grummelte Eschenbach. Er fuhr sich mit der linken Hand durch sein Haar, das nun fast wieder trocken war. Mit der anderen Hand hielt er sich immer noch am Dach fest. »Konnten Sie eine Schaufensterpuppe auftreiben?«
Jagmetti berichtete über seinen Kaufhausbesuch, darüber, dass er von Pontius zu Pilatus habe gehen müssen, bis er schließlich von der Assistentin des Verkaufsleiters – der er wohl nicht unsympathisch gewesen sei – die gewünschte Puppe gegen Beleg und Kaution ausgehändigt bekommen habe.
Er erzählte auch, dass es sich bei dem Exemplar um eine weibliche Puppe handle, mit bleichen festen Brüsten, und dass er mit hochrotem Kopf und der nackten Dame unter dem Arm durch halb Zürich habe gehen müssen, um gerade noch rechtzeitig zu Dr. Salvisberg zu gelangen.
Holpernd fuhren sie an einer Gruppe mit Golfern vorbei, die an einer Böschung mit ihren Schlägern im halbhohen Gras herumstocherten und einen Ball suchten, den einer von ihnen verloren hatte.
»Und jetzt steht die Frau mit den festen Brüsten am fünfzehnten Loch und wartet auf uns?« Eschenbach gefiel die Geschichte, er stellte sich vor, wie der schlaksige Jagmetti mit der Puppe durch die von Geschäftsleuten und Touristen überfüllte Bahnhofstraße eilte.
»Sie ist nicht mehr nackt«, sagte Jagmetti. »Johnny und ich haben sie eingekleidet. Johnny, das ist der Golfpro. Es ist wegen der Etikette und so.«
Eschenbach war, als hörte er ein leichtes Bedauern in Jagmettis Tonfall. »Kleidervorschriften für Puppen«, sagte er und schnalzte mit der Zunge. »Das hat allerdings Stil.«
Sie fuhren an einem kleinen Hügel vorbei, der mit Sträuchern und höherem Gras überwachsen war, und sahen, rechts unter sich, den Tatort.
Er war nicht zu übersehen.
Farbtupfer auf grünem Hintergrund. Zierfische in einem Aquarium, die sich zwischen Wasserpflanzen und mit Algen bewachsenen Kieselsteinen um das Futter balgten.
Gelb-blau karierte Hosen, ein roter Pullunder, ein hellblaues und ein sandfarbenes Poloshirt, weiß-braune Schuhe, Strohhut. Ein dunkelblauer Blazer mit weißem Hemd.
Wer war die Puppe? Eschenbach machte sich ein Spiel daraus, die farbigen Gestalten zu identifizieren. Der Dunkelblauweiße, mit Streifenkrawatte, das muss Aebischer sein. Eindeutig. Der rote Pullunder mit Strohhut der Pro.
Sie kamen näher. Die gelb-blauen Karos bewegten sich. Beide trugen dunkelblaue Schirmmützen.
Jetzt erkannte Eschenbach unter der einen Kappe blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren und nach hinten abstanden. Die andere war die Puppe.
Sie waren noch etwa zehn Meter entfernt.
»Wer ist der Blondschopf?«, fragte Eschenbach.
»Doris Hottiger. Sie ist hübsch, nicht?«
»Das kann ich von hier aus nicht beurteilen.«
Claudio Jagmetti wurde rot. Er hätte seine flapsige Bemerkung am liebsten zurückgenommen. »Sie arbeitet hier im Club. Assistentin von Aebischer oder so.«
»Oder so was? Seine Geliebte?«
»Nein, die ist doch viel zu jung. Knappe zwanzig, oder so.«
»Aha, oder so.« Eschenbach zog die Augenbrauen hoch. Jagmetti hielt den Wagen an. Es war Viertel nach fünf. Die sengende Hitze hatte nachgelassen, und von den Glarner Alpen her zogen vereinzelt ein paar Wolken auf.
»Herr Kommissar! Wo stecken Sie denn?« Es war der forsche Aebischer, der mit perfekt gebundenem Schlips, Clubemblem auf der Brusttasche und ausgestreckter Hand auf ihn zukam.