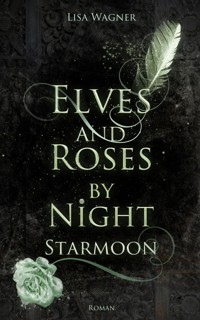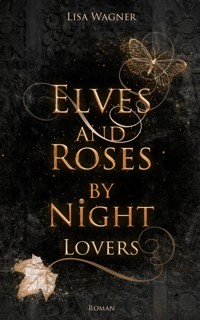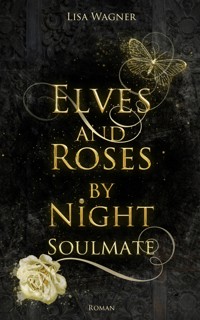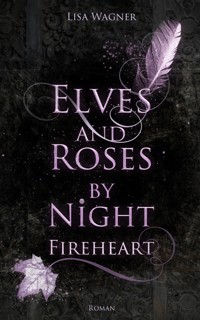
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auch der Tod schreckt nicht vor einer wahren Liebe zurück!
Medina hat nur knapp den Kampf gegen Leopas überlebt, und das auch nur mit Glück und der Hilfe von Lenox. Doch dafür hat sie einen hohen Preis zahlen müssen, der sie verändert hat. Eine schwarze Wolke schwebt über Medinas Leben, welche sie zu verschlingen droht. Nur mit der Hilfe ihrer Familie wird sie einen Weg finden, um Leopas aufhalten zu können. Wird sie es schaffen, jemals den Pfad in ihr altes Leben zurückzufinden? Oder wird sie die Hoffnung auf Liebe und Glück ganz verlieren?
Es handelt sich um den 3. Teil der Fantasy-Reihe "Elves and Roses by Night".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Elves and Roses by Night: Fireheart
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenFireheart
Lisa Wagner
Elves and Roses by Night
Fireheart
Fantasy-Liebes-Roman
Copyright: Lisa Wagner 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches - auch auszugsweise - sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet. Handlungen und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Teil 3 der fantastischenEARBN-Reihe
Widmung
Was ist Trauer,
wenn nicht Liebe, die überdauert ...
Für die Leser und Leserinnen,
die sich zu gern verzaubern lassen!
Lyvián
Aussprache der Namen
NachtelfenMedina Aryell - Me-di-na Ar-jellTobén Blackthorn - Toh-ben Bleck-zornPhiliás - Fili-jäsGildá - Gil-deiLoóna - Luh-naMaxím - Ma-xiemGarrow - Ger-rohRíccon - Ri-konFarláh - Far-leiFaolán - Fao-lenRayánne - Rei-enEsmé - Es-mieLavindyr - La-win-durCeangáel - Ken-giel
ElfenLenox - Len-noxCarrán - Kar-reinLeopas - Leo-pasSiénah - Zieh-en-nahBrandur - Brahn-durSloan - Slo-ehnAlvá - Al-weiGrádom - Grei-demSiocháin - Zioh-schen
SchattenwölfeBéal - Bie-hlGhrian - Grie-anSolas - Soh-lasLyrazs - Lü-raschBreack - Brie-k
RiesenMoérs - Mö-rsGrifhyn - Griff-inAéryn - Ei-renChará - Ka-rahDeégan - Die-genGlyn - Glin
DruidenKeálas - Kiel-li-esEndovíer - En-do-wirMírjam - Mier-jemLianne - Li-enEydána - Ih-denaKasimyr - Ka-si-mür
MeerwesenDaymón - Dei-menÉdessa - Ih-deßaNikósz - Nie-koschMenélaos Szinárdín - Mieneh-laos Zienar-denNephíles Szinárdín - Ne-fie-les Zienar-denLava - Lah-wa
AndereSidney/Sid - Zit-nei/ZitCollien/Lien - Kol-lin/LinSibhyél - Sie-billFalingeár - Fah-ling-gierMelody - Mel-lo-diLydía - Li-diaLuascán - Lu-asch-kahnAmathá - Ah-mah-taRobúlái - Roh-bu-lah
Prolog
Die Kälte der Steintreppe kroch ihm in den Körper. Wie jede Nacht saß er hier und blickte nachdenklich über den Burghof. Die Sterne strahlten auf ihn herab und Stille umzingelte ihn. Nur die Tiere außerhalb der Mauern waren zu hören, genau so wie das leise Plätschern des Flusses. Er hielt seine Beine eng an seinem Körper und blickte weiterhin stumm in den Himmel, doch seine Gedanken gaben keine Ruhe. So viel Schmerz und Trauer waren in ihm und er selber konnte damit nur ganz schlecht umgehen oder in irgendeiner Weise klare Gedanken fassen. Alles um ihn herum schien einfach nur noch falsch zu sein. Es schmerzte ihn, als hätte ihm jemand das Herz herausgerissen, und irgendwie war auch genau das passiert. Er hatte etwas verloren. Nein, er hatte jemanden verloren. Seinen besten Freund, seinen Bruder, den High Lord der Nachtelfen.
Von einem auf den anderen Tag war alles anders gewesen und noch immer gab es keine Klarheit. Für niemanden. Tobén war einfach verschwunden, sein Körper nirgendwo zu finden, und selbst Keálas hatte niemandem etwas dazu sagen können, obwohl er sonst immer auf alles eine Antwort hatte. Sie hatten alles abgesucht, mehrere Tage lang, immer und immer wieder, doch ohne Erfolg. Es gab absolut keine Hinweise, nichts, und das machte ihn so fertig. Tobén konnte nicht einfach weg sein, das war unmöglich, doch dieses Gefühl schlich sich langsam in sein Bewusstsein, obwohl er es nicht wahrhaben wollte. Er hasste das alles und wie sollte er so weitermachen? Sein Kopf fiel auf seine Knie. Er wollte nicht, dass jemand seine Tränen sah, obwohl er genau wusste, dass er auch diese Nacht alleine hier war. Niemand war so spät noch unterwegs und sonst sah man auch nur noch selten jemanden umherlaufen. Die Welt um ihn herum war eingeschlafen, alle standen noch unter Schock. Immer noch trauerten sie um ihren High Lord. In seinen Gedanken sah er die schwarzen Kleider, die seit Tagen von jedem getragen wurden, und hörte die unzähligen Trauergesänge. Wie sollte das alles noch weitergehen? Er wusste es nicht. Daran erinnern, wann er das letzte Mal ohne seinen besten Freund gewesen war, wusste er nicht mehr. Für ihn waren sie schon immer Seite an Seite gewesen und jetzt sollte das einfach vorbei sein? Mit einer Hand wischte er sich die Träne von der Wange.
Jeden Tag wurde der Schmerz größer und setzte sich tiefer in seinem Herzen fest, doch mit diesem Gefühl war er nicht allein. Medina hatte es besonders hart getroffen, härter als ihn selber. Seit Wochen war sie nur noch eine Hülle. Sie war nicht einmal aus ihrem Zimmer gekommen und er wusste nicht einmal, ob sie überhaupt noch lebte. Sie aß nichts mehr und ihr Lachen war schon lange verschwunden, genau so wie sein eigenes. Nicht nur er litt Qualen, auch sie, und er machte sich unglaubliche Sorgen um Medina. Er wusste, dass sie aufgegeben hatte und diese Verluste nicht ertragen konnte. Er hatte ihr helfen wollen, jedes Mal, wenn er sie besuchen gegangen war. Sie hatte nicht gesprochen, ihr Essen nicht angerührt und sich in ihrem Bett verkrochen oder an ihrem Fenster gelehnt und den Blick weit in die Ferne gerichtet. Er hatte ihr in die Augen geblickt und war dann wieder gegangen. Seitdem hatte er sie nicht mehr besucht oder irgendetwas versucht, um ihr zu helfen. Er konnte ihren Anblick nicht ertragen. Sie sah miserabel aus und er wusste genau, dass er nicht viel besser aussah.
Wann hatte er sich das letzte Mal gewaschen oder war auf den Trainingsplatz gegangen, um zu trainieren? Er hatte einfach keinen Sinn mehr darin gesehen und es für Zeitverschwendung gehalten. Das alles war einfach nur schiefgelaufen. Und dann waren da diese Vorwürfe, die ihn quälten. Er hätte Tobén beschützen müssen, hätte an seiner Seite kämpfen sollen, doch er hatte es nicht gekonnt. Die Greifer hatten ihn in Schach gehalten und ihn zum Bluten gebracht. Noch immer hatte er einige Wunden, die nur langsam verheilten, und dann war da auch noch sein gebrochener Unterarm, der auch jetzt noch in einen weißen Verband gehüllt war. Als er den lauten Aufprall gehört hatte, war es zu spät gewesen, und er hatte seinen Augen nicht trauen können.
Vor lauter Wut hatte er unkontrolliert um sich geschlagen. Sein Schwert war durch unzählige Körper geglitten, hatte einem Greifer nach dem anderen den Kopf durchtrennt und am Ende war er mit schwarzem Blut besudelt gewesen. Aber selbst dieses kurze Hochgefühl hatte nichts geändert. Er war nicht mehr der Mann, der er vorher gewesen war, wenn er das überhaupt irgendwann wieder sein konnte. Dieses Gefühl von Stärke und Hoffnung hatte ihn verlassen und doch wollte er stark sein. Er wollte es irgendwie schaffen, seine Familie zusammenzuhalten. Für Tobén. Er wusste, dass er der Einzige war, der Einzige, der etwas tun konnte und musste. Siénah war verzweifelt und kaum zu etwas imstande. Ihre Gedanken kreisten nur um Medina. Jeden Tag ging es nur darum, dass sie doch etwas essen, oder mal wieder an die frische Luft musste. Sie durfte sich selber nicht einsperren. Ja, er gab Siénah vollkommen recht und doch ging das alles viel tiefer, als sie vermuteten, und mit ihrer strengen Art kam auch Siénah gerade nicht an Medina heran. Keálas war mehr fort als da und wenn er da war, sprach er kaum.
Irgendetwas hatte sich komplett an ihm verändert, doch er war noch nicht dahinter gekommen, woran das liegen konnte. Er versuchte es aber auch nicht ernsthaft, denn auch Keálas brauchte anscheinend seine Zeit zum Trauern. Carrán lenkte sich mit Training ab. Jeden Tag stand er stundenlang auf dem Burghof oder auf dem Trainingsgelände und verpulverte seine Kraft. Für ihn war es genauso schwierig wie für sie alle. Auch er hatte seinen besten Freund verloren, der sich für sie alle geopfert hatte. Als Carrán ihm das erzählt hatte, war ihm die Luft weggeblieben und er hatte sich einfach auf den Boden fallen lassen. Dass Lenox das wirklich für sie getan hatte, damit hätte er niemals gerechnet und er rechnete es ihm hoch an, obwohl er ein Elf und Mitglied der Königsfamilie gewesen war. An manchen Tagen wünschte er sich wirklich, dass er nicht so streng mit Lenox gewesen wäre. Sein Egoismus war wie immer viel zu groß gewesen und er hatte diesem jungen Elf die Schuld für die Vergehen gegeben, mit denen er absolut nichts zu tun gehabt hatte. Jetzt war es definitiv zu spät, um sich zu entschuldigen. Er wischte sich noch einmal über das Gesicht und ließ seinen Blick zurück in den Nachthimmel gleiten. Dann war da auch noch dieser Riese, der ihm schlichtweg auf die Nerven ging. Moérs hielt sich immer noch in der Burg auf. Er wusste nicht, warum er noch hier war, und ihm wäre es lieber, wenn der Typ verschwunden wäre.
Seine Arroganz war ihm schon immer gegen den Strich gegangen und er gab gerne offen zu, dass er Moérs nicht leiden konnte. Außerdem beschlich ihn das Gefühl, dass mehr hinter der ganzen Sache steckte und Moérs einfach nur eine Fassade aufrecht erhielt, hinter der ein falsches Spiel gespielt wurde. Er würde es in Erfahrung bringen, da war er sich sicher. Doch das war erst einmal Nebensache. Er musste irgendetwas für Medina tun können. Seine Gedanken kreisten oft um sie. Er wusste, dass sie ohne ihre Stärke, ohne ihre Macht verloren waren. Sie war die Stärkste von allen. Wie konnte er ihr also helfen? Es musste einfach eine Möglichkeit geben. Er konnte nicht tatenlos weiter herumsitzen und nichts tun. Abrupt stand er von den Stufen auf und blickte noch einmal in den Himmel. Seine Augen trafen auf die funkelnden Sterne, die ihn von oben herab auszulachen schienen.
Dann ging er zurück in die Burg.
Er ließ die Tür weit offen stehen, während ihn immer mehr die Verzweiflung zu übermannen schien. Die ganze Situation musste seinen Verstand ausgeschaltet haben. Er handelte wie von Sinnen, als seine Hände auf das Erste trafen, was er erkennen konnte. Die Vase auf der Kommode flog durch die Halle und ein verzweifelter Schrei kam aus seiner Kehle.
1
Ich sah zu Tobén, dessen Mund weit offen stand, aber kein Ton herauskam. Wie in Trance stand er da und dann, ohne Vorwarnung, fiel er einfach auf die Knie, wie ein Häufchen Elend. Sein Blick galt dabei nur mir und ich konnte deutlich sehen, wie immer mehr Kraft aus ihnen verschwand. Auch wenn ich meinen Blick nicht ganz von Tobén lösen konnte, sah ich alles deutlich um ihn herum. Leopas schritt ganz langsam auf ihn zu. Näher und Näher.Doch Tobén rührte sich nicht ein kleines bisschen. Wie versteinert saß er da und blickte mich weiterhin an und ich blickte zurück. Seine Augen waren feucht und eine glänzende Träne bahnte sich ihren Weg. Ganz langsam kullerte sie über seine Wange.- Für immer und ewig liebste Meddi!Die schwarze Magie, die Leopas erzeugte, rauschte auf ihn nieder. Er wurde von dem Boden gehoben und schleuderte mit voller Wucht davon. Sein Aufprall in die Steinwand hinter uns brach mir das Herz. Der Knall war ohrenbetäubend. Schutt und Asche flogen umher. Eine Staubwolke stob in den Himmel und nur ein riesiges Loch blieb übrig. Das laute Knacken war noch lange zu hören, während Trümmer des Gesteins von oben herabrieselten und Tobéns Körper unter sich begruben.
Schweißgebadet wachte ich auf. Ich blickte mich hektisch um, doch ich erkannte sofort die deckenhohen Fenster und die blauen Laken, die mich bedeckten. Schon wieder dieser Albtraum. Jede Nacht das Gleiche.Und wieder brummte mein Kopf vor Schmerzen von den wenigen Stunden, die ich geschlafen hatte. Wenn man das überhaupt schlafen nennen konnte. Es war eher ein Hin und Her zwischen wach sein und quälenden Träumen. Doch das waren sie nicht. Es waren keine Träume. Diese Erinnerung, die mich jede Nacht wach hielt, war real und ich musste mir gar nichts vormachen. Auch als Erinnerung in meinen Gedanken tat es unglaublich weh und war kaum auszuhalten.
Ich zog langsam das Laken von meinen Beinen und hievte mich aus dem Bett. Schweren Schrittes trugen mich meine Beine zu den großen Fenstern, die hell zu schimmern schienen. Die Sonne stand mitten am Himmel, schien ununterbrochen und schickte ihre Wärme in die Natur. Es musste mitten am Tag sein, doch das war mir egal. Alles war mir egal. Ich ließ mich an der Scheibe hinabgleiten und landete auf dem Holzboden. Meine Beine hielt ich angewinkelt an meinem Körper und meine Stirn lehnte an dem kühlen Glas, welches die Wärme der Sonne überhaupt nicht aufgenommen hatte. Mein Blick wanderte umher. Erst traf er auf den Garten, der direkt unter mir lag. Links der kleine Brunnen, in dem das Wasser plätscherte und der mich an viele schöne Momente erinnerte. Rechts die weite Wiese mit den unzähligen verschiedenen Blumen und dem Drachen, der sich auf ihr ausgebreitet hatte. Seit Wochen hatte er sich nicht vom Fleck bewegt, genau so wenig wie ich. Seine rot-braunen Schuppen schimmerten im Licht der Sonne und verschmolzen mit dem Grün der Wiese. Aus seinen Nüstern stiegen kleine Rauchwolken und schwebten langsam hinauf in den Himmel. Nur daran erkannte ich, dass Falingeár am Leben war und ich wusste, dass er meine Gedanken hörte, die mich jeden Tag wach hielten. Trotzdem ließ er sich nichts anmerken und döste weiter ruhig vor sich her. Er hatte mich die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Dafür war ich ihm irgendwie dankbar. Noch jemanden, der mich belästigte, brauchte ich ganz sicher nicht. Ich wollte einfach nur meine Ruhe und allein sein. Ich wollte trauern können, ohne dass mich jemand dabei zu Gesicht bekam, denn ich hatte alles verloren. Alles, was mir wichtig gewesen war. Mein Glück, meine Hoffnung und am Ende sogar meine Liebe.
Ich presste meine Beine noch fester an mich. Wieder überkam mich dieses Gefühl von Einsamkeit. Seit Wochen war sie mein stetiger Begleiter. Obwohl ich es nicht gerne zugab, war ich einsam. Mein Herz war in tausend Teile zerbrochen und ich wusste selbst nicht, ob es irgendwann wieder heilen würde. Wieder hatte ich meinen Traum vor Augen, meine widerspenstige Erinnerung. Den letzten Augenblick, in dem ich Tobén gesehen hatte. Für immer und ewig liebste Meddi ...
Das waren seine letzten Worte an mich gewesen und je mehr Tage vergingen, desto undeutlicher wurde seine Stimme. Ich vergaß sie, die Stimme meines Mannes, und das machte mir Angst. Meine Trauer ebbte nicht ab. Sie wurde umso stärker, je öfter ich an ihn dachte und mich daran erinnerte, dass er nicht mehr hier war. Nicht mehr bei mir. Tobén war verschwunden und sein Körper mit ihm. Ich hatte es nicht mit eigenen Augen gesehen, nur Wortfetzen hingen in meinen Erinnerungen.... Wir haben alles abgesucht ...... Er hätte dort sein müssen ...... Tobén ist einfach verschwunden ...Ich hatte mich nicht von ihm verabschieden können und diese noch so winzige Geste würde mich noch lange verfolgen. Selbst eine Beerdigung war zu viel, um darüber noch weiter nachzudenken. Es war einfach alles zu viel und sinnlos. So ging es für mich nicht mehr weiter. Ich wollte nicht mehr und die anderen wussten das. Deswegen hatte Keálas mir meine Magie genommen und sie hinter einem Schutzzauber versteckt, den ich nicht brechen konnte. Wir wollen dich doch nur beschützen! So nannten sie es immer, doch für mich war es hier einfach nicht mehr auszuhalten. Ja, natürlich hörte ich mich an wie ein weinerliches Kind und niemand hätte sein Leben einfach so weggeworfen, nur weil deren Mann gestorben war. Doch für mich war meine Welt einfach nur noch schwarz und in einen dichten Nebel gehüllt. Ich wollte diesem Schmerz doch einfach nur entkommen und mich nicht mehr daran erinnern. Das Einzige, was ich wollte, war wieder Tobéns Nähe zu spüren, seine Wärme und mich in seinen Berührungen wohlfühlen. So oft hatten wir diese Momente zusammen gehabt, wo ich einfach alles vergessen konnte und nur er und ich zählten. Doch Tobén war tot. Eindeutig. Der Schmerz in meinem Inneren zeigte es mir. Tag für Tag, Stunde für Stunde pochte es in meinem ganzen Körper. Warme Tränen liefen über mein Gesicht und ich ließ es einfach geschehen. Schon lange hatte ich aufgehört, mich dagegen zu wehren und mich an eine Hoffnung zu klammern, die aussichtslos war. Es gab gerade keine Hoffnung, keinen Lichtblick, der mich zurück in mein Leben holte. Niemand machte mir ernsthafte Vorwürfe, denn nicht nur ich trauerte. Auch das Volk der Nachtelfen war in tiefe Trauer versunken. Bunte Kleider hatten sich schwarz gefärbt und überall standen schwarze Blumen. Die Fahnen am Burgtor hingen auf halbmast, niemand lachte mehr und die fröhlichen Gesänge waren verstummt. Als hätte sich mein Schmerz wie ein Fluch über die Burg gelegt und vielleicht war es genau so gewesen. Wir hatten unseren König, meinen Mann, verloren. Nichts war von ihm übrig geblieben. Und ihre Königin? Ich war ein Häufchen Elend, zu nichts zu gebrauchen, und wieso sollten sie an mich glauben, wenn ich mich versteckte und mich in meiner Trauer verlor? Mein Zimmer hatte ich nicht mehr verlassen und niemand hatte mich seit Wochen zu Gesicht bekommen.Ich war nicht ihre Königin, nicht ihre High Lady. Ohne Tobén war ich nichts davon. Ich war einfach nur Medina, eine Frau, die in eine Rolle gedrängt worden war, die sie niemals haben wollte. Hätten Siénah und die anderen nicht so schnell reagiert, dann wäre das ganze Grübeln und Trauern schon lange vorbei. Ich wäre nicht mehr hier, nicht mehr am Leben, hätte Keálas mich nicht aufgehalten. Ohne Zweifel wäre ich Tobén in den Tod gefolgt, damit wir uns in 30.000 Jahren wiederfinden konnten, doch die anderen hielten es für eine dumme Idee. Ich musste mir eingestehen, dass ich in dieser Situation egoistisch handelte und mir die Meinung anderer egal war. Sie konnten sagen, was sie wollten, doch für mich war der Tod ein ziemlich guter Weg hier raus. Dass sie sagten, dass man ohne Tobéns Körper nicht wüsste, ob er wirklich tot war, war für mich nur eine Ausrede. Ich glaubte das alles nicht. Sie wollten mich damit doch nur beruhigen und mich irgendwie von der Trauer ablenken oder mir falsche Hoffnungen machen und ich wollte einfach nur meine Ruhe. Wieder zupfte ich an Tobéns T-Shirt herum, das ich seit Tagen trug. Ich nahm seinen Geruch wahr und erinnerte mich an die Zeit mit ihm. An die Zukunft, die wir miteinander gehabt hätten, wenn der schwarze Erhabene ihn mir nicht genommen hätte. Wie von selbst ballte sich meine Hand zur Faust, doch ich versuchte durchzuatmen. Meine Gefühle spielten Achterbahn und ich hatte nichts mehr unter Kontrolle. Gleich würde ich wahrscheinlich wieder vor Wut schreien, weinen oder mich auf den Boden fallen lassen und stumm die Decke anstarren. Das übliche Spiel, welches ich jeden Tag aufs Neue spielte.
Ein Klopfen an der Tür weckte meine Aufmerksamkeit, doch ich rührte mich nicht. Ich blieb einfach sitzen, während mein Blick weiterhin aus dem Fenster gerichtet war. Ein leises Quietschen ließ erahnen, dass die Tür geöffnet wurde und in der Spiegelung in dem Fenster erkannte ich die Person. Es war Siénah. Pünktlich wie jeden Tag. Sie trug eine schwarze Rüstung aus Lederhose und Wams. Ihre Haare hatte sie zu einem festen Zopf geflochten, doch auch ihre Augen waren verschleiert. Wie bei jedem anderen auch, der mich seit dem Tag anblickte. Sie trug ein Tablett in den Händen, auf dem eine große Karaffe gefüllt mit Wasser stand und etwas Brot sowie Obst. Sie kam weiter in den Raum herein, ohne auf meine Abneigung zu reagieren, und stellte das Tablett auf dem kleinen Tisch neben dem Kamin ab. Dann straffte sie ihre Schultern und blickte mich wieder mit diesen traurigen Augen an.„Ich habe dir etwas zu essen und Wasser gebracht. Außerdem auch die Kräuter, die du laut Keálas zu dir nehmen sollst, damit ... damit deine ...“
Sie ließ den Blick abrupt sinken. Eine lose Haarsträhne fiel ihr dabei ins Gesicht, die sie mit einer schnellen Handbewegung hinter ihr Ohr klemmte. Siénah konnte es nicht aussprechen. Warum sollte sie auch? Es betraf sie ja nicht. Woher sollte sie also wissen, wie es sich anfühlte. Wie es sich anfühlte, den Ehemann und das ungeborene Kind verloren zu haben und das an dem gleichen Tag. Ich fühlte diesen ganzen Schmerz nur wegen eines Monsters, das mir alles nehmen wollte, was ich liebte. Der es am Ende sogar geschafft hatte, mir alles zu nehmen. Wieder erfüllte dieser Hass meinen ganzen Körper, doch ich riss mich am Riemen. Nicht jetzt. Nicht vor Siénah ... Ich gab ihr keine Antwort, beachtete sie nicht einmal. Sie sollte wieder gehen, einfach wieder verschwinden und mich alleine lassen. Mehr wollte ich gar nicht.„Meddi, du musst etwas essen. Und die Kräuter helfen deinem Körper wieder gesund zu werden ...“
Mein Körper würde niemals wieder gesund werden. Er hatte Strapazen durchgemacht, die ich nicht annähernd beschreiben konnte. Die Fehlgeburt war die Schlimmste davon gewesen. Jedes Mal, wenn ich die Narbe sah, die direkt unter meinem Bauchnabel hell aufschimmerte, kamen die Erinnerungen wieder. Der Schmerz, der meinen Körper durchzuckt hatte. Dann das viele Blut, welches an meinen Beinen hinab gelaufen war. Meine Schreie und die Tränen, die ich vergossen hatte. Die Schmerzen waren so unerträglich gewesen, dass ich in Ohnmacht gefallen war und gar nichts mehr mitbekommen hatte, doch ich wusste, dass das alles real gewesen war. Mit jedem Blick in den Spiegel durchlebte ich es noch einmal. Als wäre es nicht schon genug gewesen, dass Tobén und auch Lenox ihr Leben verloren hatten. Nein! Ich hatte durch meine Dummheit das letzte Teil von Tobén verloren. Unseren Sohn. Und damit war alles von Tobén verschwunden. Ich hatte ihn nicht weiterleben lassen können oder seinem Sohn von ihm erzählen können, was er doch für ein toller Nachtelf gewesen war und ein noch besserer König.„Meddi hörst du ...“
Ja, ich hörte laut und deutlich und doch wollte ich ihr nicht antworten. Mit jemandem reden war das Schlimmste, was man mir gerade antun konnte. Sie war meine Freundin, meine beste Freundin, und ich wusste, dass sie sich nur Sorgen machte. Doch auch ihre täglichen Bemühungen waren sinnlos, genau so wie die von Keálas oder von Carrán, der mich nur an einen weiteren Verlust erinnerte. Lenox ist tot ... Auch er hatte sein Leben für mich und die anderen gegeben und am Ende war auch dieser Tod sinnlos gewesen. Auch wenn ich noch am Leben war, zu welchem Preis war er gestorben? Für nichts und wieder nichts. Der schwarze Erhabene war immer noch am Leben. Zwar hatte Lenox ihn verwundet, aber er war nicht tot. Lenox war umsonst gestorben, denn auch ich war verloren und nicht imstande weiterzuleben.„Meddi bitte ...“
Immer noch nahm ich ihre Umrisse in den Fenstern wahr und wie sie mit gesengtem Kopf da stand. Ihre traurigen Augen, die auf mir lagen. Sie hatte ihre Arme vor der Brust verschränkt und trat von einem Bein auf das andere. Anscheinend fühlte sie sich unwohl in dieser Situation und es war ihr nicht zu verdenken. Ich machte es ihr ja auch nicht gerade einfach, dass sie sich in irgendeiner Weise wohlfühlen konnte. Doch immer noch konnte ich nichts sagen. Ich wollte nichts zu ihr sagen. Meine Worte waren schon lange verstummt und auch Worte konnten mir Tobén nicht wieder zurückbringen.Wieder das leise Quietschen der Tür. Siénah hatte ihre Hand auf den Türgriff gelegt. Sie stand mit dem Rücken zu mir und ihr langer Zopf fiel ihr über die Schulter. Ein Meer aus Schwarz und Blau.„Ich vermisse dich, Meddi.“
Dann hörte ich das mir bekannte Klicken. Die Tür war wieder geschlossen und Siénah verschwunden. Ich drückte meine Stirn wieder fester an die Glasscheibe.Die Kühle prickelte auf meiner Haut. Meine Hand glitt hinterher und traf auf die harte Scheibe. Langsam strich ich hin und her und hinterließ sanfte Spuren. Die beiden Ringe an meinem Finger funkelten im Licht und auch die Linie auf meiner Haut war deutlich zu erkennen. Ich nahm die Hand wieder herunter. Ließ sie auf mein Knie gleiten, wo sie einfach liegen blieb. In einem musste ich Siénah trotzdem recht geben. Ich vermisse mich auch ...
2
Ich war schon wieder wach. Hatte ich schlecht geträumt? Nein. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Dieses Mal nicht. Doch irgendetwas hatte mich geweckt. Plötzlich hörte ich es wieder. Ein lautes Geräusch durchzuckte die Stille. Ein Poltern ging durch die Burg und ich nahm Schreie wahr. Sie mussten aus der Eingangshalle kommen, doch ganz sicher war ich mir nicht. Außerdem waren es verschiedene Stimmen, die zu hören waren und sie waren laut. Wieder hörte ich laute Schreie, doch die Worte waren nicht richtig zu verstehen. Was war hier los? Wurde die Burg angegriffen? Nein. Draußen schien es ruhig zu sein. Nur das Licht des Mondes schien durch die Fenster, doch immer noch waren die dumpfen Geräusche zu hören. Und wieder polterte etwas laut auf.
Sollte ich nachschauen, was da los war? Eigentlich interessierte es mich nicht, doch insgeheim beschlich mich ein schlechtes Gefühl. Ich war immerhin die High Lady. Obwohl ich mich seit Wochen nicht mehr so verhalten hatte, konnte ich dieses starke Desinteresse nicht mit meinem Gewissen ausmachen. Nur kurz nach dem Rechten sehen, das würde mir schon nicht schaden.Ich schwang meine Beine über die Kante des Bettes und griff im Gehen nach meinem Morgenmantel. Weich und geschmeidig legte er sich auf meine Haut. Ein Gefühl, welches ich schon lange nicht mehr gespürt hatte. Wozu auch. Da ich mich nur in meinem Zimmer aufhielt, musste ich keinen Morgenmantel tragen und mich in irgendeiner Weise wohlfühlen. Bis jetzt hatte Tobéns T-Shirt mir gute Dienste geleistet. Doch als ich den Flur vor meinem Zimmer betrat, war ich froh über den Mantel. Ein kalter Wind wehte durch meine Haare und sofort zog ich das Stück Stoff noch enger um meinen Körper. Ich sah das Fenster am Ende des Flures, welches sperrangelweit geöffnet stand, und eine kühle Brise wehte ungehindert hinein. Jemand musste vergessen haben, es zu schließen. Jetzt, wo ich in dem lang gezogenen Flur stand, waren auch die Geräusche deutlicher wahrzunehmen. Sie kamen definitiv aus der anderen Richtung, aus der Eingangshalle. Also trieb ich meinen Körper an. Ich wusste nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal bewegt hatte, so richtig bewegt hatte. Meine Füße schmerzten schon nach wenigen Metern und auch meine Oberschenkel brannten. Das kam davon, wenn man nur im Bett lag oder auf dem Boden saß und sich einfach gehen ließ. Ich ging weiter und blendete den Schmerz aus. Wenn ich mich schon einmal aufgerafft hatte, dann konnte ich auch noch die letzten Meter überwinden.
Die Geräusche wurden immer lauter. Es kam mir vor, als würde jemand die Eingangshalle demolieren, und es wurde immer deutlicher, dass es mehrere Personen waren. Die Geräusche vermischten sich mit mehreren Stimmen und ziemlich viel Hektik herrschte in ihnen. Als ich oberhalb der Treppe ankam, erkannte ich auch endlich, wer da sprach. Ich konnte die Stimmen den einzelnen Personen zuordnen. Trotzdem blieb ich versteckt hinter der Nische stehen. Ich musste sie nicht sehen, um zu wissen, wer es war. Außerdem wollte ich vermeiden, dass sie mich sahen. Eine mögliche Unterhaltung war nicht das, was ich wollte.„Ihr versteht es alle nicht! Und ihr versteht Medina nicht! Euch ist absolut nicht klar, was sie durchmacht ... Was ich durchmache!“Seine Stimme drang überdeutlich an meine Ohren.
So intensiv und energisch und doch spürte ich die Trauer in ihr, die unbändige Wut. Im nächsten Augenblick flog wieder etwas umher. Mit einem lauten Krachen knallte es gegen die Wand. Es musste eine der Vasen gewesen sein, die auf der Kommode standen. Mit einem lauten Scheppern zerbrach sie in tausend Teile.„Ich habe meinen Bruder verloren! Und ich weiß nicht, wo er sich gerade aufhält ... Ja, verdammt! Wir haben alle unseren High Lord verloren, aber das ist nicht das Gleiche, was Medina im Moment fühlt ... Sie hat nicht nur ihn verloren, sondern auch ihren Sohn. Den letzten Teil, den sie von Tobén noch besaß ...“Hatte ich jemals schon so viel Trauer in Philiás Stimme gehört? Nein! Und wenn doch, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. So vieles hatte ich in den letzten Wochen verdrängt. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er mich besser verstand als die anderen. Auch er hatte vor langer Zeit seine erste große Liebe verloren und vielleicht verstand er dadurch mein Schicksal etwas besser. Oder er ließ seinen Frust einfach freien Lauf und hatte es heute Nacht nicht mehr geschafft, sich unter Kontrolle zu halten. Er konnte schnell aufbrausend sein, das wusste jeder, doch so einen Ausraster hatte selbst ich nicht erwartet. Nicht von ihm, sondern eher von mir.„Philiás, Geliebter. Wir müssen sie irgendwie da herausholen. Sie isst kaum bis gar nichts und lässt niemanden an sich heran. Sie ist ganz allein da oben, obwohl sie uns hat, ihre Familie ...“Siénah, mit ihrer sanften und beruhigenden Stimme.
Schon immer hatte sie einen Einfluss auf Philiás, auch vor ihrer Liebe zueinander. Liebe, für die ich sie in diesem Moment beneidete. Noch immer konnten sie sich gegenseitig spüren, in den Armen halten und sich in die Augen schauen. Mir blieb das alles verwehrt.„Aber vielleicht will sie diese Familie gar nicht mehr! Ist dir das schon einmal in den Sinn gekommen? Wir waren ihre Familie, als Tobén noch ein Mitglied davon war! Und als die beiden sich so sehr auf ihren Sohn gefreut haben ... Und jetzt? Wie würdest du dich fühlen an ihrer Stelle, Siénah?“„Ich-ich weiß es nicht ...“Wieder ein Poltern. Dieses Mal hatte es wohl die Kommode getroffen. Holz splitterte und ein lauter Schrei kam aus Philiás Kehle, der selbst mir eine Gänsehaut bereitete.„Philiás, beruhige dich doch. Du weckst noch die ganze Burg. Willst du, dass Medina das hier mitbekommt? Sie würde dir in High Lady Manier den Arsch aufreißen.“Ja, das würde ich, da musste ich Keálas recht geben. Wenn ich in besseren Umständen gewesen wäre, hätte ich Philiás die Hölle heißgemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Wahrscheinlich war meine Lieblingsvase schon längst zu Bruch gegangen und die Kommode hatte mir auch immer sehr gut gefallen.„Dann soll sie es ruhig tun! Dann wüsste ich wenigstens, dass sie ihren Mut nicht ganz aufgegeben hat und dass wir zusammen einen Weg finden würden, um nach Tobéns Körper zu suchen ...“„Philiás, du glaubst doch nicht wirklich, dass Tobén noch am Leben ist ...“Ich hätte am liebsten um die Ecke geblickt, um Philiás Gesicht bei seiner Antwort zu sehen, doch ich traute mich nicht. Ich wollte nicht die Hoffnungslosigkeit in seinen Augen sehen, diesen vernichtenden Blick, der alles noch realer wirken ließ. Und auch seine Antwort hätte ich am Liebsten nicht mitbekommen, doch dafür war es jetzt zu spät.„Es geht mir nicht darum, Siénah. Falls er noch lebt, dann ist es hoffentlich von der Mondgöttin vorherbestimmt, dass wir ihn noch rechtzeitig finden. Aber dieser Mann hat eine richtige Beerdigung, eine Trauerfeier verdient und dafür brauchen wir seinen Körper. Und glaube mir, bevor ich Tobén nicht in meinen Händen halte, werde ich keine Ruhe geben!“Seine Worte taten zugleich gut und machten auch alles noch schlimmer. Ich wusste, dass er recht hatte und dass kaum noch jemand daran glaubte, dass Tobén am Leben war. Ich konnte es niemandem verübeln. Selbst ich glaubte nicht mehr daran. Auch wenn ein Fünkchen in meinem Herzen stetig weiter pochte, mir immer wieder in den Kopf rief, dass er vielleicht noch am Leben war. Den Gedanken schüttelte ich schnell wieder ab. Nicht hier und nicht jetzt. Hoffnung war ein Verräter.„Das ist nicht dein Ernst?“
Ich konnte Siénahs schockiertes Gesicht deutlich vor mir sehen und ihre vor der Brust verschränkten Arme. Ihre übliche Pose, wenn sie etwas nicht ernst nehmen konnte, wenn sie etwas nicht ernst nehmen wollte.„Und wie das mein verdammter Ernst ist! Und wenn ihr mir nicht helfen wollt und Medina mir nicht helfen will, mache ich es halt allein!“
Schnelle, schwere Schritte hallten durch den Flur, dann wurde eine Tür aufgezogen und mit einem lauten Knall wieder geschlossen. Philiás musste aus dem Burgtor gestürmt sein und dabei hatte er die anderen einfach stehen gelassen. Wahrscheinlich war das besser für die Einrichtung. Es war mir nicht egal, dass er die Halle zerstört hatte, und ich würde ihm dafür noch die Hölle heißmachen, darauf konnte er sich verlassen, doch nicht heute. Er war zu aufgewühlt und ich war es definitiv. Es würde nur eskalieren und wahrscheinlich zum Tode führen und diese Anstrengung war mir deutlich zu viel. Ich wollte einfach nur wieder in mein Bett, mich weiter in meiner Trauer suhlen, also drehte ich mich wieder in den Flur und ging die ersten zwei Schritte, als ich jemanden an der Wand lehnen sah.„Auch ich bin durch Philiás nächtliche Störung wach geworden. Es war ja nicht zu überhören. Dass du dich dafür aus deinem Zimmer wagst, damit hätte ich nicht gerechnet. Es scheint dir doch nicht alles egal zu sein ...“Er war immer noch hier? Das hatte ich nicht gewusst.
Aber woher auch. Ich redete ja mit niemandem und sehen wollte ich auch niemanden. In meiner Trauer war ich davon ausgegangen, dass er gegangen wäre, zusammen mit seinem Volk, um sein Königreich neu aufzubauen. Auch die Riesen hatten Verluste in dem Kampf erleiden müssen und nachdem sie das Elládan-Gebirge wieder zurückerobert hatten, hatten sie dort genügend Aufgaben zu erledigen. Unwillkürlich landete mein Blick auf seinem Gesicht. Seine Augen fixierten mich und schienen nach mehr zu verlangen, als sie es tun sollten. Dieses Verlangen in ihnen war nicht in Ordnung, trotzdem blickte ich unverfroren zurück in seine schönen gelben Augen. Er war immer noch ein hübscher Mann. Das war mir bei unserer ersten Begegnung schon bewusst gewesen und doch war er einfach nur ein Freund, ein Teil der Familie, die wohl nicht mehr zu existieren schien. Meine Beine trugen mich weiter und stumm lief ich an ihm vorbei. Mein Blick heftete sich nach vorne. Ich wollte nicht, dass er mich so sah, dass irgendjemand mich so sah, und wieso sollte ich mich ausgerechnet mit Moérs unterhalten, wenn ich es sonst mit niemandem tat.
„Du ziehst das mit der unendlichen Trauer echt durch. Mit niemandem zu reden wird dich nicht weiterbringen, Medina. Wo ist dein Mut? Dieses unbändige Feuer, welches ich an dir vergöttert habe ...“Ich ging einfach weiter. Sollte Moérs doch seine Reden schwingen, mir war es egal. Er sollte mich in Ruhe lassen und sich lieber um seine Angelegenheiten kümmern. Er konnte mir nicht weismachen, dass er nichts Wichtigeres zu tun hatte, als hier herumzulungern und mir dumme Sprüche an den Kopf zu werfen. Ich bog um die nächste Ecke und sah schon die Tür zu meinem Zimmer, doch dann hielt mich etwas auf. Moérs, der mit seiner Hand meinen Arm hielt. Er drückte nicht feste, sein Griff war aber stark genug, um mich zurückzuhalten. Ich sah ihn nicht an, starrte weiter stur auf den Boden vor meinen Füßen.
„Glaubst du wirklich, er hätte das gewollt? Er hat sein Leben gegeben, damit du weiterlebst und nicht, damit du dich selber fertigmachst und aufhörst zu leben! Er würde sich für dich schämen, Medina. Und auch ich schäme mich. Dass du so schwach bist, hätte ich niemals erwartet!“Er ließ meinen Arm los und ein leichtes Kribbeln zog sich über meine Haut, dann war Moérs auch schon in der Dunkelheit des Flures verschwunden. Ich war wieder allein, wie in den letzten Wochen auch, doch ich stand weiterhin wie angewurzelt da. Ich spürte die warmen Tränen auf meinem Gesicht, die sich den Weg hinunter bahnten. Moérs war ein Idiot und schon immer ein überheblicher Kerl gewesen, doch seine Worte hatten gesessen, eindeutig. Er hatte die kleine Stelle getroffen, die am meisten schmerzte, und ich war mir sicher, dass Moérs genau das beabsichtigt hatte. Er wollte mich nicht verletzten, er wollte an meine Gefühle appellieren, und insgeheim wusste ich, dass er recht hatte.
***
Die restliche Nacht machte ich kein Auge mehr zu. Zu sehr hatte mich das Ganze aufgewühlt. Philiás unbändige Wut, seine enorme Trauer und dann die Begegnung mit Moérs. Seine harten Worte, die mich getroffen hatten. Auch wenn ich es nicht gerne zugab, aber die Wahrheit tat weh und Moérs hatte mit allem recht gehabt. Ich verhielt mich wie ein dummes Kind. Meine Trauer übermannte mich jeden Tag aufs Neue. Doch ich wusste einfach nicht damit umzugehen. Wie auch! Noch nie in meinem Leben hatte ich so etwas erlebt, noch nie war ich mit so viel Hass und Wut konfrontiert worden, und dann diese unendlichen Schmerzen, die sich einfach nur in Trauer verwandelten. Der seelische Schmerz war schlimm, der körperliche Schmerz kam noch hinzu. Immer wieder spürte ich das Brennen meiner Narbe, die wohl noch einige Wochen brauchte, bis sie einigermaßen verheilt war. Verschwinden würde sie nicht, da war ich mir sicher. Diese Erinnerung würde ich mein Leben lang tragen und das machte es auch nicht besser. Die Entscheidung, das mit mir alleine durchzustehen, war nicht fair, nicht fair den anderen gegenüber. Meine Familie, mit der ich schon so einiges durchgestanden hatte, ließ ich einfach im Stich, doch ich konnte einfach nicht anders. Ich wusste nicht damit umzugehen, ich würde niemals mit so etwas umgehen können. Das Ganze war einfach zu viel für mich. Ich hatte Tobén verloren und seinen Sohn, unser Kind. Ich hatte das nicht gewollt und jetzt war es einfach zu spät. Niemand konnte irgendetwas rückgängig machen. Niemand konnte mir helfen, das zurückzubekommen, wonach ich mich so sehr sehnte. Ich sah dem Mond entgegen, der langsam am Horizont verschwand, und insgeheim verfluchte ich ihn. Nein! Meine Wut galt jemand anderem. Der Mondgöttin, die mir dieses Leben auferlegt hatte. Sie war daran schuld. Daran, dass es mir jetzt so schlecht ging, dass ich alles gehabt hatte und nun mit leeren Händen da stand. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, dann würde ich es tun. Sollte sie sich doch eine andere Seele suchen. Warum ausgerechnet meine? Ich hatte ein tolles Leben geführt. Meine besten Freundinnen an meiner Seite, einen Abschluss in Kunst und Design. Ich hätte in einem Museum arbeiten können oder selbst eine kleine Galerie geführt. Lenox wäre ich niemals begegnet und in Tobén hätte ich mich dann auch nicht unsterblich verliebt. Niemals hätte ich so einen Schmerz spüren müssen, wie ich es in diesem Moment tat. Ich wäre einfach nur Medina gewesen, ein Mensch und nicht die Retterin, die kläglich versagt hatte. Von vornherein hätte ich wissen müssen, dass ich für dieses Leben einfach nicht gemacht war. Kämpfen, töten und Kriege führen. Nein! Ich spürte wieder die heißen Tränen auf meinem Gesicht und den Schmerz in meiner Brust.
Innerlich ohrfeigte ich mich für diese Gedanken. War das wirklich ich? Nein, das konnte nicht sein. Hätte ich Lenox nicht getroffen, wüsste ich nichts über wahre Liebe. Erst durch ihn erfuhr ich, wie es sich anfühlte zu lieben und auch lernte ich das Gefühl kennen, das jemand fühlte, dessen Liebe nicht erwidert wurde.
Ich hätte Philiás und Siénah niemals kennengelernt, Carrán oder Keálas. Niemals hätte ich diesen magischen Ort zu Gesicht bekommen. Lyvián, das Land, in dem ich meine Heimat gefunden hatte, wo ich mich zu Hause fühlte und ich einfach nur glücklich gewesen war. Dank der anderen und vor allem dank Tobén. Er hatte mir immer Mut zugesprochen, mich in allem bestärkt und mir gezeigt, dass man Vertrauen und Hoffnung haben musste, auch wenn die Vergangenheit umso schlimmer gewesen war. Er war der Fels in der Brandung gewesen, er war mein Fels in stürmischen Zeiten, und so früh Abschied nehmen zu müssen, war nicht fair. Es war einfach nicht fair. Auf so etwas war ich nicht vorbereitet gewesen und wahrscheinlich war es deswegen auch so schlimm für mich. Vielleicht war ich auch einfach zu naiv gewesen. Ich hatte doch tatsächlich gedacht, dass wir es locker mit Leopas aufnehmen könnten, vor allem, da wir die Talismane besaßen und es sogar geschafft hatten, sie am Ende doch noch zu verbinden. Doch auch das hatte uns nicht weitergebracht. Leopas lebte. Tobén und Lenox waren tot und ich enttäuschte sie beide. Ich schlug mir die Hände vor das Gesicht, womit ich irgendwie diesen Schmerz verdrängen und die Tränen aufhalten wollte, doch sie flossen einfach ungehindert weiter. Ich musste hier heraus, wollte einfach nur noch weg von hier. Dieses Zimmer hing mir zum Halse raus. Es fühlte sich an, als könnte ich nicht mehr atmen, als würden meine Lungen den Dienst verweigern. Ruckartig war ich auf den Beinen. Wie von Sinnen, als hätte mich irgendetwas gestochen. Im Vorbeilaufen schnappte ich mir meinen Morgenmantel und schon war ich durch die Tür gelaufen. Ich nahm nichts mehr um mich herum wahr. Meine Beine trugen mich immer weiter. Ich lief so weit und so schnell ich nur konnte. Frische Luft, das war es, was ich jetzt brauchte. Ich schwang mich die Treppe hinunter und nahm mehrere Stufen gleichzeitig. Nur schemenhaft nahm ich die zerstörte Kommode wahr, die Holzsplitter auf dem Boden und die zertrümmerten Vasen. Philiás hatte ganze Arbeit geleistet, das musste ich ihm zugestehen. Doch jetzt war nicht die Zeit darüber nachzudenken. Zielstrebig ging ich auf die große Glastür im hinteren Teil der Halle zu. Ich stieß sie mit voller Wucht auf. Noch immer rannte ich schnell wie der Wind, bis ich nicht mehr konnte und meine Beine unter mir nachgaben. Meine Knie trafen auf den Boden. Nässe und Schlamm krochen meine Glieder hoch, grüne Grasflecken bildeten sich auf meiner Hose, doch das war mir egal. Ich warf meinen Kopf in den Nacken und atmete die frische, kühle Luft ein. Meine Lungen füllten sich immer mehr mit der wohltuenden Substanz. Der Mond schien ununterbrochen auf mich nieder und gab den Blick auf die wunderschöne Natur um mich herum frei. Dieser Garten war seit dem ersten Tag meine Zuflucht gewesen. Schon damals, bei meinem ersten Besuch hier. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit her an. Tobén hatte mich zu sich eingeladen, mir dieses Bündnis regelrecht aufgezwungen, und ich hatte es gehasst. Blind wie ich war, hatte ich es ohne zu zögern angenommen, um Carrán das Leben zu retten. Ich hatte mich dem Feind in die Arme geworfen, so dumm und naiv wie ich war. Und dann kam alles anders. Tobén war meine Rettung gewesen. Ich hatte mich unsterblich in ihn verliebt. Seitdem hatten wir nicht mehr als ein paar Tage getrennt voneinander verbracht. Und jetzt waren es bereits mehrere Wochen. Alles hier erinnert mich an ihn ... Egal wohin ich ging, Tobén war immer da, und manchmal glaubte ich sogar seine Wärme zu spüren, seinen Duft zu riechen oder seine wunderschönen Augen direkt vor mir zu sehen. Doch das waren nur Erinnerungen, an die ich mich so festklammerte, wie es nur ging, und die sich viel zu oft viel zu sehr mit der Realität vermischten.
- Deine Seele wandert umher und findet keine Ruhe, weil du ihr versuchst, etwas vorzumachen ...Ich erschrak so sehr, dass ein quietschender Laut aus meinem Mund kam. Eine Stimme in meinem Kopf zu hören, war mir fremd geworden, doch ich war selbst schuld. Ich hatte Falingeár neben mir nicht eine Sekunde wahrgenommen und doch sah ich ihn jetzt ganz deutlich, wie er ein paar Meter von mir entfernt auf der Wiese lag, der Schein des Mondes über seine Schuppen strich und sie zum Glänzen brachte. Seine Augen waren weiterhin geschlossen und sein Kopf ruhte sanft auf einer seiner Pranken. Er sah in diesem Moment unglaublich friedlich aus, als wäre er kein mächtiger Drache, keine mächtige Waffe.
- Ich höre deine Gedanken, kleine Lady. Ich höre sie klar und deutlich. Jeden Tag ...Ich hatte es geahnt und in diesem Moment tat es mir leid, dass ich ihm meine Trauer aufgedrückt hatte, ohne ihn zu fragen, ob er es erlaubte. Ich hatte meine Barriere fallen lassen und jedem in meiner Umgebung alles von mir preisgegeben, weil es mir egal gewesen war. Ich war sauer auf mich, dass ich nicht darüber nachgedacht hatte. Vielleicht hatte ich es insgeheim aber genau so gewollt. Jemand hatte mich hören sollen, meine Gedanken und mir trotzdem meine Ruhe lassen sollen, weil ich nicht imstande war, irgendetwas laut auszusprechen.
„Hast du dich deswegen keinen Meter von meinem Fenster wegbewegt?“Vorsichtig öffnete er eins seiner Augen. Das helle Grün leuchtete mir entgegen und traf mich mit voller Wucht.
- Einst hast du mir das wertvollste Geschenk gemacht und mich aus meinem Gefängnis gerettet. Dich zu beschützen und an deiner Seite zu stehen ist nur ein kleiner Teil davon, was ich dir zurückgeben will ...Ich blickte noch immer in seine Richtung, in sein großes Auge, und auch hier erkannte ich die Trauer. Die Sehnsucht nach etwas, dass uns allen fehlte.„Ich ... Ich will das nicht!“
- Zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun, liegt oft nur ein schmaler Grat. Und ich glaube dir nicht, dass du allein sein willst, kleine Lady.Ich schüttelte hastig den Kopf. Nein! Er konnte nicht wissen, was ich wollte. Falingeár konnte gar nichts wissen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er die gleiche Masche versuchte wie Moérs.
- Du hast Angst, dass eine neue Hoffnung in dir aufkeimen könnte, sobald du jemanden an dich heranlässt. Die Hoffnung, seinen Körper und somit auch ihn wiederzufinden. „Was soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht ...“Noch einmal ließ Falingeár eine kleine Rauchwolke aus seinen Nüstern steigen. Dann ließ er sein Auge langsam wieder zu fallen, als würde er schlafen, doch seine Stimme war weiterhin deutlich in meinem Kopf zu hören und was ich da hörte, konnte ich unmöglich glauben.
- Deine Seele ist unruhig, weil sie genau weiß, dass er noch irgendwo da draußen ist, gefangen in seinem Körper, aber lebend. Du solltest nicht zu lange zögern, sonst wirst du ihn vielleicht niemals wiederfinden ...
3
Dieses Gefühl tief in meinem Inneren hatte sich eingenistet. Die Hoffnung, dass Tobén wirklich noch am Leben war. Es war ganz klein, doch das reichte schon aus, um mich in Aufruhr zu versetzen. In mir rumorte es, meine Gefühle, meine Gedanken, alles spielte verrückt. Es musste stimmen, doch ich wusste absolut nicht, woher ich diese Hoffnung jetzt auf einmal nahm. Vielleicht lag das ganz allein an Falingeár und seinen Worten, vielleicht hatte sich aber auch ein Schalter in meinem Kopf umgelegt. Irgendetwas sagte mir, dass die Möglichkeit wirklich bestand, dass Tobén noch lebte. Irgendwo musste er sein. Auch wenn ich es bis jetzt versucht hatte zu verdrängen, Falingeár hatte diese Tür wieder geöffnet. Er hatte in dem Moment nicht viel getan, doch seine Worte hatten einfach alles verändert.
Immer wieder tauchten sie in meinem Kopf auf, ernst und drängend, und jede Sekunde fiel es mir schwerer, nicht daran festzuhalten. Er muss doch irgendwo sein ...
Ja! Er konnte nicht einfach verschwunden sein, einfach so, ohne sich richtig verabschiedet zu haben. Das hätte er mir niemals angetan. Dafür hatte Tobén mich zu sehr geliebt, liebte mich hoffentlich immer noch. Auch hätte er niemals seine Freunde im Ungewissen gelassen, das war einfach nicht seine Art. Tobén, wo bist du nur? Eine leichte Brise wehte durch das offene Fenster, flog mir sanft durch mein Haar und spielte damit. Für einen Moment ließ es mich alles vergessen. Wo ich war und wer ich war. Ich schloss ganz vorsichtig die Augen, um den Moment kurz zu genießen und horchte tief in mich hinein. Meine Magie war deutlich zu spüren, tief in mir und ganz sachte. Ich sah sie, wie sie rot schimmerte und hinter der unsichtbaren Barriere von Keálas Zauber gefangen war. Undurchdringbar, unmöglich an sie heranzukommen, und natürlich fehlte noch etwas anderes. Kein grüner Funke sprang umher, kein Gefühl der puren Freude war zu spüren. Ich vermisste es so sehr, vermisste ihn. Unser Sohn ... Seine Magie war schon lange verflogen und ewig hatte ich nicht mehr nach ihm gesucht oder versucht mich an das Gefühl zu erinnern. Er fehlte mir. Ich hatte ihn zwar nie kennengelernt, aber das war egal. Seine Magie in mir und zu wissen, dass er da war, in mir heranwuchs. Das hatte vollkommen ausgereicht, um sich in jemanden zu verlieben, den man nicht kannte. So musste es wohl für jede Mutter sein, die sehnsüchtig auf ihr Kind wartete, und für mich war es genau so gewesen.
Meine Augen öffneten sich und mein Blick traf wieder auf den Himmel. Dunkel lag er vor mir und der Mond leuchtete hell. Er ließ die Umgebung für meine Augen sichtbar werden, doch mein Kopf dröhnte. Es war ein unangenehmes Gefühl. Ich drückte meine Hände an meine Schläfe und versuchte, den Druck damit zu verdrängen, als sich ein Bild vor meinem inneren Auge formte.
Alles fühlt sich hier so weich an wie eine große Wolke, die sich sanft um meinen Körper legt.Ich spüre nichts, außer diese Leichtigkeit um mich herum und direkt in mir. Alles scheint hier gut zu sein und ich fühle mich unglaublich. Meine Haut ist so weich und ich spüre jede Faser meines Körpers.Ganz alleine bin ich hier in dieser Leichtigkeit.Nur Schwärze und Stille um mich herum, doch irgendetwas fehlt mir. Ich spüre es deutlich und ganz tief in meinem Herzen. Irgendetwas ist verschwunden und mein Herz ruft danach. Nein, viel mehr ist es irgendjemand. Sie! Die Liebe meines Lebens, die Frau, die mich gerettet hat. Ich vermisse sie, als würde ich nicht mehr ohne sie leben können. Dieses Verlangen, in ihren Armen zu liegen und sie zu berühren.Mein Verlangen nach ihr ist so groß. Ich liebe sie, doch sie ist nicht hier, nicht hier bei mir. Keiner ist hier bei mir und es wird auch keiner kommen. Ich bin ganz allein in dieser weichen Wolke und schwebe einfach nur umher. Es gibt nichts, worüber ich mir Sorgen oder Gedanken machen muss. Dieses Gefühl, einfach nur zu schweben und zufrieden zu sein, fühlt sich wie ein Traum an. Ich könnte mein Leben lang nur diesen einen Traum haben und ich wäre zufrieden. Mehr brauch ich gar nicht, um mich glücklich zu fühlen.Doch ich weiß, dass es kein Traum ist. Ich bin wirklich hier. Die Leichtigkeit legt sich noch enger um meinen Körper und verdrängt alle schlechten Gefühle. Langsam gleite ich weiter und denke an nichts.Ich bin glücklich ...
Wie von Sinnen schlug ich die Augen auf.
Eine Vision! Von ihm! Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte. Wieder und wieder rief ich mir das Bild vor meine Augen. Ich hatte ihn nicht sehen können, nur die totale Finsternis und leichte Schatten, die immer wieder aufgeflackert waren. Seine Stimme hatte ich dafür deutlich erkennen können. Unter Tausenden hätte ich sie erkannt. Er war es, da war ich mir ganz sicher, doch es war ein komisches Gefühl, jetzt so eine Vision gehabt zu haben. Noch vor ein paar Tagen hätte mich dieses Ereignis komplett aus der Bahn geworfen. Tobén lebte! Irgendwie und irgendwo. Mehr wusste ich nicht. Mein Herz schlug heftig gegen meine Brust. Ich konnte nicht mehr still sitzen bleiben. Meine Beine trugen mich, während ich durch das Zimmer lief. Hin und her, ohne wirklich zu wissen, was ich da tat. Was sollte ich jetzt tun? Er war am Leben, das spürte ich umso deutlicher, nachdem ich seine Stimme gehört hatte. Wo war er? Wo sollte ich suchen? Ich hatte keinen Anhaltspunkt. Gar nichts. Ich musste doch etwas tun können. Nicht umsonst hatte ich diese Vision gehabt. Irgendwo musste ich doch anfangen zu suchen. Ich konnte nicht länger hierbleiben, nicht länger hier herumsitzen. In diesem Moment faste ich einen Entschluss. Schnell lief ich in das Ankleidezimmer und schnappte mir meine Hose und ein Oberteil. Ich spürte den weichen Stoff auf meiner Haut und jetzt merkte auch ich zum ersten Mal die Veränderung, die nicht nur mein Geist, sondern auch mein Körper durchgemacht hatte. Er war nicht mehr der Alte. Ich hatte an Gewicht verloren und das nicht zu wenig. Die Hose saß locker auf meiner Hüfte und das Oberteil sah aus wie ein Sack. Das war überhaupt nicht gut. Mein Körper würde so nicht mehr lange mitmachen. Was hatte ich mir nur angetan? Ich erkannte mich selber nicht wieder. Meddi, das muss aufhören ...
Ja! So ging es nicht weiter. Ich konnte und durfte meinen Kopf nicht länger in den Sand stecken. So schwach war ich nicht zu gebrauchen, vor allem nicht jetzt, wo ich endlich wieder eine Aufgabe hatte. Ein Ziel. Ich wollte Tobén finden und ihn wieder zurückholen, zurück zu mir und seiner Familie. Schon oft hatte ich mich geirrt und war auf dem Boden der Tatsachen gelandet, doch dieses Mal würde das nicht passieren. Noch immer konnte ich es nicht beschreiben, wieso ich mich in diesem Moment so unglaublich stark und kraftvoll fühlte. Ich hatte nichts in der Hand und rannte einfach ins offene Feuer, doch ich musste es einfach tun.
Ich schnappte mir die dünne, schwarze Weste und hohe Stiefel, die sich um meine Füße schmiegten. Und dann schwang die Tür vor mir auf. Wie von selbst trugen mich meine Beine über den langen Flur, die Treppe hinunter und durch die Eingangstür direkt auf den Burghof.
***
Amathá schnaubte unter mir, wieder und wieder und in einem stetigen Rhythmus. Ihr Herz pochte wie wild, genau so wie meines. Sie war gerannt. Die ganze Zeit hatte sie ein Bein vor das andere geworfen und war über die Ebene geflogen wie ein wild gewordener Orkan. Ich hatte sie nicht einmal antreiben müssen. Sie wusste anscheinend, worum es ging und auch wenn ich das Ziel nicht kannte, war sie immer weiter gerannt. Doch langsam ging ihr die Puste aus und mir auch. Ich ließ mich zurück in den Sattel fallen und parierte sie damit zu einem ruhigen Schritt durch.
„Alles gut, mein Mädchen. Wir sind weit gekommen, gönnen wir uns eine Pause.“
Ich ließ mich von ihrem Rücken gleiten und führte sie an den Zügeln zum Fluss. Die ganze Zeit hatte er sich neben uns lang geschlängelt und noch immer glitzerte er im fahlen Licht des Mondes. Die Sterne spiegelten sich in seiner Oberfläche und alles um mich herum sah wie aus einem Traum aus. Amathás Schnauze traf auf das kühle Nass und sie ließ ein zufriedenes Schmatzen hören. Auch ich tunkte meinen Wasserschlauch hinein und nahm mehrere Schlucke auf einmal. Es tat unglaublich gut, die Kühle auf meiner Zunge und in meinem Hals zu spüren. Das Adrenalin aus meinem Körper verschwand langsam wieder und ganz vorsichtig ließ ich meinen Blick umherschweifen. Wie lange wir geritten waren, wusste ich nicht. Ich hatte mich auch gar nicht darum bemüht, es herauszufinden und war einfach nur meinem Herzen gefolgt, doch es musste einige Zeit vergangen sein. Der Mond senkte sich bereits dem Boden zu. Nicht mehr lange, dann würde die Sonne ihn von seiner Aufgabe ablösen.