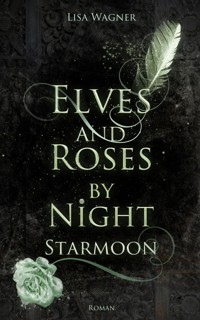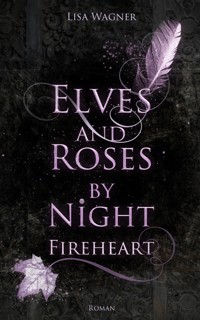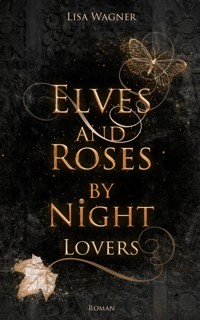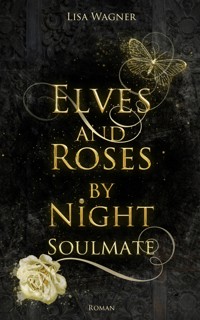Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fast-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Wir alle verdienen eine Zukunft, in der wir die Vergangenheit hinter uns lassen können! Selbst sie verdient es! - Thórvi hatte die Qualen ihres Körpers überstanden, doch ihr Herz war abermals in tausend Teile gerissen worden. Obwohl sie am liebsten wieder in die Höhle ihrer inneren Zuflucht gekrochen wäre, gab es die Mission, die auf sie und ihre Gefährten wartete. Doch die Reise hielt weitere Probleme für sie bereit, gegen die sich nicht nur Thórvi stellen musste. Wie lange konnten sie Lyvián und die geretteten Völker sich selbst überlassen? Was würden sie in der fremden Welt erleben? Könnte die Gruppe das goldene Himmelswerk finden und Hjerdíz damit das Handwerk legen? Und was war mit Hawke? In dem unendlichen Chaos musste Thórvi begreifen, dass der wunderschöne Mann an ihrer Seite derjenige war, der sie vollkommen machte und ihr Herz höherschlagen ließ. Band 3 der magischen Fire and Souls tonight-Reihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Überlebenskünstlerinnen. Für die starken Heldinnen.
Für die Mütter, für die Frauen.
Für Mama. Für Shanice.
Für Elli und Sabine.
Für die wahren Mutigen unter uns.
Steht auf, richtet eure Kronen, und kämpft weiter!
Die folgenden sexuellen und Gewalt aufzeigenden Inhalte können auf Leserinnen und Leser verstörend wirken. Es werden explizite sexuelle Momente deutlich und im Detail beschrieben. Bitte denkt immer daran, dass der folgende Inhalt meiner Fantasie entstammt und keine realen Augenblicke zeigt, die ich oder jemand anderes erlebt hat.
Inhaltsverzeichnis
VÖLKER UND NAMEN
PROLOG
KAPITEL EINS
THÓRVI
DAYMÓN
KAPITEL ZWEI
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL FÜNF
DAYMÓN
THÓRVI
DAYMÓN
KAPITEL SECHS
THÓRVI
DAYMÓN
KAPITEL SIEBEN
ACHT TAGE SPÄTER
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL ACHT
DAYMÓN
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL NEUN
DAYMÓN
KAPITEL ZEHN
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL ELF
DAYMÓN
THÓRVI
DAYMÓN
KAPITEL ZWÖLF
THÓRVI
KAPITEL DREIZEHN
DAYMÓN
KAPITEL VIERZEHN
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL FÜNFZEHN
DAYMÓN
KAPITEL SECHZEHN
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL SIEBZEHN
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL ACHTZEHN
DAYMÓN
KAPITEL NEUNZEHN
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL ZWANZIG
THÓRVI
KAPITEL EINUNDZWANZIG
DAYMÓN
THÓRVI
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
DAYMÓN
THÓRVI
DAYMÓN
THÓRVI
EPILOG
ZWEI JAHRE SPÄTER
VÖLKER UND NAMEN
Nachtelfen
Thórvlyn Blackthorn
-
Tzohrv-lin/Tzhor-wie
Daymón Szinárdín
-
Dei-men Zienar-den
Thylion Blackthorn
-
Thü-lion
Thalia Blackthorn
-
Tzah-lia
Medina Blackthorn
-
Me-di-na/Me-die
Tobén Blackthorn
-
Toh-ben
Gildá
-
Gil-dei
Garrow
-
Ger-roh
Loóna
-
Luh-na
Faolán
-
Fao-len
Rayánne
-
Rei-en
Philiás
-
Fili-jäs
Connáh
-
Kon-nei
Siénah
-
Zieh-en-nah
Elfen
Carrán
-
Kar-rein
Melody
-
Mel-odie
Ronán
-
Ruh-nen
Fréya
-
Frei-jah
Rueth
-
Ruh-ß
Maéron
-
Me-ron
Druiden
Keálas
-
Kiel-li-es
Endovíer
-
En-do-wir
Riesen
Chará
-
Ka-rah
Deégan
-
Die-gen
Maghnus
-
Mag-nuß
Ráihn
-
Rei-n
Meerwesen
Nephíles Szinárdín
-
Ne-fie-les Zienar-den
Ménelaos Szinárdín
-
Mieneh-laos Zienar-den
Gréycia
-
Gries-ja
Édessa
-
Ih-deßa
Nikósz
-
Nie-kosch
Dexter
-
Dex-ter
Lyrisches Volk
Hawke Greyborn
-
Hoh-k
Séron Dento
-
Sie-ron
Yvaná
-
Jieh-wa-nei
Geroh
-
Gier-roh
Schattenwölfe
Méave
-
Mie-wah
Fhongan
-
Fon-gahn
Dhjaná
-
Die-janah
Béal
-
Bie-hl
Breack
-
Brie-k
Ínnogen
-
Ih-no-gien
Cianná
-
Zie-jan-ie
Sonstige
Glyn
-
Glin
Sloan
-
Slo-ehn
Eydána
-
Ih-dena
Kasimyr
-
Ka-si-mür
Grimmáir
-
Grim-mjir
Ásta
-
Ie-sta
Hjerdíz
-
Jer-dis
Beahron
-
Bier-ron
Nazhár
-
Nah-sier
Logán
-
Loh-gien
Satan
-
Sa-tan
Goldéra
-
Gol-di-ra
Jupíter
-
Juh-pe-tier
Súrhja
-
Sür-ja
Marjón
-
Mar-jien
Aídan
-
Ieh-denn
Bróhck
-
Brou-k
Cadíff
-
Ka-deff
Orte
Lyvián
-
Lüh-wian
Anduvár-Fluss
-
An-du-wiar
Dragongóul-Berg
-
Dra-gon-guhl
Elládan-Gebirge
-
El-ja-den
Thierim
-
Tzi-rim
Therren
-
Tzer-ren
Éldem
-
Iel-dem
Merédyn
-
Meri-dün
Delhyá
-
Del-jia
Gréyven
-
Grie-wen
Nadhíla
-
Nat-jilah
Tempel Midháan
-
Mida-an
Splítterberge
-
Schplie-tahr-berge
PROLOG
Daymón rannte durch die Flure. Sein Atem kam in einem tiefen Röcheln aus seiner Kehle. Die nackten Füße flogen über den kratzigen Marmor, während der kälter werdende Körper in seinen Armen schlaff an seine Brust gedrückt wurde. Schweiß rann über sein Gesicht und die gerötete Haut und vermischte sich mit den Tränen, die ihm unkontrolliert über die Wangenliefen.
Alles in Daymón schrie, dass er schneller rennen sollte. Dass er dringend jemanden brauchte, der die Frau in seinen Armen rettete.
Hilf mir!
Du musst mir helfen, Daymón!
Ihre verzerrte Stimme hallte bei jedem Schritt durch seine Gedanken. Sein Puls raste und grau wirkende Farben rauschten an seinen glasigen Augen vorbei, während Daymón immer schneller lief und die Stahltür direkt vor sich fixierte. Er spürte, dass sich in dem riesigen Raum jemand befand, der ihm helfen konnte. Er musste nur durch diese Tür laufen.
Ich sterbe, Daymón!
Müsste er nicht den Körper fest an sich drücken, hätte er sich die Hände auf die Ohren geschlagen, um die Stimme in seinen Gedanken zu verdrängen. In diesem Moment, als Thórvi ihn flehend angeblickt und die zarten Worte ausgesprochen hatte, war sein Körper in tausend Teile gesplittert. Sein Herz war aus seiner Brust gesprungen, und dann war die ängstlich wirkende Frau in seinen Armen zusammengebrochen.
Seitdem wusste Daymón nicht, was er tun, denken oder sagen sollte. Vor wenigen Augenblicken hatte er noch mit ihr gesprochen, war wütend auf sie gewesen und aus ihrem Zimmer gestürmt. Jetzt lag sie bewusstlos in seinen Armen und kämpfte erneut um ihr Leben. Er hasste das Gefühl der Hilflosigkeit. Nicht zu wissen, ob ihm jemand helfen oder was er tun könnte, machten die quälenden Minuten, die er rannte, noch unerträglicher. Was war mit der Frau, die er liebte, passiert? Welch dunkle Magie war auf sie eingeprasselt und machte ihr den Kampf um ihr Leben so schwer? Daymón konnte keinen klaren Gedanken fassen, als sich das verzerrte Gesicht der Zauberin in seinen Kopf schob, die in diesem Moment triumphierend lächeln müsste.
Hjerdíz hatte ihr Ziel erreicht.
Sie hatte sich ihre Macht zurückgeholt, das Land an sich gerissen, gegen das sie so viel Hass empfand, und nun hatte sie sich ebenfalls ihre Rache an Thórvi genommen. Oder war dieser Schlag gegen ihn selbst gerichtet? Hatte die Zauberin ihn damit brechen wollen? Wollte sie ihn somit von innen heraus zur Kapitulation zwingen?
In diesem Moment flog der Meermann durch die Tür und kam abrupt zum Stehen, als ihn die Blicke der Umstehenden trafen und sich ein leichtes Raunen und Tuscheln durch den Raum schlichen. Einige Gesichter, die er keinen Namen zuordnen konnte, drehten sich dem aufgewühlten Prinzen zu, doch das war ihm egal. Ebenfalls interessierte es Daymón nicht, dass er in einem zerknitterten Hemd und mit rot geräderten Augen vor ihnen stand. Thórvis Anblick war das Einzige, was durch seine Gedanken schwebte und seinen Körper zum Zittern brachte.
»Hilfe!«, kam es in einer Mischung aus Flehen und Husten aus seiner Kehle, bevor er sich erschöpft zu Boden gleiten lassen musste. Seine Knie kamen auf dem Marmor unter ihm auf und schickten einen brennenden Schmerz durch seine Muskeln, doch das hielt ihn nicht davon ab, die Frau an seiner Brust fester an sich zu drücken. Er klammerte sich in ihre Haut, konnte den Geruch ihres Parfüms überall an ihm wahrnehmen, bevor er sich erneut an die Meute richtete. »HILFE!«, schrie er, und seine Stimme hallte an den Wänden des geräumigen Thronsaals wider.
Endlich kam Bewegung in die versteinerten Körper. Schritte wurden deutlich, einige Personen wurden zur Seite gedrängt, während sie ihre Augen nicht von dem Anblick nehmen konnten. Zuerst konnte er Dexter spüren, der hinter ihm angelaufen gekommen war und nun ebenfalls auf den schlafenden Körper von Thórvi blickte. Und dann fühlte Daymón seit Langem eine Wärme über seine Haut laufen, als ihm eine schmale zitternde Hand an die Wangegelegt wurde.
»Was ist passiert?«, fragte Medina, die immer deutlicher zum Vorschein kam. Die High Lady hatte sich ebenfalls auf die Knie fallen lassen, eine Hand Daymón gereicht und die andere auf die Stirn ihrer Tochter fallen lassen. Ein weiterer Körper drängte sich in das Bild, als der High Lord sich neben seine Frau fallen ließ und ganz langsam den Körper aus Daymóns Armen nahm.
Der Prinz konnte durch das Dröhnen in seinem Kopf hören, wie jemand nach dem Magier schicken ließ, und spürte weitere Personen näher treten. Da war Connáh, der sich die Hand vor den Mund halten musste und ebenfalls mit Tränen zu kämpfen hatte. Ronán und seine Schwester. Er spürte die Wut in Chará aufkeimen, und dann erinnerte er sich an die Worte, die Medina zu ihm gesagt hatte. »I-ich weiß es n-nicht ... Ihre Hand war bereits schwarz, als ich sie gefunden habe, und dann ist sie zusammengebrochen.«
Ein dankendes Lächeln zog sich über die Lippen der High Lady, bevor sie sich ihrem Mann zuwendete und ihre Augen abwechselnd von ihm zu ihrer Tochter huschten.
»LASST DAS!«, brüllte Daymón so ungehalten, sodass er das kurze Zucken in ihren Körpern erkennen konnte. »Haltet mich nicht zum Narren und sagt mir, welche Vermutungen ihr in euren Köpfen hin und her sendet!« Er wusste, dass seine Nerven brachlagen. Dass er es in normalen Umständen niemals gewagt hätte, so mit Medina und Tobén zu sprechen. Doch das hier war alles andere als gut.
Thórvi lag im Sterben.
Und Daymón hatte es zugelassen.
Doch bevor Medina ihm antworten konnte, stürmten zwei weitere Personen in Windeseile auf sie zu. Thalia ließ sich neben ihren Vater fallen und presste die Hände auf Thórvis Stirn. Keálas blieb aufrecht stehen und betrachtete die Prinzessin mit besorgtem Blick. Die Druidensteine auf seiner Brust vibrierten und schickten seine Magie über die Körper vor ihm. Alle hielten gespannt den Atem an, während sie darauf warteten, dass Keálas etwas sagte. Dass er ihnen preisgab, was genau sich hier abspielte.
»Es ist Hawke.«, wisperte der Magier vor sich her. »Die Zauberin nutzt ihre Verbindung aus, um Thórvi unschädlich zu machen.«
»Wir müssen etwas tun!«, schickte Thalia durch die Stille. Während sie sich weiterhin auf ihre Schwester konzentrierte, funkelten ihre Hände in einem unnatürlich weißen Ton. Vorsichtig ließ sie ihre Magie durch Thórvis Körper schweben und suchte nach dem rettenden Anker. Doch Daymón konnte in ihrer Haltung erkennen, dass es der jungen Nachtelfe schwerfiel, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Niemand hier wollte wahrhaben, dass es der Frau zwischen ihnen schlecht ging. Niemand wollte mit dem Gedanken leben, dass sie heute sterben könnte.
Der Schleim zog sich weiter Thórvis Arm hinauf, und als die ersten Zuckungen durch den leblos wirkenden Körper pulsierten, schaffte Daymón es nicht mehr, still sitzen zu bleiben. Er sprang unter Tränen auf und fiel seinem besten Freund in die Arme, mit denen er den Prinzen der Meerwesen beharrlich an sich drückte. Ein beruhigendes Brummen ging durch Dexters Körper, doch dieses Mal schaffte er es nicht, Daymóns Herz ruhiger schlagen zu lassen.
Daymón war gebrochen, und nicht nur das laute Knacken in seinem Inneren durchbrach die Stille. Ein dunkles, sadistisches Lachen drang an seine Ohren und setzte sich in jeder Faser seines Körpers fest. Als er sich von Dexter löste und den Blick hinter sich richtete, konnte er dem Tod in voller Pracht entgegenblicken.
Alles in seinen Erinnerungen verschwamm zu einem Fluch, der ihn auf die Knie zwingen wollte. Dieser Anblick war schlimmer als alles, was er in seinen Träumen gesehen hatte, denn die geliebte Frau war zu einem Monstergeworden.
Thórvi strahlte boshafte dunkle Macht aus, die nicht nur Daymón zurückschrecken ließ. Alle Umstehenden waren ebenfalls einige Schritte zurückgewichen und starrten ängstlich auf die Frau in ihrer Mitte. Tobén hatte seine Arme um Medina geschlungen, die sich mit zittrigen Händen an ihm festkrallte. Rueth war zu Thalia gelaufen, hatte sie zur Seite gedrängt und konnte den Weinkrampf ihres Körpers nur mühselig unterdrücken. Die gesamte Angst, die sich in diesen Raum festgesetzt hatte, stachelte die Boshaftigkeit in Thórvis dunklen Augen weiter an. Während der schwarze Schleim deutlicher ihren Arm hinauflief, sich dunkle Schwaden um ihre Füße zogen und sie wissend zu grinsen anfing, drehte sie sich um ihre eigene Achse und nahm jedes Detail in sich auf.
Als sich ihre Augen erneut auf Daymón fixierten, wich er einen weiteren Schritt zurück. »Du bist ein Narr, zu glauben, du könntest die Völker und deinen Palast vor dem Untergang bewahren!«, hallte die verzerrte Stimme durch die Stille um sie herum, und nichts daran erinnerte mehr an den lieblichen Klang, den Daymón immer gerne gehört hatte. Ihm war sofort klar, dass Hjerdíz den Körper vor ihm übernommen hatte. In diesem Moment schien nichts mehr von Thórvi übrig geblieben zu sein. Ihr schwarzes Haare wirbelte ungehalten um ihre eingefallenen Gesichtszüge und machten das Bild der gebrochenen Frau noch deutlicher.
»Es war so leicht, die Verbindung zwischen ihnen zu erkennen und sie zu meinem Vorteil zu nutzen.« Bei diesen Worten ließ sie ihren Blick über den eigenen Körper und ihre fremd wirkenden Hände gleiten, und ein überhebliches Grinsen breitete sich dabei auf ihren Lippen aus. Dann huschten die schwarzen Augen, die so unnatürlich grausam aussahen, wieder zu dem Prinzen und brachten seinen Körper erneut zum Rebellieren. »Ich könnte hier und jetzt alles beenden! Es wäre ein Leichtes, durch ihren Körper diesen Palast in Schutt und Asche zu legen. Euch zu vernichten und mir meinen Platz an der Spitze zu sichern.«
»Wieso tust du es dann nicht?«, brummte Dexter, der sich dicht neben Daymón gestellt hatte und seine Hände zwei Dolche beherbergten, die in dem schummrigen Licht unheilvoll aufblitzten.
Der Prinz zuckte zusammen, als sich erneut ein erfreutes Lachen unheilvoll über seine Ohren zog und ihn kurzzeitig in eine Starre versetzte, aus der er glaubte, nicht mehr herausfinden zu können.
»Wäre das nicht zu einfach?«, fragte die Stimme, die in keiner Weise an Thórvi erinnerte. »Würde ich mir damit nicht selbst den Spaß verderben?«, setzte sie hinzu, und ganz langsam ließ sie sich über den Boden tragen. Ihre nackten Füße hinterließen dunkle Abdrücke, während sie durch die Reihen der Umstehenden flanierte. Automatisch wichen sie vor dem Monster zurück und konnten dabei nur schwer verbergen, wie viel Angst in ihren Körpern wohnte.
Daymón konnte nicht widersprechen, als er merkte, dass sich dieses Gefühl ebenfalls durch seine Adernschlängelte.
Er empfand unbändige Angst.
Er wusste, dass sie einen Rückschlag erlitten hatten. Dass Hjerdíz Thórvis Körper übernehmen konnte, und nun mitten unter ihnen stand, war das Schlimmste, was ihnen hätte widerfahren können. Und die dunkle Macht an ihrem Körper zeigte deutlich, dass sie sie nutzen könnte. Das Monster könnte mit einem Fingerschnippen alles vernichten, und niemand würde ihnen zur Hilfe kommen können. Es würde niemanden mehr geben, der sich gegen Hjerdíz stellen könnte, würde ihre Magie heute über sie einbrechen.
»Was willst du dann?«, hörte Daymón den High Lord der Nachtelfen fragen, der sich mit seiner Frau immer noch auf den Boden kauerte und der Gestalt mit zusammengekniffenen Augen folgte. Was plante Tobén? Versuchte er, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken? Oder wägte er ab, was er bereit war, seiner eigenen Tochter anzutun, würde sie ihre Macht freilassen? Noch nie zuvor fühlte Daymón sich so stark in zwei Richtungen gezogen. Er liebte die Frau, die sich vor seinen Augen in ein Monster verwandelt hatte. Doch er wusste ebenfalls, dass er sie aufhalten müsste, würde nur eine der Personen in diesem Raum durch ihre Hände sterben.
Der erste Wandteppich schmolz in Thórvis Händen zu Asche, als sie ihre Finger über das Gewebe laufen ließ und sich weiter durch den Raum schob. »Ich will euren Tod! Aber nicht auf diese Weise und nicht heute. Ich bin hier, weil ich mir das holen will, was ich seit Ewigkeiten begehre!«, kamen die Worte über ihre Lippen.
Daymón ahnte, was es war.
Er wusste, dass Hjerdíz nur wegen des Mannes, in den sie sich verliebt hatte, Thórvis Körper übernommen hatte und ihnen diese Angstbereitete.
Sie wollte den König.
Seinen Vater.
»Du scheinst nicht auf den Kopf gefallen zu sein, kleiner Prinz!«, schnurrte sie ihm entgegen, und dabei schienen ihre Augen unheilvoll aufzublitzen. »Wenn du ihn mir überlässt, wirst du deine hübsche Freundin wiederbekommen! Ihn gegen sie!« Daymón spürte, wie einige Blicke zu ihm huschten. Medina schaute ihn fragwürdig an, während er in Ronáns Augen die Herausforderung spüren konnte. Alles in ihm verkrampfte sich bei der Erkenntnis, dass nur er und Dexter wissen konnten, wen sie begehrte. Doch würde er seinen Vater ausliefern können? Würde er den Tod seiner Geliebten riskieren, um den König zu retten?
Obwohl er in den letzten Monaten mehrmals mit seinem Vater aneinandergeraten war, war es ihm ein Dorn im Auge,der Zauberin das zu geben, was sie verlangte. Er wusste, dass sie den König der Meerwesen ebenfalls zu einer ihrer Marionetten machen würde. Dass sie mit ihm das Volk der Zauberinnen neu erschaffen wollte. Und wahrscheinlich würde sie alles dafür tun, Ménelaos Szinárdín in die Finger zu bekommen. Sie würde nicht davor zurückschrecken, die Mauern dieses Palastes einzureißen, die Stärke der Wellen auf sie niederregnen zu lassen und ihnen einen schnellen Tod zu bereiten.
Denen, die nicht unter Wasser atmen konnten.
Schweiß bildete sich in Daymóns Nacken, während er die Bilder vor seinem inneren Auge vorbeilaufen sah. Tote Körper, die sich durch die Wellen tragen ließen und mit weit aufgerissenen Augen ins Leere starrten. Konnte er das verhindern, ohne seinen Vater aufzugeben?
»Deine Spielchen sind jetzt vorbei, Hjerdíz! Du kannst mich haben, doch du wirst den Palast und seine Bewohner verschonen.«
Daymón wirbelte herum und blieb mit seinem Blick am Eingang des Thronsaals hängen, wo er die mächtige Gestalt seines Vaters erkennen konnte. Sein weißes Haar mit den grauen Strähnen an den Seiten wirkte länger und matter als jemals zuvor. Die hohen Wangenknochen in dem schmalen Gesicht waren kantiger und traten deutlich hervor, und seine beigefarbenen Augen mit dem goldenen Ring um die Iris waren dunkel und lagen in tiefen Höhlen. Er wusste nicht mehr, wann er die Stimme seines Vaters zuletzt gehört hatte, doch alles in ihm wurde unruhiger, als der König weitere Schritte in den Raum hinein machte.
Die Augen von Ménelaos Szinárdín verharrten dabei auf ihm.
Ich tue das für dich, deine Mutter, deine Seelengefährtin und für unser Volk. Kümmere dich um deine Mutter, und womöglich werden wir uns irgendwann wiedersehen. Wir haben diese Katastrophe über das Land gebracht, also muss ich versuchen, es wieder gut zu machen und ihr das zu geben, was sie verlangt. Ich glaube an dich, mein Sohn. Ab jetzt bist du Oberhaupt der Meerwesen. Ab jetzt bist du König!, hallte die Stimme von Ménelaos durch Daymóns Gedanken. Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. In diesem Moment war der Prinz – König – nicht mehr Herr seiner Sinne.
»Ich habe immer gewusst, dass du mir nicht widerstehen kannst, Ménelaos!«
Während sein Vater an Daymón vorbeilief und auf das Monster in Thórvis Körper zu marschierte, konnte er dem Meermann nur nachblicken und sich den Gefühlen in seinem Inneren hingeben. Ihm war schleierhaft, wie sein Körper es schaffte, aufrecht stehenzubleiben, während alles um ihn herum zusammenbrach. Sein Vater begab sich freiwillig in die Hände des Feindes, und noch immer wusste Daymón nicht, ob seine Seelengefährtin zu retten war. Würde sie dasselbe Schicksal ereilen wie seine Mutter? Oder würde er gegen die Frau, die er liebte, antreten müssen? Schaffte er es, ihr ein Schwert durch die Muskeln zu rammen?
Widerwillig schaute er dem Meermann hinterher, der sich jetzt in die Hände des Monsters begab. Er hörte Geflüster und Tuscheleien, konnte aber nicht verstehen, was gesprochen wurde. Irgendein unheilvolles Dröhnen hatte sich in seine Ohren geschlichen und mischte seine Gedanken zu einem grauen Nebel. Und dann spürte er eine neue Präsenz direkt neben sich. Er konnte das Leuchten der Druidensteine auf Keálas Brust im Augenwinkelerkennen. Daymón sah, wie sich der High Lord und die High Lady der Nachtelfen erhoben und ebenfalls dicht neben den Magier stellten, bevor seine leise Stimme den Nebel seiner Gedanken beiseite schob.
»Wenn wir die Verbindung zwischen Thórvi und Hawke nicht trennen, werden wir der Zauberin weiterhin ausgesetzt sein. Wir werden Verluste erleiden, unser Versteck aufgeben, und womöglich werden wir die Prinzessin zurücklassen müssen!«
Ein Schauer lief über Daymóns Haut, als er verstand, was Keálas ihnen mitteilen wollte. Er hatte ihnen unmissverständlich klar gemacht, dass Thórvis Verbindung zu Hawke ein Risiko war, dass sie nicht länger eingehen konnten.
»Ist es die Liebe zwischen ihnen oder das undurchdringbare Band der Ehe?«, hörte Daymón die High Lady leise flüstern, und er konnte nicht sagen, ob das Knacken in seinem Inneren von einem weiteren Riss in seinem Herzen herrührte oder es nur Einbildung gewesen war.
Ein klägliches Schnauben kam aus der Kehle des Magiers. »Ich habe nicht gewusst, dass sie die Zeremonie der Ehe absolviert haben. Das ändert natürlich alles.«
»Es war ihr Wunsch, es niemandem zu erzählen.«, setzte Tobén als kleine Erklärung hinzu, wobei Daymón den Blick des High Lord deutlich auf sich spüren konnte. Womöglich versuchte sein Freund, sich auf diese Weise bei ihm zu entschuldigen. Doch war er jemals ernsthaft sauer über die Verbindung gewesen? Daymón konnte es nicht sagen. Die Beziehung zwischen Hawke, Thórvi und ihm war wohl komplizierter, als er es sich jemals hätte eingestehen wollen.
»Deswegen hat die Zauberin es geschafft, in Thórvlyns Körper einzudringen. Sie nutzt die Verbindung der Ehe zwischen den beiden Seelen.«, sagte Keálas, während sie alle weiter auf das Monster mit den dunklen Augen starrten, dass ihre Macht nun um den Körper des Königs spielen ließ. Sie schien ihn einzuhüllen, seine Gedanken in einen Nebel zu versetzen und davon zu überzeugen, dass er sie ebenfalls liebte und begehrte. Und dann verschwand der König in einer Wand aus schwarzem Schleim, aus der nichts als Leere zurückblieb.
Die sich langsam zurück in die Spitzen der dunklen Finger schob, die das Monster ihnen noch immer offenbarte. Anscheinend hatte Hjerdíz noch lange nicht genug. Ihre Macht strahlte weiterhin aus jeder Pore an Thórvis Körper.
»Du hast, was du willst! Lass endlich meine Tochter frei!«, brüllte der High Lord der Nachtelfen der Frau entgegen, während er sich von der kleinen Gruppe entfernte und die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Daymón spürte sofort das Adrenalin durch seine Adern schießen, als er verstand, was das zu bedeuten haben könnte. Sie machten sich auf einen Angriff bereit. Einen Angriff, bei dem sie die Prinzessin versuchen würden, zu retten.
»Mir bleibt nichts anderes übrig außer das Anima divortium.«, richtete Keálas das Wort an die Frau neben sich, und sofort hörte Daymón die starke und entschlossene Stimme von Medina. »Tue es! Irgendwann wird Thórvi uns verzeihen können, dass wir die Eheschließung rückgängig gemacht haben.«
Daymóns Herz fing deutlicher zu pochen an. Sein gesamter Körper füllte sich mit purem Adrenalin und schien ihn von innen heraus zu überschwemmen.
Wollten sie die Ehe zu Hawke wirklich vernichten?
Und wie würden sie es anstellen können?
Noch immer hatte Hjerdíz den Körper seiner Seelengefährtin in ihren Händen. Würden sie es schaffen, überhaupt etwas zu erreichen?
Ein Brüllen hallte durch die Stille, als Daymón Thórvis Vater erkannte, der zu Boden gegangen war und sich die Schulter hielt, an der Rauch emporstieg. Das breite Grinsen auf ihrem Gesicht und der schwarze Feuerball, der in ihrer Hand züngelte, zeigten dem Meermann, dass Hjerdíz wohl doch einen Moment Zeit hatte, um mit ihnen zu spielen.
Doch sie wusste nicht, was sie damit ausgelöst hatte.
Tobén Blackthorn verschwand in einer Wand aus dichtem dunklen Nebel, bevor eine Welle aus rot-orangenem Feuer an Daymóns Augen vorbeilief und alles in ein helles Licht tauchte. Die Flammen richteten sich auf Thórvi und hüllten sie in ein hitziges Gefängnis, während ihre Mutter weitere züngelnde Salven auf sie zuschießen ließ. Tobén hatte sich hinter seiner Frau materialisiert und brachte mit deutlichen Bewegungen und lautem Gebrüll die restlichen Personen dazu, den Thronsaal zu verlassen und so weit zu laufen, wie ihre Füße es zulassen sollten. Keálas schritt neben der High Lady her, und zusammen kamen sie dem Gefängnis, in dem sich Thórvi befand, immer näher.
Hitze stieg in Daymóns Wangen, die nicht nur von Medinas Magie hervorgerufen wurde. Alles an ihm schien zu brennen.
Seine Haut, die Haare auf seinem Kopf, die Muskeln und Adern in seinem Körper.
Er wusste, dass die Verbindung zwischen ihnen ihm diese Gefühle offenbarte. Er fühlte, dass Thórvis Körper sich dagegen wehrte und ihr Geist nur langsam wieder zu sich kam. Er spürte ihr Herz, das im gleichen Klang mit seinem pulsierte, die Hitze, die ihre Haut zu versängen drohte. In diesem Moment stand er ebenfalls in den mächtigen Flammen und war gefangen.
Sekunden später schrie sein Herz auf und er heftete seinen Blick starr auf den einen Punkt. Als er sich sicher war, dass seine Geliebte von dem Monster zurückgelassen wurde, ließ er sich vor Dexter zu Boden fallen und den Schmerz, den sein Körper in diesem Moment fühlte, aus sich herausschießen. Er brüllte die Gefühle und Empfindungen, die Thórvi ebenfalls spüren musste, aus seiner Kehle, presste die Handinnenflächen auf den kalten Marmorboden vor sich, um nicht zusammenzubrechen.
Er fühlte am eigenen Leib, wie sich die Feuerwand weiter um ihren Körper drängte und die dunkle Macht aus ihr verschwinden ließ, bis kein Fünkchen mehr übrig war.
Als Daymón seinen Kopf hob und vor sich blickte, konnte er den Magier erkennen, der sich in einen lila Schein gehüllt durch eine kleine Öffnung in der lodernden Wandquetschte und dahinter verschwand.
Ein qualvoller Schrei durchbrach den Nebel in Daymóns Kopf. Er verlor nicht nur die Nerven, sondern auch jegliches Gefühl für Zeit. Thórvis Stimme hallte eine Ewigkeit an den Wänden des Saals wider, und sein Herz hielt es nicht länger aus und brach bei jedem Geräusch weiter auseinander. Bevor sein Körper und seine Gedanken sich dagegen wehren konnten, brach er in Dexters Armen zusammen und verlor das Bewusstsein. Das einzige Wort, das dabei durch seinen Kopf schwebte, war der Name der Frau, die er liebte.
Thórvi ...
EINS
THÓRVI
Der Mann in deinem Herzen gehört mir, kleine Prinzessin. Du wirst ihn niemals wieder in deinen Armen halten oder seine Stimme über deine Haut streichen spüren. Du hast Hawke verloren und ihn seinem Schicksal überlassen.
Siehst du, wie glücklich er ist? Wie stark und mächtig sein Körper durch meine Macht geworden ist? Und dafür braucht er dich nicht, kleine schwache Prinzessin!
Seine Seele hat sich für den Platz an meiner Seite entschieden, und seine Liebe zu dir existiert nicht mehr! Er ist jetzt mein Mann, mein Gefährte! Eure Verbindung ist nur noch ein Schandfleck auf seiner Haut und bald nicht mehr relevant, wenn ich mit dir und deiner Familie fertig bin.
Er wird sich nicht mehr an dich erinnern und ganz alleine mir gehören. Und du bist daran schuld, kleine Prinzessin. Du hast ihn von dir gestoßen, obwohl du ihn hättest lieben sollen. Du hast ihn vergessen, während ein anderer Mann seinen Platz eingenommen hat.
Du bist schwach, kleines Mädchen.
Und am Ende werde ich dir das Herz herausreißen und dich qualvoll sterben lassen!
Mein Körper bebte und Adrenalin schoss durch meine Adern, als meine Augen aufrissen und sich das helle Leuchten der blauen Wellenvor dem Fenster über sie legte. Die Kerze auf dem Beistelltisch neben dem Sessel, auf dem ich mich zusammengekauert hatte, war fast heruntergebrannt. Der Duft von erkaltetem Tee stach in meine Nase, und während ich mich ordentlich hinsetzte und die Arme auf meinen Knien abstützte, konnte ich das kleine Buch auf dem hölzernen Boden erkennen, in dem ich gelesen hatte, bevor ich eingeschlafen war.
Ich presste meine kalt wirkenden Hände gegen die Schläfen und versuchte, die schreckliche Stimme und die dazugehörigen Bilder aus meinem Kopf zu verbannen. Ich versuchte, sie so weit von mir zu schieben, wie es mir mein Körper erlaubte, und gleichzeitig meine Atmung unter Kontrolle zu bringen. Das Pochen meines Herzens wurde nur langsam ruhiger.
Schon wieder hatte mich derselbe Albtraum geplagt wie in den letzten Tagen. Ein Traum, der keiner war, und mich immer wieder zu dem Punkt zurückbrachte, als ich mich der Macht von Hjerdíz hatte ergeben müssen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was alles passiert war. Das Einzige, was ich deutlich vor mir sah, waren Daymóns erschrockene Augen gewesen, die mich anblickten, bevor sich die Schwärze über meinen Körper gelegt hatte.
Bevor sich die Stimme von Hjerdíz in mein Bewusstsein geschlichen und mir qualvolle Bilder von Hawke und ihr gezeigt hatte. In diesem Moment hatte sie mich gebrochen. Mit diesen Bildern hatte sie meinen Körper zum Aufgeben gebracht und die Kontrolle über mich gewonnen.
Und meine Seele hatte sich die ganze Zeit in meinem Inneren verkrochen und laut geschrien, bis selbst sie in einen tiefen Schlaf gefallen war.
Aus dieser heilenden Trance war ich erst vor drei Tagen erwacht. Ich hatte mich an nichts erinnern können und war mit einem lauten Brüllen in diesem Zimmer erwacht, wo ich direkt von meiner Mutter in die Arme geschlossen worden war. Minuten später waren Keálas und Thalia hereingestürmt und hatten mich untersucht, bis sie bestätigt hatten, dass es mir gutging und ich wieder Thórvi war. Im ersten Moment hatte ich nichts damit anfangen können, doch Mutter war erpicht darauf gewesen, mir alles zu erklären.
Danach war ich erneut in ihrem Armen zusammengebrochen, hatte unzählige Tränen vergossen und mich unter der Decke versteckt, bis mein Körper mich wieder hatte einschlafen lassen. Ein Selbstschutz meiner ramponierten Seele, wie Keálas es ausgedrückt hatte.
Noch immer hatte ich damit zu kämpfen, was passiert war. Nicht nur die Träume von Hawke und Hjerdíz plagten mich. Ebenfalls machte es mir zu schaffen, dass ich schwach gewesen war und mich hatte überrumpeln lassen. Dass Hjerdíz so leicht hatte die Verbindung zwischen ihm und mir nutzen können.
Doch damit war es jetzt für immer vorbei, was das Gefühl in meinem Inneren nicht unbedingt verschwinden ließ.
Ich hatte versagt.
Alles, was ich gewollt hatte, war, dass meine Familie und Freunde in Sicherheit waren. Dass sie sich auf mich verlassen konnten und ich ihnen einen Ausweg aus dieser Katastrophe offenbaren könnte. Doch dass Hjerdíz meinen Körper hatte in Besitz nehmen können, war ein brutaler Schlag in die Magengegend gewesen.
Und ich schämte mich dafür.
Eine lose Strähne meines schwarzen Haares verlor sich in meinen Blick, und mit einer schnellen Handbewegung beförderte ich sie zurück hinter mein Ohr. Dann schnappte ich mir das Buch, das an einer Stelle einen kleinen Kratzer abbekommen hatte, und legte es neben die Tasse mit dem Tee auf den Beistelltisch. Dabei funkelte mir der silberne Ring entgegen, in dessen Fassung sich der grüne Smaragd befand, und den ich ebenfalls auf der Oberfläche abgelegt hatte.
Sofort stahl sich mein Blick auf meine linke Hand, an deren Ringfinger nichts mehr zu erkennen war, außer endlose Leere. Die dünne Linie aus schwarzer Tinte war verschwunden, als wäre sie niemals da gewesen.
Als hätte ich sie mir eingebildet.
Hawke und ich hatten geheiratet. Wir hatten die Zeremonie im Beisein meiner Eltern absolviert und uns geschworen, für immer zusammen zu bleiben. Diese Ehe, die ich vor einem weiteren Unheil hatte beschützen wollen, hatte vier Tage gehalten. Dieses Ende fühlte sich surreal und nicht greifbar an, und doch wusste ich, dass ihnen keine Wahl geblieben war.
Durch das magische Band der Ehe hatte Hjerdíz es geschafft, Besitz von meinem Körper nehmen zu können und alle in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie hatte sich in diesem Palast und in dem Zufluchtsort der Geflüchteten befunden und hätte dieses Band wieder und wieder für ihre Zwecke ausgenutzt. Obwohl es weh tat und ich Angstdavor hatte, was meine Gedanken mit mir machten, war mir bewusst, dass meine Mutter zu meinem Wohlentschieden hatte.
Sie war es gewesen, die Keálas dazu gebracht hatte, das Anima divortium einzusetzen. Das Gesetz der Ehe und der Zauber, der die Seelenscheidung zweier Gefährten bedeutete. An diesen Schmerz erinnerte ich mich zu gut.
Wie ein zischender Blitz war der Zauber über meine Haut gejagt, hatte sich durch jede Ader in meinem Körper geschlichen und am Ende in meinem Herzen verirrt, wo die Verbindung zu Hawke zunichtegemacht worden war.
Und nun erinnerte nichts mehr an unsere Ehe, an die Verbindung unserer Seelen oder dass Hawke jemals Liebe für mich empfunden hatte. Er war fort und gefangen in der dunklen Magie, die Hjerdíz in seinen Körper gepflanzt hatte.
Dass sie Ménelaos Szinárdín in ihre Finger bekommen hatte, war ebenfalls ein Rückschlag, und der Schock hatte mir ins Gesicht gestanden, als Thalia mir davon erzählt hatte. Wegen des Königs der Meerwesen war Hjerdíz überhaupt auf die Idee gekommen, meinen Körper in Beschlag zu nehmen. Sie hatte ihn gewollt und Daymón dazu gezwungen, ihn ihr zu übergeben, um mich wiederzubekommen. Weitere Informationen hatte ich nicht von meiner Schwester erhalten. Und Daymón hatte ich seit meinem Erwachen nicht wieder zu Gesicht bekommen.
Ich glaubte daran, dass er mir aus dem Weg ging. Womöglich konnte er mich nicht ansehen, ohne an diesen Tag erinnert zu werden. Ohne die Bilder seines Vaters zu sehen, wie er sich in die Hände des Feindes begeben musste. Ich wusste nicht einmal, ob er sich durch den Flur vor meiner Tür geschlichen und nicht getraut hatte, an meine Tür zu klopfen. Oder war er gekommen, während ich geschlafen hatte? Seitdem Hjerdíz Besitz von meinem Körper genommen hatte, konnte ich meinen Empfindungen und den Gefühlen nicht mehr vertrauen. Ich wusste nicht mehr, ob es meine eigenen Bedürfnisse und Gedanken waren, oder ob mir jemand etwas in meinen Kopf gelegt hatte. Manchmal glaubte ich daran, Daymóns Herzschlag vor meiner Tür zu spüren oder dass sein Geruch durch die Luft schwebte und sich in meine Nase schlich. Doch an keinen von diesen Tagen bekam ich ihn zu Gesicht.
Als wäre er ein Geist, der sich unsichtbar durch den Palast schlich und mir aus dem Wegging.
Erhitzte Tränen liefen über meine Wangen und tropften von meinem Kinn auf den Boden neben meinen Füßen, wobei sich ein zarter Schluchzer aus meiner Kehle quälte. Die Erinnerungen an Hawke brachten meinen Körper heute erneut zum Kapitulieren. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht weinte. An dem ich mich nicht unter der Decke versteckte und an nichts anderes dachte als an den lyrischen Krieger, den ich verloren hatte.
Dass ich es heute überhaupt aus dem Bett und auf diesen Sessel geschafft und bereits eines der Croissants mit Marmelade gegessen hatte, war ein reines Wunder. In den letzten Tagen war es eher selten dazu gekommen, dass ich freiwillig etwas zu mir genommen hatte. Wenn es dazu gekommen war, hatte meine Mutter lange auf mich einreden und mir das Essen schon fast selbst in den Mund stopfen müssen. Doch heute war es anders gewesen.
Ich war von selbst aus meinem Bett gekrochen, hatte mich stundenlang durch das Becken mit dem warmen Wasser gleiten lassen und mich dabei gewaschen. Meine Haut duftete nach Lavendel, und die Strähnen meiner Haare waren weicher und geschmeidiger als ich sie in Erinnerung hatte. Danach hatte ich mich angezogen und eine junge Meerfrau darum gebeten, mir etwas zu Essen zu bringen. Obwohl ich mich besser fühlte, wollte ich nicht durch die Flure laufen und jemandem begegnen, der mich missbilligend anblicken könnte.
Obwohl mir jeder versuchte zu bestätigen, dass mir keiner die Schuld gab, spürte ich trotzdem, dass die Angst der Bewohner in diesem Palast die Oberhand gewonnen hatte. Niemand von ihnen wollte erneut erleben, wie ein Monster direkt zwischen ihnen umherlaufen und sie mit einer schnellen Bewegung dem Todhätte näher bringen können.
Ich wollte es ebenfalls nicht wieder erleben.
Und obwohl ich Keálas Magie vertraute und er mir deutlich klargemacht hatte, dass der Zauber funktioniert hatte, war ich vorsichtig. Hjerdíz war wohl mächtiger als wir alle zusammen. Und wenn sie es bereits einmal geschafft hatte, konnte wohl keiner behaupten, dass sie es nicht wieder schaffen könnte.
Ich ließ mich aus dem Sessel gleiten und machte langsame Schritte auf den Rand des Beckens vor mir zu. Bei jeder Bewegung strich die schwarze, weiche Baumwolle des Kleides über meine Haut, das sich eng um meinen Oberkörper schmiegte und in leichten Wellen um meine Beine spielte. Lange Ärmel und ein hoher Kragen bedeckten die Haut darunter und versteckten die Narben meines Körpers und die in meinem Inneren vor fremden Augen. Der Verband an meinem Oberschenkel spannte, als ich mich an die Kante setzte, den Stoff mit beiden Händen über meine Knie zog und sich die Haut an meinen Beinen mit der Wärme des Wassers mischte.
Die Wunde, die ich in Gréyven davongetragen hatte, war bereits geschlossen und engte mich nicht mehr ein. Trotzdem musste ich sie weiterhin vor Schmutz beschützen, weswegen ich mir jeden Morgen und Abend einen neuen Verband anlegte. Ich wollte ganz sicher nicht, dass sie sich entzündete.
Das leuchtende Blau der Wellen vor dem breiten Fenster hüllte mich in eine sanfte Atmosphäre, und ich spürte, wie mein Herzschlag sich beruhigte und ich innerlich entspannte. Nie zuvor war mir aufgefallen, dass das Meer eine derartige Anziehungskraft auf mich hatte. Dass ich mich nicht davor fürchtete und die Wellen stundenlang beobachten konnte, ohne mich zu langweilen. Womöglich lag meine neu aufgeblühte Zuneigung an dem Ort,an dem ich mich befand.
Der Palast der Meerwesen. Zu finden in den Tiefen des Meeres und unter dem herrlichen Blau.
Es war ein atemberaubender Ort, an dem ich mich sofort wohlgefühlt hatte. Das Rauschen des Meeres war selbst hinter den dick wirkenden Scheiben zu hören, und während sich weit in der Ferne eine Dunkelheit über den Grund legte, erstrahlte um mich herum das schönste Farbenspiel, das ich jemals gesehen hatte.
Pflanzen, die sich sachte hin und her wiegten, erblühten in hellen und leuchtenden Farben, verteilten sich über den gesamten Grund und umringten den Palast bis in die kleinste Ecke.
Grün, Lila, Blau. Rot und Gelb, Orange und Türkis.
Farbenfrohe Besinnlichkeit, die meine Seele in ihren Bann zog.
Auch heute fixierte ich die leuchtende Schönheit vor meinen Augen und konzentrierte mich auf die beweglichen Punkte, die sich wie elegante Farbkleckse durch die Wellen schoben. Ich kannte Fische und hatte etliche mit eigenen Händen gefangen, wenn ich mit Vater in dem Fluss neben der Burg geangelt hatte. Doch die Lebewesen, die in dem schmalen Abschnitt bei uns zuhause gelebt hatten, waren mit diesen nicht zu vergleichen.
Sie waren rund und besaßen große Augen, oder zogen sich in die Länge und ließen ihre schimmernden Flossen an ihrem Körper herabhängen. Andere leuchteten in unnatürlichen Farben und suchten zwischen den kleinen Staubkörnern am Boden mit ihrem Mundnach Futter.
Leider hatte mir keiner etwas über diese Fische beibringen können. Da ich mich nicht aus diesem Zimmer bewegt hatte, war mir auch niemand von den Meerwesen über den Weg gelaufen, den ich hätte fragen können. Daymón war vom Erdboden verschluckt, und von Dexter wusste ich, dass er sich auf die neuesten und wichtigen Patrouillen begab, um außerhalb der Mauern alles im Auge behalten zu können. Ich hatte ihn gesehen, wie er sich einer Gruppe Wachen direkt vor meinem Fenster angeschlossen hatte. Das Bild des starken Mannes, dessen Lederwams über seiner Brust spannte und dessen Beine in eine gelb-grüne Flosse verwandelt waren, hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt.
Ganz sachte hatte er mir an diesem Tag zugewunken und war dann mit der Gruppe davon geschwommen. Ich hatte es nach wenigen Sekunden aufgegeben, ihnen mit meinem Blick weiter zu folgen. Seitdem hatte ich den Meermann nicht mehr gesehen.
Womöglich hatte Daymóns Verschwinden gar nichts zu bedeuten. Vielleicht machte ich mir zu viele Sorgen. Wahrscheinlich hatte er mehr zu tun, als er sich eingestehen wollte. Jetzt, da er das Amt des Königs hatte übernehmen müssen. Sein Vater war fort und seine Mutter immer noch in ihrem schlafenden Gefängnis eingesperrt. Ich hatte sie nicht besucht, doch Thalia hatte mir von ihrem Zustand berichtet. Der schwarze Schleim zog sich bereits sachte über die Erhebung an ihrer Schulter. Ein Kloß hatte sich damals in meinem Hals gebildet und ich spürte ihn erneut in den Vordergrund treten.
Es tat mir unglaublich leid, dass wir Daymóns Mutter und die Königin noch immer nicht hatten retten können. Dass sie weiterhin um ihr Leben zu kämpfen hatte und sich dabei auf ihren Sohn und mich verlassen musste.
Wir wussten nicht, wo wir weitermachen sollten. Das goldene Himmelswerk war in der anderen Welt versteckt, und obwohl wir nicht sagen konnten, ob Hjerdíz davon eine Ahnung hatte, wollten wir unsere Reise nicht überstürzen. Meine Überlegungen hatte Chará mir bestätigt. Da sich Thylion noch immer von seinem Becken- und Rippenbruch erholen musste, wollte Chará nicht sofort von seiner Seite weichen müssen. Ich war ebenfalls noch nicht ganz genesen, und wie es Daymón erging, konnte keiner von uns sagen. Chará hatte mir mitgeteilt, dass auch sie den König der Meerwesen nicht gesehen hatte.
Viel schlimmer war der Gedanke daran, dass wir die geflüchteten Völker zurücklassen müssten. Wie lange würden sie ohne unseren Schutz auskommen? Wann hätte Hjerdíz das Warten satt und würde ihre Leute nach Merédyn schicken?
Das alles waren offene Fragen, die niemand beantworten konnte, und doch würden wir uns auf diese Reise begeben müssen. Wir brauchten noch immer das goldene Himmelswerk.
Ein erneut aufkommender Gedanke wischte den grauen Schlieren in meinem Kopf beiseite. Unsere kleine Gruppe würde nicht darum herumkommen, sich weitere Verbündete zu suchen, die bereit waren, ihr Leben auf dieser Mission zu riskieren.
Und eine Person sprang mir dabei immer wieder durch meine Erinnerungen.
Obwohl ich keinen Anhaltspunkthatte, wo er sich in diesem Moment und in diesen schwierigen Zeiten aufhalten könnte. War er weiter in den Westen gereist oder hatte er sich nach Norden aufgemacht?
In jeder mir bekannten Richtung gab es Orte und Länder, die für ihn hätten interessant sein können.
Der Gedanke, Nazhár um Hilfe zu bitten, verflüchtigte sich schnell wieder. Es würde Wochen oder Monate dauern, ihn ausfindig zu machen. Wenn wir es überhaupt schaffen würden, den abtrünnigen Elfen und selbsternannten Piratenlord irgendwo zu finden. Er war schon immer ein Meister darin gewesen, vor fremden Augen versteckt zu bleiben, wenn er es gewollt hatte.
Ich ließ die Luft aus meinen Lungen weichen und konzentrierte mich wieder auf das Farbenspiel vor meinem Fenster. Dabei glitten meine Füße durch das wärmende Wasser in dem Becken und verströmten einen erneut aufkeimenden Lavendelduft. Ich ließ meine Hände hineingleiten und tröpfelte mir einige Kleckse auf das Gesicht. Mit zarten Bewegungen massierte ich mir das Wasser in die Haut und erspähte dabei die leuchtenden roten Linien in der Innenfläche meiner Hand.
Der Handel mit den Weberinnen war mehrere Tage her, und obwohl sie mich nicht mit Schnelligkeit beauftragt hatten, wusste ich nicht, wie lange sie ohne ihre Wirte überleben könnten. Ich hatte ihnen versprochen, sie wieder zu ihnen zurückzubringen, doch dabei hatte ich eine ganz andere Sache im Sinn gehabt.
Womöglich sollte ich mich zuerst um diese Aufgabe kümmern. Da ich wusste, wo die Robúlái zu finden waren und Vater mir angeboten hatte, mich zu begleiten, würde es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
Natürlich nur, wenn der Teil Lyviáns nicht auch bereits in Hjerdíz‘ Hände gefallen war.
Ich bettete zur Mondgöttin, dass wir dieses eine Mal das Glück auf unserer Seite hätten. Ich wollte den Handel hinter mich bringen und den Weberinnen nicht weiterhin etwas schuldig sein oder sogar die Schuld daran haben, dass sie einen qualvollen Hungertod sterben mussten.
Ich hoffte, dass Vater mich immer noch begleiten wollte. Er würde seiner Tochter doch niemals etwas abschlagen können, oder?
Ich ließ meine Hand erneut in das Becken gleiten, als jemand kräftig an meine Tür klopfte und mich damit zum Zucken brachte.
DAYMÓN
Das schummrige Licht in dem klein wirkenden Raum schickte eine leichte Wärme über meine Haut. Ich konnte mich kaum daran erinnern, wie ich hierher gekommen war. Was mich dazu angetrieben hatte, aus meinem Zimmer mit den aufgehäuften Papieren auf meinem Schreibtisch zu marschieren, durch die Gänge zu laufen und mich in diesen Raum zu verirren, dem ich so lange aus dem Weggegangen war.
Die kalte Haut der Finger meiner Mutter ruhte in meiner Hand, während ich mich neben ihr Bett kniete und sie aus schmalen Augen betrachtete. Es sah aus, als würde sie schlafen, doch ich wusste es besser. Noch immer kämpfte sie gegen die dunkle Macht an, die sich über ihren Geist gelegt hatte. Nach zwei Jahren war sie noch immer gefangen in ihren Träumen. Kein Zucken war durch ihren Körper gelaufen. Es gab kein Anzeichen dafür, dass sie atmete oder überhaupt noch am Leben war, und doch hielt ich ihre Hand fest in meiner und hoffte darauf, dass sie aufwachen würde.
Dass sie mir sagen könnte, dass alles gutgehen würde. Dass sie stolz auf mich war.
In den letzten Tagen hatte ich mich um nichts anderes als meine neuen Aufgaben als König gekümmert. Obwohl sie langweilig und unnütz wirkten, hatten sie meine gesamte Zeit in Anspruch genommen. Ich wusste nicht mehr, wann ich das letzte ausgiebige Bad genommen hatte; wann Dexter erneute Papierhaufen auf meinen Schreibtisch geworfen oder wann ich das letzte Mal einen ruhigen Schlaf erlebt hatte. Alles drehte sich um meine Pflichten oder um die Mission, die erneut zum Stillstand gekommen war. Um das Volk und die Geflüchteten, die ich zu beschützen hatte.
Der Schmerz in meinem Herzen setzte mir weiterhin zu. Nichts von alledem, worüber ich mir Gedanken machen musste, war unter Kontrolle. Ich hatte meinen Vater verloren und wusste nicht, ob er überhaupt noch der Mann war, den ich in Erinnerung hatte. Meiner Mutter blieb ebenfalls nicht mehr viel Zeit, und wie sollte ich es anstellen, eine Mission anzutreten, während ich mein Volk ungeschützt zurückließ?
Doch womöglich war das nur eine weitere Ausrede, meinem Schicksal aus dem Weg zu gehen. Der Frau, die sich etliche Zimmer entfernt aufhielt, nicht in die Augen blicken zu müssen. Nicht ihren unbändigen Schmerz zu sehen und damit konfrontiert zu werden, dass sie sich aufgegeben hatte.
Ich konnte Thórvis Schmerz nachvollziehen.
Sie hatte den Mann, den sie ebenfalls liebte, verloren und keine Verbindung mehr zu ihm. Das alles, weil Hjerdíz ihr Band ausgenutzt und ihren Körper mit dunkler Magie gefangen gehalten hatte. Und ich erinnerte mich zu gut an die Qualen, die durch Thórvis Körper gelaufen waren, als der Magier das Anima divortium angewendet hatte. Ich spürte es selbst jetzt noch in jedem Muskel.
Ich glaubte daran, dass mein Körper die Reißleine gezogen und mich deshalb in Ohnmacht versetzt hatte. Er hatte mich vor dem Schmerz beschützen wollen, der durch Thórvis Körper gelaufen und durch das Seelenband direkt in meine Gedanken gedrungen war. Ich wusste, dass es schlimm für mich hätte enden können. Dass sie so lange geschlafen hatte, zeigte mir deutlich, dass es ihre Seele ebenfalls mitgenommen hatte. Und bis heute wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Ich fokussierte mich wieder auf das Gesicht meiner Mutter, das ruhig und völlig gelassen wirkte. Ich musste mir eingestehen, dass ich sie noch nie so friedlich gesehen hatte. Sie war immer stark und selbstsicher gewesen, und obwohl sie eine Seherin war und nie den Eindruck gemacht hatte, dass ihr etwas zusetzte, hatte sie doch immer eine undurchdringbare Mauer um sich gewoben.
Eine Mauer, durch die sie nicht einmal mich hatte blicken lassen. Ihren eigenen Sohn.
Mein Blick verschwamm, als ich die Tränen in meinen Augen aufkeimen spürte. Ich wollte nicht weiter daran denken, dass sie nie wieder aufwachen könnte. Dass ich ihre Stimme nicht mehr hören würde.
Ein leichter Kloß bildete sich in meinem Hals, als ich ihre Hand zurücksinken ließ und mich langsam erhob. »Ich komme dich bald wieder besuchen, Mutter.«, flüsterte ich ihr zu und hoffte insgeheim auf eine Antwort von ihr. Doch die Stille blieb bestehen, und bevor ich es mir anders überlegen konnte, trugen mich meine Füße über den Boden und aus der Tür hinaus, die ich hinter mir zufallen ließ.
Ein nervöses Flattern legte sich über mein Herz, als ich mich nach rechts und links umblickte und die Dunkelheit des Flures über meine Haut glitt. Was könnte ich jetzt tun? Dex war erneut auf Patrouille und konnte mir keine Gesellschaft leisten. Allein durch die Meere schwimmen war mir als König nicht mehr möglich, und ich wollte es ebenfalls nicht riskieren, einem Gegner oder sogar Hjerdíz in die Arme zu laufen. Ich würde es nicht einmal schaffen, mich zu der versteckten Bucht oberhalb von Merédyn zu schleichen. An jedem Ausgang waren Wachen stationiert, die jeden mit Adleraugen beobachteten, der hinaus oder hinein kommen wollte. Auf der Oberfläche von Merédyn hielten sich ebenfalls ausgebildete Krieger auf, genauso wie in den Weitendes Meeres.
Ich hatte es selbst veranlasst.
Ein Angriff sollte so früh wie möglich entdeckt werden, damit wir überhaupt eine Möglichkeit hatten, dagegen anzukommen. Jetzt, wo Hjerdíz meinen Vater in ihren Händen hatte, war alles möglich. Dieser Gedanke brachte das Adrenalin zurück in meine Adernund setzte meinen Körper in Bewegung.
Womöglich tat die Stille um mich herum ihr Übriges, dass sich tausende Gedanken durch meinen Kopf schoben. Was tat die Zauberin meinem Vater an? Was hatte sie Gréycia und Hawke angetan, von dem ich nichts wusste? Wer war alles auf ihr Angebot eingegangen? Was war von Lyvián und meiner Heimat noch übrig? Würde ich die Mission jemals antreten können? Und wie ging es Thórvi?
Als ihr Name durch meine Gedanken rauschte, konnte ich das leichte Flimmern in meinem Herzen spüren. Obwohl ich sie so lange nicht gesehen oder gesprochen und mich mit Aufgaben abgelenkt hatte, war ich mir immer noch sicher, dass die wunderschöne Nachtelfe mein Herz gestohlen hatte.
Dass ich sie bedingungslos und auf ewig lieben würde.
Diese Erkenntnis trieb mich durch die Flure direkt vor ihr Zimmer, wo ich ihren sanften Herzschlag durch das Holz spüren konnte. Ich konnte den Duft von Lavendel wahrnehmen und hörte das leise Plätschern von Wasser. Mein gesamter Körper vibrierte, als ich meine Hand anhob und vor das Holz der Tür hielt, doch ich schaffte es nicht, anzuklopfen.
Ich hatte Angst davor, sie mit meiner Anwesenheit zu überrumpeln oder den Schmerz in ihren Augen zu sehen, mit denen sie mich anblicken würde. Ich hatte Angst davor, meine Gefühle nicht länger hinter der Mauer versteckt halten zu können und vor ihr zusammenzubrechen, obwohl sie den starken Meermann an ihrer Seite brauchte. Thórvi sollte wissen, dass ich für sie da war und sie sich auf mich verlassen konnte, obwohl die Situation um uns herum ausweglos erschien.
Schaffte ich es, ihr dieses Bild zu vermitteln? Würde ich es jemals schaffen, ihr entgegenzutreten? Was hatte das Monster mit uns angestellt? Und was würde noch auf uns zukommen?
All das waren Fragen, die ich mir in diesem Moment nicht beantworten konnte, und doch zog mich das aufkeimende Verlangen weiter zu der Frau hinter der Tür. Meine Hand traf auf das Holz und ein kräftiges Klopfen drang durch die Stille, bevor ich ihre sanfte Stimme aus dem Inneren wahrnehmen konnte, mit der sie mich hereinbat.
Meine Finger zitterten, als ich die Klinke herunterdrückte und ein wohlig warmer Duft im Inneren meine Sinne benebelte, und sofort stahl sich Thórvis schlanker Körper in meinen Blick. Sie saß am Rand des Beckens, ein eng anliegendes schwarzes Kleid bedeckte ihre Haut, und ihr Gesicht mit den wunderschönen, leuchtenden Augen und den schwarzen Haaren war zu mir gerichtet. Sie beobachtete mich, während meine Beine einen Schritt nach dem anderen machten. Ich wusste nicht, ob ich es schaffte, die Gefühle in meinem Inneren vor ihr zu verstecken oder ob ich ein offenes Buch für sie war. Eigentlich war es völlig egal. Thórvi sollte sehen, was es mit mir machte, bei ihr sein zu dürfen. Sie anblicken zu können und mich wieder und wieder in sie zu verlieben.
»Ich habe an dich gedacht.«, hörte ich ihre Stimme flüstern, während ich mich neben sie an den Rand des Beckens gleiten ließ, wobei ich darauf bedacht war, das Wasser nicht zu berühren. Ich hatte keinen Trank dabei, der mir meine Beine zurückgeben würde, würden sie sich in eine Flosse verwandeln. Und dieser Beweis meines unbändigen Vertrauens Thórvi gegenüber würde nicht in diese Situation passen. Ich musste erst einmal herausfinden, wie wir zueinander standen, nachdem wir uns so viele Tage nicht gesehen oder gesprochen hatten.
»Ich hoffe, dass nur Gutes dabei herausgekommen ist.«, säuselte ich vor mir her und versuchte, ein ehrliches Lächeln auf meine Lippen zu legen. Ein Glücksgefühl überschwappte meinen Körper, als ihre Augen sich in meine mischten und wir einige Sekunden schweigend nebeneinander saßen.
»Ich habe mich gefragt, warum ich dich so lange nicht gesehen habe.«, antwortete sie und ließ dabei erneut ihre Füße durch das Becken gleiten. Ein schwaches Plätschern war zu hören, und dann entzog sie mir ihren Blick. Ein leichter grauer Schleier legte sich über das Weißsilber ihrer Augen und machte mir deutlich, dass es ihr nicht so gut ging, wie sie mich wissen lassen wollte.
»Ich hatte ... viel zu tun.«, kam es abgehackt aus meiner Kehle. Ich wusste nicht, warum ich mich schlecht fühlte, obwohl ich ihr ehrlich geantwortet hatte. Die Papiere hatten sich meterhoch auf meinem Schreibtisch gestapelt, während eine Sitzung nach der anderen einberufen worden war. Doch womöglich war es mein schlechtes Gewissen, das sich in den Vordergrund stahl.
Ich hatte mich vor dem ersten Aufeinandertreffen mit ihr gedrückt.
»Aha ...«, ließ Thórvi leise hervordringen. Für mich fühlte sich das Wort wie ein Schlag in die Magengrube an. Nervös ließ ich die Finger durch meine Haare streichen, bevor ich mich von ihr abwendete und die Luft aus meinen Lungen gleiten ließ.
»Ich bin dir aus dem Weg gegangen.«, sprach ich die bedeutungsschweren Worte aus, die sich wie ein dunkles Loch in meinem Herzen einquartiert hatten. »Ich hatte Angst vor diesem Treffen. Angst davor, mir eingestehen zu müssen, was dein Verlust – und auch mein Verlust – mit uns angerichtet haben.« Ich musste sie nicht anblicken, um die Falten auf ihrer Stirn zu erkennen, die mir zeigten, dass sie ebenfalls über dieses Treffen nachgedacht hatte.
»Ich werde es mir nie verzeihen können, dass du meinetwegen deinen Vater hast gehen lassen müssen.«, kamen die Wortetraurig und melancholisch über ihre Lippen, die sie zu einem schmalen Strich zusammengepresst hatte. Ich schaffte es nicht, sie weiter unbeobachtet zu lassen, und schickte meinen Blick erneut über ihre weichen Gesichtszüge.
»Es ist nicht deine Schuld!«, antwortete ich, und ganz sachte trafen meine Finger auf die Haut an ihrem Handgelenk. »Ich habe dir in keinem Moment die Schuld dafür gegeben. Ich weiß, dass du alles dafür getan hast, um diesen Augenblick nicht zustande kommen zu lassen. Und doch waren wir beide unvorbereitet und nicht darauf gefasst, was Hjerdíz imstande war, mit Hawke und somit mit dir anzustellen.«
Die erste dicke Träne rann über Thórvis Gesicht, und als sie anfing, an ihren Fingern herumzuknibbeln, kroch ich näher an sie heran und zog sie in meine Arme. Sie wehrte sich nicht, als mein Kinn auf den Ansatz ihrer Haare traf und sich ihr erhitztes Gesicht an meine Brust schmiegte. Sie blieb auch dann noch ruhig, als meine Arme sich um ihren Körper schlossen und ich kleine Kreise auf ihrem Schulterblatt zeichnete. »Ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich es schaffen könnte, mich von dir abzuwenden.« Mein Puls raste, als die Worte, die ich ihr gerade entgegengeschleudert hatte, auch in meinem Kopf ankamen. Die Schläge meines Herzens wurden deutlicher, und die Muskeln in meinem Körper spannten sich automatisch an. »E-es tut mir leid ...«, wisperte ich wie ein kleiner Junge vor mir her.
»Würde es dich beruhigen, wenn ich sagen würde, dass ich dich ebenfalls liebe?«, drangen ihre gedämpften Wortean meine Ohren, woraufhin sich ein kleines Lächeln über mein Gesicht schlich. Nicht, weil sie noch nie etwas in der Art zu mir gesagt hatte, sondern, weil ich wusste, dass es nicht ganz der Wahrheit entsprach.
Ich ließ meine Arme von ihrem Körper fallen, drückte sie einige Zentimeter von meiner Brust und ließ eine Hand an ihr Kinn gleiten, mit der ich sie zwang, mich anzusehen. »Nein, es würde mich nicht beruhigen. Denn ich sehe noch immer die Sehnsucht nach Hawke in deinen wunderschönen Augen.« Sofort traten erneute Tränen in ihr Gesicht, die sich wie kleine Bäche über ihre Wangenzogen.
»Ich vermisse ihn! Und ich will mich nicht damit abfinden müssen, dass ich ihn verloren habe ...« Ihre letzten Worte wurden von einem Keuchen aus ihrer Kehle unterdrückt. Ein Beben durchschüttelte ihren Körper und ließ die gebrochene Frau erneut an meine Brust fallen, wo ich sie noch einmal in eine Umarmung drückte.
Am liebsten hätte ich mich der Trauer in meinem Inneren ebenfalls hingegeben. Am liebsten hätte ich ihr den Teil von mir offenbart, den noch nie jemand zuvor erblickt hatte. Den einsamen und verzweifelten Meermann, den ich vor allen versteckt hielt. Doch ich konnte nicht.
Ihretwegen.
In diesem Moment musste ich stark sein. Ich musste ihr den Schutz und den Rückhalt geben, den Thórvi so sehr gebrauchen konnte. Den ich ihr geben wollte, obwohl sie mich nie darum gebeten hatte. Aus dem einzigen Grund, weil ich ihr Fels in der Brandung sein wollte. Sie sollte merken, dass sie sich auf mich verlassen konnte. Dass ich auch in schlechten Phasen ihres Lebens da sein würde, um sie zu halten und mit ihr zu weinen, wenn sie es zulassen würde.
Womöglich hatte ich mir umsonst Sorgen vor diesem Treffen gemacht. Es fühlte sich normal an, mit ihr hier zu sitzen, sie in den Armen zu halten, während die Trauer die Oberhand über ihren Körper gewann. Sie über einen Mann reden zu hören, der ihr Herz ebenso stark in Besitz genommen hatte wie sie meines.
Vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt.
Ich brauchte Hawke nicht als Gegenspieler zu betrachten, denn das war er nie gewesen. Er war Teil dieser Beziehung. Ein Stück aus ihrem Leben und somit auch aus meinem. Hawke war daraus nicht wegzudenken, und in diesem Moment glaubte ich fest daran, dass wir es hinbekommen hätten.
Der lyrische Krieger und ich hätten Thórvi all das gegeben, was sie verdient hätte. Gemeinsam, und ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen oder einen Anspruch auf sie zu erheben. Wir hätten es geschafft, eine Beziehung zu dritt zu führen und glücklich zu sein. Das Einzige, was uns dazu gefehlt hatte, war die Zeit zusammen als Einheit und Team.
Für diesen Geistesblitz war es eindeutig zu spät.
Ich glaubte nicht mehr daran, dass wir Hawke zurückbekommen würden. Hjerdíz würde ihn nicht freiwillig gehen lassen, und wir wussten nicht, was die dunkle Magie mit ihm anstellte. Womöglich wäre er danach nicht mehr der, der er vorher gewesen war, und das wollte ich Thórvi – und mir – nicht antun müssen.
»Ich werde noch etwas erledigen müssen, bevor wir in die andere Welt aufbrechen.«, konnte ich ihre klare und gefasste Stimme an meiner Brust hören. Als sie sich aus meiner Umarmung löste, strich sie die letzten Tränen von ihrer Wange und blickte mich herausfordernd an. Das pulsierende Weiß ihrer Augen bohrte sich in mein Herz, und für einen Moment schien es auszusetzen. »Was hast du vor?«, fragte ich.
»Ich werde den Handel mit den Weberinnen zu Ende bringen und vielleicht einen alten Freund von mir aufsuchen müssen. Obwohl ich nicht sicher bin, wo ich anfangen sollte, nach ihm zu suchen.«
»Was willst du gegen den Handel tun?«, kam es aus meiner Kehle geschossen, ohne, dass ich den verräterischen Ton in meiner Stimme unterdrücken konnte. Ich würde sie ganz sicher nicht allein gehen oder in ihr Verderben rennen lassen.
»Mein Vater hat mir erzählt, wo ich die Robúlái finden kann und mir angeboten, mich auf diesem Weg zu begleiten.«, sagte Thórvi, hielt sich aber in der ganzen Zeit mit ihrer Euphorie zurück. Obwohl es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung war, wollte sie anscheinend nicht zu glücklich darüber klingen. Hatte sie Angst, sich selbst falsche Hoffnungen zu machen?
In meinen Gedanken setzte sich die Erkenntnis über ihre Worte fest. »Du willst den Weberinnen die Robúlái als Wirte anbieten!« Ich wusste, dass ich sie nicht danach fragen musste. Ihr Plan war so offensichtlich, dass es mich zu überrumpeln drohte. Stolz füllte meine Brust.
Die Frau vor mir war schlauer und gerissener, als ich es jemals für möglich gehalten hätte.
»Das stimmt. Die Robúlái sind unnütze Geschöpfe und Gefangene. Ein Dorn in unser aller Augen. Keiner würde uns einen Vorwurf machen, wenn wir sie den Weberinnen übergeben.« Ein kleines freches Grinsen huschte über ihre Züge, das sogleich wieder verschwand, als sie das Verlangen in meinen Augen erkennen musste, das ich nicht länger schaffte, zu verstecken.
Diese Frau machte mich wahnsinnig.
Und ihr schlaues Köpfchen war attraktiver als ihr Körper in diesem viel zu engen Kleid.
»Was ist das für ein Freund, dem du unbedingt einen Besuch abstatten willst?«, versuchte ich, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Ich musste es schaffen, die Hitze aus meinen Wangen und meinen Lenden zu vertreiben. Dies war der absolut unpassendste Augenblick für die Vorstellung, Sex mit Thórvi zu haben.
»Eigentlich ist er gar kein richtiger Freund.«, hörte ich sie sagen, wobei ich bemerkte, dass sie sich nervös über den schwarzen Stoff an ihren Beinen strich und es automatisch weiter nach unten zog. Ich konnte ihr wirklich nichts vormachen. »Er ist ein Abtrünniger und zählt die Meere und ein Schiff namens Black Diamond zu seiner Heimat. Es ist viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, doch noch immer verbindet unser beider Leben ein Handel.« Thórvis Finger glitten an ihrem linken Ohr entlang, und als sie die Haare auf die andere Seite schob, entblößte sie ein weiteres rotes Mal, das sich dahinter versteckt gehalten hatte.