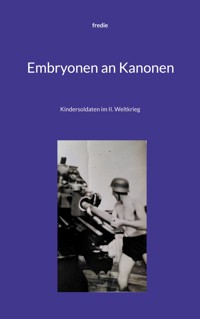
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Dritten Reich versuchte Hitler die Jugend im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen. Es galt das "Führerprinzp". Ausgehend von der Behauptung "Der Führer hat immer Recht" ergab sich das verpflichtende Motto:"Führer befiehl, wir folgen Dir!". Der Autor wuchs in dieser Zeit auf und erinnert sich an Begebenheiten, die er ganz im Gegensatz zum Führerprinzip erlebte und sich so gegen die Selbstaufgabe des Individuums richtete. Dazu gehörte auch der Mut des Batteriechefs der schweren Flak-Abteilung 4./326, Oberleutnant Johannes Klant, den Führerbefehl zu missachten, um so allen als Luftwaffenhelfer eingezogenen ADO-Schülern des Jahrganges 1928 das Leben zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Prodöhls
Die Diebels
Die Vereinigung
Das Dorf Britz
Planung und Errichtung der Hufeisensiedlung Britz
Ein neues Leben beginnt
Fredi ist da!
Ein wohlbehütetes Leben
Ein eigenes Zimmer und ein sorgenfreies Leben
Die »Klippschule«
Sexuelle Aufklärung
In Liebe aufwachsen
Erziehungsmethoden
Vater und die NS-Ideologie
Nahrhafte Begebenheiten
Oma und Opa
Prodöhl’sche Familienfeten
Was aus ihnen wurde
Cousine Häsi
Kristallnacht
Häsi und ihr Geheimnis
Ausflüge und Reisen
Der »Diebel-Clan«
Im Dienste der Organisation Todt
Einschulung in die ADO
Die Aufnahmeprüfung
Die Lehrer
Papa Hoernigk und die Altstoffsammlung
Angriff auf das Ärgerzentrum der Lehrer
Fauler Lümmel
Klassenkameraden
»Arbeit adelt!«
Kinderlandverschickung
Auf nach Kattowitz
Hitlerjugend
Jungvolkführer-Freundschaft
Ausbildungsfähnlein
Rückzug und Aufstieg
Pimpfenführer ohne Pimpfe
Bubis Leid
Fahnenflüchtiger Lagermannschaftsführer
Erneute »Flucht«
Weihnachtsgans-Besorgungsauftrag
Ein Einberufungsbescheid flattert ins Haus
Fliegerbombe statt »Weißer Traum«
»Ausgebombt« und Umzug
Jetzt Luftwaffenhelfer, nicht mehr ein »Knabe«
Wir lernen das »Flakeinheitstempo« und manches dazu
Das geheimnisvolle MÜO
Plaudereien an der Strippe
Müder Krieger
Am Geschütz »Emil«
Der Schulunterricht geht weiter
»Truppenverpflegung«
Mein Freund, der Unteroffizier Gruber
Rheumatische Romantik
Im Kloster vom Guten Hirten
Freienbrink
Und weiter geht der Schulunterricht
»Schleifen« im Flakeinheitstempo
Nächste Lazarettbekanntschaft, und dann kam ein Hammer
Das erste Mal aus Versehen volltrunken
Lazarett-Finale
Letzter Flakeinsatz gegenüber dem Hydrierwerk Pölitz bei Stettin
Erster Fronteinsatz bei Schwedt an der Oder
Zweifrontenkampf in Greifenhagen
Im Artillerieeinsatz bei Radekow und Rosow
Bratkartoffeln in Angermünde
Letzter Einsatz mit »gebremstem Schaum«
»Urräh – urräh – urräh«
Scheißhauskrähen und anderes Ungeziefer
»Vorwärts, Kameraden, wir hauen ab!«
Brüssow
Neubrandenburg
Malchin, Teterow, Stavenhagen
Bruel
Schwerin – in amerikanischer Gefangenschaft
Eutin in englischer Gefangenschaft, von Deutschen bewacht!
Endlich frei! – Diemarden bei Göttingen
Über die »grüne Grenze« nach Berlin
Politischer und sonstiger Nachholbedarf
Jugendarbeit bei den »Falken«
Die Luftbrückenzeit
Kinderzeltlager im Glienicker Schlosspark
Politische Bildungsarbeit oder Spiel und Freude
Meine Laienspielgruppe
»Schrippenmeier« und andere Freuden
Geburtstagsüberraschung
Papa hatte wieder einmal recht
Die Prodöhls
Ich werde nicht wetten, aber ich glaube nicht, dass das Dorf Zippnow dem geschätzten Leser bekannt sein dürfte. Wie auch? Es heißt heute Sypniewo und liegt an der Straße Nadarzyce–Jastrowie im heutigen Polen. Bis 1945 gehörte es zum westpreußischen Regierungsbezirk Deutsch Krone und war mit Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 enger mit dem übrigen Deutschland verbunden. Insbesondere die polnisch-katholische Geistlichkeit versuchte, einen deutschen Einfluss zu unterwandern. Erst 1876 konnte der Gebrauch der deutschen Amtssprache zugelassen werden, was von polnischer Seite als Unterdrückung des polnischen Volkstums und als Germanisierungsmaßnahme angeprangert wurde. Die Arbeitslosigkeit in dieser Region war groß. Die bestehenden Nationalitätenprobleme und »Kulturkämpfe« belasteten die Bevölkerung zusätzlich.
Es muss so um das Jahr 1877 gewesen sein, also ein Jahr nach Einführung der deutschen Amtssprache, da verliebte sich eines der hübschesten Mädel Zippnows, Anna Sack, in den drei Jahre älteren Arbeiter Lorenz Prodöhl. Sie »gingen« miteinander, und da beide katholischer Herkunft waren, sehnten sie sich nach der Lust bringenden Hochzeitsnacht und heirateten alsbald.
Sie bewohnten eine kleine zum Gutsbetrieb gehörende Instwohnung und arbeiteten tagsüber als Saisonarbeiter auf dem Felde. Die Entlohnung, die sie für ihre schwere Arbeit erhielten, war gering. Sie reichte gerade aus, um leben zu können. Wenn die Saison vorüber war, versuchten sie sich im Dorf andere Arbeit zu verschaffen. Pille und Präservative gab es noch nicht, der Begriff »Verhütung« war auch noch nicht erfunden und der Koitus interruptus wurde von der katholischen Kirche verdammt. Man war aber sehr katholisch und voller Liebe zueinander. Und die Abende, frei von Fernseher, Radio, Zeitung und sonstigen Lustbarkeiten der heutigen Wohlstandsgesellschaft, dienten dazu, diese Liebe auszuleben. Das Ergebnis ließ sich sehen:
1880 wurde Eduard, ihr erster Sohn, geboren. Martin kam 1881 auf die Welt und Mathilde 1884. 1887 folgten Johann und 1889 Anna. Tochter Lucia erblickte 1893 das Licht, 1896 kam Bernhard an die Reihe und am 13. Juli 1898 war endlich Maria dran, Maria, meine Mutter! Aber damals wusste ich es noch nicht. Sie übrigens auch nicht! Es folgten nach ihr in Britz noch Lorenz (1902) und Paul (1905).
Mutter Anna war eine tüchtige Hausfrau, die ihre Familie zusammenhielt und in erster Linie um das Wohl ihrer zehn Kinder besorgt war. Trotz der leeren Kassen gelang es ihr immer wieder, ihre Kinder satt zu bekommen. Vater Lorenz unterstützte sie dabei, so gut er konnte.
Ende des 19. Jahrhunderts versuchten sie mehrmals aus ihrem Zippnow auszubrechen, um in Berlin Fuß zu fassen. Doch auch hier waren freie Arbeitsstellen rar. Zudem wurde ja auch noch eine Wohnung gesucht. Die Prodöhls ließen aber nicht locker.
1898 gründeten die Gebrüder Friesecke in Britz bei Berlin eine Kunststeinfirma, in der Fassaden- und Architekturteile, Kunstgranit- und Gehwegplatten, Betonrohre und anderes nützliches Brauchbares hergestellt wurden. Die Frieseckes suchten tüchtige Arbeitskräfte, und das erfuhren auch die Prodöhls im fernen Zippnow. Da galt es doch, mit Sack und Pack gen Berlin zu reisen und bei Frieseckes vorstellig zu werden. Vater Lorenz machte es auch nichts aus, dass die Firma Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs war. In der Chausseestraße, direkt am Teltowkanal, hatte die Firma nicht nur ihr großes Betriebsgelände, sondern auch ein kleines Häuschen, in dem eine Wohnung, bestehend aus Küche und drei Stuben, von einem Friesecke’schen Mitarbeiter gemietet werden konnte. Und Lorenz hatte Glück. Seine Familie bekam die Wohnung und er einen Arbeitsplatz in dem Kunststeinwerk.
Maria Prodöhl
Die älteren Kinder suchten sich in Berlin Arbeit und verließen bald die gemeinsame Wohnung, zumal die drei kleinen Stuben für die Großfamilie keinen ausreichenden Platz boten. Übrigens gab es kein Bad. Die dringenden Geschäfte mussten auf einem Plumsklosett, das unweit des Hauses stand, verrichtet werden. Eine auf dem Hof stehende Pumpe diente auch der Körperpflege. Und da Mutter Anna sehr auf Reinlichkeit achtete, waren ihre Töchter und Söhne abgehärtet und benötigten keine jährliche Grippeschutzimpfung.
In der nicht allzu großen Küche spielte sich das Leben der Großfamilie ab. Hier wurde gekocht, geflickt, gegessen und geklönt. Mutter Anna war nicht nur eine gute Köchin, sondern verstand es auch, die Familie zusammenzuhalten. Die Kinder vertrauten ihr, wie auch sie es ihnen gegenüber tat. Sie hatten ein herzliches und liebevolles Verhältnis zueinander. Wenn unter den Kindern irgendetwas nicht in Ordnung war, nahm Mutter Anna sich die Zeit, es zu richten, zu schlichten oder zu trösten. Meine Cousine Hertha beschrieb sie so: »Für mich war sie die Großmutter, wie man sie aus den Märchen kannte. Ich konnte mich als Kind oft in ihren Schoß flüchten!«
Um den Lebensunterhalt der noch im Hause lebenden fünf erwachsenen Kinder nebst ihrer Eltern zu sichern, nahm Mutter Anna Heimarbeit auf, bei der ihr ihre Töchter Maria und Lucia sowie ihr Sohn Lorenz tüchtig halfen. Die von einer Spangenfabrik gelieferten Spangen und Kämme mussten teilweise zusammengeklebt und zu jeweils einem Dutzend auf Kartons aufgesteckt werden. Wahrlich, eine sehr stupide Arbeit. Doch unsere fleißigen Kammkleber machten sich ihre Arbeit durch fröhlichen Gesang althergebrachter Moritaten und Küchenlieder erträglich.
Trotz der bestehenden finanziellen Sorgen ging es im Prodöhl’schen Hause immer fröhlich zu. Vater Lorenz, Mitglied und zweiter Schriftführer des Britzer Katholischen Män nervereins St. Joseph, liebte die Geselligkeit und hatte die Gabe, allseits für gute Laune und Stimmung zu sorgen. Er sang sehr gern und wusste viele wahre und geflunkerte Geschichten aus seiner Zippnower Zeit zu erzählen. Seine geheimnisvollen Gruselgeschichten sollen manchen seiner Zuhörer den Schlaf geraubt haben.
Es nahm nicht wunder, dass Prodöhls Kinder in der im Hause vorherrschenden freundlichen Atmosphäre nicht »weit vom Stamm fielen«. Alle waren sangesfreudig und zu Späßen aufgelegt. Sie feierten gern im Familienkreis und einige trugen durch Gesangseinlagen oder Sketche zur allgemeinen Erheiterung bei. Lieder und Sketche waren nicht immer ganz stubenrein, aber das tat selbst dem katholischen Glauben keinen Abbruch.
Sohn Lorenz sollte noch in der Heimat als Priester ausgebildet werden. Nach einigen katholischen Seminaren verging ihm aber die Lust und er erlernte ein Handwerk. Als treuer Katholik kannte er die Bibel und wusste aus den Seminaren auch mit ihr umzugehen. Diese Kenntnis und sein Talent nutzte er bei Familienfeierlichkeiten weidlich aus. Wenn der Ruf erscholl: »Lorenz, mach mal den Pfarrer!«, verschwand Lorenz ins Nebenzimmer, zog sich um und erschien in einem hinten zugeknöpften schwarzen Mantel, auf dem Kopf eine bis an die Augenbraue reichende Baskenmütze, breitete die Arme aus und begann seine Predigt: »Und es begab sich zu seiner Zeit, da die Elbe brannte und die Hunde und Katzen nach Stroh liefen, um das Feuer zu löschen. Doch sie wurden nicht Herr über das Feuer. Da riefen die Katzen alle Hasen zu Hilfe, um das Feuer zu löschen. Sintemalen waren es aber der Hunde viele und – es stand schon geschrieben: Viele Hunde sind des Hasen Tod…« – Gegen Ende befasste er sich in seiner Predigt mehr und mehr mit den geheimen und Lust befriedigenden weiblichen Körperteilen. Abschließend wurde die »Gemeinde« imNamen des Herrn gesegnet und zu einem kräftigen Schluck aus der Pulle aufgefordert.
Die Diebels
Zu jener Zeit, da für Anna und Lorenz die Reichshauptstadt lockte, gebar Luise Pauline Mühmel, verehelicht mit Friedrich Wilhelm Diebel, am 5. Dezember 1892 in Berlin-Neukölln einen Knaben namens Franz Emil Paul, meinen Vater. Aber auch das wusste ich damals noch nicht!
Gleich den Prodöhls hatten sie das Landleben satt gehabt und nach langem Hin und Her in Berlin Fuß gefasst. Sie waren ursprünglich in dem zum Deutschen Reich gehörenden Kreis Grünberg – in Schlesien, nahe der Mark Brandenburg gelegen – zu Hause und hatten Ähnliches erlebt, wie ihre fahnenflüchtigen Landsleute aus Westpreußen. Paul focht dies aber nicht sonderlich an, er machte sich auf den Weg, ein echter Berliner zu werden.
In der in Neukölln gelegenen Juliusstraße, die von der Chausseestraße abging, verbrachte er seine ersten Jugendjahre. Er ging auf die »Klippschule«, wie er fürderhin die Volksschule nannte, war ein guter Schüler mit ordentlichem Betragen, was ihn aber nicht davon abhielt, sich zur Verteidigung der Juliusstraßenehre in regelmäßigen Abständen Straßenschlachten mit den ihre Ehre verteidigenden Lümmel aus der Glasower Straße zu liefern. Bei diesen Auseinandersetzungen gab es weder Tote noch Schwerverletzte. Ein paar Blessuren trug wohl ein jeder mit nach Hause und ließ sie dort mütterlich behandeln. Allerdings gab es abends für Paul vom körperlich hart arbeitenden Steinsetzer Wilhelm Diebel ein paar väterlich gar nicht so gut gemeinte Maulschellen.
Mit 15 Lenzen begann Paul eine Lehre als »Schreiberlehrling« in der Fakturenabteilung der Annoncenexpedition August Scherl und wechselte dann als Kontorist und Registrator zur Annoncenexpedition Jacques Albachary.
Paul Diebel
Als 1914 Kaiser Wilhelm furchterregend mit dem Säbel rasselte, heiratete er noch schnell das Fräulein Martha Sorique und zog am 7. Dezember 1914 als Landsturmmann der 51. Kompanie des 11. Armee-Bataillons aus, die Franzosen zu verhauen. Wie wir wissen, kam es in Frankreich zu lang anhaltenden Stellungskämpfen, die auf beiden Seiten unzähligen Menschen das Leben kosteten. Paul hasste zwar den Krieg, erfüllte aber andererseits jederzeit seine Pflicht. So erhielt er für vorbildliche Durchführung eines Spähtrupps das Eiserne Kreuz II. Klasse. Aber dennoch verriet ihn die Heimat ganz hinterlistig und schnöde. Er merkte es allerdings erst, nachdem er während seines Heimaturlaubes einige illustre Nächte mit seiner flotten Martha verbracht hatte. Für ihn war es äußerst peinlich, als er, wieder an die Front zurückgekehrt, an Tripper erkrankte. Er ließ sich von seinem Luxusweib, das, während er im Felde um die Ehre des Kaisers oder so kämpfte, ihren Körper gegen entsprechendes Salär vermietet hatte, scheiden. Am 13. Januar 1919 wurde er – inzwischen zum »überzähligen Gefreiten« ernannt – infolge Demobilmachung aus dem Wehrdienst nach Britz in die Chausseestraße 92 entlassen.
Die Zeiten nach dem irrsinnigen Krieg waren alles andere als rosig. Die große Arbeitslosigkeit und Hungersnot, die bereits während des Krieges bestanden hatte, verstärkte sich jetzt durch die zurückkommenden Krieger. Bereits 1910 wurde in Britz der Straßenbahnhof in der Gradestraße, nahe seinem Wohnsitz, eröffnet. Paul hatte Glück. Er bewarb sich dort und erhielt einen Arbeitsplatz als Straßenbahnschaffner. In dieser Eigenschaft klingelte er sich auch oft auf einer der Linien 21, 28, 58 oder 55 durch die Chausseestraße, vorbei an dem auf dem Friesecke’schen Gelände stehenden kleinen Wohnhaus Nummer 64. Irgendwie hatte Paul spitzgekriegt, dass dort noch eine hübsch anzusehende Maria frei herumlief. Doch hinter Maria war auch ein gewisser Otto her, dessen Frau Anna verstorben war und der nun eine Mutter für seinen einsamen Sohn suchte. Vergeblich! Maria roch den Braten. Sie wollte eigentlich noch gar nicht unter die Haube. Doch als besagter Paul um sie buhlte, verfiel sie seiner charmanten Art. Fortan gingen sie miteinander. Und die Eltern hatten noch nicht einmal etwas dagegen! Paul, nicht dumm, hatte sich nämlich vorerst die Sympathie der wachsamen Mutter Anna gesichert. Er begrüßte sie immer mit Kusshand und behandelte sie als Dame. Paul verehrte eben Frauen, eine Eigenschaft, die er trotz seiner Trippererfahrung nicht ablegte.
Die Vereinigung
Es kam, wie es kommen musste (denn sonst wäre ich wohl nicht existent): Am 17. Juni 1922 heiratete der geschiedene Straßenbahnschaffner Paul Diebel die Fabrikarbeiterin Maria Prodöhl. Eigentlich wollten sie sich kirchlich trauen lassen. Beide kamen ja aus einer gläubigen katholischen Familie, und besonders Paul war recht bibelfest. Einer der bei der Anmeldung zur Trauung die Personalien aufnehmenden Nonne gefiel aber Pauls nicht gerade knitterfreier Papiermassenanzug (es war sein einziger!) nicht und sie erlaubte sich die Bemerkung, dass er mit diesem Anzug doch wohl nicht die Kirche betreten wolle. Das hätte sie nicht sagen sollen. Paul nahm seine Maria an die Hand und verzichtete auf die kirchliche Trauung. Er bekannte sich fürderhin in Glaubensfragen nur noch als »Dissident«.
Die Hochzeitsfeierim Hause Chausseestraße 64 sollte für das jüngste Mädchen, Liebling der Eltern und seiner Geschwister, unvergessen bleiben. Es wurde gesungen, Sketche wurden dargeboten und Reden gehalten. Das Paar erhielt viele Geschenke und wurde mit Blumen förmlich überschüttet. Übrigens war es die einzige Hochzeitsfeier im Hause und mangels Nachwuchses auch die letzte. Die ganze Familie hatte dafür gespart, jeder Reichspfennig ging in den hochzeitlichen Sparstrumpf und sorgte für eine gelungene Feier.
Die Jungvermählten erhielten in der kleinen Wohnung eine Stube, in der sie ihre ersten Ehejahre verbringen konnten. Maria arbeitete weiterhin in der Kammfabrik und Paul klingelte zunächst noch weiter als Straßenbahnschaffner. Später gelang es ihm, als Expedient bei einer Berliner Verlagsgesellschaft unterzukommen.
Das Dorf Britz
Maria und Paul liebten ihr Britz. Paul wollte mehr über »sein« Britz wissen und hatte Gelegenheit, sich in seiner Verlagsgesellschaft mit entsprechender Literatur zu versorgen. Und so erweiterte er sein Wissen über die Entwicklung dieses Dorfes bei Berlin (erst seit 1922 gehört es zu Berlin):
Das genaue Geburtsdatum des Dorfes Britz konnte er in den Annalen kaum finden. Es wird vermutet, dass so im 13. Jahrhundert unter dem Einfluss der Askanier eine Ansiedlung gegründet wurde. Erstmals werden die Eigentumsverhältnisse des Dorfes »Britzik« 1375 erwähnt, das zu der Zeit aus 58 Hufen bestand. Die Familie, die sich später »Britzke« nannte, war bereits im Besitz der Gerichtsbarkeit, der Wagendienste und des Patronats.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), von dem auch Britz nicht verschont wurde, wechselte in kurzen Zeitabständen ein Besitzer den anderen. Namen wie der von Hofmarschall von Erlach und Graf Friedrich Wilhelm von Schwerin gingen – wenn auch nur kurz – in die Annalen ein.
Nachdem Britz zum Allodialgut erhoben worden war, erwarb es 1719 Heinrich Rüdiger von Ilgen, der Wirklich Geheime Staats- und Kabinettsminister Friedrich Wilhelms I., für 36.000 Taler. Von Ilgen, ein Mann von Genialität und Sarkasmus, war es nicht vergönnt, das Gut weiter auszubauen. Er verstarb im Dezember 1728. Nach seinem Tode übernahm seine Tochter Charlotte, Louise Freifrau von Knyphausen, den Besitz. Ihre Erbin, Gräfin Hilma Maria von Hertzberg, geborene Freiin von Knyphausen, überließ 1789 das Allodialrittergut Britz ihrem Gemahl, dem Königlichen Kabinettsminister Ewald Friedrich von Hertzberg, zum Taxwert von 42.000 Talern. Hertzberg hatte Maria, eine Enkelin von Ilgens, geheiratet, soll aber seine Frau nur kurz bei der Trauung gesehen haben. Es heißt, dass er nach der Trauung in der Britzer Kirche seinen Degen zwischen sich und seiner Frau legte.
Paul, der Frauen verehrte – seine Schwiegermutter, der er auch nach seiner Hochzeit mit Maria noch immer die Hand küsste und die er bis zu ihrem Tode siezte –, war mit Recht empört, als er das lesen musste. Und dann hieß die so Gedemütigte auch noch so wie seine ihm Angetraute!
Von Hertzbergs Maria wurde tiefsinnig. Sie bekam eine Dienerin und hielt sich mit ihr im sogenannten Irrgarten des Schlossparkes auf. »Dennoch«, sagte sich Paul, »Hut ab vor Ewald Friedrich!« Er, der treue Berater des Alten Fritzen, tat für das Gut und Dorf Britz sehr viel. Trotz seiner anstrengenden Tätigkeit im Staatsdienst kümmerte er sich viel um seine Güter. So oft es ihm die Umstände gestatteten, weilte Hertzberg nicht nur in Britz, um sich unter dem Laubdach hundertjähriger Baumriesen von den Staatsgeschäften zu erholen, sondern er sorgte sich auch um das Wohl und Wehe seiner Untertanen. Die Leibeigenschaft bestand zu seiner Zeit noch, war aber für ihn bedeutungslos. Er suchte, dem ollen Fritz gleich, das persönliche Gespräch mit jedem seiner Leute. So entstand ein Vertrauensverhältnis, das für die weitere Entwicklung der Gemeinde sehr förderlich war.
Nachdem Minister Hertzberg im Jahre 1786 wegen seiner außerordentlichen Verdienste den Grafentitel abgestaubt hatte, verstarb er im Mai 1795 in Berlin und wurde im nachfolgenden Juni im Gewölbe der Britzer Kirche beigesetzt. Seine rothaarige Maria verschied ein Jahr später. Sie ruht nun – trotz der Degengeschichte – neben ihrem Gemahl in jenem »Erbgewölbe«.
Nach dem Tode Hertzbergs ging das Gut an seinen Bruder, den Rittmeister Ernst Rudolph Graf von Hertzberg, über. Das Gut war zu dieser Zeit nahezu eine Musterwirtschaft. Die Brauerei und die Brennerei bildeten zwei wichtige Faktoren im Betriebe. Die 70 bis 80 Kühe friesischer Rasse wurden schon damals mit der sogenannten »Schlempe«, dem Rückstand aus der Spritbrennerei, gefüttert. Ernst Rudolph ließ auch eine große Maulbeerbaumplantage anlegen, um die Seidenraupenzucht zu intensivieren. Die Seide wurde damals in Britz nicht nur gewonnen, sondern auch gesponnen und gewebt.
Nachdem Ernst Rudolph im März 1805 verstorben war, erbten das Gut seine beiden Kinder Dorothea und Albertina Augusta Gräfin von Hertzberg sowie Ewald Friedrich Georg Wilhelm Julius (Paul war es bei seiner Recherche nicht möglich, noch mehr Vornamen aufzutreiben) Graf von Hertzberg. Denen gelang es in 19 Jahren, das Gut vollkommen herunterzuwirtschaften, das dann Baron von Eckardstein erwarb.
Vom Jahre 1824 an befand sich das Rittergut dann erstmals in bürgerlichen Händen. Besitzer wurde Johann Karl Jouanne. Er war als tüchtiger Landwirt bekannt, krempelte die Ärmel hoch und versetzte im Laufe der Jahre das Gut wieder in seinen ehemaligen mustergültigen Zustand. Wenige Jahre nach seinem Tode verkauften Johanns Kinder das Gut an den Geheimen Archivrat Adolf Friedrich Riedel, der es drei Jahre später an den Kaufmann und Fabrikbesitzer Wilhelm August Julius Wrede weiterverscheuerte.
Die Wredes taten alles, um das Gut Britz in mustergültiger Verfassung zu erhalten. Unter ihrem Einfluss wurde der Gutspark neu gestaltet. Das Schloss ließen sie 1883 vollständig umbauen.
Planung und Errichtung der Hufeisensiedlung Britz
Im Jahre 1924, zwei Jahre nachdem das Dorf Britz zu Groß-Berlin gehörte, erwarb die Stadt das Rittergut von den Erben des 1895 verstorbenen Rittergutsbesitzers Wrede. Die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften »Einfa« (eine Tochter der »Gehag«) und »DeGeWo« kauften ihrerseits von der Stadt große Geländeteile, um darauf moderne, zeitgemäße Wohnungen zu erschwinglichen Mieten zu bauen und diese rationell und vorteilhaft zu verwalten.
Bruno Taut, Architekt und Stadtplaner bei der Gehag, war zusammen mit dem Stadtbaurat Martin Wagner für die Planung einer neuen Siedlung auf dem erworbenen Gelände verantwortlich. Beide entwickelten das stadtplanerische Konzept der Britzer Hufeisensiedlung.
In sieben Bauabschnitten entstanden in den Jahren 1925 bis 1932 1.072 Wohnungen, von denen 472 in aneinandergereihten Einfamilienhäusern und 600 in dreigeschossigen Mietshäusern liegen. Der Innenbereich des »Hufeisens« mit dem Teich bildete die dominierende Freifläche und verband den Bereich mit der Fritz-Reuter-Allee als zentralem Kommunikationsbereich mit Versorgungseinrichtungen. Taut baute für die Gehag im vom Bauhaus inspirierten Stil der »neuen Sachlichkeit« den westlich von der Fritz-Reuter-Allee gelegenen Bereich, während östlich der ochsenblutfarbigen Mietshausfront die DeGeWo-Wohnanlage »Am Eierteich« entstand. Die von der DeGeWo beauftragten Architekten Engelmann und Fangmeyer orientierten sich dabei an der traditionellen Formensprache mit verspielten und romantisierenden Elementen.
Ein neues Leben beginnt
Paul und Maria wohnten noch immer in der zu der elterlichen Wohnung gehörenden Stube. Ihre Bemühungen, eine eigene Wohnung zu erhalten, scheiterten wegen der bestehenden Wohnungsnot. Inzwischen hatte Maria am 25. Februar 1926 ihren Sohn Günter geboren, der durch einen tragischen Unglücksfall im Alter von sieben Monaten verstarb. Trauer und die beengten Wohnverhältnisse ließen das junge Ehepaar schier verzweifeln. Doch Paul, der ja die Entwicklung des Rittergutes Britz verfolgt hatte, blieb nicht untätig. Er bewarb sich bei der DeGeWo um eine Wohnung in der Hufeisensiedlung. Freunde und Verwandte hielten ihn für verrückt bis größenwahnsinnig, wurde doch vermutet, dass die Mieten in dieser Wohnanlage für einen wie ihn unerschwinglich sein würden. Paul ließ sich nicht davon abbringen, war sich aber selbst darüber im Klaren, dass die finanzielle Decke sehr eng werden würde. Seit 1923 hatte er zwar einen sicheren Arbeitsplatz als Anzeigenbuchhalter bei der Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin, mit seinem Monatsgehalt konnte er sich aber keine großen Sprünge leisten. Er musste sich darüber klar sein, dass er mit seinem Wohnungswunsch ins kalte Wasser sprang. Und Paul sprang!
Anfang 1928, Maria war in freudiger Erwartung eines neuen Gewächses, erhielten sie nicht nur die Zusage, sondern auch eine im zweiten Stockwerk des Hauses Parchimer Allee 60 gelegene 2-Zimmer-Neubauwohnung mit einem an der Nordseite angepappten Balkon.
Fredi ist da!
Am 19. Juli 1928 herrschte in der Neubauwohnung eine Riesenaufregung. Maria lag in den Wehen, umringt von einer Hebamme, dem Arzt Dr. Brandt, einer Nonne und… Paul! Der Ehemann war sich nicht zu schade, nein, er war nachgerade fest gewillt, Zeuge bei der Entbindung seiner geliebten Frau zu sein. Gewiss, die Hebamme drängte ihn ein wenig Richtung Tür, aber immerhin war Paul seiner Zeit weit voraus und kehrte sich einen Kehricht um das Getuschel im Bekanntenkreis. Er wollte Zeuge sein! Übrigens muss die Nonne irgendetwas Unpassendes zu Pauls Verhalten gesagt haben; denn einige Monate später verlor die katholische Kirche ein weiteres Mitglied. Maria wurde Protestantin! Er blieb weiter Dissident.
Ich schrie furchterregend, als man mich aus dem geschützten Mutterleib in die mir vollkommen unbekannte Welt hinauskomplimentierte. Gefiel mir gar nicht, aber was sollte ich machen? Ich war jetzt mit einem Mal da und meine Mutter hieß Maria, mein Vater Paul. Und mich nannten sie Fredi, mit dem zweiten Namen Heinz. Alle drei hießen wir Diebel.
Ich will ja nicht protzen, aber immerhin wog ich nachweislich einer Eintragung der Städtischen Kleinkinder- und Säuglingsfürsorgestelle Nummer »römisch drei« am 17. August 4,680 Kilogramm und war 56 Zentimeter lang. Mama wog 76,7 Kilogramm. War auch nicht schlecht! Der letzten Eintragung in der Wiegekarte am 31. Mai 1929 zufolge hatte mich die gute Muttermilch auf 11,530 Kilogramm Lebendgewicht gebracht. Ein Jahr später wurde ich zum ersten Male »mit Erfolg« geimpft und genügte somit schon in diesem zarten Alter erstmalig meiner gesetzlichen Pflicht. Die Zukunft empfing mich mit offenen Armen!
Ein wohlbehütetes Leben
Mit Nuckel oder Daumen der linken Hand (»das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen«) begann ich meine erste Lustbefriedigung, die sich zur Wollust steigerte, bekam ich mit meiner rechten Hand ein Stück Seide zu fassen, das ich sanft zwischen Daumen und Zeigefinger rieb. Ich war dann das artigste und zufriedenste Kind zumindest in der Parchimer Allee 60. Ich kam bald dahinter, dass die Damen jener Zeit ihre nicht immer den heutigen Körpermaßen entsprechenden Figuren mit seidenen Unterröcken umhüllten, die sanft vor meinen Augen schwebten. Wer konnte es mir verwehren, dass meine kleinen Händchen zugriffen und wollüstig meiner Lieblingsbeschäftigung nachgingen? – Den Damen war es recht, sie ließen den Winzling gewähren und unterhielten sich derweilen angeregt. Um allen Vorurteilen zu begegnen: Es ging mir wirklich nur um die Seide!
Neben uns wohnte die Familie Albert und Frieda Krautz mit Ursel, Rudi und Roselotte in einer gleich großen Wohnung, wie wir sie hatten. WährendUrsel und Rudi bereits das Kleinkinderalter hinter sich hatten, war »Püppi«, wie die Erwachsenen Roselotte nannten, für mich schon ein ernst zu nehmender Erdenmensch. Püppi war bei meiner Geburt gerade einmal ein Jahr und sieben Monate älter als ich, also nicht zu alt, um mit ihr nach meiner Nuckelphase ernsthaft anzubändeln. Das Verhältnis zwischen den beiden Familien entwickelte sich dank der beiden Mütter Maria und Frieda vom nachbarlichen »Sie« zum freundschaftlichen »Du«, wobei sich Frieda mit ihren deftigen Sprüchen (»So warsch, Herr Kommissarsch, es gab eins auf den Arsch und weg warsch« oder »Wird schon wer’n mit Mutter Beern, mit Mutter Born ist’s ooch jewor’n – bloß Mutter Schmitten ham’se jeschnitten«) kontaktfreudig und unkompliziert hervortat. Ein Stockwerk tiefer wohnte das Ehepaar Nicolai.Tante »Nittai« liebte Kinder und war sowohl für meine Mama wie auch für Mutter Krautz die Betreuerin, bei der man sein Kind bedenkenlos »abgeben« konnte, wenn einmal »Not an der Frau« war. Bei Tante Nittai erhielt ich auch jedes Mal ein kleines Leckerli und – als ich aus dem Nuckelalter heraus war – die »Bauchbinde« einer Havanna, die Onkel »Nittai« am Abend vorher genussvoll geraucht hatte.
»Dowitz« Fredi
Von meiner Mutter wohlbehütet, von einem Vater, der auf seinen Sohn stolz war und ihn wie ein rohes Ei behandelte (sich auch nicht scheute, ihn allein im Kinderwagen spazieren zu fahren, und damit den Spott seiner männlichen Bekannten auf sich nahm), wuchs ich, mit mir und den Meinen zufrieden, heran. Meine Mutter begann zwar alsbald, mir den Beinamen »Dowitz«, zunächst ohne Zusatz, später mit dem Zusatz »alter« zu geben, aber dies tat unserer Liebe zueinander keinen Abbruch, betrachtete ich ihn doch als gewisse Auszeichnung für irgendeinen Unsinn, der mir wieder einmal eingefallen war.
Die Wohnhäuser der Parchimer Allee 58 bis 62 umgaben mit den Blöcken der Fritz-Reuter-Allee und den Einfamilienhäusern der Dömitzer Straße mit Sträuchern abgegrenzte Wirtschaftwege, die zu den Mülltonnen- und Klopfstangenplätzen sowie zu den Gärten der Einfamilienhäuser führten. Dazwischen lagen mit kleinen Hecken umgebene Rasenflächen und zwei recht große Buddelkästen für die kleinsten Bewohner der DeGeWo-Häuser. Hier, abseits des Autoverkehrs, der jedoch mit dem heutigen kaum zu vergleichen ist, backte ich meine ersten Sandtorten und pinkelte auch mal in den zu trockenen Sand, wenn es keiner sah. Meine Mutter begleitete mich vom zweiten Jahr meines Erdendaseins an mit Strickzeug und dem Ergeiz, mir das Einsammeln der von mir verstreuten Buddelutensilien (sie nannte es »Ordnung«) beizubringen. Später kam sie dann nicht mehr mit, sondern saß mit ihrem Strickzeug oder einer Hausarbeit auf dem Balkon, von dem aus sie den Buddelkasten im Blickfeld hatte, und passte auf mich auf. Mit der Zeit hatte ich dann auch gelernt, ihrem Rufe »Fredi, raufkommen!« – meistens mit Zeitverzögerung und ohne die eine oder andere Buddelform – zu folgen. Und manchmal waren auch die Hosen nass, weil ich keine Gelegenheit gehabt hatte, ungesehen in den Sand zu machen.
Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob man meine »kleinen Geschäfte« Lingling- oder Pipimachen nannte. Ich meine, es war »Pullern«. Wenn mein Vater mit mir allein im Zickzackkurs (nicht, weil er einen über den Durst getrunken hatte – was auch selten passierte –, sondern weil ich noch halb stolpernd den Kurs angab) die Runde um die Häuser machte, war er immer sehr darum besorgt, dass ich mit trockenen Hosen zu Hause ankam. So wurde öfter eine Pause eingelegt, in der er mich an den Rinnstein stellte, meinen Puller herausholte und mit einem zischenden, enorm hohen Pfeifton mein Innerstes zur Entleerung reizte. Wenn es nicht gleich klappte, erhöhte er den Ton so lange, bis ich pullerte. Und so übergab er mich meiner Mama fast immer stubenrein.
Mein Vater wünschte sich schon längst eine größere Wohnung und möglichst – für ihn ein Traum – mit einem an der Südseite liegenden Balkon. Er bewarb sich bei der DeGeWo um eine in der Parchimer Allee 58 im ersten Stockwerk gelegene 2-Zimmer-Wohnung mit Kammer, Wohnküche, Bad und einem Südbalkon. Die Miete sollte 64,80 RM betragen, eine erhebliche finanzielle Belastung für die Haushaltskasse. Meiner Mutter, Vater nannte sie »Miekchen«, war dabei nicht ganz wohl, war sie es doch, die für die Ausgaben des täglichen Lebens verantwortlich war und in Zukunft noch sparsamer wirtschaften müsste. Aber sie vertraute ihrem Mann und setzte auch ihre Unterschrift unter den Mietvertrag.
Ein eigenes Zimmer und ein sorgenfreies Leben
Das Mietverhältnis begann am 1. Februar 1933, zwei Tage nachdem Reichspräsident Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte. Ich durchlebte gerade mein fünftes Lebensjahr und war dabei, einen eigenen Willen zu entdecken und ihn gegen meine Eltern durchzusetzen. Manchmal gelang es mir ja, aber meistens kam ich einfach gegen den Starrsinn der immer recht haben Wollenden nicht an und wehrte mich mit einem handfesten Bock. Der wiederum schien überhaupt keinen Eindruck zu schinden. Man ließ mir meinen Bock und schenkte uns beiden kaum Beachtung. Mama kommentierte meinen Auftritt höchstens mal mit der Bemerkung: »Alter Dowitz!« – In der neuen Wohnung hatte ich jetzt mein eigenes Zimmer. Es war etwa acht Quadratmeter groß, aber leider nicht beheizbar. Das focht mich nicht an, konnte ich mich doch mit oder ohne meinen Bock zurückziehen und über die Ungerechtigkeiten, die das Leben einem fast Fünfjährigen beschert, nachdenken.
Lieselotte und Fredi im Hufeisen
Die Krautzens wechselten zu dieser Zeit auch ihre Wohnung und wohnten dann in einer gleich großen Parterrewohnung, Parchimer 50. Roselotte (»Püppi« wurde sie ja nur von den Erwachsenen genannt) war für mich also immer noch gut erreichbar. Sie besaß ein aus mehreren Zimmern bestehendes Puppenhaus, das Vater Albert ihr selbst gebaut hatte. Dieses Haus hatte es mir angetan, und obwohl männlichen Geschlechts, spielte ich fast leidenschaftlich gern damit. Wenn Roselotte die Lust an diesem Spiel manchmal verlor, wollte ich kein Ende finden und machte allein weiter. Mutter Krautz holte mich dann mit dem Hinweis auf meine »sicherlich schon wartende Mama« in die Wirklichkeit zurück.
Wenn von draußen der Lockruf »Fredi, kommste runter?« ertönte, war ich fast immer bereit, ihm zu folgen, denn unten warteten die Spielfreudigen, überwiegend Mädchen, auf einen Mitspieler. Und da musste ich doch mitmachen! Ich fragte eigentlich immer Mama: »Darf ich?«, und nach dem beinahe obligatorischen »Aber um … bist du wieder oben!« sockte ich auf die Straße. Vor den an der Parchimer Allee gelegenen Häusern der Hufeisensiedlung waren mit niedrigen Hecken eingefasste Rasenflächen angelegt, die durch die Zugangswege zu den einzelnen Eingängen unterbrochen wurden. Zwischen den beiden Fahrbahnen der asphaltierten Straße verlief eine breite, grobkiesige Promenade mit einem Bestand älterer Ahornbäume. Da auf den Siedlungsstraßen selten Kraftfahrzeuge verkehrten, konnten wir auch vor den Häuserreihen gefahrlos spielen. Auf den mit Steinfliesen befestigten Bürgersteigen ließ es sich stuckerfrei mit Rollern, Holländern oder Dreirädern wunderbar fahren, während sich die Promenade weniger dazu eignete. Aber nur wenige Kinder besaßen ein derartiges Fortbewegungsgerät, weil die Väter doch nicht so viel verdienten, um sich neben dem Luxus der modernen Wohnung auch noch teure Spielsachen für ihre Kinder leisten zu können. Meiner konnte es ganz sicher nicht. So war ich auf die Gnade meiner mobilen Mitspieler angewiesen, um auch einmal »eine Runde« mit ihrem Gerät, was immer das gerade war, fahren zu dürfen. Als Alleinunterhalter im Trieseln gehörte ich, mich von Jahr zu Jahr fortbildend, bald zur Spitze aller Trieselerinnen und Trieseler der Nachbarschaft. Die Anschaffungskosten für dieses Sportgerät waren äußerst gering. Eigentlich kostete nur der »Triesel« (Kreisel), ein fünf bis zehn Zentimeter langer Holzkegel, etwas. Eine etwa ein Meter lange dünne, reißfeste Strippe wurde an einen Stock geknüpft. Das war gewissermaßen die Peitsche, mit der man den Triesel an der Erde trieb. Es kam darauf an, den Gepeitschten so lange wie möglich in Bewegung zu halten. Ein Stück Kreide, mit dem auf dem Bürgersteig ein »Hopsekasten«-Feld, unten mit »Erde« und oben mit »Himmel«, aufgezeichnet wurde, kostete auch nicht viel. Dieses Hüpfspiel war sehr abwechslungsreich und allseits beliebt. Gar nichts kostete das Spiel »Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?« Dazu benötigten wir aber eine Straße. Meistens begaben wir uns in die selten von einem Auto benutzte Dömitzer Straße. Auf der einen Straßenseite nahmen die fragenden Kinder Aufstellung. Der Fischer stand auf der anderen Seite. Beantwortete der Fischer die gestellte Frage mit »Ja«, kam von der anderen Seite die weitere Frage: »Dürfen wir rüber?«, und wenn der dann die Überquerung gestattete, rannten alle durch das tiefe Wasser und der Fischer musste wenigstens einen von ihnen fangen. Man mag erkennen oder auch nicht, dass meine Erinnerung an dieses Spiel mehr als fragwürdig ist. Ich weiß aber noch ganz genau, dass es einen riesigen Spaß gemacht hatte. Wir mussten allerdings ab und an wegen eines dennoch durchfahrenden Autos das irre Fangenspiel unterbrechen.
Fredi und Cousinen
»Vater, Mutter, Kind« war auch ein Spiel, das nur eines Stücks Kreide bedurfte. Damit wurde auf dem Bürgersteig der Grundriss eines kleinen Einfamilienhauses aufgemalt, bestehend aus Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad. Manchmal war auch ein Kinderzimmer mit dabei. Für dieses Spiel brauchte man eine Spielkameradin. Ein Junge konnte die Frauenrolle schlecht übernehmen, weil man damals die Schwulenehe noch nicht kannte. – Unser aller Führer und Reichskanzler hätte sicherlich auch etwas dagegen gehabt. – In diesem Spiel wurde oftmals Selbsterlebtes aus dem Elternhause nachgespielt. Da waltete die Frau in der Küche und bereitete das Essen vor, während der liebende Ehemann schon vor der Wohnungstür stand und »Klingelingeling« sagte. Sie öffnete, fiel aber ihrem Gatten nicht um den Hals und liebkoste ihn, sondern sagte nur: »Komm doch rein!« Und dann wurde es meistens sehr eng in dieser Wohnung. Man trat auf die Wände, sagte noch dies oder das, bis einer von beiden den Vorschlag machte, Hopse zu spielen. Und das machte dann mehr Spaß.
Ich gehe davon aus, dass Winter, die man in der Kindheit erlebt hat, immer kälter und schneereicher waren als die heutigen Winter. In den Jahren von 1934 bis 1939 war es jedenfalls die Regel. Der Britzer Kirchteich war zugefroren und zum Eislaufen freigegeben, am Ufer stand eine kleine Wärmehalle, in der man heiße Brühe und Würstchen kaufen konnte. Wer keine Schlittschuhe hatte, konnte sie sich dort auch leihen. Lautsprecher berieselten die fleißigen Läufer mit Musik. Ich hatte Kufen, die man unter die Schuhe klemmen konnte. Sie hatten auch den Vorteil, mit der Schuhgröße mithalten zu können, und konnten so jahrelang ihrem Besitzer dienen, sofern er sie auch richtig pflegte. Meine hielten jedenfalls sehr lange. – Zum Schlittenfahren standen uns nur die kleinen Hügel in der hinter den Häusern liegenden Wirtschaftsanlage, die etwas größeren im Hufeisen und am Fennpfuhl und der größte am Buschkrug zur Verfügung. Sie wurden weidlich genutzt. Mit dem Kampfschrei »Baaahhhne!« wurden unachtsam fahrende Rodler darauf hingewiesen, dass nun der Rufer käme und sie bitte schön Platz zu machen hätten, da es sonst rumste! Und so rumste es denn auch öfter. Tote waren nicht zu verzeichnen, aber es gab einige blaue Flecke.
Unter diesen schneebedeckten Anlagen hielten Rasenflächen ihren Winterschlaf, die vom Frühjahr an wieder als Zierrasen gehegt und gepflegt wurden. Zum Schutze des Rasens, der Ziersträucher und der Rosen und um die Ordnung zu überwachen, war ein Wächter angestellt, der für die Grünanlagen der Hufeisensiedlung zuständig war. Ich weiß nicht, wie er hieß, wir nannten ihn »Pupe«. Es war uns immer ein Bedürfnis, ihn zu ärgern, indem wir die ausgesprochenen Verbote missachteten. Er schimpfte dann immer wie ein Rohrspatz, konnte uns aber nichts anhaben, weil wir die Schnelleren waren. Trotzdem hatten wir vor ihm einen Heidenrespekt, denn wenn er uns kriegte, konnten nicht nur wir, sondern auch unsere Eltern viel Ärger mit der Obrigkeit bekommen. – Im Sommer hatten die Rollschuhe Saison. Sie waren auch unter die Schuhe zu schnallen und wuchsen mit der Schuhgröße mit. Auf den Asphaltstraßen in der Hufeisensiedlung ließ es sich auch fantastisch mit den Rollschuhen laufen. Abseits des Straßenverkehres fuhr es sich auf der asphaltierten Promenade allerdings sicherer.
Das in der Sexta gelernte Gedicht »My cupboard is large, deep and white – I take my books and toys inside …« fällt mir ein, wenn ich an den in meinem Zimmer stehenden Allzweckschrank denke. Darin sah es aus wie Kraut und Rüben. Meine Mutter mühte sich vergeblich ab, mir Ordnung beizubringen. In der kleinen Kammer befanden sich neben meinem Bett ein kleiner runder Tisch und ein Stuhl sowie ein kleiner Kleiderschrank. Mehr ging nicht rein. Der zur Verfügung stehende Freiraum reichte gerade aus, um zu den einzelnen Möbelstücken zu gelangen. Neben mir hätte vielleicht noch ein Spielkamerad ein Plätzchen auf dem Fußboden gefunden. Es war eben nur eine Kammer, aber es war mein Zimmer und ich konnte darin wunderbar allein spielen. Den größten Teil der Schularbeiten machte ich allerdings am Küchentisch.
»A proper place I have for each…« Das war es ja gerade, was ich nicht hatte. Meine Angewohnheit, aus Stabil-Metallbaukästen mühsam irgendwelche selbst zusammengeschraubten Bauwerke nach einer gewissen Spielzeit nicht wieder auseinanderzuschrauben und fein ordentlich in die Kästen zu tun, sondern einfach unter das Bett zu schieben, verärgerte meine Mutter. Im Laufe einerWoche sammelten sich unter dem Bett viele Bauwerke und sonstiger Kleinkram an, der von der fleißigen Hausfrau entrümpelt werden musste. Klein Fredi störte das nicht, er hatte sein eigenes Ordnungsprinzip. »And nothing is beyond my reach …« Was unter dem Bett lag, interessierte ja schon nicht mehr, es brauchte – jedenfalls von mir – nicht mehr erreicht zu werden! Im Laufe der weiteren Entwicklung legte sich zum Glück diese Unart des unordentlichen Kindes.
Das Kind bekam auch zu besonderen Anlässen von seinen Eltern – je nach Ebbe oder Flut in deren Geldbeutel– Geschenke. Obwohl mein Vater ein sehr entschlossener Kriegsgegner war, schenkte er mir, allerdings auf besonderen und eindringlichen Wunsch, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Mit der Zeit wuchs meine Streitmacht auf immerhin 21 Kämpfer aus Plastilin an. Ein kniend Schießender, ein liegend Schießender, drei stehend Schießende befanden sich unter den mit »Gewehr über« Marschierenden. Es brachte gar nicht den erwarteten Spaß, mit dieser Truppe zu spielen. Einmal fehlte der Feind und außerdemwaren die paar Männeken viel zu wenig, um eine richtige Schlacht darzustellen. Selbst als ich zu Weihnachten ein mobiles Flakgeschütz bekam, änderte sich an diesem Dilemma nichts. Und wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie man Schlacht spielt! –Und so machten mir meine Soldaten keine Freude mehr. Sie lagen nutzlos in der Reserve unter dem Bett. In einem plötzlichen Befreiungsanfall nahm ich alle 21 und schmiss sie in den glutbestückten Kachelofen. So starben sie den Heldentod, verbrannten aber nicht und wanderten in den Müllkasten.





























