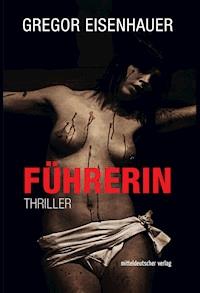Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erich Kästner (1899–1974), dessen Todestag sich 2024 zum 50. Mal jährt, ist einer der bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren. Bücher wie „Pünktchen und Anton“ (1931) oder „Das doppelte Lottchen“ (1949) wurden geliebt, millionenfach verkauft, vielfach verfilmt – und sind noch immer nicht vergessen. Kästners Leben Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre lässt sich als Komödie erzählen. Er schrieb in kurzer Zeit drei Gedichtbände, die ihn zum Liebling der Leser und vor allem der Leserinnen machten. Er wurde mit „Emil und die Detektive“ (1929) über Nacht weltberühmt. Und er verdiente sehr viel Geld. Was in Vergessenheit geriet: Erich Kästner war in seinen letzten Lebensjahren ein tieftrauriger Mensch, der zusehends versteinerte. Gregor Eisenhauer erzählt von dieser Zeit. Wie kam es dazu, dass einer, der allen Grund hatte, glücklich zu sein, einsam starb?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage
© 2024 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werks insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen auch für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen und strafbar.
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Umschlagabbildung: Erich Kästner, 1961, © Basch, […] / Opdracht Anefo /
Wikipedia CC0 1.0 (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36966907)
Frontispiz: Walter Trier, Mann auf Bücherturm, ca. 1960; letzte Seite: Walter
Trier, Zeitungsleser, ca. 1950, Quelle: Walter Trier-Archiv, Konstanz
ISBN 978-3-96311-975-0
INHALT
Vorwort
I. Zu viel des Guten
II. Romanzen, aber kein Roman
III. Das verlorene Lachen
IV. Der Gang vor die Hunde
V. Kein ganz glückliches Ende
Das Kind ist des Mannes Vater
William Wordsworth
VORWORT
Dies ist ein Buch über die Hinwendung zum Tod. Nicht zu meinem eigenen Tod. Dafür fehlt mir der Mut. Zum Tod Erich Kästners. Erich Kästner hat mir viel bedeutet, als ich ein Heranwachsender war. Er hat sehr vielen sehr viel bedeutet, Kindern wie Erwachsenen. Dennoch starb er einen einsamen Tod. Erich Kästner hat viele Leser glücklich gemacht mit seinen Gedichten und Erzählungen, dennoch war er an seinem Lebensende unglücklich.
Warum das so war, wurde selten gefragt, sei es aus Diskretion oder Scham. Aber am Unglück der anderen ist nichts Beschämendes. Beschämend ist nur die Unterlassung der Frage: Warum bist du unglücklich? Diese Frage ist eine Frage der persönlichen Art. Sie klingt im Folgenden zuweilen fordernder, als es sich gehört. Darf ein Leser diese Frage stellen? Er darf es, wenn er den Autor, über den er schreibt, als Freund sieht. Er darf ihn als Freund sehen, denn jeder gute Autor ist ein Freund des Lesers. Für wen sonst sollte er da sein?
Erich Kästner war ein sehr höflicher Mensch, ein sehr distanzierter. Indiskrete Fragen verbat er sich. Als Autor war er anders. Da wurde er zum freizügigen Doppelgänger seiner selbst und sprach öffentlich über Dinge, die er privat nie preisgegeben hätte. Der Mensch Erich Kästner ist mir fremder als der Autor. Das gibt mir kein Recht zu übermäßiger Neugier. Aber die Neugier richtet sich nicht auf Privates, so seltsam das klingt. Sein Tod war kein privater. Im Tod sind Mensch und Autor eins. Der Tod Erich Kästners gibt auch Auskunft über sein Leben als Dichter.
Wie nah darf man einem Autor treten? Als Leser, als guter Freund, ja, als guter Freund, denn manche Autoren begleiten einen lebenslang. Sie geraten zeitweilig aus dem Blick, weil andere sich wichtig dazwischendrängen, aber echte Freunde unter den Autoren findet ein Leser nicht viele. Bücher, zu denen man zurückkehrt, wenn man sich müde fühlt, oder einsam oder einfach nur traurig. Dann tröstet Pu der Bär. Der Wind in den Weiden scheint wieder zu wehen. Und von Weitem winkt Winnetou und lädt zum Ritt über die Prärie. Wenn Liebeskummer das Herz kränkt, tröstet Jane Austen und plaudert so dahin, bis unter Tränen ein Lächeln hervorbricht. Und wenn man vor lauter klugen Ratschlägen nicht ein noch aus weiß, hilft es, den klügsten Ratschlag zu beherzigen, den ein Dichter je gegeben hat: „Es gibt nichts Gutes / außer: Man tut es.“
So ein Buch fürs Leben war Erich Kästners Fabian, denn in diesem Buch steht geschrieben, was Liebe ist und Freundschaft, und dass der Weltschmerz kein Ende nimmt, weil das Unglück in der Welt kein Ende nimmt. Aber das ist kein Grund zum Verzweifeln. Weil es die Liebe gibt und die Freundschaft.
Fabian starb einen seltsamen Tod. Er sprang in den Fluss, um ein ertrinkendes Kind zu retten. Das Kind konnte schwimmen. Fabian nicht. Das Kind überlebte. Fabian ertrank. Dieses Ende hat mich lange Zeit empört. Es scheint so sinnlos. So unverständlich. Warum sollte ein Mann das tun? Sterben für ein Kind, das seiner Hilfe gar nicht bedarf. Es sei denn, er ist dieses Kind selbst.
I. ZU VIEL DES GUTEN
„… wenn Erfolg glücklich machen könnte,
müßten Sie eigentlich der glücklichste Mensch
in Deutschland sein.“
Stefan Zweig, Januar 1933
Das Kind rennt. Es rennt um sein Leben. Es rennt um das Leben seiner Mutter. Das Kind rennt durch die Straßen, durch die es immer rennt, wenn die Mutter ihren Tod angekündigt hat. Der Zettel auf dem Küchentisch. „Ich kann nicht mehr! Sucht mich nicht!“ steht darauf. „Leb wohl, mein lieber Junge!“ Kein Wort des Abschieds für ihren Mann, nur für ihren Sohn. Ganz allein an ihn sind die Worte gerichtet. Erich rannte los. Rannte um ihr Leben. „War es noch Zeit, oder war es zu spät?“ War sie gesprungen? Von einer der Elbbrücken. Oder wartete sie bereits auf ihn, weil sie genau wusste, dass er sie suchen würde. Er fand sie jedes Mal. Auf einer der Brücken. Redete ihr gut zu, bis sie erwachte aus ihrer Starre. Oder war sie längst wach, weil sie auf ihn gewartet hatte? Eine Schauspielerin ihres Kummers, bis er ihre Hand griff, und sie wieder das Kommando übernahm. „Komm, mein Junge, bring mich nach Hause!“
Szenenwechsel: Die Mutter wartete, bis ihr Junge aus dem Haus war. Dann setzte sie ihren Hut auf und lief ihm heimlich hinterher. Wenn sie fürchtete, dass er sie bemerken könnte, verbarg sie sich hinter Plakatsäulen oder großen, dicken Leuten. Sie ließ ihn nicht aus den Augen, bis er in der Schule verschwand. Das ging einige Tage so, bis sie ihrem siebenjährigen Sohn zutraute, den Schulweg allein meistern zu können. „Dächt ich: ‚Die Ärmste ist übergeschnappt?‘ Oder: ‚Beobachte ich eine Tragödie?‘ Oder: ‚Wird hier ein Film gedreht?‘“
War sie verrückt, die Mutter? Sie war verrückt. Verrückt vor Liebe. Ihre Macht über den Sohn war absolut, und er war ihr untertan. Ein Leben lang. Noch über ihren Tod hinaus. Erich Kästners Kindheitserinnerungen Als ich ein kleiner Junge war erschienen 1957, im Todesjahr des Vaters, die Mutter war schon sechs Jahre tot. Es waren die glücklichsten Jahre des Vaters. Die Jahre der Freiheit, der ungeteilten Liebe des Sohnes.
Was ihr Mann Emil Kästner tat, war in den Augen seiner Frau Ida immer zu wenig. Dennoch blieb er geduldig, ein Leben lang. Es ist eine traurige Geschichte, die Geschichte Emil Kästners, eine Geschichte, die nie erzählt wurde, nie erzählt werden wird. Wie er Jahrzehnte neben einer Frau lebte, die ihn verachtete, die ihn selbst noch im Alter, als sie in Umnachtung versank, quälte, weil er ein Nichts war für sie, ein Niemand. Er hatte kein Glück mit seiner Frau, er hatte Glück mit seinem Sohn, von dem er nicht einmal wusste, ob es sein eigener war.
„Ich liebe ihn doch gar nicht“, hatte Ida Augustin ihren Schwestern geklagt, als die sie mit dem Sattler und Tapezierer Emil Kästner verkuppelten – dennoch hatte sie ihn geheiratet. Sie wusste, was ihn erwartete, er nicht. Am 31. Juli 1892 war die Hochzeit, die Hochzeitsnacht, und erst Jahre später, am 23. Februar 1899, wurde Erich Kästner geboren. Da wohnten sie längst nicht mehr in Döbeln, wo Emil Kästner sich mit einer Sattlerei selbstständig gemacht hatte, sondern schon vier Jahre in Dresden. Ida hat lebenslang keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihren Mann körperlich verabscheute. Aber sie wollte ein Kind. Also gab sie sich ihm hin. Oder einem anderen. Vielleicht ergab sie sich tatsächlich ihm, dem Kind zuliebe. Vielleicht suchte sie von Anfang an einen anderen Mann, einen, der etwas darstellte in der Welt. Ida Kästner war eine willensstarke Frau. Sie traute sich viel zu. Weil sie sich selbst nur als Werkzeug sah. Ohne Kind wäre sie in Depressionen versunken. Ganz anders ihr Mann, dem sein Handwerk den Glauben an sich selbst gab. Auch wenn er davon nicht leben konnte, mit der Sattlerei pleiteging und in Dresden in einer Kofferfabrik arbeiten musste. Denn als Handwerker war er tüchtig, aber nicht sehr geschäftssinnig. Er war treu, nie aufbrausend, und selbst im Alter, als sie ihn mit seniler List noch infamer peinigte als in den Jahren zuvor, stand er aufopferungsvoll zu ihr. Ebenbürtig war der Sattlermeister Emil Kästner seiner Frau nur in der Liebe zu seinem Kind, um das sie stritten, als wäre es die einzige Trophäe, die das Leben ihnen je darreichen würde. Und so war es auch. Nach dem Krieg kam das Gerücht auf, dass der wahre Vater Erich Kästners ein ganz anderer sei, der jüdische Hausarzt nämlich, der Deutschland hatte verlassen müssen. Gemessen an der Liebe, die Emil Kästner seinem Sohn entgegenbrachte, gab es allerdings nur einen möglichen Vater, ihn – auch wenn der Sohn sich ihm gegenüber viele Jahre die an Verachtung grenzende Herablassung der Mutter zu eigen machte. Bis er ihn dann im Alter doch noch lieben lernte. Emil Kästner war der Glücklichste in der Familie. Er hatte sich nie etwas vorzuwerfen. Er tat viel mehr als nur seine Pflicht, was sein Sohn ihm in den letzten Jahren dankte, indem er ihn zu sich holte nach München, zu einem Besuch auf dem Oktoberfest. Emil Kästner war mit wenigem zufrieden. „Er war stets ein Meister des Handwerks und fast immer ein Meister im Lächeln.“
Ida Kästner war klug und vorausdenkend. Hatte sie sich für einen anderen Erzeuger entschieden, von Anfang an? Wen hatte sie im Blick? Sollte es eine Zufallsbekanntschaft sein oder eine vertraute Person, die ihrem Sohn zur Seite stehen konnte, durch Rat und Tat, und finanzielle Hilfe, wenn sie einmal nicht mehr sein würde? Weil ihr alles zu viel war. Weil sie von der Brücke springen würde. Was gar nicht ihre Absicht war. Oder nur ein wenig, weil sie sich der Liebe ihres Sohnes ganz, ganz sicher sein musste. Sonst wäre das alles nicht zu ertragen gewesen. Ohne Erich keine Zukunft für sie.
Wer half dem Jungen in der Not? Ging er zum Vater? Zu seinem richtigen Vater? In den Erinnerungen erwähnt Erich Kästner nicht, ob sein rechtlicher Vater Emil ihm in diesen Stunden geholfen hat, in den Arm genommen, getröstet. Davon ist nicht die Rede. Erich, früh erwachsen, wendete sich an den jüdischen Hausarzt, Sanitätsrat Doktor Zimmermann. Ein starker Raucher, wie Kästner beiläufig bemerkt, was dennoch auffällt, weil aus dem kleinen Jungen auch ein sehr starker Raucher werden wird. Was die beiden in diesem Erinnerungsmoment verbindet. Aber viel mehr ist da nicht, in dieser Szene, wo es einen Vater mehr noch als einen Arzt gebraucht hätte. „‚Und Sie glauben nicht, daß sie wirklich von der Brücke … vielleicht … eines Tages …?‘ ‚Nein‘, sagte er, ‚das glaub ich nicht. Auch wenn sie alles um sich her vergißt, wird ihr Herz an dich denken.‘ Er lächelte. ‚Du bist ihr Schutzengel.‘“
Der Vater, wenn er denn der Vater war, gab seine Verantwortung an den Sohn ab. Vielleicht wusste er auch gar nicht, dass er der Vater war. Eine Affäre, folgenlos. Ida hatte ihn im Unklaren gelassen, er hatte im Unklaren bleiben wollen. Dr. Emil Zimmermann emigrierte 1933 nach Brasilien. Er hat in der Folgezeit keinen Kontakt mehr zu Erich Kästner gesucht.
„Du bist ihr Schutzengel.“ Ist das ein Glück oder ein Fluch? Für das Kind Erich – ein Fluch. Sein Versagen wäre ihr Tod. Was für eine Verantwortung für einen kleinen Jungen. Einfacher für alle wäre es gewesen, wenn sie ein paar Monate hätte ausspannen können, wie es der Sanitätsrat leichthin empfahl. Geldsorgen hinderten sie. Wäre dieser Arzt tatsächlich Erich Kästners Vater gewesen, wie es Werner Schneyder in seiner Biografie kraft der Aussage des Sohnes von Erich Kästner behauptet, dann hätten beide, Mutter wie Sohn, mehr Hilfe von ihm erwarten dürfen. Wenn tatsächlich alle in der Nachbarschaft von dieser Affäre wussten, dann hätten die Nationalsozialisten Erich Kästner kurzerhand als „Halbjuden“ brandmarken können – sie haben es nicht getan.
Es ist ein Rätsel um die Vaterschaft, wie bei allen Helden, das Erich Kästner zeitlebens auch nicht auflösen wollte, eben weil es etwas angenehm Mysteriöses hat. Denn es ist undenkbar, dass Ida Kästner eine fortdauernde Affäre mit dem Arzt unterhielt. Also war es ein einmaliger Schöpfungsakt: „der Erwählte“. Diesen Nimbus des Glückskinds wahrte Kästner viele Jahre. Auch wenn er wusste: Es ist ein Verhängnis, ewig Kind sein zu müssen.
Er wurde bemuttert auf alle möglichen Weisen. Der Vater arbeitete in der Fabrik, die Mutter frisierte daheim die Damen der Nachbarschaft, ein Zimmer der kleinen Wohnung war untervermietet, meist an Lehrer. Die Eltern mussten sparen. Dem Jungen fehlte es an nichts, außer an der Freiheit, für sich selbst sein zu dürfen. „Manchmal könnte ich mich fast beneiden!“, scherzt Kästner in seinen Erinnerungen. War er zu beneiden? Nein. Zu keiner Zeit. Schon gar nicht in der Kindheit. Ida Kästner war eine unglückliche Frau, die ihr Leben gut im Griff hatte – und ihren Sohn. Den Mann ohnehin. Aber es war zu spüren, für alle, dass sie unter sich selbst litt. Was auch immer zum Wohl Erichs geschah, es war mit Anstrengung verbunden. Es war keine unglückliche Kindheit, denn Glücksmomente gab es viele, es war eine traurige Kindheit. Er konnte nie sorglos Kind sein, denn er war nie frei von Verantwortung. Selbst an den schönsten Tagen des Jahres nicht.
Weihnachten: „Gleich würde ich lächeln müssen, statt weinen zu dürfen.“ Er stand am Gabentisch und musste sich im „Pendelverkehr“ freuen über all die Geschenke, die da präsentiert wurden. Vom Vater und von der Mutter, nicht von den Eltern. Vater und Mutter im Wettbewerb um die Liebe des Sohnes. Wie gelingt es, die Mutter zu bevorzugen, ohne den Vater zu verletzen? Es kann nicht gelingen. Denn sie war unersättlich in ihrem Liebesverlangen. „Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden.“ Alles tat sie für ihn, in der festen Erwartung, dass er es ihr danken würde. „Sie war gut zu mir, und darin erschöpfte sich ihre Güte.“ Sie verausgabte sich in der Liebe zu ihrem Sohn und vergaß sich selbst darüber. Sie war „eine arme Seele“. Das hat ihm das Herz zerrissen, schon als Kind, lange bevor ihm tatsächlich eine Herzschwäche attestiert wurde, als Folge der Schinderei in der Rekrutenausbildung.
Erich Kästners Kindheit war traurig. Daran lässt er keinen Zweifel in seinen Erinnerungen. Er beklagt sich nicht, aber er sagt klar, es war ihm zu viel, ein Zuviel an Liebe. Für das er dankbar war, weil er dankbar sein musste. Er durfte nie versagen, weil er es der Mutter stets recht machen musste. Das ist ihm gelungen. Er war von Anfang an ein Musterschüler – in allem. Er hat sehr selten versagt. Deswegen war die Traurigkeit sehr selten zu spüren. Aber was nach außen hin glücklich wirkte, war mit einer Anstrengung verbunden, die über seine Kräfte ging. Die lange Zeit der Müdigkeit im Alter ist von der Kindheit her zu verstehen.
Was Mutterliebe vermag: eine Glücksgeschichte. Erich Kästners Leben kann als Folge von Glücksmomenten erzählt werden. Ein kleiner Dresdner erobert die Welt. Aber mit seiner Größe durfte man ihm nicht kommen. Denn darüber ärgerte er sich zuweilen, wenn er Hochwüchsigen begegnete, dass er selbst ein wenig kurz geraten war. Aber der Glaube an sich, die Hoffnungen der Mutter ließen ihn über sich selbst hinauswachsen. Er spazierte durchs Leben in seinen jungen Jahren, als führte ihn eine Fee an der Hand. Ein Lächeln wie Hans im Glück. Da sind keine Hindernisse, nur Stolpersteine, die im Nachhinein schmunzeln lassen.
Von der Mutter über alles geliebt. Vom Vater verwöhnt. In kargen Verhältnissen aufgewachsen, aber häufig zu Gast bei den reichen Verwandten, die ihm die Scheu vor den Wohlhabenderen nahmen. Musterschüler. Guter Turner. Gesunde Konstitution, bis ihn auf dem Kasernenhof der Sergeant Waurich in seine Hände bekam. Ein Menschenschinder, der ihm letztlich das Leben rettete. „Der Mann hat mir das Herz versaut. / Das wird ihm nie verziehn.“ Aber: Das schwache Herz bewahrte ihn vor dem ersten Krieg wie vor dem zweiten. Und es tat seinen Dienst bis zum Schluss, trotz Zigaretten und Alkohol.
Er hatte Lehrer werden wollen, bis er merkte, dass seine Talente zu weitaus mehr taugten. Er blieb nicht an der Universität, obwohl es ihm nicht schwerfiel, akademisch zu denken. Aber schreiben wollte er ganz anders als die Professoren. Er wurde ein guter Journalist und ein noch besserer Satiriker, mit so spitzer Feder, dass in der Leipziger Provinz kein Bleiben für ihn war und er nach Berlin gehen musste. Wo er mit offenen Armen empfangen wurde. Seine natürliche Selbstsicherheit ließ anderen kaum eine Wahl. Ein Augenzwinkern nur, und sein gewinnendes Wesen öffnete ihm Türen, vor denen andere schüchtern verharrten. Stets am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Stets wissend, wer ihm hilfreich sein konnte. Aus dem „patentierten Musterknaben“ war ein erfolgreicher Schriftsteller geworden, der seinen Witz, je nach Erfordernis, in so charmanter Dosierung darbot, dass ihm die Herzen nur so zuflogen und er sie einfach zusammenband wie Luftballons und sich tragen ließ. Er hatte Glück, wann immer er es brauchte.
Vom Niemand zum Liebling der Welt in nur fünf Jahren. 1928 erschien Erich Kästners erster Gedichtband Herz auf Taille, der ihn bekannt machte, berühmt wurde er durch das Kinderbuch Emil und die Detektive, das 1929 erschien. Ein kleiner Dresdner erobert die Welt. Emil Tischbeins Geschichte vom Verlieren und Wiederfinden eines Bündels Geldscheine wurde in viele Sprachen übersetzt, mehrfach verfilmt und zum Lieblingsbuch von Millionen Kindern. Als Das fliegende Klassenzimmer 1933 erschien, war Erich Kästner ein gemachter Mann, der mit vielem rechnete, nur nicht damit, dass ihm der Gefreite Adolf Hitler aus Braunau am Inn die Zukunft stehlen würde.
Erich Kästner hätte emigrieren können, aber er blieb in Deutschland. Die Gestapo lud ihn zweimal vor, ließ ihn aber wieder gehen. Er konnte arbeiten, wenn auch unter Pseudonym, verdiente mit dem Münchhausen-Drehbuch zum Geburtstagsfilm der Ufa-Filmstudios sehr viel Geld, bis Hitler ihm endgültig das Schreiben verbot. Hitler starb in Berlin; Erich Kästner hat den Krieg überlebt. Wie auch seine Eltern den Krieg überlebten, in Dresden, seiner Heimatstadt. Zerstört. Berlin, ein Trümmerfeld. Aber Erich Kästner gelang noch in den letzten Kriegsmonaten mit einem Filmteam die ministerial genehmigte Flucht ins tirolische Mayrhofen, wo er den Untergang des „Tausendjährigen Reiches“ unbeschadet protokollieren konnte. Er zog nach München, war drei Jahre Feuilletonchef der auflagenstarken Neuen Zeitung, schrieb fürs Kabarett und auch sonst allerhand für die Großen und die Kleinen. Der Ruhm, der Wohlstand, beides kehrte rasch zurück. Sein Kinderbuch Das doppelte Lottchen wurde ein internationaler Erfolg, sein Erinnerungsbuch Als ich ein kleiner Junge war vom Publikum geliebt. P. E. N.-Präsident, Büchner-Preisträger, es mangelte weder an Ehrungen noch an Geld. Seine Werke wurden in mehr als dreißig Sprachen übersetzt, über hundert Schulen in Deutschland tragen seinen Namen.
Auf der Sonnenseite des Lebens. Die Frauen liebten ihn auch nach dem Krieg nicht weniger leidenschaftlich als er die Frauen. Er bekam einen Sohn von einer sehr viel Jüngeren, blieb aber seiner alten Lebensgefährtin Luiselotte Enderle treu, mit der er ein kleines Haus mit großem Garten und vielen Katzen im Münchner Villenvorort Bogenhausen bewohnte. Die letzten Jahre wurde es still um ihn, die heitere Resignation des Alters ließ ihn wieder zu jenem Kind werden, das er schon immer gewesen war. Staunend und still blickte er hinaus in seinen Garten, sah den Vögeln bei ihrem bunten Treiben zu und vergaß sich im Nachsinnen über all die gewesenen Turbulenzen. Nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz wahr, diese Geschichte.
Warum nicht dabei belassen? Die Vergangenheit soll ruhen. Seine Bücher bleiben ja. Wen kümmert es, ob er glücklich war oder unglücklich, als er sie schrieb? Mich kümmert es. Mich, seinen Leser. Weil es verlogen ist. Weil es die Geschichten nicht verlogen macht, aber doppelbödig. Kein Fundament, wie ich einst glaubte, auf das sich vertrauen lässt. Die Liebe, von der Erich Kästner so viel spricht in seinem Erinnerungsbuch, diese Liebe hat sein Leben ruiniert. Aber das erfährt der Leser erst im Nachhinein. Das Zerstörerische der Liebe kann nur begreifen, wer die ganze Geschichte wissen will. Nicht nur das, was erzählt wird. Sondern auch das, was zwischen den Zeilen steht. „Brauchtest Liebe. Findest keine. / Träumst vom Glück. Und lebst im Leid. / Einsam bist du sehr alleine – / und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.“
Was Mutterliebe vermag: eine Unglücksgeschichte. Es war zu viel Liebe. Immer schon. Als Kind wie als Heranwachsender. Von allem zu viel. Sein Erinnerungsbuch Als ich ein kleiner Junge war erschien 1957. Es war eine Reise zu sich selbst. Wie auch die Neuerzählung der Kinderbücher in diesen Jahren. Die Kindheit kehrte wieder, im Guten wie im Schlechten. Sein Erinnerungsbuch versammelt Szenen von großer Grausamkeit, zuweilen sehr beiläufig. Der einsame Vater, von Frau und Sohn ins Abseits verbannt, zu Lebzeiten wie auch in der Erinnerung. Der verarmte Großvater, von seinen reichen Söhnen im Stich gelassen. Die Mutter, die ihrem Kind mit Selbstmord droht. Die Eltern, die nicht nur an Weihnachten an ihrem Kind mit zerreißender Liebe zerren. Der Lehrer, der seinen Musterschüler unter dem Vorwand einer Wanderung zu einer Kletterpartie im steilen Fels zwingt, was er nur mit knapper Not überlebt. Todesängste. Wie viele Tode starb dieser kleine Junge? Wie oft ist er seiner Mutter hinterhergesprungen, im Traum? Wie groß die Ängste, mit denen er allein war, allein gelassen wurde.
Er hat darüber geschrieben. Über diesen Tod, den er gestorben ist. Nicht als Kind, als Erwachsener, der einem Kind helfen wollte. Aber ihm gar nicht helfen konnte. Fabian, der Held des gleichnamigen Romans, der eigentlich Der Gang vor die Hunde hätte heißen sollen, ertrinkt. Ein unsinniger Tod. Auch aus literarischer Sicht. Er springt einem Kind ins Wasser hinterher, obwohl er nicht schwimmen kann. Das Kind hingegen kann sehr wohl schwimmen. Zumindest kann es sich ans Ufer retten. Was für eine seltsame, unerklärliche Dummheit, so schien es mir beim ersten Lesen, als ich sechzehn war und alles besser wusste. So etwas vergisst man doch nicht, dass man nicht schwimmen kann. Wie dumm, mein Vorwurf unter Tränen. Denn ich wollte nicht, dass Fabian stirbt, und schon gar nicht wollte ich, dass er einen so unsinnigen Tod stirbt. Warum springt er von der Brücke? Er bringt keinem etwas, dieser Tod. Als tragische Pointe, vielleicht. Aber das ist zu theatralisch. Das ist nicht Kästner. Oder doch? Erich Kästner ist nicht Fabian, aber Fabian stirbt einen Tod, den auch Kästner viele Male gestorben ist. Als Kind wie als Erwachsener. Wie oft wollte seine Mutter von der Brücke springen, wie oft ist sie in seinen Albträumen gesprungen? Wie oft kam er zu spät? Wie oft ist er im Traum selbst ertrunken, bei dem Versuch, sie zu retten? „Du bist ihr Schutzengel.“ Aber wer rettete den kleinen Jungen? Diese Angst vor dem Selbstmord eines geliebten Menschen sollte ihm noch zum Verhängnis werden. Denn sie verhinderte eine Trennung, die ihm vielleicht ein besseres Lebensende ermöglicht hätte.
Die Ängste seiner Kindheit blieben unausgesprochen. Erst als seine Mutter gestorben war, schien sich Erich Kästner noch einmal auf sich selbst besinnen zu wollen. „Manches, was man als Kind erlebt hat, erhält seinen Sinn erst nach vielen Jahren. Und vieles, was uns später geschieht, bliebe ohne die Erinnerung an unsre Kindheit so gut wie unverständlich.“ Das ist mysteriös gesprochen, denn 1957, als sein Erinnerungsbuch erschien, war der Autor Erich Kästner erfolgreicher denn je. Kein Grund zur Klage, was die Mehrung seines Ruhms anging. Aber tatsächlich war er sich schon viel früher der Tatsache bewusst, dass da etwas falsch gelaufen war in seinem Leben.
Das Haus Erinnerung. Eine Komödie in einem Vorspiel und drei Akten. Nur das Vorspiel hielt Kästner für gelungen und ließ es als Einakter 1958 in den Münchner Kammerspielen uraufführen. Geschrieben hatte er es bereits Ende der Dreißigerjahre. Ein klassisches Kästner-Szenario. Klassentreffen. Der Professor versammelt seine ehemaligen Schüler, darunter einer, der ihm besonders am Herz liegt. Sein Musterschüler, begabter Schriftsteller, aber lebensuntauglich. „Warum“, fragt der Professor, „bist du mit dir so – unglücklich?“ Der Musterschüler: „Ich weiß es nicht. Lächelnd Ich weiß es nicht, und das ist das ganze ‚Unglück‘. Wieder sachlich, als spräche er über einen Dritten Je schneller man im Leben vorankommt, umso sicherer glaubt man, auf dem richtigen Wege zu sein. Man freut sich über das Tempo und denkt nicht an die Himmelsrichtung. Sie wird schon stimmen! Was aber, wenn sie nicht stimmt? Wenn man verkehrt läuft?“
Franz Kafka, selbst ein Wanderer mit unsicheren Zielen, hat dieses Dilemma der gefühlten Ausweglosigkeit als Fabel erzählt: „‚Ach‘, sagte die Maus, ‚die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.‘ – ‚Du musst nur die Laufrichtung ändern‘, sagte die Katze und fraß sie.“
Dergleichen Ratschläge hat Erich Kästner viele bekommen: „Du musst nur die Laufrichtung ändern.“ Von Freunden, von Kritikern, von Nachgeborenen, die alles besser wissen, da die Zeit ihnen die Karten offengelegt hat, die Kästner seinerzeit nur erraten konnte. Denn das Schicksal spielt für gewöhnlich mit verdeckten Karten. Er war immer ein glücklicher Spieler gewesen. Da war immer eine Trumpfkarte in seinem Blatt oder in seinem Ärmel. Neue Zeiten, neues Spiel. Im Krieg wie im Frieden. Es wurde neu gemischt. Jedes Blatt, das er bekam, war gefühlt ein Verliererblatt. Plötzlich stand er vor dem Nichts. Was die anderen nicht sahen. Er konnte nicht mehr gewinnen. Dieses Gefühl, vom Glück verlassen worden zu sein. Warum? Ausgerechnet er?!
Was tun, wenn man das Glück aus den Augen verliert? „Man könnte“, sinniert der Musterschüler in Haus Erinnerung, „den Weg schrittweise zurückgehen. Und den Kreuzweg suchen, wo man irrte … Oder man könnte zum Arzt gehen, wie heute zum Lehrer. Zu einem Seelenarzt, sich aufs Kanapee legen, die Augen schließen und seine Träume erzählen … Oder die hehre Dichtkunst an den Nagel hängen … ironisch auflachend Oder, ganz im Gegenteil, einen dicken Roman drüber schreiben, unter dem Titel ‚Der Kreuzweg‘ …“
Erich Kästner ist weder zum Arzt gegangen, noch hat er den Roman geschrieben. Er ist seinen Weg zu Ende gegangen, wohl wissend, dass es ein falscher war. Warum er das tat? Er konnte nicht anders. Er konnte die Laufrichtung nicht mehr ändern. Warum auch? Es türmten sich keine Hindernisse vor ihm auf. Dem Anschein nach ging es ihm gut. Er hatte alles. Mehr als andere. Mehr als er brauchte. Mehr als er ertragen konnte. Denn er wurde seine Erinnerungen nicht los.
Die Liebe zur Mutter war ein Verhängnis. Auch schriftstellerisch. Die Briefe an sie, Mein liebes gutes Muttchen, Du!, ausgewählt und eingeleitet von Luiselotte Enderle, erschienen erst nach seinem Tod. Fraglich, ob er sie selbst in nüchternen Jahren je hätte publizieren wollen. Sie sind schmerzhaft zu lesen, weil im bemühten Ton wie in ihrer inhaltlichen Leere sehr fern dem Kästner, der Herz auf Taille geschrieben hat. Sie sind sentimental, was rührt, aber zwanghaft in ihrer immer gleichen Beteuerung einer Liebe, die ihn als erwachsenen Mann zwingt, kindisch zu sein. Nur so kann er sie glücklich machen – indem er lebenslänglich ihr Kind bleibt. Er tut so, als fiele ihm das leicht. Als wäre es ein Glück, so lieben zu dürfen. Mutter und Kind auf ewig eins. Es gibt Umarmungen, die in die Tiefe ziehen. Die keine Luft zum Atmen lassen. Ein ewiges Klammern. Die Mutter fand darin Halt. Der Sohn hingegen ging verloren. Er ging sich selbst verloren, verkümmerte seelisch im Würgegriff. Was er erst sehr spät begriff.
Die Mutter ist nicht von der Brücke gesprungen. Die Mutter ist nicht ertrunken. Sie nutzte seinerzeit ihre Selbstmorddrohungen nur als Bindemittel, so der Verdacht des Sanitätsrates. Fabian ist ertrunken. Anstelle Kästners. Beim Versuch, sich selbst als Kind zu retten, ist der Mann gestorben. Fabian konnte nie erwachsen werden. Fabian konnte weder eine andere Frau lieben noch sich selbst. Die selbstmörderische Logik des Romans folgt keinem gesellschaftskritischen Kalkül. Sie spiegelt die Biografie Kästners. Mit dem Unterschied, dass er sich zu Tode trank, weil er weder zu sich noch zu der Frau stehen konnte, die er liebte. Fabian ist ertrunken, bei dem Versuch, ein Kind zu retten. Er konnte nicht schwimmen. Er hatte nie gelernt, selbstständig zu sein. Hilflos bis zum Ende, weil ewig umarmt. Das ist die Schuld der Mutter. Das ist die Tragödie, die sie gemeinsam aufführten, und die nur wenigen als solche auffiel. „Mein liebes gutes Muttchen du. Dein oller Junge“, zu viele Liebesworte, zu sinnlos die Reihung.
„Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.“ Als Erich Kästners Mutter gestorben war, erfand er sich seine Kindheit noch einmal neu. Er las die Bücher von damals und erzählte sie auf seine Weise, den Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Den Don Quichotte, der gegen Dämonen kämpft, die kein anderer sieht. Den Gulliver, der mal ein sehr großer Mann ist, bei den Liliputanern, und mal ein sehr kleiner, bei den Riesen. Und glücklicher als alle, unglücklicher als alle: Peter Pan. Der ewige Junge, der ganz allein weiß, was Einsamkeit ist. Denn die Erwachsenen haben ihn im Stich gelassen. Und die Kinder werden es auch tun, indem sie erwachsen werden. Nur er bleibt der, der er immer war.
Die Friedensordnung der Alliierten trennte Mutter und Kind. Sie überlebte den Untergang Dresdens, aber sie verwand nie den Abschied von ihrem Sohn. Sie blieb in der alten Heimat, er in der neuen. Erich Kästner wollte nicht zurück nach Berlin. Die Mutter blieb in Dresden. Sie konnten lange nicht zueinanderkommen. Das beschleunigte ihre Umnachtung. Erst im Sanatorium, kurz vor ihrem achtzigsten Geburtstag, gab es ein Wiedersehen. Da war sie schon geistesabwesend. „Wo ist denn der Erich?“, fragte sie ihren Sohn. Die Frage war empfindsamer als sie selbst.
Edith Jacobsohn war eine sehr kluge Verlegerin. Nach dem Tod ihres Mannes leitete sie neben ihrem Kinderbuchverlag auch noch die politisch-satirische Wochenzeitschrift Die Weltbühne und versammelte regelmäßig ihre Mitarbeiter in ihrem Haus im Grunewald. Auf einem dieser Treffen nahm sie Erich Kästner beiseite und fragte ihn, aus heiterem Himmel, wie er es empfand, ob er „nicht einmal versuchen wolle, ein Kinderbuch zu schreiben“.
Wie kam sie auf die Idee? „Warum verfiel die Dame mit dem Monokel, jawohl, sie trug eines, ausgerechnet auf mich?“ Erich Kästner gibt keine Antwort auf die Frage. Er redet auf alberne Weise drumherum und gibt so, auf Umwegen, Auskunft. „Sah sie mir die mögliche Eignung an der Nasenspitze an? An meiner Nasenspitze war, glaube ich, nichts zu sehen.“ Warum er das Buch dann doch schrieb, obwohl es völlig außerhalb seiner literarischen Interessen lag? „Ich war auf meine Talente neugierig.“ Das leuchtet ein. Aber eine erfolgreiche Verlegerin wie Edith Jacobsohn war nicht neugierig auf seine Talente im Allgemeinen. Sie sah etwas anderes in ihm. Sie sah das Kind in Erich Kästner. Den kleinen verlorenen Jungen. Der in Not war und Hilfe brauchte. Der das alles gut verbarg, indem er den Witzbold und Charmeur schauspielerte. Aber es war zu spüren. Warum sonst hätte sie den lyrischen Satiriker und politisierenden Feuilletonisten gebeten, ein Kinderbuch zu schreiben. Dass Emil auf die Welt kam, verdankt Erich Kästner einer Frau. Dass er berühmt wurde, verdankt er wiederum besagtem Emil. Es muss seltsam sein, seinen Ruhm und Reichtum einem Kind zu verdanken. Man ist nie mehr auf Augenhöhe mit seinen Lesern. Litt Mark Twain darunter, dass ihm seine Geschöpfe einfach so auf und davon liefen? Tom Sawyer und Huckleberry Finn wurden viel berühmter als er selbst. Pippi Langstrumpf ist viel, viel bekannter als Astrid Lindgren, Harry Potter beliebter als Joanne K. Rowling. Wer wäre Erich Kästner ohne Emil und seine Detektive? Emil ist der Sohn, der ihn stolz gemacht hat, und reich, und weltberühmt. Ohne Emil und die Detektive wäre er als guter Gebrauchslyriker, als mäßig erfolgreicher Romanschriftsteller und glückloser Dramatiker in die Literaturgeschichte eingegangen. Dieses Buch, und all die folgenden Kinderbücher, haben ihn ewig jung sein lassen – und begehrenswert. Junge Frauen verliebten sich in ihn, weil sie sich schon in ihrer Kindheit in seine literarischen Figuren verliebt hatten.
Das Geheimnis seiner Anziehungskraft als Mann: Er war zuweilen wie ein Kind. So wurde er auch in Besitz genommen. Von vielen Frauen. Nicht nur von seiner Mutter, nicht nur von Edith