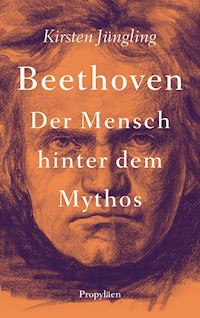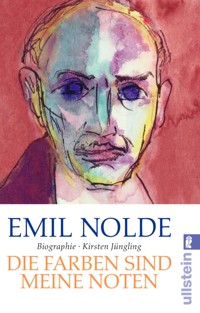
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Emil Nolde zählt zu den großen Künstlern der Moderne. Seine ausdrucksstarken, farbintensiven Gemälde und Aquarelle gehören zum Bilderkanon unserer Zeit. Die erfahrene Biographin Kirsten Jüngling legt die erste große Nolde-Biographie vor und wirft einen neuen Blick auf dieses bemerkenswerte Künstlerleben, in dem sich die großen Umbrüche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spiegeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kirsten Jüngling
Emil Nolde
Die Farben sind meine Noten
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Um die Authentizität zu wahren, wurde in den Briefzitaten von Ada und Emil Nolde die Originalschreibweise beibehalten.
ISBN 978-3-8437-0614-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013
Lektorat: Julia Niehaus
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
»Bild der Eltern« Hanna Christine und Niels Hansen, wie Emil Nolde es dem ersten Band seiner Autobiographie Das eigene Leben 1931 voranstellte.
»Viel Schönheit und etwas Religiosität«1
Im Elternhaus
Da sitzt einer im Heufach. Hat sich zurückgezogen, verweigert sich dem väterlichen Anspruch, nach einer bescheidenen Schulkarriere in die Hofarbeit hineinzuwachsen wie die Brüder. Blaue Schimmelwolken nehmen ihm den Atem. Sechzig Rinder und zehn Pferde muss der 16-Jährige versorgen. Er ist sehr schlechter Stimmung. Denkt er an den vergangenen Sommer, sieht er die dichten weißen Nebelschwaden, wie sie auf den gemähten Wiesen lagern und gerade mal die Spitzen der zahllosen Heudiemen freigeben.2 Jetzt, im Winter, muss er das in der Feuchtigkeit zu festen Kuchen zusammengepappte schimmelige Gras auseinanderreißen und verfüttern.
In diesen Monaten will Emil Missionar werden. In die Bibel vertieft er sich bis zur Extase. Vor Jahren schon hat er gelobt, seinem Gott ein Lied fürs Gesangbuch zu dichten. Damals hatte er in der Schule versagt, die vierte Klasse wiederholen müssen – zu viel Phantasie.3 »Zeitweise einfältig wie ein Narr, doch seinen Brüdern überlegen«4, so will Emil sich sehen. Das Gebiet, auf dem er ihren Respekt zu erringen sucht, soll das der Religion sein. Vorerst. Dem Breklumer Pastor Jensen könnte er folgen. Sich von der seit zehn Jahren dort ansässigen Nordelbischen Missionsgesellschaft schulen und nach Indien, Afrika, Indonesien oder China schicken lassen. Auch die Herrnhuter Brüdergemeinde in Christiansfeld, überschaubare siebzig Kilometer nördlich des heimatlichen Hofs an der Ostküste Südjütlands gelegen, könnte ihm zu einem Leben verhelfen, das den Neid der Brüder kitzeln und die verehrte Mutter glücklich machen würde. Im Jütländisch-Schleswigschen wimmelt es von sektiererischen Konventikeln, von Wanderpredigern, die auch in seiner Familie Gehör und in seinen Brüdern Mitstreiter finden.5
Emil liebt und bewundert seine Mutter – weil sie zwar als Bäuerin ziemlich untüchtig, aber hellsichtig ist,6 und weil sie in ihm etwas Besonderes sieht: Geige sollte er spielen lernen. Das jedoch muss er ihr schuldig bleiben. Alltags geht sie in schönen Kleidern von grün-weißem Beiderwandstoff aus Leinen und Wolle. Sie mag es, den Kälbern ihre Milch zu geben oder Blumen aus dem Garten in Vasen und Schalen zu »Ewigkeitsranken« zu arrangieren, was ihrem Jüngsten ebenso in Erinnerung bleibt wie ihre Fest- und Feiertagskleider: blau-rot-lila oder braun-violett aus feinstem Tuch mit Seidenfäden durchwebt und Tonderner Klöppelspitze verziert. All das, samt Spitzenhaube, Goldbrosche und Schlangenring, hebt die Mutter unter den Frauen der anderen Geestbauern hervor.7 Zusammen mit silbernen Löffeln, die Engelsköpfchen zieren, werden solche Schätze in einer eisenbeschlagenen Truhe verwahrt, in der auch zwölf kleine Holztafeln liegen, auf denen Szenen aus dem Leben Christi zu sehen sind, gemalte »mystische Wunder«.8 Die Bilder wie auch die Schnitzereien am Alkovenpaneel und am grünen Schrank, der im dunklen Gang steht, sind etwas ganz Besonderes, Staunenswertes. Oder? Nein, all das findet sich so oder so ähnlich in vielen bäuerlichen Familiengeschichten.
Auch andere übliche Topoi fehlen nicht in den Erinnerungen des Erwachsenen – 63 Jahre wird Nolde alt sein, als er sie verfasst, veröffentlicht werden sie im Jahr darauf. Die Vorbildlichkeit des Vaters, dem nichts über einen Besuch im von Rindern dichtbesetzten Stall geht, der ein Pferde- und Wetterkenner und Inhaber vieler Ehrenämter ist. Die Extravaganz der Mutter, die Nolde in ihrem Blumengarten, mit jungen Lämmern oder den Vater über die Getreidefelder begleitend darstellt. Wenn sie im Winter mit den beiden Mägden nahe beim Ofen sitzt und spinnt, hat sie das feinste Spinnrad weit und breit. Und wenn sie ausnahmsweise selbst kocht, dann »seltene und feine Gerichte«. Wie sie den Vater unterstützt, wenn die großen Ochsen verkauft werden sollen, wie sie alles herrichtet und mit den fremden Herren, mit denen das Geschäft gemacht werden soll, »so fein und schön« spricht, das imponiert den Kindern, die sich stolz in eine Ecke drücken, um alles mitzubekommen.
Ein Idyll in der Geest, das ist es, was Nolde unter dem Titel Das eigene Leben entworfen hat. Die Eltern, die Geschwister, der Hof, das Dorf, das Leben in der Abfolge der Jahreszeiten. Das Hinaustreiben des Viehs zur Sommeräsung im Frühjahr. Die Tage, an denen »piepsend, bläkend, brüllend, wiehernd« all die Küken, Lämmer, Kälber, Füllen ums Haus herum tollen und der kleine Emil barfuß hinter ihnen herläuft. Im Sommer schaut er den singenden Knechten und Mägden nach, die auf Leiterwagen zur Heuernte fahren. Draußen gibt es später dickflüssige Mehlgrütze mit einem Butterklecks in der Mitte, in die auch Emil seinen Löffel hineintauchen darf. Beeren reifen im Garten, und es blühen vielfarbige Rosen »und ich der Knabe warf scherzend den Mädchen die Hände voll hin«.9 Die Roggenernte, das Fest auf der Tenne, das Karussellfahren auf dem Herbstmarkt in Tondern,10 Schlittschuhlaufen über zugefrorene Gräben, der Weihnachtsabend. Zwischendurch Fahrten in einer Reihe von Pheatons zu großen Familienfeiern, am liebsten zu den Verwandten in der Marsch, dorthin, wo der Vater alle Höfe beim Namen kennt und auch die Geschichten ihrer Inhaber … Alles passt ins Klischee und soll es auch. Aber die Kindheitserinnerungen Emil Noldes, wie er sich seit seinem 35. Lebensjahr nennt, sind nicht nur »licht und schön«.11
Tante Ellen, Mutters Schwester, ist fürs Grobe da. Fürs Alltagskochen, fürs Ausbessern verschlissener Kleidung, auch für die Erziehung der Kinder: Gut in der Fürsorge, radikal in der Bestrafung, urteilt Nolde. Einsperren in die dunkle Torfscheune gehört dazu, oder »wenn ich Schlimmes getan hatte, hielt sie mich an den Füßen hoch, mit dem Kopf nach unten, über die Spülgrube. ›Da kommst ’nein‹, sagte sie; unten sah ich spiegelnd mich selbst, und das war erschreckend.«12 Kein Gedanke an das verlockende eigene Abbild, sondern früh empfundenes Grauen. Allgegenwärtig wie das Wasser. Man kann darin umkommen, wie das Kindermädchen, das im nahen Bach ertrank. Trotz strengem Verbot reizt es Emil, nachzusehen, ob bei den Hechtschnüren, die die älteren Brüder in der Grünau hinterm Wehr ausgelegt haben, einer angebissen hat. Er fällt hinein, wird in einem Strudel hinabgezogen. Wäre sein Bruder Nicolai nicht zur Stelle gewesen, wer weiß.
Andere Gefahren kennt er nur vom Hörensagen. An den Winterabenden dürfen die Knechte mit in der Stube sitzen, am Alkovenpaneel, hinter dem die Betten der Familienmitglieder verborgen sind, nahe dem Ofen. Sie erzählen Schauergeschichten von knarrenden Türen und unerklärlichem Wagengetöse auf dem Hof. Von Räubern, die im Wald oder auf der Heide plötzlich aus Gräben springen. Und von Nis Puk, dem guten Hausgeist, der verschwindet, wenn man ihm nicht richtig huldigt. Die Geschichten und die Bilder, die sich dazu einstellen, während Emil sich beim Zuhören den Platz auf der Decke mit dem Hofhund teilt, um weniger Angst zu haben, blieben ihm in Erinnerung. Dazu kommen Ereignisse auf dem Hof, vor denen die Mutter zum Nachbarn flieht, die der Junge aber mit eigenen Augen sieht: Der Todeskampf eines laut schreienden Schweins, das Spalten des Schädels einer Kuh. Hinstürzen und letztes Zucken, während das Blut in einer weißen Schüssel aufgefangen wird.
Aber auch Erlebnisse ganz anderer Art hinterlassen Eindrücke: Wenn die beiden im Haus beschäftigten Mägde im Wechsel mit den Knechten von Liebesschwur und Liebesleid singen. Die vom Heufach aus beobachteten Tändeleien zwischen einer von ihnen und einem der Brüder in der Scheune. Süße Empfindungen sind das, die er nie vergisst, wie auch die: »Drei Jahre mag ich gewesen sein, als das Mädchen mich in der Morgenfrühe zum Ankleiden auf einen Stuhl stellte, und ich dann ihre Wangen streichelnd sagte: ›Kleine süße Ingeburg‹; ich hatte sie so gern«. Frühe zärtliche Spiele: Spannung und Erlösung – Löwe und Lamm mit Hans, dem ältesten Bruder, zur Dämmerstunde. Füchse in ihrem Bau mit einem Freund, in einer Höhlung hinter dem Deich, der den Garten gegen die Grünau schützt. Und »Bussemand-Spiele«: »Es wurde dann die Hose ausgezogen, über den Kopf geschoben, die Arme in die Beine hineingesteckt, unten hing das weiße Hemd und – wir waren furchtbar!«13
Das träumerische Versagen in der Schule, riskante Kinderstreiche mit den Freunden aus dem Dorf, hinter dem Rücken der Erwachsenen. Ist es Stolz auf Kameraderie oder Rebellion, wenn Nolde so ausführlich davon berichtet? Wenn er noch nach so vielen Jahren die Jungen beim Namen nennt, mit denen er seine Exkursionen in verbotenes Terrain unternahm. Genau Auskunft gibt über die Knechte, die so viel bei ihm galten? Das alles passt in einen Lebensbericht, der dem entsprechen will, was man Anfang der dreißiger Jahre von einem solchen erwartete. Aber Nolde schreibt auch über das, was das Kind Emil Hansen von den anderen unterschied: seine Mal- und Zeichensucht. Er malt, wo er geht und steht. Mit Mergelstückchen,14 mit Holunder- und Rote-Bete-Saft, mit »richtigen« Farben, die er zu Weihnachten geschenkt bekommt. Auf Scheunentore, Wagenbretter, die Schultafel, in seine Bibel. Er zeichnet die Kameraden, Gipsengel, die Kirche, die Schule, Tiere, eins seiner Augen, exakt bis zu den Wimpern … Er wird sogar bezahlt: von den Großbauern für Karten von ihren Ländereien, von den Konfirmanden für Stammbuchblätter, das Stück zwei Pfennig. Ganz nutzlos war schon seine allererste künstlerische Produktion nicht. Fünf Jahre alt mag er da gewesen sein: kleine Lehmfiguren, dazu gemacht, auf Heckpfähle gestellt und von den Kameraden mit Steinen hinuntergeschmissen zu werden.15
Neuruppiner Bilderbögen finden ihren Weg zu dem kleinen Jungen in Nolde, auch ein Heftchen über Dürer, ein Artikel über Makart. Kann man sich tatächlich mit etwas anderem beschäftigen als mit Ackerbau und Viehzucht? Man kann. Man muss nicht hinter den großen Brüdern dreinlaufen, wie der kleine Emil einst auf dem Schulweg nach Buhrkall, und sich dabei im Bemühen, Schritt zu halten, blutige Knöchel schlagen mit den zu schweren Holzschuhen. Aber der Vater will es nicht. Er kann ziemlich unerbittlich sein. Er kann »heftig werden. Er dann faltete ein Tau zusammen und vornüber gebeugt, mit meinem Kopf zwischen seinen Knien, wurde ich Schlingel verbläut, bis laut ›lieber, lieber Vater‹ weinend ich schrie.«16 Schlachter kann er sich für seinen jüngsten Sohn vorstellen, auch Tischler. Da hilft es wenig, dass der Lehrer dessen Begabung erkennt und ihn durch Sonderaufgaben im Zeichnen fördert. Und nichts, dass ein Nachbar angesichts dessen, was der jüngste Hansen da verfertigt, nachdenklich wird. Eine Meinung der Mutter zu diesem Thema ist nicht überliefert. Man einigt sich schließlich auf eine Ausbildung zum Schnitzer. Vielleicht, so hoffen alle, kann Emil sich damit versöhnen.
Außer den Schnitzereien im Elternhaus kennt er die viel bedeutenderen in der Kirche von Buhrkall. Uralt17 steht sie nahe der Brücke über die Grünau, die auch am Hof der Eltern vorbei fließt. Jeden Sonntag muss Emil mit der Familie dorthin zum Gottesdienst. Eine langweilige, im Winter noch dazu ausgesprochen frostige Sache, die er durch Herumschauen abzukürzen sucht, weshalb ihm die Altartafeln sehr vertraut sind: im Halbrelief geschnitzte Motive nach Kupferstichen von Albrecht Dürer, angefertigt – sollte das wegweisend sein? – in einer Flensburger Werkstatt.18 Emil wird also nicht Bauer werden. Er wird den heimatlichen Hof verlassen, hoffend, damit auch seiner Schwermut zu entkommen, die ihn seit etwa zwei Jahren im Griff hat. So beliebt, wie er einmal war, so gemieden und verstoßen fühlt er sich, seit er nicht mehr der fröhliche Spielkamerad sein kann. »Ich, verstimmt, ging weg, mir Vorwürfe machend, bitter und im Innern tief traurig, weil ich ein so absonderlicher Mensch geworden war. Alle sonnige Lebensschönheit war mir genommen. Ich wurde wie in eine Wüste versetzt zur Selbstbesinnung, in schwere menschlich kaum zu ertragende Vereinsamung.« Den Kameraden entfremdet und zu befangen, sich den angehimmelten Mädchen zu nähern. Und: »Auch mein letztes Jahr in der Schule war einsam, ich war nur da mit mir selbst, aber fleißig war ich geworden. In dem einen Jahr lernte ich mehr, als in den neun vorangegangenen.«19
Ist es verwunderlich, dass Emil sich vorkommt wie der biblische Joseph im Verhältnis zu seinen drei Brüdern? Ganz unten im Brunnen – wie in der Spülgrube? Er schafft es nicht, seine Pflichten auf dem elterlichen Hof zu erfüllen und seinem Malen nachzugehen. So wie Hans, der Älteste, der nebenbei aufschreibt, was ihm bedeutsam erscheint: Geschichtsdaten, Statistiken etwa. Oder wie Nicolai, der, wann immer er Zeit dafür findet, über Konstruktionszeichnungen für Maschinen sitzt, die er sich ausdenkt. Oder wie Leonhard, der sich vorgenommen hat, mehr über Handel und Tierheilkunde zu lernen.20 Was die kleine Schwester betrifft, nun ja: »Ihr sind keine besonderen Gaben gegeben.«Und: »Sie war Vaters liebes kleines Mädchen und lief so gern an seiner Hand hüpfend, plaudernd, fragend.«21
Für sich selbst reklamiert er die »Kuriosität zweier Geburtstage«: Er kam am 7. August 1867 zur Welt, wurde aber als am 20. August geboren ins Kirchenbuch eingetragen.22 Er liebt das Aparte an seiner Biographie, wie die Geschichte des Kennenlernens seiner Eltern: Emils Vater, Niels Hansen, Sohn von Hans und Petrea Hansen,23 1831 auf Merlingfeld in der Marsch geboren, war mit fünf Schwestern und drei Brüdern aufgewachsen. Der Hof, im Kirchspiel Aventoft gelegen, war ein Haubarg. Das bedeutet, dass Wohnräume, Stallungen und Scheune sich unter einem hohen, nach der Mitte zusammengefassten Reetdach befanden. »Die beiden jungen Brüder Jens und Niels Hansen reisten alljährlich zur Geest hinauf, um junge Ochsen für ihre Grasweiden auf Merlingfeld zu kaufen.« Sie kamen auch in die Ortschaft Nolde, wo Niels auf einem der Höfe die Schwestern Lena, Ellen und Hanna Christine kennenlernte. Als im Alter von 49 Jahren Hans Hansen an Lungenentzündung starb und Petrea mit den neun Kindern Merlingfeld nicht halten konnte, fand Niels hier ein neues Zuhause, wobei er sich für Hanna Christine entschied. Sieben Jahre waren die beiden verlobt, danach »erfolgte bei der Heirat die Übernahme des elterlichen Hofes meiner Mutter durch meinen Vater.«24
Dass der Hof in Nolde – einer von fünfen, aus denen das Dorf damals im Wesentlichen bestand – seit neun Generationen im Besitz der mütterlichen Familie war, erschien Emil immer als etwas Besonderes. Ihm gefällt der Gedanke, dass die fünf Meter langen Eichenpfähle und die Granitblöcke ganz in der Nähe als Überbleibsel einer Burg galten, die auf einem flachen Hügel in sumpfiger Waldung gelegen haben soll, und das Dorf von deren letztem Besitzer, Thøger Nold, seinen Namen bekam.25
Um Emil herum wird ein Gemisch aus Deutsch und Dänisch, Nordfriesisch und Südjütisch gesprochen.26 Zwei unterschiedliche Landschaften umgeben ihn: Marsch und Geest. In der Geest, wo seine Mutter geboren ist und auch er selbst, sieht er seine Wurzeln. In der Marsch, wo der Vater herkommt und die Hansens seit Generationen nicht nur als Bauern, sondern auch als Gastwirte und Windmüller sesshaft sind, wird er später zweimal ein Haus für sich finden.
Die Marsch, die oberhalb des Meeresspiegels zum Zeitpunkt des mittleren Tidenhubes liegt, ist immer wieder Ebbe und Flut ausgesetzt und steht oft ganz unter Wasser. Dabei wird Land von der Nordsee übers Watt und die Salzwiesen gespült, fruchtbares Land. Wer sich dort ansiedelt, tut das auf aufgeschütteten Hügeln, Warften, die bei Überflutung aus dem Wasser ragen.
Die Geest ist höher gelegen, trocken, früher besiedelt, aber wenig fruchtbar. Auf die Heideflächen treibt man in Emils Jugend Rinder, für die Jungtiere gibt es ein paar Heuwiesen zur Grünau hin. Die besseren Weiden sind in der nur etwa dreißig Kilometer entfernten Marsch. Man pachtet sie, oder man wirbt darum, dass die dort ansässigen Bauern das in der Geest aufgezogene Vieh kaufen, um es auf ihren Fennen so lange grasen zu lassen, bis es schlachtreif ist. Für Schlachtvieh gibt es Abnehmer bis nach England. Gehandelt wird es auf den großen Viehmärkten in Tondern und Leek.
Die Geestbauern sind erfinderisch, wenn es darum geht, ihre naturgegeben schlechte Situation zu verbessern. Emil bekommt mit, dass aufgeforstet wird, wo im 17. Jahrhundert gerodet worden war, um landwirtschaftlich nutzbare Fläche und Brennholz, Bauholz und Holz für den Schiffbau zu gewinnen. Nun braucht man Nachwuchs, auch, damit das Land vor Winderosion geschützt ist. Möglich, dass das Emil zur Anlage eines eigenen Baumgartens anregte: Ahorn, Eschen, Eichen, Kastanien. Es ist eine schöne Vorstellung, dass vor vielen, vielen Jahren ein kleiner Junge aus Samen zog, was man heute auf dem Areal, wo der Hansen-Hof stand, findet.27
Im Gegensatz zum Haubarg der väterlichen Familie sind im mütterlichen Hof Wohn- und Wirtschaftsräume sowie die Stallungen durch einen quer durch das Haus gelegten Gang voneinander getrennt. Eine Dreiflügelanlage, um einen steingepflasterten quadratischen Hofplatz angeordnet. Rote Ziegelmauern, weißgestrichene Tore, Strohdach. Im südlichen Trakt der nur zu feierlichen Anlässen benutzte Pesel, daran anschließend das feine Mittelzimmer, etwas öfter in Gebrauch, und die Döns, das Alltagswohnzimmer, in dem Stühle mit strohgeflochtenen Sitzen stehen und das mit Schnitzereien dekorierte Alkovenpaneel, das die Betten verbirgt. Über der Tür nach draußen steht »1694«, das Jahr, in dem der Hof gebaut wurde. Im an die Döns anschließenden Ostflügel sind die Küche und der Keller, in dem die Lebensmittel aufbewahrt werden: Herrschaftsbereich der Tante Ellen, wie auch der sogenannte Waschraum mit Spülgrube, Backtrog und Backofen. Dort werden die im Keller verwahrten und später in der Küche verarbeiteten Lebensmittel hergestellt: Es wird gebuttert, gebacken, gebraut, geräuchert. Nebenan liegt die Rollkammer zum Glätten der Wäsche, die auf eine Rolle aufgewickelt unter einem mit Granitblöcken gefüllten Kasten hin- und hergezogen wird. An das Knarren und Quietschen erinnerte sich noch der erwachsene Nolde. Durch eine weitere Tür kommt man in die Torf- und Flaggenscheune. Im Nordflügel haben die Tiere ihren Platz, die vom Vater hochgeschätzten Ochsen. Hinter dem Gebäude: der Garten mit den Rosen, dann eine Dornenhecke, dann eine Baumreihe. Dann senkt sich das Land, Weideland, zur Grünau hin, ein Wehr ist nahebei zu sehen, eine Windmühle und die Kirche von Buhrkall im Hintergrund – so malt es Emil 1893 in seiner Schweizer Zeit.
»Mit den drei Schwestern Lena, Ellen und Christine begann anscheinend in unserem Geschlecht ein über das alltäglich Materielle hinausgehender, etwas gehobener Flug. Christine, meine Mutter, stand licht und gefestigt neben meinem Vater.«28 Als »sonnenschön«29 beschwört Nolde sein Leben, als er noch »Mille« gerufen wurde, noch nicht 15 war und noch nicht schwermütig. Wie sich das dann anfühlte, verschweigt er nicht: »Zuweilen aber ging ich allein übers Feld, von Gedanken und unbestimmten Gefühlen getrieben. Im hohen Kornfeld, von niemandem gesehen, legte ich mich hin, den Rücken platt zur Erde, die Augen geschlossen, die Arme starr ausgestreckt, und dann dachte ich: So lag Dein Heiland Jesus Christus, als Männer und Frauen ihn vom Kreuz ablösten, und dann drehte ich mich um, im Boden eine schmale Tiefe scharrend, darüberhin ich mich legte,in unbestimmbarem Glauben träumend, daß die ganze große, runde, wundervolle Erde meine Geliebte sei.«30
Da sitzt also einer im Heufach und weiß nicht, wohin es gehen soll. Aber so viel weiß er: Bauer will er nicht werden. Er will nicht mehr hinter den Brüdern hertraben. Er hat Blut geleckt: Seine Mal- und Zeichenkünste machen etwas Besonderes aus ihm, und das will er bleiben. Und eine schöne, eine besondere Frau will er haben.
Emil Hansen während seiner Flensburger Lehrzeit um 1886
»Das Glück will ich erzwingen«31
Schnitzen lernen in Flensburg
April 1884. Bahnhof Bülderup Bau,32 ein schlichtes flaches Gebäude, zwei Perrons auf ein paar Metern Bahnhofsgelände. Im Flachen verliert sich ein Gleis nach Westen, nach Tondern. In diese Richtung schaut Emil, denn von dort muss der Zug kommen, der ihn fortbringen soll in Richtung Osten, zunächst bis Tingleff,33 wo er umsteigen wird in die Bahn nach Flensburg. Dort ist alles geregelt: Er soll Lehrling der Sauermannschen Möbelfabrik34 und damit Schüler der Sauermannschen Schnitzschule werden und bei einer Frau Lange wohnen. Die Trasse folgt einem uralten Weg. Schon in der Bronzezeit trieb man das Vieh entlang der Wasserscheide auf dem Ochsenweg35 von der mageren Geest auf die fetten Weiden in der Marsch. Inzwischen nutzen auch Hansens aus Nolde die Lebendviehtransportmöglichkeit mit der Bahn. Aber das interessiert den Sechzehnjährigen nicht mehr. Mit der Landwirtschaft hat er abgeschlossen. Er hat sich vorgenommen, seine Chance zu nutzen. Fleißig und sparsam will er sein, damit er etwas vorzuweisen hat, wenn er von Flensburg zu Besuch nach Nolde kommt. Was genau das sein kann? Er will es herausfinden.
Doch kaum steht er an der Schnitzbank, überfällt ihn das alte Leiden. Nun nennt er es Heimweh. Er ist streng mit sich, arbeitet »von 7 Uhr früh bis 7 Uhr spät und abends noch zwei Stunden Fortbildungsschule und Sonntags gewerbliches Zeichnen, vier Stunden lang.«36 Kein Wunder, dass er morgens oft nicht aus dem Bett kommt, also erst einmal durch Verspätung auffällt, nicht durch Leistung. Dabei bedeutet es ihm viel, nach vorbildlichen Werkstücken Zeichnungen anzufertigen und so den geschnitzten Spiralen und Schnörkeln nachzuspüren, oder mit spiritusgetränkten Lappen die Figuren eines alten Altars so lange zu bearbeiten, bis deren verborgene Schönheit wieder sichtbar ist. Der Gedanke erregt ihn, dass es an diesem Meisterwerk37 künftig Ergänzungen von seiner Hand geben wird, denn er darf fehlende Hellebarden und Schwerter der Kriegsknechte ergänzen. Aber mehr als diese einfachen Aufgaben bewältigt er lange nicht. Er quält sich, die Augen machen Probleme, das gebückte Stehen strengt ihn an. Das Schnitzen klappt erst im vierten Jahr richtig: »fast plötzlich ich es konnte«.38 Jetzt schnitzt er Greife, Karyatiden, Tiere, Engel. Heinrich Sauermann39 staunt. Der ist ein Mann mit hochgesteckten Zielen: In seinem Unternehmen soll die Kunst maßgeblichen Einfluss auf die industrielle kunstgewerbliche Fertigung haben. Er hatte eigentlich Maler werden wollen und davon geträumt, an der Akademie in Kopenhagen zu studieren, doch sein Vater bestand auf einer Handwerksausbildung. Also lernte er Sattler und Tapezierer und nahm nebenbei Zeichenunterricht. Während seiner Wanderjahre besuchte er Genf und 1867, im Jahr der Weltausstellung, Paris. 1873 gründete er seine Fabrik: historistische Möbel, dem Zeitgeschmack entsprechend, mit neuen Techniken nach alten Vorbildern hergestellt. Sein Können und Wissen gibt er in einer Fachschule weiter, daneben stehen Buchführung und deutsche Rechtschreibung auf dem Lehrplan, auch für Emil Hansen.
Sauermanns hervorragender Ruf lockt ehrgeizige junge Leute aus allen Teilen Deutschlands an: »launisch, bitter, ausgelassen oder unzufrieden«.40 Die Gesellen beschäftigen Emil noch lange: ihre groben Redensarten, ihr Schimpfen, ihre Ohrfeigen, wenn er »ihre Lampen schlecht geputzt hatte, oder das Feuer im Ofen nicht brennen wollte«.41 Der Vergleich mit den Knechten auf seines Vaters Hof liegt für ihn nahe und die Lehrjungen erinnern ihn an seine Schulfreunde. »Wo aber sind sie geblieben?«, wird er in seinen Erinnerungen fragen und die Anwort gleich mitliefern: »[…] Heinrich Thode, der immer mich überflügeln wollte, Wilhelm Johannsen? – Thode griff zum Revolver, sich tötend, Johannsen in der Großstadt sich verlor.« So kann es also gehen. Wenn man zu schwach ist? Emil Hansen will sich das nicht vorwerfen. Wenn die Kameraden turnen, tanzen, schwimmen, Karten spielen, ist er nicht dabei. »Ihm war nur die Arbeit wert und sein eigenes Tun und Müssen. Er konnte nicht lachen und hatte keine Jugend.«42 So ganz traurig muss man sich das nicht vorstellen. Oft sitzt er im »Gnomenkeller«, einem Weinausschank unweit der Sauermannschen Fabrik. Natürlich mit dem Skizzenblock – die derben Wandmalereien dienen ihm als Vorlage.43
Das Schicksal seiner Wirtin Frau Lange und ihrer drei Söhne führt dem aus der Geborgenheit des elterlichen Hofs Kommenden die Folgen von sozialem Abstieg vor Augen. Einer von ihnen, Sophus, muss hinnehmen, dass der gleichaltrige Bauernsohn aus Nolde ihm als Schlafgenosse zugewiesen wird. Die kleine Kammer, die beide sich im Haus auf dem Friesischen Berg teilen, liegt unterm Dach. Aber der Lärm von der Schmiede im Erdgeschoss des Hauses und von den auf der Straße aufgeschlagenen Marktbuden dringt bis zum späten Abend hinauf und wird danach abgelöst von dem Radau, der bis zum frühen Morgen aus dem Tanzlokal »Sanssoucie« gegenüber kommt. Mit Sophus verträgt Emil sich, aber Wilhelm, der Primaner, und Carl, der Dichter, sind bemüht, sich gegen den zahlenden Gast abzugrenzen. Das funktioniert vor allem über die Musikalität der Familie. Vierstimmig singen sie, und Emil staunt. Wilhelm, so glaubt er, wird Professor werden. Carl beeindruckt ihn zunächst durch Wortgewandtheit, doch dann erweist sich sein Gerede als verhängnsvoll:
»Während eines Besuches bei meinen Eltern, sagte er Ihnen – vielleicht nur als Unterhaltung – was alles an Sorgen sie von mir erwarten könnten, wodurch Beunruhigung und Zweifel hervorgerufen wurden, und mein Vater nahm mich ernstlich vor, – mich, der ich monatlich nur 50 Pfennige Taschengeld verbrauchte und bis zum äußerst Möglichen arbeitend pflichttreu tat, was ich tun konnte – ich ging, bitterlich weinend hinters Haus, und dann in einer dunkelsten Gartenecke stand ich von Trotz und gräßlichen Gedanken gequält. Es ist das Traurige dieses Erlebnisses leider nie mehr ganz gewichen. In allen späteren nächtlichen Träumen war immer mein Vater der strenge harte Mann […]«
Auch Carl Lange wird Emil Nolde in seinen Erinnerungen in die Galerie derjenigen einreihen, die vor dem Leben kapitulieren: »auf offener See, eines Nachts, ungesehen, sprang er ins dunkle Meer.«44
In seinem letzten Flensburger Jahr verlässt Emil das Haus der Witwe Lange und zieht mit drei Kameraden in eine Wohngemeinschaft.45 Auch hier gibt er den Außenseiter, der sich in seiner knappen Freizeit lieber im freien Zeichnen und Modellieren übt und die Mädchen meidet. Dafür darf er sich am Ende seiner Lehrzeit über einen Händedruck vom Flensburger Oberbürgermeister und ein Ehrenzeugnis freuen – er hatte ein Ahornblatt akribisch abgezeichnet – und anschließend im »Schwarzen Walfisch«46 feiern.
Die Eulen an Theodor Storms Schreibtisch, 1887 zu dessen 70. Geburtstag von den »Kieler Damen« bei Sauermann in Auftrag gegeben, zeigen, was der junge Hansen als Möbelschnitzer gelernt hat.
Weiter gesteckte Ziele verfehlt er erst einmal: Der Vater will eine Fortsetzung der Ausbildung nicht zugestehen. Misslungen auch der ehrgeizige Versuch, durch besondere Leistung – er zeichnet den Altar der Flensburger Marienkirche ab, vor allem eine Fleißarbeit – zum Einjährig-Freiwilligen zu werden, was eine in vielerlei Hinsicht privilegierte Militärdienstzeit bedeutet hätte. Tatsächlich dient Emil überhaupt nicht. Im Entnazifizierungsfragebogen der Militärregierung für die Amerikanische Zone wird Nolde am 3. Juli 1946 die Frage, ob er vom Militärdienst zurückgestellt worden sei, mit »ja« beantworten und die Frage nach den genauen Umständen mit »überzählig (1887)«.47 Warum auch immer: Er verlässt Anfang 1888 das preußische Flensburg und zieht erst einmal nach Bayern.
Das Nordfriesische Wohnzimmer, wie es auf der Kunstgewerbeausstellung 1888 in München gezeigt wurde.
»In überspannter sinnlicher Belastung ging ich umher«48
München und Karlsruhe – vom Kunstgewerbe zur Kunst
Himmelhoch scheinen die Kirchen zu sein. Der festliche Weihrauchduft, das durch farbige Glasfenster gefilterte Licht, die kostbaren Gewänder selbst der Chorknaben, bunt und goldig. Wie sie sich bewegen in all der Herrlichkeit, wie sie singen zur Orgel. Es ist kaum auszuhalten. Draußen der nicht weniger beeindruckende Aufmarsch der lilarot gekleideten Kirchenfürsten in der Fronleichnamsprozession, an deren Spitze Prinzregent Luitpold geht.49 Wie sich die protestantischen Kirchen im Norden darstellen, weiß Emil gut. Nun ist er überwältigt von der Sinnlichkeit des Katholizismus.
Von Flensburg nach München fährt man im Frühjahr 1888 42 Stunden lang. An jeder noch so kleinen Station hält der Zug. In der vierten Klasse sitzt man diese Zeit in Gesellschaft von »Krämern, Musikanten und allerlei fremdartigen Menschen«50 ab. So kommt der 20-Jährige in die Großstadt München. Zweck der Reise erst einmal: Er darf beim Einbau des Prunkraums helfen, mit dem Sauermann auf der Deutsch-Nationalen Kunstgewerbeausstellung die Leistungen seiner Fachschule präsentieren will. Seit Monaten hat der junge Hansen an den Schnitzereien mitgearbeitet, sie für die Farbaufträge vorbereitet. Typische Elemente aus nordfriesischen Stuben werden zusammengefügt, auch die germanischen Götter Wodan und Freia sind im Relief zu sehen. Fremdartig und heimelig zugleich muss das Gesamtwerk aufs bayerische Publikum gewirkt haben.
Am 15. Mai wird die Schau eröffnet. Im Lehel an der Isar ist eigens ein Gebäudekomplex errichtet und über eine Brücke mit dem ebenfalls neuen Restaurant und Café auf der Praterinsel verbunden worden. Der junge Hansen pendelt hin und her. Stolz gibt er den Kellnerinnen Trinkgeld. In den auf Zeit gebauten Hallen schaut er sich gut um. Es reizt ihn, in München zu bleiben. In den kunstgewerblichen Sammlungen des Nationalmuseums will er ein- und ausgehen können – und in Anton Pössenbachers Fabrik arbeiten. Dort werden Luxusmöbel hergestellt, und zwar für allerhöchste Ansprüche. Pössenbachers Handwerker hatten die Ideen von Märchenkönig Ludwig II. für Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein umgesetzt. Hier will Emil Hansen dazulernen und möglichst dazuverdienen, denn der Vater hält seinen Geldbeutel fest geschlossen.
Am 20. Mai 1888 bescheinigt ihm Heinrich Sauermann aus dem fernen Flensburg, Fachkenntnisse in der Holzbildhauerei sowie im Zeichnen und Entwerfen von Möbeln und Möbelteilen durch Fleiß und Pünktlichkeit (!) erworben zu haben. Hansen darf sich nun »Bildhauergehilfe«51 nennen und will die nächste Stufe einer Karriere im Kunstgewerblichen angehen. Er bewirbt sich bei Pössenbacher, bekommt tatsächlich eine Anstellung, und findet ein Zimmer am Sendlinger-Tor-Platz, wieder unterm Dach. Seine Wirtinnen sind zwei alte »Schwester-Damen«,52 ihr Mädchen ist jung und schön, das fällt Hansen auf. Aber er kann sich nicht einleben. Von der Pössenbacher-Fabrik hat er sich viel versprochen, lernt jedoch nichts dazu. Im Gegenteil, er liefert schlechte Werkstücke ab und muss sich von den Leuten dort ärgern lassen. Emil versteht die Münchner nicht. Nicht ihre Sprache und auch nicht ihre Gepflogenheiten. Er lässt es sich gefallen, dass ihn eine Frau auf der Straße aufsammelt, durch einen dunklen Hof und über eine Treppe hinauf in ihre Kammer zieht: »Mir bebte. Vor mir stand ein wüstes Weib mit breitem Mund.« Oder imaginiert er nur? Ausgerechnet am Geburtstag seines Vaters, »ein geweihter Tag«,53 will er das erlebt haben. Er ist noch längst nicht in der Lebenswirklichkeit außerhalb seines Heimatdorfes angekommen. Gleich zu Beginn seiner Münchner Zeit hatte ihn das großstädtische Leben schockiert – beim Anblick von Damenstiefeln vor der Zimmertür seines Meisters: » – meine Ideale rasselten tief nieder.«54
München ist erst einmal erledigt, aber Emil hat eine neue Idee: Auch badische Aussteller sind ihm auf der Deutsch-Nationalen Kunstgewerbeausstellung aufgefallen. Weder die Leistungen des Großherzogtums auf den Gebieten Wissenschaft, Technik, Bildung, noch seine liberale Tradition interessieren ihn. Aber in Karlsruhe gibt es Ziegler und Weber, Anstalt für Dekoration und Einrichtung, samt Möbelfabrik. Und eine Kunstgewerbeschule. Das sollte genügen, um sich dort durch- und weiterzubringen.
»Am Fenster des Zuges saß ich, fahrend durch das ganze schöne Land.«55 Sein Gepäck: Eine Holzkiste mit wenigen Habseligkeiten und achtzig Schnitzeisen, Startkapital für Karlsruhe. Geld zählt nicht dazu. Sein erster Lohn wird an den Dienstmann gehen, der ihm beim Transport der schweren Kiste zu seiner neuen Dachwohnung hilft. Damit löst Emil einen Ring von der Mutter aus, den er ihm als Pfand überlassen hat.56
»Ich arbeitete tags an der Schnitzbank, und die Nächte träumend auch. Mit der Energie eines Fanatikers bereitete ich mich auf Höheres vor.« Und natürlich: »Ich sparte. Nur zwei trockene Semmeln mit Wasser waren jeweils mein Morgen- und Abendessen, ein gutes Mittagessen einzig nur hielt den Körper hoch.« In einem Teich im Park Goldfische zu fangen und zu verzehren, wie ein Leidensgenosse, verkneift er sich. An der Schnitzbank geht es gut. So gut, dass sogar die alten Gesellen neidisch werden. Anfangs ist er unterfordert, wie in München, aber dieses Mal bittet er bald um »bessere Arbeit«.57 An zwei Pilastern im Neorenaissancestil für den Großen Saal im neuen Nordflügel des Heidelberger Rathauses kann er sich beweisen. Seine Ziele? Seit Flensburg sind es die gleichen: im Handwerklichen weiterkommen, sich auf Ausstellungen und in Museen (in Karlsruhe im Kunstgewerbemuseum) umsehen, Musterzeichnungen für die Möbelindustrie und die Schreiner in den Handwerksbetrieben der Region, im Schwarzwald vor allem, entwerfen. Malen? Vielleicht auch malen.
Der Ruf der Karlsruher Kunstgewerbeschule ist hervorragend, mit entsprechenden Erwartungen belegt Hansen seinen ersten Kurs – bei Max Läuger,58 der vom Schüler zum Lehrer der Anstalt aufgestiegen ist, was dem Neuling eine weitere berufliche Perspektive aufzeigt. Doch das Zeichnen »kubischer Holzklötze« langweilt den nur drei Jahre älteren Lehrer genauso wie seinen einzigen Schüler im Abendkurs. Im Winter wechselt Emil Hansen in die Tagesklasse. Er gehört jetzt richtig dazu, »ein kleiner Traum war schon erfüllt«.59 In seinen Erinnerungen, in denen er sich als freier Künstler sehen will, der Handwerk und Kunsthandwerk hinter sich gelassen hat, erwähnt Nolde nur zwei der Lehrer mit Namen: Rudolf Mayer, Lehrer für Goldschmiedekunst, der seine Neigung zum freien Zeichnen akzeptiert, seine Begabung erkennt und ihn sich sogar als Assistenten vorstellen kann. Und Eugen Bischoff, zuständig für Architektur, mit dem Emil nicht zurechtkommt, weil er vom Blatt des Schülers alles wegzuradieren pflegt, was nicht genau der Vorlage entspricht. Seinen »langstieligen« Vorträgen kann Emil sich nur entziehen60 und in die Kunstschule, ohnehin Ziel seiner Wünsche, ausweichen. In die Aktklasse, da sind die Modelle aus anderem Stoff.
Dennoch, der Kunstgewerbeschüler Hansen ist angepasst. Die Lehrer schätzen ihn, das zeigt sein Zeugnis, in dem ihm bestätigt wird, dass er vom 21. Juni 1888 bis August 1889 die Großherzoglich Badische Kunstgewerbeschule zu Karlsruhe besucht und sich »während dieser Zeit durch steten Fleiß und gute Leistungen die Zufriedenheit seiner Lehrer erworben hat«.61 Im Freihandzeichnen bekommt er sogar ein Preisgeld in Höhe von vier Mark. Die Kameraden aus seiner als »Saustall« verrufenen Klasse hat er durch einen gezielten Regelverstoß für sich eingenommen: Während der Unterrichtszeit hat er sich mit zwei anderen Schülern biertrinkend im »Goldenen Karpfen« vom Schuldiener erwischen lassen.62 Die Kommerszeitung zur Abschlussfeier 1889 gestaltet Emil mit: Kosende Putten, junge Damen mit Krügen oder Lauten, Blütenzweige – seine Entwürfe sind ganz nach Art des Hauses. Drückte er sich beim Maskenfest in der Stadthalle noch an den Wänden herum, »allein, staunend in all dem Rausch«, so erscheint er auf dem Abschlussball der Kunstgewerbler tatsächlich in weiblicher Begleitung. Er kommt mit Lina, der Tochter seiner Wirtin, »vollbackig, schlank, rotblond, trug lange Zöpfe«. Vor dem Ball haben sie »Française« geübt. Die Kameraden, ja sogar die Lehrer staunen, und Emil ist so im Überschwang, dass er das Mädchen an diesem Abend küsst. Doch ein Paar wird aus den beiden nicht, Lina ist katholisch!63
Was die Kunstgewerbeschule ihm geben konnte, Emil hat es genutzt, mit allem Drum und Dran. Noch nach Jahren wird er gern an diesen Lebensabschnitt denken, so trifft er beispielsweise 1894 auf der Durchreise seinen ehemaligen Mitschüler Ernst Schleith, dem der Übergang an die Großherzoglich Badische Kunstschule – als Schüler von Hans Thoma u. a. – und zum Kunstmaler gelang. Auch Emil Hansen hätte sich einen solchen Weg vorstellen können, aber als 22-Jähriger scheut er ihn. Er fürchtet erneute Unsicherheit und Vereinsamung. Ihm fehlt das Selbstbewusstsein, er hat hohe Vorstellungen vom Künstlertum. Vor allem aber ist das Geld alle und ein Gönner lässt sich nicht finden, der Vater will für ein in seinen Augen aussichtsloses Unterfangen nicht zahlen. Dazu kommt, dass Emil sich seit einer schweren Grippe64 noch immer schwach fühlt. Heimweh hat er auch. Über seinem Bett hatte er ein Bündel Reet befestigt, das ihm wohl schöne Träume vom Norden bescheren sollte – stattdessen regneten Wanzen daraus herab.65 Schon in der ersten Septemberhälfte sitzt er im Zug nach Norden, um seine Eltern zu besuchen. Bleiben will er nicht, Nolde ist ihm zu klein geworden. Bald macht er sich erneut auf die Reise.
Das Berliner Kunstgewerbemuseum mit seiner Unterrichtsanstalt, die Emil gern besucht hätte. Stattdessen musste er Geld verdienen.
»Ja mir ist vielleicht dies alles Gesehene wie eine Dunggrube geworden«66
Sich durchschlagen in Berlin
Emil Hansen hat sich Berlin vorgenommen. Dort ist sein alter Flensburger Freund Wilhelm Johannsen inzwischen Kunstgewerbeschüler; sie kennen sich seit ihrer gemeinsamen Lehrzeit bei Sauermann. Das und die Hoffnung, durch ihn Kontakt zur Kunstszene zu finden, sich in größeren und reicheren Sammlungen umschauen zu können, als er sie von München und Karlsruhe kennt, und dort zu zeichnen, mag für Emil Anreiz genug gewesen sein. Was er in den Berliner Museen sieht, füllt tatsächlich schon im Oktober 1889 seine Skizzenbücher.67 Aber was die Szenekontakte betrifft, geht es bald um alles andere als um Kunst und Künstler.
Man darf bezweifeln, dass der alte Hansen seinem Sohn doch noch einmal Geld in die Hand gedrückt hätte – 100 Mark68 als Startkapital für Berlin –, hätte er geahnt, mit wem Emil dort die Wohnung, die Fresspakete und eben auch dieses Geld teilen würde. Der drei Jahre jüngere Johannsen ist »ein schöner Mensch, groß, dunkel, gewandt […]. Zu allen schönen Mädchen lächelte er, und in seine dunklen Augen verliebten sich alle. Er war […] in Flensburg von Frauen jung verführt, [es] hatten zweie ihm bereits je ein Kind geboren. […] ein lieber Freund«69 – aber ein schlechter Umgang eben auch, das will Emil nicht verhehlen. Für das Zusammensein mit Johannsen und seiner Clique müssen einige Ideale über Bord geworfen werden. Sobald sie ein paar Mark in Händen haben, woher auch immer, zieht es die jungen Herren in die »Destillationen« und »Sing- und Negerkabaretts«. Weit müssen sie nicht gehen, um dahin zu kommen, »wo es am wüstesten war«: Nördlich des Kunstgewerbemuseums und der angeschlossenen Unterrichtsanstalt, nahe beim Völkerkundemuseum findet der künftige Maler Emil Nolde seine »Dunggrube«, aus der später »Lilien und Rosen blühen wollten«.70 Ruinöse Exkursionen sind das – für die Gesundheit und den Geldbeutel Emil Hansens, der es nicht schafft, seinen Lebensunterhalt zuverlässig zu sichern. Nur Gelegenheitsarbeiten werden ihm angeboten. Wie es gerade kommt, entwirft er hübsche Vignetten für Geschäfte, Etiketten für Zigarrenkisten, Möbel für Tischler. Und modelliert Ornamente und Figuren für Stukkateure, von denen einige möglicherweise heute noch an Berliner Häusern zu finden sind.
Kann sein, dass die einschlägigen Behörden auf ihn aufmerksam werden, weil er wieder in Preußen lebt. Jetzt soll er jedenfalls Soldat werden. Pionier, aber sein Gesundheitszustand ist miserabel. Artillerist Ersatzreserve, dafür reicht es. Und letztlich ist er wohl wirklich »überzählig«. Gut. Schlecht, dass das ärztliche Verdikt korrekt ist. Hansen kann so nicht weitermachen. Er hat zunehmend Probleme mit den Augen, die er den Nächten in verräucherten Etablissements zuschreibt.
Immerhin, er verlässt die Wohngemeinschaft mit Johannsen in einem »Hof der Wilhelmstraße«.71 Ein Berliner »Hof« dieser Tage ist der größte denkbare Gegensatz zu dem Hof in Nolde: Hinter pompösen Fassaden verbergen sich hohe, schmucklose Gebäude mit vielen Stockwerken, sie bilden auf engstem Raum mehrere Innenhöfe, die – das ist die einzige Bauvorschrift – so groß sein müssen, dass darin eine Feuerspritze wenden kann, also etwa dreißig Quadratmeter. »Mietskasernen«72 werden diese Spekulationsobjekte in Zeiten großer Wohnungsnot und rasanten Bevölkerungswachstums in Berlin zu Recht genannt. Emil mietet ein Zimmer und dann ein neues im Osten der Stadt, wieder in irgendwelchen Hinterhöfen. Alle sind sie gleich schlecht. »Trübes Licht«, »graue Zeit«, »auf meinem Sinn lasteten die kurzen Dezembertage«, »an einem kleinen Fenster, zu einem düsteren Hof gewendet«, eine »kleine Kinderstimme«, »das schwere Leid« einer jungen Arbeiterwitwe – solche Eindrücke sind ihm aus dieser Zeit erinnerlich. »Alles im Leben erschien mir öd, ich war stumpf und dumpf bis zur Verzweiflung.«73 Schließlich ist er ganz ohne Arbeit. Er findet Kontakt zu einem Verein, der ihn gerade so weit unterstützt, dass er nicht verhungert, aber: »Dafür sollte ich politisch gewonnen werden. Sozialistisch, kommunistisch, anarchistisch, ich wußte von allem nichts.«74
Aber er rappelt sich wieder auf. Für den Gegenwert einer Briefmarke kann man sich fachmännisch rasieren und frisieren lassen und sich, so hergerichtet, um die Stelle als Zeichner und technischer Leiter in einer kleinen Galanteriewarenfabrik für Holz- und Bronzekunst und Luxusindustrie75 bewerben. Ein umtriebiger Bildhauer, Gustav Peters, ist der Gründer, aber über die Einstellung entscheidet der neue Inhaber Wrzeszinsky. Emil Hansen, abgeschlossene Lehre in Flensburg, Absolvent der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe sowie Berufserfahrung dort und in München, wird genommen und erledigt seine »Aufgaben spielend«, ja er bekommt jedes Quartal eine Gehaltserhöhung, weil seine Arbeit den Umsatz steigert. Das Entwerfen von Puderdosen, Knöpfen, Schnallen, Fächern oder Kleinmöbeln etwa stellt keine Herausforderung an seine Fähigkeiten dar, erweitert diese aber auch nicht. Den großen Fackelzug zum neunzigsten Geburtstag des Generalfeldmarschalls von Moltke nimmt er noch mit,76 dann ist es bald genug. Anfang 1891 ist er wieder in Nolde. Er kann da zeichnen, was er will – und er tut es nur zu oft nach Vorlagen: Geschnitzes, wie Truhen, Gegossenes, wie Tischglocken. Dafür fährt er sogar bis nach Flensburg.
Zurück in Berlin, verhelfen ihm Beziehungen77 zu einer besseren Anstellung: als Zeichner bei der »damals größten« Möbelfabrik I. C. Pfaff, »Möbeltypen erfindend, Figuren modellierend und Ornamente zeichnend. Rokokoornamente zu Umrahmungen von zuckersüßen Bildern für Salons der Bremer Lloyddampfer«. Auch das alles liefert er anstandslos ab, aber er fühlt sich weiter elend. Seelisch – da mögen ihn die Lästereien der Kollegen über die zum Greifen nahe und doch so ferne Kunstszene zusätzlich bedrücken – und körperlich. Ein Arzt, dem er sich im Frühjahr 1891 vorstellt, spricht hilflos von Lungenschwindsucht, und nun ist Emil ganz und gar verzweifelt. Ziellos irrt er durch die Wälder um Berlin, einen »Stock quer überm Rücken in den Ellenbogen verkrampft«, »schreiend zum Himmel«, mit »allen Fasern um Leben ringend«.78 Sein Arbeitgeber genehmigt eine Auszeit, und der junge Hansen fährt zum Gesundwerden nach Hause.