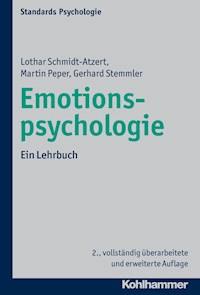
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Emotionen sagen, was für uns wirklich wichtig ist. Wir erleben im Alltag Gefühle wie Freude, Angst und Traurigkeit und "erkennen" Emotionen bei anderen Menschen. Die psychologische Forschung hat sich seit über 100 Jahren mit Emotionen befasst. Heute verfügen wir über ein großes Repertoire an Methoden zur Auslösung von Emotionen und zu deren Messung. Psychologische und neurobiologische Erklärungsansätze geben Antworten auf die Frage, wie Emotionen entstehen. Umgekehrt beeinflussen Emotionen unser Denken und unser Verhalten. Das Lehrbuch behandelt in verständlicher Form zentrale Fragen der Emotionsforschung. Es orientiert sich dabei an klassischen Theorien und Untersuchungen wie auch an aktueller Forschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kohlhammer Standards Psychologie
Begründet von
Theo W. Herrmann (†)
Werner H. Tack
Franz E. Weinert (†)
Herausgegeben von
Marcus Hasselhorn
Herbert Heuer
Silvia Schneider
Lothar Schmidt-AtzertMartin PeperGerhard Stemmler
Emotionspsychologie
Ein Lehrbuch
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechteinhaber ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© 1996/2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-020595-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-023911-1
epub: ISBN 978-3-17-025119-9
mobi: ISBN 978-3-17-025120-5
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage
Vorwort zur ersten Auflage
1 Das Konzept der Emotion
1.1 Historische Entwicklung der Emotionspsychologie
1.2 Definitionen
1.3 Beziehung zu verwandten Konstrukten
1.4 Zentrale Fragen der Emotionspsychologie
1.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
2 Methoden der Emotionsforschung
2.1 Natürliche Auslöser von Emotionen
2.1.1 Befragung zu Alltags- und Lebensereignissen
2.1.2 Ereignisnahe Messung von Emotionen
2.1.3 Messung von Emotionen unter verschiedenen Lebens- und Umweltbedingungen
2.2 Induktionsmethoden im Labor
2.3 Messmethoden für Emotionen
2.3.1 Emotionales Erleben
2.3.2 Physiologische Veränderungen
2.3.3 Mimik und andere Verhaltensindikatoren
2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
3 Wie entstehen Emotionen: Psychologische Erklärungsansätze
3.1 Behaviorale Ansätze: Angeborene Reaktionsbereitschaft
3.2 Kognitive Ansätze
3.2.1 Bewertung des auslösenden Ereignisses
3.2.2 Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Reaktion
3.2.3 Willentliche Emotionsregulation
3.3 Persönlichkeit als Moderator und Mediator
3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
4 Emotion und Gehirn
4.1 Neuropsychologische Erklärungsansätze
4.2 Evolutionsbiologische Annahmen
4.3 Emotionale Teilfunktionen und neurale Netzwerke
4.3.1 Organismische Adaptation und Selbstregulation
4.3.2 Emotionale Evaluations- und Bewertungsfunktionen
4.3.3 Emotionen und Handlungskontrolle
4.3.4 Erlebte Gefühle
4.3.5 Kommunikation von Emotionen
4.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
5 Auswirkungen von Emotionen
5.1 Behaviorale Effekte
5.1.1 Prosoziales Verhalten
5.1.2 Aggressives Verhalten
5.1.3 Entscheidungsverhalten und Einschätzen von Risiken
5.2 Kognitive Effekte
5.2.1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
5.2.2 Beurteilung der eigenen Person und der Umwelt
5.2.3 Gedächtnis
5.2.4 Problemlösen
5.3 Gesundheitseffekte
5.3.1 Zusammenhang zwischen Emotionen und Gesundheit
5.3.2 Erklärungsversuche für einen kausalen Effekt von Emotionen auf Gesundheit
5.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
6 Entwicklung von Emotionen
6.1 Entwicklung des Ausdrucks
6.1.1 Emotionen im Alltag
6.1.2 Beobachtungen in Laborsituationen
6.1.3 Ausdruckskontrolle
6.1.4 Kulturunterschiede im Emotionsausdruck
6.2 Entwicklung der physiologischen Reaktionen
6.3 Entwicklung von Gefühlen
6.3.1 Erwerb des Emotionsvokabulars
6.3.2 Sprachliche Mitteilung von Gefühlen
6.4 Erklärungsansätze
6.4.1 Angeborene Reaktionsbereitschaft
6.4.2 Einfluss von Reifungsprozessen
6.4.3 Sozialisierungsprozesse
6.4.4 Klassisches Konditionieren
6.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Vorwort zur Neuauflage
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ist die emotionspsychologische Forschung enorm angewachsen. Eine Literatursuche mit PsychINFO unter Verwendung der Schlüsselbegriffe (key concepts) »emotion« oder »mood« oder »affect« ergab ein auch für die Verfasser überraschendes Ergebnis: Für den Zeitraum von 1860 bis 1995 (als die Recherche zur ersten Auflage abgeschlossen war) sind 17 774 Publikationen nachgewiesen. Seitdem (26.08.2013) ist die Zahl auf 44 926 angewachsen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sich die Erkenntnisse seitdem mehr als verdoppelt haben. Aber es bedeutet, dass bei der Neuauflage sehr viel neue Literatur zu sichten war. Die »alte« Literatur bis 1995 macht gerade einmal 40 % der heute verfügbaren Quellen aus.
Eine weitere Konsequenz daraus war, dass der Aufbau des Buchs gegenüber der ersten Auflage verändert wurde. Da in der Forschung alle Ergebnisse von den Methoden abhängen, mit denen sie gewonnen wurden, sollten die Methoden in einem eigenen Kapitel abgehandelt werden. Das Methodenkapitel (Kap. 2) ist umfangreicher als die beiden »alten« Kapitel »Auslöser von Emotionen« und »Beschreibung und Erfassung von Emotionen« zusammen, die sich auch bereits mit Forschungsmethoden befasst hatten. Die neuropsychologische Emotionsforschung war in der ersten Auflage noch stiefmütterlich behandelt worden. Der große Anstieg an Publikationen verpflichtete uns, diesem Themenkomplex ein größeres Gewicht zu verleihen. Zudem war mit Martin Peper ein Kollege ins Autorenteam aufgenommen worden, der auf diesem Gebiet Experte ist. So entstand ein neues Kapitel, das sich explizit mit neuropsychologischen Erklärungsansätzen und Erkenntnissen zur Emotionspsychologie befasst. Die neuropsychologischen Methoden wurden getreu dem Konzept, alle Methoden in einem Kapitel zusammenzuführen, in das Methodenkapitel ausgelagert. Die neuropsychologischen Erklärungsansätze (Kap. 4) werden von den psychologischen Erklärungsanasätzen abgegrenzt, denen sich Kapitel 3 widmet. Dieses Kapitel führt nun auch die Ansätze zusammen, die in der ersten Auflage in den Kapiteln »Moderierende Faktoren und Mediatoren« und »Beziehungen zwischen den Emotionskomponenten« zu finden waren. Das »alte« Kapitel »Anwendungsperspektiven der Emotionsforschung« wurde aufgelöst. Wir haben uns entschieden, in den anderen Kapiteln an geeigneter Stelle auf die Bedeutung einer Methode oder von Forschungsergebnissen für die Praxis hinzuweisen. Damit sollten diese Kapitel für die Leserinnen und Leser1 auch interessanter und lesenswerter werden.
Das Buch richtet sich primär an Studierende der Psychologie. Diese werden sich im Bachelorstudiengang mit der Emotionspsychologie befassen. Auch im Bachelor-Studienfach Entwicklungspsychologie spielt Emotionspsychologie eine Rolle. Das sechste Kapitel (Entwicklung von Emotionen) dürfte dort von Interesse sein. Wir haben uns daher um einen verständlichen Ausdruck bemüht. Damit kann das Buch auch Studierende erreichen, die Psychologie im Nebenfach studieren. Die Neuropsychologie hat an den einzelnen Psychologie-Standorten einen unterschiedlich großen Stellenwert, mancherorts erfährt sie erst im Masterstudiengang die volle Aufmerksamkeit. Daher richtet sich speziell Kapitel 4 auch an Studierende in höheren Semestern.
Jedes Kapitel kann auch separat gelesen werden. Zum Verständnis kann es dennoch manchmal hilfreich sein, einem Querverweis auf eine Stelle in einem anderen Kapitel, insbesondere in dem Methodenkapitel, zu folgen. Die Zusammenfassungen an Ende eines jeden Kapitels dienen nicht nur dazu, sich das Gelesene noch einmal in kondensierter Form vergegenwärtigen zu können, sie bieten auch eine Orientierung bei der Auswahl von Kapiteln, mit denen man sich gründlich befassen möchte.
Wir möchten uns zunächst beim Kohlhammer-Verlag für dessen Unterstützung und auch Nachsicht bedanken. In der Planungsphase waren uns Ulrike Albrecht und Dr. Ruprecht Poensgen wichtige Ansprechpartner. Ihnen danken wir auch besonders für ihre große Geduld; wir konnten unsere ursprünglichen Zeitpläne nicht einhalten und mussten mehrfach um »mehr Zeit« bitten. Das Buchprojekt hatte sich als größer erwiesen als zunächst gedacht. Hinzu kamen immer wieder andere Verpflichtungen, die die Autoren zwangen, die Arbeit am Buch zu unterbrechen oder mit reduziertem Aufwand weiterzuführen. Celestina Filbrandt hat als »unsere« Lektorin alle Teile des Manuskripts zügig und sehr kompetent bearbeitet. Die Zusammenarbeit mit ihr war sehr angenehm.
Bevor die Texte an den Verlag geschickt wurden, haben Studierende sie aufmerksam und kritisch gelesen. Sie haben uns auf mögliche Unklarheiten und Verständnisprobleme hingewiesen, manchmal auch eine andere Formulierungen vorgeschlagen und natürlich auch Schreibfehler entdeckt. Teilweise haben sie auch Abbildungen bearbeitet oder eigenständig erstellt. Wir möchten uns ganz herzlich bei Fiona Rohowski, Charleen Henn, Anika Geist und Frank Sattler bedanken, ebenso auch bei Dr. Mira-Lynn Chavanon.
Marburg, im August 2013
Lothar Schmidt-Atzert,Martin Peper, Gerhard Stemmler
1 Einer besseren Lesbarkeit zuliebe verzichten wir im Text meist auf eine getrennte Nennung der weiblichen und männlichen Form. Soweit dies möglich war, haben wir geschlechtsneutrale Formulierungen wie »Studierende« gewählt, ansonsten die männliche Form. Diese schießt stets das andere Geschlecht ein.
Vorwort zur ersten Auflage
Im deutschen wie auch im englischen Sprachraum sind umfassende Darstellungen zur Emotionspsychologie selten anzutreffen. Die vorliegenden Werke sind ungewöhnlich heterogen. Mit etwas Übertreibung könnte man feststellen, die größte Gemeinsamkeit bestehe darin, daß sie das Wort »Emotion« im Titel tragen. Der Grund für diese Vielfalt dürfte darin liegen, daß man sich dem Thema aus sehr unterschiedlichen Richtungen nähern kann. Emotionspsychologie wird nicht nur in der Allgemeinen Psychologie betrieben, sondern u. a. in der Sozialpsychologie, der Klinischen Psychologie und der Entwicklungspsychologie. Neben experimentellen und anderen empirischen Ansätzen existieren auch phänomenologische. Die Lager können ferner danach unterteilt werden, ob etwa kognitive oder biologische Erklärungsansätze bevorzugt werden.
Der Anlaß für dieses Buch war, daß ein beim gleichen Verlag erschienenes Werk des Verfassers zum Thema »Emotionen« vergriffen war. Es stellte sich schnell heraus, daß es nicht möglich war, dem heutigen Stand der Forschung auf diesem Gebiet mit einer bloßen Überarbeitung gerecht zu werden. Was ursprünglich als überarbeitete Neuauflage konzipiert war, entwickelte sich sehr bald zu einem völlig neuen Lehrbuch. Bei dessen Abfassung hatten zwei Ziele einen hohen Stellenwert, die sich zwar nicht ausschließen, aber doch schwer zu vereinbaren sind. Der Text sollte verständlich sein, wie man das zu Recht von einem Lehrbuch erwarten darf, und er sollte der Komplexität des Gegenstandes gerecht werden und über eine bloße Einführung hinausgehen. Es bleibt zu wünschen, daß das Resultat dieser Bemühungen sowohl in den Augen der Studierenden als auch vor dem kritischen Urteil der Fachkolleginnen und -kollegen bestehen kann.
Auch beim Verfassen eines Lehrbuchs ist es nicht möglich, über den Dingen zu stehen und von einer neutralen Position aus zu urteilen. Der Verfasser fühlt sich der empirischen Forschung verpflichtet und ist dabei überzeugt, daß wissenschaftliche Ergebnisse wesentlich von den Methoden abhängen, mit denen sie gewonnen wurden. Die Botschaft dieses Buches soll aber keinesfalls lauten, daß alles relativ sei und man nichts Genaues wisse! Manche Ergebnisse sind eben besser gesichert als andere, und das soll deutlich gemacht werden. Auf dem Weg zu Erkenntnissen können Theorien sehr hilfreich sein. Aber gerade in der Emotionspsychologie scheint der Nutzen einer bloß theoriegeleiteten Forschung doch sehr begrenzt zu sein. Diese Erkenntnis spiegelt sich im Aufbau des Buches wider. Theorien wurden inhaltlichen Fragen untergeordnet.
Zielgruppe dieses Lehrbuchs sind in erster Linie Studierende, die sich vielleicht zum ersten Mal im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem Thema »Emotionen« befassen. Aber auch für fortgeschrittene Psychologiestudenten, die sich etwa in ihrer Diplomarbeit mit Fragen der Emotionspsychologie auseinandersetzen, sollen Grundlagen und Forschungsmethoden vermittelt werden. Besonders für diese Gruppe sind die Hinweise auf weiterführende Literatur gedacht. Darüber hinaus können auch Vertreter anderer Disziplinen wie Medizin, Soziologie, Ökonomie oder Pädagogik, die bei ihrer Forschung auf Emotionen stoßen, eine Orientierung finden.
Psychologiestudentinnen haben Teile des Manuskripts kritisch gelesen und mich auf schwer verständliche Ausdrücke oder Passagen aufmerksam gemacht. Dafür danke ich Hyun-Sook Park, Martina Erdle und Renate Stark. Wertvolle Hinweise stammen auch von Michaela Pirkner sowie von Dr. Manfred Holodynski. Mit PD Dr. Michael Hüppe hatte ich anregende Diskussionen über einzelne Themen. Besonderer Dank gebührt meiner Frau, die häufig auf gemeinsame Freizeit verzichten mußte und die bei der Überarbeitung des gesamten Textes geholfen hat.
Die Fertigstellung des Manuskriptes hat sich länger hingezogen, als ursprünglich geplant war. Dem Lektor des Verlags, Herrn Dr. Heinz Beyer, danke ich für seine Geduld.
Würzburg, im März 1995Lothar Schmidt-Atzert
1 Das Konzept der Emotion
1.1
Historische Entwicklung der Emotionspsychologie
1.2
Definitionen
1.3
Beziehung zu verwandten Konstrukten
1.4
Zentrale Fragen der Emotionspsychologie
1.5
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
In einem kurzen Streifzug durch die Geschichte der Emotionspsychologie werden wir auf die Vorläufer der heutigen Forschung zu Ausdruck, Erleben, körperlichen Veränderungen und Gehirnprozessen bei Emotionen eingehen. Diese Komponenten spielen auch in vielen Emotionsdefinitionen eine Rolle. Die Frage, was eine Emotion überhaupt ist, wird in einem Abschnitt über Definitionen behandelt. Diesem Abschnitt wird eine wissenschaftstheoretische Einordnung vorangestellt. Eine Arbeitsdefinition wird vorgeschlagen und erläutert. Durch eine Abgrenzung zu verwandten Konstrukten soll die Begriffsunsicherheit weiter reduziert werden. Schließlich wird versucht, den Forschungsgegenstand »Emotionen« durch einige zentrale Fragen näher zu bestimmen.
1.1 Historische Entwicklung der Emotionspsychologie
Die Philosophie befasst sich schon seit mehr als 2000 Jahren mit Emotionen (Gardiner, Metcalf & Beebe-Center, 1937; Schmidt-Atzert, 1981, S. 14 ff.; Solomon, 1993, 2008; Ulich & Mayring, 2003). Viele dieser Gedanken fanden vor allem über die frühen Psychologen, von denen viele Lehrstühle für Philosophie innehatten, Eingang in die Psychologie.
Die Geschichte der psychologischen Emotionsforschung kann mit Gendron und Barrett (2009) in drei große Phasen unterteilt werden, die sie mit den Schlagworten »goldene Jahre«, »finsteres Mittelalter« und »Renaissance« charakterisieren. In den »goldenen Jahren« erschienen die wegweisenden Publikationen von Darwin (1872) zum Ausdruck der Emotionen, von James (1884) und Lange (1885) zur Erklärung der Entstehung von Emotionen (noch heute als James-Lange-Theorie bekannt) und die empirisch untermauerte Replik dazu von Cannon (1929). Auch die Arbeiten von Wundt fallen in diese Zeit. Der Behaviorismus führte dazu, dass Emotionen ungefähr vierzig Jahre lang weitgehend ignoriert wurden (»finsteres Mittelalter«). Seit etwa 1960 erlebt die Emotionspsychologie eine »Renaissance«, beginnend mit Arnold (1960). In ihrem Buch legte sie den Grundstein für die später von anderen aufgegriffene Idee, die Bewertung des Ereignisses sei entscheidend für die darauf folgende Emotion. Die Überlegungen, wie eine Emotion entsteht, erfahren in Kapitel 3 eine ausführliche Behandlung.
Wir wollen hier nun einige wichtige Wurzeln aufzeigen, die für das Verständnis der heutigen Emotionsforschung nützlich sind.
Ausdruck. Zur Mimik hat der Detmolder Arzt Theodor Piderit (Piderit, 1867) ein Werk mit dem Titel »Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik« vorgelegt. Darin können wir lesen: »Die mimischen Gesichtsbewegungen bilden die stumme Sprache des Geistes. Die Wortsprachen der Völker sind verschiedenartig und wechselnd, die Mienensprache aber ist aller Orten und zu allen Zeiten dieselbe geblieben. Auf dem Gesichte der amerikanischen Rothaut wie des befrackten Europäers, des Sclaven wie des Königs, des Kindes wie des Greises ist der Ausdruck des Schreckens, des Zorns, der Entzückung u.s.w. immer derselbe, und daß diese Mienensprache sich zu allen Zeiten gleich geblieben ist, das zeigen uns die Bilder vergangener Jahrhunderte, die Statuen und Monumente des Altertums« (S. 3). Piderit vertrat also die Auffassung, dass sich Emotionen in der Mimik zeigen. Weiterhin nahm er an, dass der mimische Emotionsausdruck, so würde man heute sagen, kulturunabhängig und über die Zeit invariant ist. Der Emotionsausdruck sei einfach zu erkennen; selbst Säuglinge und sogar Tiere seien dazu fähig: »Diese Sprache ist so deutlich und so verständlich, daß selbst Säuglinge den Ausdruck der Trauer oder des Unmuths auf dem Antlitze der Mutter erkennen …; sogar Tiere, wie Hunde und Elephanten, wissen die Stimmung ihres Herrn in seinem Gesicht zu lesen« (S. 3).
Beobachtungen und Überlegungen zur Mimik finden sich auch in früher erschienenen Werken, auf die Piderit, zum Teil auch kritisch, Bezug nimmt. Auch Aristoteles habe erkannt, dass Leidenschaften zu charakteristischen Zügen im Gesicht führten, dem aber wenig Bedeutung beigemessen, u. a. weil verschiedene Geisteszustände zu den gleichen mimischen Veränderungen führen könnten. Aristoteles habe vorgeschlagen, Menschen und Tiere zu vergleichen: »Dicke Nasen (wie die der Ochsen) sollen auf Trägheit deuten, … spitze Nasen (wie die der Hunde) auf Jähzorn, … gebogene Nasen (wie die der Raben) auf Unverschämtheit« (S. 119). Bemerkenswert ist, dass Piderit dem großen Philosophen nicht ehrfürchtig vertraut, sondern widerspricht: »Wenn der Ton der ganzen Abhandlung nicht ein so ernster wäre, so könnte man sich oft versucht fühlen, dies Alles für einen Spaß zu halten« (S. 120).
Piderit bemühte sich um eine genaue Beschreibung der mimischen Erscheinungen und ihrer muskulären Grundlagen. Indem der Verfasser »das flüchtige und complicierte Spiel der Mienen in seine Einzelheiten zerlegt, gelangt er zu einer systematischen Einteilung und Erklärung der mimischen Muskelbewegungen« (S. 14). Im Anhang des Buches finden sich insgesamt 94 Zeichnungen, die bewusst einfach gehalten sind, um das Wesentliche herauszustellen. Der Leser könne selbst überprüfen, ob die Darstellungen treffend seien: »Erkennt der unbefangene Beobachter in ihnen [den Zeichnungen] mit Leichtigkeit den beabsichtigten Geisteszustand, so liefern sie den practischen Beweis, dass die Regeln richtig sind, nach welchen sie construiert wurden« (S. 16). Beispielsweise widmet Piderit dem Ausdruck der Verachtung (Abb. 1.1) insgesamt drei Seiten; seine Beschreibungen sind hier verkürzt wiedergegeben.
Verachtung zeige sich teils in den Augen und teils im Mund. Der Verachtende hebe den Kopf und blicke das Objekt seiner Verachtung von der Seite an. Die Augenbrauen seien in die Höhe gezogen, auf der Stirnhaut bildeten sich horizontale Falten. Die Augendeckel senkten sich wie im Zustand der Schläfrigkeit. Die Unterlippe werde durch die Kinnhebermuskeln aufwärts gezogen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























