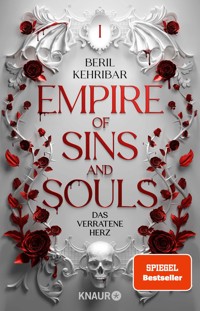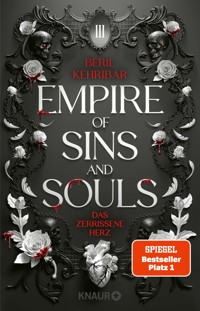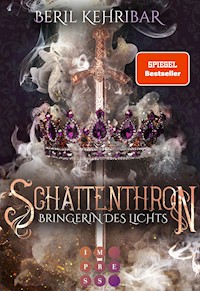12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Empire of Sins and Souls
- Sprache: Deutsch
Ein dunkler Prinz und ein unwiderstehlicher Graf, doch nur einer sagt die Wahrheit »Das gestohlene Herz« ist der zweite Band der »Empire of Sins and Souls«-Trilogie, eine spicy Enemies-to-Lovers-Romantasy in einer viktorianischen Welt. Mit emotional scars, zwei broken heroes und einer Protagonistin, die nicht weiß, für wen von beiden ihr totes Herz schlägt. Zurück in der Welt der Lebenden muss Zoé Durand das gestohlene Relikt finden und nach Xanthia zu Graf Alexei bringen. Doch als wäre die Suche nicht schon nervenaufreibend genug, wird sie nun auch noch von einem mysteriösen Unbekannten gejagt. So bleibt Zoé nichts anderes übrig, als die Hilfe des arroganten Prinzen Kaspar anzunehmen, der mehr über die geheime Organisation rund um die Église des Saints weiß, die es auf die beiden Xanthia-Flüchtigen abgesehen hat. Auf der Suche nach dem Relikt kommen Zoé und Kas sich näher, und schon bald muss Zoé sich eingestehen, dass sie mehr in dem Prinzen sieht als ihren Feind. Geplagt von ihrem schlechten Gewissen gegenüber Alexei, versucht sie mit aller Macht, die aufkeimenden Gefühle für Kas zu unterdrücken. Sie ahnt noch nicht, dass einer der beiden einen furchtbaren Verrat plant, der ihr Leben für immer verändert … Diese Tropes sind enthalten (Auswahl): - enemies to lovers - forced proximity - only one bed - he falls first - he hates everyone but herBeril Kehribar ist die Bestseller-Autorin der düsteren Jugendbuch-Reihe »Schattenthron«. Mit »Empire of Sins and Souls« hat sie eine spicy gothic Fantasy geschrieben, die sich an eine erwachsene Zielgruppe richtet – sexy, düster und unwiderstehlich. Die Dark-Romantasy-Geschichte geht weiter in »Empire of Sins and Souls 3: Das zerrissene Herz«. »Düster, sinnlich, herzzerreißend. Ich konnte das Buch gar nicht aus der Hand legen.« – Carina Schnell über Empire of Sins & Souls 1 »Dieses Buch lebt von düsterer Romantik und einem tragisch-schönen Erzählton vor seiner bitterbösen Kulisse. Ich bin hoffnungslos verliebt!« – Juli Dorne über Empire of Sins & Souls 1 Diese Trilogie beinhaltet Themen, die bei manchen Menschen ungewollte Reaktionen auslösen können. Bitte achtet daher auf die Liste mit sensiblen Inhalten, die wir im Buch zur Verfügung stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Beril Kehribar
Empire of Sins and Souls 2
Das gestohlene Herz
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zurück in der Welt der Lebenden erkennt Zoé Durand, dass ihre Mission zum Scheitern verurteilt ist. Sie muss ein verschwundenes Relikt finden und zurück nach Xanthia zu Graf Alexei bringen, sonst wird sie auf ewig als Geist zwischen den beiden Welten gefangen sein. Und als wäre die Suche nicht schon nervenaufreibend genug, wird sie nun auch noch von einem mysteriösen Unbekannten gejagt. So bleibt Zoé nichts anderes übrig, als die Hilfe des arroganten Prinzen Kaspar anzunehmen, der mehr über die geheime Organisation rund um die Église des Saints weiß, die es auf die beiden Xanthia-Flüchtigen abgesehen hat. Im Herzen der Kirche angekommen, müssen sie Seite an Seite kämpfen, und schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Feinden und Verbündeten. Zoé versucht mit aller Macht, die aufkeimenden Gefühle für Kas zu unterdrücken – nicht nur hat sie ein schlechtes Gewissen gegenüber Alexei, sie ahnt auch, was für Abgründe sich hinter der Fassade des dunklen Prinzen auftun. Wie finster jene Abgründe wirklich sind, erfährt sie jedoch erst, als es bereits zu spät ist …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Widmung
Playlist
Martin bei Rivière in der République Adrasteau
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zur selben Zeit im Blutdistrikt in Xanthia
Kapitel 9
Bei Domcourt in der République Adrasteau
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kurz zuvor im Blutdistrikt in Xanthia
Kapitel 17
Villedeux in der République Adrasteau
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
In der Nähe des Blutdistrikts in Xanthia
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Irgendwo in Xanthia
Epilog
Danksagung
Personenverzeichnis
Content Notes
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist der zweite Band der Empire of Sins and Souls-Trilogie. Wie bereits im ersten Band erwarten euch auch in diesem Buch möglicherweise triggernde Themen. Eine genaue Auflistung findet ihr auf Seite 395, jedoch enthält sie potenzielle Spoiler für die Geschichte. Bitte passt auf euch und eure mentale Gesundheit auf.
Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Fortsetzung von Zoés Geschichte!
Eure Beril
Für alle, die den Abgrund kennen
In der Dunkelheit sieht man das Licht am besten.
Für Franziska Hoffmann und Maria Weber
Weil ihr dieses Licht für mich wart, als ich es am dringendsten brauchte.
Playlist
Love into a Weapon – Madalen Duke
Back from the Dead – Besomorph, AViVA, Neoni
Bleeders – Black Veil Brides
I’m Not A Vampire – Revamped – Falling in Reverse
The Worst In Me – Bad Omens
Dirty Thoughts – Chloe Adams
The Walls – Chase Atlantic
River – Bishop Briggs
Dethrone – Bad Omens
Nightmare – UNDREAM, Neoni
Hypnotic – Zella Day
Snuff – Slipknot
VALENTINE – Måneskin
THE DRIVER – Måneskin
Unleashed – Epica
World War 3 – Ruth B.
Just Pretend – Bad Omens
Another Life – Motionless In White
Lost In Paradise – Evanescence
Lithium – Evanescence
You Will Know My Name – Arch Enemy
My Heart’s Grave – Fouzia
Blood on Your Hands – Veda, Adam Arcadia
Going to Hell – The Pretty Reckless
Martin bei Rivière in der République Adrasteau
Kapitel 1
Zoé
Das penetrante Ticken der Standuhr war der einzige Laut, der das Zimmer erfüllte. In meinem Kopf hingegen schlug das wiederkehrende Echo von Kaspars Worten um sich.
Du wirst jedes einzelne dieser Versprechen brechen, und wir werden dabei sehr viel Spaß haben, kleine Diebin.
Ich hielt die Luft an, während alles, was ich über den verbannten Prinzen wusste, durch meinen Schädel ratterte wie ein morbides Theaterstück, das ich nie wieder aus meinen Erinnerungen würde löschen können.
Wir gedenken der Opfer des Rippers.
Sie wurde bestialisch abgeschlachtet – von einem Mann, den man den Ripper nennt. Es war wohl ein Blutbad. Der Graf soll sich nie davon erholt haben.
Ich gab ihm alles. Er hatte mein Herz. Doch er entschied sich dazu, es mir in Scherben zurückzugeben.
Ich kniff die Augen zusammen und klammerte mich an mein Versprechen. Solange ich mich daran hielt, konnte dieser schlimmste aller Xathyr mir nichts anhaben.
Niemals werde ich dir vertrauen. Niemals werde ich dich in meine Nähe lassen. Und niemals werde ich dich mit mir nach Xanthia nehmen.
Ich leerte meine Lungen und funkelte Kaspar an.
»Du ziehst nichts als Zerstörung nach dir, Prinz. Ich will, dass du gehst.«
Der Hass, der meinen Mund gemeinsam mit den gezischten Worten verließ, schien an Kaspar abzuprallen, als trüge er eine Rüstung aus undurchdringlichem Stahl. Er taxierte mich noch immer aus seinen tiefblauen Augen, in denen ich die gleiche aufgepeitschte See erkannte, die seit unserem Aufeinandertreffen auch in meinem Inneren tobte. Bis auf das Tosen der Wellen war seine Miene jedoch ungerührt, sein Atem traf in gleichmäßigen Zügen auf mein Gesicht.
»Dann lass mich dir etwas versprechen, von dem wir beide wissen, dass es wirklich eintreten wird.« Kaspar machte einen Schritt von mir weg, was sich anfühlte wie ein Rückzug. Aber konnte das sein? Er war doch eindeutig der Stärkere von uns beiden. Ein Mann. Der Überlegene. »Wir sehen uns wieder, kleine Diebin.« Seine Augen glitzerten verheißungsvoll. »Lass dich bis dahin nicht einfangen. Am Ende behauptet der unantastbare Graf Alexei schon wieder, ich hätte eins seiner Spielsachen kaputt gemacht.«
Wie von selbst sackte meine Kinnlade hinab, mein Mund geöffnet, um etwas zu entgegnen, aber Kaspar hatte sich bereits umgedreht und trat ans Fenster, wobei der Perserteppich zu unseren Füßen jegliches Geräusch seiner Stiefel verschluckte.
Er schob das Fenster höher nach oben und glitt hinaus in die schwarze Nacht. Nahm seine Wärme mit sich. Ohne ein weiteres Wort.
Das war der Moment, in dem all die Anspannung meinen Körper verließ. Ich atmete tief durch, und eine Mischung aus Erleichterung und Skepsis strömte durch meine Venen. Er hatte mir nichts getan. Ich war sicher. Aber …
»Einfangen?«, murmelte ich, mein Blick auf der Suche nach irgendetwas, das ich an diesem Ort nicht finden würde. Was hatte Kaspar hier zu suchen gehabt? Hatte er mich wirklich verfolgt? Wieso ließ er mich dann einfach gehen?
Ich schaute zurück zu jener Stelle, an der er bis gerade eben noch gestanden hatte, und ein Gedanke klopfte an meinem Hinterkopf an, schob sich mit einer Vehemenz in mein Bewusstsein, die mich für einen Moment wanken ließ. Mein Herzschlag glich einem Donnern, das mich zerreißen wollte.
Hatte Nika nicht gesagt, Geister durften nicht mit der Welt interagieren? Ich betrachtete das hochgeschobene Fenster, meine Hand flog zu dem Anhänger, der unter meiner Kleidung auf meiner Brust ruhte, kühl und fremd. Sie hatte mir kaum etwas verraten. Nicht einmal über die Kette. Trotzdem hielt ich mich daran fest, als wäre sie mein Anker im Sturm.
Plötzlich fühlte ich mich so allein wie schon lange nicht mehr. Ich war wütend auf Nika, aber sie, Alexei und selbst Xanthia waren in den letzten Wochen zu meiner neuen Realität geworden, die mir innerhalb eines Wimpernschlags wieder genommen worden war. Wie bereits mein Leben zuvor.
Ich musste zurück, zusammen mit dem Relikt. Dann würde alles wieder in Ordnung kommen.
Gehetzt spähte ich in die Dunkelheit des Zimmers, machte vage Umrisse von antiken Möbelstücken aus. Fort war die Spur, der ich bis hierher gefolgt war. Der Geruch nach frisch erblühten Rosen, der zu Kaspar gehört hatte.
Nicht zum Relikt.
Jetzt war da nichts mehr. Keine Kugel.
Ich stieß den Atem aus, dann ging auch ich ans Fenster, das nichts als das alte graubraune Mauerwerk des Nebengebäudes hinter sich offenbarte. Unten erstreckte sich die schmale Gasse mit der einzelnen Laterne, die die Finsternis einsam erleuchtete. Der Gedanke daran, dass ein einziges kleines Licht genügte, um all die Dunkelheit zu vertreiben, bewegte etwas in meinem Herzen.
Aber ich konnte mir jetzt nicht erlauben, sentimental zu werden. Ich schob mich durch den Spalt im Fenster, der nun groß genug war, um ohne Mühe auf die Leiter zu gelangen. Diesmal blickte ich nicht nach unten, bis meine Füße irgendwann den Boden berührten. Erleichtert stellte ich fest, dass Kaspar bereits fort war.
Und jetzt? Was sollte ich tun? Wo sollte ich mit der Suche nach der Kugel anfangen?
Du trägst eine Spur auf deinem Körper, die dich zu ihr führen wird.
Ich hielt inne. Eine Spur auf meinem Körper. Ich trug die Spur auf meinem Körper. Das hieß, ich konnte sie nicht verfolgen. Sondern mich von ihr führen lassen? Ich grub die Zähne in meine Unterlippe, während ich zu entschlüsseln versuchte, was Nika mir damit hatte sagen wollen. Warum, verflucht noch mal, hatte sie sich so kryptisch ausdrücken müssen?
Ich senkte die Lider und horchte in mich hinein. Aber da waren nur all die Gedanken, die Runde um Runde in meinem Kopf drehten und auf meine Ohren drückten.
Was hatte Kaspar gemeint, als er von mir als Alexeis Marionette gesprochen hatte? Ja, ich erfüllte die Aufgabe, die der Graf mir aufgetragen hatte, doch ich bekam im Gegenzug etwas dafür. Nichts anderes hatte mir der Prinz selbst vorgeschlagen, bevor er gegangen war. Hätte es mich nicht zu seiner Marionette gemacht, wenn ich auf seine unverschämte Forderung eingegangen wäre?
Nimm mich mit dir nach Xanthia.
Es war ein Handel. Wie mit Alexei.
Bist du bereit für einen Pakt, Zoé?
Ich trat langsam aus der Gasse und rieb mir fröstelnd über die Arme, dabei spürte ich die Kälte des aufgekommenen Windes als Geist gar nicht. Trotzdem beschloss ich, Kaspars Mantel anzubehalten. Er hatte Taschen und konnte nützlich sein. Ich ließ meine Hand hineingleiten und schloss die Finger um das falsche Relikt.
Meine Füße führten mich an der Boulangerie vorbei, in der vorhin noch Licht gebrannt hatte, bevor ich die Leiter in das darüberliegende Zimmer nach oben geklettert war. Der späte Abend schien in die tiefe Nacht übergegangen zu sein.
Wie von selbst gelangte ich zurück auf die Hauptstraße, dorthin, wo ich aus der Kutsche gestiegen war. Dorthin, wo ich die falsche Präsenz zum ersten Mal gespürt hatte.
Hatte Kaspar gerade tatsächlich angedeutet, Alexei würde Lügen über ihn verbreiten? Nachdem ich doch mit eigenen Augen gesehen hatte, was mit Nastya geschehen war? Was Kaspar ihr angetan hatte?
Spiegel lügen nicht, hatte Alexei gesagt.
Aber was, wenn …
Drei Männer, und nur einer sagt die Wahrheit. Ich schauderte, als Baron Mirons Stimme in meinem Kopf erklang. Die anderen erzählen Unwahrheiten, sobald sie den Mund aufmachen. Es ist an dir, die Lügner zu enttarnen.
Zeigten Spiegel wirklich die Wahrheit, oder war es Alexei, der mich belog? Ließ ich mich gerade von Prinz Kaspar – einem verbannten Mörder – in die Irre führen? Versuchte er, mich auf seine Seite zu ziehen, wie er es einst bei Nastya getan hatte, bevor er …
Vor meinem inneren Auge sah ich das Messer im Mondlicht aufblitzen, ehe sich seine Schneide durch Knochen und Sehnen in einen Brustkorb bohrte. In ein Herz.
Mein eigenes ging dazu über, sich verzweifelt gegen meine Rippen zu werfen. Erst jetzt bemerkte ich einen fremden Geruch, der mir zuvor nicht aufgefallen war.
Wie konnte das sein? Ich hatte bisher keine Gerüche wahrgenommen, nicht in meiner Geistergestalt, abgesehen von Kaspar. Selbst der Duft des frisch gebackenen Brotes aus der Boulangerie war nicht zu mir durchgedrungen. Ich runzelte die Stirn und blickte um mich. Einige Häuser drängten sich dicht an dicht entlang der gepflasterten Straßen. Sie waren niedrig, die unteren Hälften aus gräulich braunem Backstein gebaut, die oberen aus dunklem Holz. Schilfgrüne Ziegel blinzelten unter der dünnen Schneeschicht der Dächer hervor, aus dessen Schornsteinen sich Rauchschwaden in den düsteren Himmel schlängelten. Hinter den hölzernen Fensterrahmen brannte kein einziges Licht. Die Stadt schlief, lediglich die schwarze See brandete irgendwo in der Ferne.
Ich reckte meine Nase in die Luft und sog sie in meine Lungen. Eine Spur von feuchtem Holz hatte sich darin verwoben und etwas … Salziges. Herbes. Männliches.
Mit einem Mal hatte ich das grässliche Gefühl, beobachtet zu werden. Mein Puls beschleunigte sich, mein Atem tat es ihm gleich. Was konnte das sein? Wer? Kaspar hatte ganz eindeutig anders gerochen.
Nervös blickte ich umher, konnte immer noch niemanden ausmachen.
Ich war losgegangen, ehe ich überhaupt beschlossen hatte, von hier wegzugehen. Das mulmige Gefühl in meinem Magen begleitete mich, als ich in eiligem Tempo über den Bordstein schritt. Ich passierte verschlossene Ladenfronten, die den örtlichen Marktplatz säumten, und überquerte eine Brücke, unter der das schwarze Wasser des Mordogne im Mondschein glänzte wie dickflüssiges Öl. Wenn ich dem Fluss folgte, würde ich zum Hafen von Martin gelangen, der sich bis nach Rivière erstreckte. An ebenjener Grenze würde der Nachtmarkt in wenigen Stunden seine Pforten öffnen.
Ich hob den Blick und jagte ihn in jene Richtung. Mir war, als könnte ich den großen Steinbogen ausmachen, der den südlichen Eingang zum Diebesplatz markierte, wie man den Nachtmarkt im Volksmund nannte. Ich verstand, weshalb.
Sollte ich dorthin? An den Ort, an dem alles begonnen hatte? Der Anfang von meinem Ende. Eine Gänsehaut kroch über meinen Körper und stellte die Härchen in meinem Nacken auf. Dort, wo das Fallbeil meinen Kopf von meinem Körper getrennt hatte. Der intensive Geruch schien mich bis hierher verfolgt und nun eingeholt zu haben, da ich noch immer wie festgefroren auf der Brücke stand.
Mein gehetzter Blick flog über meine Umgebung, ich suchte sogar den dunkelgrauen Himmel ab, in den sich inzwischen ein feiner Nebel gestrickt hatte. Der volle Mond wirkte dahinter wie eine ausgefranste Lichtkugel, ihr Schein gedämpft von einer unsichtbaren Hand, die sie in ihrem festen Griff gefangen hielt.
Friiisch…fleiiisch.
Ich erstarrte, als die säuselnde Stimme in mein Bewusstsein drang, getragen vom schwach gehenden Wind, der mit rauen Fingern über meine Ohren strich. Mit weit aufgerissenen Augen wirbelte ich herum, bereit, meinem Schicksal in die grausige Fratze zu blicken, doch … Ich war noch immer allein. Mein Herzschlag kroch hinauf in meine Kehle, in der es so heftig pulsierte, dass ich fürchtete, gleich keine Luft mehr zu bekommen.
Ich drehte mich um, und dann rannte ich. Rannte um mein Leben, das ich vor Wochen schon verloren hatte. In meinen Lungen stach es, als wären es Dornen, die ich einatmete, meine Fußsohlen brannten bei jedem Schritt auf den matschbedeckten Pflastersteinen.
Aber ich hielt nicht an. Ich hatte kein Ziel, hatte keinen Plan, sah nur die verzerrten Umrisse von Häusern, Laternen und Bäumen an mir vorbeiziehen, während ich schneller wurde, immer schneller. Nur entfernt hörte ich das Rauschen von Wasser, das näher zu kommen schien, je weiter ich rannte. Das Kopfsteinpflaster zu meinen Füßen ging über in Holzlatten, die unter jedem meiner donnernden Schritte knarzend protestierten. Die Silhouetten, die sich links und rechts von mir in der Dunkelheit auftürmten, wurden größer. Ich sah nur flüchtig an ihnen hinauf, doch das genügte, damit sich mein Elend vollends entfaltete.
Ich prallte gegen etwas Hartes, meine Kräfte verließen meinen Körper, und ich landete, begleitet von einem lauten Krachen, auf dem Holzsteg. Ich stöhnte auf und blinzelte einige Male, um auszumachen, was – oder schlimmer noch, wen – ich da umgerannt hatte. Wenn das ein Mensch war, hatte er mich gespürt, weil die Berührung von mir ausgegangen war. Das wäre nicht gut. Hätte ich im Weg gestanden und er wäre in mich hineingerannt, hätte keiner von uns irgendetwas bemerkt. Aber so …
Rufe ertönten hinter mir, und augenblicklich hörte ich auf zu atmen. Niemand kann mich sehen, rief ich mir in Erinnerung, um mich zu beruhigen. Ich bin ein Geist. Ein bebender Atemzug glitt über meine Lippen. Ich bin ein Geist. Verborgen vor Gefahr.
»Die verdammten Fischfässer sind umgekippt!«, krächzte eine raue Männerstimme.
Erst da fiel mein Blick auf das Meeresgetier, das sich um mich herum verteilt hatte. Und ich sah das große Fass, aus dem eine Menge Wasser geschwappt war, vermutlich gemeinsam mit den silbrigen Fischen, die verzweifelt um Sauerstoff rangen.
»Ich kümmere mich darum!«, rief ein anderer Mann, der bereits auf mich zuhechtete.
Er kann mich nicht sehen, er kann mich nicht sehen, er kann mich nicht sehen.
Eilig kroch ich rücklings aus dem Schlachtfeld, das sich um mich herum erstreckte, und bemerkte dabei zu spät, dass einer der glitschigen Fische unter meine Hand geraten war. Ich rutschte so heftig aus, dass sich erst mein Ellenbogen, dann meine Schulter in die Holzlatten unter mir bohrten. Ich biss mir auf die Lippe, um meinen Schmerzensschrei zu dämpfen, als könnten die Leute um mich herum ihn hören.
»Was zum …« Der Mann mit den breiten Schultern und dem schütteren blonden Haar blieb wenige Fuß von mir entfernt stehen und kratzte sich am Kopf. »Ist der beschissene Fisch gerade weggesprungen?«
Von Panik ergriffen schaute ich um mich, um sicherzugehen, dass niemand sonst gesehen hatte, was passiert war. Dabei stellte ich fest, dass die großen Silhouetten, die mich verfolgt hatten, zu den wuchtigen Schiffsrümpfen gehörten, die sich auf der See hin und her wiegten. Ihre gehissten Flaggen blähten sich im Wind, sprenkelten den tristen Himmel mit bunten Farben. Meine Füße hatten mich zum Hafen getragen, an dem das Leben allmählich erwachte.
»Hey, du!«, rief der blonde Mann und winkte, ehe er die ersten Fische zurück in das Fass beförderte. »Hilf mir mal!«
Erst als sich ein Umriss in mein Sichtfeld schob, stellte ich erleichtert fest, dass er nicht mit mir sprach, sondern mit einem groß gewachsenen Mann, der hinter mir hervortrat. Ich erkannte sofort, dass er nicht hierhergehörte. Zum einen war er alt. Und zum anderen war seine Kleidung die eines Geschäftsmannes, nicht die eines Hafenarbeiters. Eine weiße Uniform, die an einem Ort wie diesem nach nur zwei Minuten Arbeit dreckig werden würde. Bevor er die Hände in seine Hosentaschen gleiten ließ, erhaschte ich noch einen Blick auf ein rotes Symbol, das in den Ärmel des weißen Stoffes gestickt worden war.
Aber es war nicht die ungewöhnliche Kleidung des Mannes, die mich in jenem Moment scharf die Luft einziehen ließ. Auch nicht die harten Gesichtszüge, die sich unter seinem vollen, aschefarbenen Bart abzeichneten.
Es war sein Geruch. Sein Geruch nach feuchtem Holz und Meersalz.
Der Mann bückte sich, um einen der Fische aufzuheben. Ehe ich es mich versah, hob er das verzweifelt zappelnde Tier an seinen Mund und biss geräuschvoll hinein. Flüssigkeiten spritzten auf und zogen feuchte Spuren durch den krausen Bart. In meinem Magen brodelte es, und ich meinte, bereits die bittere Galle auf meiner Zunge zu schmecken.
Aber die Übelkeit verflog mit dem Glockenschlag der Kirchenuhr, als sich der Mann mit dem Fisch in der Hand breit grinsend zu mir umwandte, die Zähne blutverschmiert hinter den gekrümmten Lippen. Mein Herzschlag setzte aus. Denn er bohrte den Blick aus seinen milchig weißen Augen zielsicher in mein Gesicht.
Kapitel 2
Du sollst mir helfen und nicht mein Geld wegessen, verflucht!«
Die Stimme zerschnitt die ohrenbetäubende Stille, die zwischen mir und dem Mann in der weißen Uniform aufgekommen war. Die Sekunden hatten sich über uns ausgedehnt wie eine zähflüssige Masse, die jeden Augenblick drohte, mich zu ertränken.
»Und überhaupt«, fuhr er gestikulierend fort, »der Fisch hat noch gelebt, Mann! Das ist barbarisch!«
Als der Uniformträger nicht reagierte, ging der blonde Hafenarbeiter dazu über, ihn von der Seite zu mustern, als würde er ihn erst jetzt so richtig sehen. Die Furchen auf seiner Stirn vertieften sich, und ein Ausdruck von Unglaube mischte sich in seine Züge. Sein Mund schwang auf und wieder zu, auf und wieder zu. Ähnlich dem Maul des Fisches, der in jenem Moment aus seinen fleischigen Händen rutschte, um mit einem dumpfen Laut auf den Boden zu klatschen.
»Du bist ein Geistlicher«, stieß er schließlich aus.
Es war, als gleite ein goldener Schleier über die milchig weißen Augen des seltsamen Mannes, bevor sich die Iriden dunkelbraun färbten und endlich von mir lösten. Mein Herz nahm seinen Takt wieder auf, doch diesmal so schnell, dass es in wenigen Minuten gänzlich erschöpft in sich zusammensacken würde, wenn ich mich nicht sofort beruhigte.
Was war da gerade passiert?
Der Blonde bückte sich, um den Fisch aufzuheben. »Was macht jemand wie du hier unten?«
»Ich habe geschäftlich zu tun.« Er lachte leise und irgendwie grausam, was mich schaudern ließ. »Ich suche jemanden.«
Ich spürte, wie sich meine Augen weiteten, bevor ich noch ein Stück zurückkroch, um mehr Abstand zwischen ihn und mich zu bringen. Im selben Moment presste der Hafenarbeiter den inzwischen reglosen Fisch an seine Brust und blickte gehetzt um sich.
»Was soll das heißen?« Ich konnte das Zittern aus seiner Stimme heraushören. »Ist euch einer entwischt?«
Irritiert zog ich die Augenbrauen zusammen, mein Herz hämmerte laut. Ich hatte mich noch nie mit der Arbeit der Geistlichen in dieser Stadt auseinandergesetzt, wusste nur, dass sie beteten, keusch lebten und angeblich frei von Sünde waren. Als Prostituierte hielt ich mich von der Kirche fern wie der Teufel sich vom Weihwasser. Wer oder was sollte diesem Geistlichen also entwischt –
Wie Eis, dessen Finger über einen Teich glitten, drang noch etwas in meine Erinnerung, als ich an die roten Rauten dachte, die leuchtend auf den Türen vieler alleinstehender Frauen in kleineren Städten Adrasteaus prangten.
Sie exorzierten Menschen, von denen sie dachten, dass sie besessen wären. Von …
»Du weißt doch, wie es ist. Manche Dämonen müssen unschädlich gemacht werden, bevor sie unseren Frieden gefährden. Es ist an meinen Brüdern und mir, sie einzufangen.«
Einfangen? Meine Gedanken begannen, in Aufruhr auf einen Abgrund zuzurasen, drohten zu stürzen, wirr und zerbeult und voller Löcher.
Und doch kam ich zu einer Erkenntnis, die mich schneller auf die Beine springen ließ, als ich blinzeln konnte. Dieser Mann – dieser Geistliche –, wer auch immer er war, er jagte mich.
Lass dich bis dahin nicht einfangen.
Kaspars Worte krachten durch mich hindurch wie Steine, die ebenso schwer auf den Grund meines Magens sackten. Ich überlegte nicht lange, sondern lief los. Irgendwohin. So schnell ich konnte. Was wollte er von mir? Ich war doch gar kein Mensch, und da war auch kein Dämon in meinem Körper. Wieso konnte er mich überhaupt sehen? Was passierte hier? Was –
In der blanken Panik, die meine Sicht unscharf werden ließ, steuerte ich direkt auf einen riesigen Haifisch zu, den man an der Schwanzflosse aufgehängt hatte. Es gelang mir im letzten Moment, nach rechts auszuweichen, bevor ich mit dem Gestell kollidierte, an dem das Tier leblos baumelte.
Ich duckte mich unter geknüpften Netzen hindurch, sprang über Holzbalken, die lose auf dem Boden lagen, und stieg über gestapelte Kisten, ohne sie umzuwerfen. Jedes Geräusch würde dem Mann verraten, wo ich war. Wenn er mich aus einem unerklärlichen Grund sehen konnte, dann musste er mich auch hören.
Beinahe knickte ich um, als mein Fuß auf einem gefüllten Mehlsack landete statt auf dem Steg, eine weiße Puderwolke stob in die Luft, aber ich konnte mich fangen und an einer Fischerhütte vorbei in die Stadt flüchten.
Erst als es erbarmungslos in meiner Brust brannte, verlangsamte ich meine Geschwindigkeit, um zu Luft zu kommen. Sie schien sich in meiner Kehle zu sammeln, nicht gewillt, bis in die Tiefen meiner Lungen vorzudringen. Ich hielt mir die Seite, die von Nadelstichen malträtiert wurde, und blickte um mich. Um zu erkennen, ob der Mann mir bis hierher gefolgt war, und um auszumachen, wo hier überhaupt war. Mein Atem ging noch immer zittrig, während sich die Umrisse von Gebäuden und Menschen aus der Dunkelheit schälten.
Taverne du Requin pendu stand auf einem Schild, das sich quietschend dem Wind beugte. Es hing vor einem dreistöckigen Backsteingebäude mit ausladendem Balkon. Nach meinem Beinahezusammenstoß am Hafen bekam Zum gehängten Hai eine ganz neue Bedeutung. Gleichzeitig realisierte ich, dass ich zurück in Rivière war. Diese Taverne schloss an die Grenze zu Martin an.
Und … Ich sah die Straße runter, die nur von einzelnen Passanten bevölkert war, und wusste, wohin sie führte. Hinter der Kreuzung würde sie in die Rue Marceau übergehen, die dann zur Rue de Lorraine wurde.
Ich schluckte gegen die Enge an, die sich plötzlich in meinem Hals breitmachte, und bei meinem nächsten Atemzug schüttelte es mich. Der penetrant-herbe Geruch meines Verfolgers drang an meine Nase und trieb mich an, weiterzugehen.
Beinahe geräuschlos glitt ich über das Kopfsteinpflaster, huschte in eine der schmalen Gassen, um unentdeckt entlang der Hauptstraße zu spähen. Einige Atemzüge lang stand ich starr da, lauschte meinem Herzschlag, bis er nicht mehr ganz so schrecklich schmerzhaft gegen meine Rippen pochte. Ich konnte den Mann nirgends entdecken, also schlüpfte ich aus der Gasse und lief eilig weiter, obwohl meine Beine inzwischen protestierten. Waren meine Schritte sonst fest, so fühlten sie sich nun unsicher und wackelig an. Bei jedem weiteren musste ich befürchten, dass eines meiner Beine unter mir nachgeben würde.
Erleichtert bemerkte ich, dass sich der Geruch des Uniformträgers verlor, je mehr Menschen auf die Straßen strömten. Wirre Stimmen drangen durch den wabernden Nebel und schenkten mir trotz der unheimlichen Atmosphäre für den Moment das Gefühl von Sicherheit. Ich erlaubte mir eine kleine Pause, wobei ich mich in den Schatten einer der ockerfarbenen Hausmauern schmiegte. Es war seltsam, die Kälte, die von dem Mauerwerk ausgehen musste, nicht auf meiner erhitzten Haut zu fühlen.
Obwohl ich am liebsten die Augen geschlossen hätte, um mich für nur einen Moment der Illusion hinzugeben, dass alles in Ordnung war, zwang ich mich, wachsam zu bleiben. Das Unheil nicht zu sehen, hieß nicht, dass es nicht da war. Lieber behielt ich es im Blick, um rechtzeitig reagieren zu können.
Ich beobachtete Passanten, die an mir vorbeigingen, ohne auch nur in meine Richtung zu schielen. Eine Frau auf der anderen Straßenseite öffnete gerade ihren Laden, nachdem sie einige bettelnde Kinder verjagt hatte.
Dann musste es bereits in den frühen Morgenstunden sein. Der Himmel changierte noch immer in dunklen gräulichen Blautönen, aber das war nicht verwunderlich in den kalten Wintermonaten. Kaum war der Gedanke verflogen, schob sich ein weiterer in mein Bewusstsein: Mein zweiter Tag auf der Erde brach an. Ich schluckte schwer, und meine Hand fand den Kettenanhänger, der sich durch den Stoff meiner Bluse drückte. Er erinnerte mich an Nikas Worte. Ich hatte nicht viel Zeit.
Nach einer Minute des Durchatmens stieß ich mich von der Mauer in meinem Rücken ab, nur um einen Wimpernschlag später zu erstarren. Da war ein Gesicht in der Menge, das ich sogar durch den leichten Nebel hindurch erkannte. Es gehörte nicht meinem Verfolger. Es gehörte gar nicht erst zu einem Mann. Das war Lola. Meine ehemalige Kollegin aus dem Salon Rouge.
Mein Herz schlug erneut einen schnelleren Takt an, während ich dabei zusah, wie sie sich bei einer anderen Frau unterhakte, die mir den Rücken zuwandte. Sie hatte dasselbe schokoladenbraune Haar wie Lola und warf in jenem Moment den Kopf in den Nacken, als sie laut auflachte. Lilou, ihre Zwillingsschwester. Die beiden liefen in Richtung der Rue Marceau, und ich wusste, wohin sie gingen.
Einem inneren Impuls folgend eilte ich lautlos hinter ihnen her wie einem Geist der Vergangenheit. Hinter meiner Stirn baute sich ein Druck auf, der nur wenige Sekunden später als Brennen in meine Augen stieg. So viele Erinnerungen brachen hervor und gruben sich in meinen Verstand wie unzählige kleine Insekten. Sie labten sich an dem Leid, das sie verursachten, und ich schlang die Arme um meinen bebenden Körper, um es auszuhalten. Beinahe meinte ich, den mir vertrauten Geruch auszumachen, der sich hier in den Straßen staute, eine Mischung aus Pisse, Alkohol und Erbrochenem.
Ich schaute um mich, bohrte die Fingernägel in meine Oberarme, als könnte der Schmerz mich davon ablenken, wie sehr ich mich vor den Schatten fürchtete, die über die Hauswände glitten.
Es war keine zwei Jahre her, da hatte mich ein Mann in eine der Gassen unweit von hier zerren wollen, bevor ich meine Schicht im Salon Rouge begann. Er hatte im Dunkeln gelauert und nach meinem Kleid geschnappt, als hätte er in seinem schäbigen kleinen Versteck nur auf mich gewartet.
Bei der Erinnerung begann mein Herz zu rasen. Es klopfte so laut, dass das Rauschen meine Sinne flutete und die Bilder wegspülte. Bilder davon, wie ich sein Gesicht zerkratzte, um mich irgendwie aus seinen Klauen zu befreien.
Kaum hatte sich eine Träne aus meinem Augenwinkel gelöst, wischte ich sie fort. Ich wischte sie alle fort, waren sie doch ohnehin unsinnig. Sie verschleierten meine Sicht, und das konnte ich mir nicht erlauben.
Rasch warf ich einen weiteren Blick hinter mich, lauschte angestrengt über das Dröhnen meines Herzens hinweg in den erwachenden Alltagslärm der Stadt und sog tief die Luft ein, die entgegen meinen Erinnerungen keinen Geruch mit sich trug. Nicht mehr, jetzt, da ich ein Geist war.
Erleichtert stieß ich den angehaltenen Atem aus, ehe ich Lola und Lilou über das Kopfsteinpflaster bis runter ins Trou folgte, dessen Straßen zu dieser Tageszeit nahezu leer waren. Jenes Viertel Rivières, in das sich keine Seele freiwillig verirrte. Hier tummelten sich nur noch mehr zwielichtige Gestalten zwischen brüchigen Hauswänden und geplünderten Läden.
Und mittendrin, zwischen einer Schlachterei und einem Kaffeehaus, befand sich der doppelstöckige, dreckig-grau gemauerte Salon Rouge, vor dem die Schwestern zum Halten kamen.
Meine Brust zog sich zusammen, als ich die gerundete, rot gestrichene Holztür betrachtete, die den Eingang in das Etablissement darstellte. Davor stand keine Marie, die sich zwischen zwei Kunden eine Zigarette genehmigte. Keine Marie, die mich fürs Zuspätkommen tadelte. Keine Marie, die mir ein letztes Lächeln entlockte, bevor ich in die Hölle hinabsteigen musste. Dafür hatte ich gesorgt. Und jetzt wollte sie nichts mehr von mir wissen.
Ich blinzelte gerade eine neue Träne weg, als die Tür nach außen aufschwang. Mein Herz hörte auf zu schlagen, als eine Befürchtung mit kalter Hand nach ihm griff.
Bitte nicht. Ich will ihn nicht sehen. Bitte –
Eine Frau trat heraus, und ich ließ den Atem, den ich unbewusst angehalten haben musste, lautstark entweichen. Ich hätte es nicht verkraftet, in Jean-Pauls ekelerregende Visage zu sehen. Stattdessen schien er Ersatz für mich gefunden zu haben.
Das laute Klirren von Gläsern drang aus dem Gebäude, begleitet von einem gedämpften Stimmengewirr, in das sich heiseres Lachen und Gestöhne mischten, bis die Tür hinter der Frau ins Schloss fiel und die scheinbar schillernde Welt des Freudenhauses von der grauen hier draußen trennte.
»Habt ihr heute nicht frei?« Die Frau mit den mausbraunen Locken zupfte am tiefen Ausschnitt ihres Kleides herum, bevor sie eine Schachtel Zigaretten zwischen ihren Brüsten hervorholte.
Die Zwillinge nickten.
»Aber Jean-Paul will mit uns sprechen«, sagte Lola.
»Du weißt schon, seit sie seine Lieblingshure geköpft haben, sucht er nach einer neuen Blume.« Lilou nahm eine Zigarette entgegen, die die Frau ihr reichte. »Er weiß, dass wir eine jüngere Schwester haben.«
»Früh übt sich«, ergänzte Lola, und die drei brachen in heiseres Gekicher aus.
In meinem Magen rumorte es, was nicht nur daher rührte, dass die beiden Jean-Paul ihre Schwester anbieten wollten wie ein Stück Fleisch.
Sie redeten über mich. Ich war seine Blume gewesen. Dabei war das nichts Erstrebenswertes, doch was wussten sie schon? Sie waren geblendet von ihrer Eifersucht, dachten, meine Stellung würde Privilegien mit sich bringen – nicht ahnend, welche Konsequenzen es tatsächlich bereithielt, Jean-Pauls Liebling zu sein. Ich konnte es ihnen noch nicht einmal verübeln. Blumen waren etwas Schönes. Sollten sie sein.
Meine Gedanken schossen weiter zu dem anderen Wort, das eine Gänsehaut über meinen Körper gejagt hatte. Geköpft. Was man wohl in der Zeitung über mich geschrieben hatte?
Die Tötung des Phantoms.
Es hat sich ausgegeistert.
Selbst das Phantom ist nur ein Mensch.
Ich lachte bitter. Das Phantom, der Geist, der ich zu Lebzeiten nie wirklich gewesen war, sollte ich also von nun an sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Welch Ironie das Leben doch bereithalten konnte.
»Hast du es schon gehört, Josefin?«, krächzte Lilou, nachdem sie eine Rauchwolke in die Luft gepustet hatte. »Sie haben wieder Häuser markiert.«
Während mein Herz in meine Kniekehlen sackte, weiteten sich die Augen der Frau, die sich daraufhin prompt noch eine Zigarette ansteckte. Meine Panik wurde größer, als Lola hinzufügte: »Sie haben im Westen von Aubervilliers angefangen. Man sagt, es betreffe zwei Häuser.«
»Alleinstehende Frauen?«, hakte Josefin nach.
Erneut folgte ein synchrones Nicken der Zwillinge.
Ich wartete gar nicht ab, was sie weiterhin sagten. Meine Füße hatten sich bereits in Bewegung gesetzt, mein Puls hämmerte laut in meinen Ohren, angetrieben von einem einzigen Gedanken, der durch meine Venen sickerte wie klebriges Gift. Eine widerliche Übelkeit breitete sich von meinem Magen bis in meinen Hals aus, von wo aus sie bitter auf meine Zunge kroch.
Nicht Maman, lief es in Endlosschleife durch meinen Kopf. Nicht Maman, nicht Maman, nicht Maman, nicht Maman.
Der Schritt über die westliche Grenze zu Aubervilliers fühlte sich anders an. Schwer und bedeutsam. Obwohl ich das Wetter nicht spüren konnte, hatte ich das Gefühl, dass die Luft hier kälter war, dick und trocken. Sie legte sich auf meine Schultern, hüllte mich in einen Kokon, der alles an Lärm und Licht verschluckte.
Ich bewegte mich nur schwerfällig in der Dunkelheit, die mich umschloss, mein Atem ein Wechselspiel aus viel zu schnell und viel zu langsam. Weiße Dunstwolken quollen zwischen meinen Lippen hervor, schwebten dicht vor meinem Gesicht, stoben auseinander, bevor die nächsten folgten.
Wenn ich die Augen zusammenkniff, erkannte ich die Umrisse heruntergekommener Häuser, die den Bordstein säumten. Bei jeder einzelnen Tür, die ich betrachtete, zog sich das Band um meine Brust ein wenig fester zusammen. Ein Teil von mir hoffte, die beiden markierten Häuser zu entdecken, bevor ich das unsere erreichte, aber der andere Teil hatte Mitleid mit jenen, die es getroffen haben würde.
»Verfluchte Fanatiker.« Alle paar Monate suchten sie sich neue Opfer. Kranke Menschen – nein, Frauen –, denen sie nachsagten, von Dämonen besessen zu sein. Mit ihren teuflischen Ritualen, die jene Besetzer austreiben sollten, gelang es ihnen lediglich, die armen Seelen in den frühen Tod zu treiben.
Und das sollten Männer der Kirche sein. Sogenannte Männer Gottes. Ein verächtliches Schnauben baute sich in mir auf, aber die Sorge um Maman schnürte mir die Kehle zu. Mein Herz sank hinab ins Bodenlose, als sich durch die Finsternis um mich herum eine leuchtend rote Farbe brannte.
Ich blieb stehen und sog tief Luft in meine Lungen. Das war das Haus von Madame Bernard. Ihr Mann war vor langer Zeit gestorben, und ihr Sohn war erst fünfzehn Jahre alt gewesen, bevor der Tod auch ihn im letzten Winter zu sich holte. Ich erinnerte mich daran, mit ihm auf dem Innenhof gespielt zu haben, als wir noch Kinder gewesen waren. Madame Bernard hatte uns himmlisch duftende Kekse gebacken und mir welche für Maman mitgegeben, die sich nicht länger um mich kümmern konnte. Sie waren das Leckerste, das ich je gegessen hatte.
Mein Blick fixierte noch immer das rote Symbol an ihrer Haustür, während mir die Erinnerung an den buttrigen Geschmack der Kekse entglitt. Eine Raute, durch die sich eine horizontale Linie zog. Wie viel Zeit würde ihr bleiben, bis die Teufel sie holen kamen?
Ein bebendes Schaudern überlief meine Wirbelsäule, und ich schlang meine Arme um meinen Oberkörper, als könnte ich so die klirrende Kälte, die sich durch meine Eingeweide fraß, vertreiben. Ich schluckte schwer und setzte meinen Weg fort. Was blieb mir auch für eine Wahl?
Es waren nicht mehr viele Häuser, die zwischen dem von Madame Bernard und unserem lagen. Vielleicht sieben oder acht. Da war kein Symbol an der Tür von Madame Michel, auch keines an jener von Mademoiselle Dubois.
In der Ferne konnte ich bereits die vertraute Silhouette ausmachen, das eingeschlagene Fenster, über das ich ein Stück Holz genagelt hatte. Es hing immer noch halb herunter, ließ die kalte Luft ins Innere des kleinen Häuschens strömen.
Mit jedem weiteren Schritt, den ich mich auf unser Haus zubewegte, verstärkte sich das Zittern meiner Knie, auch das enge Band um meinen Brustkorb erlaubte mir kaum mehr zu atmen. Tränen stiegen in meine Augen, versuchten, das Offensichtliche zu verhüllen, das sich durch ihren dichten Schleier nur langsam in mein Bewusstsein kämpfte.
Weitere wackelige Schritte brachten mich näher an das Unvermeidliche, von dem ich eigentlich schon längst gewusst hatte, dass es eintreten würde. In jenem Moment, in dem Lilou darüber gesprochen hatte. Ich hatte es gespürt wie ein Geschwür in meinem Magen.
Die rote Raute prangte an unserer Haustür gleich einem Mahnmal. Und bevor der Wind über mein tränenfeuchtes Gesicht strich, dachte ich, dass das Schlimmste eingetreten war, das hätte passieren können. Doch der Geruch, der in der Brise mitschwang, lachte mir höhnisch ins Gesicht, weil ich mich so sehr getäuscht hatte.
Feuchtes Holz und Meersalz.
Kapitel 3
Ich drehte mich um, ganz langsam. Wusste, dass es keinen Unterschied machte, ob ich es früher oder später zu Gesicht bekam.
Mein Ende.
Das rote Mal in meinem Rücken und der Mann in der weißen Uniform zwischen zwei Häusern direkt vor mir. Vielleicht zehn Fuß entfernt. Er grinste breit, seine Augen funkelten wie gezückte Messer. Die dunkelbraunen Iriden jagten von links nach rechts, als suche er etwas.
»Komm raus zum Spielen.«
Seine Stimme war heiser, kratzte wie Stein, der gegen Stein scheuerte. Der Ton jagte eine Gänsehaut über meine Arme, und ich schluckte hart, bevor ich fragend die Augenbrauen zusammenzog. Er konnte mich doch nicht sehen?
Schwer atmend machte ich einen Schritt nach hinten, hoffte, im Schatten unseres Hauses untertauchen zu können. Im nächsten Moment schoss ein anderer Gedanke durch meinen Kopf, der eisige Schauder nach sich zog.
Was, wenn meine Mutter in diesem Moment die Tür öffnete und diesem Geistlichen begegnete, der schon bald auch sie holen würde? In meinem Inneren brach ein Tumult los, bis –
Atemlos sah ich dabei zu, wie sich erneut der goldene Schleier über die Augen des Mannes legte, ehe sie wie vorhin diesen grotesk-weißen Ton annahmen. Danach benötigte es nur noch einen Wimpernaufschlag, bis sein Blick mich fand. Ich keuchte.
»Ah«, machte er und trat auf mich zu. »Da bist du ja.«
»Wieso verfolgst du mich?«, entfloh es meinen Lippen. Was würde es mir bringen, Zeit zu schinden? Aber vermutlich lag es in der Natur des Menschen, den eigenen Tod so weit wie möglich hinauszögern zu wollen. Meistens.
Strahlend weiße Zähne blitzten im letzten Licht der Laternen, bevor bald die Sonne hinter den düsteren Wolken auftauchen würde.
»Weil Abscheulichkeiten nicht in unsere Welt gehören.« Er griff in die Innentasche seines Jacketts, und goldener Stahl glühte auf. Ein Dolch mit juwelenbesetztem Griff. Der Mann richtete die Spitze auf mich, und erschrocken wich ich nach hinten.
Der Anblick der Waffe versetzte mich zurück in die kleine Kabine im Salon Rouge. Erinnerte mich daran, wie ich einen Dolch aufgehoben und in Raouls Brust versenkt hatte. Ich war so erschrocken darüber gewesen, wie gut es sich angefühlt hatte, sein Leben auszulöschen. Ich hatte mich für dieses Gefühl verabscheut. Aber ich hatte es getan, um zu überleben. Ich hatte es genossen, diesen Bastard zu töten, weil es Kontrolle bedeutete. Und solange ich selbst die Kontrolle über mich hatte, konnte sie kein anderer haben. Das war es, was Freiheit bedeutete. In dem Moment, in dem ich Raouls Leben beendete, hatte ich vermutlich zum ersten Mal von ihr gekostet, und ihr Geschmack war berauschend gewesen.
Der Mann stürzte auf mich zu, und ich wusste, dass ich ihm keine Macht über mich geben durfte. Wenn er mich töten würde, dann als die Zoé, die frei war. Ich schloss die Augen, stellte mich meinem Schicksal, wohl wissend, dass ich jeden einzelnen Tag alles gegeben hatte, damit es ein Morgen gab.
Ich war sicher, dass die Spitze der Waffe jeden Moment auf meine Brust treffen und Fleisch aufreißen würde, da verstummten alle Geräusche um mich herum. Ich riss die Lider auf. Der Mann war in seiner Bewegung eingefroren. Blinzelnd blickte er um sich, und ich bemerkte den schwarzen Rauch, der zunächst um meine Knöchel wirbelte, dann über das Kopfsteinpflaster kroch und sich um meinen Verfolger schlängelte. Gleichzeitig drangen Rufe und Gurgeln und Schreie verschiedener Stimmen wie durch Nebel an meine Ohren. Es war nicht mein Angreifer, der sie ausstieß. Doch woher …?
Hektisch atmend beobachtete ich, wie der Rauch immer dunkler wurde, so undurchdringlich, dass er den Mann gänzlich verschluckte. Mein Herzschlag donnerte ohrenbetäubend laut durch meinen Körper, verdrängte die anderen grauenvollen Laute. Der Geistliche im Strudel aus Grautönen gab keine Geräusche mehr von sich.
In jenem Moment fiel Licht vom Himmel, und als würde es das Eis in meinen Knochen auftauen, entspannte sich mein Körper. Die Sonne blinzelte schwach durch den Nebel, ihre Strahlen zersetzten die dichten Schwaden, die sich im Nichts verloren. Gebannt starrte ich auf die Stelle, an der mein Verfolger bis vor wenigen Sekunden eben noch gestanden hatte, doch er war fort.
Was ist da gerade passiert? Wo ist er hin?
Erschüttert taumelte ich weiter zurück und spürte sogleich einen rauen Widerstand in meinem Rücken. Die Tür mit der Raute. Mein Kopf zuckte nach links, und ich erblickte das notdürftig zusammengeflickte Fenster mit seinen dreckverschmierten Scheiben.
Ich müsste meinen Hals nur ein wenig recken, um hineinsehen zu können. Der Schaukelstuhl meiner Mutter stand direkt darunter. Vermutlich saß sie sogar in diesem Moment darin und beobachtete den Sonnenaufgang. Die Vorstellung ließ mein Herz in meinem Brustkorb zappeln wie einen der Fische, die aus dem Fass geschwappt waren. Um Sauerstoff ringend.
Ich sah zurück auf die Straße. Gähnende Leere starrte zurück.
Der Mann war tatsächlich verschwunden.
Ich benötigte einige tiefe Atemzüge, um zur Ruhe zu kommen, ehe ich mich dem Fenster zuwandte. Eigentlich sollte ich wegrennen, so viel Abstand wie möglich zwischen meinen Angreifer und mich bringen. Wer wusste schon, wann er wieder auftauchte?
Auf der anderen Seite …
Ich wollte meine Mutter sehen, so sehr.
Aber was, wenn sich ihr Zustand verschlechtert hatte? Was, wenn ich nicht vorsichtig genug war und sie bemerkte, dass jemand hier war? Andererseits … Was, wenn ich die Relikte nicht finden würde und das hier meine letzte Möglichkeit war, meine Mutter je wieder anzusehen? Mir die Linien ihres Gesichts einzuprägen? Vielleicht einen Blick auf ein letztes Lächeln zu erhaschen?
Ich presste mir die Hand auf den Mund, als ein zittriges Schluchzen aus meiner Kehle stieg und all die Anspannung mit sich nahm. Nur langsam schob ich mein Gesicht näher an die Scheibe und zuckte zusammen. Sie war tatsächlich hier. Maman. Auf der anderen Seite des Fensters, nur wenige Handbreit von mir entfernt. Ihre hellblauen Augen wirkten überschattet, saßen tief in ihren dunklen Höhlen. Und wie immer schauten sie direkt durch mich hindurch, was einen schmerzenden Stich in meinem Inneren nach sich zog.
Wieso war sie aufgestanden und ans Fenster getreten? Spürte sie mich? Wusste sie, dass ich sie nicht verlassen hatte?
Ein weiteres lautes Schluchzen kroch in mir hinauf, als ich meine Hand hob und an die vereiste Scheibe legte. Mir war bewusst, dass meine Mutter mich nicht sehen konnte, doch ich erlaubte mir den irrationalen Gedanken, dass ich ihr auf diese Weise ein Stück näher sein konnte.
Als auch meine Mutter ihre Hand hob, stockte mir der Atem. Sie schmiegte die Hand an ihre Seite des Fensters, nur wenige Zentimeter unter meine. Ihre Fingerspitzen würden meine Handfläche berühren, wäre da keine Scheibe, die uns trennte.
Und die Tatsache, dass ich ein Geist war.
Mit verschleiertem Blick beobachtete ich, wie sich auch die Augen meiner Mutter mit kristallklaren Tränen füllten.
»Ich komme zu dir zurück.« Bevor es zu spät ist, ergänzte ich in Gedanken, nachdem ich kurz zur blutroten Raute schielte. Der Wind trug meine geflüsterten Worte fort, doch das änderte nichts daran, dass sie ein Versprechen waren.
Ich hatte mir vorgenommen, zum Diebesplatz zu gehen, dem Ort, an dem ich das Relikt einst verloren hatte. Der Nachtmarkt würde dort noch nicht zu finden sein, aber ich hegte die Hoffnung, dass ich irgendeine andere Spur zu der Kugel finden würde. Ich hatte keine anderen Anhaltspunkte. Ich hatte nichts, gar nichts.
Du trägst eine Spur auf deinem Körper, die dich zu ihr führen wird.
Ich schnaubte. Nika hatte mir helfen wollen, aber im Endeffekt hatte sie nichts dergleichen getan. Ja, sie hatte mich zu Gregoris Haus begleitet, aber Miron hatte ich mich allein gestellt.
Und versagt, verhöhnte mich meine innere Stimme. Ich ballte die Hände zu Fäusten. Sie würde mich nicht von meinem Weg abbringen.
Ich konnte nicht sagen, wie lange ich die Rue de Lorraine bereits zurücklief, während es unter meinen Fußsohlen brannte. Ich war müde. So, so müde.
Angestrengt versuchte ich, durch den wieder dichter werdenden Nebel zu spähen, um mich zu orientieren. In einigen Metern Entfernung erkannte ich das Café Komine, das sich in der Nähe des Salon Rouge befand. Dann war ich also noch immer im Trou. Es sollte mich nicht wundern bei den Gestalten, die mir ab und an über den Weg liefen. Betrunkene, zum Beispiel. Oder Männer, die Flecken auf ihrer Kleidung hatten, die verdächtige Ähnlichkeiten mit Blut aufwiesen. Ich schüttelte mich.
Als ich am Café vorbeilief, konnte ich nicht anders, als kurz anzuhalten und durch das Schaufenster zu spähen, wie ich es früher so oft getan hatte. Ich erinnerte mich an den massiven Verkaufstresen aus dunklem Holz, auf dem sich Etageren aneinanderdrängten, die die verschiedensten kleinen Törtchen zur Schau stellten. Dahinter stand eine Frau, das Weiß ihrer Schürze durchsetzt von Flecken in den buntesten Farben. Sie passten zu jenen, die das Gebäck zierten. Kuchen, belegt mit tiefvioletten Pflaumen und glitzerndem Zimtzucker, daneben eine hell glasierte Blätterteigtasche, aus der pürierte Äpfel quollen. Rote Schattenmorellen glänzten auf schokoladenbraunem Rührteig, zwischen seinen einzelnen Schichten eine butterfarbene Creme. Ich legte eine Hand auf meinen Bauch, in dem es immer sofort rumort hatte, wenn ich etwas zu essen sah.
Aber heute blieb mein Magen stumm.
Gerade als ich mich von dem Schaufenster abwenden wollte, beobachtete ich, wie die Verkäuferin ausgiebig gähnte, ehe sie durch einen Leinenvorhang in den hinteren Bereich des Cafés verschwand. Der Stoff schwang hinter ihr zu, und jetzt war der Laden leer.
Ich schluckte und sah um mich. Die Straße war menschenleer. Ich warf einen erneuten Blick durch die Scheibe. Die Verkäuferin war noch nicht zurückgekehrt. Meine Hand lag weiterhin auf meinem Bauch. Noch ein Schlucken.
Nika hatte gesagt, dass ich nicht mit der Welt interagieren durfte, aber Kaspar hatte das Fenster hochgeschoben. Vielleicht war es also gar nicht so ein großes Verbrechen, wenn ich nur kurz …
Meine Finger schlossen sich wie von selbst um die abgegriffene Türklinke. Ich stieß die Ladentür auf, und im nächsten Moment ertönte das Klingeln einer Glocke direkt über meinem Kopf. Sein Echo vibrierte in meinen Knochen, Eis dehnte sich in meinem Inneren aus, und beinahe wäre ich an Ort und Stelle festgefroren, wenn nicht meine Instinkte übernommen hätten.
Ich zog mich sofort zurück, die Tür fiel ins Schloss, die Glocke wurde leiser. Die Verkäuferin stürmte aus dem Hinterraum, hatte ihr freundlichstes Lächeln aufgesetzt, das sogleich von ihren Lippen schmolz, als sie das Café leer vorfand.
Meine Brust wurde eng, doch ich wartete nicht länger, sondern setzte meinen Weg mit zitternden Gliedern fort. Ich verfluchte mich dafür, was ich gerade getan hatte. Was hatte ich mir dabei gedacht? Was wäre passiert, wenn die Frau bemerkt hätte, dass die Tür von einem Geist geöffnet worden war?
Sonst liest du von weiteren Geistersichtungen in euren Zeitungen.
Ich verfluchte Nika, die alles gewesen war, nur nicht hilfreich.
Nachdem ich das Café hinter mir gelassen hatte, bog ich in eine lange, schmale Gasse, die mich endlich zurück auf die Kreuzung führen würde. Ich durfte mein Ziel nicht aus den Augen verlieren, und ich durfte mich nicht noch mal von meinen Gelüsten zu etwas hinreißen lassen, das mein Ziel gefährden würde. Das Relikt. Der Diebesplatz. Nur noch ein Tag.
Kaum hatte ich die dunkle Gasse zur Hälfte durchquert, ließ mich ein Geräusch zusammenfahren. Ich drehte mich um und erkannte eine Gestalt, die sich unauffällig im Schatten der Hauswände bewegte, direkt auf mich zu. Sofort begann mein Herz, donnernd gegen meine Rippen zu schlagen, heftiger noch als vorhin im Café.
War der Mann in der weißen Uniform zurück? Hatte er mich erneut aufgespürt? Wollte er beenden, was er angefangen hatte?
Ich wirbelte herum und erstarrte. Auch von der anderen Seite kam mir jemand entgegen. An der Statur konnte ich ausmachen, dass auch er mich um einige Köpfe überragte. Panik ließ meine Kehle eng werden. Ich steckte fest in diesem schwarzen Gang, und meine Optionen lösten sich in Luft auf, als plötzlich ein weiteres Geräusch die Gasse erfüllte.
Musik.
Ich sah nach oben und erblickte eine Leiter, die hoch zu einem Gebäude führte. Natürlich, das Théâtre Bellevue. Das hier musste eine Art Feuerleiter sein.
Eine lästige Stimme ertönte in meinen Gedanken, um mich daran zu erinnern, dass es noch immer früher Morgen war und das Theater somit noch gar nicht geöffnet sein sollte. Doch ich war bereits auf die Leiter gesprungen, die wie ein helles Licht in all meiner Dunkelheit leuchtete.
Adrenalin flutete meine Nervenbahnen, und ich erklomm Sprosse um Sprosse, obwohl meine Hände so sehr zitterten, dass sie mir kaum gehorchen wollten. Mein Blut rauschte mir so laut in den Ohren, dass ich permanent einen hohen Piepton hörte. Ich konnte unmöglich sagen, ob weitere Geräusche durch die Gasse schallten, Schritte oder Stimmen.
Aber ich sah nicht nach unten. Schaute nicht nach, ob die Männer bereits dazu übergegangen waren, auf mich zuzurennen wie ein Pack Hyänen, das leichte Beute witterte.
Ich stieg nur immer weiter nach oben, mein ganzer Körper bebte, bebte, bebte.
Und dann passierte es.
Weil ich meine Beine kaum noch spürte, rutschte mein Fuß ab, bevor ich eine weitere Sprosse zu greifen bekam. Ein gellender Schrei zerriss meine Kehle, als ich auch mit dem anderen Fuß den Halt verlor. Tränen der Angst stachen in meinen Augen, zogen brennende Spuren über meine Wangen, während ich meine starren Finger verzweifelt an die Leiter klammerte. Das würde ich nicht lange durchhalten. Ich war zu schwach. Zu erschöpft.
»Was treibst du da unten?«
Erschrocken hob ich den Kopf, meine Wimpern verklebt von nassen Tränen. Nur vage erkannte ich seine Gesichtszüge. Aber das silbrige Blond seiner Haare war unverkennbar, so, wie es sich vor dem dunklen Mauerwerk hinter ihm abhob.
In dem Moment, in dem ich Kaspar erkannte, fand mein rechter Fuß zurück auf die Sprosse. Ich wimmerte vor Erleichterung, zitterte am ganzen Leib.
»Ich habe mir eine Meisterdiebin irgendwie anders vorgestellt.« Kaspar sah zu mir runter, den Kopf in einer Mischung aus Neugier und Abscheu schief gelegt, so, als betrachtete er ein besonders hässliches Insekt.
Ich presste die Zähne aufeinander und beschloss, ihn zu ignorieren, solange mein Leben am seidenen Faden hing. Vielleicht verschwand er ja wieder, wenn ich ihm keine Aufmerksamkeit schenkte. Nur mit Mühe löste ich meine Finger, um weiter nach oben zu steigen. Kaspar trat einen Schritt zur Seite, damit ich zu ihm auf die überdachte Veranda des Theaters klettern konnte.
Oben angekommen, blieb ich auf dem Boden sitzen. Das Holz unter mir war morsch und dreckig, Moos spross zwischen den einzelnen Latten hervor. Erst jetzt bemerkte ich, wie still es geworden war. Da war keine Musik mehr. Nur meine schweren Atemzüge, die die nebelverhangene Luft erfüllten.
»Wir müssen hier weg.«
Meine Stimme hörte sich rau und kratzig an, und ich musste husten, während ich versuchte, auf die Füße zu kommen.
Kaspar blinzelte an mir vorbei nach unten, seine Miene hätte nicht gleichgültiger aussehen können.
»Sie können uns nicht sehen.«
»Doch!«
Mein Bein gab unter mir nach, und ich sackte erneut in mich zusammen. Eine feste Hand schloss sich um meinen Oberarm und zog mich hoch. Überfordert von dem Ruck, der durch mich hindurchschoss, krallte ich meine Finger in das Nächste, das ich zu greifen bekam. Kühler Stoff schmiegte sich an meine Finger, darunter brannte Wärme.
Kaspar keuchte und entriss mir seinen Arm. »Fass mich nicht an.«
Ich zog scharf die Luft ein, Hitze kroch in mir hoch, durchsetzt von Scham und Wut. »Du hast mich zuerst angefasst!«
In einer arroganten Geste hob er das Kinn. »Ich habe dir geholfen.«
»Und ich habe dich nicht darum gebeten, oder?«, konterte ich.
In Kaspars Augen glomm etwas auf, das mich einen Schritt zurückweichen ließ. Es war derselbe Ausdruck wie in jener Nacht, in der er das Messer über seinen Kopf gehoben hatte.
»Es sah erbärmlich aus, wie du immer wieder hingefallen bist.«
Ich funkelte ihn zornig an. »Wir müssen hier weg«, wiederholte ich, eindringlicher diesmal.
»Gut«, schloss ich dann, als er keine Anstalten machte zu reagieren, und schob mich an ihm vorbei, wobei ich einen kurzen Blick in die Gasse unten riskierte. Sie war leer. »Du kannst gerne hier stehen bleiben und sie ablenken, wenn sie zurückkommen. Ich verschwinde.«
»Warte.«
Kaspars Stimme war leise, und doch spürte ich die klirrende Kälte, die darin mitschwang und sich eisig auf meine Haut legte.
»Was?« Nun starrte ich doch in sein Gesicht mit den messerscharfen Kanten. »Darf ich auch nicht mit Euch sprechen, werter Prinz?«, fragte ich mit herausforderndem Spott. »Glaub mir, auch mir liegt nichts ferner, als mich in deiner Nähe aufzuhalten. Ich will schließlich nicht im Schlaf erdolcht –«
»Du darfst die Nacht bei mir bleiben.«
Empörung machte sich in mir breit und stieg heiß in meine Brust. Ich hoffte, dass sie sich nicht als rote Flecken auf meiner Haut bemerkbar machte. Dieser Mann – dieser Xathyr – hatte Alexei unsägliches Leid zugefügt. Allein schon dieselbe Luft zu atmen wie er, ließ es in meinen Eingeweiden brodeln.
»Hast du mir gerade nicht zugehört?«, keifte ich. »Danke für das durchaus großzügige Angebot, aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Gar. Nichts. Obwohl …« Ich neigte den Kopf. »Du darfst gerne den nächsten Messerangriff meiner Verfolger über dich ergehen lassen, was meinst du?«
Steile Falten gruben sich zwischen Kaspars silberblonde Augenbrauen, die er zusammenzog, während er mich wortlos anschaute.
Ich seufzte. »Was ist nun schon wieder?«
»Sie haben dich angegriffen?«
In dem Versuch, die schaurige Gänsehaut zu vertreiben, die bei der Erinnerung über meinen Rücken jagte, lachte ich auf. Es klang hohl und seltsam blechern.
»Ja, einer von ihnen hat es versucht. Aber ich kenne mich mit übergriffigen Männern aus, kein Grund zur Sorge.«
»Das dachte ich mir.« Kaspars Stimme klang beiläufig, doch sein Gesicht blieb weiterhin aufmerksam. »Du hast trotzdem Glück, dass du noch lebst.«
»Je nachdem, wie man leben definiert«, murmelte ich und verschränkte die Arme vor meinem Körper.
»Hör zu.« Kaspar blinzelte, und zurück war die kunstvolle Maske, die seine Emotionen verbarg. »Diese Leute sind keine gewöhnlichen Geistlichen. Sie sind von der Église des Saints
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: