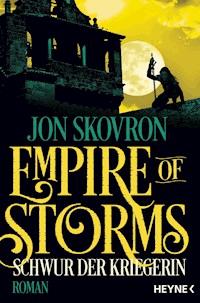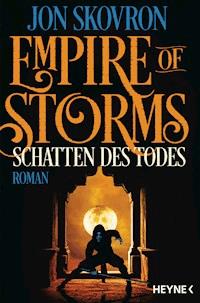11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Empire of Storms-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf von den Magiern des Kaisers angegriffen und dem Erdboden gleich gemacht wird. Sie allein überlebt und findet in einem Kloster nicht nur Unterschlupf, sondern wird dort auch von den Kriegermönchen in den Kampfkünsten unterwiesen. Red ist ein Straßenjunge, der in den finsteren und überfüllten Gassen New Lavens zum besten Taschendieb heranwächst, den das Imperium je gesehen hat. Jahre vergehen – doch als Hope und Red einander auf schicksalhafte Weise begegnen, schließen sie einen Pakt, der die Zeit der Ungerechtigkeit beenden wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Ähnliche
Jon Skovron
PAKT DER DIEBE
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michelle Gyo
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Eine Schwertkämpferin,
Ein Meisterdieb,
Ein magisches Imperium
Hope ist acht, als ihr Heimatdorf von den Magiern des Kaisers angegriffen wird. Sie ist die einzige Überlebende und findet Unterschlupf in einem Kloster des Vinchen-Ordens, wo sie von Großmeister Hurlo in den geheimen Künsten der Kriegermönche unterwiesen wird. Jahre später ist Hope nicht nur zu einer atemberaubenden Schönheit, sondern zu einer gefährlichen Waffe geworden – genauso tödlich wie Kummerklang, ihr magisches Schwert, das sie stets bei sich hat und das das Lied der toten Seelen singt. Als Hurlo ermordet wird, muss Hope fliehen. Im Herzen trägt sie den Wunsch nach Rache. Rache für den Mord an ihrer Familie, Rache für den Tod ihres geliebten Lehrers.
Red, der Junge mit den flinken Fingern und den roten Augen, ist acht Jahre, als er als Vollwaise auf der Straße landet – im schmutzigsten und gefährlichsten Viertel New Lavens. Einzig sein Traum hält ihn am Leben: Eines Tages will er der größte Dieb sein, den die Welt je gesehen hat. Doch als er Jahre später der schönen Vinchen-Kriegerin Hope begegnet, begreift er, dass es mehr gibt als den nächsten Beutezug: Gerechtigkeit. Ehre. Loyalität.
Die Schwertkämpferin und der Meisterdieb schließen einen Pakt: Er hilft ihr, Rache an den Biomaten des Kaisers zu nehmen und sie hilft ihm, seine Welt zu einem besseren Ort zu machen. Noch ahnen die beiden nicht, dass ihr Pakt, fatale Folgen hat …
Der Autor
Jon Skovron wurde in Columbus, Ohio, geboren. Er arbeitete unter anderem als Schauspieler, Musiker und Webdesigner, doch seine wahre Leidenschaft gehörte schon immer dem Schreiben. In seiner Heimat Amerika hat er sich mit verschiedenen Jugendbüchern und Kurzgeschichten bereits einen Namen gemacht, bevor er mit Empire of Storms – Der Pakt der Diebe seinen ersten Fantasy-Roman für Erwachsene veröffentlichte. Der Autor lebt in der Nähe von Washington D.C.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: HOPE & RED – THE EMPIRE OF STORMS Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 03/2017 Redaktion: Catherine Beck Copyright © 2016 by Jon Skovron Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München Karte © 2016 by Tim Paul Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von faestock/Shutterstock und John Gomez/Shutterstock Satz: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-19428-4V002www.heyne.de
Für meinen Vater, Rick Skovron, der mir meinen ersten Fantasy-Roman in die Hand gedrückt hat.Siehst du, was du angerichtet hast?
ERSTER TEIL
»Die, die alles verloren haben, sind frei,
jemand zu werden. Sie bezahlen einen hohen Preis,
aber so verhält es sich immer mit wahrer Größe.«
Aus dem Buch der Stürme
1
Kapitän Sin Toa bereiste diese Meere schon seit vielen Jahren als Händler, und so etwas hatte er bereits gesehen. Das machte es nicht einfacher.
Bleak Hope war eine kleine Gemeinde, die auf einer der kalten Südlichen Inseln am Rande des Imperiums lag. Öde Hoffnung, der Name des Dorfs, war irgendwie passend. Kapitän Toa war einer der wenigen Seeleute, die überhaupt so weit in den Süden segelten, und auch nur im Sommer. Während der Wintermonate, wenn sich eine dicke Eisschicht auf dem Wasser bildete, war das Dorf nahezu unerreichbar.
Doch der getrocknete Fisch, die Walfischbarten und das einfache Lampenöl, das die Bewohner Bleak Hopes aus dem Fischtran pressten, gaben eine gute Fracht ab, die Toa in Steingrat oder New Laven zu einem vorteilhaften Preis verkaufen konnte, und die Dorfbewohner waren auf die ihnen eigene wortkarge, südländische Art immer freundlich und zuvorkommend gewesen. Ihre Gemeinschaft hatte in dem rauen Klima seit Jahrhunderten überlebt, und das flößte Toa Respekt ein.
Traurig betrachtete er die Überreste des Dorfs. Während sie in den engen Hafen einliefen, suchte er die ausgetretenen Pfade und Steinhütten nach einem Lebenszeichen ab, doch er konnte keines entdecken.
»Was ist, Sir?«, fragte Crayton, sein Erster Offizier. Ein guter Kerl. Auf seine Art zuverlässig, wenn auch nicht ganz ehrlich, wenn es darum ging, seinen Teil der Arbeit zu erledigen.
»Hier gehen wir nicht an Land«, sagte Toa leise. »Dieser Ort ist tot.«
»Tot, Sir?«
»Hier ist keine Menschenseele mehr.«
»Vielleicht halten sie gerade irgendeinen religiösen Ritus ab«, sagte Crayton. »So weit im Süden haben die Leute ihre eigenen Sitten und Bräuche.«
»Ich fürchte, das ist es nicht.«
Mit einem dicken, vernarbten Finger deutete Toa auf den Kai. Eine mannshohe Tafel war dort ans Holz geschlagen worden. Das Schild zeigte ein schwarzes Oval mit acht schwarzen Linien, die nach unten liefen.
»Gott schütze sie«, flüsterte Crayton.
»Genau das hat er nicht getan«, sagte Toa. »Er hat sie nicht beschützt.«
Die beiden Männer starrten auf das Zeichen. Alles war still, bis auf den eisigen Wind, der an Toas langem Wollmantel und seinem Bart zerrte.
»Was sollen wir jetzt tun, Sir?«, fragte Crayton.
»Nicht an Land gehen, das ist mal sicher. Sag den Männern, sie sollen den Anker auswerfen. Es ist schon spät. Ich will nicht im Dunkeln durch das seichte Gewässer steuern, also bleiben wir über Nacht hier. Mit dem ersten Tageslicht stechen wir wieder in See. Wir werden nie mehr auch nur in die Nähe von Bleak Hope zurückkehren.«
Früh am nächsten Morgen setzten sie die Segel. Toa hoffte, innerhalb von drei Tagen die Insel Galemoor zu erreichen. Wenn alles gut ging, würden ihm die Mönche dort genug Bier verkaufen, damit er den Verlust, den er durch die Zerstörung Bleak Hopes erlitten hatte, wieder ausgleichen konnte.
Den blinden Passagier fanden sie in der zweiten Nacht.
Toa wurde durch ein Hämmern an seiner Kabinentür geweckt.
»Käpt’n«, rief Crayton. »Die Nachtwache … Sie haben … ein kleines Mädchen gefunden.«
Toa stöhnte. Er hatte zu viel Grog getrunken, und jetzt pochte ein unangenehmer Schmerz hinter seinen Augen.
»Ein Mädchen?«, fragte er nach einem Moment.
»J-j-ja, Sir.«
»Wasser der Hölle«, murmelte er, während er aus seiner Koje kletterte. Er zog seine kalte, feuchte Hose an, den Umhang und die Stiefel. Eine Frau an Bord, und sei es nur ein kleines Mädchen, brachte auf den südlichen Meeren Unglück. Das wusste jeder. Toa überlegte bereits, wie er seinen blinden Passagier wieder loswerden sollte. Doch als er die Tür öffnete, sah er mit Erstaunen, dass Crayton allein dastand und seine Wollmütze in den Händen knetete.
»Also? Wo ist das Mädchen?«
»Im Heck, Sir«, sagte Crayton.
»Warum bringst du sie nicht zu mir?«
»Wir … ähm, das heißt, die Männer bekommen sie nicht hinter der verstauten Takelage hervor.«
»Sie bekommen sie nicht …« Toa seufzte tief und fragte sich, warum keiner seiner Leute auf die Idee gekommen war, das Kind einfach zu packen und aus seinem Versteck herauszuzerren. Es sah seinen Männern gar nicht ähnlich, dass sie gleich weich wurden, nur weil sie ein kleines Mädchen vor sich hatten. Vielleicht lag es an Bleak Hope. Vielleicht hatte das schlimme Schicksal des Dorfs sie daran gemahnt, was ihnen selbst im Himmel bevorstehen würde.
»Gut«, sagte er. »Bring mich zu ihr.«
»Aye, Sir«, sagte Crayton, sichtlich erleichtert, dass nicht er den Unmut des Kapitäns zu spüren bekam.
Toa fand seine Mannschaft um den Frachtraum versammelt, wo die Ersatztakelage verstaut war. Die Luke stand offen, und die Männer starrten in die Dunkelheit, murmelten einander zu und schlugen das Zeichen, mit dem man böse Flüche abwehrte. Toa nahm einem von ihnen die Laterne aus der Hand und leuchtete in das Loch hinab, während er sich fragte, was an diesem kleinen Mädchen so besonders war, dass es seine Männer derart verunsicherte.
»Hör mal, Kleine, du machst jetzt besser …«
Sie hatte sich hinter dem Stapel schwerer Taue verkrochen, und abgesehen davon, dass sie schmutzig und halb verhungert war, sah sie für ein Mädchen von etwa acht Jahren halbwegs normal aus. Auf diese südländische Art war sie eigentlich sogar recht hübsch: blasse Haut, Sommersprossen und Haare von einem Blond, das beinahe weiß wirkte. Doch wenn sie einen direkt ansah, lag da etwas in ihrem Blick. Ihre Augen waren leer … schlimmer als leer: Es waren Abgründe aus Eis, die jede Wärme im Innern ihres Gegenübers vertrieben. Es waren uralte Augen. Gebrochene Augen. Augen, die zu viel gesehen hatten.
»Wir haben versucht, sie rauszuziehen, Käpt’n«, sagte einer der Männer. »Aber sie steckt fest. Und, also … sie ist …«
»Aye«, sagte Toa.
Er kniete sich neben die Luke und zwang sich, dem Mädchen in die Augen zu sehen, auch wenn er sich lieber abgewandt hätte.
»Wie heißt du, Kleine?«, fragte er, mittlerweile viel ruhiger.
Sie starrte ihn an.
»Ich bin der Kapitän dieses Schiffs«, sagte er. »Weißt du, was das bedeutet?«
Langsam nickte sie.
»Das bedeutet, dass jeder auf diesem Schiff mir gehorchen muss. Das heißt, auch du. Verstanden?«
Wieder nickte sie.
Er streckte seine gebräunte, haarige Hand in den Lagerraum.
»Also, Kleine. Ich will, dass du jetzt da rauskommst und meine Hand nimmst. Ich verspreche dir, dass dir auf diesem Schiff nichts passieren wird.«
Lange regte sich nichts. Dann streckte das Mädchen vorsichtig seine magere Hand aus und legte sie in Toas riesige Pranke.
Toa und das Mädchen gingen zurück ins Kapitänsquartier. Er vermutete, dass die Kleine eher anfangen würde zu reden, wenn nicht ein Dutzend hartgesottener Seebären sie anstarrten. In seiner Kabine angekommen, reichte er ihr eine Decke und einen Becher heißen Grog. Er wusste, dass man Kindern keinen Alkohol geben sollte, aber es war das einzige Getränk, das er außer frischem Wasser an Bord hatte, und Wasser war zu kostbar, um es zu verschwenden.
Er saß an seinem Schreibtisch und sie auf seiner Koje, die Decke fest um die Schultern gewickelt, den Becher dampfenden Grogs in den winzigen Händen. Sie nippte daran, und Toa erwartete schon, dass sie wegen des beißenden Geschmacks das Gesicht verziehen würde, doch sie trank in kleinen Schlucken und starrte ihn weiter mit diesen leeren, gebrochenen Augen an. Sie waren von einem kalten Blau, kälter, als er es je gesehen hatte, tiefer als die See selbst.
»Ich frage dich noch einmal, Mädchen«, sagte er. Sein Tonfall war immer noch sanft. »Wie ist dein Name?«
Sie schwieg.
»Woher kommst du?«
Immer noch keine Regung.
»Bist du …« Er konnte den Gedanken selbst kaum fassen, geschweige denn, dass er es laut aussprach. »Bist du aus Bleak Hope?«
Sie blinzelte, als würde sie aus einer Trance erwachen.
»Bleak Hope.« Nachdem sie so lange nicht gesprochen hatte, klang sie ganz heiser. »Ja. So ist es.« Ihr Tonfall jagte Toa einen Schauder über den Rücken, den er zu unterdrücken versuchte. Die Stimme des Mädchens war so leer wie ihre Augen.
»Wie bist du auf mein Schiff gekommen?«
»Das war danach«, sagte sie.
»Wonach?«, fragte er.
Als sie den Blick jetzt auf ihn richtete, waren ihre Augen mit einem Mal nicht mehr leer. Sie waren voller Seele. So voll, dass sich Toas salziges altes Herz in seiner Brust anfühlte wie ein verwitterter Lumpen, den jemand auswrang.
»Ich erzähle es dir«, sagte sie, und ihre Stimme war so schwer und seelenvoll wie ihre Augen. »Aber ich erzähle es nur dir. Und nur ein einziges Mal. Danach werde ich nie wieder darüber sprechen.«
Das Mädchen war draußen auf den Felsen gewesen. Deshalb hatten sie sie nicht gefunden.
Das Mädchen liebte die Felsen. Große, zerklüftete schwarze Felsbrocken, auf denen sie über die tosenden Wellen hinwegklettern konnte. Mama versetzte es in Angst und Schrecken, wenn sie dort über die Steine sprang. »Du wirst dir wieder wehtun!«, hatte die Mama immer gesagt. Und sie hatte sich wehgetan. Häufig. Ihre Schienbeine und Knie waren übersät mit Schorf und Narben von den scharfkantigen Steinen. Aber das war ihr egal. Das Mädchen liebte die Felsen trotzdem. Und bei Ebbe blieben immer Schätze am Grund zurück, halb vergraben im grauen Sand. Krebspanzer, Fischgräten, Muscheln und manchmal, wenn sie viel Glück hatte, auch kleine Stücke Seeglas. Das mochte sie am liebsten.
»Was ist das?«, hatte sie Mama eines Abends gefragt, als sie nach dem Essen am Feuer saßen, ihr Leib gewärmt und satt vom Fischeintopf. Sie hielt ein Stück rotes Seeglas ins Licht, sodass die Farbe über die Steinwand ihrer Hütte funkelte.
»Das ist Glas, meine kleine Möwe«, hatte Mama gesagt, deren flinke Finger gerade ein Fischernetz für Papa flickten. »Glasscherben, die von der See geschliffen werden.«
»Aber warum sind sie bunt?«
»Damit sie hübscher sind, nehme ich an.«
»Und warum haben wir kein buntes Glas?«
»Ach, das ist bloß der Schnickschnack der Nordländer«, hatte Mama gesagt. »So etwas brauchen wir hier unten nicht.«
Seither liebte das Mädchen das bunte Seeglas umso mehr. Sie sammelte die Stücke, bis sie genug beisammenhatte, um sie an einer Hanfschnur zu einer Halskette aufzufädeln, die sie Papa, einem schroffen, wortkargen Fischer, zu seinem Geburtstag schenkte. Er hielt die Kette in seiner ledrigen Hand und betrachtete misstrauisch die leuchtend roten, blauen und grünen Seeglasstücke. Dann sah er ihr in die Augen und erkannte, wie stolz sie auf das Geschenk war, wie sehr sie die Kette liebte. Sein wettergegerbtes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, als er sich die Kette vorsichtig um den Hals band. Die anderen Fischer zogen ihn wochenlang damit auf, doch er berührte das Seeglas bloß jedes Mal mit seinen schwieligen Fingern und lächelte.
An dem Tag, an dem sie kamen, war gerade Ebbe, und das Mädchen suchte am Fuß der Klippen nach neuen Schätzen. Sie hatte die Masten ihres Schiffs in der Ferne gesehen, war aber mit der Suche nach Seeglas viel zu beschäftigt gewesen, um sie weiter zu beachten. Erst als sie wieder auf die Felsen geklettert war, um ihre Sammlung aus Muscheln und Knochen zu begutachten, hatte sie bemerkt, wie seltsam das Schiff aussah. Ein großes, kastenförmiges Ding mit drei geblähten Segeln und Kanonenluken, die sich über die ganze Länge zogen. Ganz anders als die Handelsschiffe, die sonst nach Bleak Hope kamen. Dem Mädchen hatte der Anblick nicht gefallen. Und das, noch bevor sie die große Rauchwolke über ihrem Dorf erblickte.
Sie rannte, ihre dünnen, kurzen Beine wirbelten über den Sand und durch das hohe Gras, während sie sich ihren Weg zwischen den struppigen Bäumen hindurch zum Dorf bahnte. Wenn es brannte, würde Mama die Schätze, die unter ihrem Bett in einer hölzernen Truhe schlummerten, nicht retten – das war alles, woran das Mädchen denken konnte. Sie zu sammeln hatte sie zu viel Zeit und Mühe gekostet, um sie jetzt an die Flammen zu verlieren. Es waren ihre kostbarsten Besitztümer. Zumindest dachte sie das.
Als sich das Mädchen dem Dorf näherte, erkannte sie, dass das Feuer bereits das ganze Dorf erfasst hatte. Sie sah fremde Männer, gekleidet in weiß-goldene Uniformen mit Helmen und gepanzerten Brustplatten, und fragte sich, ob das wohl Soldaten waren. Aber Soldaten sollten Menschen beschützen. Diese hier trieben die Dorfbewohner mithilfe von Schwertern und Pistolen in der Mitte des Hauptplatzes zusammen. Als das Mädchen die Pistolen der Männer sah, blieb sie abrupt stehen. Sie hatte bisher nur eine einzige Pistole in ihrem Leben gesehen, und die gehörte Shamka, dem Dorfältesten. Jeden Winter, am letzten Tag des Jahres, feuerte er einmal in den Himmel, um den Mond aus seinem Schlaf zu wecken und die Sonne zurückzubringen. Die Pistolen der Soldaten sahen anders aus als die vom alten Shamka. Zusätzlich zu dem hölzernen Griff, dem eisernen Lauf und dem Abzug besaßen sie einen runden Zylinder.
Das Mädchen fragte sich noch, ob sie näher herangehen oder sich verstecken sollte, als der alte Shamka aus seiner Hütte trat, etwas rief und dann auf den Soldaten schoss, der ihm am nächsten stand. Das Gesicht des Soldaten stürzte regelrecht in sich zusammen, als die Kugel ihn traf, dann fiel der Mann nach hinten in den Schlamm. Einer der anderen Soldaten hob seine Pistole und feuerte auf den alten Shamka, verfehlte ihn jedoch. Shamka lachte triumphierend auf. Doch dann feuerte der Fremde ein zweites Mal, ohne die Waffe erst nachladen zu müssen. Shamkas Gesicht erstarrte. Dann fasste er sich an die Brust und kippte vornüber.
Fast hätte das Mädchen geschrien. Stattdessen biss es sich auf die Lippe, so fest es nur konnte, und duckte sich ins hohe Gras.
Stundenlang lag sie dort versteckt im kalten, matschigen Feld. Sie musste die Zähne fest zusammenbeißen, damit sie nicht klapperten. Sie hörte die Rufe der Soldaten. Ein merkwürdiges Hämmern und Klappern. Das Flehen der Dorfbewohner, die wissen wollten, was sie getan hatten, um den Imperator zu verärgern. Doch die einzige Antwort, die sie bekamen, war ein lautes Klatschen.
Als das Mädchen ihre tauben Gliedmaßen endlich in die Hocke hochzwang, um einen Blick zu wagen, war es dunkel und das Feuer längst erloschen.
Auf dem Dorfplatz stand ein großes braunes Zelt, fünfmal größer als jede Hütte. Die Soldaten standen mit Fackeln in den Händen im Kreis drumherum. Das Mädchen konnte keinen der Dorfbewohner entdecken. Vorsichtig kroch sie ein Stück näher.
Ein riesiger Mann, der statt der Uniform einen langen weißen Umhang mit Kapuze trug, stand im Eingang des Zelts. In seinen Händen hielt er eine Truhe. Einer der Soldaten zog die Plane des Zelteingangs beiseite, und der Mann im Umhang trat ein. Wenige Augenblicke später kam er ohne die Kiste wieder heraus. Der Soldat band die Plane fest, sodass das Zelt offen blieb, dann deckte er die Öffnung mit einem Netz ab, das so feinmaschig war, dass nicht einmal ein winziger Vogel hindurchgepasst hätte.
Der Mann im Umhang zog ein Notizbuch aus der Tasche und setzte sich an einen kleinen Tisch, den der Soldat für ihn hingestellt hatte. Dann reichte der Soldat ihm Feder und Tinte, und der Mann begann zu schreiben. Immer wieder mal hielt er inne, um durch das Netz ins Zelt zu sehen.
Aus dem Inneren drangen Schreie. In diesem Moment begriff das Mädchen, dass die Dorfbewohner in dem Zelt gefangen gehalten wurden. Sie hätte nicht sagen können, warum die anderen schrien, aber sie bekam solche Angst, dass sie sich wieder in den Schlamm fallen ließ und sich die Ohren zuhielt, um die Geräusche auszublenden. Die Schreie hielten nur ein paar Minuten an. Bis sich das Mädchen dazu durchringen konnte, wieder zum Dorfplatz hinüberzusehen, dauerte es deutlich länger.
Die Soldaten mit den Fackeln waren verschwunden. Nur eine Laterne erhellte den Zelteingang, und der Mann im Umhang saß noch da und schrieb in sein Notizbuch. Ab und zu blickte er hinüber in das Zelt, dann auf seine Taschenuhr, und dann runzelte er die Stirn. Das Mädchen fragte sich, wohin die Soldaten wohl gegangen waren, als sie bemerkte, dass das merkwürdige, kastenförmige Schiff hell erleuchtet im Hafen lag, und als sie die Ohren spitzte, konnte sie die rauflustigen Stimmen der Männer hören.
Durch das hohe Gras schlich das Mädchen auf die Seite des Zelts zu, die am weitesten von dem Mann im Umhang entfernt lag. Nicht dass er sie hätte sehen können. Er schien so vertieft in seine Notizen zu sein, dass sie an ihm hätte vorbeispazieren können, ohne dass er sie bemerkt hätte. Und doch hämmerte ihr Herz, als sie vorsichtig das freie Gelände vor der Zeltwand überquerte. Der Zeltboden war so tief in der Erde befestigt worden, dass sie mehrmals an den Pflöcken ziehen musste, bevor sie darunter hindurchschlüpfen konnte.
Im Inneren war es stockfinster und die Luft stickig und heiß. Die Dorfbewohner lagen mit geschlossenen Augen am Boden, aneinandergekettet und an die dicken Zeltstangen gefesselt. In der Mitte stand die hölzerne Truhe mit geöffnetem Deckel. Darin lagen tote Wespen, so groß wie Vögel.
Das Mädchen sah sich um. Weiter hinten in einer Ecke entdeckte sie Mama und Papa, die wie alle anderen reglos dalagen. Sie stürzte auf die beiden zu, während sich ihr Magen vor Angst zusammenkrampfte.
Als ihr Vater sich schwach bewegte, war sie unendlich erleichtert. Vielleicht konnte sie sie immer noch retten. Sanft berührte sie ihre Mutter, doch sie reagierte nicht. Sie schüttelte ihren Vater, aber der stöhnte nur, die Lider flatterten kurz, öffneten sich aber nicht.
Das Mädchen sah sich um, wollte versuchen, die Ketten zu lösen. Dann hörte sie plötzlich ein lautes Summen direkt neben ihrem Ohr. Sie wandte sich um. Über ihrer Schulter schwebte eine riesige Wespe. Da schoss eine Hand an ihrem Gesicht vorbei und schlug die Wespe weg, ehe sie zustechen konnte. Mit einem gebrochenen Flügel wirbelte das Tier herum und fiel zu Boden. Sie drehte sich um. Vor ihr stand Papa, das Gesicht vor Schmerzen verzerrt.
Er packte ihr Handgelenk. »Geh!«, brachte er heraus. »Weg.« Dann stieß er sie so fest von sich, dass sie umfiel.
Sie starrte ihren Vater an, verängstigt und zugleich mit dem Gefühl, ihm helfen zu müssen, damit dieser Schmerz aus seinem Gesicht verschwand. Um sie herum regten sich mittlerweile auch andere – die Gesichter qualvoll verzerrt, genau wie das von Papa.
Mit einem Mal machte die Seeglaskette um seinen Hals einen seltsamen Sprung. Das Mädchen sah genauer hin. Es passierte wieder. Papa krümmte sich. Er riss Augen und Mund auf, als wollte er schreien, brachte aber nur ein feuchtes Gurgeln hervor. Ein weißer Wurm, so dick wie ihr Finger, wand sich aus seinem Hals heraus, und Blut strömte aus zahlreichen Wunden, als sich weitere Würmer aus seiner Brust und seinem Bauch kämpften.
Jetzt wachte auch Mama auf und schnappte nach Luft, blickte wild um sich. Auch unter ihrer Haut bewegte sich etwas. Sie streckte die Hände aus und rief nach ihrer Tochter.
Um sie herum warfen sich die anderen Dorfbewohner in die Ketten, als die Würmer aus ihnen hervorbrachen. Bald schon war der Boden von einer weißen, sich windenden Masse bedeckt.
Am liebsten wäre das Mädchen davongerannt. Stattdessen hielt sie die Hand ihrer Mutter und sah zu, wie sie sich wand und krümmte, während die Würmer sie von innen auffraßen. Sie rührte sich nicht und sah auch nicht weg, bis ihre Mutter sich schließlich nicht mehr bewegte. Erst da kam sie auf die Füße, schlüpfte unter der Zeltwand hinaus ins Freie und rannte zurück ins hohe Gras.
Als der Morgen dämmerte, kauerte das Mädchen immer noch in seinem Versteck und beobachtete von Weitem, wie die Soldaten mit großen Leinensäcken zurückkehrten. Der Mann im Umhang verschwand für eine Weile im Zelt, kam wieder heraus und schrieb erneut in sein Notizbuch. So ging es noch zweimal, dann trug er einem der Soldaten etwas auf. Der nickte, gab den anderen ein Zeichen, und die Männer mit den Säcken gingen nacheinander in das Zelt. Als sie wieder herauskamen, wimmelte es in den Säcken. Das Mädchen nahm an, dass darin die Würmer waren. Sie trugen sie zurück zum Schiff, während die anderen das Zelt abbauten. Darunter kamen die Leichen der Dorfbewohner zum Vorschein.
Der Mann im Umhang sah zu, wie die Soldaten die Ketten von den Leichen lösten. Das Mädchen beobachtete ihn genau, während er dort stand, und seine Züge brannten sich in ihr Gedächtnis ein. Braunes Haar und ein spitzes, rattenhaftes Gesicht mit fliehendem Kinn, das von einer Brandnarbe auf der linken Wange gezeichnet war.
Und endlich – nachdem sie ein sonderbares Zeichen auf das Dorfschild gemalt hatten – segelten die Fremden in ihrem großen, kastenförmigen Schiff davon. Als sie nicht mehr zu sehen waren, wagte sich das Mädchen zurück ins Dorf. Es hatte sie Tage gekostet, vielleicht sogar Wochen. Doch am Ende hatte sie jeden von ihnen begraben.
Kapitän Sin Toa sah auf das Mädchen hinab. Während sie ihre Geschichte erzählt hatte, war ihr Gesicht zu einer Maske des Grauens verzerrt gewesen. Jetzt zeigte es wieder die kalte Leere, die er bemerkt hatte, als er sie aus dem Frachtraum hervorgelockt hatte.
»Wie lange ist das her?«, fragte er.
»Ich weiß nicht«, sagte sie.
»Wie bist du an Bord gekommen? Wir haben nicht angelegt.«
»Ich bin geschwommen.«
»War eine ganz schöne Strecke.«
»Ja.«
»Und was soll ich jetzt mit dir anfangen?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Auf einem Schiff ist kein Platz für ein kleines Mädchen.«
»Ich muss am Leben bleiben«, sagte sie. »Damit ich den Mann finden kann.«
»Weißt du, wer er war? Was das Zeichen zu bedeuten hat?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Das ist das Wappen der Biomanten des Imperators. An diesen Mann wirst du niemals herankommen.«
»Doch«, sagte das Mädchen leise. »Und wenn es mein ganzes Leben lang dauert. Eines Tages finde ich ihn. Und dann werde ich ihn töten.«
Kapitän Sin Toa war klar, dass er sie nicht an Bord behalten konnte. Frauen, selbst achtjährige Mädchen, zogen die Seeschlangen dieser Meere ebenso sicher an wie ein Eimer voll Blut – das wusste jeder. Seine Männer würden eine Meuterei anzetteln, wenn sie erfuhren, dass er darüber nachdachte, das Mädchen auf dem Schiff zu lassen. Doch er würde sie nicht einfach ins Meer werfen oder auf einem einsamen Felsen aussetzen. Als sie am darauffolgenden Tag in Galemoor einliefen, suchte er einen runzeligen alten Mönch namens Hurlo auf, den Anführer des Ordens der Vinchen.
»Dieses Mädchen musste Dinge mit ansehen, die niemand sehen sollte«, sagte er. Die beiden Männer standen im steinernen Hof des Klosters. Der hohe schwarze Steintempel ragte über ihnen auf. »Sie ist gebrochen. Vielleicht ist das Kloster die einzige Chance auf ein normales Leben, die ihr geblieben ist.«
Hurlo schob die Hände in die Ärmel seiner schwarzen Robe. »Ich fühle mit ihr, Kapitän. Das tue ich wirklich. Aber der Orden der Vinchen ist Männern vorbehalten.«
»Sie kommt aus einem kleinen Dorf und ist harte Arbeit gewöhnt«, entgegnete Toa. »Ihr könnt doch sicher eine Magd gebrauchen?«
Hurlo nickte. »Das schon. Aber was passiert, wenn sie älter wird und ihre Reize sich zeigen? Sie würde die Brüder in Versuchung führen, vor allem die jüngeren.«
»Dann behaltet sie wenigstens, bis sie herangereift ist. So hättet ihr sie immerhin für ein paar Jahre beherbergt. Bis sie alt genug ist, um ihrer eigenen Wege zu gehen.«
Hurlo schloss die Augen. »Das Leben im Kloster wird für sie nicht leicht werden.«
»Ich glaube, sie wüsste sowieso nicht, was sie mit einem leichten Leben anfangen sollte.«
Hurlo sah Toa an, und zu Toas Überraschung lächelte er. Seine alten Augen funkelten. »Wir werden das gebrochene Kind aufnehmen, das du gefunden hast. Ein bisschen Aufruhr in der alten Ordnung bringt Veränderung. Vielleicht zum Besseren.«
Toa zuckte mit den Schultern. Er hatte weder Hurlo noch den Orden der Vinchen je ganz verstanden. »Wenn du es sagst, Großlehrer.«
»Wie lautet der Name des Kindes?«, fragte Hurlo.
»Sie hat ihn mir nicht gesagt. Ich glaube fast, sie erinnert sich nicht mehr an ihn.«
»Wie sollen wir sie dann nennen, dieses Kind, das aus Albträumen geboren wurde? Da wir uns ihrer angenommen haben, liegt es nun wohl an uns, ihr einen Namen zu geben.«
Kapitän Sin Toa zupfte an seinem Bart, während er darüber nachdachte. »Vielleicht nennen wir sie nach dem Dorf, das sie überlebt hat. So bleibt wenigstens etwas davon im Gedächtnis zurück. Taufen wir sie Bleak Hope.«
2
In dieser Nacht war Sadie betrunken. Viel zu betrunken, um es noch zurück in ihr Bett zu schaffen. Doch dort, wo sie war, konnte sie nicht bleiben.
»Wir schließen jetzt, Sadie«, sagte Hosenträger-Madge.
Sadie sah zu ihr auf und blinzelte ein paarmal, damit sie Madge nicht doppelt sah. Hosenträger-Madge war die Rausschmeißerin in der Ersoffenen Ratte, und mit ihren eins neunzig war sie so groß, dass sie Hosenträger brauchte, um ihre Röcke oben zu halten. Madge war eine der gefürchtetsten Personen im Armenviertel von New Laven. Und eine der am meisten respektierten. Jede Dumpfnase in der Paradieskehre, auf dem Silberrücken und in Hammerhusen wusste, dass Hosenträger-Madge in ihrer Taverne alles im Griff hatte. Wer dumm genug war, Ärger zu machen, dem biss Madge höchstpersönlich das Ohr ab und verbannte ihn für immer aus der Ersoffenen Ratte. Mit dieser Schande war man dann für den Rest seines Lebens gekennzeichnet. Ihre Ohrensammlung bewahrte Madge in Einmachgläsern hinter der Theke auf.
»Sadie«, sagte Madge noch einmal. »Zeit zu gehen.«
Sadie nickte und kam auf die Füße.
»Hast du eine Bleibe für heute Nacht?«, fragte Madge.
Sadie schlurfte über den mit Sägemehl bestreuten Fußboden und winkte ab. »Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
Madge zuckte mit den Schultern und begann, die Stühle auf die Tische zu stellen.
Sadie stolperte aus der Ersoffenen Ratte und sah sich um. Vielleicht traf sie jemanden, den sie kannte und der sie für die Nacht aufnehmen würde. Sie versuchte, im flackernden Dämmerlicht der Laternen etwas zu erkennen, doch die Straße lag praktisch verwaist da. Entweder war die Wache gerade erst hier durchpatrouilliert oder sie würde bald kommen.
»Verpisste Hölle«, fluchte Sadie, während sie sich das schmutzige, verfilzte Haar kratzte.
Sie stolperte die Straße entlang, bis sie das schlichte Holzschild über dem Gasthaus Des Seemanns Mutter sah, einem berüchtigten Anheuerhaus. Doch sie war Sadie die Ziege – die beste Diebin, Söldnerin und Unruhestifterin, die es je gegeben hatte. Das wusste jede Dumpfnase in der ganzen Paradieskehre, auf dem Silberrücken und in Hammerhusen. Niemand wäre so dumm, sie südholen zu wollen.
Schwankend bahnte sich Sadie ihren Weg in das Gasthaus, um ein Zimmer für die Nacht zu verlangen. Der Wirt, ein dünner Typ mit Hängewangen namens Backus, musterte sie interessiert.
»Keine krummen Sachen«, sagte sie und bohrte ihm den Finger so hart in die Stirn, dass ein Abdruck zurückblieb.
»Natürlich nicht.« Backus lächelte ein schiefes, hängewangiges Lächeln. »Ich kümmere mich höchstpersönlich um dich. Wollen ja keine … Missverständnisse, nicht wahr?«
»Sonnig«, sagte Sadie. »Geh vor, Wirt.«
Backus führte sie die windschiefe Holztreppe hoch und einen schäbigen Flur entlang. Durch die geschlossenen Türen, die von dem Korridor abzweigten, drangen Lachen, Schluchzen und der Klang einer Geige, die irgendein Bastard zu dieser gottvermaledeiten Uhrzeit spielte. Backus schloss die Tür links am Ende des Gangs auf, und Sadie schob sich an ihm vorbei auf eine schmutzige Matratze zu, die auf dem Boden lag.
»Darf ich dir noch einen Schlummertrunk bringen?«, fragte Backus.
»Das wäre wirklich sehr sonnig, Wirt«, antwortete Sadie. »Vielleicht hab ich dich ja falsch eingeschätzt.«
»Ich wette, das hast du«, sagte Backus und lächelte wieder.
Ohne ihre Röcke, Stiefel und Messer abzulegen, ließ Sadie sich auf die Matratze fallen. Eine Weile lang sah sie zu, wie sich die Zimmerdecke über ihr unangenehm drehte, dann kam Backus mit einem gekühlten Becher zurück, in dem irgendetwas Nettes schwappte.
Wäre Sadie nicht so betrunken gewesen, hätte sie die Spuren der schwarzen Rose in dem Getränk gerochen, bevor sie auch nur daran genippt hatte. Doch so leerte sie den Becher mit einem einzigen großen Schluck, und wenige Minuten später wurde es schwarz um sie.
Als Sadie aufwachte, lag sie nicht mehr auf der Matratze in Des Seemanns Mutter, sondern mit dem Gesicht nach unten auf schwankenden Holzplanken. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass unter ihr ein Schiffsbauch hin und her schaukelte. Sadie hob den Kopf. Ein schmaler Sonnenstrahl fiel durch ein rundes Bullauge herein und erhellte den Raum um sie herum so weit, dass sie erkennen konnte, dass sie sich in einem Frachtraum befand.
»Verpisste Hölle!« Sadie rappelte sich auf, aber ihre Hände und Füße waren mit einem schmierigen Seil gefesselt, sodass sie sich nur aufsetzen konnte. Sie versuchte, die Handfesseln zu lösen, bekam jedoch das Seil nicht zu fassen. Außerdem war der Seemannsknoten so verwirrend und kompliziert, dass sie nicht wusste, wo sie überhaupt anfangen sollte.
Als sie sich zurücklehnte, hörte sie ein leises Grunzen. Sie drehte sich um und entdeckte einen kleinen Jungen, der ebenfalls gefesselt war, zerlumpt und schmutzig. Wahrscheinlich ein Straßenkind, das genauso aufgelesen worden war wie sie.
»He, Bürschchen.« Sie knuffte ihn mit ihrem knochigen Ellbogen fest in die Rippen. »Wach auf.«
»Hau ab, Filler«, murmelte der Junge. »Ich hab nichts für dich.«
»Dumm«, sagte sie und stieß ihn erneut an. »Wir sind verpisst noch mal südgeholt worden.«
»Was?« Der Junge riss die Augen auf. Seine Iriden waren tiefrot wie Rubine. Ein sicherer Hinweis darauf, dass seine Mutter während der Schwangerschaft süchtig nach Purpurwurz gewesen war. Scheußliches Rauschmittel, das einem langsam das Hirn aus dem Kopf fraß. Die meisten Kinder, die purpursüchtig zur Welt kamen, schafften nicht einmal den ersten Monat. Sadie argwöhnte, dass ein enormer Lebensmut in diesem Jungen steckte, wenn er das überstanden hatte. Irgendwo tief in ihm drin. Denn so sicher wie Pisse konnte man ihm den im Moment wirklich nicht ansehen. Er plärrte und jaulte wie ein geprügelter Welpe, und Tränen kullerten unter dem zottigen braunen Pony aus seinen roten Augen, während er heulte: »W-w-w-wo bin ich? W-w-w-was ist passiert?«
»Ich hab’s dir doch gerade gesagt, oder nicht?«, blaffte Sadie ihn an. »Wir sind südgeholt worden.«
»W-w-w-was heißt das?«
»Bist du echt so eine Dumpfnase?«, fragte Sadie. »Noch nie was davon gehört? Wie konntest du auf der Straße leben und so was nicht wissen?«
Die Unterlippe des Jungen zitterte, als würde er gleich wieder aufheulen. Doch dann überraschte er sie, indem er tief Luft holte. »Ich bin erst seit einem Monat auf der Straße. Ich weiß nicht viel. Also, bitte, Lady. Bitte sagt mir, was hier los ist.«
Er sah ihr direkt ins Gesicht. Vielleicht war es ein erstes Anzeichen dafür, dass sie allmählich weich wurde, dachte Sadie, aber statt aufzulachen oder auszuspucken, seufzte sie nur. »Wie heißt du, Kind?«
»Rixidenteron.«
»Verpisste Hölle, das ist mal ein Zungenbrecher!«
»Meine Mutter war Malerin. Sie hat mich nach dem großen romantischen Maler Rixidenteron dem Dritten benannt.«
»Ist sie tot, deine Ma?«
»Ja.«
Sie schwiegen einen Moment lang, nur unterbrochen vom Schniefen des Jungen, dem Knarren des Schiffs und dem sanften Zischen, sobald der Bug wieder durchs Wasser schnitt. Sie mussten gut Fahrt aufgenommen haben.
Schließlich sagte Sadie: »Also, Rixidingsbumms, es sieht so aus: Wir wurden auf ein Schiff gebracht, das zu den Südlichen Inseln fährt. Zwangsrekrutiert. Sie lassen uns eine Weile hier sitzen, dann kommen sie zu uns runter. Vielleicht lassen sie uns ein bisschen bluten, damit wir kapieren, dass sie es ernst meinen. Und stellen uns vor die Wahl: der Mannschaft beitreten oder als blinder Passagier über Bord geworfen werden.«
Die Augen des Jungen waren immer größer geworden, bis sie aussahen wie große rot-weiße Teller. »Aber …« Seine Lippe zitterte wieder. »Aber ich kann nicht schwimmen. Ich würde ertrinken!«
»Das ist ja der verpisste Sinn der Sache, wenn man über Bord geworfen wird. Und selbst wenn du schwimmen könntest, sind wir inzwischen sicher so weit weg von der Küste, dass du es nie im Leben schaffen würdest. Von den Haien und Seehunden will ich gar nicht erst anfangen.«
»I-i-i-ich will nicht auf die Südlichen Inseln«, jammerte er. »Man sagt, dass da überall Monster sind und dass es kein Essen und kein Licht gibt, und niemand kommt jemals zurück … dass du gar nicht zurückkommen kannst, denn wenn du erst mal da bist, dann bist du dort gefangen, für immer!« Seine Stimme brach, als er von Schluchzern geschüttelt wurde.
Sadie hatte die Schnauze voll von seinem Gewinsel. Sie dachte darüber nach, ihm einen hübschen Tritt vor den Kopf zu verpassen. Das würde ihn fürs Erste ruhigstellen. Überhaupt bezweifelte sie, dass er ihr eine große Hilfe sein würde, wenn ihr die Flucht gelänge. Er war ja nicht einmal ein anständiges Straßenkind. Er war ein Künstlerfratz – wahrscheinlich hatte er an der Titte seiner Ma gehangen, bis er fünf gewesen war. Wie er einen Monat auf der Straße hatte überleben können, war ihr schleierhaft.
Aber er hatte überlebt. Und so richtig abgemagert sah er auch nicht aus. Irgendetwas musste er also können. Sie musste nur herausfinden, was das sein mochte.
Die Schluchzer des Jungen waren zu leisem Schniefen geworden. Um dem lästigen Geräusch endlich Einhalt zu gebieten, sagte sie: »Erzähl mal, Rixidingsbumms. Wie war deine Ma so? Und was ist mit ihr passiert?«
Er schniefte ein letztes Mal, dann wischte er sich die roten, verheulten Augen mit dem Ärmel. »Willst du das wirklich wissen?«
»Klar will ich das«, sagte Sadie, lehnte sich gegen einen Kartoffelsack und versuchte, es sich so gemütlich wie möglich zu machen – soweit das mit gefesselten Handgelenken und Füßen eben ging. Schließlich konnte es noch Stunden dauern, bis jemand in den Frachtraum kam und sie einen Fluchtversuch unternehmen konnte. Die trostlose Geschichte des kleinen Rotzbengels war immer noch besser als gar keine Unterhaltung.
»In Ordnung.« Er wurde ernst. »Aber du musst versprechen, dass du es niemandem erzählst.«
»Ich schwöre bei meines Vaters purpurnem Schwanz«, sagte Sadie.
Rixidenterons Mutter, Gulia Pastinas, entstammte einer wohlhabenden Familie, die im Norden von New Laven lebte, weit weg vom Schmutz und der Gewalt in der Paradieskehre, dem Silberrücken und Hammerhusen. Gulia war die zweite Tochter gewesen und sehr hübsch, aber so stur und mit einem Willen zur Unabhängigkeit ausgestattet, dass ihr Vater es schließlich aufgab, sie verheiraten zu wollen. In reichen Familien war es nicht wohlangesehen, wenn Frauen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgten, sodass er sie weiterhin würde aushalten müssen.
Als Gulia ihrem Vater eines Tages erzählte, dass sie sich einer Künstlertruppe unten im Silberrücken anschließen wollte, war er begeistert. Damals war es in Mode, dass sich Kinder reicher Familien eine Weile in der Bohème herumtrieben. Mehr erwartete er nicht: eine nette kleine Pause von seiner anstrengenden jüngsten Tochter.
Es stellte sich jedoch heraus, dass sie eine ungeheuer begabte Malerin war – und dass sie nicht binnen eines Jahres mit eingeklemmtem Schwanz nach Hause zurückkehren würde. Sie würde überhaupt nicht mehr nach Hause kommen. Zunächst weil sie viel zu beschäftigt damit war, sich von der Künstlergesellschaft in New Laven feiern zu lassen. Später dann, weil sie zu krank geworden war, um zu ihrem Vater zurückzukehren. Nicht dass sie wieder nach Hause gewollt hätte, selbst wenn sie gekonnt hätte.
Rixidenterons Vater war eine Hure. Er kam aus einer alteingesessenen Familie von Huren, männlichen wie weiblichen, und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass sein Beruf jemals Probleme machen würde, bis er auf einer Feier einer wunderschönen, dunkeläugigen Künstlerin begegnete, die zehn Minuten lang mit ihm geplaudert und dann verkündet hatte, dass sie ihn von seinem elenden Leben befreien würde. Sie war aufgedreht, weil sie gerade erst eine Reihe von Gemälden verkauft hatte, und aufgeputscht vom Purpurwurz. In jener Nacht hatte sie ihn mit zu sich nach Hause genommen und darauf bestanden, dass er sein Leben im Gewerbe aufgab. Rixidenterons Vater hatte sein sanftes, warmes Lächeln gelächelt und genickt. Er war so vernarrt in ihren Charme und ihre feurige Leidenschaft, dass er alles getan hätte, worum sie ihn bat.
Und so malte sie, während er kochte und sauber machte, und eine Zeit lang waren sie glücklich. Als Rixidenteron geboren wurde, änderte sich alles, so wie immer, wenn Menschen Eltern werden. Ihr Sohn kam mit den verräterischen roten Augen des Kindes einer Purpursüchtigen auf die Welt, und ihre Freunde prophezeiten, der Kleine werde nicht einmal die erste Woche überstehen. Doch hatte er wohl eine verborgene Stärke in sich. Vielleicht lag es auch daran, dass seine Eltern sich aufopfernd um ihn kümmerten und alles dafür taten, um ihn am Leben zu halten. Sie aßen nichts, damit sie sich die Medizin leisten konnten, die Gulias Schwester aus der Apotheke im Reichenviertel vorbeibrachte. Schon bald hatten sie so wenig Geld, dass Rixidenterons Vater anbot, wieder anschaffen zu gehen. Gulia lehnte ab und malte stattdessen so viel und so verbissen, dass ihre Hände in einem fort voller Farbe waren. Jahre später nannten die Kritiker das ihre erlesenste Phase.
Rixidenteron überlebte – allen Widrigkeiten zum Trotz. Und an seinem ersten Geburtstag dachten seine Eltern, sie hätten das Schlimmste überstanden. Aber die Farben, die Gulia zum Malen benutzte, enthielten das Gift einer Qualle. In kleinen Mengen war es ungefährlich, aber die Substanz war über die Jahre in Gulias Haut gesickert und begann nun, ihre Nerven anzugreifen. Durch ihre Krankheit und die jahrelange Purpursucht fiel es Gulia immer schwerer zu arbeiten. Als Rixidenteron zwei Jahre alt wurde, konnte sie den Pinsel nicht mehr halten, ohne zu zittern. Wieder bot sein Vater an, zu arbeiten. Wieder lehnte Gulia ab. Stattdessen brachte sie Rixidenteron bei, für sie zu malen. Sie zwang ihn, Lederhandschuhe zu tragen, damit ihn nicht das gleiche Schicksal ereilte wie sie, und dann ließ sie ihn malen. Rixidenteron liebte die Stunden, die sie so miteinander verbrachten, und er war stolz darauf, dass er seiner Mutter, der berühmten Malerin, bei ihrem Schaffen helfen durfte. Im Alter von vier Jahren konnte er jedes Bild, das ihm beschrieben wurde, mit atemberaubender Detailtreue erschaffen. Rixidenteron malte und malte, während seine Mutter auf dem schäbigen blauen Sofa in ihrer Wohnung lag, sich mit zitternden Händen die Augen zuhielt und ihm flüsternd von den Bildern in ihrem Kopf erzählte. Und er verlieh ihnen Gestalt.
Doch je mehr Zeit verstrich, desto schwerer wurde es. Statt sie vom Purpurwurz abzubringen, trieben Rixidenterons schwächliche Konstitution und die Folgen ihrer eigenen Abhängigkeit Gulia umso tiefer in die Sucht. Als Rixidenteron sechs wurde, waren ihre anfangs so detaillierten Beschreibungen nur noch unverständliches Gemurmel, sodass er die meisten Bilder selbst erfinden musste. Aber während er ihr Geschick geerbt hatte, fehlte ihm noch ihre Vorstellungskraft. Und das sah man den Gemälden an. Die Leute behaupteten, die große Gulia Pastinas sei am Ende.
Dieses Mal fragte sein Vater nicht. Er ging einfach wieder arbeiten. Obwohl er inzwischen älter und vom Leben gezeichnet war, sah er immer noch gut aus und verdiente genug Geld, um sich als anonymer Käufer die Gemälde seiner großen Liebe leisten zu können. Und so dachte Gulia, sie würde ihre Familie nach wie vor ernähren. Rixidenteron kannte die Wahrheit, doch als er schließlich den Mut aufbrachte, es ihr zu sagen, war sie bereits zu krank, um seine Worte zu verstehen. Zumindest hatte er das damals gedacht. Inzwischen war er nicht mehr so sicher, denn in derselben Nacht, in der er ihr erzählt hatte, dass sein Vater wieder auf den Strich ging, nahm Gulia eine Überdosis Purpurwurz und starb.
Rixidenteron und sein Vater lebten eine Weile weiter wie zuvor, doch am Ende des darauffolgenden Jahres war sein Vater dünn und blass geworden. Rixidenteron wusste nicht, ob eine Krankheit dahintersteckte oder die Trauer um seine Frau. Was es auch war, seinem Vater lag nichts mehr am Leben.
Eine Woche vor seinem achten Geburtstag fand Rixidenteron seinen Vater tot im Bett. Er wusch ihm Scheiße und Blut vom Körper, verbrannte die Bettlaken und ging.
»Aber wie hast du allein auf der Straße gelebt?«, fragte Sadie. »Wie in aller Höllen Namen hast du überlebt, wo du doch so offensichtlich von nichts eine Ahnung hast?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich hab ein paar Jungs getroffen, und denen durfte ich mich anschließen. Weil ich gut Dinge nehmen kann …«
»Was meinst du damit: Du kannst gut Dinge nehmen?«
»Meine Hände sind schneller als die von anderen. Vielleicht wegen der Malerei. Keine Ahnung. Aber Geldbörsen, Uhren – mir all das einfach zu nehmen, fällt mir leicht. Und die Leute merken es nie.«
Sadies Augen glänzten. »Das ist eine seltene und nützliche Gabe, Rixidingsbumms.« Sie sah auf den komplizierten Knoten hinab, der ihre Hände aneinanderfesselte. »Ich nehme nicht an, dass deine Hände auch das hier aufbekommen?«
»Möglicherweise schon«, sagte er.
»Obwohl deine Hände auch gefesselt sind?«
»Ich kann es ja mal versuchen.«
»Wieso nicht«, sagte sie.
Die Sonne war bereits wieder untergegangen, und schwaches Mondlicht fiel durch das Bullauge, als endlich ein Matrose herunterkam, um nach ihnen zu sehen. Sie hörten ihn, bevor sie ihn sahen; seine Stiefel stampften laut über die steilen Holzstufen, während er vor sich hinmurmelte. »Mädchen und Kinder als Mannschaft. Was für eine miese Reise das wird.«
Er war schon älter, trug einen Wollpullover, der über dem Bauch spannte, und humpelte ein wenig. In seine fettigen schwarzen Haare und den Bart mischte sich nicht wenig Weiß. Sadie und der Junge kauerten nebeneinander auf dem Boden, das Seil gut sichtbar um ihre Hände gewunden. Sadie zwang sich, so stumpfsinnig wie möglich auszusehen, als der Seemann sie mit kleinen Augen anblickte, denen man den häufigen Alkoholgenuss ansah.
»Hört mal, ihr zwei«, sagte er. »Ihr wurdet verhökert, um hier auf der Sturmbraut mit anzupacken. Wenn ihr tut, was der Kapitän und ich euch sagen, dann dürft ihr gehen, wohin ihr wollt, sobald wir wieder in New Laven anlegen. Vielleicht bezahlen wir euch sogar. Wenn ihr unsere Anweisungen nicht befolgt, werdet ihr ausgepeitscht. Ungefähr so.« Er schlug Sadie hart ins Gesicht, sodass ihre Lippe aufsprang. »Nur noch viel schlimmer. Haben wir uns verstanden?«
Sadie lächelte, das Blut lief aus ihrem Mund. »Weißt du, warum sie mich Sadie die Ziege nennen?«, fragte sie.
Er beugte sich zu ihr hinunter, sein Atem stank nach Grog. »Wegen deinem hässlichen Bart?«
Sie rammte ihm die Stirn ins Gesicht. Während der Seemann sie anstarrte und Blut aus seiner Nase strömte, schüttelte Sadie das Seil ab, das nur lose um ihre Handgelenke gelegen hatte, zog den Dolch, den sie immer im Stiefel versteckte, und rammte dem Mann die Klinge in die weiche Haut unter dem Kinn. Langsam drehte sie den Dolch herum, der Seemann krümmte sich und sein Blut spritzte ihr ins Gesicht. Dann riss sie die Schneide nach unten, und der Schnitt öffnete seinen Hals bis zum Schlüsselbein. Ungerührt ließ Sadie den zitternden Körper zu Boden fallen.
Mit dem Ärmel wischte sie sich über das Gesicht, bückte sich und nahm das Schwert des Seemanns an sich.
»Hier.« Sie gab dem Jungen ihren Dolch. »Da oben sind noch mehr von denen. Wahrscheinlich werden wir sie alle töten müssen.«
Der Junge starrte auf die blutverschmierte Waffe in seiner Hand.
»Red«, sagte sie. Als er nicht antwortete, gab sie ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.«
Er blinzelte sie dümmlich an.
»Red. Das ist von jetzt an dein Name. Du bist mein Handlanger. Kapiert?«
Er riss die Augen auf und nickte.
»Jetzt gehen wir hoch und erklären diesen Anglern, dass wir es gar nicht mögen, südgeholt zu werden.«
An Deck war es dunkel, nur eine schmale Mondsichel war zu sehen. Der Seemann, der oben Wache stand, war so überrascht, sie zu sehen, dass sie ihm das Schwert ins Auge rammen konnte, ehe er auch nur einen Mucks herausbrachte. Zuckend fiel er zu Boden, und es dauerte einen Moment, bis sie die Klinge wieder aus seinem Schädel herausbekam. Die meisten Matrosen waren betrunken oder schliefen – oder beides. Sadie kümmerte das nicht. Sie hatten es nicht anders verdient. Sie war keine geübte Schwertkämpferin, also hackte und schlitzte sie sich ihren Weg quer über das Deck. Als sie das Quartier des Kapitäns erreicht hatten, war sie außer Atem, ihr Arm tat weh, und sie war mit dem Blut von sechs Männern besudelt. Die Kabinentür war abgeschlossen, also pochte sie mit dem Knauf ihres Schwerts gegen das Holz. »Komm raus, du fischbäuchiger Scheißehaufen!«
»Sadie!« Reds Stimme war schrill.
Sie drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie ein Mann mit einem breitkrempigen Hut aus ein paar Metern Entfernung mit einer Pistole auf sie zielte. Doch statt zu feuern, ließ er die Waffe auf den Boden fallen und umfasste mit der Hand den Messergriff, der aus seiner Brust ragte.
Reds Hand war leer. Er grinste ein wenig verlegen, und seine roten Augen leuchteten im Mondlicht. »Eigentlich wollte ich die Waffe treffen.«
Mit einem breiten Grinsen klopfte Sadie ihm auf den Rücken. »Gut gemacht, Red. Ich hab’s doch gewusst, dass in dir Künstlermemme eine Menge Mut steckt. Na dann, lass uns den Kahn mal wenden. Da gibt’s noch einen von diesen Anglern in New Laven, dem wir schön langsam und deutlich erklären müssen, warum man Sadie die Ziege besser nicht südholen sollte.«
Das Schiff zurück in die Unterstadt von New Laven zu steuern, war nicht ganz leicht. Weder Sadie noch Red wussten, was sie genau zu tun hatten. Doch sie hatten Glück – der Wind spielte mit, und endlich erreichten sie das Hafenbecken. Sie wären wohl in den Kai hineingekracht, hätte Sadie nicht ein paar Kerle im Hafen gekannt, die ihnen halfen, das Schiff zu navigieren, ohne dabei sich selbst oder andere zum Kentern zu bringen.
Sadie grunzte den Seemännern ein paar knappe Dankesworte zu, als sie die Sturmbraut verließ, dann stiefelte sie über den Kai, das blutverkrustete Schwert in der Hand. Red huschte hinter ihr her, neugierig darauf, wie seine neue Heldin Rache nehmen würde.
Es war zu früh am Tag, als dass Backus schon seine Schicht in Des Seemanns Mutter angetreten hätte. Also hielt Sadie schnurstracks auf die Ersoffene Ratte zu. Sie riss die Tavernentür weit auf.
»Backus! Du verschlagener Arschwurm!«
Backus blickte mit seinem schmalen, hängewangigen Gesicht von seinem Becher Bier auf. Schlagartig verstummten die Gäste der Ersoffenen Ratte, und ihre Blicke huschten zwischen ihm und Sadie hin und her.
»Wenn das mal nicht Sadie die Ziege ist.« Die Ruhe in seiner Stimme klang gekünstelt. »Ich hab nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Bist sogar für Seemänner zu hässlich, was?«
»Ich mach dich gleich noch viel hässlicher, als ich sie zurückgelassen habe.« Sadie hob ihr Schwert und machte angriffslustig einen Schritt auf ihn zu.
Zuerst sah Backus ihr ungläubig entgegen. Dass man in der Ersoffenen Ratte keinen Ärger anfing, war bekannt. Doch als sie näher kam, verzerrte sich seine Miene vor Angst.
Wie aus dem Nichts tauchte Hosenträger-Madge auf, packte Sadie am Schwertarm und riss sie mit gefletschten Zähnen von den Füßen. Hart knallte sie Sadies Hand auf den nächsten Tisch, Bierkrüge flogen in alle Richtungen, und Sadie musste das Schwert loslassen.
»Du solltest es besser wissen, als hier Ärger anzufangen, Sadie.« Ihre Stimme war ein heiseres Grollen.
»Er sollte es besser wissen!«, entgegnete Sadie und versuchte, ihre Hand aus Magdes eisernem Griff zu befreien. »Jede Dumpfnase hier soll wissen, dass man Sadie die Ziege nicht südholt!«
»Schon verstanden«, sagte Madge. »Aber hier weiß auch jeder, sogar du, dass in meiner Taverne keiner umgebracht wird. Und jetzt scher dich zur Hölle noch mal raus hier!«
Hosenträger-Madge mochte Sadie, das war allgemein bekannt. Sie hatte ihr die Möglichkeit gegeben zu gehen. Sadie hätte Madges Angebot einfach annehmen können, und damit wäre die Sache erledigt gewesen. Doch das tat sie nicht.
»Nicht, bevor ich es ihnen allen gezeigt habe!« Sie wollte sich erneut auf Backus stürzen.
Hosenträger-Madge schnaufte, die Hand immer noch fest um Sadies Handgelenk geschlossen. Sie zog Sadie zurück, packte mit der anderen Hand ihren Kopf, beugte sich hinunter und biss ihr mit einem nassen Reißen das Ohr ab.
Das Heulen, das aus Sadies Kehle drang, war so laut, dass die Gläser hinter der Bar klirrten. Sie schrie vor Schmerz und Wut und hielt sich den blutüberströmten Kopf. Ihr Ohr steckte immer noch zwischen Madges Zähnen, zusammen mit einem Büschel Haare, die sie ebenfalls erwischt hatte. Tränen der Scham brannten in Sadies Augen, als sie aus der Ersoffenen Ratte rannte.
Die Blicke der Gäste folgten Madge, wie sie in aller Seelenruhe hinter die Theke ging, eines der Einmachgläser ihrer Ohrensammlung nahm und Sadies abgebissenen Lauscher hineinspuckte.
Red blickte zu Sadies blutigem Schwert hinüber, das immer noch auf dem Tisch lag. Er wusste nicht, was als Nächstes passieren würde, aber er ahnte, dass Sadie das Schwert noch brauchen würde. Er stürzte quer durch die Taverne, gerade als sich Backus ihm zuwenden wollte, und schnappte sich die Waffe, bevor der Gastwirt auch nur die Hand heben konnte. Dann flitzte er aus der Taverne und hinter Sadie her.
Er schloss zu ihr auf, als sie bereits zurück zu den Docks stolperte. Sie fluchte und weinte, während sie sich den Kopf hielt und das Blut zwischen ihren Fingern hindurchsickerte.
»Was ist passiert?« Seine Stimme war schrill.
»Ich bin erledigt«, heulte sie. »Sadie die Ziege, vor allen gedemütigt! Hosenträger-Madge hat mein Ohr in ihrer Sammlung, und ich kann mich nirgends mehr sehen lassen!«
»Und was machen wir jetzt?«, fragte er.
»Wir?«, knurrte sie. »Was wir jetzt machen?« Sie sah aus, als würde sie ihn im nächsten Moment verprügeln wollen. Doch dann hielt sie inne und runzelte die Stirn. »Wir«, sagte sie noch einmal, dieses Mal ein wenig leiser. Sie sah zu den Docks hinüber. Die Sturmbraut lag immer noch dort, wo sie sie zurückgelassen hatten. »Wir«, flüsterte sie jetzt und grinste Red an. »Wir widmen uns jetzt einem neuen Gewerbe, mein Bester. Wer braucht schon den Dreck von der Paradieskehre, vom Silberrücken oder aus Hammerhusen, wenn es so viele andere interessante Gegenden gibt, die nur darauf warten, von uns geplündert zu werden. Sadie die Ziege ist vielleicht erledigt, aber Sadie die Piratenkönigin fängt gerade erst an.«
3
Die Küste von Galemoor bestand aus schroffzackigen schwarzen Felsen, die von den eisigen Wellen glatt geschliffen worden waren. Die dunkle Erde weiter innen im Land war hart, aber fett, sodass viele Saaten erfolgreich gediehen, wenn man den Boden nur richtig bearbeitete. Vor allem Gerste und Hopfen wuchsen gut, und aus dem brauten die Mönche der Vinchen ihr braunes Ale, das im ganzen Imperium gerühmt wurde.
Die Insel wurde zum großen Teil für den Ackerbau genutzt, doch in ihrem Zentrum befand sich das Kloster der Vinchen, das Jahrhunderte zuvor aus dem schwarzen Stein der Insel gehauen worden war, damals von den Schülern von Manay dem Wahren, einem der weisesten Großlehrer der Geschichte des Imperiums. Die langen, quadratischen Bauwerke umschlossen einen großen Platz, und in der Mitte dieses Hofs stand der Tempel. Die Südseite des Klosters beherbergte die Gemeinschaftsräume der Mönche, und eine abgetrennte – aber immer noch bescheidene – Behausung für den Großlehrer. An der Nordseite befanden sich die Küchen, auf der Westseite die Brauerei.
Großlehrer Hurlo hatte bereits viele Jungen an den schwarzen Eisentoren des Klosters ankommen sehen, die Augen voller Furcht. Die meisten waren reich, verwöhnt und häufig dazu bestimmt worden, ein Vinchen zu werden, weil ihre Eltern ihrer Erziehung zu Hause nicht Herr wurden. Hurlo erinnerte sich noch an die Zeit, als man sich gewünscht hatte, ein Vinchen zu sein. Es war sogar in Mode gewesen. Doch die, die ihm jetzt gebracht wurden, brauchten Jahre, bis sie schätzen lernten, was er und die anderen Mönche ihnen zu geben versuchten. Und doch hatte er zu akzeptieren gelernt, dass die Dinge heute nun einmal so waren.
Allerdings wusste er nicht, was er von dem Mädchen halten sollte. Sie war etwas völlig Neues, für ihn und für den Orden. Kapitän Toa brachte sie in ihren schmutzigen Lumpen ans Tor. Ihre dunkelblauen Augen nahmen alles um sich herum auf und verrieten gleichzeitig nichts.
»Hallo Kind«, sagte Hurlo. »Ich bin Großlehrer Hurlo. Willkommen im Kloster der Vinchen.«
»Danke«, sagte sie mit kaum hörbarer Stimme.
»Viel Glück, Hurlo.« Sin Toa reichte ihm seine große, behaarte Hand.
»Gute Wege«, antwortete Hurlo und schüttelte sie warmherzig.
Nachdem Toa gegangen war, rief Hurlo alle Mönche und Schüler in den Hof. Sie betrachteten das kleine Mädchen, das da neben Hurlo stand, mit einer Mischung aus Überraschung, Verwirrung und Abneigung.
»Das hier ist Bleak Hope. Sie ist dank der Taten eines Biomanten verwaist und heimatlos«, sagte er. »Sie wird bei uns bleiben, bei den Hausarbeiten helfen und andere niedere Dienste leisten, bis sie alt und stark genug ist, um weiterzuziehen.«
Keiner der Mönche war respektlos genug, um etwas zu sagen, aber Hurlo hörte, wie einige scharf die Luft einsogen. Das überraschte ihn jedoch nicht. Keine Frau, egal, welchen Alters, hatte jemals einen Fuß in das Kloster gesetzt. Und jetzt sollte eine unter ihnen leben, jeden Tag, vielleicht jahrelang.
»Ihr dürft zu euren Pflichten zurückkehren«, sagte er ruhig. Er sah ihnen zu, wie sie sich langsam zerstreuten und ihm und Hope dabei verstohlene Blicke zuwarfen, und er beschloss, dass es interessant sein würde, sie dabei zu beobachten, wie sie sich dieser Anordnung stellten.
Das Buch der Stürme sagte, dass es nur einen Himmel, jedoch viele Höllen gäbe. Jede Hölle sei einzigartig und doch genauso grausam wie alle anderen auch. Das, so sagte das Buch, liege an der uferlosen Leidensfähigkeit der Menschen, und die Welt verfüge über unzählige Möglichkeiten, diese Leiden zu verursachen.
Großlehrer Hurlo dachte oft an diese Zeilen. Er vermutete, dass den Jungen, die erst kürzlich dem Orden der Vinchen beigetreten waren, Galemoor selbst als Hölle erscheinen musste. Fern der großen Städte und der luxuriösen nördlichen Anwesen ihrer Kindheit, lag es in der Mitte der Südlichen Inseln, so weit weg von der warmen, sonnigen Hauptstadt Steingrat wie nur möglich.
Für viele der älteren Brüder war schon Veränderung allein eine Form der Hölle. Schon eine einzige Neuerung in der seit Jahren starren Routine ließ diese Männer in Panik ausbrechen. Sie schienen sich nicht weiter um das Mädchen zu kümmern, solange sie ihren Tagesablauf nicht störte. Doch wenn sie ihre Kammern reinigte, beschwerten sie sich bei Hurlo, manche sogar darüber, dass ihre Räume zu sauber seien. Wenn sie ihnen beim Essen auftat, beschwerten sie sich auch, selbst wenn ihr einziges Vergehen gewesen war, ihnen zu viel Essen auf den Teller getan zu haben.
Für andere Brüder bedeutete die Hölle schon die plötzliche Anwesenheit eines weiblichen Wesens unter ihnen. Wenn sie in der geschürzten, alten schwarzen Mönchsrobe, die ihr bis an die Knöchel reichte, an ihm vorbeilief, still und blass wie ein Geist, ihre Augen im Schatten der Kapuze verborgen, konnte Hurlo nicht einmal erkennen, dass sie eine Frau war. Und doch konnten einige Brüder kaum die einfachsten Aufgaben erledigen, wenn sie in der Nähe war.
Das Buch der Stürme sagt, dass eines Mannes Hölle viel über ihn aussagt. Und so war es auch mit seiner Reaktion auf sein Leiden. Hurlo beobachtete mit Interesse, dass sich einige über Hope beschwerten, andere sie ignorierten und einige versuchten, sich mit dieser kleinen blonden Vertreterin ihres Leidens anzufreunden. Diese wohlmeinenden Brüder gaben jedoch meist nach wenigen Versuchen der Schmeichelei und Süßigkeiten auf, da sie dem unergründlichen blauen Blick nicht lange standhalten konnten.
Nach wenigen Tagen der Beobachtung widmete sich Hurlo wieder seinen Studien und der Meditation. Und so merkte er nicht gleich, dass eine andere Reaktion auf Hope unter den Brüdern aufkam. Grausamkeit.
Es war eine Woche her, dass Bleak Hope im Kloster der Vinchen angekommen war. Sie konnte nicht sagen, dass sie glücklich war. Sie war nicht mal sicher, ob sie das je wieder sagen könnte. Doch sie fühlte sich wohl. Sie hatten einen warmen Platz zum Schlafen und drei Mahlzeiten am Tag.
Sie verstand nicht wirklich, was die Vinchenbrüder taten. Sie meditierten, sie lasen und sie trainierten. Jeden Tag versammelten sie sich vor dem Abendessen im Tempel zum Gebet. Keine dieser Beschäftigungen hatte in ihrem Dorf großen Anklang gefunden. In vielerlei Hinsicht war ihr dieses Leben unter den ruhigen Mönchen noch weniger vertraut als die wenigen lauten und rauen Tage auf Kapitän Toas Schiff.
Ihre Arbeit verstand sie jedoch. Kleine Kammern, die in Ordnung gehalten werden mussten, einfaches Essen, das serviert werden musste, einfache Kleidung, die gewaschen und gestopft werden musste. Die Arbeit gefiel ihr nicht besonders, aber die Eintönigkeit brachte ihr so etwas wie Frieden. Diesen Frieden schätzte sie sehr, denn die restliche Zeit waren ihre Gedanken von Tod und einem düsteren Hunger nach Rache beschwert. In der Nacht war es am schlimmsten. Sie lag in der Küche auf ihrer Matratze aus Stroh, und ihre Gedanken lagen so schwer auf ihr, dass sie kaum Luft bekam. Wenn sie endlich einschlief, so war ihr Schlaf unruhig und voller Albträume.
»Du da. Bauernmädchen.«
Hope blieb stehen. Sie hatte die Plumpsklos gereinigt und war jetzt auf dem Weg zurück in die Küche. Sie wandte sich um und sah, dass Crunta in der Tür des Schlafsaals der Mönche lehnte. Crunta war einer der jüngeren Brüder, vielleicht dreizehn Jahre alt, und er befand sich noch in der Ausbildung. Als Hurlo ihr die ersten Aufgaben gegeben hatte, hatte er erwähnt, dass sie die meisten Arbeiten für die älteren Brüder erledigen würde. Die jüngeren mussten diese Arbeiten selbst ausführen, deshalb war Hope erstaunt, dass Crunta sie rief.
»Ich?«, fragte sie.
»Ja, du, dummes Ding«, sagte er und bedeutete ihr, näher zu kommen.
Unsicher ging sie zu ihm.
»Komm herein.« Er wandte sich um und lief voraus.
Hope folgte ihm. Das Gebäude bestand aus einem einzigen Raum. Auf den glatten Holzböden lagen ordentlich aufgereiht Schlafmatten aus Stroh und kleine, zylindrische Kissen. Hope sah zu, wie Crunta seine schwarze Mönchsrobe auszog. Darunter trug er einen schmalen Lendenschurz, der seinen Oberkörper und die Beine frei ließ. Sein Körper war schlank und muskulös, und er hatte fast keine Haare auf der Brust.
Er knüllte seine Kutte zusammen und drückte sie ihr in die Arme. »Wasch das, und bring es mir sofort zurück.«
Hope war sich ziemlich sicher, dass die jüngeren Brüder ihre Wäsche selbst machen mussten, und doch hatte sie Angst, es zu sagen. »Ja, Bruder.«