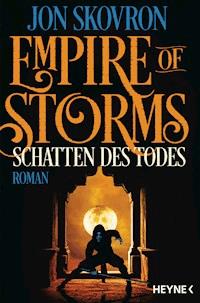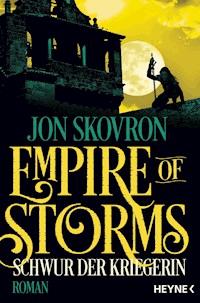
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Empire of Storms-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das Imperium der Stürme ist in Aufruhr, der Imperator ist schwach und die Biomanten – mächtige Zauberer, die Menschen mit einem Wimpernschlag töten – haben mehr und mehr an Einfluss gewonnen. Der ehemalige Straßendieb Red, inzwischen Spion der kaiserlichen Familie, soll dafür sorgen, dass die Biomanten gestürzt werden. Damit die Mission gelingt, braucht er die Hilfe seiner ersten großen Liebe, der Vinchen-Kriegerin Hope. Doch Hope hat ihr Schwert niedergelegt und geschworen, nie wieder eine Klinge zu führen. Und der Schwur eines Vinchen ist härter als Stahl und währt ewiger als ein Kaiserreich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Jon Skovron
SCHWUR DER KRIEGERIN
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michelle Gyo
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Das Imperium der Stürme ist in Aufruhr, der Imperator liegt im Sterben und der Rat der Biomanten festigt seine Machtposition am Kaiserhof. Das wird in adeligen Kreisen allerdings nicht gerne gesehen, denn die Lords und Ladys fürchten um ihren eigenen Einfluss auf die kaiserliche Familie. Vor allem Merivale Hempist, der Anführerin des imperialen Geheimdienstes, ist der Rat der Biomanten ein Dorn im Auge. Um die gefährliche Pläne der Biomanten zu vereiteln und sie ein für alle Mal aus dem Palast zu vertreiben, schickt Lady Hempist ihren besten Spion aus: Lord Rixidenteron Pastinas, besser bekannt als der ehemalige Straßendieb Red. Damit seine riskante Undercover-Mission gelingt, braucht Red die Unterstützung seiner alten Gefährten: Nessel, die inzwischen zur gefürchteten Bandenchefin aufgestiegen ist. Brigga Lin, die selbst eine mächtige Magierin ist, und die Alte Yammy, die mehr Geheimnisse birgt als das Imperium selbst. Am dringendsten aber braucht er die Hilfe seiner großen Liebe, der Vinchen-Kriegerin Hope – ohne sie hat Red keine Chance seinen Auftrag zu erfüllen. Hope jedoch hat ihr Schwert nach den schrecklichen Abenteuern, die sie bestehen musste, niedergelegt und geschworen, nie wieder eine Klinge zu führen. Und der Schwur eines Vinchen ist härter als Stahl und währt länger als die Ewigkeit …
Der Autor
Jon Skovron wurde in Columbus, Ohio, geboren. Er arbeitete unter anderem als Schauspieler, Musiker und Webdesigner, doch seine wahre Leidenschaft gehörte schon immer dem Schreiben. In seiner Heimat Amerika hat er sich mit verschiedenen Jugendbüchern und Kurzgeschichten bereits einen Namen gemacht, bevor er mit Empire of Storms sein erstes Fantasy-Abenteuer für Erwachsene veröffentlichte. Der Autor lebt in der Nähe von Washington, D. C.
Die Empire of Storms-Saga:
Erster Roman: Pakt der Diebe
Zweiter Roman: Schatten des Todes
Dritter Roman: Schwur der Kriegerin
Titel der amerikanischen Originalausgabe: BLOOD & TEMPEST – THE EMPIRE OF STORMS Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2018 Redaktion: Catherine Beck Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München Karte © 2017 by Tim Paul Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock (tsuneomp und Mediamix photo) Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
Für meine Stiefmutter, Doktor Sandra Skovron, die nie auf ihre guten Taten aufmerksam macht, weshalb ich viel zu lange brauchte,
ERSTER TEIL
»Meine Ordensbrüder sind bemüht, Zweifel zu meiden. Sie glauben, Zweifel machen sie schwach. Sie begreifen nicht, dass der Zweifel der Beginn von wahrhaftigem Verstehen ist, und demzufolge wahrhaftige Stärke.«
1
Man sagt, die Schwärze der Nacht selbst habe ihn hervorgebracht, und er sickere aus der Dunkelheit hinein und hinaus, als wäre er ein Teil von ihr.«
Der Alte Turnel, der Steinmetz, stellte seinen Krug Bier ab, wischte sich den Schaum vom buschigen Schnurrbart und musterte die anderen drei Kerle am Tisch mit einem wissenden Blick. Sie alle nickten über ihren Krügen. Sie hatten Ähnliches gehört.
Die Taverne Zum Radkasten war voll, so wie fast jeden Abend in den letzten Wochen. Die Menschen in Steingrat fühlten sich seit einiger Zeit nicht mehr sicher, und so war es nur natürlich, dass sie sich versammelten. Und doch konnten sie nicht aufhören, über die Sache zu reden, die sie mit solchem Grauen erfüllte.
»Jemand hat mir erzählt, dass er keine Geräusche macht und nicht mal einen Mund hat«, sagte da Mash der Tintenmacher.
»Nein, ich habe gehört, er hat sogar drei Mäuler«, widersprach Trina die Flickschusterin. »Eins speit Säure, eines Gift, und eines schreit so laut, dass einem die Ohren davon bluten.«
»Ich habe sein Werk mal mit eigenen Augen gesehen, die armen Teufel waren nicht verbrannt oder vergiftet oder so«, sagte der Alte Turnel. »Sie alle und jeder von denen sind zu Tode gewürgt worden, ohne dass Fingerabdrücke auf den Hälsen gewesen wären.«
Die Menschen hatten diesem neuen Mörder den Spitznamen Steingratwürger gegeben. Seine Opfer tauchten jede Nacht auf, vom Künstlerweg bis hinab zu den Docks. Und nicht nur Männer und Frauen, auch Kinder waren darunter. Dieser Schattendämon, der ein paar Monate zuvor umgegangen war, war schon übel genug gewesen. Doch der hatte immer die Regimekritiker und Aufrührer als Ziel gewählt. Der Steingratwürger schien jedoch weder ein Motiv noch ein Muster zu haben, und das machte ihn umso furchterregender. Die Eltern begannen, ihre Kinder nachts drinnen zu behalten, und selbst die zahmsten Miezen trugen ein Messer mit sich herum, wenn sie in der Stadt unterwegs waren. Im Verlauf des letzten Monats war die Hauptstadt des Imperiums der Stürme von einer Angst gepackt worden, die kurz davor zu sein schien, sich in einer stadtweiten Panik zu entladen.
»Sie sagen, dass er keine Sonne verträgt«, sagte Mash. »Das ist doch was, oder nicht?«
»Falls es stimmt«, sagte Trina.
»Mein Kater hat was Merkwürdiges gehört unten an den Docks«, sagte Hooper der Schneider. Er war ein ruhiger Kerl, aber von den anderen wohlgeachtet, da er der Erfolgreichste unter ihnen war. Er hatte sogar schon Kleider für Lady Hempist und Erzlady Bashim geschneidert, zwei der elegantesten Adligen im Imperium. »Kennt ihr das alte Lagerhaus am westlichen Ufer der Kaufmannsgabel?«
»Das, das seit zehn Jahren langsam in sich zusammenfällt?«, fragte Trina.
»Genau das«, sagte Hooper. »Auf jeden Fall war mein Kater da unten und hat mit Jacklow dem Fischer verhandelt. Kennt ihr den?«
»Das ist mein Cousin!«, rief Mash, immer darauf bedacht, Hooper auf jede nur erdenkliche Weise zu beeindrucken.
Hooper warf dem jüngsten Mitglied der Truppe einen Blick zu, dann sagte er: »Sei es, wie es mag, meinem Kater und mir ist Jacklow als ehrlicher Kerl bekannt, der immer kristallklar ist. Und er hat gesagt, jemand hat in den letzten Monaten dort in diesem Lagerhaus herumgelungert. Jemand, der nicht völlig … normal ist.«
»Das ist ja ungefähr der gleiche Zeitraum, in dem die Morde begonnen haben«, stellte der Alte Turnel fest.
Hooper nickte ernst und nahm einen Schluck aus seinem Krug.
»Woher weiß Jacklow, dass jemand Unnatürliches da herumlungert?«, fragte Trina. »Hat er ihn geseh’n?«
Hooper schüttelte den Kopf. »Er hört immer nur, wie es dort bei Sonnenuntergang heult und stöhnt, als wäre es ein Tier. Geschieht fast jede Nacht, sagte er.«
Mash erschauderte. »Wird mir noch Albträume bescheren, wenn wir weiter von so was reden.«
»Sei kein Weichei«, sagte Hooper.
Mash wandte sich mit flehendem Blick Trina zu. »Denkst du nicht auch, Trin? Der hier ist sogar schlimmer als der Schattendämon.«
Bevor Trina antworten konnte, warf eine neue Stimme ein: »Glaubst du?«
Der Sprecher saß am Nachbartisch, er hatte sich mit überkreuzten Armen auf seinem Stuhl zurückgelehnt. Er trug eine feine Jacke und die Krawatte eines Lords, und er passte nicht ganz in den Radkasten. Aber noch merkwürdiger war, dass er eine Brille mit so dunklen Gläsern trug, dass sie seine Augen verbargen. »Und wer würde da wohl einen Kampf gewinnen, was denkt ihr?«
Die Kunsthandwerker sahen einander an.
»Zwischen dem Würger und dem Schattendämon?«, fragte Hooper.
»Ich würde mein Geld auf den Dämon setzen«, sagte der Neuankömmling.
»Warum sollten sie gegeneinander kämpfen?«, fragte Mash.
»Wahrscheinlich sind sie doch verbündet«, stimmte Trina zu.
Der Neuankömmling zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, das wäre möglich.«
»Aber wenn ich’s recht bedenke …«, sagte der Alte Turnel und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger gedankenverloren über den Schnauzer. »Sie könnten auch kämpfen, wisst ihr. Um das Revier.«
»Könnte sein«, sagte der Neuankömmling. »Oder vielleicht kämpfen sie auch, weil der Schattendämon Buße für seine vergangenen Verbrechen tun will.«
Sie warfen einander erneut Blicke zu.
»Hab dich noch nie hier gesehen, Fremder«, sagte der Alte Turnel schließlich. »Hast einen Namen?«
Der Mann grinste. »Ihr dürft mich Red nennen.«
Am folgenden Abend ging Red hinunter zu den Docks. Der Himmel hatte die besondere goldene Färbung des Zwielichts, und alles um ihn herum wirkte ein wenig unecht, als er an kleinen, einmastigen Schaluppen vorbeilief, die man gerade be- und entlud. Red trug die weichen grauen Sachen, die die Biomanten ihm gegeben hatten, als sie ihm den Schattendämon aufgezwungen hatten. Seine Spitzenkleider wären im Hafen aufgefallen, und falls er in Schwierigkeiten geriet, behinderten sie ihn in seinen Bewegungen.
Er hatte immer gedacht, die Docks der Paradieskehre wären groß mit den über zwanzig Anlegestellen und gut fünfzig Schiffen, die ständig ein- und ausliefen. Doch die Docks von Steingrat zogen sich entlang des Flusses Burness vom Herzen der Stadt durch die Überreste des Donnertors bis ganz zur Küste hinab. Sogar in einigen der größeren Nebenflüsse des Burness waren Anlegestellen errichtet worden. Und an der Stelle, an der der Burness in das Meer floss, erstreckten sich die Docks meilenweit an der Südküste entlang. Alles in allem waren es fast achtzig Anlegestellen und über einhundert Lagerhallen. Red konnte nicht einmal schätzen, wie viele Schiffe hier ein- und ausliefen.
Glücklicherweise war die Kaufmannsgabel einer der kleineren Nebenflüsse, der vor allem von Kunsthandwerkern für den Handel untereinander genutzt wurde. Das wiederum bedeutete, dass er nicht besonders gut überwacht wurde und auch nicht annähernd so voll war. Es war, so dachte Red, der perfekte Ort für ein Monster, um sich zu verstecken. Red hoffte, dass Jacklow der Fischer wirklich etwas »Unnatürliches« in dem verlassenen Lagerhaus gehört hatte. Lady Hempist hatte ihm den Auftrag bereits vor Wochen erteilt, und dies war die erste vielversprechende Spur.
Er lief am Flussufer entlang und ging dabei den Dockarbeitern aus dem Weg. Es waren mehr, als er so kurz vor Sonnenuntergang erwartet hatte, und das bereitete ihm ein wenig Sorgen. Merivale hatte kristallklar gesagt, dass seine Mission unauffällig vonstattengehen musste, wie ein anständiger Spionageeinsatz eben. Er sollte kein unnötiges Aufsehen erregen oder die ohnehin schon panischen Stadtbewohner noch mehr in Angst und Schrecken versetzen. Er musste auch seine Identität verbergen, indem er einen grauen Schal um die untere Gesichtshälfte zog. Anscheinend taugte es nicht, wenn jemand den Lord von Pastinas Manor bei der Monsterjagd erkannte. Zuerst war es ihm dumm erschienen, Mund und Nase bedeckt zu halten, während man seine Augen sah. Sie waren doch sein auffälligstes Erkennungsmerkmal. Aber Merivale hatte ihm erklärt, dass man ihn als Lord Pastinas kaum je ohne die geschwärzten Gläser sah, und so wussten die meisten nicht, dass seine Augen rot waren.
Gegen Sonnenuntergang kam Red endlich bei dem Lagerhaus an. Die Schusterin hatte nicht übertrieben, als sie sagte, dass die Halle fast zusammenbrach. Das Dach war zum größten Teil verschwunden, und die Wände sackten nach innen aufeinander zu. Es gab zwei Eingänge. Einer war am Flussufer, durch den früher wohl die Waren von den Booten hineingebracht worden waren. Der andere Eingang befand sich auf der gegenüberliegenden Seite, wo man die Waren wohl auf Wagen geladen hatte, um sie in die Stadt zu bringen. Da alle Opfer im Landesinneren gefunden worden waren, beschloss Red, sich von dem landwärtigen Eingang aus zu nähern und so den Fluchtweg zu verstellen, der zu unschuldigen Menschenleben führte.
Red hatte versucht, sich im Geiste ein Bild von der Kreatur zu machen, aber die unterschiedlichen Beschreibungen, die er gehört hatte, waren so widersprüchlich, dass er immer noch keine Ahnung hatte, was er vorfinden würde. Nur einer einzigen Sache war er sich hierbei ziemlich sicher, nämlich dass, was immer es war, von einem Biomanten erschaffen worden sein musste, und zwar mit deren üblichem Mangel an Mitgefühl oder Mindestmaß an Anstand.
Als er sich der Lagerhalle näherte, hörte er einen bedrückenden, klagenden Ton von drinnen. Es war ein Laut zwischen dem Weinen eines Kinds und dem Heulen eines verletzten Tiers.
Er sah ein großes Fenster über dem Eingang. Das Glas war bereits zerbrochen, und er beschloss, dass diese Möglichkeit ein wenig besser war, als einfach durch die Tür hineinzuspazieren. Er kletterte an der Mauer hinauf, und sein verbesserter Tastsinn erlaubte es seinen Fingern und Zehen, die in weichen Schuhen steckten, jeden Spalt und Riss zu ertasten, der ihm bei seinem Aufstieg helfen würde.
Er hockte auf dem Fensterbrett und musterte das Innere der Lagerhalle. Mit seinem roten, katzenartigen Augen sah er im Dämmerlicht besonders gut. Es war ein großer offener Raum, übersät mit verrostetem Bootszubehör, verrottenden Tauen und Dachteilen, die bereits hinabgestürzt waren. Unter dem Dach gab es Fenster, die die letzten schwachen Sonnenstrahlen hineinließen und alles in blutrotes Licht tauchten.
Die gequälten Schreie drangen aus einem umgekehrten Ruderboot an der gegenüberliegenden Mauer. Der Raum unter dem Boot reichte für eine recht große Kreatur, doch diese würde das Boot umdrehen müssen, um aus ihrem Versteck zu kommen. In diesem Augenblick wäre sie verletzlich, und so würde es der perfekte Moment für Reds Angriff sein. Also machte er es sich gemütlich und wartete.
Es war nicht besonders bequem dort oben auf dem Fenstersims. Er musste seine Beine mehrfach ausschütteln, um die Blutzirkulation in Gang zu halten. Und als die letzten Strahlen des Sonnenlichts endlich schwanden, bewegte sich das Boot nicht. Voll makabrer Faszination beobachtete Red, wie ein blasses, von Adern durchzogenes Etwas durch den schmalen Ritz zwischen Boot und Boden sickerte. Es floss in einer klumpigen Pfütze über die Holzbretter des Bodens, und nur gelegentlich hob sich die Bootskante ein wenig, wenn ein größerer Fleischbrocken darunter hindurchsickerte.
Als das Etwas vollständig unter dem Boot hervorgekommen war, erkannte Red, dass es nicht wirklich ein Blob oder eine Pfütze war. Das Ding hatte eine Gestalt. Eine menschliche Gestalt. Doch sie war dehnbar, als wäre jeder Knochen weich und nachgiebig. Der Mensch lag auf dem Bauch, schlaff und schwer, und die Arme und Beine ragten gebogen an den Seiten heraus wie Insektenbeine aus Gummi. Dann sah Red das eingedrückte Gesicht.
»Brackson?«
Red erinnerte sich daran, dass Progul Bon Brackson einmal beiläufig erwähnt hatte. Man hatte die ehemalige rechte Hand von Deadface Drem bestraft, nachdem er Reds Schwachstelle mit den schrillen Tönen voreilig ausgeplaudert hatte. Red hatte angenommen, dass ihm etwas Grässliches zugestoßen sein musste, doch er hatte nicht damit gerechnet, dass sie ihn am Leben gelassen hatten.
Das Ding, das einmal Brackson gewesen war, wandte sich träge um, als Red seinen Namen rief. Statt zu gehen, oder auch nur zu kriechen, wand und schlängelte sich das Wesen über den Boden wie eine Kreuzung aus Mensch und Oktopus. Der Brustkorb war so weich, dass das Gewicht auf seine Innereien drücken musste. Red nahm an, dass er höllische Schmerzen litt. Und so wie Bracksons Kopf zur Seite sackte, wie eine Pastete, die in sich zusammenfiel, war wohl auch sein Gehirn nicht besonders gut geschützt.
»Brackson, kannst du sprechen?« Red hatte Brackson schon immer gehasst. Doch das hier hatte niemand verdient. Er zog seinen Schal hinunter, damit sein Gesicht zu sehen war. »Erkennst du mich?«
Brackson stieß ein Grunzen aus, das nicht besonders freundlich klang. Sein Mund wabbelte. Vielleicht versuchte er zu sprechen, aber sein Kiefer war zu weich, um Worte zu formen.
»Hör mal. Ich weiß, wir waren niemals Kumpel, aber was man dir angetan hat, ist furchtbar falsch. Lass mich dir helfen.« Er wusste nicht, wie, aber er kannte den Prinzen und die Imperatrix. Es musste doch etwas geben, das er tun konnte.
Brackson bewegte sich auf die Tür zu, als ignorierte er Red. Oder vielleicht hatte sein Gehirn einen so großen Schaden davongetragen, dass er ihn nicht verstanden hatte. Auf jeden Fall schien er die Lagerhalle verlassen und zurück in die Stadt zu wollen, wahrscheinlich um stumpfsinnig jeden zu erwürgen, der in die Nähe seiner Gummiarme kam.
Red seufzte und zog den Schal wieder vor den Mund. »Ich hätte wissen müssen, dass du es mir selbst jetzt nicht leicht machst.« Er sprang von dem Fenstersims und versperrte Brackson den Weg. »Tut mir leid, alter Pott. Deine Mordserie endet heute Nacht.«
Bracksons gummiartiges Gesicht verzog sich zu einer Art Stirnrunzeln, dann stieß er ein leises, gurgelndes Knurren aus.
Red nahm in jede Hand ein Wurfmesser. Brackson zögerte, als er den glänzenden Stahl sah, und zog sich ein wenig zurück.
»Na also«, sagte Red. »Du verstehst vielleicht nicht viel, aber du erkennst die Gefahr noch, wenn du sie siehst. Vielleicht können wir die Sache ja doch friedlich beilegen.«
Brackson krümmte sich noch weiter in sich selbst zusammen. Dann schoss er wie eine Feder vor, prallte gegen Reds Brust und stieß ihn zu Boden.
Brackson trampelte über ihn hinweg und wäre fast entkommen, doch Red rammte ihm eines seiner Messer in die weiche Schulter, als er an ihm vorbeiwabbelte. Dann stach er das zweite Messer in die andere Schulter und hielt sich daran fest. Er war dankbar für die fingerlosen Lederhandschuhe, die er noch trug, sonst hätten die Klingen seine Handflächen aufgeschlitzt.
Brackson stieß trillernde Protestlaute aus und bewegte sich schneller vorwärts, als Red es für möglich gehalten hätte. Es war ein merkwürdiges Taumeln, bei dem Brackson sich zusammenzog, dann wieder nach vorne schoss, wobei seine gummiartigen Arme und Beine um alles krallten, das ihm zusätzlichen Halt bot. Reds Plan sah mittlerweile vor, ein oder auch beide Messer in Bracksons weichen Schädel zu rammen, doch wegen der hektischen, unwägbaren Geschwindigkeit würde er abgeworfen, sobald er auch nur eines der Messer losließ, die in den Schultern der Kreatur steckten. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich weiter festzuklammern.
Red und seine unwillige Mitfahrgelegenheit schossen durch die klapprige Tür und dann auf dem Pfad für die Transportwagen auf die Stadt zu. Die Stadt war der letzte Ort, an den Red wollte, also hängte er sich fest in die Klingen in Bracksons Schultern und steuerte ihn in einem weiten Bogen zurück zu den Docks am Westufer des Flusses. Brackson hatte einige Schwierigkeiten, sich auf dem Gras fortzubewegen, und Red glaubte schon, seine Chance zu bekommen. Doch bevor er sich diese zunutze machen konnte, erreichten sie die Docks. Bracksons gummiartige Finger und Zehen hakten sich in die weit auseinanderliegenden Holzplanken, und das merkwürdige Paar schwankte noch schneller voran.
»Aus dem Weg!«, schrie Red, als sie sich einer Gruppe Dockarbeiter näherten, die etwas – zu dieser Stunde sicher Schmuggelware – aus einer kleinen Schaluppe luden.
Die Arbeiter sprangen beiseite, und Brackson trampelte krachend durch die Kisten, sodass ein feines, pinkfarbenes Puder in die Luft stäubte. Purpurwurz.
»Kein Verlust«, murmelte Red. Er hegte immer noch einen Groll gegen die Droge, die seine Mutter geholt und ihn als Säugling beinahe umgebracht hatte. Da war er gefühlsduselig.
Ungläubig starrten die Dockarbeiter auf das seltsame Paar, das an ihnen vorbeiraste. Das Dock erstreckte sich etwa eine Viertelmeile am Fluss entlang. Red sah, dass noch weitere vier oder fünf Gruppen vor ihnen arbeiteten, und sie alle versperrten ihnen den Weg. Er musste die Sache beenden, bevor jeder Drogenschmuggler von Steingrat das hier mitbekam. Es wurde Zeit für eine gewagte und vielleicht etwas auffällige Akrobatennummer.
Red riss die Klingen aus Bracksons Schultern und sprang auf. Mitten in der Luft warf er die Messer, die sich beide in Bracksons Nacken gruben. Red landete auf dem Boden und rollte sich ab. Er lag auf den Docks und blickte gerade rechtzeitig auf, um zu sehen, wie die nun leblose Monstrosität von ihrem eigenen Schwung getragen in einen weiteren Stapel Kisten krachte. Die wütenden Rufe der Arbeiter wandelten sich rasch in alarmierte Schreie, als sie sahen, was ihre Ladung umgestoßen hatte.
Red rappelte sich eilig auf, lief zu Brackson und schubste dessen Körper über den Rand des Docks ins Wasser, wo er rasch versank und nicht mehr zu sehen war.
Ein anständiger Spion hätte sich in diesem Augenblick wohl unauffällig davongemacht, still und geheimnisvoll. Gut, ein anständiger Spion hätte sich wohl gar nicht erst in diesen Schlamassel verwickeln lassen. Da er nun aber schon einmal mitten im Morast steckte, konnte Red nicht widerstehen, dem ganzen einen kleinen Schnörkel zu verpassen.
»Na denn, meine Kerle«, sagte er zu den Schmugglern, und seine roten Augen glühten im Mondlicht über der grauen Maske. »Ich denke, das war es dann wohl mit dem Steingratwürger!«
Er verneigte sich knapp vor ihnen, dann rannte er davon, und sein Lachen hallte hinter ihm her durch die Nacht.
»Ihr habt eine eigentümliche Vorstellung davon, was unverdächtiges Verhalten sein soll«, sagte Lady Merivale Hempist.
Sie und Red waren in ihren Gemächern, die tadellos sauber und minimalistisch, beinahe schon karg eingerichtet waren. Sie saß an ihrem Glastisch und zerteilte sorgsam eine gebratene Wachtel. Trotz ihres kühlen Auftretens und des stählernen Blicks hatte Lady Hempist einen gewissen Reiz an sich, den Red nicht ganz ignorieren konnte. Es half nicht, dass sie Kleider bevorzugte, die ihr überaus einladendes Dekolleté betonten.
»Mylady, ich weiß nicht worauf Ihr Euch da bezieht«, sagte Red lässig. Er lungerte auf einem gepolsterten Sessel herum und ließ ein Bein über die Armlehne hängen.
Träge schwenkte er den letzten Schluck Rotwein in seinem Glas und trank ihn dann aus. Merivale hatte wirklich den besten Wein. Eines der wenigen Dinge, die diese Einsatzbesprechungen erträglich machten. Red hatte Lady Hempists Gesellschaft sehr genossen, als sie noch vorgegeben hatte, ihn für sich gewinnen zu wollen. Seit sie sein Boss war, schien sie weniger geneigt, seinen Humor zu würdigen. Er wusste, dass dies die echte Merivale war. Eine brillante Taktikerin und Spionin mit einem fast schon beängstigenden Mangel an Empathie. Er war einer der wenigen Menschen auf der Welt, die ihren wahren Charakter zu sehen bekamen, und die meiste Zeit flößte sie ihm Ehrfurcht ein. Allerdings machte sie so sicher auch weniger Spaß.
»Ich spreche natürlich von Eurer kleinen Darbietung an den Docks letzte Nacht«, sagte sie.
»Darbietung?«, fragte er unschuldig.
»Man redet in jeder Taverne der südlichen Stadthälfte darüber.«
»Es war wahrscheinlich auch ein ziemlich heroischer und unvergesslicher Anblick«, gab er zu. »Aber es ging nicht anders.«
Merivale tupfte sich mit einer Serviette die Lippen ab. »Heroisch. Ja. Das erinnert mich daran, dass außerdem ein recht erstaunliches Gerücht die Runde macht, dass der, der den Steingratwürger getötet hat, niemand anderes ist als der Schattendämon.«
»Wie merkwürdig.« Red strich mit dem Finger über den Rand seines Weinglases, sodass es leise summte.
»Anscheinend«, fuhr Merivale fort, »sagt man, dass er den guten Leuten von Steingrat hilft, um Buße zu tun. Ich vermag mir nicht vorzustellen, wo sie so etwas herhaben.«
Red schenkte ihr sein huldvollstes Lächeln. »Die Vorstellungskräfte des gewöhnlichen Volks sind wahrlich lebhaft, nicht wahr?«
Sie blickte ihn einen Moment lang an, dann stand sie auf, ging zum Fenster und sah hinaus in das strahlende, wolkenlose Blau. »Ihr habt viele Talente, lieber Lord Pastinas. Allerdings gelange ich zu der Einsicht, dass Spionage nicht dazu gehört.«
»Vielleicht wäre ich besser dazu geeignet, die Suche nach Bleak Hope anzuführen.« Er sagte es leichthin, als wäre es in der Vergangenheit nicht Thema mehrerer hitziger Unterhaltungen gewesen.
»Ich sagte Euch bereits, darum wird sich gekümmert«, antwortete Merivale. »Im Moment haben wir dringlichere Sorgen.«
»Ah ja?«
»Eurer mangelnden Diskretion ungeachtet, bin ich tief besorgt über dieses neueste Werk der Biomanten. Euch auszusenden und als Schattendämon ausgewählte Ziele töten zu lassen war eine Sache. Aber eine geistlose Kreatur auf das gemeine Volk loszulassen?«
»Das erscheint in der Tat unverantwortlich«, sagte Red. »Und wie nichts, was Progul Bon getan hätte.«
»Genau«, sagte Merivale. »So sehr wir Bon alle gehasst haben, so fürchte ich, dass er die anderen Biomanten doch zurückgehalten hat.«
»Sie waren vorher zurückhaltend?«
»Bons Tod hat ihre Strategie ganz offensichtlich verändert. Diese Kreatur ist nicht der einzige Hinweis darauf. Sie haben anscheinend auch beschlossen, dem Kaiser zu erlauben, die Verhandlungen mit Botschafterin Omnipora aufzunehmen.«
»Das ist in der Tat überraschend«, stimmte Red ihr zu.
»Ich will wissen, warum sie so plötzlich ihren Kurs ändern«, sagte Merivale. »Und ich will alles wissen, was ihre Pläne bezüglich dieser neuen Allianz mit den Vinchen betrifft.«
»Ich habe versucht, sie während meines Trainings auszufragen, aber sie sind ein glitschiger Haufen«, sagte Red.
Sie wandte sich vom Fenster ab und sah ihn an. »Ich glaube, es ist an der Zeit, Eure einzigartige Verbindung zu ihnen auf eine etwas … direktere Art zu nutzen.«
»Merivale, Ihr wisst so gut wie ich, dass es diese Verbindung völlig zerstören könnte, wenn ich zu aggressiv vorgehe. Wenn sie herausfinden, dass ich nicht mehr nach ihrer Pfeife tanze, ist alles vorbei.«
»Ich bin bereit, das zu riskieren«, sagte Merivale.
»Seid Ihr so besorgt?«
»Wisst Ihr, wann die Biomanten und die Vinchen zuletzt zusammengearbeitet haben?«, fragte sie leise.
»Zur Zeit des Dunklen Magiers«, sagte Red.
»Ja«, erwiderte Merivale. »Und Jahrhunderte später erholen wir uns immer noch von diesem verheerenden Ereignis. Wenn etwas von ähnlichem Ausmaß jetzt ausbricht … es ist durchaus möglich, dass das Imperium das nicht übersteht.«
Red blickte einen Moment auf sein leeres Weinglas, dann sah er sie an. »Was soll ich tun?«
In dieser Nacht saß Red in seinem Gemach und malte. Das tat er regelmäßig, seit er von Klein-Basheta zurückgekehrt war. Wann immer er spürte, dass sich die Dunkelheit in seinem Inneren erhob, half ihm das Malen, den Druck aufzulösen. Nicht dass er wirklich fürchtete, erneut die Kontrolle über sich zu verlieren. Doch es war ein unangenehmes Gefühl, und Red war gemeinhin der Kerl, der sich gern sonnig fühlte, selbst wenn schlimme Dinge um ihn herum geschahen. Er hatte noch nie viel Sinn darin gesehen, in düsteren Grübeleien zu versinken.
»Soll doch alles absaufen, das ist aber mal eine Furcht einflößende Kreatur!« Prinz Leston blickte über Reds Schulter auf das Gemälde.
Der Prinz neigte dazu, zu kommen und zu gehen, wie es ihm gefiel. Red war das recht, denn es bedeutete, dass er das ebenfalls so halten konnte. Und der Prinz verfügte über das bessere Essen und die Getränke, sodass es Red für gewöhnlich zugutekam. Außerdem erinnerte ihn dieser lockere Umgang an einfachere Zeiten, als Filler und er sich noch ein Zimmer geteilt hatten.
»Gefällt es Euch nicht, Eure Hoheit?«, fragte Red und fuhr fort, an dem Gemälde von Brackson zu arbeiten, der unter dem Boot hervorkam. Er hatte Jackett und Halstuch beiseitegelegt und malte mit aufgerollten Hemdsärmeln.
»Es ist sehr gut ausgeführt«, sagte Leston rasch. »Aber allgemein betrachtet malen Menschen erfreuliche Dinge, wie Blumen oder Landschaften.«
»Natürlich«, sagte Red. »Diese Menschen wollen ihre Gemälde verkaufen, also malen sie Dinge, die sich die Leute ansehen wollen. Ich habe jedoch nicht vor, eines meiner Gemälde zu verkaufen, also muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was andere Leute sehen wollen. Ich male nur für mich selbst.«
Leston zog einen Hocker heran und starrte das Bild von Brackson an.
»Doch warum würdest du ein so unerfreuliches Bild malen wollen?«, fragte er.
»Wenn ich es gut auf die Leinwand bringe«, sagte Red, »dann fühlt es sich nicht mehr an, als würde es in meinem Kopf feststecken.«
Leston schwieg einen Moment lang. »Es muss wundervoll und schrecklich zugleich sein, Künstler zu sein.«
»Na kommt schon, mein Kerl. Ich bin sicher, Prinz zu sein hat auch seine guten Seiten.« Dann wurde Reds Miene ernst, und er legte den Pinsel nieder. »Hört mal, es könnte sein, dass ich für eine Weile … gehen muss.«
»Was meinst du damit, gehen müssen? Den Palast verlassen?«
»Steingrat verlassen. Ich muss etwas erledigen, das mir eine Menge Ärger einbringen könnte. Wahrscheinlich werde ich hier eine Weile nicht allzu willkommen sein.«
Oder niemals wieder, aber das sprach er nicht aus.
Leston runzelte die Stirn. »Lady Hempist hat dir bereits einen weiteren Auftrag zugewiesen? Etwas noch Schlimmeres?«
»Der, für den sie mich ursprünglich angeheuert hatte, schätze ich.«
»Hat es etwas mit den Biomanten zu tun?« Er schüttelte den Kopf. »Das ist zu gefährlich. Ich verbiete es.«
»Tut mir leid, Leston«, sagte Red. »Das ist etwas, das getan werden muss. Und dieser Befehl kommt von Ihrer Imperialen Majestät, deshalb steht er über Eurem.«
»Was ist mit Hope?« Leston warf ihm einen flehenden Blick zu. »Hattest du keine Vereinbarung mit den Biomanten getroffen, dass sie ihr nichts tun, solange du hierbleibst?«
»Ja, und die haben sie gebrochen, indem sie die Vinchen auf Hope angesetzt haben. Also hat diese Vereinbarung für mich keine Gültigkeit mehr, auch wenn sie sich streng genommen an ihr Wort halten.«
»Aber kann es nicht ein anderer erledigen?«
»Ich bin der Einzige, der nahe genug herankommt.«
»Aber …« Das Gesicht des Prinzen verzog sich vor Ärger. »Nach allem, was du bereits durchgemacht hast …«
In seinem ganzen Leben, trotz all der verrückten Dinge, die er sich erträumt hatte, hätte sich Red niemals ausgemalt, dass er der Freund des Erben des imperialen Throns sein würde. Mehr noch überraschte ihn allerdings, wie gern er diesen Kerl tatsächlich mochte. Sicher, der Prinz war über die Maßen des Vernünftigen hinaus abgeschirmt, auf unerträgliche Weise mächtig und unglaublich verhätschelt. Und trotz alledem war er noch ein guter Mensch geblieben.
Red drückte dem Prinzen die Schulter. »Danke, alter Pott. Ich bin froh, dass mir irgendjemand zustimmt. Und doch ändert das gar nichts.«
»Wann … gehst du?« Leston sah untröstlich aus. Red war sich schmerzlich bewusst, dass er der einzige wahre Freund des Prinzen war.
»Morgen, aller Vorrausicht nach.«
»Wirst du dich von Nea verabschieden?«
Red schenkte dem Prinzen ein gequältes Lächeln. Selbst nach mehreren Monaten standen sich er und Nea immer noch fern. Er warf ihr das natürlich nicht vor. Kontrolle durch die Biomanten hin oder her, es war verständlich, dass sie nicht in der Nähe des Menschen sein wollte, der sie fast umgebracht hätte. Nea war jedoch keine feige Spitze, und Red fragte sich, ob sie in Erfahrung gebracht hatte, dass Red als Spion für Merivale arbeitete. War dies der Fall, so war ihre Vermeidungstaktik mehr politischer denn persönlicher Natur. In gewisser Weise hoffte er, dass es das war, denn er mochte die Gesandte von Aukbontar recht gern.
Dennoch war sie die Botschafterin eines fremden Lands, und sie durfte absolut nichts über eine so delikate Angelegenheit wissen.
»Wisst Ihr was?«, sagte er deshalb. »Könntet Ihr das für mich erledigen, Eure Hoheit? Ich würde es sehr zu schätzen wissen. Aber erst nach morgen.«
Am nächsten Morgen stand Red allein in seinem kleinen Salon und sah die Möbel an. Es waren wirklich schöne Möbel. Es gab zwei Sessel und ein kleines Sofa. Die Gestelle waren aus feinem dunklem Holz gemacht, das von Merivales Insel Klein-Basheta stammte. Das Holz war geglättet und gebeizt worden, bis es fast wie Glas glänzte. Die Sitzflächen und Lehnen waren mit weichem, seidenem Stoff in dunklem Mitternachtsblau von der Insel Fashlament bezogen, wo es laut Merivale aus den Hintern von Würmern kam. Vielleicht hatte sie auch einen Witz gemacht. Bei ihr war das manchmal schwierig zu sagen. Einer der Gründe, aus denen er sie mochte.
Neben den Stühlen stand ein rechteckiger Tisch mit Glasplatte, die auf einem schmiedeeisernen Gestell lag, dessen Ecken mit Muscheln verziert waren. Ein seidener Läufer lag auf dem Tisch. Er war mit den Bildern von Seevögeln und Fischen bestickt, und Red hatte sich immer gefragt, ob es wohl fliegende Fische oder Unterwasservögel sein sollten.
Nicht dass Red sich beschweren wollte. Über nichts davon. Er hatte noch nie so feine Möbel in seinem Salon gehabt. Bei allen Höllen, er hatte noch nie zuvor einen Salon gehabt. Und er vermutete, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass er jemals wieder einen haben würde.
Er stieß einen Seufzer aus und strich ein nicht vorhandenes Staubkorn von einer Stuhllehne.
»Nun, es war schön, solange es dauerte.«
»Wie war das, mein Lord?«, fragte Hume, der mit einem Stapel sauberer Bettlaken vorbeikam.
»Ich würde mir nicht die Mühe machen, die Laken zu wechseln, Humey, alter Pott«, sagte Red fröhlich. »Ich werde heute Nacht nicht in diesem Bett schlafen. Oder in irgendeiner Nacht, aller Voraussicht nach.«
Hume drehte sich zu ihm um. Sein eisengrauer Pferdeschwanz saß perfekt, und seine Haltung war aufrecht. Nur ein paar Linien auf seiner Stirn ließen ahnen, dass er sich ernsthafte Sorgen machte. Red hatte im letzten Jahr sein Bestes gegeben, um ihn zu erschüttern, und es war in gewisser Weise folgerichtig, dass dies nun den gewünschten Effekt hatte.
»Mylord?«, fragte Hume vorsichtig.
»Du warst gut zu mir, Hume«, sagte Red. »Ein verpisster Engel, wirklich. Besser, als ich es verdient hatte. Um ganz ehrlich zu sein, auch wenn ich immer so getan habe, als bräuchte ich dich nicht, so werde ich dich doch vermissen.«
»Wenn ich das sagen darf, Mylord, Eure Worte haben eine gewisse … Endgültigkeit an sich.«
Red schenkte ihm ein mattes Lächeln. »Merivale muss erfahren, was diese Biomanten vorhaben. Ich sehe mich ja selbst gern als Seidenschwätzer, aber ich habe jetzt seit Monaten versucht, etwas aus ihnen herauszubekommen, ohne jeglichen Erfolg. Diese Schwanzspritzer sind besser darin, Geheimnisse zu bewahren, als der Besitzer der Himmelsschnitte in der Paradieskehre. Und lass dir gesagt sein, das heißt etwas.«
»Mir ist die Person, auf die Ihr Euch da bezieht, bekannt«, sagte Hume trocken.
Reds Augen leuchteten auf. »Siehst du? Was für eine Schande, dass ich erst jetzt erfahre, dass du und Mo mal Kerle wart. Nun gut. Merivale braucht Ergebnisse, und mein Job ist es, diese zu beschaffen.«
»Ihr habt etwas Unbesonnenes vor, nicht wahr, Mylord«, sagte Hume ernst.
Red grinste. »Humey, mein Kerl, das ist es, was ich am besten kann.«
Er mochte dramatische Abgänge sehr, deshalb drehte er sich um und ging zur Tür.
»Noch eine Frage, Mylord«, sagte Hume.
Red blieb stehen und drehte sich wieder zu ihm um.
»Was soll ich mit diesen hier tun?«, fragte Hume und deutete auf den Stapel Gemälde, die an der Wand lehnten.
»Was immer du möchtest, Hume. Ich male, um ich selbst zu bleiben. Ich brauche sie danach nicht mehr.«
»Vielleicht sollte ich sie Mr. Thoriston Baggelworthy von Hohlfall geben? Er scheint besonders empfänglich, was die Pastinas’sche Neigung zu den Künsten betrifft.«
»Nur, wenn du sie ihm für eine ungeheuerliche Summe verkaufst, um dir dann selbst damit etwas Hübsches zuzulegen«, sagte Red.
Ein schmales Lächeln hob Humes Mundwinkel. »Wie Ihr wünscht, Mylord.«
2
Sie war nicht mehr auf Bleak Hope gewesen, seit sie ein Mädchen von acht Jahren gewesen war. Und doch fühlte es sich irgendwie an, als wäre sie niemals fort gewesen.
Sie war nach diesem Ort benannt worden, damit sie ihn und die schrecklichen Ereignisse, die sich dort abgespielt hatten, niemals vergaß. Vielleicht hatte das zu gut funktioniert, denn sie hatte sich nicht nur daran erinnert, sie hatte das Schicksal der Insel all diese Jahre als Bürde mit sich herumgetragen.
Deshalb kehrte sie jetzt zurück. Um diese Bürde abzulegen. Vielleicht konnte sie so eine neue Richtung und eine neue Bestimmung für sich finden.
Als die Insel in Sicht kam, hielt sie nicht direkt auf den Steg zu. Stattdessen lenkte sie ihr kleines Boot an der öden Küste entlang, bis sie die Felsen sah, auf die sie als kleines Mädchen immer geklettert war. Es war Flut, also segelte sie vorsichtig zwischen den zerklüfteten schwarzen Steinbrocken hindurch, bis sie an die Wassergrenze kam. Sie zog ihr Boot an Land, dann setzte sie sich auf den kleinen Bug. Sie schob die Kapuze ihrer schwarzen Robe zurück und wartete.
Aufmerksam beobachtete sie, wie die Flut nach und nach den Fuß der Felsen freigab. Das hatte sie in letzter Zeit häufig gemacht: den langsamen Veränderungen in der Natur zugesehen. Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, die Bewegungen der Wolken am Himmel. Einmal hatte sie sogar dem Eis beim Schmelzen zugesehen. Der stetige, aber unaufhaltsame Fluss dieser Dinge hatte etwas an sich, das sie zu begreifen suchte. In seinem Tagebuch hatte Hurlo notiert, dass er die Muster der Natur dazu genutzt hatte, seinen Geist zu erbauen. Was konnte es auch Erbaulicheres geben als einen Sonnenaufgang?
Als sie mit der Übung begonnen hatte, diese langsamen Naturereignisse zu beobachten, war es ermüdend gewesen. So viel Zeit damit zu verbringen, etwas zu beobachten, das sie nicht einmal wirklich erfassen konnte, sich von einem Augenblick zum nächsten veränderte. Doch sie zwang sich dazu, die Bewegungen der Sonne, des Monds und der Gezeiten weiter zu beobachten, und alles andere, von dem sie dachte, dass es ihr dabei helfen könnte … etwas zu begreifen. Sie konnte jedoch nicht genau sagen, was das sein sollte.
Jeden Tag hatte sie diese Abläufe beobachtet, Woche für Woche, Monat für Monat. Allmählich verlor sie ihre Ungeduld und begann, die Bewegungen wirklich zu sehen. Sie passte ihre Wahrnehmung an das Ereignis an, das sie beobachtete. Worte wie langsam und schnell verloren einen Teil ihrer Bedeutung, wenn sie sich in diesem Geisteszustand befand. Die Zeit wurde dehnbar, und ihre Wahrnehmung passte sich dem einzigartigen Moment an.
Jetzt sah sie also zu, wie die Ebbe enthüllte, was am Fuß der Felsen lag, wie die schwungvolle Geste, mit der ein Magier seine Vorführung abschloss.
Sie lächelte, als sie sich dabei ertappte, wie sie selbst nach all diesen Jahren den steinigen Sand nach Seeglas absuchte. Ihr Puls beschleunigte sich, als sie ein Stück sah, aber sie rannte nicht sofort darauf zu. Stattdessen stand sie auf und ging langsam hinüber, genoss es, die Belohnung hinauszuzögern, obwohl ihre Hand sich danach sehnte, das Stück zu berühren.
Sie kniete sich hin und hob es auf. Es war weder rot noch blau oder grün, sondern farblos. Sie hielt das kleine milchige Dreieck in der Hand und rieb mit dem Daumen darüber, genoss das Gefühl der matten Oberfläche.
Farblos. Ungebeugt. Vielleicht war das ein Zeichen. Oder eine Erinnerung.
Sie ließ das Stück Seeglas in die Tasche ihrer Robe gleiten. Dann zog sie die Kapuze wieder über den Kopf und wandte sich den Ruinen des Dorfs zu. Als sie jetzt hindurchschritt, erschien ihr das Gras nicht mehr so hoch wie als Mädchen.
Als sie das Dorf erreichte, stellte sie fest, dass es von menschlicher Hand unberührt geblieben war. Das Zeichen der Biomanten stand immer noch am Steg, und es genügte, um die Neugierigen fernzuhalten. Ihr Heim war dem Wind, dem Regen und dem Schnee überlassen worden, die es langsam und still zersetzten. Zwischen den ausgebrannten Skeletten der Gebäude waren mehrere Mauern eingestürzt. Ein paar weitere beherbergten nun die Nester von Möwen. Und doch brachte der Anblick, auch wenn er anders war, so lebhafte Erinnerungen zu ihr zurück, dass es fast war, als lägen zwei Bilder übereinander. Damals und jetzt. Leben und Tod.
Langsam lief sie über die einzige und unbefestigte Straße des Dorfs. Es gab nur zwanzig Hütten, und so dauerte es nicht lange, bis sie das Massengrab am anderen Ende erreichte, das sie für ihre Leute gegraben hatte. Seltsamerweise war es das Einzige, das ihr größer erschien als in ihrer Erinnerung. Sie staunte, dass sie eine solche Aufgabe alleine bewältigt hatte, so klein, wie sie gewesen war. Natürlich hatte sie lange dafür gebraucht und dabei die ungeheure Tragweite dessen, was sie da tat, nicht wirklich begreifen können. Sie hatte nur gewusst, dass es getan werden musste.
Sie sah das Massengrab jetzt an und begriff es wirklich. Wie konnte jemand so viele Menschen umbringen? Sie kannte die Antwort auf diese Frage, weil sie es selbst getan hatte. Wenige machten sich auf den Weg, um ein Massaker anzurichten, doch durch ihre Arroganz und ihren Anspruch, durch ihr starres Festhalten an Idealen oder einer Ideologie taten sie es dennoch, da sie daran glaubten, dass das Opfer es wert war. Teltho Kan hatte eine Waffe entwickelt, von der er geglaubt hatte, dass sie das gesamte Imperium retten würde. Fünfzig Leben waren ihm da als geringer Preis erschienen. Vielleicht hatte er sogar vom »Wohl der Allgemeinheit« gesprochen, so wie sie, als sie all diese Menschen gegen den Biomanten Progul Bon, den Schakallord Vikma Bruea und ihre Armee aus Leichen in die Schlacht und in ihren Tod geführt hatte.
Doch Leben zu opfern, um Leben zu retten, war keine Lösung, die sie länger akzeptieren konnte. Es musste einen anderen Weg geben. Am Ende hatte Hurlo das auch geglaubt. Er hatte keinen neuen Weg finden können, und vielleicht würde das auch ihr nicht gelingen. Starb sie aber auf der Suche nach diesem Weg, so konnte sie sich keinen besseren Grund vorstellen.
Sie wandte sich vom Friedhof ab und ging durch das Dorf zurück. Im Vorübergehen sah sie in die zerstörten Hütten, weil sie neugierig war, was wohl übrig geblieben war. Meist waren es Teller und Tassen, Töpfe und Werkzeuge. Ein paar verrottende Kleider und schimmelnde Puppen. Sie ging in ihre eigene Hütte und fand die Truhe mit ihren Schätzen. Das Holz war vom Feuer geschwärzt, das die imperialen Soldaten gelegt hatten, aber der Inhalt, vor allem Muscheln und Knochen, war unberührt. Sie dachte darüber nach, ein paar an sich zu nehmen, aber als sie eine der Muschelschalen in die Hand nahm, schien sie ihr unnatürlich schwer. Sie erinnerte sich daran, dass sie hier war, um eine Bürde abzulegen und keine neue an sich zu nehmen.
Das Heim von Shamka, dem Dorfältesten, war das größte und stabilste. Es hatte besser überdauert als die anderen Hütten. Selbst das Dach, mit sich überlappenden Schieferplatten gedeckt, war noch ganz. Als Kind war es ihr nie erlaubt gewesen, sein Heim zu betreten, und so konnte sie jetzt nicht widerstehen und warf einen Blick hinein.
Seine Unterkunft mit dem eisernen Bettgestell und einer Federmatratze war kaum üppig zu nennen, aber vermutlich war sie dennoch Gegenstand des Neids für alle anderen Dorfbewohner gewesen. Keine Bücher, natürlich. Keiner in ihrem Dorf hatte lesen können. Aber es gab einen gut gearbeiteten Tisch und ein Schränkchen aus einem Holz, von dem sie sicher war, dass es nicht auf der Insel wuchs.
Sie inspizierte diesen »Reichtum« mit einem spöttischen Vergnügen, bis zwei Gegenstände auf dem obersten Regalbrett des Schranks ihre Aufmerksamkeit auf sich zogen. Der erste war eine kleine Handsichel. In die Klinge war eine Inschrift geritzt, doch die Sprache war ihr nicht vertraut. Neben der Sichel lag eine bemalte Holzmaske mit einer spitzen Schnauze, die mit echten Tierschnurrhaaren und scharfen Fangzähnen geschmückt war. War es ein Wolf oder ein Hund?
Sie nahm die Maske runter und untersuchte sie sorgsam. Nein, vielleicht war es ein Schakal.
Sie hatte vorgehabt, zum Kloster auf Galemoor zurückzukehren, wenn sie auf der Insel fertig war. Doch die Gegenstände, die sie in Shamkas Hütte gefunden hatte, ließen Vikma Brueas Behauptung, dass die Leute der Südlichen Inseln eine direkte Verbindung zu den Schakallords und zur Nekromantie besaßen, glaubwürdig erscheinen. Und so auch zu den Hunderten von Mädchen, die auf Morgenlicht ermordet worden waren.
Dieser Gedanke hatte sie seit Monaten verfolgt, seit dem Kampf, aber sie hatte keinen Beweis dafür finden können. Sie hatte in der Bibliothek von Galemoor nachgesehen, die zweitgrößte im Imperium. Doch alles, was sie gefunden hatte, war eine zerbröselnde Schriftrolle, auf der eine recht poetische Darstellung der Gründung des Imperiums verfasst war. Sie sprach von »Engeln« mit goldenen Haaren aus einer anderen Welt, die Cremalton dabei geholfen hatten, die Inseln zusammenzuführen. Allerdings sagte sie nichts darüber aus, wie sie dabei geholfen hatten oder was danach mit ihnen geschehen war. Sie schienen wenig mehr als eine Fußnote in der Geschichte des Imperiums zu sein. Sie konnte nicht einmal sicher sein, dass diese goldhaarigen Menschen eine Verbindung zu den Schakallords oder den Menschen der Südlichen Inseln aufwiesen.
Sie wusste, dass es Informationen über die Herkunft der Schakallords in der Bibliothek in Steingrat geben könnte, aber das war der letzte Ort im Imperium, an dem sie jetzt sein wollte. Progul Bon hatte behauptet, dass Red »so verändert« war, dass sie ihn nicht einmal wiedererkennen würde. Und da Biomanten nicht logen, wusste sie, dass seine Worte wahr sein mussten. Nachdem sie Filler, Sadie und sozusagen auch Nessel verloren hatte, glaubte sie nicht, es ertragen zu können, Red von der Biomantie so pervertiert zu sehen.
Sich dem Beweis, dass sie Red im Stich gelassen hatte, nicht zu stellen, war natürlich feige. Doch wenn sie aus den anderen Fehlern, die sie kürzlich begannen hatte, etwas gelernt hatte, dann dass sie ihre Grenzen kennen musste, sowohl die emotionalen als auch die physischen. Und da die Behauptung des Schakallords sie zwar beunruhigt hatte, schien es doch nicht wichtig genug, eine Reise quer durch das Imperium zu der einen Insel zu rechtfertigen, vor der sie sich fürchtete.
Doch der Beweis, den sie in Shamkas Hütte gefunden hatte, verlieh diesem Gedanken eine neue Dringlichkeit. Die Sichel sah aus wie die, die Vikma Bruea in der Hand gehalten hatte, als er die Kehlen der unschuldigen Mädchen auf Morgenlicht durchschnitten hatte, und je länger sie die hölzerne Maske untersuchte, desto offensichtlicher erschien es ihr, dass es sich um einen Schakal handelte.
Vielleicht waren es nicht die Bibliotheken, in denen sie nachsehen musste. Immerhin waren die meisten Menschen der Südlichen Inseln des Lesens unkundig. Vielleicht musste sie stattdessen mit ihren Verwandten sprechen. Und so kehrte sie nicht nach Galemoor zurück, sondern fuhr weiter gen Osten zu der Nachbarinsel namens Möwenschrei.
Es war Sommer und das Eis deshalb so offen, dass sie die Insel innerhalb weniger Tage erreichte. Sie machte ihr Boot an dem kleinen Steg fest und lief das kurze Stück zum Dorf. Als sie sich umsah, fühlte sie sich wie in einem Traum, denn es sah hier fast genauso aus wie in ihrem alten Dorf, nur dass hier Leben herrschte. Die Menschen trugen einfache, grobe Kleider, an die sie sich so gut aus ihrer Kindheit erinnerte. Viele arbeiteten neben ihren Hütten aus Lehm und Stein, räucherten Fisch oder kochten Walspeck aus, um Öl daraus zu gewinnen.
Die Menschen sahen sie mit wachsamen blauen oder grünen Augen an. Ihre Gesichter waren vom harten Leben der Südlichen Inseln gezeichnet, was der graue Sand, der seinen Weg in jede Falte und jeden Riss in ihren blassen Gesichtern gefunden hatte, nur noch betonte. Auf gewisse Art sah Hope aus wie sie, und doch hoben ihre schwarze Robe und ihre mechanische Hand sie von den anderen ab. Zudem war es in einem so kleinen Dorf ungewöhnlich, jemanden zu sehen, mit dem man nicht aufgewachsen war.
Sie blieb vor einer Hütte stehen, in deren Tür eine ältere Frau saß und ein Fischernetz ausbesserte.
»Entschuldigt. Mein Name ist Hope. Darf ich fragen, wo ich Euren Ältesten finde?«
Die Frau sah mit wässrigen Augen zu ihr auf, doch ihre Finger unterbrachen ihre Arbeit nicht. »Das wär’ dann Maltch, junge Miss. Was braucht Ihr von ihm?«
»Ich bin von der Nachbarinsel«, sagte Hope. »Und ich wollte ihm eine Frage über die Geschichte unserer Leute stellen.«
»Nachbarinsel, hm?« Ihre alten Finger fuhren mit der Arbeit fort, sie waren erstaunlich flink, bedachte man, wie knotig sie aussahen. Ihre Miene verriet nichts. »In welcher Richtung?«
»Westlich.«
»Ist das so?« Wieder sah sie auf ihre Arbeit hinab, die Miene immer noch unverändert. Nach einem Augenblick sagte sie: »Ich schätze, dann hast du wohl keinen eigenen Ältesten mehr, um ihn zu fragen.«
»Nein«, erwiderte Hope. »Habe ich nicht.«
»Hab’ nicht gedacht, dass es Überlebende gab.«
»Nur mich«, antwortete Hope.
Die Frau fuhr schweigend mit ihrer Arbeit fort. »Maltch ist da unten. Drittletzte Hütte auf der rechten Seite. Kannst es nicht übersehen. Größtes Heim auf Möwenschrei«, sagte sie dann.
»Danke.« Hope wandte sich um und lief in die Richtung, die die Frau ihr genannt hatte.
»Hab die Leute von Bleak Hope früher einmal im Jahr gesehen«, rief die Frau da.
Hope blieb stehen und wandte sich wieder zu ihr um.
Das Gesicht der Frau war nun ein wenig zerfurchter, während sie ihre Arbeit untersuchte. »Wir hielten am Ende des Sommers ein Fest ab, bevor das Wasser unpassierbar wurde, und die beiden Dörfer kamen immer für eine große gemeinsame Feier zusammen.« Sie sah zu Hope auf, und ihre Miene wurde vielleicht ein bisschen weicher. »Deine Leute werden vermisst.«
Die Frau machte sich wieder an ihre Arbeit, aber Hope stand da und sah ihr noch eine Weile zu. In ihrer Erinnerung war das Massaker an ihrem Dorf immer etwas gewesen, das in Abgeschiedenheit geschehen war. Etwas, das niemand sonst bemerkt hatte oder auch nur jemand anderen geschert hätte. Der Gedanke, dass die Bewohner Bleak Hopes vermisst wurden, wenn auch nur von den Menschen des nächsten bescheidenen Dorfs, war ihr nie zuvor in den Sinn gekommen. Jetzt ließ der Gedanke sie verblüfft und seltsam dankbar zurück. Sie stand mehrere Minuten einfach so da, bevor sie sich wieder umwandte und zu Maltchs Heim lief.
Das Haus dieses Ältesten war Shamkas recht ähnlich, es war mehr aus Stein als aus Lehm erbaut, und das Dach würde selbst beim raustem Wetter nicht undicht. Sie klopfte mit ihrem Haken an die Tür und merkte zu spät, dass das Geräusch den Bewohner aufschrecken könnte.
Es dauerte ein paar Augenblicke, aber dann öffnete sich die Tür langsam, und ein alter Mann musterte sie misstrauisch.
»Ich komme von Bleak Hope, und ich habe eine Frage zur Geschichte unserer Leute.«
Er musterte sie eine Weile, als begriffe er erst langsam, was sie sagte und wie sie aussah, und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Am längsten verweilte sein Blick auf dem Metallhaken, den sie statt einer Hand hatte.
Schließlich sagte er: »Bleak Hope, hm?«
»Ja.«
»Was hast du die ganze Zeit über gemacht?«
»Überlebt.«
Die lose, faltige Haut an den Winkeln seines Munds und der Augen verzogen sich zu etwas, das ein Lächeln sein mochte. »Was willst du wissen?«
Sie nahm die behelfsmäßige Schultertasche ab, öffnete sie und zeigte ihm die Sichel und die Maske darin.
»Was ist das?«
Er musterte die beiden Gegenstände sogar noch länger, als er sie gemustert hatte.
»Es tut mir leid«, sagte er schließlich. »Das kann ich nur dem erzählen, der meinen Platz einnehmen wird. Niemandem sonst. Nicht einmal der Überlebenden von Bleak Hope.«
Jetzt war es an ihr, ihn anzustarren. Er hatte nicht einmal versucht, Ahnungslosigkeit vorzutäuschen. Er wusste etwas. Sie war sicher, dass sie es mit Gewalt aus ihm herausbringen konnte. Der Drang war da. Eine Klinge an der Kehle würde ihn rasch zum Reden bringen. Oder ihn einfach ein paarmal gegen den Türrahmen zu stoßen.
Aber so wollte sie die Dinge nicht mehr angehen.
»Ich dachte, wir wären ein einfaches Volk, ohne Geheimnisse oder List«, sagte sie.
Sein Blick hielt ihrem stand, unbeirrbar und kalt. »Das dachtest du?«
Sie versuchte es anders. »Ich habe Gold …« Sie griff nach der Börse an ihrem Gürtel.
»Und was soll jemand so weit hier unten mit imperialen Münzen anfangen?«
Seine Stimme troff vor Hohn, und das wohl zu Recht. Hope hätte es besser wissen sollen. Das hier war eben nicht die Unterstadt von New Laven. Die Leute betrieben Handel oder tauschten. Geld nützte ihnen auf den Südlichen Inseln nichts.
»Tut mir leid …«, sagte sie ungeschickt. »Ich bin nur …«
»Ich weiß nicht, was du tun musstest, um zu überleben. Ich gehe davon aus, dass es nicht erfreulich war«, sagte er. »Aber das verleiht dir keine besonderen Rechte. Wir alle leiden. So ist es eben. Und jetzt gehst du am besten dahin zurück, wo auch immer du hergekommen bist.«
Er wandte sich ab und schickte sich an, die Tür zu schließen.
Wieder raste der Drang, Gewalt anzuwenden, durch Hope hindurch. Ein rascher Schlag in den Magen würde ihn sehr viel gefügiger machen. Aber sie schluckte ihre Wut und ihre Ungeduld hinunter. Stattdessen fragte sie: »Ist die Antwort so schändlich?«
Er blieb im Türrahmen stehen, den Rücken ihr zugewandt. Er antwortete nicht, holte nur langsam und tief Luft. Das feuchte Gurgeln ließ Hope sich fragen, wie viel Zeit ihm noch blieb, und ob er seinen Nachfolger bereits gefunden hatte. Jemanden, dem er das schreckliche Wissen auflasten konnte, was es auch war.
»Ich werde dir etwas sagen«, meinte er schließlich. »Du könntest die Antwort auf diene Frage auf Höhenlage finden.«
»Höhenlage?« Das war die Insel, von der Vikma Burea ihr erzählt hatte, auf die die Schakallords verbannt worden waren.
»Halte dich von hier aus gen Osten«, sagte Maltch. »Wenn du zu einer Insel kommst mit nichts als Eis im Süden und im Osten nur Wasser, dann bist du dort.«
»Was finde ich dort?«
»Vielleicht nichts. Vielleicht mehr, als du wolltest. Egal, wie, mach dich besser auf den Weg. Der Sommer ist fast vorbei, und sobald die dunkle Jahreszeit anbricht, kommt niemand mehr von diesem gottverlassenen Ort herunter.« Er sah über die Schulter zu ihr zurück und beäugte die Sichel und die Maske in der Umhängetasche. »Und bedecke die. Zeige sie niemandem sonst auf dieser Insel. Verstanden?«
Hope nickte wortlos. Sie verstand jetzt immerhin eine Sache. Es war so schändlich.
Höhenlage war die unwirtlichste Insel, die Hope je gesehen hatte. Es sah aus wie eine kleine Gebirgskette, die sich aus dem Wasser erhob. Sie konnte kein ebenes Gelände erkennen. Das einzige Blattwerk waren die rauen Dornensträucher, die sich stur an die Felsen klammerten. Wie konnte hier jemand leben?
Sie fand eine winzige Landzunge mit einem grauen Strand für ihr Boot. Dann hielt sie nach dem niedrigsten Gipfel Ausschau und begann ihren Aufstieg. Sie kletterte den ganzen Tag ohne Pause, doch mit ihrem Haken war sie langsam, und so hatte sie bei Sonnenuntergang nur die Hälfte des Aufstiegs geschafft. In dieser Nacht ruhte sie auf einem kleinen kalten Felsen, der aus dem Berg herausragte.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, war ihre schwarze Robe von Frost bedeckt. Ihre Glieder waren steif, während sie den Anstieg erneut begann, aber sie lockerten sich, als ihr von der Anstrengung warm wurde. Sie erreichte die Schneegrenze am Mittag, kurz danach kam sie am Gipfel an. Höhere Gipfel erstreckten sich zu beiden Seiten, aber jetzt konnte sie sehen, dass sich in der Mitte der Insel ein Tal befand, das beinahe auf Meereshöhe lag. Das Tal war vom Wind geschützt, und Sonnenstrahlen fielen hinein. Als sie ihren Abstieg begann, wurde die Luft spürbar wärmer.
Der Talboden war von dichtem, dunkelgrünem Gewächs überwuchert. Während sie durch das kniehohe Gras watete, suchte sie nach einem Zeichen für Bewohner. Dem Tal war eine einfache Schönheit eigen, mit gelben, lila und weißen Wildblumen, die aus kleinen Bäumen wuchsen, und harten roten Beeren, die an Büschen leuchteten. Hope nahm an, dass es hier im Winter genauso rau und unerbittlich war wie auf dem Rest der Südlichen Inseln, aber in den Sommermonaten schien es ein verborgenes Paradies zu sein. Wenn die Schakallords hierher verbannt worden waren, so hätten sie an wahrlich schlimmere Orte geschickt werden können.
Nachdem sie eine Stunde lang gelaufen war, sah sie eine große Höhle, die sich in der Felswand an der Ostgrenze des Tals auftat. Die gleichen, ihr unbekannten Buchstaben, die auf der Sichel standen, waren in den Felsen um den Eingang der Höhle geritzt. Das hätte ihre Aufmerksamkeit fesseln können, doch darunter war etwas noch Interessanteres.
Oder besser gesagt: jemand.
Ein Junge von etwa fünf oder sechs Jahren saß im Gras vor dem Eingang der Höhle. Seine nackten blassen Beine ragten aus einem rauen grauen Kittel heraus, und er saß mit gekreuzten Beinen da. Seine Füße steckten in schweren schwarzen Stiefeln, die an ihm fast schon komisch groß wirkten. Sein struppiges Haar war unheimlich knochenweiß, heller selbst als das typische blonde Haar der Menschen von den Südlichen Inseln. Sein Kopf war nach vorn geneigt, sodass sie sein Gesicht nicht sah. Er hielt etwas Kleines, Dunkles im Schoß, und er summte fröhlich und zugleich verstörend vor sich hin.
Hope näherte sich dem Jungen langsam, um ihn nicht aufzuschrecken. Als sie herankam, bemerkte sie, dass das Ding im Schoß des Jungen ein toter Vogel war. Sie bemerkte auch das Aufblitzen von Metall im Gras neben ihm, vielleicht ein Messer oder ein anderes Jagdwerkzeug.
Sie war davon ausgegangen, dass der Vogel tot war, weil er so ruhig in seinen Händen gelegen hatte. Aber plötzlich bewegte er sich. Der Junge lachte erfreut auf und entließ ihn hinauf in den Himmel. Er stützte sich auf die Hände und lehnte sich zurück, lächelte hinauf zu dem Vogel, der über ihm kreiste. Merkwürdigerweise flog der Vogel jedoch nur immer weiter im Kreis, und sein Kopf war in einem unnatürlichen Winkel zur Seite gebogen.
»Wer bist du?«, fragte der Junge mit zwitschernder Stimme. Die Art, wie er sie starr angrinste, hatte etwas Raubtierhaftes, beinahe Gestörtes an sich. Jetzt erkannte sie, dass seine nackten Arme und Beine von dünnen rosafarbenen Narben bedeckt waren, als ob er unzählige Male geschnitten worden wäre. Vielleicht von Vikma Bruea? War das der Sohn des Schakallords oder ein Opfer seiner Grausamkeit?
Sie zog ihre Kapuze zurück und betrachtete ihn einen Augenblick. »Du kannst mich Hope nennen, wenn du möchtest.«
Er zeigte mit dem Finger auf sie. »Du bist ein Mädchen!«
Sie nickte.
Er hielt weiter den Finger auf sie gerichtet. »Dann bist du nicht mein Lord. Er ist ein Junge.« Er schien sehr zufrieden mit dieser Schlussfolgerung.
»Wie ist dein Name?«, fragte sie und trat näher.
»Ich werde Uter genannt.« Dann wurde seine Miene flehentlich. »Wirst du mein Freund sein?«
»Vielleicht«, sagte sie.
»Hurra!«
Mit überraschender Geschwindigkeit packte er das Messer, das neben ihm im Gras lag. Es sah aus wie die kleine Sichel, die sie bereits kannte. Immer noch lächelnd warf er sich nach vorn und hieb nach ihrer Kehle. Sie lehnte sich zurück und wich der gebogenen Klinge aus.
Einen Moment lang sah er überrascht aus, weil sie seinem Angriff entkommen war. Dann verzog sich sein Gesicht zu einem Schmollen.
»Ich dachte, du bist mein Freund!« Er drang mit einer Reihe rascher Hiebe auf sie ein, und die Klinge zischte in der Luft.
»Das habe ich nie versprochen.« Sie wich ruhig jedem Schlag aus, zog sich jedoch nicht zurück. »Und überhaupt, wie können wir Freunde sein, wenn ich tot bin?«
»Dummerchen, so werden wir doch Freunde.«
Sie wich seinen Angriffen weiter aus und dachte einen Augenblick darüber nach. »Was, wenn ich einen besseren Weg kenne, um dein Freund zu sein?«
Er hörte jäh auf. Seine Augen wurden schmal. »Was für ein Weg?«
»Warum erklärst du mir nicht, wie du es kennst, und ich erkläre dir, was ich weiß, und dann entscheiden wir gemeinsam, welcher Weg besser ist.«
Das wahnsinnige Grinsen kehrte auf sein Gesicht zurück. »Wie ein Wettkampf?«
»Sicher«, stimmte Hope zu.
»Okay, großartig!« Er ließ sich wieder zu Boden fallen und streckte die großen Stiefel von sich, während er die Sichel nachlässig ins Gras fallen ließ. »Mein Weg ist es, sie zu töten, und sie dann wieder ins Leben zu holen. Wenn ich das mache, tun sie immer, was ich sage.«
Hope blickte zu dem Vogel hinauf. »Hast du das mit dem Vogel gemacht?«
»Na klar!« Er legte sich ins Gras, streckte Arme und Beine aus und sah zu dem Vogel.
»Das scheint auf jeden Fall wirkungsvoll zu sein«, sagte Hope.
»Also gewinne ich?« Er griff nach seiner Sichel.
»Du musst dir erst meinen Weg anhören.«
»Stimmt!« Er ließ die Sichel wieder ins Gras fallen, rollte sich auf den Bauch, blickte zu ihr auf und stützte dabei das Kinn in die Hände. »Du bist dran!«
»So finde ich meine Freunde«, sagte Hope. »Ich mache nette Dinge für dich, und du machst nette Dinge für mich.«
Uter sah weiter zu ihr auf, bis er begriff, dass das alles war, was sie zu sagen hatte. Dann wurden seine Augen groß. »Das ist es?«
»Das ist es.«
»Und … wann hört das auf?«
»Solange wir nette Dinge füreinander tun, muss es niemals enden.«
»Du meinst, deine Freundschaft ist für immer?«
»Das kann sie sein.«
Er ließ den Kopf zu Boden sinken. »Fein«, sagte er dann. »Du hast gewonnen.«
»Dein Weg hält nicht so lange an, vermute ich?«
Er schüttelte den Kopf, die Stirn immer noch in den Schmutz gedrückt. Ohne aufzusehen, deutete er zielsicher auf den Vogel, und sein Finger folgte den langsamen Kreisen. »Sieh nur. Es ist fast vorbei.«
Hope sah zu, wie der Vogel noch ein paar Runden drehte. Dann fiel er vom Himmel, plötzlich wieder leblos.
»Ist es schwer, ihn wieder lebendig zu machen?«
»Nö.«
»Ich dachte, es dauert Tage, und der Körper müsste mit unterschiedlichen Chemikalien behandelt werden.«
Er hob den Kopf und lächelte wieder. Auf seiner geisterhaft weißen Stirn war ein großer Schmutzfleck. »Das ist der normale Weg. Aber ich habe einen besonderen Weg.«
»Einen besonderen Weg?«
»Ja. Weil ich einer Wesung unterzogen wurde!«
»Wesung?«
»Ich zeige es dir.« Er nahm die Sichel und klemmte sie zwischen die Zähne, dann robbte er durch das Gras zu dem toten Vogel. Er setzte sich wieder mit überkreuzten Beinen hin und legte sich den Vogel in den Schoß. Dann schlitzte er sich mit der Sichel die Handfläche auf und warf die Klinge beiseite. Er hielt die Handfläche, aus der jetzt Blut floss, über den Vogel und ließ das Blut auf den geöffneten Schnabel und die Augen tropfen. Dann blickte er in freudiger Erwartung grinsend auf den Vogel herab.