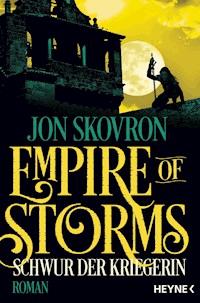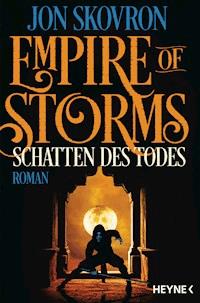
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Empire of Storms-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Imperium der Stürme ist ein gewaltiges Reich, das von einem gottgleichen Kaiser regiert wird - und von den Biomanten, mächtigen Zauberern, die einen Menschen mit nur einem Wimpernschlag töten können. Der junge Straßendieb Red soll von ihnen zum Assassinen ausgebildet werden, im Gegenzug dafür schenkten die Magier seiner großen Liebe Hope die Freiheit. Noch während Red versucht, das Spiel der Intrigen und Ränke am Kaiserhof mitzuspielen, segelt Hope als Piratenkönigin Dire Bane die Küste entlang. Doch dann stößt sie auf eine gewaltige Verschwörung der Biomanten, die Red in tödliche Gefahr bringt. Eine Verschwörung, die sogar das Imperium der Stürme in den Untergang reißen könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Ähnliche
Jon Skovron
SCHATTEN DES TODES
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michelle Gyo
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Eine Piratenkönigin
Ein Magierlehrling
Ein gewaltiges Abenteuer
Einst haben sich die junge Vinchen-Kriegerin Hope und ihre große Liebe, der gerissene Straßendieb Red, geschworen, das Imperium der Stürme von der Herrschaft der Biomanten zu befreien und die Zeiten von Ungerechtigkeit, Willkür und Gewalt ein für alle Mal zu beenden.
Dann opferte Red seine Freiheit, um Hopes Leben zu retten und begab sich in die Hand der Biomanten. Einen Assassinen wollen sie nun aus ihm machen. Einen Schatten des Todes – lautlos und gefährlich. Je tiefer Red in die Politik des Kaiserreiches eingebunden wird, desto mehr begreift er, dass die Intrigen am Hof manchmal tödlicher sind als eine geschliffene Klinge.
Währenddessen verbreitet Hope unter dem Piratennamen »Dire Bane« Angst und Schrecken auf den Meeren. Eines Tages erfährt sie auf ihren Raubzügen von einer riesigen Verschwörung der Biomanten, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Ein Komplott, dass das Imperium der Stürme in den Untergang reißen könnte – und damit auch Red! Hope fasst einen mutigen Entschluss: Sie wird eine Piratenarmee aufstellen und Red befreien …
Der Autor
Jon Skovron wurde in Columbus, Ohio, geboren. Er arbeitete unter anderem als Schauspieler, Musiker und Webdesigner, doch seine wahre Leidenschaft gehörte schon immer dem Schreiben. In seiner Heimat Amerika hat er sich mit verschiedenen Jugendbüchern und Kurzgeschichten bereits einen Namen gemacht, bevor er mit Empire of Storms – Der Pakt der Diebe seinen ersten Fantasy-Roman für Erwachsene veröffentlichte. Der Autor lebt in der Nähe von Washington D.C.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: BANE & SHADOW – THE EMPIRE OF STORMS Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 11/2017 Redaktion: Catherine Beck Copyright © 2016 by Jon Skovron Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München Karte © 2017 by Tim Paul Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von tsuneomp/Shutterstock, Pikoso.kz/Shutterstock und Igor Zh./Shutterstock Satz: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-19426-0V001www.heyne.de
Zum Andenken an Eve Reinhardt Caripedes, tapferste Kriegerin
ERSTER TEIL
»Weder das Schicksal noch der Zufall allein kontrollieren unser Geschick. Vielmehr ist es der Zusammenprall dieser schrecklichen Mächte, die unsere Leben und auch unser Vermächtnis auf brutale und grausame Weise gebären.
Und was ist mit der Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen? Ich habe noch nie einen überzeugenden Beleg dafür gesehen, dass sie auch nur den kleinsten Unterschied macht.«
– Aus den geheimen Schriften des Dunklen Magiers
1
Es war nicht Brice Vadertons erster Einsatz, aber es kam ihm fast so vor, weil er zum ersten Mal eine imperiale Fregatte als Kapitän befehligte. Die Wächterin war brandneu, ein dreimastiges Kriegsschiff mit Rahsegeln und zweiundvierzig Kanonen. Es war fast um die Hälfte größer als sein letztes Schiff, und es hatte zweimal so viel Feuerkraft.
Kapitän Vadertons Quartier war groß genug für ein Schreibpult, eine Doppelkoje und eine Liege. Er hätte seine Frau mit an Bord bringen können, wäre er verheiratet gewesen, genug Platz gab es dafür. Die Kabine lag im Heck unter dem erhöhten Hüttendeck. Sie verfügte über mehrere große Bullaugen, durch die man den hellen, wolkenlosen Himmel und das sich kräuselnde dunkelgrüne Wasser bis zum Horizont überblickte. Dafür, dass sie an der westlichen Grenze des Imperiums segelten, hatten sie ungewöhnlich gutes Wetter, vor allem für diese Jahreszeit. Sobald der Spätsommer in den Herbst überging, wurde diese Region normalerweise von plötzlich auffrischenden, unberechenbaren Winden und eisigem Regen gepeitscht. Sie hatten jedoch klaren Himmel und einen beständigen, leicht anpackenden Wind. Vaderton erwartete nicht, dass dies anhielt, aber er nahm es, solange er es hatte.
Der Kapitän saß an seinem Pult und brachte seine Logbücher auf den neuesten Stand. Er führte die Aufzeichnungen peinlich genau, und seine Vorgesetzten hatten ihm mitgeteilt, dass dies einer der Gründe gewesen war, der sie davon überzeugt hatte, ihm trotz seines Alters eines der größten Schiffe des Imperiums anzuvertrauen. Vaderton hatte gerade sein vierzigstes Jahr gefeiert und war jetzt der jüngste Offizier, der je das Kommando über eine imperiale Kriegsfregatte erhalten hatte. Er hatte vor, ihnen zu beweisen, dass sie ihm ihr Vertrauen nicht umsonst geschenkt hatten. Als Teil der großen imperialen Kontrollflotte lautete seine Order, die westliche Grenze des Imperiums bis zu der Meerenge hinabzusegeln, die die Südlichen Inseln vom Rest des Imperiums trennte, und sich dann gen Osten zu wenden und Vance’ Posten anzusteuern. Unterwegs sollte er jeden Hafen anlaufen, um einerseits die jährlichen Berichte über die Bevölkerungszählung einzuholen und andererseits die neue, prächtige Stärke der Imperialen Marine vorzuführen. So einfach diese Tour war, Vaderton hatte dennoch vor, sie streng nach Vorschrift auszuführen, ohne Ausnahme.
Er sah auf die Uhr. Neun Uhr. Zeit für seine morgendliche Inspektion an Deck. Er stand auf und zog seine schwere weiße Jacke an. Trotz der Spätsommerhitze, die noch in der Luft hing, mochte er ihr Gewicht. Die Steifheit des Goldbrokats vorn und die goldenen Epauletten an den Schultern sorgten dafür, dass er sich fühlte, als beschützte ihn die Macht der gesamten imperialen Marine. Er glättete sein kurzes, nach den Regularien der Marine gestutztes Haar, nahm seine Kapitänsmütze und setzte sie fest auf den Kopf. Sie war ebenfalls weiß mit goldenen Verzierungen. Er hatte gesehen, wie andere Kapitäne den Hut in den Nacken geschoben trugen. Das machte eine gute Figur, aber es war schrecklich unpraktisch. Die erste heftige Windbö würde sie hinaus auf See wirbeln. Auf der Akademie hatten ihn einige seiner Klassenkameraden damit aufgezogen, weil er sich über solch winzige Kleinigkeiten Gedanken machte. Allerdings hatte auch keiner von denen schon das Kommando über eine Fregatte erhalten, deshalb war er überzeugt, dass sein Weg der richtige war.
Vaderton öffnete die Tür und trat hinaus auf das Achterdeck.
»Kapitän an Deck!«, rief Seeoffiziersanwärter Kellert. Jeder an Deck, der seine Arbeit niederlegen konnte, tat ebendas und salutierte Kapitän Vaderton zackig. Erst einen Monat auf See, und sie entwickelten sich schon zu einer feinen Mannschaft. Zählte man die Kanoniere mit, so bestand die Besatzung der Wächterin aus etwa zweihundert Mann, mehr als dreimal so viele wie auf seinem letzten Schiff. In der Vergangenheit hatte er immer Wert darauf gelegt, den Namen jedes Einzelnen zu kennen. Das war jetzt unmöglich, aber als er über das Deck blickte, sah er jedem von ihnen kurz in die Augen. Es war ebenso wichtig, gutes Benehmen anzuerkennen, wie schlechtes zu bestrafen.
»Rührt euch!«, sagte er ernst, und sie machten sich wieder an die Arbeit. Er wandte sich an Kellert, der in seinem weißen Jackett der Imperialen schmuck aussah. Das war ein Streitpunkt zwischen ihnen gewesen, als sie in See gestochen waren. Kellert war von Natur aus eher schlampig und ungepflegt. Kapitän Vaderton hatte angeregt, dass Kellert in der weniger formellen Unterkunft der Besatzung willkommen wäre, wenn er nicht wie ein richtiger Offizier aussehen wollte. Ein paar Nächte in einer Hängematte und das gemeinsame Essen mit den Männern, und die Sache hatte sich schnell erledigt. Eine von Vadertons Pflichten bestand darin, seine Offiziere darauf vorzubereiten, eines Tages dem Imperium als Kapitän auf einem eigenen Schiff zu dienen. Diese Aufgabe nahm er so ernst wie jede andere.
»Bericht, Mr. Kellert«, sagte er, während er die Männer bei ihrer Arbeit an Deck musterte.
»Alles klar, Kapitän.« Kellert lächelte kurz und sagte dann: »Nun ja, außer dem Geisterschiff.«
Kapitän Vaderton erwiderte das Lächeln nicht. »Was meint Ihr mit ›Geisterschiff‹, Mr. Kellert?«
»Oh, es ist nichts, Sir. Der junge Jillen, der die Nachtwache oben im Krähennest hält, hatte gedacht, kurz vor Sonnenaufgang ein Schiff in der Ferne gesehen zu haben. Doch als er zu mir hinunterrief, konnte ich mit dem Glas nichts entdecken. Er ist wahrscheinlich nur kurz weggedöst, aber die Männer ziehen ihn seither damit auf, dass er ein Geisterschiff gesehen hätte. Um dem armen Jungen Angst einzujagen.«
»Er bleibt dabei, dass er das Schiff gesehen hat?«, fragte Kapitän Vaderton.
Kellert wirkte jetzt, als fühlte er sich etwas unbehaglich. »Ich nehme es an, Sir.«
»Ihr nehmt es an? Habt Ihr ihn nicht weiter befragt? Vielleicht nach Einzelheiten zu dem Schiff, das er gesehen hat?«
»Der Junge ist erst zwölf Jahre alt. Das kann alles gewesen sein, Sir.« Kellert begann, ernsthaft nervös auszusehen.
»Alles beinhaltet auch Piraten, Mr. Kellert.«
Kellert wurde blass. »Ja, Sir. Möchtet Ihr, dass ich ihn jetzt befrage?«
»Schickt ihn zu mir. Ich werde es selbst tun.«
»Ja, Sir«, antwortete Kellert kleinlaut.
Kapitän Vaderton nickte, dann blickte er dem Offiziersanwärter nach, während der davoneilte. Er befand, dass sein Schützling noch einen weiten Weg vor sich hatte.
Gemessenen Schrittes ging Vaderton über das Achterdeck, dann hinunter auf das Hauptdeck. Er beobachtete, wie sich die Besatzung um ihn herum mit angespannter Sorgfalt bewegte, und bewunderte, dass diese Männer – keiner für sich genommen interessant oder bemerkenswert – zusammengebracht werden und gemeinsam die einschüchternde Aufgabe vollbringen konnten, eines der mächtigsten Schiffe im ganzen Imperium zu segeln.
Er erklomm die kurze Leiter zum Vorderdeck und stellte sich so, dass er über das kabbelige grüne Wasser bis zum Horizont blicken konnte, wo es auf den glatten blauen Himmel traf. Für gewöhnlich behielt Kapitän Vaderton seine Gedanken und Gefühle für sich. Aber der Anblick der offenen See und der Geruch des salzigen Winds erweichte seine Haltung, wenn auch nur ein wenig.
»Ihr wünscht mich zu sehen, Sir?«, fragte eine helle Stimme.
Kapitän Vaderton wandte sich um und betrachtete Jillen. Der Junge war eigenartig, weshalb Vaderton sich wahrscheinlich auch an ihn erinnerte. Er war ungewöhnlich klein und zierlich gebaut, selbst für einen Jungen seines Alters. Er sprach in dem undeutlichen Tonfall von jemandem, der in den Armenvierteln von New Laven geboren worden war, aber für solch eine bescheidene Herkunft war er erstaunlich intelligent. Vaderton hatte sogar bemerkt, wie er Bücher und Notizen durchgesehen hatte, als ob er über Grundkenntnisse des Schreibens und Lesens verfügte.
»Mr. Kellert hat mich darüber unterrichtet, dass du während der Mitternachtswache etwas gesehen hast?«, fragte er den Jungen.
»Das habe ich, Sir. Am Heck. Sah wie ein Schiff aus, Sir.«
»Kannst du dieses Schiff beschreiben?«
»Zwei Masten mit jeder Menge Segeln. Hielt auf uns zu. Und da waren keine imperialen Flaggen. Zumindest keine, die ich erkennen konnte.«
»Und hast du das an Mr. Kellert berichtet?«
»Das habe ich, Sir.«
»Und er fand nicht, dass diese Sichtung es wert wäre, mir sofort mitgeteilt zu werden?«
»Soweit ich es verstanden habe, Sir, dachte er, dass ich das geträumt haben muss. Weil, als er geschaut hat, war es verschwunden.«
»Ein verschwundenes Schiff? Das ist dein Bericht?«, fragte Vaderton ernst.
»Ich schätze, ja, Sir.« Jillen sah den Kapitän nervös an. »Ich weiß, das klingt glitschig, aber das habe ich gesehen, Sir.«
Kapitän Vaderton verstand, warum Kellert nicht erpicht darauf gewesen war, ihm das mitzuteilen. Der Seeoffiziersanwärter hielt es für unmöglich. Vaderton hätte vielleicht den gleichen Fehler gemacht, als er jünger gewesen war. Aber wenn ihn die letzten Jahre etwas gelehrt hatten, dann, dass man sich nie darauf verlassen sollte, dass etwas unmöglich war.
»Junger Mister Jillen«, sagte der Kapitän. »Sag mir, was ein Schiff ist.«
»Sir?« Jillen wirkte noch nervöser, sein Blick flitzte umher, als würde er nach einem Fluchtweg suchen.
»Du steckst nicht in Schwierigkeiten«, sagte der Kapitän. »Sag mir nur, mit einfachen Worten, was deiner Meinung nach ein Schiff ausmacht.«
»Es ist ein hölzernes Fahrzeug, das schwimmt und Segel hat, mit denen es den Wind einfängt, damit es vorwärtskommt.«
Kapitän Vaderton nickte. »Nicht schlecht. Aber ein Schiff ist mehr als ein Fahrzeug. Es umfasst auch die Menschen darauf. Sie sind ebenfalls ein Teil des Schiffs. Jeder hat seine Aufgabe, die er für das Wohl des Ganzen ausführen muss. Wenn eines dieser Teile nicht mehr funktioniert, leidet das gesamte Schiff darunter.«
»Wie bei den Bienen«, sagte Jillen.
»Bienen?«, fragte Vaderton überrascht.
»Sicher, man braucht Hunderte Bienen für einen Bienenstock, damit er in Gang bleibt. Jede Biene hat ihre oder seine Aufgabe. Die Bienenkönigin trägt die Verantwortung, aber selbst sie hat eine Aufgabe, die sie erledigen muss. So funktioniert ein Bienenstock.« Jillen strahlte zu ihm empor, dann setzte er ein »Sir« nach.
»Ja«, sagte Vaderton, der sich fragte, wo ein Gassenkind aus New Laven dieses Wissen aufgeschnappt hatte. »Und denken diese Bienen wohl, dass sie ihren Pflichten nicht mehr nachzukommen brauchen und hoffen einfach darauf, dass es die Königin nicht bemerkt oder dass es ihr nichts ausmacht?«
»Natürlich nicht, Sir. Wenn die Bienen aufhören zu arbeiten, könnte der ganze Stock sterben.«
»In der Tat«, sagte Vaderton. »Nun, wenn ein Mensch an Bord eines Schiffs also beschließt, nicht all seinen Pflichten nachzukommen? Sagen wir, er beschließt, selbst zu entscheiden, ob etwas möglich war oder nicht, statt es dem Kapitän zu melden, damit der darüber entscheidet. Dieses Mitglied der Besatzung könnte doch das gesamte Schiff in Gefahr bringen.«
Jillen riss die Augen auf. »Aber Kapitän, ich habe gesagt …«
Kapitän Vaderton hob die Hand, und Jillen verstummte sofort. Schlauer Junge. »Wie ich zuvor sagte, junger Mister Jillen, du steckst nicht in Schwierigkeiten. Aber ich möchte, dass du dir das, was ich gesagt habe, sehr gut merkst und daran denkst, während du dabei zusiehst, wie Offiziersanwärter Kellert seine zehn Hiebe erhält.«
»J-ja, Sir«, stammelte Jillen, sah dabei aber keineswegs weniger verängstigt aus.
Am Mittag wurden alle Mann zusammengerufen, damit sie Zeugen wurden, wie Kellert die Hiebe empfing. Die Sonne brannte hell auf ihre Köpfe herab und ließ Blut und Schweiß auf dem Rücken des Offiziersanwärters, der den Großmast umklammerte, glänzen. Zweifellos fanden einige Männer, dass der Kapitän zu hart vorging, vor allem Kellerts Mitoffiziere, die dazu neigten zu glauben, dass sie über einer solchen Bestrafung stünden. Aber mit dieser öffentlichen Zurschaustellung machte der Kapitän klar, dass er keine schlampige Arbeit duldete, weder von der Besatzung noch von den Offizieren. Außerdem kam diese Lektion auch Kellert zugute. Trotz der großen Schiffe und der grimmig kämpfenden Männer war es doch die eiserne Entschlossenheit der Offiziersklasse, die dafür sorgte, dass die imperiale Marine unermüdlich die Meere befuhr. Und so war es die heilige Pflicht Kapitän Vadertons, sie durch das Feuer der Erfahrung und der Disziplin so zu härten, dass die Kapitäne der Zukunft diesem Anspruch Genüge taten und ebenfalls über einen eisernen Willen verfügten.
Kapitän Vaderton konnte dem Unterfangen jedoch nichts abgewinnen. Er war vielmehr froh, als er merkte, dass Kellert nicht schrie. Selbst als er zu den Offiziersquartieren geleitet wurde, um sich dort zu erholen, war Kellerts Gang gleichmäßig, und er hielt den Rücken gerade und den Kopf erhoben. Er mochte nicht der zuverlässigste Offizier sein, doch er konnte immerhin eine Züchtigung ertragen.
Nachdem die Tortur beendet war und er die Männer auf ihre Posten zurückgeschickt hatte, besetzte Kapitän Vaderton jede Schicht doppelt und gab die Anweisung, dass alle Beobachtungen sofort an ihn höchstpersönlich zu melden wären, ganz gleich, wie unbedeutend oder seltsam sie erscheinen mochten. Dann übernahm er das Steuer. Das war natürlich nicht nötig. Die Wächterin hatte mehrere Steuermänner. Doch hin und wieder genoss Kapitän Vaderton es, das harte Holz des Steuerruders unter den Händen zu spüren, vor allem wenn er eine seiner widerwärtigeren Pflichten ausgeübt hatte. Die Spätnachmittagssonne ließ Funken über die weiß getupfte See tanzen. Er holte tief Luft und gestattete sich, die stetige, sanfte Bewegung des Steuers unter den Händen auszukosten – der Sog des Meeres selbst. Für ihn gab es nichts Erhabeneres auf der Welt.
Langsam wurde sich Kapitän Vaderton bewusst, dass jemand in respektvollem Abstand in seiner Nähe wartete.
»Mister Jillen«, sagte er. »Hast du etwas auf dem Herzen?«
»Ich bitte um Verzeihung, Kapitän.« Jillen blinzelte in der grellen Sonne zu ihm auf.
Die fein geschnittenen Züge des Jungen hätte man fast als hübsch bezeichnen können, dachte Vaderton. Er wusste, dass seine Kameraden dem Jungen bald die Hölle auf Erden bereiten würden, wenn er nicht härter wurde. Doch es war nicht Kapitän Vadertons Aufgabe, den Mitgliedern der Besatzung Verhaltensregeln zu erteilen. Das lag in der Verantwortung des Bootsmanns. Also sagte Vaderton nichts darüber. »Heraus damit, Mr. Jillen. Du hast meine Ruhe bereits gestört.«
»Also, Sir.« Jillen sah ernst zu ihm auf. »Ich wollte nur wissen, was Ihr denkt, was ich gesehen habe. Das verschwundene Schiff, meine ich.«
»Ich weiß es nicht«, sagte der Kapitän. »Aber es gibt seltsamere Dinge auf dieser Welt als Schiffe, die zu verschwinden scheinen, das kann ich dir versichern. Ich habe gesehen, wie das Wetter ohne Warnung umschlägt. Ich habe Riemenfische gesehen, so lang wie dieses Deck. Und einmal habe ich ein riesiges Schiff in der Ferne erblickt, ganz in Metall gekleidet.«
»Ein Schiff aus Metall, Sir? Warum ist es nicht gesunken?«
»Vielleicht handelt es sich um eine Art des Segelns, die uns noch nicht bekannt ist. Vielleicht war es Biomantie.«
»Biomantie, Sir?« Jillen zögerte einen Moment. »Die Männer sagen, Ihr kennt einen, Sir. Einen Biomanten, meine ich. Ist das wahr?«
»Ich bin nicht sicher, ob ein normaler Mensch einen Biomanten kennen kann. Aber eine Zeit lang habe ich einem gedient, und er war zufrieden mit meiner Leistung.« Vaderton wusste, dass viele seiner Genossen darüber tuschelten, dass dies der wahre Grund gewesen sei, aus dem man ihm in so jungen Jahren das Kommando über eine Fregatte übertragen hatte. Die Gunst der Biomanten galt sowohl in der Marine als auch am Hof des Imperators viel.
»Sind es wirklich Zauberer, Sir?«, fragte Jillen. »Sind das nicht nur Tricks?«
Der Kapitän lächelte schwach. »Wusstest du, junger Mister Jillen, dass wir nicht das einzige große und tödliche Ding auf diesen Meeren sind, das Wächter genannt wird?«
»Ich dachte, keine zwei Schiffe könnten den gleichen Namen tragen.«
»Oh, aber ich meine kein Schiff«, sagte Vaderton. »Ich meine das große Meeresuntier, das von den Biomanten dazu erschaffen wurde, die nördlichen Grenzen des Imperiums gegen Eindringlinge zu schützen. Ein schrecklicher Kraken, so groß wie eine Insel, der ein Schiff mit einer seiner mächtigen Tentakeln so leicht zerdrücken kann wie ein Ei.«
»Das klingt unglaublich, Sir.« Jillens Augen waren so groß und rund wie Strudel im Wasser.
»Denk nur an die Kraft dieses Kraken. Und dann stell dir die Macht vor, die man brauchte, um ein solches Ding zu erschaffen. Und so sieht die Macht der Biomanten aus.«
Jillen erschauderte.
»Du wirst feststellen, junger Mister Jillen, dass die Welt voller Wunder und Schrecken ist, die weit jenseits unserer bescheidenen Erwartungen liegen. Wahrscheinlich wirst du vor dem Ende dieser Reise etwas davon zu sehen bekommen.«
Jillen sah verängstigt aus, aber auch außer sich vor Freude. »Das hoffe ich, Sir.«
Vaderton lächelte. »Es ist das Vorrecht der Jugend, Abenteuer zu suchen. Allerdings haben die meisten früher genug davon, als sie gedacht hätten.«
»Ich nicht, Sir«, sagte Jillen, das schmale Gesicht voller Zuversicht. »Ich werde bis ans Ende meiner Tage danach suchen.«
Kapitän Vaderton nickte. »Möge es immer so sein, junger Mister Jillen.«
Es dämmerte schon fast, als ein Ruf aus dem Krähennest drang. Kapitän Vaderton hielt sich wieder in seinem Quartier auf und speiste allein, wie es seine Gewohnheit war. Eine Faust hämmerte wie wahnsinnig gegen seine Tür. »Wir werden angegriffen, Kapitän!«
Kapitän Vaderton schnappte sich seinen Mantel und die Mütze, dann stieß er die Tür auf. »Wie viele?«, herrschte er den aschfahlen Offizier an. »Sind es Piraten?«
Der Offizier schüttelte den Kopf, er stammelte bei dem Versuch, die Worte herauszubekommen. »Geisterschiff!«
»Beruhigt Euch.« Vaderton schob den Offizier so heftig beiseite, dass der junge Mann zu Boden ging. Vaderton eilte bereits über das Achterdeck, während er sich noch den Mantel überstreifte. Hecker stand am Steuer und umklammerte das Ruder, sodass seine Knöchel weiß hervortraten.
»Bericht!«, blaffte der Kapitän.
»Es nähert sich von backbord, Sir.«
»Gebt mir Euer Glas.«
Hecker reichte es ihm. »Ihr werdet es aber nicht brauchen, Sir.«
Der Kapitän runzelte die Stirn und ging nach achtern, wo er die Leiter zum Hüttendeck erklomm. Aus dieser Höhe sah er deutlich, was Hecker meinte. Ein Schiff hielt auf sie zu, an beiden Masten war so viel Tuch gehisst, wie nur Platz war, und dazu kamen noch die Ausleger und das Gaffelsegel. Ungewöhnlich war jedoch, dass das gesamte Schiff, vom Rumpf bis zum Königssegel, in schaurigem Grün leuchtete, so wie er es schon in ruhigen Nächten bei Quallen unter der Meeresoberfläche beobachtet hatte. Und selbst wenn man die vielen Segel und den günstigen Wind bedachte, näherte es sich ihnen mit unmöglicher Geschwindigkeit. Ausweichen kam nicht infrage. Nicht dass er überhaupt vorhatte zu fliehen.
»Alle Mann!«, rief er. »Klar Schiff zum Gefecht!«
Der Befehl wurde mithilfe der Trommeln an Deck weitergegeben, die man nun zu schlagen begann. Bald war die Messe leer, und das Deck wimmelte von Männern. Der Kapitän lief zu Hecker am Ruder zurück. Der Geschützmeister, Mr. Frain, kam gerade angelaufen, er sah zerzaust aus, und seine Augen waren weit aufgerissen vor Sorge.
»Frain, richtet Euer Hemd. Hecker, bringt uns längsseits und zeigt ihnen unsere Breitseite. Geister oder nicht, wir machen Treibholz aus ihnen.«
Frain richtete sofort seine Kleider, und seine Miene wirkte gleich ruhiger. Hecker nickte und drehte das Steuer bei. »Aye, Kapitän.«
Oft genügte das. Man zeigte etwas Mut, und die Männer fanden ihren eigenen wieder.
Die Wächterin drehte langsam bei, ihr gewaltiger Rumpf kämpfte gegen die vorherrschende Strömung an.
»Melde mich zum Dienst, Sir.« Offiziersanwärter Kellert stand stramm, er wirkte blass, aber ruhig, seine Uniform war sauber und faltenfrei.
Kapitän Vaderton hatte ihm gestattet, sich nach seiner Züchtigung auszuruhen, doch jetzt sah er erfreut, dass der junge Offizier dies offensichtlich abgelehnt hatte. Er legte Kellert die Hand auf die Schulter und nickte. »Sehr gut, Mr. Kellert. Wir machen noch einen Mann aus Ihnen. Sagt Mr. Bitlow, er soll die Jagdkanonen bereit machen, falls sie plötzlich wenden.«
»Aye, Sir.« Kellert salutierte erneut und eilte davon.
Die Wächterin hatte jetzt ganz beigedreht, sodass die Backbordseite dem herannahenden Schiff entgegenstand.
»Mr. Frain, zeigt ihnen, auf was sie sich gefasst machen dürfen«, rief Vaderton zu dem Geschützmeister hinüber.
»Backbordkanonen bereitmachen!«, rief Frain zum Kanonendeck hinunter.
Vaderton hörte, wie zwanzig Kanonen ausgerichtet wurden, und jetzt strotzte der Rumpf nur so von eisernen Geschützmündungen. Er konnte das zerstörerische Potenzial des Schiffs förmlich durch das Deck unter seinen Füßen vibrieren fühlen.
»Sie scheinen nicht beidrehen zu wollen, Sir«, sagte Hecker.
Der Kapitän runzelte die Stirn. »Ein Frontalangriff auf unsere Breitseite ist Selbstmord. Selbst bei ihrer Geschwindigkeit würden sie wahrscheinlich in Stücke zerrissen, bevor sie nah genug an uns herankommen, um uns zu rammen oder zu entern. Das muss ihr Kapitän doch sehen.« Er richtete sein Glas auf sie, aber es war schwer, Einzelheiten auf dem grün umwaberten Schiff auszumachen. Er sah keine Männer, keine Flaggen oder andere Erkennungsmerkmale. Er spürte, dass hier etwas anderes am Werk sein musste, doch er hatte keine Ahnung, was das sein konnte. Das konnte er sich vor seinen Männern selbstverständlich nicht anmerken lassen.
»Vielleicht sind sie bereits tot, Sir«, sagte Hecker. »Könnte sein, dass unser Schuss einfach durch sie hindurchgeht.«
»Wenn das stimmt, dann würden sie auch einfach durch uns hindurchsegeln. So oder so, wir werden es bald genug herausfinden«, sagte Vaderton grimmig. »Mr. Frain, feuert, sobald wir in Reichweite sind.«
»Aye, Kapitän.«
Stille legte sich über die Mannschaft, während alle auf das näher kommende, leuchtende Schiff blickte.
»Feuer!«, rief Frain.
Die Kanonen donnerten los und schickten dicke Rauchwolken in die Luft. Sie hatten gut gezielt, und der Schuss traf das sich nähernde Schiff vor den Bug. Aber statt Zeichen der Zerstörung aufzuweisen, zerstob das gesamte Schiff ohne einen Laut in winzige, glühende Teilchen, die in den Nachthimmel hinaufschwebten und dann ins Wasser zurücksanken.
»Was in allen Höllen …«, sagte Frain.
Das Brüllen von Kanonen erklang an Steuerbord, und die Wächterin bockte heftig. Kapitän Vaderton fuhr herum, er hatte Mühe, sich auf dem schwankenden Deck auf den Füßen zu halten. Ungläubig starrte er auf das Schiff, das plötzlich auf der anderen Seite aufgetaucht war. Es sah genauso aus wie das erste, nur dass es nicht waberte oder leuchtete. Dieses Schiff war nur zu echt, und es hatte gerade einen Kugelhagel aus nächster Nähe auf ihre Steuerbordseite abgefeuert.
»Kapitän«, rief Frain, seine Stimme klang angespannt und verängstigt. »Seht Euch die Flagge an.«
Die Flagge, die am Besanmast des Schiffs wehte, zeigte ein schwarzes Oval mit acht herablaufenden Linien auf weißem Grund. Es war das Zeichen der Biomanten, das Vaderton nur zu gut kannte, doch darüber war ein fettes, blutrotes X gemalt. Das hatte er noch nie gesehen. Aber er hatte davon in den alten Geschichten gehört.
»Die Flagge der Krakenjäger«, flüsterte Hecker. »Es ist Dire Bane.«
»Nein«, sagte der Kapitän Vaderton, doch selbst seine Stimme stockte jetzt. »Das kann nicht sein. Er wurde vor vierzig Jahren von einem Vinchen getötet. Dire Bane ist tot!«
Ein Seemann eilte vom Geschützdeck zu ihnen herüber und sagte leise etwas zu Frain, der daraufhin zusammenzuckte und sich dann an den Kapitän wandte. »Sie hat den größten Teil unserer Steuerbordkanonen außer Gefecht gesetzt.«
»Dringt Wasser ein?«, verlangte Vaderton zu wissen.
Frain schüttelte den Kopf.
»Wenigstens etwas«, sagte Vaderton, dessen Stimme wieder fester wurde. Er beobachtete, wie die Krakenjäger beidrehte und über Heck an ihre Backbordseite wechselte. »Sie haben uns hübsch reingelegt, aber dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei, Gentlemen. Ich weiß nicht, wer die Flagge von Dire Bane übernommen hat, aber es ist an der Zeit, dass wir ihnen zeigen, was ein imperiales Kriegsschiff kann. Mr. Frain, wie lange, bis die Bordkanonen neu geladen sind?«
»Nicht mehr als ein oder zwei Minuten«, sagte Frain. »Wir sind bereit, lange bevor sie es sind.«
»Hervorragend. Feuert, sobald wir bereit sind.«
Die Krakenjäger flog auf sie zu und kam schnell näher. Doch bevor die Wächterin auch nur einen Schuss abgeben konnte, ließ die Krakenjäger eine weitere Kanonade los, diesmal an Backbord. Das Schiff wurde wieder durchgeschüttelt, und Vaderton hörte die Schreie der sterbenden Kanoniere.
»Wie konnten sie so schnell nachladen?« Frain schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich schwöre, Kapitän, das ist unmöglich.«
»Offensichtlich ist es das nicht.« Vaderton beobachtete, wie die Krakenjäger noch weiter aufschloss. Sie war immer noch zu weit entfernt zum Entern, doch wahrscheinlich würden sie vor Bug kreuzen und auf der anderen Seite festmachen, da sie sich jetzt nicht mehr vor dem Geschützfeuer in Acht nehmen mussten.
Doch stattdessen feuerten sie eine dritte Ladung ab. Diesmal waren es Schrotkugeln, die über das Hauptdeck stoben und Männer und Segel mit gleicher Wucht zerfetzten.
»Wie laden sie so schnell nach?«, schrie Frain.
Die Krakenjäger setzte ihre Bahn über Bug fort.
»Wo sind meine Bugkanonen?«, brüllte Kapitän Vaderton.
Er richtete das Glas auf den Bug und sah, dass sich die dritte Ladung auf das Vorderdeck konzentriert hatte. Das hatte weniger Leben gefordert, als wenn sie auf das Mittelschiff gefeuert hätten, aber jetzt bemannte niemand mehr die Kanonen. Unter den Toten und Sterbenden erblickte Vaderton Kellert, der leblos über einer Kanone lag, als würde er sie mit seinem Körper schützen wollen. Eine Ladung hatte die Seite seines Schädels abgerissen, Blut und Gehirn hatten sich über die eiserne Mündung ergossen.
Mittlerweile hatte die Krakenjäger wieder an Steuerbord beigedreht. Sie war immer noch zu weit entfernt, um zu entern, und Vaderton glaubte, dass sie eine vierte Ladung abfeuern wollten. Er schrie: »Alle Mann runter!«, und die gesamte Besatzung warf sich aufs Deck, gemeinsam mit ihrem Kapitän.
Aber statt des Kanonendonners hörte er zwei Knallgeräusche, so als schnappten Sprungfedern. Er sprang auf und sah gerade noch, wie zwei Enterhaken ins obere Barkholz an Steuerbord der Wächterin einschlugen. Die Leine spannte sich, und die Krakenjäger zog sich heran.
»Alle Mann nach Steuerbord, wir werden geentert!«
Die Besatzung raffte sich auf, man griff Schwerter, Piken und Pistolen und beeilte sich, nach Steuerbord zu kommen.
Doch bevor sie dort ankamen, erhoben sich vier Gestalten von der Krakenjäger.
Links stand ein großer, kräftig gebauter Mann in einer schwarzen Weste. Er trug das Haar kurz und hatte einen Bart, sein gebräuntes Gesicht war von Ruß bedeckt. Ein Bein steckte in einer Stahlkonstruktion, und in der Hand hielt er einen schweren Streitkolben. Seine Miene wirkte gelassen. Fast schon gleichgültig.
Rechts stand eine Frau mit lockigem dunklem Haar. Sie trug einen kurzen Wollmantel und eine Hose, die in hohen Lederstiefeln steckte. In den Händen hielt sie eine seltsame Waffe. Es sah aus wie eine lange, feingliedrige Kette, an deren Ende ein schweres Gewicht baumelte, und am anderen eine Klinge. Ihre dunklen Augen blitzten schärfer als ihr Kettenmesser, und sie verzog die weinrot bemalten Lippen zu einem Knurren.
Neben ihr stand die größte Frau, die Vaderton jemals gesehen hatte. Sie hielt sich sehr aufrecht, es wirkte fast schon hoheitsvoll, und sie trug eine enge weiße Robe mit langen, wehenden Ärmeln. Eine große weiße Kapuze verhüllte ihr Gesicht fast vollständig. Es erinnerte Vaderton auf schreckliche Weise an die Roben der Biomanten. Zwischen den Strähnen ihres glatten schwarzen Haars erkannte man nur die untere Hälfte ihres Gesichts, ihre Miene war ruhig, und sie hatte sich die Lippen leuchtend rot angemalt.
Die letzte Gestalt war eine Frau, deren blasse Haut und blonde Haare ihre Abstammung von den Südlichen Inseln verrieten. Sie trug eine schwarze Lederrüstung der Vinchen und ein Schwert dort, wo ihre rechte Hand hätte sein sollen. Als sie den Blick der kalten blauen Augen auf den Kapitän richtete, drang ein Frösteln bis in sein Herz.
»Ergebt euch, und es wird kein weiteres Blutvergießen mehr geben«, sagte sie. Ihre Stimme hallte über das Schiff.
»Ich gebe zu, ihr habt ein paar Überraschungen dabei«, sagte der Kapitän. »Aber du bist nicht Dire Bane. Nur eine Frau. Und außerdem seid ihr zahlenmäßig unterlegen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr noch vor Sonnenaufgang tot seid.« Er zog seine Pistole und feuerte auf sie.
Sie bewegte den Schwertarm. Die Klinge summte schaurig, als sie sich an einem Scharnier an ihrem Handgelenk durch die Luft bewegte und die Kugel beiseiteschlug. Gleichzeitig hob die Frau in Weiß die Arme, sodass die langen weißen Ärmel im Wind wehten, während sie die Finger spreizte. Jede geladene Kanone an Deck explodierte. Männer schrien und packten sich an die vom Pulver verbrannten Hände und Gesichter.
Keiner außer einem Vinchen konnte eine Kugel aus der Luft schlagen. Und wer außer einem Biomanten könnte eine Kanone dazu bringen, spontan in die Luft zu gehen? Aber Vaderton wusste mit Sicherheit, dass Frauen sowohl bei den Vinchen als auch bei den Biomanten nicht zugelassen waren. Womit hatte er es hier also zu tun?
Die Frau, die wie ein Vinchen gekleidet war, richtete die Spitze ihres Schwerts auf Kapitän Vaderton. Sie ließ ihn nicht aus den Augen, während sie begann, sich ihren Weg fast schon gemächlich durch das unbeschreibliche Chaos aus verwundeten und verängstigen Männern zu säbeln. Das tiefe traurige Klagen ihres Schwerts mischte sich mit den Schmerzensschreien.
Ihre Begleiter stürzten sich jetzt ebenfalls ins Gewühl. Der Mann schlug mit dem Streitkolben um sich und zertrümmerte fast schon beiläufig Schädel, oder er brachte die Männer mit seinem Stahlbein zu Fall. Die Frau auf der anderen Seite huschte hierhin und dorthin, schlug ihr Kettenmesser in die Kehle eines Seemanns, dann in das Auge eines anderen, während sie sich gleichzeitig mit dem Gewicht am anderen Ende vor allen Angriffen schützte. Die Biomanten-Frau stand hinter den anderen, die Hände bewegten sich beständig, als tanzte sie. Wo immer sie auch hinzeigte, schlug der Tod zu. Manche Männer fingen Feuer, andere zerfielen zu Staub. Wieder andere krallten die Hände in die eigene Haut und kreischten, als verbrenne ihr Blut sie bei lebendigem Leib.
Viel zu schnell erreichte die Vinchen-Frau das Achterdeck, und eine breite Schneise aus Körpern ohne Köpfe oder Gliedmaßen lag hinter ihr. Schwer hing der Geruch nach Blut in der Luft.
Kapitän Vaderton zog sein Schwert, aber seine Hand zitterte trotz seiner Bemühungen, sie ruhig zu halten.
Der Blick der Vinchen-Frau war so grimmig und unergründlich wie die See. »Kapitän Vaderton, ihr seid als Diener des Rats der Biomantie bekannt. Ergebt Euch oder seid des Todes.«
»Ein Kapitän gibt sein Schiff niemals auf«, sagte Vaderton, und seine Stimme zitterte so sehr wie seine Hand. »Ich werde meine Pflicht tun oder dabei sterben.«
Sie nickte. »Vielleicht steckt doch noch etwas Ehre in Euch. Ich werde es schnell machen.« Sie senkte ihr Schwert.
»Nein!«
Der junge Jillen warf seinen schmalen Körper zwischen Vaderton und das Schwert.
Die Vinchen-Frau drehte den Arm im letzten Moment, und das Schwert sauste zur Seite. Sie starrte den Jungen böse an. »Geh zur Seite, oder ich werde dich auch töten müssen.«
Vaderton spürte, wie der Junge vor Angst am ganzen Körper zitterte, aber er schüttelte den Kopf und bewegte sich nicht.
Die Frau nickte, ihre Miene war traurig. »Ich verstehe und erkenne deine Tapferkeit an.« Dann hob sie ihr Schwert erneut.
»Kapitän, warte!«
Die Vinchen hielt inne und wartete geduldig, während die Frau mit dem Kettenmesser zu ihnen herübereilte.
Sie starrte Jillen an. »Bienchen? Bist du das?«
Die Frage ließ Jillen zurückzucken, obwohl das Schwert es nicht geschafft hatte.
»Filler!«, rief die Frau mit der Kette.
Der Mann wandte den Kopf.
»Komm her!«
Er zertrümmerte dem Mann, gegen den er gerade kämpfte, noch gelassen den Schädel, dann stampfte er mit seinem klickenden, metallischen Bein langsam zu ihnen herüber. »Was gibt’s, Nessie?«
Die Frau namens Nessie deutete wortlos auf Jillen.
Fillers Augen wurden riesig. »Jilly? Was machst du auf einem Imp-Schiff?«
Jillen tat vorsichtig einen Schritt nach vorn. »Filler? Bist du das wirklich?«
»Natürlich bin ich das, Bienchen. Und warum bist du wie ein Junge gekleidet?«
»Sie gibt vor, ein Seemann zu sein, ist doch klar«, sagte Nessie.
»Aber warum?«, fragte Filler.
Jillen (oder war es Jilly?) sah zu Filler auf, als wollte sie sich ihm nähern, aber gleichzeitig Vaderton nicht ohne Verteidigung stehen lassen. »Ich suche meine Mama. Sie hat sich freiwillig gemeldet, schon vergessen?«
Fillers Miene verzog sich. Er berührte etwas an seinem Metallbein, sodass sich das Knie beugte, dann kniete er sich vor sie. »Es tut mir leid, Bienchen. Red und ich haben dich in dem Glauben gelassen, dass es stimmt, was der Imp über deine Mama sagte, dass sie sich freiwillig gemeldet hätte. In Wahrheit wurde sie von den Biomanten geholt.«
»Nein.«
»Ich habe deine Mutter gekannt«, sagte er leise. »Sie hätte sich keinesfalls für die Marine gemeldet. Tatsache ist, dass sie Schiffe und Imps gleichermaßen gehasst hat. Es tut mir leid, Jilly.«
Die beiden starrten einander an, und Jillys Miene war ein Schlachtfeld ihrer Gefühle.
»Ich töte die anderen einfach allein, ja?«, rief die Biomanten-Frau. Dann drückte sie den Schädel eines Seemanns mit einer Geste ein.
»Ja, danke, Brigga Lin«, sagte die Vinchen-Frau zerstreut, sie blickte immer noch Jilly an. »Reds Freunde sind auch meine. Du kannst dich gern meiner Mannschaft anschließen, Jilly.«
»Aber ich gehöre schon zu dieser Besatzung hier«, sagte Jilly.
»Tust du das?«, fragte die Vinchen.
Jilly wandte sich an den Kapitän, der alles stumm mit angehört hatte. Seine Miene hatte langsam von Entsetzen zu Furcht zu Entrüstung gewechselt.
»Kapitän?«
»Einen Offizier zu täuschen, was dein Geschlecht betrifft«, stieß er mit erstickter Stimme hervor, »wird mit dem Tod bestraft.«
»Hör zu, du Dumpfnase«, sagte Nessie. »Dieses Mädchen hat gerade dein Leben gerettet.«
Kapitän Vaderton richtete sich auf, und seine Wut beruhigte endlich seine Hände und brannte Mut in sein Herz. »Ich würde lieber sterben, als einer launischen New-Laven-Fee in Dank verbunden zu sein.«
»Das war’s, was mir noch gefehlt hat …« Die Frau schlang sich ihre Kette um die Hand.
»Halt«, sagte die Vinchen-Frau leise. »Nessel, hilf Brigga Lin beim Aufräumen, dann geh zu Alash, macht die übrigen Kanonen unschädlich, schneidet die Takelage herunter und holt alle Kugeln und das Pulver. Filler, geh in die Kapitänskajüte und hol die Geldtruhe.«
Ohne ein weiteres Wort gingen die beiden davon.
Jilly blickte nervös zwischen der Vinchen und Kapitän Vaderton hin und her. »Was hast du mit ihm vor?«
»Ich werde ihn am Leben lassen, ob ihm das gefällt oder nicht.« Sie sah Vaderton erneut mit dunkelblauen Augen an. »Wir lassen dich auf deiner Wächterin treiben, zusammen mit der toten Besatzung, die du hättest beschützen sollen. Falls du irgendwie überlebst, wirst du jedem, den du triffst, von mir erzählen.«
»Wer bei allen Höllen bist du?«, verlangte Vaderton zu wissen.
»Ich bin Dire Bane. Und ich werde dieses Imperium von dem Rat der Biomantie befreien, selbst wenn ich es dazu niederreißen muss, Schiff für Schiff.«
2
Willmont Pavi verlor die Zeit häufiger aus den Augen. Vor allem, wenn er mitten in einem großen Projekt steckte. Seine Freunde hatten sich so daran gewöhnt, dass sie es für gewöhnlich nicht einmal kommentierten, wenn er spät in der Taverne Zum Radkasten auftauchte und dann auch zerlumpt und unrasiert war.
Doch er wusste, dass das Treffen in dieser Nacht anders war, und dass er auf keinen Fall zu spät dran sein durfte. Also zwang er sich den ganzen Nachmittag über, in regelmäßigen Abständen von seiner Arbeit aufzusehen und auf die große Uhr zu blicken, die feierlich auf dem Regalbrett tickte. Als die Sonne endlich hinter den Dächern versank und Mr. Blagely die Eingangstür des Möbelgeschäfts abschloss, packte Willmont als erster Lehrling seine Arbeit zusammen. Der Alte Blagely bedachte ihn mit einem erstaunten Blick, als er bemerkte, wie er seinen Arbeitstisch aufräumte.
»Triffst du dich mit einem Mädchen, Willy?« Blagely hatte keine Haare auf dem Kopf, und so runzelte er die Stirn bis zum Ansatz seines glatten, gefleckten Skalps.
»Ich treffe nur ein paar Freunde, Mr. Blagely.« Willmont war nicht daran gewöhnt zu lügen, aber das war nur zum Teil eine Lüge.
»Sieh nur zu, dass du das Stück, an dem du da arbeitest, nicht übers Knie brichst, Willy.«
»Ich werde nichts überstürzen, Mr. Blagely.«
»Ich muss dich nicht daran erinnern, wie wichtig es für dich und mich und jeden hier im Laden ist?«
»Nein, Sir«, sagte Willmont.
»Guter Junge.« Blagely klopfte ihm auf die Schulter. »Dann mal los.«
»Danke, Sir.« Willmont eilte aus dem Hinterausgang, wo sie die Holzlieferungen aus Klein-Basheta oder auch Eimer mit Farben, Kisten voller Nägel und andere Dinge annahmen, die sie für das Anfertigen erlesener Möbel brauchten. Mr. Blagelys Geschäft war unter den Adligen und reichen Kaufmannsleuten wohlbekannt dafür, einige der qualitativ hochwertigsten Stücke in Steingrat herzustellen. Aber das schien Blagely nicht mehr gut genug zu sein. Er hatte sich hohe Ziele gesetzt, und er verließ sich auf Willmont, diese zu erreichen.
Willmont lief durch die enge Gasse hinter dem Laden hinaus auf die Hauptverkehrsstraße des Künstlerwegs. Er ging an Stoffgeschäften vorbei, an den Läden der Glasbläser und anderen Handwerkern. Das Viertel war bei den Adligen beliebt, deshalb ratterten regelmäßig elegante Kutschen vorbei, und Willmont teilte sich den Bürgersteig mit gepflegt gekleideten Dienern, deren Arme mit Päckchen beladen waren.
Willmont lief weiter zur Taverne und dachte dabei mit Freude und auch Sorge an den Tag zurück, an dem ihm dieses neue Stück überantwortet worden war, das Blagely so wichtig nahm.
Zwei junge Männer waren ins Geschäft gekommen. Es war ein großer Laden mit vier Arbeitstischen, und an jedem saß ein Lehrling. Sein Tisch stand der Tür am nächsten, und Mr. Blagely drängte ihn immer, sich mehr darum zu bemühen, die Kundschaft höflich zu grüßen, wenn sie hereinkam, selbst wenn sie seine Arbeit unterbrachen. Willmont hatte vorgeschlagen, dass er sich stattdessen an einen der Tische im hinteren Teil des Ladens setzen könnte, und dass einer der anderen Lehrlinge sich bemühen sollte, höflich zur Kundschaft zu sein. Aber Blagely hatte abgelehnt.
»Du bist mein würdigster Lehrling, Willy, und ich will, dass die Kunden deine Arbeit zuerst sehen«, sagte er. »Ich wünschte nur, du würdest mehr auf dein Benehmen achten.« Dann hatte er in müder Resignation geseufzt. »Ich nehme an, das geschieht mir nur recht, weil ich den Sohn eines Steinmetzes angenommen habe.«
Es stimmte, dass Willmonts Vater ein Steinmetz war, und einer, der seine Worte nicht mit Höflichkeit oder Manieren milderte. Sonderbarerweise hatte Willmont die Lehrstelle in Blagelys Möbelgeschäft angenommen, weil sein Vater ihn als viel zu schwächlich und feinfühlig erachtete, um seinen älteren Brüdern ins Familiengeschäft zu folgen. Sein Vater hatte die Nachgiebigkeit seiner Mutter gegenüber ihrem jüngsten Kind dafür die Schuld gegeben, Gott hab sie selig. Willmont dachte, dass vielmehr ihr frühzeitiger Tod ihn ein wenig zartbesaiteter hatte werden lassen, nicht ihre Erziehung. Doch sein Vater war nicht die Sorte Mann, mit dem man über solche Dinge reden konnte. Und sein Vater hatte recht behalten mit der Wahl des Betriebs. Das kunstvolle Fertigen von Möbeln passte weit besser zu Willmonts Temperament als das mühsame Meißeln und Schürfen von Mauerwerk. Mr. Blagely war viel gütiger als sein Vater. Willmont kam sogar gut mit den Handwerkern der anderen Läden aus, und schon bald besaß er einen kleinen Freundeskreis. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen den einfachen, ernsten Gesprächen der Handwerker und der feinen Sprache der Oberschicht. Immer wenn er mit Leuten aus dem Schloss sprach, erwachte eine winzige Version seines Vaters in ihm.
An dem Tag, als die beiden jungen Männer in das Geschäft gekommen waren, beendete Willmont gerade die Verzierungen für eine Stuhllehne. Das war sein liebster Teil beim Möbelmachen. Bereits während der früheren, einfacheren Stufen eines Projekts freute er sich darauf. Also ignorierte er die beiden Männer, als sie hereinkamen und erwartungsvoll vor ihm stehen blieben.
Nach ein paar Minuten räusperte sich einer von ihnen und sagte mit klarer Stimme: »Hallo Bruder, sagte ich.«
»Ja?«, brummte Willmont, sah aber immer noch nicht von seiner Arbeit auf.
»Ich fragte mich, wer diese exquisite Schnitzerei einer Taube gemacht hat, die derzeit auf dem Fenstersims eures Geschäfts sitzt.«
Willmont unterbrach seine Arbeit und sah die beiden zum ersten Mal aufmerksam an. Der Sprecher trug einen leuchtend blauen Gehrock und hatte sein langes, dunkles Haar sorgfältig zu Locken gedreht. Sein Gesicht war mit einer dünnen Schicht des orangefarbenen Puders bestäubt, das viele der reichen jungen Leute auftrugen. Für Willmont sah er aus wie jeder andere Kunde. Der andere junge Mann war jedoch ein wenig ungewöhnlich. Er trug ein feines Leinenhemd, ein Halstuch und weiche Lederstiefel, genau wie sein Begleiter. Aber statt eines Gehrocks trug er einen braunen Langmantel aus Leder, der aussah, als sei er bereits durch mehrere Höllen und wieder zurück geschleift worden. Er trug auch fingerlose Handschuhe und eine Brille mit so dunkel getönten Gläsern, dass seine Augen dahinter nicht zu erkennen waren.
»Ich habe die Taube gemacht«, sagte Willmont endlich.
»Es ist ein prachtvolles Stück«, sagte der Mann mit dem lockigen Haar.
»Sie ist nicht zu verkaufen«, sagte Willmont.
Der Mann lächelte. »Natürlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie über einen hohen sentimentalen Wert verfügt, als dass Ihr Euch von ihr trennen mögt.«
»Nein«, sagte Willmont. »So etwas verkaufen wir hier nur einfach nicht. Wir verkaufen Möbel.«
»Ah, ich verstehe.« Der Mann begann Zeichen von Verwirrung und Frustration zu zeigen, die Willmont häufig bei Kunden hervorzurufen schien. Sobald er diesen Blick sah, sollte er Mr. Blagely holen. Aber Mr. Blagely war unterwegs, um Besorgungen zu machen. Also machte Willmont sich einfach wieder an seine Arbeit.
Aus dem Augenwinkel nahm Willmont wahr, wie der lockenhaarige Mann ein paarmal auf den Fußspitzen vor und zurück wippte. Er hörte, wie er Luft holte, als wollte er etwas sagen, aber dann ließ er es doch. Das Ganze sorgte dafür, dass sich Willmont unwohl fühlte. Er versuchte, sie so gut es ging zu ignorieren, und beugte sich wieder über seine Stuhlverzierungen.
Da trat der Mann mit der dunklen Brille vor. »Es ist so, mein Kerl«, sagte er fröhlich. »Wir wollten wissen, ob du bereit wärst, ein ähnliches Stück für uns zu machen. Aber statt einer Taube sollte es ein …« Er blickte den lockenhaarigen Mann an.
»Ein Falke«, sagte der Mann.
»Richtig. Ein Falke sein«, sagte der Mann mit der dunklen Brille. »Genauso sonnig wie das Stück, das du gemacht hast, aber ein anderer Vogel, klar?«
»Das würde lange dauern«, sagte Willmont.
»Natürlich würde es das, alter Pott«, sagte der Mann. »Wir würden nicht im Traum daran denken, deine Kunstfertigkeit anzutreiben, wenn ich das so nennen darf. Und natürlich würdest du gut bezahlt.«
»Ich weiß nicht …« Willmont machte sich nicht besonders viel aus Falken oder anderen Jagdvögeln. Sie neigten dazu, die Vögel zu fressen, die er mochte.
Da öffnete sich die Tür, und Mr. Blagely eilte geschäftig herein. »Hallo, ehrenwerte Herren!« Er ging um sie herum und stellte sich neben Willmont. »Mein Name ist Honus Blagely, ich bin der Eigentümer dieses Geschäfts. Ich entschuldige mich, falls Willy etwas Schlimmes gesagt hat. Er ist ein verdammt guter Handwerker, aber er taugt nicht viel, wenn es darum geht …« Als er die Männer zum ersten Mal richtig ansah, wurden seine Augen groß, und er verneigte sich tief. »Eure Hoheit! Bitte verzeiht, dass ich Euch nicht früher erkannt habe!« Er warf Willmont einen Blick zu und erkannte, dass der sich nicht verneigte, also streckte er die Hand aus und zog ihn ebenfalls hinab.
Dazu gezwungen, in der Verbeugung auszuharren, verdrehte Willmont den Kopf, um den lockenhaarigen Mann anzusehen, der etwas verlegen lächelte. »Es ist schon in Ordnung, Mr. Blagely. Ich habe den Palast zum ersten Mal ohne eine vollzählige Eskorte verlassen. Es scheint, Lord Pastinas hier ist so todbringend wie ein ganzer Trupp Soldaten – und etwas weniger auffällig.«
Lord Pastinas grinste auf eine, wie Willmont fand, sehr untypische Weise für einen Lord. »Ich gebe mein Bestes, Eure Hoheit.«
»Wir stehen ganz zu Euren Diensten, Eure Hoheit.« Blagely erhob sich langsam, und Willmont durfte sich ebenfalls wieder aufrichten. »Womit dürfen wir Euch heute helfen?«
»Ich bewundere die geschnitzte Taube Eures Lehrlings wirklich sehr und hoffe, er willigt ein, mir einen Falken zu machen.«
»Er wäre erfreut und geehrt, Eure Hoheit!«, sagte Blagely.
»Hervorragend«, sagte Prinz Leston. »Danke … Willy, ja?«
»Ja, Eure Hoheit«, sagte Blagely rasch, denn Willmont war es strengstens untersagt zu reden, wenn sein Herr einen Auftrag verhandelte. Ansonsten hätte er ihnen auch mitgeteilt, dass er es vorzog, mit seinem vollen Namen angesprochen zu werden.
»Unser Willy hat Bedenken kundgetan, dass es ihn einige Zeit kostet, den Auftrag auszuführen«, sagte Lord Pastinas.
»Oh, kümmert Euch nicht um ihn.« Blagely lachte unbehaglich auf.
»Ich möchte wirklich sichergehen, dass er für seine Zeit angemessen vergütet wird«, sagte Prinz Leston. »Würden fünfzig Goldtaler ausreichen, was denkt Ihr?«
Blagelys Augen wurden riesig. »Eure Hoheit ist überaus großzügig.«
»Ausgezeichnet.« Der Prinz nickte Lord Pastinas zu, der einen Beutel an seiner Hüfte öffnete und begann, fünfzig Stück abzuzählen.
Als Blagely die fünfzig Goldstücke in seiner Schürze hatte, verneigte er sich erneut vor dem Prinzen. »Ich liefere es direkt zum Palast, sobald es fertig ist, Eure Hoheit.«
»Ich freue mich darauf, Mr. Blagely«, sagte Prinz Leston. Dann wandte er sich um und ging, und Lord Pastinas folgte ihm.
Als sie weg waren, stieß Blagely einen Seufzer aus. »Gott sei Dank kam ich herein, als ich hereinkam!«
»Es wird lange dauern, einen Falken zu machen«, sagte Willmont. »Ich werde eine ganze Weile keine Stühle machen können.«
Blagely legte die Hände auf Willmonts Schultern und grinste. »Piss auf die Stühle! Das könnte unsere Zukunft sein, Junge!«
»Falken zu machen?«, fragte Willmont.
»Luxuskunstwerke für den Adelsstand! Stell dir das nur vor! Wenn dein Falke dem Prinzen gefällt, wird er ihn irgendwo im Palast ausstellen. Und all die katzbuckelnden Lords und Ladys werden ihn bewundern und ihn fragen, wo er ihn herhat, und er wird ihnen von unserem Geschäft erzählen. Du weißt ja, wie diese Spitzen sich alle gegenseitig kopieren. Sie alle werden einen Vogel oder ein anderes Tier haben wollen, und sie alle werden dafür eine Menge mehr bezahlen als für einen einfachen Stuhl. Wenn wir es richtig anstellen, könnten wir selbst reich werden!«
Danach war nichts mehr wie vorher. Willmont hörte auf, Stühle zu machen, und verbrachte jeden Tag damit, an dem Falken für Seine Imperiale Hoheit zu arbeiten. Es war nicht so, dass Willmont lieber Stühle machte. Tatsächlich liebte er es sogar, jeden Tag in den Laden zu kommen, sich an seinen Tisch zu setzen und an dem Stück Holz zu arbeiten, aus dem nach und nach der Falke hervortrat. Was er nicht unbedingt mochte, waren die Dinge, die damit einhergingen. Mr. Blagely hielt sich ständig in seiner Nähe auf, prüfte seinen Fortschritt, fragte, wie es voranging, wie er sich fühlte, ob er genug aß und Hunderte weiterer Fragen, die Willmont alle zusammengenommen schrecklich nervös machten. Die andere Sache, die der Falke mit sich gebracht hatte, waren die Gottesfürchtigen Naturalisten.
Willmont hatte seinen Freunden natürlich von seinem neuen imperialen Auftrag erzählt. Ein paar Wochen später hatte einer von ihnen, Kiptich, ihn gefragt, ob er dabei helfen wollte, das Imperium ein wenig besser zu machen. Natürlich hatte Willmont Ja gesagt. Wer wollte nicht, dass das Imperium besser wurde? Also hatte Kiptich ihn zu einer Taverne namens Donner und Sturm gebracht. Sie war viel schmutziger und roch schlechter als der Radkasten. Dort hatten sie sich mit einem hängewangigen Mann getroffen, der Hannigan genannt wurde. Kiptich musste viel reden, bis er Hannigan davon überzeugt hatte, dass Willmont vertrauenswürdig war. Dann hatte Hannigan Willmont eine Menge merkwürdiger Fragen gestellt: was er von dem Prinzen hielt, vom Imperator und selbst von Lord Pastinas. Er fragte aus irgendeinem Grund auch, was er von den Biomanten hielt. Schließlich hatte Hannigan zugestimmt, dass Willmont am nächsten Treffen der Gottesfürchtigen Naturalisten teilnehmen durfte.
Und zu diesem Treffen eilte er jetzt. Das Treffen, zu dem er auf keinen Fall zu spät kommen durfte, wie Kiptich ihm erklärt hatte.
Willmont ging mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen durch die sauberen, breiten Straßen von Steingrat, der schon sein ganzes Leben dort gelebt hatte. Er wusste, es gab viele Leute, die kamen und gingen, aber er hatte das nie verstanden. Immerhin war Steingrat die größte Insel im Imperium. Es war auch die reichste und mächtigste, da es die Hauptstadt war. Soweit es Willmont betraf, war es der beste Ort auf der ganzen Welt. Warum würde den jemand freiwillig verlassen wollen?
Auf dem Nordteil der Insel stand der schwarze Berg, nach dem die Stadt benannt worden war. Der Fuß erstreckte sich fast über ein Viertel der ganzen Insel. Die Hauptstraßen verliefen wie Speichen an einem Rad von dort über die Insel. Oder genauer gesagt wie ein Drittel eines Rads. Die Gebäude waren für gewöhnlich zwei oder drei Stockwerke hoch, mit flachen Dächern und Backsteinmauern, die mit gleichförmigem beigefarbenem Verputz bedeckt waren. Viele Städte waren aus unterschiedlichen Gründen willkürlich gewachsen. Aber Steingrat war eine Stadt, die von Anfang an sorgfältig geplant worden war. Als Imperator Cremalton die Inseln vereinigt hatte, hatte er Steingrat als Hauptstadt gewählt, weil dort der höchste Berg des Imperiums stand. Er hatte seinen Palast in die Seite des Bergs hineingebaut, sodass er auf sein gesamtes Imperium hinabblicken konnte. Früher hatte eine kleine Stadt am Fuß des Bergs existiert, aber der Imperator hatte sie niederbrennen lassen, damit er neu beginnen konnte. An ihrer Stelle hatten er und sein führender Biomant, Burness Vee, eine Stadt entworfen, die Seiner Imperialen Majestät würdig war. Imperator Cremalton erlebte die Fertigstellung nicht mehr. Aber Biomanten lebten unnatürlich lang, sodass Burness Vee anwesend war, als der letzte Stein an seinen Platz gelegt wurde. Er starb am nächsten Tag, als hätte er nur aus diesem Grund seinen Tod hinausgezögert.
Es war kurz nach Sonnenuntergang, und die letzten Lichtstrahlen tauchten die beigen Wände der Gebäude in Gold, als Willmont im Donner und Sturm eintraf. Er trat in die Taverne und rümpfte die Nase über den Gestank nach Schweiß und schalem Bier. Die Taverne war nicht überfüllt, was Willmont nicht überraschte. Wer würde schon freiwillig diese stinkende, schummrige Kaschemme betreten?
Willmont ging zur Theke im hinteren Teil, wie Kiptich ihm gesagt hatte. Neben der Theke war eine Luke im Boden, die in den Keller führte. Der Barmann sah scheinbar gleichgültig dabei zu, wie Willmont die Luke öffnete und hinabstieg.
Die Kellerdecke war hoch genug, dass Willmont aufrecht stehen konnte. Man hatte Fässer und Kisten ordentlich aufgereiht auf dem weichen Lehmboden gestapelt. Es war fast vollkommen dunkel, aber ein Licht schien am Ende des Gangs auf. Nervös ging er darauf zu und versuchte, nicht an all die Spinnen und Ratten zu denken, die in der Dunkelheit um ihn herum lauern konnten.
Als er das Licht erreichte, sah er fünf Männer, die um einen Tisch saßen, auf dem in der Mitte eine Laterne stand. Einer der Männer war Kiptich. Ein anderer war Hannigan. Er erkannte auch einen Silberschmied, der seinen Laden die Straße weiter unten vom Möbelladen hatte. Ihren Schürzen und schwieligen Händen nach zu urteilen, waren die beiden anderen auch Handwerksgenossen.
»Du hast es pünktlich geschafft!« Im Licht der Laterne bemerkte er die Erleichterung in Kiptichs hagerem Gesicht. Von Beruf war er Glasbläser, und er behauptete, dass die Dämpfe des geschmolzenen Glases ihm den Appetit nahmen.
»Das habe ich versprochen«, sagte Willmont. »Ich halte meine Versprechen, immer.«
»Ich bin froh, das zu hören.« Die Haut um Hannigans Augen hing wie die eines alten Hundes, aber der Blick war klar und aufmerksam. »Setz dich, Willmont, und wir erzählen dir, warum wir dich heute Nacht hierher eingeladen haben.«
Willmont nahm auf dem leeren Platz am Fuß des Tisches Platz. Die beiden Männer, die er nicht kannte, saßen zu seiner Linken, der Silberschmied und Kiptich zu seiner Rechten und Hannigan am Kopf.
»Zuerst lass mich dir erzählen, warum die Gottesfürchtigen Naturalisten gegründet wurden«, sagte Hannigan. »Wir finden, es gibt ein Problem im Imperium.«
»Ein Problem?«, fragte Willmont.
»Du würdest zustimmen, dass Imperator Martarkis, der in direkter Linie von Cremalton abstammt, von Gott erwählt wurde, um zu regieren, oder nicht?«
»Natürlich.«
»Es mag dich ängstigen, wenn du hörst, dass der Imperator in seinem hohen Alter von den Biomanten kontrolliert wird.«
»Wie, kontrolliert?«
»Biomanten haben ihre Möglichkeiten, weißt du. Und alte Männer können leicht getäuscht werden. Tatsache ist, dass der Imperator seit unnatürlich langer Zeit lebt, oder nicht?«
»Über einhundert Jahre«, sagte Willmont. »Kein normaler Mann hat jemals so lange gelebt. Ich dachte, es ist Gott, der ihn aus einem höheren Grund so lange am Leben erhält.«
Kiptich schüttelte den Kopf. »Siehst du es nicht, Willmont? Die Biomanten sind es, die ihn am Leben erhalten. Weil sie wissen, dass, wenn Imperator Martarkis stirbt, der rechtmäßige Herrscher, Prinz Leston, an die Macht käme. Also halten sie stattdessen den alten Martarkis am Leben, nur gerade so. Ein Mal im Jahr führen sie ihn bei der imperialen Verkündigung vor und lassen ihn wie eine Marionette reden.«
»Aber warum wollen sie nicht, dass der Prinz regiert?«, fragte Willmont. »Er scheint ziemlich nett zu sein für einen Adligen.«
»Das ist das Problem«, sagte einer der Männer, die Willmont nicht kannte. »Wir alle lieben den Prinzen, und wenn er die Verantwortung trägt, würde er den Biomanten nicht mehr erlauben, unsere guten, ehrlichen Menschen für Experimente herzunehmen. Er würde diesen Gräueltaten ein Ende bereiten.«
»Für andere Inseln ist es sogar noch schlimmer«, sagte der Silberschmied. »Ich habe gehört, die Biomanten kommandieren Schiffe von der imperialen Marine und fahren mit ihnen zu kleinen Inseln in den Außenbezirken des Imperiums, um dort an ganzen Bevölkerungen Experimente durchzuführen.«
Hannigan nickte. »Diese Biomanten gedenken etwas Schreckliches und Unnatürliches mit dem gesamten Imperium zu machen.«
»Was sollen wir denn tun?«, fragte Willmont, der Steingrat liebte und nicht zusehen wollte, wie es zu etwas Schrecklichem und Unnatürlichem gemacht wurde.
»Da kommst du ins Spiel, mein Junge«, sagte Kiptich. »Wir müssen dem Prinzen eine Nachricht zukommen lassen. Ihm erklären, was wirklich vorgeht da draußen in der Welt. Diese Biomanten schotten ihn so ab, dass er wahrscheinlich gar keine Ahnung hat. Wir haben versucht, uns ihm auf der Straße zu nähern, aber seine Soldaten haben uns nicht zu ihm vorgelassen.«
»Er hat keine Soldaten mehr«, sagte Willmont. »Nur einen Mann.«
»Den mit der dunklen Brille?«, sagte der Silberschmied verächtlich. »Wer weiß, warum er die trägt. Kann dich wahrscheinlich mit einem einzigen Blick töten, wenn er wollte.«
»Oder vielleicht hat er nicht einmal Augen«, sagte ein anderer.
»Er schien mir nicht so übel«, sagte Willmont. »Wenigstens konnte er normal reden.«
»Der Punkt ist«, sagte Hannigan, »wir können es nicht riskieren. Wir müssen schlau vorgehen. Also haben wir uns überlegt, dem Prinzen einen Brief zu schreiben. Und dann wirst du ihn zu ihm schmuggeln, in dem Falken, den du da machst.«
»Du meinst, ein Geheimfach hineinmachen?«
»Genau!«, rief Kiptich. »Es muss so gut versteckt sein, dass niemand sonst es sieht, aber nicht so gut verborgen, dass der Prinz es nicht findet, wenn er das Stück bekommt.«
Willmont dachte darüber nach. »Ich schätze, ich könnte einen kleinen Schlitz in den Boden machen, in den man die Nachricht schieben könnte. Dann könnte ich eine Platte darüber kleben, um den Schlitz zu verdecken. Wenn ich den Kleber ein wenig mit Wasser verdünne, würde es nur ein paar Tage lang halten. Und dann wäre es hoffentlich schon sicher im Besitz des Prinzen.«
Hannigan grinste Kiptich an. »Du hattest recht. Der Junge ist ein Juwel.«
»Sag ich doch«, sagte Kiptich.
Hannigan wandte sich wieder Willmont zu. »Willkommen bei den Gottesfürchtigen Naturalisten, mein Junge.«
»Danke«, sagte Willmont und sah sich am Tisch um. »Also, gibt es nur uns?«
Hannigan lachte. »O nein. Es gibt noch ein paar andere Gruppen. Wir sind die Handwerkergruppe, aber ob du es glaubst oder nicht, das alles wurde von einer Gruppe Lords im Palast begonnen, die es müde waren, dabei zuzusehen, wie die Biomanten das Imperium mit ihrer unnatürlichen Art infizieren. Und es gibt auch ein paar Kerle drüben am Südmarkt. Vor allem Bauern, Köche und ein paar Weinhändler und dergleichen. So wie ich das sehe, haben wir alle einen Einfluss darauf …«
Plötzlich ragten kleine Klingen aus Hannigans Augen. Er erschauderte, und Blut rann aus seinen zerstörten Augenhöhlen, dann fiel er nach vorn. Willmont hatte noch nie gesehen, wie jemand getötet wurde, und einen Moment lang konnte sein erschütterter Geist nur verständnislos auf den toten Mann starren, der gerade noch mit ihm gesprochen hatte.
Dann wimmerte Kiptich ein pathetisches »Verpisste Hölle«, und der Bann brach. Panik stieg in Willmont auf wie eine Welle, als er die anderen Männer am Tisch ansah.
Der Silberschmied starrte blicklos vor sich hin, als wäre er in einem Rausch. Dann kippte er langsam nach vorn auf den Tisch. Eine Klinge ragte aus seinem Nacken.
Willmont wandte sich den beiden Männern zu seiner Linken zu, die er nicht kannte. Sie hatten sich gegeneinander gelehnt, die Augen waren weit aufgerissen, und die Münder standen offen.
»Kiptich«, flüsterte Willmont. »Was geschieht hier?«
Kiptich schüttelte den Kopf, sein hageres Gesicht sah im Laternenlicht verängstigt aus. »Lass uns hier verschwinden, bevor wir die nächsten sind.«
Die beiden standen auf. Kitpich ging vom Tisch weg und aus dem Licht.
»Warte, lass uns die Laterne mitnehmen!« Willmont nahm sie auf und leuchtete damit zu Kiptich hinüber. Er sah seinen Freund einen Moment lang wieder. Dann bewegte sich eine dunkle Gestalt im Lichtschein rasch vor ihm vorbei und versperrte ihm die Sicht. Als er Kiptich wieder sah, presste sein Freund die Hände auf die Rippen, und Blut tropfte zwischen seinen Fingern hervor. Er warf Willmont einen verängstigten Blick zu, während er nach Luft rang, doch er schien keine zu bekommen. Dann fiel er zu Boden.
Willmont stand allein da. Das Zittern seiner Hände ließ die Laterne flackern. Obwohl sein Geist ihm zuschrie, endlich zu rennen, zur Luke zu laufen, blieben seine Füße, wo sie waren, aus Angst wie festgefroren.
Dann spürte er einen scharfen Schmerz im Handgelenk. Er jaulte auf und ließ die Laterne fallen.
Er umklammerte sein blutendes Handgelenk und blinzelte in die Dunkelheit. Über seine eigenen rauen Atemzüge hörte er ein Geräusch und riss den Kopf herum. Am Rand des Lichtkegels sah er eine schattenhafte Gestalt in Grau gekleidet.
Dann spürte Willmont einen weißglühenden Schmerz an der Kehle. Er versuchte zu schreien, aber es kam nur ein Gurgeln heraus. Etwas Warmes und Nasses floss über seine Brust, während er dabei zusah, wie die schattenhafte Gestalt wieder mit der Dunkelheit verschmolz.
Das Letzte, was ihm in den Sinn kam, bevor er starb, war der Falke, der nie beendet werden würde. Mr. Blagely würde so enttäuscht sein.
3
Jilly stand an der Reling und sah zu, wie die zerstörte Wächterin in der Ferne verschwand. Die Krakenjäger war eine schnelle kleine Brigg, doch Jilly konnte kaum begreifen, wie sie ein Schiff hatte schlagen können, das dreimal so groß war und viermal so viele Kanonen an Bord hatte.
»Mr. Finn?«