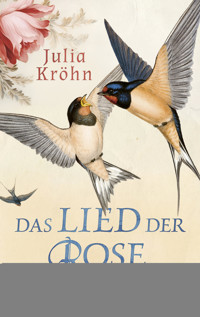6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sie sind wunderschön. Doch niemand ahnt, wie viel Leid in ihrer Schönheit versteckt liegt ...
Österreich, 19. Jahrhundert. Schon als Kind ist Samuel ein feinsinniger Künstler: Er malt Portraits wie kein anderer. Und die Bilder bestechen vor allem durch eins: die absolute, ungeschminkte Wahrheit. Aber seine Kindheit verläuft lieblos und der talentierte Samuel entwickelt sich immer mehr zu einem verschrobenen Kauz, der sein Leben ausschließlich der Malerei widmet. Doch seinen Bildern fehlt eine Seele. Und um die seinen Werken einzuhauchen, braucht er vor allem eins: das Blut Liebender ...
»Geschickt hält Julia Kröhn die Spannung bis zum Ende.« Segeberger Zeitung
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
ERSTER TAG
ZWEITER TAG
DRITTER TAG
VIERTER TAG
FÜNFTER TAG
SECHSTER TAG
SIEBTER TAG
ACHTER TAG
NEUNTER TAG
ZEHNTER TAG
ELFTER TAG
ZWÖLFTER TAG
DREIZEHNTER TAG
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Österreich, 19. Jahrhundert. Schon als Kind ist Samuel ein feinsinniger Künstler: Er malt Portraits wie kein anderer. Und die Bilder bestechen vor allem durch eins: die absolute, ungeschminkte Wahrheit. Aber seine Kindheit verläuft lieblos und der talentierte Samuel entwickelt sich immer mehr zu einem verschrobenen Kauz, der sein Leben ausschließlich der Malerei widmet. Doch seinen Bildern fehlt eine Seele. Und um die seinen Werken einzuhauchen, braucht er vor allem eins: das Blut Liebender ...
Julia Kröhn
Engelsblut
Historischer Thriller
Lena tut es.
Obwohl ich es von ihr verlangt habe, scheint es merkwürdig und unvermutet. Zuerst nestelt sie an ihrer Bluse, als wolle sie nur ein Taschentuch hervorziehen. Dann aber beginnt sie, Knopf um Knopf zu lösen und sich langsam zu entkleiden. Wortlos zieht sie die Bluse von den Schultern. Sie sind nicht schlaff, wie man vermuten könnte, da sie doch zwanzig Jahre älter ist als ich, sondern marmorglatt und nur von verblichenen Sommersprossen bestreut.
Ich starre sie mit trockenem Mund an. Schon zieht sie an den Schnüren des Mieders, und ich sehe und fühle ihre Bewegungen, die so langsam und steif sind, als wären sie in Ton gehauen. Ich kann mich kaum zurückhalten, auf sie zuzugehen, Sprünge in den Ton zu schlagen und ein Weib zu berühren, von dem ich die letzten Tage nichts anderes dachte, als dass es alt, steinern und ohne Verstand sei.
Sie quält mich mit ihrer Langsamkeit, macht mich den Wunsch vergessen, ihr Tun zu begreifen, stutzt mich zurecht auf das bloße Begehren, ihre nackten Brüste zu sehen.
Inständig hoffe ich, sie möge mir diesen Anblick nicht vorenthalten, ihr Mieder nicht nur zögernd aufbinden und dann womöglich verharren, ohne es abzustreifen.
Endlich, endlich – ich schlucke verwirrt – löst sich das Mieder an seinen Rändern, beginnt sich von einer Haut zu schälen, die jung und alt zugleich ist, beinahe unberührt und doch durch ein Leben getragen, in dem viel mehr geschehen ist als in meinem. Jetzt, da der Stoff ihrer Kleidung sie nur mehr lose bedeckt, glänzt ihre Haut nicht mehr tönern, sondern wächsern. Sie wird weich. Wenn ich sie angreife, denke ich, wird die Haut nachgeben, ich werde darin versinken, ich werde vorgreifen können bis zu ihrer Seele – und vielleicht werde ich daran sterben.
Wer liebte diese Frau und hat es überlebt?
Ihr Anblick saugt mich auf. Dort, wo ich eben noch stand, scheint ein dunkles Loch verblieben zu sein. Ich selbst bin verschwunden unter ihrer sachte schimmernden Haut, einverleibt und verspeist auf ewig.
Jetzt stockt sie. So abrupt fällt diese Bewegung aus, dass sie mich zurück auf meinen Platz befiehlt, zurück in die Rolle des Starrenden. Ehe sie sich mir gänzlich nackt zeigt, reicht sie mir ein zusammengefaltetes Bild, das sie zwanzig Jahre lang wie eine zweite Haut zwischen Brust und Mieder trug, das sie vor den Augen der Welt schützte, um sich gleichsam dahinter zu verbergen, und das sie nun, da sie es mir gibt, einer Nacktheit ausliefert, die tiefer geht als das bloße Ablegen von Kleidern. Das Bild stammt von der Hand eines Malers, vielleicht des größten und des verstörendsten, der auf dieser Welt hauste.
Seinetwegen bin ich hierhergekommen. Seinetwegen habe ich mich herabgelassen, mit diesem Weib zu reden. Ihn und sein Werk wollte ich entdecken und nicht etwa diese alte Frau, die meine Mutter sein könnte und die mich dazu verführt hat, sie kurz und absolut zu begehren.
»Nun nehmt!«, sagt sie und wird wieder das, als was sie mir die letzten Tage erschien.
Zitternd neige ich mich vor.
»Das letzte Bild des Samuel Alt?«, frage ich.
»Er malte es in der Nacht vor seinem Tod«, entgegnet sie. Auf ihren Schultern richten sich die Härchen auf. Sie zittert und friert – und bleibt doch entblößt sitzen, bis ich das Bild betrachten kann.
Tagelang habe ich diese letzte Zeugin eines großen Lebens beredet, es mir zu zeigen. Nun, da ich es in den Händen halte, erstaunt mich, dass für Augenblicke ihr alter, nackter Körper wichtiger schien.
Es ist nicht nur das letzte Bild des Samuel Alt. Es ist ein Bild, das Zeugnis gibt von einem schrecklichen Verbrechen.
»Warum vertilgt mit dem Flammenschwert All die Gräuel von der Erde Der Todesengel nicht?«
FRIEDRICH HÖLDERLIN
ERSTER TAG
Es ist zu erzählen, wie Samuel von einem Domherrn gezeugt wird, Marie ihn im Kuhmist gebiert und die unglückliche Felicitas ihn nicht berühren will
Als Gräfin Marie den Bund der Ehe schloss, war ihr Leib dick. Die Leute bezeugten die Trauung mit Häme. Sie beschwatzten hinter vorgehaltenen Händen, dass der Graf von Altenbach-Wolfsberg Besseres verdient hätte und dass Marie eine Hure der schlimmsten Art, nämlich ein Kebsweib, sei.
Sie schritt mit gesenktem Kopf zum Altar, faltete die Hände, aber kannte kein Gebet. Ihr Gedächtnis war ausgehöhlt vom Verrat, der an ihr verübt worden war und der das Kind, das sie trug, zum Bastard machte. Es zählte und half nicht, dass diese Schande mit der Hochzeit verheuchelt wurde.
Marie war mit sechzehn Jahren zur Waise geworden – ein selten auftretendes Nervenfieber hatte ihr die Eltern weggerafft. Sie stierte mit blauen Augen in die Welt und war nicht in der Lage, zwischen dem, was gut, und dem, was schlecht war, zu unterscheiden. Sie war wohlerzogen, aber vom Leben wusste sie nicht mehr, als dass es ein blindes Loch voller Gefahren sei.
Ihr Oheim, ein Geistlicher, der eben Domherr in der Landeshauptstadt Linz geworden war, wurde ihr zum Vormund bestimmt. Er war ins sechzigste Lebensjahr gegangen, blickte auf einen passablen pastoralen Dienst zurück und war mit seinem Dasein zufrieden. Er hatte sich nie in Höhen verstiegen, sich nie in Tiefen verloren, und es deuchte ihn ein sehr gutes Geschäft, auf Glück zu verzichten, um Unglück auszuweichen. Ohne Gefühlsanstrengung glitt er durch den Alltag, ein wenig behäbig, das schon, distanziert gegenüber den leichtfertigen Freuden, aber sämtlichen Tücken ausweichend, und so war er niemals gescheitert.
Er mied die Menschen, war jedoch geschwätzig genug, um nicht als Sonderling zu gelten; vom Leben forderte er nicht viel, nur manche Annehmlichkeiten – gutes Essen zum Beispiel.
Mit Gelassenheit begegnete er Säkularisation und Sittenverfall. Manchmal beklagte er, dass nahezu jedes fünfte Kind außerhalb der heiligen Bande der Ehe geboren wurde. Zugleich aber wusste er, dass es ihm nicht oblag zu urteilen, sondern dass der Allmächtige selbst helfend und strafend eingreifen würde. Deswegen sorgte er sich nicht, sondern legte seine schmächtigen Hände vertrauensvoll um Messer und Gabel.
Als er Vormund der verwaisten Marie wurde, besaß er mit einem Mal eine Familie. Gedankenverloren starrte er auf das Mädchen, fühlte sich zuerst in die Enge getrieben und hub dann gemächlich an, sie zu trösten. Sie jedoch überbrückte hysterisch den Abstand zwischen ihnen beiden, sank auf die Knie und heftete sich zäh an seinen Leib. Ihre schlanken, weißen Finger gruben sich in seine behaarten Unterarme, sodass ihre Nägel sein Fleisch aufschürften.
Er erschrak über den Schmerz, versuchte, ihre Handgelenke zu umgreifen, mäßig Gewalt auszuüben, sie in die aufrechte Haltung zurückzubefördern. Jedoch während sie heulend vor ihm kauerte, fiel sein Blick auf die dunklen Adern unter ihrer weißen Haut – unheimliche schwarze Würmer, die in dem alabasternen Porzellan wucherten und darunter pulsierten.
Es wurde ihm bewusst, dass er noch nie in seinem Leben bei einem anderen Menschen die blauen Adern wahrgenommen hatte, die – unter der Haut verborgen – Lebendigkeit durch den Leib hetzen, gleich ob jener, dem dieser Leib von Gott geschenkt war, leben will oder nicht.
Marie beruhigte sich wieder, wich zurück, wollte sich von ihm lösen. Doch jetzt, da sie es konnte, vermochte er es nicht mehr. Er hielt sie an den Handgelenken fest, drückte die dunklen Adern nieder, fühlte, wie ihm die Haare auf seiner alten Hand zu Berge standen. Er beugte sich vor, um ihren Handrücken zu küssen, traf mit den Lippen jene Stelle, die er eben noch begafft hatte, schmeckte ungläubig und verstört ihre Haut. Mit der Spitze seiner rauen Zunge fuhr er über ihr Handgelenk, erwartete, dass sie kalt wie Marmor sei und säuerlich vom ungelebten Schweiß. Aber er schmeckte nichts.
Später, beim Abendessen, traf er für sie eine Entscheidung.
Er beschloss, dass sie in einen Konvent eintreten, Nonne werden und somit dem schönsten und besten Stand zugehören möge, den eine Frau anstreben könne. Er sprach wenig von Jesus und den Seinen, mehr von den Mühsalen des weltlichen Lebens, den Enttäuschungen, das es bereithält, der Arbeit und den Launen unlauterer Menschen. All dem war er selbst entgangen – und wenn sie ihm folgte, so könne sie darauf zählen, so zufrieden wie er zu werden.
An diesem Abend war er tatsächlich sehr zufrieden. Marie saß vor einem vollen Teller, ohne zu essen. Er schnüffelte über die Speisen hinweg nach ihr, fragte sich, warum er sich nicht an ihren Geschmack erinnern konnte. Vielleicht hatte er nicht lange genug probiert, vielleicht seine Zungenspitze zu rasch zurückweichen lassen in die Sicherheit seines heißen Gaumens. Jetzt war ihm die Zunge trocken.
»Du musst etwas essen, Marie«, verlangte er und verhaspelte sich bei dem gut gemeinten Rat, an den er sich selbst nicht hielt. Als Röte in ihre Wangen stieg, überlegte er, ob die Haut in ihrem Gesicht genauso fahl schmecken würde wie ihre geäderten Handgelenke: Wahrscheinlich war sie wärmer, glutheiß; wenn er daran leckte, würde zischend die aufgeraute Haut seiner Zunge verglühen und schwarz werden.
Er stand auf, trat zu ihr, nahm den Löffel, der aus der Suppe ragte, und führte ihn an ihre Lippen. Sie aß folgsam, weil sie gern gehorchte. Ihm verging der eigene Hunger noch mehr. Er wollte sie schlürfen hören, obwohl er selbst nie schlürfte. Er wollte einen Laut aus ihrem Mund vernehmen. Sie aber aß lautlos.
Drei Bissen später ließ er den Löffel fallen, neigte sich vor, schleckte den letzten Tropfen Suppe ab, der von den halb geöffneten Lippen rann, stellte erleichtert fest, dass er salzig schmeckte. Sie ließ ihn gewähren, zitterte, verkroch sich schließlich in die Wärme, die er aus ihr herauszusaugen trachtete. Auf seinem Schoß saß sie, lauschte seinen Instruktionen, was sie morgen zu tun hatte, und beugte sich dem Verbot, am gefahrvollen Leben zu nippen. Ihr fehlte ohnehin der Appetit. Sie war satt – schließlich aß, kostete, kaute er.
Als sie sich später in ihrem Zimmer befand, wo ein Bett bereitstand, das warm war wie der Schoß ihres Oheims, starrte sie auf ihr Spiegelbild, legte sich ein weißes Tuch um das Gesicht und gefiel sich als künftige Nonne. Sie erwartete vom Leben kein Glück – aber Sorglosigkeit. Und in den Armen des Domherrn war das Leben leicht.
Er hob sie am nächsten Tag unter den Achseln hoch, küsste ihr die Stirn, vergrub seine Nase in ihrem schwarzen Haar. Es schmeckte nach Holz und Honig und ein wenig wie abgestandener Essig. Er biss hinein, sie spürte nichts. Sie wunderte sich nur über sein Verhalten, das von Tag zu Tag, von Woche zu Woche seltsamer ward. Er rief sie zu sich, hob, wiegte, drückte sie, versenkte schweigend Nase und Mund in ihre Haut, lähmte ihren Widerstand. Zuletzt ließ sie ihn gewähren.
Er kostete ihr Lächeln, steckte seine Zunge in ihren Mund, leckte Zahn um Zahn ab, saugte so lange den Atem aus ihrem Gaumen, bis ihr schwindelte. Er fühlte, wie ihre Hände sich an seinem Hals zu Fäusten ballten, hoffte, sie möge ihn damit schlagen. Er wollte wissen, wie solche Schläge schmeckten. Als ihre Finger erschlafften, war er enttäuscht.
Er hörte auf zu essen – sein Menü bestand aus ihrem Körper. Er erforschte ihn nicht mit Begehren, sondern mit Appetit, wurde nicht getrieben von der Geschlechtlichkeit, sondern von der Gier des Feinschmeckers. Er wollte sich den Bauch vollschlagen mit ihr, leckte ihre Scham auf der Suche nach süßlichem Geschmack, nach dem es ihn gelüstete.
Eines Tages übermannte ihn die Gier. Er suchte sie mit seinen Fingern zu essen, mit seinem Geschlecht zu erschmecken, und erst als er damit fertig war, fand er heraus, dass Lippen und Zunge die wichtigeren Werkzeuge eines Mannes waren.
Drei Monate später ging Marie schwanger. Das wurde von einer Bediensteten festgestellt, die diesen Verdacht ihnen beiden mitteilte, mitleidig, abgebrüht, nichts Menschliches sei ihr fremd, nur von ihm, dem Domherrn, habe sie das nicht erwartet.
Marie erbrach sich. Säuerlich stieg es von den ausgespuckten Essensresten in die Nase des Geistlichen. Er wandte sich ab und dachte verlegen, wie gut ein knusprig gebratener Kapaun jetzt munden würde.
Graf Joseph Maximilian von Altenbach-Wolfsberg war fünfunddreißig Jahre alt, verwitwet und verarmt. Einer seiner Vorfahren hatte unter der Regierungszeit der großen Maria Theresia den Gutshof zur beachtlichen Größe aufgebaut. Des Grafen Vater brachte ihn später heil durch die Napoleonischen Kriege und bewahrte sein Vermögen trotz der böhmischen Truppen, die brandschatzend durchs Land zogen, und der Missernten, die folgten. Er lenkte die Geschäfte durch die Jahre, die zum Frieden von Lunéville führten, arrangierte sich, als das Land an Bayern abgegeben wurde, und konnte gut damit leben, als es später einem französischen Gouverneur unterstellt war. Er handelte, bestach, betrog, am Ende war er reicher als zuvor.
Sein Sohn nicht lange. Maximilian von Altenbach-Wolfsberg spekulierte mit dem Anbau neuer Handelsgewächse, pflanzte Baumwolle und Safran und steckte tief in Schulden, bis er endlich feststellte, dass Krapp, Rüben und Hopfen im Hausruck besser zu züchten waren. Er verkaufte einen Teil des Landes an einen Beamten, was besonders blamabel war, weil dieser zu den Bürgerlichen zählte. Schließlich, als dennoch die Schulden wuchsen und wuchsen, besann er sich auf einen entfernten Blutsverwandten, einen Domherrn zu Linz.
Er suchte dessen Hilfe zur selben Zeit, als der Geistliche ihn von sich aus einlud.
Verlegen, einer wie der andere, saßen sie im barocken Amtszimmer, umgeben von Gemälden, aus denen die Gesichter der Vorväter streng und unberührt in den trüben Raum starrten. Das Gespräch holperte. Der Domherr rühmte die Gattin des gütigen Kaisers Ferdinand, die treu ihren kränklichen Gatten umsorgte und unter Beweis stellte, wie wichtig eine verständnisvolle, aufopferungsvolle Frau sei – ein Glück wäre das für den höchsten Herrn des Staates, der seit Kurzem erst regierte und von dem man nicht wisse, ob er die schwere Krone auf dem schwächlichen Haupt tragen könne.
Sie nippten am alten französischen Likör, der noch aus jenen Zeiten stammte, da ein Gouverneur Napoleons Linz regiert hatte. Dann machte der Domherr ein Angebot.
Wenn Graf Maximilian Marie die Ehe verspreche, so sei ihm eine monatliche Unterstützung zugedacht, mit der er alle Schulden begleichen und seinen Gutshof sogar noch vergrößern könne. Er wäre die Geldsorgen los und hätte eine hübsche, junge Frau, die ihm das Bett wärmen könne und die obendrein sehr fruchtbar sei.
»Und bedenkt«, erklärte der Domherr nippend, »Ihr habt zwei Söhne aus Eurer ersten Ehe. Undenkbar also, dass jemand Euch beerben könnte, dessen Blut nicht das Eure ist.«
Erst jetzt verstand Graf Maximilian, wovon der andere sprach, errötete, wollte nichts hören, warf schließlich den Namen einer Base ins Spiel, die an seiner Seite den Hof bewirtschaftete und die er eigentlich seit Langem schon zu heiraten gedachte.
Der Domherr lächelte süffisant, schenkte Likör nach, erhöhte den Betrag der monatlichen Zuwendung. Bedächtig setzte er hinzu, dass sich gewiss ein anderer Bräutigam für jenes Fräulein finden lasse.
Marie tobte, schrie und heulte, als sie von ihrem Schicksal hörte. Man kleidete sie nicht zur Nonne, sondern zur Braut, führte sie die Treppe hinunter zur bereitstehenden Kutsche und gab ihr alles Hab und Gut hinterdrein, damit nichts von ihr bleiben möge im Haus des Domherrn. Als sie bei der Kutsche ankam, befreite sie sich, hastete die Stufen zurück zum Oheim, der dort stand, krallte ihre blassen Finger noch einmal in seine grau behaarten Unterarme. Betroffen packte er sie, schleifte das sich windende Mädchen zurück zum Gefährt. Sie hieb ihm die Zähne in die Hand – da schmeckte es salzig in ihrem, nicht in seinem Mund. Als sie endlich fort war, blickte er besorgt auf die Wunde und beschloss, sie in Branntwein zu tauchen, damit sie sich nicht entzünden möge.
Bei ihrer Hochzeit war Marie erstarrt und verstummt. Ihr Bauch war dick, ihre Augen geschwollen, die Leute grinsten, als sie gratulierten. Erst später in der Nacht kehrte das Leben in sie zurück, sie konnte wieder fühlen und denken. Das Erste, was ihr einfiel, war, dass der Domherr sie missbraucht, verraten, fortgeschickt hatte. Um die Furcht loszuwerden, dass diese Ahnung wahr sein könnte, fiel ihr nichts anderes ein, als sich auf den Grafen zu stürzen, sich ihm anzuvertrauen – mit jenem Leib und jener Seele, die der Domherr weggeworfen hatte.
Sie klammerte sich an Maximilian von Altenbach-Wolfsberg wie an den Geistlichen, rieb den geschwollenen Leib an ihm, befahl flehend und gellend, er möge sie zu seiner Frau machen und lieben und beweisen, dass der Domherr sie dem besten Gatten auf Erden anvertraut habe.
Bislang war Marie dem Grafen nur ein Schatten gewesen, der sich weder rührte noch fühlen ließ. Jetzt, da dieser Schatten zu einem Körper wurde und sich mit all seinem Gewicht auf ihn warf, wich er zurück.
»Lass mich! Lass mich!«, schrie er hilflos und eingeschüchtert. Er bekam Angst vor der Frau, die ihn ganz für sich haben wollte.
»Lass mich!«, schrie er erneut, als sie nicht von ihm abließ – und dann beschimpfte er sie, dass kein Mann sie jemals freiwillig berühren würde, dass sie ein Kebsweib sei, dass sie einen stinkenden Bastard in ihrem gräulich aufgeblasenen Leib trage.
»Ich bin Eure Frau! Mein Kind wird Euren Namen tragen!«, gab sie zurück.
Endlich riss der Graf sich los, rannte aus ihrem Schlafgemach in seines, als ginge es um sein Leben, schloss panisch die Tür hinter sich und drehte den Schlüssel zweimal um, da sie ihm nachgeeilt war.
Marie hämmerte sich an der Tür die Hände wund – im Takt der Worte, an denen sie sich festbiss wie am Grafen: Der Domherr will mein Bestes, der Domherr will mein Bestes. Ihre Hände bluteten, ihre Stimme wurde heiser, aber sie ließ nicht davon ab zu beteuern, dass der Domherr sie nicht verraten habe, dass der Graf sie annehmen müsse, dass er sich nicht vor ihr versperren dürfe. Solange sie brüllte und trommelte und forderte, fühlte sie sich geschützt und geliebt.
Unruhig schritt der Graf im Innern auf und ab. Bis in die frühen Morgenstunden empfand er sich als Maries Gefangener. Dann öffnete er in seiner Not das Fenster, rief hinaus in den Hof, dass Felicitas kommen möge, jene Base, die er zu ehelichen beabsichtigt hatte, ehe Marie in sein Leben trat.
Als Felicitas kam, verstummte Marie atemlos und erschöpft. Ihre Stimme war so leise geworden, dass der Verrat sich kaum noch übertönen ließ. Steif stand Felicitas vor ihr und sagte nichts. Auch Marie war jetzt still. Sie erhob sich bleich, begaffte hasserfüllt die fremde Frau und war unendlich erleichtert, dass sie nicht mehr um den Grafen kämpfen musste.
Felicitas klopfte, der Graf öffnete, Marie wich tonlos zurück.
Er würde mich ja lieben und zur Frau nehmen, dachte Marie müde und fühlte sich endlich geborgen und behütet. Er würde mich ja lieben – wenn diese Hure nicht wäre.
»Du musst verstehen«, sagte der Graf zu Felicitas. »Ich konnte mich nicht anders verhalten. Es ist der Hof meines Vaters, Gott hab ihn selig, den ich zu bewahren habe. Und wer sonst, wenn nicht der Domherr zu Linz ...«
Er hatte Felicitas, die verstoßene Verlobte, noch nie liebkost. Jetzt raunte er weiche Schwüre und strich ihr sachte über die Wange, indessen sie noch vorgab, zu stolz zu sein, um ihm zu erliegen. Er warb zum ersten Mal um sie, versuchte, sie für sich einzunehmen, und gleichsam Marie, die vor Tagen nur ein Name, heute ein lästig schwerer Leib war, aus seinem Gemüt zu verdrängen. Vorsichtig knüpfte er mit eben dieser Marie einen Knoten zwischen sich und Felicitas, während ihn früher nur ein lose dahingeworfenes Eheversprechen an sie gebunden hatte.
Felicitas teilte die Empörung über das unliebsame Eheweib – was freilich nicht bedeutete, dass sie seine Mätresse werden wollte. Noch war ihr Wunsch, ihn zu besitzen, nicht stark genug, um dafür ihre fromme Erziehung zu verraten. Noch wollte sie ihre Liebe außerhalb der sittlichen Grenzen nicht leben.
Hartnäckig gab der Graf gleichwohl nicht auf, dieser Liebe seinen Odem einzuhauchen.
»Marie bedeutet nichts«, erklärte er schmachtend. »Ich weiß, dass ich dir nicht viel bieten kann. Ein heimliches Verhältnis nur, das nie ins Licht der Ehrbarkeit treten wird. Aber stoße mich nicht von dir. Ich brauche dich!«
Sie neigte zur Ablehnung. Diese witternd fiel er ihr ins Wort. »Bei keiner anderen Frau würde ich so weit gehen. Bei keiner anderen Frau würde ich dieses Anliegen so deutlich benennen. Aber du bist es wert! Du bist stark genug dafür! Ich setze auf dich! Ich weiß, dass du dich nicht hinter Eitelkeit verstecken wirst. Ich weiß, dass du bereit bist, dich für mich von Konventionen zu lösen. Für die Liebe lohnt es doch zu kämpfen!«
Liebe hatte sie niemals von ihm erwartet, nur den Ehering. Heute schenkte er sich ihr überreif, zog sie an sich ohne Geduld, rankte eine belegte Stimme um angenehme Worte, die ihr schmeichelten und Kraft zusprachen – ein wohlfeiles Lob. Sie war sich nicht sicher, ob es ihr diente. Stark genug zu sein für Entehrung war nichts, was sie je hatte erproben wollen.
»Felicitas, Felicitas«, flüsterte er ihr ins Ohr, und seine Stimme klang müde vom langen Kampf gegen Marie. »Was soll ich tun, wenn du mich alleine lässt? Wie könnte ich leben mit diesem verrückten Weib, wenn ich dich nicht an meiner Seite wüsste? Die Ehe ist nur Schein. Du wirst die echte Gattin sein.«
Sie entwich ihm ein letztes Mal; sie gedachte des steifen Grafen von früher, den sie stets bewundert und angebetet hatte, jedoch als unnahbaren, würdigen, nicht begehrenden Mann kannte. Seine Liebe verstörte sie. Felicitas ahnte, dass sie in dieser Heftigkeit unmöglich bis morgen anhalten könne. Aber dann, überlegte sie strauchelnd, wenn er nicht mehr genug von dieser Liebe hat, dann könnte ich ja an seiner statt lieben?
Er hörte auf, sie zu liebkosen, kaum, dass er sich ihrer sicher wähnte.
Schließlich raunte er nicht mehr, sondern packte sie ungeduldig und roh. Zorn lag darin – auf Marie und darüber, dass ihn die Flucht vor seinem Eheweib zu einer Geliebten getrieben hatte, die er niemals hatte haben wollen. Die Zärtlichkeit von eben war ihm bereits lästig und hatte sich im Werben um Felicitas aufgebraucht. Erkaltet riss er ihr nun die Kleider vom Leib, stopfte sein Glied in ihren trockenen Schoß und entzog es ihr, sobald das möglich war. Es war ihm peinlich, ihr zuzusehen, wie sie danach das Unterkleid auf ihre nässende Scham presste und wortlos aus seinem Gemach schlich.
Bevor sie es betreten hatte, war sie eine aufrechte Frau gewesen. Jetzt war sie unglücklich und allein.
Er muss ja so kalt sein, dachte sie und ahnte, dass er ihr zum letzten Mal etwas versprochen hatte, er muss ja so kalt sein, wenn doch sein Weib Marie sich derart wahnsinnig gebärdet.
Fortan war Feindschaft zwischen den Frauen. Felicitas konnte Marie nicht ansehen, ohne beschämt zu erblassen. Die neue Gräfin tat ihr leid, die eigene Stellung erschien ihr schmachvoll und widersinnig ertrotzt. Um beides ertragen zu können, verachtete sie Marie, lief ihr den ganzen Tag auf dem Gutshof nach und zeigte sich höhnisch, trotzend, eitel, auf dass die andere mehr an ihr litte, als sie selbst es tat. Sie gaukelte ihr vor, die Glücklichere zu sein; sie protzte mit abfälligem Grinsen, mit feiner Kleidung und hämischen Worten.
Wenige Monate nach der Hochzeit betrat Gräfin Marie eines Tages ihr Zimmer. Kein Mann, vor allem nicht der eigene, hatte es jemals betreten. Jetzt saß Felicitas vor ihrem Spiegel, kämmte sich mit Maries Kamm das Haar und legte den Schmuck der Gräfin an.
Nach langer Zeit fiel Marie der Domherr wieder ein, und dass er sie verraten hatte entgegen allem Leugnen.
»Lass das los!«, schrie Marie. »Schau, dass du auf deinen Platz kommst!«
Ächzend, gellend, girrend stürzte sie sich auf die Geliebte ihres Mannes. Sie wollte sich nicht vorstellen müssen, dass dieser nicht aus Wollust hurte, sondern weil er vom peinlichen Handel angewidert war, den er abgeschlossen hatte.
»Dir zeig ich’s!«, schrie Marie noch lauter. »Dir zeig ich’s, wo du hingehörst!«
Sie packte Felicitas an den festen, braunen Strähnen, zerrte sie durch den Gutshof zu den Ställen und riss ihr – indessen sie weiter schrie – büschelweise die Haare aus. Felicitas begann zu flennen, Marie gab nicht auf. Mit aller Kraft drängte sie sie in den Kuhmist, um ihr das freche Maul zu stopfen.
Plötzlich erstarrte sie, hielt ein, krümmte sich. Sie ächzte, gellte, girrte wieder – doch jetzt tat sie es nicht, um zu schimpfen, sondern um zu flehen.
Felicitas erhob sich ruhig, reckte den Hals und starrte verächtlich auf Marie hinab, die zu Boden sank. »Gebär deinen Bastard allein!«, höhnte Felicitas und rieb sich das verheulte Gesicht sauber. Sie wagte nicht, die Gebärende allein zu lassen, aber sie rührte keinen Finger, ihr beizustehen, sah eine ganze Stunde lang zu, wie Marie sich im Kuhmist wälzte, ihre Röcke hochschob, ihre nasse Hose mühsam vom Leib zog und aus ihrer blau geäderten Scham ein Kind herauspresste, das blutig und mit gelbem Schleim bedeckt war.
Das Neugeborene lag im stinkenden Mist. Als es seinen ersten widerwilligen Schrei tat, beugte sich Felicitas zu ihm hinab, musterte das verquollene, zerquetschte Gesicht und rief endlich nach Hilfe.
Marie lag stumm und spürte, wie feuchter Dreck durch ihr schwarzes Haar bis zur Kopfhaut kroch, sich verhärtete und eintrocknete. Als Felicitas Menschen kommen sah, hörte sie auf zu rufen. Das Schreien des Neugeborenen verglomm im leeren Stall.
Felicitas zog das Kind auf. Es ragte in die Einsamkeit der kommenden Jahre hinein, ohne sie daraus zu befreien. Es war ihr Verbündeter, das Pfand, das sie von der Welt mitbekommen hatte in ihr weggesperrtes Dasein.
Sie hielt das Kind schon in den Armen, als man Marie ins Schlafgemach brachte, sie dort vom Kuhmist reinigte und in frische Gewänder hüllte. Sie selbst rieb das Kind mit einem feuchten Tuch ab, bis es nicht mehr verschmiert war, sondern ein rotgesichtiges Baby war, auf dessen lang gezogenem Kopf sich schwarze, feuchte Haare kräuselten. Dann wollte sie es Marie geben. Doch die nahm es nicht. Der Kopf des Kindes fiel haltlos nach hinten, und Felicitas griff hastig danach, während Marie noch immer kein Wort sagte.
Graf Maximilian von Altenbach-Wolfsberg beobachtete gereizt das Verhalten seines Eheweibs, befahl, eine Amme für das Kind zu suchen, und erklärte höhnisch dessen leibliche Mutter für verhindert.
Felicitas wurde hellwach.
»Ich kann mich seiner annehmen«, erklärte sie, witternd, wie sie dem peinlichen Dasein als verleugnete Mätresse entkommen könne. »Ich kann es für Marie großziehen.«
Da der Graf keine Antwort gab, war es abgemachte Sache.
Der Pfarrer, den man rufen ließ, erklärte weise, man habe von dem unschuldigen Kleinen den Ruf abzuwenden, es sei ungewollt auf die Welt gekommen. Mit der richtigen Auswahl des Namens könnte man boshaftes Geschwätz vermeiden.
Samuel hieß das Kind der alttestamentarischen Hanna, welche jahrelang im Tempel um eine Schwangerschaft gebetet hatte und mit einem Sohn beschenkt worden war. Jener Name bedeutete »Der von Gott Erhörte«.
Der Graf stimmte ergeben zu und wandte sich von dem Kind ab. Es hatte nun einen Namen, galt als sein Sohn und war doch nichts weiter als ein Bastard, der im Kuhmist geboren worden war.
Felicitas war dem Kinde zugetan. Es begleitete sie durch die Stunden des Wartens, in denen sich ihre Hoffnungen verästelten, vom großen, einzigen Ziel abließen, Gattin des Grafen zu werden, und sich kleinen, nebensächlichen Beweisen seiner Gunst zuwandten.
Nur sehr nachlässig erteilte er ihr diese und ließ sie durch Gesten wissen, dass er die Lust auf sie schon in der ersten Nacht verloren hatte, dass ihn nur der Trotz zu ihr trieb – vor allem dann, wenn die Zahlungen des Domherrn eintrafen.
Beinahe vergaß Felicitas, dass das Kind Maries Balg und im Stall geboren war. Nur manchmal, als es größer wurde und begann, sich an sie zu schmiegen und ihren weichen Körper zu suchen, da war es ihr, als würde es nach Kuhmist und nach der verhassten Nebenbuhlerin stinken, und sie drückte es weg, schlug auf die kleinen Händchen, auf die blassen Backen und verbot jede Berührung. Doch dann reute sie ihr rüdes Benehmen, sie sang ein Lied, lauschte, wie das Kind hoch und hell einstimmte, und vergaß, wonach es roch.
Graf Maximilian sah über den Knaben hinweg, wenn er in dessen Nähe weilte. Er ließ sich von ihm weder begeistern noch verstören. Die Zeit, die er Felicitas schenkte, war rar, gefüllt mit wenigen Riten, die ihre Bedeutung nur aus der Wiederholung zogen. Nie gab er sich bemüht und zärtlich. Wiewohl nicht offen ausgesprochen, schien es beschlossen, dass sie sich längst geschlagen gegeben hatte, dass sie den Sinn ihres Lebens an einem unverbindlichen Morgen vergeudet hatte, anstatt ihn heute laut und fest bei ihm einzuklagen. Aus Bequemlichkeit schürte er ihre Träume und Fantasien, erklärte, wenn sie – selten – zu klagen anhob, dass kein Weg an seiner Ehe mit Marie vorbeiführe, dass er auf ihr Verständnis, ihr Ausharren, ihre Geduld zähle.
Anfangs traf sie willentlich die Entscheidung, ihm nachzugeben. Später verkam ihr Kapitulieren zum steifen Mechanismus. Sie forderte nicht mehr ihn, sondern plumpe Wiederholungen, deren Regelmäßigkeit zufriedenstellte.
Ihr Murren ob seiner hastigen Berührungen erstarb. Er hob ihren Rock, ohne ihre Brüste zu entblößen, öffnete seine Beinkleider, ohne sich ihrer zu entledigen, vergoss totenstill und auf die weiße Wand starrend seinen Samen.
Hernach schloss er die Hosen und ging. Ihren Rock musste sie sich selbst über die Beine ziehen.
Eines Tages, als dies geschah, blickte der Graf nicht auf die weiße Wand vor sich, sondern ungewollt in Samuels ausdrucksloses, verschlossenes Gesicht. Der Vierjährige musterte ihn wortlos, während des Grafen Hände roh und gleichgültig Felicitas betasteten.
»Himmel!«, rief der Graf entsetzt aus und schloss seine Beinkleider, bevor er fertig war. »Himmel! Das Kind versauert hier und wird blöde, es muss doch etwas mit ihm geschehen, damit’s ein rechter Mensch wird!«
Er klemmte sich Samuel unter den Arm wie ein lebloses Bündel, trug ihn auf den Hof und schüttelte ihn dort ab. Der Kleine fiel auf den matschigen Boden.
Verwilderte Kinder von Mägden, Pächtern und Häuslern äugten erstaunt.
»Nehmt’s ihn!«, schrie der Graf in ihre verdrossenen, feindseligen Gesichter. »Nehmt’s ihn, spielt’s mit ihm, schaut’s zu, dass er rote Backen kriegt!«
Samuel rappelte sich auf und glotzte auf die Kinder. Er roch zum ersten Mal die milde Landluft, den beißenden Geruch nach frischem und verfaultem Obst, nach Ställen und nach Pferden, nach feuchter Erde und abgeernteten Feldern. Er krauste sein Näschen. Er witterte Kuhmist.
»Wie heißt du?«, fragte eines der Kinder feindselig. Sie griffen nach ihm, wollten den fremden Knaben und seine edle Kleidung befühlen.
Da wich er ihnen aus und ließ sich wieder zu Boden fallen, umklammerte mit seinen dürren Fingern ein Holzstäbchen und begann den schwammigen Boden aufzuritzen – formlos zuerst, dann ergaben sich Konturen. Er zog einen Strich, zwei Löcher, einen Bogen und einen Kreis drum herum, bis er der feuchten Erde ein Gesicht geschenkt hatte.
Als Graf Maximilian später kam, gafften die Pächterskinder immer noch auf Samuel hinab. Sein Gewand hatte sich mit dem Kehricht vollgesogen; rote Backen hatte er nicht bekommen.
»Herrgott!«, kreischte der Graf, zertrampelte die Gesichter, die Samuel in den Boden gestanzt hatte, fluchte auf das seltsame Kind und schleppte das leblose Bündel wieder hinauf ins Zimmer. Felicitas schrie er an, sie möge den Jungen mit seinesgleichen zusammenbringen, auf dass er endlich zu schwatzen lerne. Wenn sie das nicht zustande brächte, so würde er sich eine bessere Aufseherin für den Kleinen suchen, und was dann mit ihr, Felicitas, geschehe, könne er nicht mit Bestimmtheit sagen.
Als er gegangen war, fing Felicitas an zu heulen, vergaß ihre Scheu vor dem Kinde, das nicht das ihrige war, und neigte sich ihm zum ersten Mal zu, um es zu umarmen und sich an seinen kleinen, warmen Körper zu schmiegen. Samuel versteifte sich. Auf ihrer Haut waren die Spuren von des Grafen Händen, und aus ihrer Scham tropfte sein Samen. Er begann zu strampeln, zu kratzen und wild um sich zu schlagen. Er riss sie an den Haaren und traf ihr Auge, das am nächsten Morgen blau werden würde. Erschrocken wich sie zurück. Kaum dass sie ihn losließ, verlor er jede Kraft und sank zu Boden. Während er da hockte, kreisten seine Finger auf dem kalten Stein und versuchten, ihm die Form von Felicitas’ entsetztem Gesicht zu geben.
Erst danach wollte er sich von ihr berühren lassen. Doch jetzt war sie nicht mehr bereit, es zu tun.
Mein Name ist Moritz Schlossberg, und ich bin Kunstkritiker aus Wien.
Lange bevor ich mich von einer halb nackten, alternden Frau gefangen nehmen lasse, ich bei ihrem Anblick vergesse, wer ich bin, und – ihr nachgebend – während vieler Tage ihrer Geschichte lausche, trieb mich nur ein Ziel in die Heimat des Samuel Alt: Ich wollte sein letztes, geheimnisvolles Bild finden und daran meine These belegen, wonach, wer liebt, ein Lügender sei, und ergo ein wahrhaftiger Maler nur sein könne, wer nicht liebe.
Ich bin (oder war) kein Feind der Liebe, aber ein Feind der Kunst, welche erlaubt, ihr Objekt durch Gefühle zu fälschen. Wer liebt, verzehrt, verstellt, verbiegt. Ich hingegen meine: Die Kunst ist der Realität verpflichtet, und der Künstler möge sich nicht in diese Realität verstricken, sondern gleichsam ein Auge sein, durch das die ganze Menschheit auf diese Realität blickt.
Dass Samuel Alt ein solches Auge war, lese ich den wenigen erhaltenen Werken von ihm ab. Gleiches wird auch seinem letzten Bild nachgesagt, das kurz vor seinem rätselhaften Tod entstand und nach dem ich seit vielen Monaten verbissen suche. Wiewohl es kaum jemand zu Gesicht bekommen hat, geht raunend das Gerücht, es sei das wahrhaftigste aller möglichen Bilder.
Ich schenkte diesem Gerücht Glauben und nahm lange Reisen auf mich, um nach dem Bild zu fahnden und mit Menschen zu sprechen, die Samuel Alt gekannt haben. Bis nach Frankfurt bin ich gekommen, in dessen Umgebung er manche Jahre seines Lebens zugebracht hatte. Dort wusste man zwar nichts von diesem letzten Werk, verwies mich aber an einen gewissen Bartholomé Vernez, der ein Schüler Samuels Alts gewesen war und lange Zeit an seiner Seite gelebt hatte. Bei unserer Begegnung sprach jener anfangs freundlich zu mir und schwelgte in Erinnerungen. Kaum aber erwähnte ich das letzte Gemälde, riss er entsetzt die Augen auf.
»Gütiger Himmel!«, stieß er aus. »Sprecht nicht davon! Keiner darf wissen, dass es dieses Bild je gegeben hat!«
Wiewohl meine Neugierde angestachelt war und ich lange Wochen voller Fragen bei ihm weilte, war nichts Weiteres von ihm zu erfahren. Unverrichteter Dinge musste ich weiterziehen – diesmal in ein Fischerdorf an der italienischen Küste, wo ein Mann wohnt, der einst als Kunsthändler Samuels Namen groß gemacht hat.
Er erschien mir weniger verstört, jedoch gleichfalls verschwiegen. Ja, sagte er, als ich von Samuel Alts letztem Bild sprach, ja, dieses gäbe es; und ja, auf diesem Bild sei etwas zu sehen, worüber sich nicht sprechen ließe und wie es bislang noch nie gemalt worden sei. Er selbst könne jedoch nur erahnen, wo es sich finden ließe. Am besten sei – dies wäre das Einzige, was er empfehle –, wenn ich an Samuels Geburtsort (der gleichen Stätte, wo er auch begraben liege) nach diesem Bild forsche.
Viel mehr Worte machte er nicht, was ich durchaus goutierte. Ich will Samuel Alts letztes Bild finden – schauerliche Geschichten über ihn hören will ich nicht. Denn diese Geschichten (in der Hauptstadt werden sie hinter vorgehaltener Hand gewispert) gehen mich nichts an.
Wenn man von einem Maler verlangt, dass nichts seinen Blick auf die Welt verstelle, so lege ich gleiches Richtmaß für den Kritiker an: Er möge von dem, der Bilder schuf, nicht mehr wissen, als eben, dass er sie erschaffen hat.
Meine These blieb also klar umrissen, mein Vorhaben weiterhin gut geplant, die Fahrt von Wien in die österreichische Provinz (mit Eisenbahn und Postkutsche) war zwar beschwerlich, aber erträglich.
Zaudernd stimmen mich nur der Nieselregen und die Kälte, die mich im Land ob der Enns empfangen (und diese Reise, wiewohl viel kürzer als alle anderen, grauer und düsterer färben). Vergebens halte ich Ausschau nach etwas, das Wärme verspricht, und muss mich schließlich mit dem Gedanken trösten, dass es ein Rechtes sei, auf diese Weise ernüchtert zu werden. Wenn Kunst nicht erhöhen, verzärteln, verwöhnen soll, darf ich dann – auf der Suche nach einem ihrer vortrefflichsten Erzeugnisse – Gemütlichkeit begehren?
Also spaziere ich tapfer und beherzt durch den Schlamm, in dem der Fußweg zwischen Schwanenstadt und dem Gutshof Altenbach-Wolfsberg versinkt, komme durchnässt und frierend an – und erwarte an dem Ort, wo Samuel Alt Kindheit und Jugend verbrachte, letzte Spuren seines Lebens.
Leider gibt es wenig, was mich hoffnungsfroh begrüßt. Nicht nur, dass ich eingeklemmt in ergrautem, fruchtlosem Land stehe – es glotzt mich obendrein ein verschlossenes Portal an, an das ich klopfen und klopfen mag, ohne dass es sich auftut.
Ich stelle fest, dass der Gutshof von Altenbach-Wolfsberg verarmt, verschimmelt und verdreckt ist. Die Wände sind ein grauer Schatten wie die zähe Wolkenwand oder die Kleidung, die auf mir klebt. Fortgeregnet scheint mir mein Mut.
Ich beginne zitternd, an das Portal nicht nur zu klopfen, sondern mit den Fäusten darauf einzuhämmern. Grimm überkommt mich – als sei ein anderer schuld, dass ich hier warten muss.
Doch gerade als ich genug vom Hämmern habe, aufgeben und vom stummen Portal wegtreten will, vernehme ich endlich schleifende Schritte und eine schwerfällige Stimme. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten – ein alter Mann öffnet mir das Tor, schnauft, starrt mich an und spricht zu mir.
»Doch die Existenz der Engel, die bezweifelte ich nie; Lichtgeschöpfe sonder Mängel, hier auf Erden wandeln sie.«
HEINRICH HEINE
ZWEITER TAG
Es ist zu erzählen, wie Felicitas um ihr Engelchen weint, Samuel einen abgebrochenen Schneidezahn malt und Andreas seinen Vetter zu lieben beginnt
Samuel ging ins sechste Jahr, suchte keinen Umgang mit seinesgleichen, aber streunte über den Hof, durch die Gänge und Kammern. Er beäugte die Menschen auf seinen Wegen, fräste sich ihre Züge und Bewegungen ins Gedächtnis und ritzte ihre Gesichter mit einem Holzstäbchen in die Erde.
Vergänglich blieben diese Zeichnungen. Füße trampelten darauf herum, oder Regen nässte sie und spülte sie glatt. Aber er ließ sich dadurch nicht abbringen, sondern begann stets aufs Neue mit seinem Tun.
Eines Tages machte er eine erstaunliche Entdeckung. Er erreichte beim Herumstreunen eine Kammer, in der ein Mann hockte, den man, so erfuhr er später, den »Herrn Schreiber« nannte. Über ein Pult gebeugt saß dieser und schrieb mit weißer Feder und schwarzer Tinte Berechnungen in ein kleines Büchlein, um den Erlös zu bestimmen, den die Züchtung von Pferden einbrachte.
Samuel blieb vor dem schreibenden Mann stehen und starrte ihn so lange an, bis jener den stillen Knaben gewahrte. Er war gutmütig, der Herr Schreiber, wollte ihn nicht verscheuchen, ließ ihn gaffen und lächelte in das misstrauische Gesicht hinein.
»Sieh an«, sagte er mit leisem Spott. »Dich habe ich hier noch nie gesehen, Bub.«
Samuel antwortete nicht.
»Wenn ich nicht irre«, meinte der Herr Schreiber, »bist du Samuel, der Sohn des Grafen.«
Samuel wusste nicht, wessen Sohn er war. Angestrengt blickte er auf das weiße Papier.
Der Schreiber lachte. »Willst wissen, was ich für deinen Vater erledige?«, meinte er aufmunternd, hob seine Feder und tauchte sie nachdrücklich in die Tinte. »Das solltest du auch lernen, Bub. Ich muss Zahlen aufschreiben. Sie festhalten.«
Die Augen des Kindes waren blicklos.
»Verstehst du das denn nicht?«, spottete der Schreiber gutmütig. »Ich muss sie festhalten!«
Der Knabe sagte noch immer kein einziges Wort. »Festhalten«, wiederholte der Schreiber verwirrt, neigte sich, da er auf keine Regung stieß, nach vorne und packte den Jungen an den Schultern, um ihm vorzumachen, wovon er sprach. »Festhalten – so wie ich dich festhalte.«
Da kreischte Samuel so laut auf, dass der Kopf des Schreibers dröhnte. Er gellte und girrte und schlug um sich, bis der andere ihn entsetzt losließ. Selbst dann vermochte sich der Knabe nicht zu beruhigen. Irr schlug er auf die Hand ein, die ihn eben noch berührt hatte, biss und kratzte.
»He!«, schrie der Mann empört und befremdet und duckte sich. »Bist du verrückt geworden? Hat man Wahnsinn in dein Hirn geträufelt?«
Samuel fiel jählings in sich zusammen, als fehlten ihm die Knochen, die seine weiße Haut stützten, und verharrte so still am Boden, dass man glauben musste, er hätte nie geschrien und nie um sich geschlagen. Kopfschüttelnd blickte der Schreiber auf ihn hinab und ängstigte sich vor dem seltsamen Kind. Um es loszuwerden, reichte er ihm ein Blatt weißes Papier.
Damit möge er nach seinem Gutdünken verfahren, er könne es mit Feder und Tinte beschreiben. »Nur nimm’s endlich und geh, ich habe noch zu arbeiten!«
Ängstlich versteckte er die Hand, die Samuel berührt hatte, unter dem Schreibpult und gab sich nicht weiter mit dem Kinde ab.
Samuel trat mit dem weißen Papier in den Hof, setzte sich in den Dreck und wartete. Gänse trotteten vorbei und suchten in der feuchten Erde nach Schnecken. Er griff sich eine, hielt sie fest und riss ihr eine Feder nach der anderen aus. Obwohl schmächtig, war er doch stärker als die Gans, die heftig schnatterte und nach ihm schnappte. Ungerührt hielt Samuel das Tier unter dem Arm und beschmierte mit den ausgerissenen Federn den Bogen Papier mit dem Gesicht des Schreibers.
Neugierig liefen die Mägde, Knechte, Pächter, Häusler zusammen, beglotzten den kämpfenden, Federn ausreißenden Samuel und das halb nackte Tier, fragten sich, warum der Knabe eine Gans rupfte, noch ehe sie geschlachtet war, und warum er mit Gänseblut malte. Sie hielten dies für eine Absonderlichkeit, die zeige, dass Samuel der Sohn der Gräfin Marie sei, nicht aber der Sohn des Grafen Maximilian. Und im Kuhmist geboren sei er obendrein.
Sie machten jedoch keine Anstalten, das Kind vor dem Tier zu bewahren oder besser noch: das Tier vor dem Kinde. So laut riefen, lachten, spotteten sie, dass selbst der Graf es hörte. Mit rotem Gesicht kam er von Felicitas weg in den Hof gerannt, erblickte Samuel und dachte im ersten Moment, dem Kinde sei etwas Schlimmes zugestoßen. Dies wollte er nicht, denn der Domherr könnte Rechtfertigung dafür verlangen.
Jetzt blickten die Menschen mit ihren geöffneten Mäulern nicht mehr auf Samuel, sondern auf Graf Maximilian. Ihren aufdringlichen Blicken folgend, gewahrte er, dass er ob seiner Hast die Beinkleider nicht geschlossen hatte, und wurde rot im Gesicht vor Scham.
Er packte den verschmierten Samuel, keifte, dass es besser wäre, wenn Marie einen Dumpen geboren hätte anstatt einen derart Missratenen, und wollte ihn nach oben schleppen. Samuel strampelte und trat nach dem Grafen wie vorhin nach dem Schreiber.
»Du bist ja völlig irre geworden!«, stieß der Graf hervor.
Samuel sah das Papier im Dreck des Hofes liegen und biss so heftig in des Grafen Hand, dass er fremdes, salziges Blut schmeckte. Dann gab er auf, ließ sich zu Boden fallen und zu Felicitas tragen, die das Kind scheu betrachtete und vermied, nach ihm zu fassen und es wieder auf die Beine zu stellen.
Mit der Zeit vergaß der Graf von Altenbach-Wolfsberg, an seiner Ehe zu leiden. So zurückgezogen lebte Marie, dass er manchmal dachte, wie gut es sei, neben einem stillen Schatten zu leben anstatt bei einem zänkischen Weib. Das Geld des Domherrn verbrauchte er nicht mehr für die nutzlose Züchtung exotischer Gewächse wie dereinst sein ererbtes Vermögen, sondern gab es diesmal für Neuerungen aus, die vom fortschrittlichen England kamen. Er erprobte die Fruchtwechselwirtschaft, die Stallfütterung und künstlichen Dünger und wurde davon reicher als seine Nachbarn.
Felicitas zeigte ihm nicht ihr wahres Gesicht, sondern nur eine Maske. Die Wünsche, die dahinter verfaulten, stanken gottlob nicht. Sie sprach sie nur im Dunkeln aus, wenn sie im Bett lag und sich ausdachte, wie ihr Leben sein könnte, falls sie jemals das Gewicht ihrer Träume dareinlegte.
Der Graf kam seltener zu ihr, nicht mehr von Trotz getrieben, sondern von nachsichtigem, unaufwendigem Mitleid. Er mied ihren Körper zumeist, und wenn nicht, war er nicht grob, sondern sprach ihr mit vorsichtigen Berührungen ein sachtes, gleichgültiges Beileid aus.
Ihre Augen hatten keine Tränen. Sie gewährte sich nicht das Recht, das Leben zu beklagen, sondern saß träge darin fest. Es war nicht mehr ihres. Sie hatte es Graf Maximilian längst zugeschoben, und als er nichts Rechtes damit anfangen konnte, sondern es zurückwies, war sie nicht bereit, es zu halten, sondern hatte es müde fallen lassen.
Sie wurde nicht mutiger, als sie merkte, dass sie vom Grafen schwanger ging. Noch bevor sie es ihm gesagt hatte, war sie sich schon im Klaren, dass er das Kind nicht würde haben wollen, dass er sie gewiss mit der Last des ungeborenen Lebens abwiese. Warum sollte er sich herablassen, sie mit ihr zu teilen?
Die Sache war verloren, die Einsamkeit besiegelt und sie ohne Aufbegehren bereit, das Kind und sich selbst verloren zu geben.
In dieser Nacht weinte sie zum ersten und einzigen Mal. Sie lag schluchzend in ihrem Bett, schmiegte die Arme schützend um den Leib, stieg dann in Samuels Schlafstätte, um das schlafende Kind zu betasten und zu halten. Zaghaft roch sie an seinen schwarzen Locken, vergrub ihr nasses Gesicht darin, begann ihn zu streicheln, zärtlich, herzend und innig. Sie schmeckte mit ihrer Zunge seinen süßen Schweiß, leckte Schläfen und Wangen ab, nahm seine Hände, um sie sich fest um die Schultern zu legen.
Samuel erwachte davon, spürte verwirrt ihre Nähe und vergaß, dass er sich nicht berühren lassen mochte und dass er für gewöhnlich um sich schlug, wenn man es dennoch tat. Schlaftrunken kuschelte er sich an den warmen Körper. Wieder nahm Felicitas seine Hände, führte sie zuerst an ihre geschwollenen Brüste, dann zu ihrem Bauch.
»Da drinnen wohnt mein Engelchen«, sagte sie verweint.
Samuels Hand war warm und schlaff. Sie küsste ihn auf die Stirn, auf die Nasenspitze, auf den Mund, nässte seine Haut und fühlte, als er wieder einschlief, seinen heißen Atem auf der Brust.
Ihr eigenes Bett war ausgekühlt und klamm, als sie zurückkam. Sie nahm eine Stricknadel, berührte mit dem kalten Metall die Innenseite ihrer Oberschenkel, suchte mit den Fingern das Loch in ihrer Scham, spreizte es und stieß mit der Nadel hinein. Zuerst war sie vorsichtig und tastend; als es anfing zu schmerzen, wurde sie ungestüm und ärgerlich. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht zu stöhnen, wartete ungeduldig auf die Krämpfe, dachte, ziellos weiterstoßend, wie seltsam es sei, dass ihr Kopf, in dem grässliche Schmerzen ankamen, ihren Händen das Stoßen doch weiter befahl. Es tat so weh, dass sie Galle würgte und endlich die Stricknadel ihrer zitternden Hand entglitt.
Ich werde mit dem blutigen Klumpen im Bauch verrecken, dachte sie. Dann fühlte sie zum ersten Mal, dass sie Graf Maximilian von ganzem Herzen hasste, so, wie sie ihn nie geliebt hatte.
»Du Dreckskerl!«, stieß sie hervor, und die Lethargie fiel von ihr ab. »Du Hurensohn! Du Hundsfott!«, knurrte sie in das nächtliche Zimmer, ertastete die Nadel erneut, stieß fester und fester und fester in ihren Leib, ohne innezuhalten. »Wie ich dich verachte! Wie erbärmlich du bist! Fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle!«
In ihrem Körper tobten Schmerzen, jagten von der Mitte des Leibes bis in ihre Fingerspitzen. Ihre Haare sträubten sich. »Bin ich denn verrückt gewesen, freiwillig bei dir zu liegen?«, geiferte sie.
Das Blut trocknete auf ihren Schenkeln, während sie gegen den Grafen wütete, in ihrem Leib stocherte und Darm und Blase zum Entleeren brachte. Dann ließ sie von sich ab. Es fiel ihr keine Verwünschung mehr ein, die sie hätte schreien können.
Samuel fand sie am nächsten Morgen, starrte schweigend auf die erkaltete, blicklose Tote und wagte lange nicht, sich von der Stelle zu rühren. Erst viele Stunden später betrat er den Hof, malte das Gesicht der Toten in die feuchte Erde, immer wieder, bis er jeden Flecken um sich herum damit gefüllt hatte. Niemand aber scherte sich um ihn und trat zu ihm, um das Schlimme anzuschauen. Da beschmierte er die Hauswände mit dem Schlamm, um darauf Felicitas darzustellen, kehrte schließlich zurück in ihr Zimmer und tauchte seine Hände in ihr getrocknetes Blut, um den Tod festzuhalten.
Keiner wollte seine Malerei sehen. Erst Tage später, da die Tote steif und stinkend lag und Wände, Boden und Decke mit ihrem Elend beschmiert waren, wurden sie und Samuel entdeckt.
Felicitas’ Tränen waren längst auf den gebleichten Wangen getrocknet. Das Blut zwischen den Beinen hatte sich mit den Exkrementen vermengt und war schwarz geworden. Samuel malte nicht mehr, sondern lag auf dem Leichnam und klammerte sich daran fest.
Sein Anblick verstörte mehr als die Tote. Heulend lief man vor dem Bett zusammen und versuchte, Samuel von der steifen Toten zu lösen.
Seine Hände krallten sich fest. »Sie trägt ein Engelchen in ihrem Bauch!«, gellte er. »Man darf dem Engelchen nichts zuleide tun!«
Der Graf kam eilig und voller Entsetzen, während sich die Mägde flüsternd fragten, warum sie nicht zu einer Abtreiberin gegangen war.
»Ich hätte ihr eine nennen können, die die Sache gut macht«, murmelte eine.
Der herbeigerufene Pfarrer befand verlegen, dass man die Tote, die Unselige, unmöglich in geweihter Erde würde begraben können. Es sei nicht rechtens, die üblichen Gebete über sie zu sprechen, unweigerlich müsse sie zum Teufel wandern, sie habe Schreckliches getan, sich am Leben vergriffen. Sein Urteil war weder kalt noch bösartig. Er selbst hätte ihr vielleicht vergeben können – aber der Herr im Himmel, so war er sich sicher, konnte es nicht.
Bestürzt hörte der Graf ihn an, ohne sich dagegen aufzulehnen, fühlte jenes unbeteiligte Mitleid mit Felicitas, das er schon seit einigen Monaten kannte, dachte an die Zeit zurück, die er mit ihr verbracht hatte. Warum hatte sie ihm nichts von dem Kinde gesagt, warum war sie immer so kalt gewesen, so verschlossen, so stumm! Alles hätte er versucht für diese Frau, doch was hatte er ausrichten können, wo sie sich von ihm abwandte? Wie hätte er sie lieben können, so nüchtern, so steif, so unbeteiligt, wie sie sich zeigte? Selbst Marie, der lautlose Schatten, schien jünger, hübscher, vitaler als Felicitas; eigentlich war es viel schwerer gewesen, mit Felicitas auszukommen, als mit Marie; eigentlich hätte er längst eine glückliche Ehe mit Marie führen können, wenn nur Felicitas nicht gewesen wäre.
Angelockt von dem Tumult kam denn auch seine rechtmäßige Frau, ekelte sich vor dem schrecklichen Anblick und dachte bestürzt, dass Felicitas nicht nur an ihrem eigenen Kind verblutet war, sondern auch an ihrem kraftlosen Warten, ihrem Festhalten an einer Liebe, die nichts anderes war als Einfallslosigkeit. Für einen kurzen Moment fühlte sie sich Felicitas nah, in ihre verwelkte Haut versetzt.
Doch als sich Mitleid in ihr regte, besann sie sich hastig, dachte an die schmähliche Geburt im Kuhmist und dass Felicitas schuld am einsamen Leben war – an ihrem eigenen und an Maries. »Jetzt ist es gut«, sagte sie laut mit Blick auf die Tote. »Jetzt ist es gut.«
Samuel nahm seine Mutter zum ersten Mal wahr. Sie ging zu ihm, versuchte ihn an der schlaffen Hand zu nehmen und mit sich zu ziehen. Wiewohl an seinem Körper das Blut der Verstorbenen klebte, war er jetzt ihr Sohn und nicht mehr der von Felicitas.
Er aber entzog ihr hastig die Hand, trat wie stets rasend und würgend vor Zorn um sich und traf den Grafen am Schienbein, gerade als jener tröstend seine Arme um die neu entdeckte Frau legen wollte.
»Fass mich nicht an!«, kreischte Samuel. »Du bist nicht meine Mutter!«
Nach Felicitas’ Tod führte für Marie kein Weg an Samuel vorbei. Bis dahin hatte sie die böse Nebenbuhlerin verklagen können, die ihr das Kind abspenstig gemacht und sie solcherart der Pflicht beraubt hatte, sich um dieses zu kümmern. Jetzt war sie gezwungen, sich vom offenkundig vorhandenen Sohn Wiedergutmachung für die Mutterschaft zu erwarten, die nur so lange als beschämend galt, als sich eine lebende Felicitas der schmählichen Geburt im Kuhstall besann.
Buhlend suchte Marie einen munteren, lebendigen Knaben, der den Menschen gefallen, sie betören und ein Familienglück beglaubigen sollte, das den Verrat des Domherrn übertünchte. Stattdessen traf sie auf ein verlorenes Kind, das nicht tröstete und das nicht erklärte, wie wundersam das Leben sei und wie aus einer Geburt im Kuhmist doch etwas Liebliches, Zutrauliches, Einnehmendes hervorgehen könne.
Immer wieder versuchte sie, ihn zu berühren, zu umarmen, zu streicheln – hoffend, es möge nur der Schrecken über den grausigen Anblick der Nebenbuhlerin gewesen sein, der ihn nach Felicitas’ Tod nach ihr treten ließ. Doch Samuel strafte ihr hündisches Warten auf einen Sohn, der Trotz, Verrat und Kränkung heilen möge, mit Ablehnung.
Er schrie nie und wehrte sich selten mit Worten – aber wenn sie ihm zu nahe trat, zuckte er zurück, wies sie ab und erklärte ein ums andere Mal, dass sie nicht seine Mutter sei.
Der Graf fand die Sache leidlich lustig. Die vage Ordnung, die seit Felicitas’ Tod zwischen ihnen herrschte, war durch Maries hoffnungsloses Bemühen, die Mutterschaft einzulösen, nicht bedroht. Sollte sie sich nur an dem störrischen Kind die Zähne ausbeißen – er würde sie gewiss nicht davon abhalten, solange sie nicht Gleiches von ihm verlangte.
Während Marie um die Liebe des Sohnes buhlte und der Graf dabei zusah, wurde Samuel erzogen. Ein Lehrer, der auf dem Gutshof als Erzieher fungierte und sich bereits der zwei Söhne des Grafen aus erster Ehe annahm, brachte ihm ab dem siebten Lebensjahr das Schreiben und Rechnen bei. Ob Samuel dies gefiel, ließ sich nicht erkennen. Zumindest gehorchte er ohne Widerstand. Er lauschte stumm, schluckte, was man in sein Gedächtnis träufelte, und spuckte hernach, wenn man auf Wiederholung pochte, alles wieder aus.
Was ihm gefiel, war, dass er jetzt nicht nur weißes Papier, sondern auch noch schwarze Tinte besaß. Wiewohl vom Lehrer angehalten, Buchstaben zu schreiben, nutzte er beides, um die Gesichter der Menschen darauf festzuhalten, die ihm begegneten – beglückt, dass diese Zeichnungen länger währten als jene Skizzen, die er in die feuchte Erde gestochert hatte.
Wenn er malte, so nichts als Menschen. Nie griff er nach der Landschaft, dem aufgezwirbelten Himmel, dem schwitzenden Korn, der geröteten Sonne. Demgegenüber war er blind – stattdessen verkrochen sich seine Augen in jedes menschliche Antlitz.
Lange Jahre malte er heimlich, stapelte die Bilder unter seinem Bett, ohne sie selbst jemals genau zu mustern, und zeigte sie niemandem. Erst als er ins elfte Lebensjahr ging – es war zwei Jahre vor der Revolution im März – geschah es, dass jemand eine seiner Malereien erspähte.
Damals beschloss der Graf, dass Samuel auf die Firmung vorzubereiten sei und dass dies durch den Pfarrer Martinus von Greifenthal geschehen sollte, denselbigen, der einst Samuels Namen gewählt und ihn zur Taufe gehoben hatte. Der Graf entschied auch, dass der Pfarrer dem Knaben eine sorgsame religiöse Erziehung angedeihen lassen möge, vielleicht als Vorbereitung auf den geistlichen Stand, zumindest aber zu dem Zweck, nicht nur die Seele, sondern auch deren Heil zu kontrollieren und zu lenken.
Martinus von Greifenthal entstammte einer verarmten Familie, hatte das Priesteramt gewählt, um dem Ruin zu entkommen, und erkaufte sich als Mittler Christi einen Respekt, den ihm seine Herkunft niemals hätte gewähren können.
Er passte sich den pastoralen Grundregeln seiner Zeit an, die Menschen zu einer aufrechten moralischen Haltung zu führen, sie die zehn Gebote zu lehren und somit in festen Lebensprinzipien zu verwurzeln. Zugleich aber war er damit uneins, wenn es um die Prioritäten des eigenen Glaubens ging. Der Verstand und die Moral, die dem Verstand folgte, waren ihm von großer Bedeutung – aber sein Herz war ihm wichtiger, und dieses Herz liebte ausschweifende Geschichten. Die Vätererzählungen des Alten Testaments gehörten dazu, die Schilderungen von Jesu Leben im Neuen, vor allem aber die vielen Legenden, die Zeugnis gaben vom wundersam starken Gottvertrauen vergangener Geschlechter.
Pfarrer Greifenthal war sanft und gutmütig, studierte aber am liebsten jene Viten, in denen die großen Heiligen blutrünstige Martyrien erfuhren, in denen dem einen die Gedärme aus dem noch lebenden Leib gezogen und aufgerollt, dem anderen stückweise seine Haut vom Leib gerissen und der Rest verbrannt wurde.
Die Vorstellung, dass Menschen dies ertrugen, war ihm selbst unerträglich. So war die Theologie für ihn ein Mysterium, das sich nur erfühlen, nicht erdenken ließ – und dies wiederum hieß, dass er entgegen jeder pastoralen Regel (und immerhin hatte er dereinst die Schriften des Matthias Fingerlos studiert) die Fragen der Moral häufig zugunsten der Farben jener Geschichten zurückstellte.
Gleiches geschah auch, wenn er bei Samuel weilte. Noch ehe der Knabe die zehn Gebote herunterzählen konnte, war es ihm dank Schulung durch Hochwürden möglich, die Heiligen im Jahreskreis einzeln zu benennen. Dass der Knabe beim Zuhören zeichnete, störte den Pfarrer nicht. Vielleicht würde es dem talentierten Kind dereinst gegeben sein, Kirchenwände mit Märtyrerlegenden auszuschmücken. Er ließ ihn gewähren und sah nicht recht hin, was der Knabe tat. Eines Tages erzählte er ihm vom Schicksal der heiligen Perpetua, die von den Hörnern eines wilden Stieres in der römischen Arena lebendig aufgespießt worden war. Ein grausames Geschick, gewiss, doch wie das bei Märtyrern ihrer Art üblich war, öffnete sich der Himmel, ließ Engel regnen, die Sterbende von der heiligen Schar aufnehmen und mit Lorbeer krönen.
Der Pfarrer schnaufte zufrieden. Er legte Wert darauf, dass die Geschichten trotz allem ein gutes Ende nahmen.
»Engel?«, fragte Samuel aufblickend.
Der Pfarrer lächelte nachsichtig. »Gewiss hast du schon von ihnen gehört!«, gab er zurück. »Und gerne sage ich dir mehr darüber!«
Wiewohl er sich nun nicht weiter Perpetuas mörderischem Stier widmen konnte, war es ihm eine angenehme Pflicht, den Jungen über die himmlischen Hierarchien aufzuklären.
»Engel sind die kostbarsten und teuersten Geschöpfe, die zwischen Himmel und Erde wohnen«, hob er zu dozieren an und betupfte sich seine Stirn, weil ihm warm wurde. »Sie sind Boten Gottes, des Kosmokrators willfährigste Diener, leibfreie, numinose Geister, die Luft und Meere, Himmel und Erde mit ihrem sanften Sein erfüllen. Sie schützen behutsam Kinder, begleiten die Seele der Verstorbenen, kämpfen mit Inbrunst gegen die Dämonen.«
Pfarrer Martinus Greifenthal machte schwer atmend eine Pause und gewahrte, dass Samuel aufgehört hatte zu malen. Dies schien Hochwürden ein gutes Zeichen zu sein, um bestärkt fortzufahren.
Die drei größten Engel, erklärte er, hießen Gabriel, Michael, Raphael. Es gebe noch weitere, die Namen trügen. Uriel, Rafael, Raguel, Sariel, Remiel. Gott schicke sie durchs Universum als seine Botengänger und Diener und weise ihnen die vielfältigsten Aufgaben zu – sie hätten Visionen zu deuten, den Kosmos zu ergründen und Recht zu lehren.
Samuel starrte gebannt.
»Den Engeln ist es zudem zu eigen«, ergänzte Hochwürden Greifenthal lächelnd, »dass sie sich stets für das Gute entscheiden. Ein Engel, der heilig ist, wird niemals eine Sünde tun, weil ihm das Heil – hat er sich diesem zugewendet – für immer und ewig gebührt. Freilich«, und bei diesen Worten leckte sich der Pfarrer seufzend über die Lippen, »freilich gibt es auch solche Engel, die sich für das Böse und gleichsam für die Verdammung entschieden haben. Der Teufel ist solch ein gefallener Engel. Man nennt ihn Satanael oder Luzifer, auch Kesperlin oder Sammael, was heißt: Engel des Giftes. Dieser Engel besitzt noch den Abglanz seiner früheren Hoheit, aber er ist das Hässlichste und Böseste, was man sich denken kann. Er ist ein finsterer, verabscheuungswürdiger Knecht, dem Ewigen Feuer verfallen, wo Sünder bratend leiden und wo der Boden niemals erlöschend Schwefeldämpfe speit. Aus seiner rotschwarzen Fratze tönen nur gurgelnde Laute; in seiner verkommenen Seele sind das Elend und der Jammer der Welt auf immerdar eingeschrieben.«