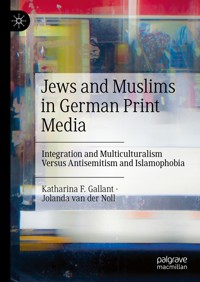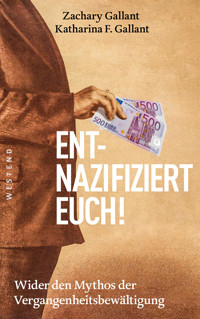
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bedeuten die Verbrechen von Nazi-Deutschland heute für jüdische Menschen sowie für Deutsche? Überlebende der Nazi-Zeit gibt es kaum noch - weder auf Seite der Opfer noch auf Seite der Schuldigen. Und doch bedeutet das Versterben dieser Generation nicht, dass alle Spuren der Nazi-Zeit unsichtbar würden. Entnazifiziert euch! erklärt, wie oberflächlich die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurde und wie wenig sie mit den jüdischen Opfern der Nazi-Zeit zu tun hatte. Es wird deutlich, dass die Profite der Nazis noch heute die deutsche Gesellschaft prägen, von der Wirtschaft über kulturelle Veranstaltungen bis hin zur interreligiösen Bildung und tagespolitischen Fragen. Während es im Alltag fast unmöglich scheint, diesen Nazi-Spuren auszuweichen, gibt es doch einen Weg, um die Nazi-Belastung zu überwinden. Es ist nicht zu spät, unser aller Leben zu entnazifizieren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Zachary Gallant Katharina F. Gallant
Entnazifiziert euch!
Wider den Mythos der Vergangenheitsbewältigung
Ins Deutsche übersetzte, angepasste und korrigierte Version.
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-074-6
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Zachary Gallant forschte als Fulbright-Stipendiat der US-Regierung zum Postkonflikt-Wiederaufbau im ehemaligen Jugoslawien und hat einen Master-Abschluss in Internationaler Politik von der Universität London. Seit 2015 führt er Antidiskriminierungs- und Klimagerechtigkeitsprojekte in ganz Deutschland durch, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und von der Europäischen Union gefördert werden. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied des American Jewish Congress(MD Chapter) und hat an Universitäten in ganz Europa über Volkszugehörigkeit, Konflikt, Migration, wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Konzepte des Jüdischseins unterrichtet.
Dr. Katharina F. Gallant ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Ihre Forschungen als Ethnologin und Psychologin befassen sich mit Interkulturalität und interethnischen Konflikten, von der Behandlung jüdischer und muslimischer Gemeinschaften in Europa bis hin zur Rolle der indigenen und afroamerikanischen Minderheiten in Nord- und Lateinamerika. Sie hat an Universitäten in Europa und Lateinamerika gelehrt und Vorträge gehalten über interethnische Konflikte, Interkulturalität und friedliche Koexistenz. Von 2019 bis 2021 gehörte sie dem Unkeler Stadtrat an.
Dieses Buch begann als einfache Recherchearbeit, entwickelte sich aber durch tiefschürfende Gespräche zwischen Zachary und Katharina sowie einen anregenden Austausch mit Expert*innen auf dem Gebiet der Ethik, der Wirtschaft, der Gesichte und der Menschenrechte zu einer umfangreichen Untersuchung über Deutschlands Umgang mit seiner Nazi-Vergangenheit. Zacharys jüdische Wurzeln gehen zurück auf Rabbiner im Nahen Osten ebenso wie auf Schtetl, die während der Nazi-Besetzung Osteuropas ausgelöscht wurden. Katharina kann ihre Wurzeln zurückverfolgen sowohl auf Mitverschwörer des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 als auch auf Generäle der Wehrmacht, die ihre Truppen an genau den Orten vorstanden, an denen Zacharys Vorfahren einst lebten. Die jüdischen Perspektiven in diesem Buch sind die von Zachary, da Katharina sich nicht anmaßt, in diesem Bereich eine Stimme zu haben, aber diese spezifisch jüdischen Themen wurden mit Rabbiner*innen und anderen jüdischen Menschenrechtler*innen diskutiert, um sicherzustellen, dass sie eine breitere jüdische Perspektive repräsentieren. Dieses Buch ist das Ergebnis einer respektvollen Zusammenführung dieser unterschiedlichen Hintergründe in der Hoffnung, eine Strategie für eine echte Versöhnung aufzuzeigen. Wir hoffen, dass dieses Endprodukt als ein erster Schritt in Richtung eines »Dialogs in Differenz« zwischen jüdischen Menschen und nicht-jüdischen Deutschen gesehen werden kann und als ein erster Schritt zur wirklichen Überwindung von Deutschlands erdrückendem Nazi-Erbe.
Widmung
Das jüdische Leben hat viele Erscheinungsformen. Es wird verkörpert nicht nur von Rabbinern, Ärzten, Anwälten und Bankern, und seine Geschichte erzählt nicht nur von tragischen Helden und gerechten Opfern.
Dieses Buch ist nicht allein den Überlebenden gewidmet, sondern vor allem den Unaufhaltsamen. Den Nazi-Jägern, den Rebellen wie Albert Einstein, Dr. Ruth, Marcel Reich-Ranicki, Helga Newmark, Henry Morgentaler, Hannah Arendt, John Slade, Simone Veil und sogar Henry Kissinger, Paul Gelb, Max Eisenhardt und Abba Kovner und so vielen anderen, die sich gegen die Nazis und ihre Anhänger auflehnten und die sich weigerten, lediglich als Opfer definiert zu werden.
Inhalt
Cover
Einleitung: Schildkröten und Nazis
Teil I: Die Wurzeln des modernen Deutschland
Ein deutsches Alltagsszenario
Schneeflocken und Lawinen
»Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.«
EDEKA
Melitta
Bahlsen
Dr. Oetker
Vorwerk
Tempo
Henkel
Wunschdenken
Henkels Persilschein
Henkel in Unkel: Geteilte Profite – geteilte Mitschuld
Was bedeutet Entnazifizierung wirklich?
Gab es überhaupt bereitwillige Nazis?
Die Rolle der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs bei der Nicht-Entnazifizierung
Entnazifizierung Ost
Reparationszahlungen – individuell oder strukturell?
Verbrecher und Helden
Teil II: »Gedächtnistheater«
»Niemals sollten wir vergessen, was geschah. Niemals sollten wir vergessen, was man geschehen ließ, und niemals sollten wir vergessen, wie leicht es fiel.«
Aufarbeitung ohne Juden
Die internationale Bedeutung der deutschen Aufarbeitung
Gesellschaften, die begonnen haben, die Stimmen nicht-dominanter Gruppen zu hören
Was macht einen Juden zum Juden?
Die »Judenrasse« zwischen weißer und arabischer Identität, zwischen Anderssein und Aussterben: Was es seit dem 7. Oktober 2023 bedeutet, in Europa jüdisch zu sein – ein Exkurs
Nestbeschmutzer
Teil III: Durch und durch
Unsichtbare Opfer und fortbestehende Täterstrukturen
Kommunale Mittäterschaft
Braune Stiftungen
Politischer Einfluss
Der neue deutsche Nationalismus
»Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert, die Vergangenheit«:347 Die Nazi-Geschichte der modernen deutschen Verlagsindustrie
Die heutige Reichsbahn
Nach Hause kommen
Gegenargument – Was finden wir unter den Nazis?
Kunst
Musik
Philosophie und Hochschullandschaft
Kirchen
Naturwissenschaften
Nachhaltigkeit
Hitler als der einzige Nazi?
Teil IV: Schlussfolgerungen
Um wie viel geht es hier wirklich?
Reform als moralische, wenn auch nicht als gesetzliche Verpflichtung
Entnazifizierung 2.0 – Deutschland rettet die Welt
Danksagung
Anmerkungen
Bibliographie
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Schildkröten und Nazis
Der Titel dieses Buches Entnazifiziert euch! ist kein persönlicher Angriff. Er ist eine institutionelle Forderung. Wir betonen ausdrücklich, dass wir viel Liebe und Respekt für deutsche Familienmitglieder, Freunde, Kollegen und einen Großteil der deutschen Gesellschaft empfinden.* In diesem Buch geht es nicht darum, einzelne Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu beschuldigen, den Nazis und ihrer Gesinnung nahezustehen.** Als kurz vor Drucklegung dieses Buches ein Sturm unser Haus beschädigte, war die erste Person, die nach Abschwächen des Windes vor die Tür trat, um uns zu helfen, unser 70-jähriger deutscher Nachbar in seinen hölzernen Handwerkerschuhen. Er half uns, das gesplitterte Holz zu sortieren und zu reparieren, was zu retten war. Ihm war es egal, woher wir kamen; es spielte keine Rolle, welche Haut-, Haar- oder Augenfarbe wir hatten: Er sah Nachbarn in Not und es als seine Aufgabe an, zu helfen. Als zu einem anderen Zeitpunkt unsere Familie größere gesundheitliche Probleme hatte, waren es unsere deutschen Freunde und Kollegen von der Katholische Kirche, die alles dafür taten, uns zu helfen. Immer wieder haben wir erlebt, wie unsere deutschen Nachbarn und Freunde sich für andere Menschen eingesetzt haben, für Deutsche ebenso wie für Nicht-Deutsche.
Der englische Titel dieses Buches, Nazis All the Way Down ließe sich sinngemäß mit »Nazis von A bis Z« oder »Nazis durch und durch« übersetzen. Wichtig ist in jedem Fall, dass, wenn wir hier von Nazis sprechen, es nicht um einzelne Personen geht. Es gibt einen Unterschied zwischen der Formulierung »Nazis überall!«, die gezielt Personen als Nazis betiteln würde, und »Nazis durch und durch« als Charakterisierung der institutionellen Ebene, des gesamten deutschen Systems.
Die Vorstellung von »all the way down« stammt von einer philosophischen Erklärung zum Wesen der Welt. Stephen Hawking, einer der größten Denker unserer Zeit, erzählt in seinem Werk Eine kurze Geschichte der Zeit von der Begegnung eines Philosophen, der einen Vortrag hält, mit einer Dame aus dem Publikum:
»Als der Vortrag beendet war, stand hinten im Saal eine kleine alte Dame auf und erklärte: ›Was Sie uns da erzählt haben, stimmt alles nicht. In Wirklichkeit ist die Welt eine flache Scheibe, die von einer Riesenschildkröte auf dem Rücken getragen wird.‹ Mit einem überlegenen Lächeln hielt der Wissenschaftler ihr entgegen: ›Und worauf steht die Schildkröte?‹ – ›Sehr schlau, junger Mann‹, parierte die alte Dame. ›Ich werd’s Ihnen sagen: Da stehen lauter Schildkröten aufeinander.‹«1
Der Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, Antonin Scalia, zitierte in einer Stellungnahme zu einem Rechtsfall eine ähnliche Geschichte, wobei in seiner Version die Erde auf dem Rücken eines Tigers steht, der Tiger wiederum auf dem Rücken eines Elefanten und der Elefant auf einer Schildkröte oder sogar auf unendlich vielen Schildkröten.2
Das Bild der Schildkröten ist folgendermaßen zu begreifen: Es gibt die Welt, die wir sehen, unsere Erde. Unter der Welt, die wir sehen, gibt es die Welt, von der wir wissen, dass sie die Welt, die wir sehen, stützt: Dies sind unsere Institutionen, die Scalia auch im Sinnbild des Tigers zusammenfasst. Darunter liegt eine Welt, die wir zu verstehen glauben, wenngleich wir sie nicht wirklich sehen können, von der wir aber wissen, dass sie da ist und wiederum die Institutionen stützt, die unsere Welt aufrechterhalten. In Scalias Bild ist dies der Elefant. Und unter all diesen Ebenen sind unendlich viele Schildkröten als Sinnbild der immer wieder auf sich selbst verweisenden Basis der Gesellschaft, unterhalb derer nichts anderes existiert.
Was haben also Schildkröten mit Nazis zu tun? Im letzten halben Jahrhundert hat Deutschland weltweit den Ruf erlangt, sich ehrlich mit den Verbrechen der Nazi-Zeit auseinanderzusetzen. Dieser Prozess, der allgemein als Aufarbeitung bezeichnet wird, befasst sich mit der systematischen Verarbeitung der Geschichte, inklusive des Eingeständnisses individueller und systemischer Schuld am Völkermord an den Juden sowie an anderen Individuen (zum Beispiel politischen Gegnern) und Gruppen (zum Beispiel Roma und Sinti), die das Nazi-Regime aus verschiedenen Gründen zu beseitigen suchte. Es ist die nationale Entschuldigung: nicht nur einmalig, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern immerwährend und ewig. Man meint es ernst, und man meint es immer wieder, für immer. Das nationale Handeln wird, wenn nicht von der nationalen Schuld, so doch zumindest von der Absicht bestimmt, »nie wieder« ein vergleichbares Verbrechen zu begehen. Darüber hinaus steht im Fokus, die spezifische(n) Gruppe(n), die durch Nazi-Deutschland zum Opfer wurden, vor weiterem Schaden zu bewahren, in welcher Form auch immer.
Dieser Prozess der Aufarbeitung, der sich zugegebenermaßen auf die Juden konzentriert, schloss sich an die vermeintliche Entnazifizierung während der Gründungszeit der Bundesrepublik an und wurde lange als gesellschaftliches Kernstück des modernen Deutschlands gehandelt.*** Die Entnazifizierung wiederum hatte die öffentliche Diskussion über die Rolle des deutschen Durchschnittsbürgers in den Vordergrund gestellt, hatte aber auch nach der Bedeutung von Persönlichkeiten aus Literatur und Wissenschaft sowie der Rolle von Institutionen wie den Kirchen gefragt, die zwar nicht dem Nazi-Regime angehört, die aber möglicherweise zum Aufstieg des Nazi-Regimes und damit zum Holocaust beziehungsweise zur Shoah beigetragen hatten.**** Die unzulängliche Umsetzung der Entnazifizierung in der frühen Zeit der Bundesrepublik Deutschland wurde von der nächsten Generation, den 68ern, angeprangert. Sie forderten eine umfassende Überprüfung des politischen und gesellschaftlichen Fundaments des modernen Deutschlands, inklusive der persönlichen Erzählungen und der offiziellen Geschichtsschreibung über die Nazi-Zeit.
Die Aufarbeitung dauert auch heute noch an. Sie wird sichtbar unter anderem in Stolpersteinen aus Messing, die vor Häusern verlegt werden, in denen einst Opfer der Shoah lebten. Indem in die Steine die Namen ermordeter Juden, ihr Geburtsjahr sowie das Jahr und der Ort ihres Todes eingraviert sind, erzählen sie überaus skizzenhaft die Geschichte der deutschen Schuld, wie sie sich in diesen Einzelschicksalen niederschlägt. Bis 2023 sollen in ganz Europa etwa 100 000 dieser Steine verlegt worden sein, die meisten davon in Deutschland.3 Sichtbar wird die Aufarbeitung auch darin, dass in vielen deutschen Städten riesige Shoah-Gedenkstätten errichtet wurden, dass es in Deutschland landesweit über 300 Gedenkstätten gibt und dass die Shoah und die Schrecken des Nationalsozialismus in den Schulen ausführlich behandelt werden.4
Im Gegensatz zu Polen, Kroatien, Rumänien oder auch Frankreich und den Niederlanden hat Deutschland seine Nazi-Vergangenheit kritisch reflektiert und eine neue Identität geschaffen, die auf dem Ansinnen beruht, eine Wiederholung dieser dunklen Geschichte niemals zuzulassen. Im Großen und Ganzen versucht Deutschland nicht, sich von seiner Nazi-Vergangenheit zu befreien; im Gegenteil ist es gerade das Zugeben seiner historischen Schuld, das Deutschland im internationalen Vergleich besonders ehrlich erscheinen lässt.
Was in Deutschland bis in die frühen 2020er Jahre hinein vorbildlich war (auch wenn sich dies gegenwärtig zu ändern scheint), ist die vollständige Akzeptanz dieser Schuld. Im Wissen um die Schuld der eigenen Nation zu leben und diese Schuld nicht als Last, sondern als Verantwortung zu akzeptieren: Das ist ein Phänomen, das es im globalen Norden sonst nirgendwo gibt, und es erscheint als Lichtblick angesichts des wachsenden Nationalismus, der so viele Länder vergiftet.
Die Betonung der Aufarbeitung der eigenen Nazi-Vergangenheit ist ein Kernstück der Identität des modernen Deutschland nach 1945. Die häufige Bezugnahme auf die Aufarbeitung bei Veranstaltungen und in Veröffentlichungen ist auch der Grund, warum viele jüdische Wissenschaftler und Aktivisten in den Vereinigten Staaten die deutsche Aufarbeitung als Modell für den Umgang mit Amerikas eigener rassistischer Geschichte propagieren. Das ist die Welt, die auf dem Tiger der institutionalisierten Aufarbeitung reitet.
Doch die Institutionalisierung der Aufarbeitung bedeutet im Umgang mit Deutschlands Nazi-Vergangenheit auch eine oberflächliche Normalisierung dieses ungeheuren Verbrechens. Allzu leicht wird eine tiefgreifende Aufarbeitung ersetzt durch einen oberflächlichen Umgang mit der Geschichte, der eine Fülle von Faktoren ignoriert: Hierzu zählen an erster Stelle der internationale Druck als auslösende Kraft des Aufarbeitungsansinnens, aber auch der Rassismus, der ausgerechnet der Aufarbeitung selbst innewohnt. Jene Unzulänglichkeiten werden deutlich, wenn wir unter den Tiger blicken und dort des Elefanten gewahr werden. Unter dem Elefanten finden wir dann einige zentrale Strukturen, die eine aufrichtige und tiefgreifende Aufarbeitung aktiv verhindern und somit erklären, warum die gegenwärtige Aufarbeitungspraxis nicht vollends gelingen kann. Obwohl es in Deutschland viele gibt, die sich die Aufarbeitung zu Herzen nehmen und sie nutzen, um die deutsche Gesellschaft und Politik moralischer zu gestalten, reduzieren diese Strukturen die sichtbare Aufarbeitung letztlich auf eine unaufrichtige Maske, die sogar einige der abscheulichsten Verbrechen der Geschichte zu beschönigen sucht.***** Dieses Buch wird diese Maske abnehmen und zeigen, was hinter der moralischen Fassade des modernen Deutschland steckt.
Teil I: Die Wurzeln des modernen Deutschland
Ein deutsches Alltagsszenario
Wir sitzen gemütlich im Esszimmer unseres kleinen Hauses in einer kleinen Stadt im Rheinland, an dem hübschen antiken Tisch, der seit den späten 1930er Jahren im Besitz unserer Familie ist. Auf ihm stehen ein paar Tassen mit dampfendem Kaffee, den wir heute Morgen noch schnell bei EDEKA gekauft und jetzt mit einem Filter von Melitta aufgebrüht haben. Neben den Kaffeetassen stehen zum Naschen zwei Schälchen mit Keksen: für die Erwachsenen Butterblätter, die mit der schönen Eichenlaubform, und für die Kinder LEIPNIZ-Kekse, beide von Bahlsen.
Auf dem Tisch liegen auch zwei überregionale Zeitungen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung, so dass wir zwei verschiedene Perspektiven auf die Nachrichten bekommen und das Gefühl haben, nicht von einer Seite manipuliert werden zu können. Außerdem liegt auf dem Tisch Das große Dr. Oetker Backbuch. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen, wurde es doch schon 1983 herausgegeben, doch gelegentlich blättern wir noch gerne darin, wenn wir auf der Suche nach süßen kulinarischen Inspirationen sind – die wir mit unserem Thermomix von Vorwerk heute natürlich viel leichter zubereiten können – oder uns an den duftenden Gugelhupf erinnern, den Oma immer in unserer Kindheit gebacken hat. Beim Gedanken an die kürzlich verstorbene Großmutter rollt uns eine Träne über die Wange, die wir schnell mit einem Tempo-Taschentuch wegwischen.
Folgen wir nun den Kindern aus dieser Szene auf ihrem Weg durch die kopfsteingepflasterten Straßen der Stadt, die vom örtlichen Geschichtsverein gepflegt und beworben wird, vorbei an dem Sportplatz, auf dem sie später in der Woche Fußball trainieren werden und der vom örtlichen Sportverein betrieben wird: Auf ihrem Weg durch diese Straßen kommen die Kinder an einer Bronzetafel vorbei, die den »jüdischen Mitbürgern« gewidmet ist und die Geschichte der Synagoge erzählt, die am 10. November 1938 niedergebrannt wurde. Die Kinder nahmen an der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Pogroms im vergangenen Jahr teil, bei der Dutzende von Einwohnern über das Leiden und den Tod der Juden berichteten, die einst in der Stadt gewohnt hatten. Die Einwohner bekannten dabei öffentlich, dass diese Verbrechen nicht nur von führenden Nazis begangen wurden, sondern dass es Bürger, ja sogar Nachbarn waren, die sich aktiv an diesen Verbrechen beteiligten oder sie zumindest bereitwillig geschehen ließen. Heute gibt es keine jüdische Gemeinde mehr in der kleinen Stadt. Im Gegenteil gilt, was eine jüdische Führungspersönlichkeit einst im Interview formulierte: »Die Wahrscheinlichkeit, einen Juden in Deutschland zu treffen, ist geringer, als einen Vierer im Lotto zu haben«,5 und die Kinder unserer kleinen Alltagsszene haben selbst nie einen Juden getroffen. Aber dank der jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen und der Gedenktafeln kennen sie die Geschichte der letzten Juden ihrer Heimatstadt.
Später kommen die Kinder in ihrer Schule an, die vom örtlichen Schul-Förderverein unterstützt wird. Nach der Schule schaukeln sie auf dem Spielplatz des neu renovierten Parks, der nach einem Mitglied der Unternehmerfamilie Henkel benannt ist. Die Kinder freuen sich an den neuen Spielgeräten, wissen sie doch, dass ohne die großzügigen Zuwendungen der Mäzenatenfamilie die öffentlichen Plätze der Stadt um einiges ärmer wären. Nach dem Schaukeln steigen die Kinder in einen Zug der Deutschen Bahn, um zur Probe des Kirchenchors der Nachbarstadt zu gelangen. Erst am frühen Abend, wenn die Dämmerung schon eingesetzt hat, kehren die Kinder nach Hause zurück. Es ist ein hübsches kleines Haus, in dem ihre Eltern erstaunlich wenig Miete an ein deutsches Ehepaar zahlen, dessen Familie dieses Haus seit 1939 besitzt und das nur diese vergleichsweise niedrige Miete verlangt, damit eine nette junge Familie wie die ihre es sich leisten kann, darin zu wohnen.6
Dieses nette kleine Alltagsszenario des Lebens in einer deutschen Kleinstadt wurde von jener Stadt inspiriert, in der wir fast ein Jahrzehnt verbrachten und genau diese Art von Leben führten. Die Stadt, die wir beschreiben, ist zwar der Ausgangspunkt dieses Buches, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich unsere Szene in praktisch jeder westdeutschen Kleinstadt abspielen könnte. Diese Szene ist die Welt, die wir sehen, und sie sieht unschuldig genug aus. Sogar der Fokus auf der Shoah-Geschichte passt hier, da solche Gedenkveranstaltungen und -tafeln eine bedeutende Rolle im modernen deutschen Leben spielen, fast gleichwertig mit der Sichtbarkeit der zuvor und im Anschluss erwähnten Unternehmen, Vereine und Institutionen. Aber natürlich sind die genannten Unternehmen nicht willkürlich ausgewählt worden. Diese Unternehmen haben alle eine düstere NS-Vergangenheit, und als die Bundesrepublik Deutschland 1949 auf den Trümmern von Nazi-Deutschland gegründet wurde, konnte dieser Vorgang die Verbrechen der Nazi-Jahre nicht einfach ungeschehen machen.
Schneeflocken und Lawinen
Als wir mit unseren Recherchen begannen, glaubten wir, dass wir gerade über den einzigartigen Fall einer Unternehmerfamilie gestolpert seien, die von den Nazi-Verbrechen profitiert hatte, und dass wir durch unsere Nachforschungen unserer lokalen Gemeinschaft dabei helfen würden, ehrlich mit dieser Vergangenheit umzugehen. Im Zentrum unseres Interesses standen die Familie und das Unternehmen Henkel, von deren Philanthropie wir persönlich profitiert hatten. Bemüht einen tieferen Einblick in die Problematik zu erhalten, wandten wir uns an anerkannte Historiker. Einige von ihnen, insbesondere Peter Hayes, der frühere Vorsitzende des akademischen Ausschusses des US Holocaust Memorial Museum, waren zu einem engeren Austausch bereit und so wurden die Hinweise dieser Experten richtungsweisend für unsere Recherchen auf eine Weise, die wir nie erwartet hatten.
Je tiefer wir in die Materie eindrangen, desto schrecklicher wurden die einzelnen Aspekte und desto mehr Zusammenhänge taten sich auf. Wie in unserem Buch Brauner Boden beschrieben, stand Henkel durch die Zusammenarbeit mit anderen Nazi-Unternehmen und durch den Handel mit den von Juden gestohlenen Vermögenswerten plötzlich mit Verbrechen einer Größenordnung in Verbindung, die wir nie in Betracht gezogen hatten. Und als wir lernten, welche Fäden wir ziehen mussten, um größere Teile der Nazi-Belastung sichtbar werden zu lassen, entdeckten wir, dass Unternehmen wie Adidas und Dutzende andere mit einigen der brutalsten Morde in Auschwitz in Verbindung gebracht werden können.
Als wir weiter nachforschten, erfuhren wir, dass Henkel nicht das einzige Unternehmen war, das sich nicht mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hatte. Aber was noch schlimmer war: Wir entdeckten, dass in den zahlreichen Fällen von Familien und Unternehmen, die Studien über ihre Nazi-Verbrechen und ihre Geschichte in Auftrag gegeben hatten, diese Studien selten, wenn überhaupt, zu einer umfassenderen Entschädigung oder gar einer Reform geführt hatten. Als wir versuchten, den Schnee von den Gipfeln des »Berges Henkel« zu fegen, um das aufzudecken, wovon wir annahmen, dass es sich um den Einzelfall einer fehlgeschlagenen Entnazifizierung handelte, landeten diese Schneeflocken auf benachbarten Gipfeln und brachten die vermeintlich unberührte Landschaft dort durcheinander. Ein Blick über Henkel hinaus wurde unausweichlich und moralisch notwendig. So verließen wir die Grenzen unserer ursprünglichen Fallstudie mit dem Titel Brauner Boden und folgten den Spuren der resultierenden Schneeballstichprobe, um das Ausmaß von Henkels Nazi-belastetem Netzwerk aufzuzeigen. Auf diese Weise verdichteten sich die Schneeflocken erst zu Schneebällen, dann zu kleinen Schneerutschen, bevor sie alle zusammen als Lawine auf die Fassade der deutschen Nazi-Aufarbeitung herabstürzten.
Wir fanden heraus, dass Haushaltswaren, wie sie von Henkel hergestellt werden, assoziiert waren mit den Aktivitäten anderer prominenter Unternehmen der gleichen Branche, ebenso wie mit Unternehmen in der Lebensmittelproduktion oder der Herstellung von Haushaltsgeräten, Bekleidung und Schuhen, mit führenden Unternehmen der Mobilitätsbranche, der Industrietechnik, Energietechnik oder Logistik, aber auch mit Pharmariesen, der Verlagswelt, ganzen Supermarktkonzernen und Kernunternehmen des deutschen Finanzsektors – um nur einen kurzen Überblick zu geben. Während einige dieser Unternehmen sich bis heute in Familienbesitz befinden, sind andere längst in Aktiengesellschaften umgewandelt worden, an denen die Gründerfamilien kaum noch beteiligt sind. Wieder andere Institutionen wie renommierte Banken oder staatliche Unternehmen fallen in keine dieser beiden Kategorien. Was die Schneeflocken und Schneebälle, die sich in diesem Buch türmen, jedoch eint, ist ihre Verbindung zur Nazi-Zeit und zum deutschen Völkermord an den Juden. Es ist diese Verbindung zu Verfolgung und Tod von Juden und anderen Minderheiten, die es vielen Unternehmen ermöglichte, ein Vermögen aufzubauen, das sie bis heute zu den führenden Kräften der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft zählen lässt.
Die Profite aus der Nazi-Zeit machen nicht bei den in den folgenden Kapiteln genannten Unternehmen halt. Sie beschränken sich nicht auf Produkte, Marken und Unternehmen mit einem offensichtlich deutschen Namen oder in rein deutschem Besitz. Das beste Beispiel für den weitreichenden Charakter der Nazi-Verstrickungen ist die Firma Thomas Built Buses. Was könnte amerikanischer sein als ebendiese gelben Schulbusse, die wir alle in amerikanischen Filmen und Fernsehsendungen gesehen haben? Nun, die Firma Thomas Built Buses ist seit 19987 im Besitz des Nazi-Profiteurs Daimler Trucks.8 Laut der Website von Thomas Built Buses ist »Thomas Built Buses … der führende Hersteller von Schulbussen in Nordamerika mit einem Marktanteil von 37 % am Markt für konventionelle Schulbusse«.9 Dies bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Schulbezirk in Nordamerika neue Busse braucht, der Auftrag mit großer Wahrscheinlichkeit an ein Unternehmen vergeben wird, das mit Nazi-Profiteuren in Verbindung steht. Ähnlich verhält es sich mit VW, dessen Ursprung direkt mit Hitlers Absicht in Verbindung gebracht werden kann, ein deutsches Auto für Deutsche zu schaffen, wobei VW in hohem Maße auf Zwangsarbeit****** (sowohl jüdisch als auch nicht-jüdisch) angewiesen war und »vier Konzentrationslager und acht Zwangsarbeitslager auf seinem Gelände betrieb«.10 Zu VW gehören die typisch italienischen Marken Lamborghini und Ducati sowie Bentley,11 ein Eckpfeiler der britischen Automobilkultur, während die ebenfalls britischen Marken Rolls Royce und Mini Cooper im Besitz von BMW sind,12 dem Unternehmen des Nazi-Profiteurs Herbert Quandt.13 Es ist nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit kaum möglich, Nazi-Profiteure beziehungsweise ihre Produkte vollständig zu meiden.
Die Nazi-Belastung ist so systemisch, dass, sobald wir ein einziges Beispiel aufgreifen, der Rest einfach folgt. Sobald wir unsere Aufmerksamkeit auf einen Aspekt des täglichen Lebens in Deutschland richten, wird es fast unmöglich, die Spuren der Verbrechen überall um sich herum zu ignorieren. Wir empfehlen, dieses Buch von Anfang bis Ende zu lesen, denn es ist atemberaubend, die Entwicklung der Lawine zu beobachten.
Wir haben unser Bestes getan, um den Schneeballeffekt zu kontrollieren und die Erzählung trotz der Fülle an schrecklichen Informationen übersichtlich zu halten: Nach einer kurzen Erkundung der Nazi-Geschichte zahlreicher deutscher Produkte gehen wir näher auf Henkel und die lokale Philanthropie der Familie Henkel ein. Dann untersuchen wir, was die Entnazifizierung war und was sie versäumt hat, wir diskutieren die Idee der »Wiedergutmachung« und fragen, welche Art von Zahlungen Deutschland geleistet hat, bevor wir die deutsche Heroisierung von Kriegsverbrechern im Alltag beleuchten. Darauf aufbauend zeigen wir, warum Deutschlands Umgang mit seiner Nazi-Geschichte kein Modell für andere Länder sein sollte. Wir erklären, wie Opfergruppen nicht als Gleichberechtigte, sondern als Zeichen eines ausgelöschten Volkes behandelt werden, und wir verweisen auf Deutschlands mangelndes Interesse, die bestehenden Unzulänglichkeiten zu beheben, während einige andere Länder erkennen lassen, dass ein fortschrittlicherer Umgang mit den eigenen historischen Verbrechen durchaus möglich ist.
Abschließend erläutern wir, wie Nazi-Geld die deutsche Gesellschaft bis heute beeinflusst, von lokalen Regierungen bis zu nationalen politischen Parteien, von Nichtregierungsorganisationen bis zu Sportteams, von der Presse bis zum Wohneigentum und alles dazwischen. Wir legen dar, wie gefeierte Aspekte der deutschen Kultur, die auf den ersten Blick nichts mit der Nazi-Geschichte des Landes zu tun haben, in der Tat mit ebendiesem Teil der deutschen Vergangenheit in Verbindung gebracht werden können, und wir beziffern den Euro-Betrag als Bestandteil der deutschen Wirtschaft, der auf Nazi-Profiten aufgebaut ist. Wir verdeutlichen, wie dies in den letzten neunzig Jahren ein Ungleichgewicht in der Berücksichtigung verschiedener Interessen hervorgerufen hat: Begünstigt wurden deutsche Interessen auf Kosten der Interessen einstiger Nazi-Opfer und ihrer Erben. Und schließlich schlagen wir eine Lösung vor, einen Weg, um dem braunen Schandfleck der deutschen Nazi-Vergangenheit endlich eine andere Farbe zu geben.
Nicht alle Themen werden alle Leser gleichermaßen interessieren. Aber alle in diesem Buch angesprochenen Themen sind miteinander verbunden und ergeben gemeinsam das Bild eines modernen Deutschland, das immer noch durch und durch von den Nazi-Profiten geprägt ist und eine bloße Fassade der historischen Verantwortung geschaffen hat, ohne tatsächlich die Nazi-Strukturen von damals durchbrochen zu haben. Mehr noch sind die Einzelheiten darüber, wie die in diesem Buch thematisierten Unternehmen durch Massenmord zu ihrem Reichtum gelangen und nach dem Sturz des Nazi-Regime ihre Macht bewahren konnten, im internationalen Zusammenhang von Interesse, verweisen sie doch auf globalen Unternehmen, die in ähnlicher Weise nach dem Ende der Sklaverei und des Kolonialismus überlebten, ohne dass ihre Gewinne geschmälert wurden.
Selbst jene Leser, die bereits viel über die Shoah wissen, mögen durch die Lektüre des gesamten Buches neue Aspekte entdecken, wenn sie die Entwicklung der gesamten Lawine in all ihrer seltsamen, schrecklichen Pracht nachvollziehen.
»Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.«14
Wir wollen zurückkehren zu den Unternehmen aus obigem Alltagsszenario, um ihre Verstrickung mit dem Nazi-Regime zu skizzieren. Bei der Beschreibung der Verbrechen der Nazi-Profiteure wollen wir vermeiden, den Nutznießern des Unrechtssystem viele Zeilen zu widmen und dieses Buch zu ihrer Geschichte werden zu lassen. Aus diesem Grund werden diese Nazi-Geschichten so kurz wie möglich gehalten; sie dienen lediglich dazu, einen Überblick über das Ausmaß der Nazi-Kontamination zu geben, ohne den Biografien der Verbrecher unnötig viel Platz einzuräumen.
Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass wir den Begriff »Nazi-Verbrechen« in erster Linie verwenden, um uns auf die von Deutschland, den Deutschen und den Kollaborateuren von Hitlers Regime in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begangenen Verbrechen zu beziehen, einschließlich derjenigen, die Hitlers Ideologie im Jahrzehnt vor seiner Machtübernahme unterstützten, und wir verwenden den Begriff »Nazi«, um diese Personen zu beschreiben. Wir tun dies aus mehreren Gründen. Erstens, weil sonst die Terminologie fast irreführend komplex werden kann: Die NSDAP als Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist allgemein als Partei der Nazis bekannt, ohne dass diese mit dem Konzept des Sozialismus in Übereinstimmung zu bringen wäre. Der Nationalsozialismus ist eine rechtsextreme politische Ideologie, eine Form des Faschismus, die in der Tat Sozialisten unterdrückte und ermordete. Zweitens sprechen wir von den Nazis und dem Nazi-System, weil es sich leichter liest, vor allem, wenn wir ein System beschreiben, das so sehr von den Verbrechen der Nazis geprägt ist, dass es kaum einen Unterschied macht, wer offizielles Mitglied, wer Nichtmitglied, aber Profiteur, und wer zwar nicht Mitglied, wohl aber aktiver Komplize war: Sie alle haben Anteil am Nazi-System. An manchen Stellen sprechen wir vielleicht von »Nationalsozialisten« oder von der »NSDAP«, um einen bestimmten Aspekt der Geschichte hervorzuheben; aber mitunter scheint die wiederholte Verwendung dieser Begriffe den Verbrechen die Bösartigkeit zu nehmen, und deshalb bleiben wir im Allgemeinen bei »Nazi«.
Zurück zu den Unternehmen, die in unserem kleinen szenischen Schnappschuss erwähnt werden. Der Historiker Lutz Budraß nennt drei Kriterien, nach denen ein Unternehmen in besonderem Maße in die Nazi-Verbrechen verstrickt war:******* die Beteiligung dieser Unternehmen an Arisierungen (der Enteignung der jüdischen Bevölkerung Deutschlands zwischen 1933 und 1945),15 der Einsatz jüdischer Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge sowie die Aneignung von Unternehmen in den besetzten Gebieten.16 Die Unternehmen in unserer Momentaufnahme des deutschen Alltags passen fast alle zu diesen Klassifizierungen. Wir wollen im Einzelnen sehen, auf welche Weise dies der Fall ist.
EDEKA
Die genossenschaftlich organisierte EDEKA-Supermarktgruppe, eine der größten17 und derzeit am schnellsten wachsenden Supermarktketten Deutschlands,18 wurde 1898 von einer Gruppe von 21 »Kolonialwarenverkäufern« in Berlin gegründet. Fritz Borrmann, einer dieser Gründer, wurde 1921 Generaldirektor. Borrmann war 1933 in die NSDAP eingetreten, wurde aber 1937 von Paul König abgelöst, der ebenfalls Partei-Mitglied war und bis 1966 EDEKA-Generaldirektor blieb. König verbreitete zu Beginn des Boykotts jüdischer Geschäfte im Jahr 1933 Propaganda, die die Gräueltaten des Nazi-Regimes leugnete.19 Wenig später übernahm EDEKA drei jüdische Weingüter durch Arisierung und nutzte den »Anschluss« Österreichs und des Sudetenlandes, um seinen Absatz zu steigern. Da sich das Unternehmen in der Nachkriegszeit weigerte, den Nachkommen seiner Opfer Entschädigungen zu zahlen, gibt es keine Anzeichen für eine unternehmerische oder persönliche Reue für diese Taten.20
Melitta
Noch deutlicher wird der Judenhass in der Geschichte des Kaffeefilter-Familienunternehmens Melitta. Horst Bentz leitete das Unternehmen von 1929 bis 1980. Bereits 1933 wurde er Mitglied der NSDAP und der SS und arbeitete für den Geheimdienst innerhalb der SS-Struktur (Reichsführer SS).21 Unter Bentz’ Führung verbreitete die Firmenzeitung Pogromhetze gegen Juden und unterstützte die militärische Expansion Deutschlands.22 So ist es nicht verwunderlich, dass Melitta 1941 als nationalsozialistischer Musterbetrieb geehrt wurde; Bentz versprach als Reaktion auf die Ehrung: »Der Betrieb und seine Arbeit gehören allezeit dem Führer.«23 Das Unternehmen konnte während der Nazi-Zeit wachsen, obwohl die Nazi-Wirtschaft systematisch die Rüstungsindustrie gegenüber der Konsumgüterindustrie, zu der Melitta zählt, bevorzugte.
Bahlsen
Auch die Leitung des familiengeführten Keksherstellers Bahlsen war schon früh in die NSDAP eingetreten und unterstützte die SS, wenngleich ihre Gründe eher wirtschaftlicher als ideologischer Natur waren: Bahlsen konnte seine Produktionskapazitäten während der Nazi-Zeit verdreifachen und profitierte durch die Leitung einer Keksfabrik in Kiew auch von der Besetzung der Ukraine.24 Bahlsen hatte zudem Interesse an der Übernahme von Bäckereibetrieben in den besetzten Niederlanden gezeigt und wurde dabei von Rudolf Diels, dem ersten Leiter der Gestapo, unterstützt.25 Des Weiteren profitierte Bahlsen vom Einsatz von Zwangsarbeitern, und der Firmenchef Werner Bahlsen reiste selbst nach Kiew, um Hunderte der stärksten ukrainischen Arbeitskräfte auszuwählen und sie nach Hannover zu transportieren.26
Dr. Oetker
Dr. Oetker ist ein weiteres Familienunternehmen, das auch heute ein erfolgreicher Vertreter der nationalen und internationalen Lebensmittelindustrie ist:27 In der Nazi-Zeit leitete Richard Kaselowsky das Unternehmen treuhänderisch, bis sein Stiefsohn Rudolf-August Oetker bereit war, selbst als Chef zu fungieren. Kaselowsky war seit 1933 Mitglied der NSDAP und trat später auch in die SS ein; Rudolf-August Oetker war bereits in den 1930er Jahren Mitglied der Reiter-Sturmabteilung und trat 1942 der paramilitärischen Waffen-SS bei. Jüdische Mitarbeiter wurden in den 1930er Jahren gemäß den Nazi-Gesetzen entlassen; das Unternehmen war bereits 1937 als NS-Musterbetrieb ausgezeichnet worden und profitierte von der Nazi-Wirtschaft, indem es sowohl die Truppen als auch die Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und Kochgut versorgte. Da Dr. Oetker 1942 als kriegswirtschaftlich bedeutsam eingestuft wurde, hatte das Familienunternehmen weit weniger mit Rohstoffengpässen zu kämpfen als andere Unternehmen, deren Produkte für das Nazi-Regime uninteressanter waren. Auf Zwangsarbeiter wurde vergleichsweise wenig zurückgegriffen, da das Unternehmen vor allem junge Frauen beschäftigte, die ohnehin nicht zum Militär eingezogen wurden, so dass es bei Dr. Oetker auch in Kriegszeiten keinen Arbeitskräftemangel gab.
Die Arisierung jüdischen Eigentums spielte für Rudolf-August Oetker als Privatmann durchaus eine Rolle: Er profitierte von der Notlage flüchtender jüdischer Verkäufer, als er in Hamburg eine Villa und ein Grundstück mit Tennisplatz für wenig Geld erwarb. Was das Handeln von Rudolf-August Oetker für die jüdischen Opfer bedeutete, erzählt ein Zeitungsartikel:
»Nebenan, im Haus Nummer 13, lebte das jüdische Ehepaar Carl und Elli Lipmann. Drangsaliert vom NS-Staat, wollte es 1940 nach Südamerika fliehen. Für die Ausreise brauchte es dringend Geld. Das sollte der Verkauf eines Grundstücks hinter ihrem Haus bringen. Der junge Nachbar Oetker war interessiert. Unter Mithilfe der Nazis ergatterte er das Filetstück samt Tennisplatz für einen lächerlich niedrigen Preis.
…
Elli Lipmann … war Spross der Textilunternehmerfamilie Elsbach. Ihr Bruder Kurt führte in Herford eine der größten Wäschefabriken Europas – bis ihn die Nazis 1938 zum Verkauf zwangen. Elli Lipmanns Ehemann Carl saß im Unternehmen im Aufsichtsrat. Ihre Schwester Käthe Maass starb später im Konzentrationslager.
…
Carl Lipmann hatte 1925 für das Grundstück 117 000 Reichsmark bezahlt. Oetker bot nur 58 000 Reichsmark … Der Reichsstatthalter der NSDAP in Hamburg setzte den Kaufpreis noch weiter herab – auf 45 500 Reichsmark.
…
›Es ist davon auszugehen, dass [die Lipmanns] kaum etwas ins Ausland mitnehmen konnten, da die Konten von Juden gesperrt und überwacht wurden‹, erklärt er [Historiker Christoph Laue].«28
Darüber hinaus verweisen der Historiker Jürgen Finger und seine Kollegen auf weitere Unternehmen jüdischer Herkunft, an denen Dr. Oetker indirekt durch Anteilsbesitz beteiligt war. Diese Anteile hatte Dr. Oetker über einen Mittelsmann erworben, so dass das Familienunternehmen nicht als unmittelbarer Initiator oder direkter Profiteur von Arisierungen in Erscheinung trat. In diesen Unternehmen gehörte der Einsatz von Zwangsarbeitern durchaus zum Tagesgeschäft.
Neben der wirtschaftlichen Schädigung der Enteigneten und dem Einsatz und Missbrauch von Zwangsarbeitern, den Dr. Oetker zur Steigerung des eigenen Gewinns bereitwillig in Kauf nahm, offenbaren die Beteiligungen des Unternehmens auch seine Verstrickung in den Massenmord an der jüdischen Bevölkerung: Ein eklatantes Beispiel dafür sind die Anteile von Dr. Oetker an dem Schuhhersteller Salamander, der jüdische KZ-Häftlinge durch brutale Schuhtests zu Tode foltern ließ.29 Darüber hinaus war Dr. Oetker an der Shoah beteiligt, indem das Unternehmen 1943 zusammen mit den Hamburger Phrix-Werken und der SS die Hunsa-Forschungs-GmbH gründete. Hier sollten künstliche Lebensmittel entwickelt und vermarktet werden. Dr. Oetker hatte sich im Vorfeld bei der SS dafür eingesetzt, den Arbeitskräftemangel bei den Phrix-Werken zu beheben, woraufhin die bereits bei Phrix beschäftigten Zwangsarbeiter durch bis zu 500 KZ-Häftlinge unterstützt wurden. Dabei hatte sich das Phrix-Werk in Wittenberg bereits 1942 als eines der »ersten rein privatwirtschaftlichen Unternehmen mit eigenem KZ-Außenlager«30 einen Namen gemacht. Während unklar ist, ob die Hunsa-Forschungs-GmbH jemals in das operative Geschäft einstieg, scheint sie für Dr. Oetker einen gewissen Selbstwert als Ausdruck einer Geschäftsbeziehung zur SS gehabt zu haben.31
Vorwerk
Die Nazi-Verstrickung des Familienunternehmens Vorwerk & Co. scheint weit weniger augenfällig zu sein als die von Dr. Oetker, was aber nicht heißt, dass sie unwichtig ist. Obwohl die Familie aus ideologischer Sicht dem Nazi-Regime nicht besonders verpflichtet gewesen zu sein scheint, beschäftigte das Unternehmen bis zu 600 Zwangsarbeiter und stellte seine Produktion zu Beginn des Krieges auf Rüstungsgüter um, wofür es 1942 einen Teil seiner Produktion nach Lodz/Litzmannstadt verlagerte.32 Obwohl die Nazis 96 Fabriken im Ghetto Lodz eröffneten, um aus der dortigen Zwangsarbeit Kapital zu schlagen,33 und der Einsatz dieser Arbeitskräfte für Nazi-nahe Unternehmen wie Vorwerk zur Tagesordnung gehörte,34 wird in einer unternehmenseigenen Veröffentlichung zur Geschichte von Vorwerk die Beschäftigung jüdischer Zwangsarbeiter nicht bestätigt.35
Tempo
Unsicherheit ob des Ausmaßes der Nazi-Verstrickung lässt der Fall der Eigentümer der Tempo-Taschentücher kaum zu: Das Patent für Einwegtaschentücher aus Zellulosepapier geht auf den jüdischen Unternehmer Oskar Rosenfelder im Jahr 1929 zurück. Daraus entstanden die Tempo-Taschentücher, der weltweite Konkurrent der 1924 von der amerikanischen Firma Kimberly-Clark erfundenen Kleenex, die aus Zellwolle hergestellt wurden. Unmittelbar nach der Machtergreifung durch die Nazis begann das Regime, Rosenfelder und seinen Bruder zu bedrohen. Sie flohen ins Ausland, und ihre Firma »Die Vereinigten Papierwerke«, die auch Einmaldamenbinden der Marke Camelia produzierte, fiel der Arisierung zum Opfer und »ging für einen Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes an einen der größten Opportunisten unter den deutschen Unternehmern in der NS-Zeit: Gustav Schickedanz«.36 Die Tempo-Taschentücher aber waren so erfolgreich, dass der Markenname im deutschsprachigen Raum längst zum Synonym für die Produktidee geworden ist. Schickedanz wiederum war bereits 1932 in die NSDAP eingetreten und soll von mindestens zehn arisierten Unternehmen und Grundstücken profitiert haben.37
Henkel********
Henkel ist ein Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro im Jahr 2021.38 Die Marken des Unternehmens sind in Europa und den Vereinigten Staaten allgegenwärtig, vom Weichspüler Vernel über das Waschmittel Perwoll, die Körperpflegeprodukte von Fa, den Toilettenreiniger Bref, die Klebstoffmarke Pattex, die Pritt-Klebestifte, die Haarpflegeprodukte Schwarzkopf und got2b und andere. Aber das bekannteste Produkt von Henkel ist das Waschmittel Persil, so dass der frühere Firmeninhaber Fritz Henkel von der lokalen Presse auch »Mr. Persil« genannt wurde.39
In der frühen Nazi-Zeit leitete Hugo Henkel die Geschäfte des Familienunternehmens. Er war bereits 1933 der NSDAP beigetreten. Dennoch veranlasste ihn das Nazi-Regime 1938 dazu, in den Beirat und Aufsichtsrat des Familienunternehmens zu wechseln und seine Position als Geschäftsführer aufzugeben. An seine Stelle trat eine neue Dreierspitze bestehend aus Hugos Sohn Jost, seinem Neffe Werner Lüps und Carl August Bagel, dem Ehemann seiner Nichte.40 Jost war selbst Mitglied der Nazi-Partei, und Werner Lüps galt als bedingungsloser Anhänger der Nazis, der nicht zuletzt bei Nazi-Vizekanzler Hermann Göring hohes Ansehen genoss.41 Die ideologische Ausrichtung von Carl August Bagel ist nicht bekannt. Dennoch weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass sich diese neue Dreierspitze insgesamt eng mit dem Nazi-Regime identifizierte und ihm mit Begeisterung begegnete,42 sie als hochrangige Vertreter der Firma Henkel aktiv an wegweisenden Entscheidungen beteiligt war und auch von Hitlers Vierjahresplan zur Kriegsvorbereitung profitierte.43 Im Klartext bedeutet dies, dass das Unternehmen von 1936 bis 1940 direkt und umfassend am Aufbau der Kriegsmaschinerie der Nazis beteiligt war, seine Produktionsbasis ausbaute und versuchte, sich die politischen Ereignisse zunutze zu machen.44 1940 wurde Henkel zudem als Nazi-Musterbetrieb ausgezeichnet.45
Während Henkel den Einsatz von jüdischen Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen verneint und nur den Einsatz von Kriegsgefangenen und ausländischen Zivilarbeitern einräumt,46 lohnt es, das Familienunternehmen im Geflecht seiner Beziehungen zu anderen Unternehmen und Institutionen unter die Lupe zu nehmen: So profitierte Henkel von der Arisierung jüdischen Vermögens. Diese Arisierungen wurden mit Hilfe der Deutschen Bank durchgeführt,47 in deren Aufsichtsrat Hugo Henkel ein prominentes Mitglied war.48
Problematischer ist jedoch, wie eng diese Arisierungen das Unternehmen Henkel mit dem Chemieunternehmen Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt, besser bekannt als Degussa, verknüpften. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die beiden arischen Chemieunternehmen Henkel und Degussa die jüdischen Unternehmen, die der Arisierung zum Opfer fielen, entsprechend ihren jeweiligen Interessenschwerpunkten unter sich aufteilten.49 Gleichzeitig versuchte Henkel zunehmend, Einfluss auf Degussa auszuüben, nicht zuletzt um dadurch die eigene Position innerhalb des deutschen Chemiesektors zu stärken. Abgesehen von der Besetzung bedeutsamer Posten im Aufsichtsrat von Degussa trieb die Dreierspitze von Henkel dieses Ansinnen voran durch den aggressiven Erwerb von Degussa-Aktien, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Enteignung der deutschen Juden im Rahmen der Novemberpogrome 1938 standen. Während der Anteil der von Henkel gehaltenen Degussa-Aktien im Januar 1938 gut 25 Prozent betrug, waren dies im September 1939 bereits rund 40 Prozent und 1941 ganze 48 Prozent.50 So galt bereits Ende 1940:
»Vor dem Hintergrund des offensichtlichen Machtungleichgewichts zwischen beiden Unternehmen, das durch Henkels Anteile und Lüps’ Verbindung zu Hermann Göring entstanden war, konnten … diplomatische Formulierungen … nicht die Tatsache verbergen, dass sich Henkel mittlerweile das Recht vorbehielt, die Schritte der Degussa nach eigenen Wünschen zu lenken.«51
Die Degussa wiederum beschäftigte rund 3 000 KZ-Häftlinge, von denen etwa 40 Prozent Juden waren.52 Die Degussa folgte damit dem Prinzip der Vernichtung durch Arbeit, das, wie auf der Wannseekonferenz 1942 klar formuliert, direkt auf die »Endlösung« abzielte.53 Teil dieser war auch die »Verwertung« der Ermordeten, bei der sich erneut die Degussa einen Namen machte: In ihren Metallschmelzöfen wurde das Gold aus den Zähnen der im Ghetto Lodz und in den Konzentrationslagern ermordeten Juden eingeschmolzen.54
Die Verbindung zur Degussa spielt auch bei der Verknüpfung Henkels mit dem dritten von Budraß genannten Kriterium eine Rolle: der Übernahme von Betrieben in besetzten Gebieten. Während die Henkel-eigene Firmenpublikation nur den Rückgriff auf Raubgut einräumt,55 berichtet Hayes, dass die Degussa im Rahmen der Arisierung in den besetzten Gebieten Unternehmen in Böhmen und Mähren übernommen habe,56 so dass auch hier der Besitz von fast der Hälfte der Degussa-Aktien durch Henkel auf eine enge Verstrickung dieses Familienunternehmens in die Verbrechen des Nazi-Regimes schließen lässt.
Und abermals geht die Verstrickung der Firma Henkel in die Verbrechen der Endlösung viel weiter, wenn wir Degussa und die Beziehungen dieses Unternehmens genauer betrachten. Eine Degussa-Tochter war die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung GmbH, auch Degesch genannt. Diese wiederum saß als Patentinhaberin an der Schnittstelle zwischen den Herstellerfirmen und den Verkäufern von Zyklon-B, also von jenem Giftes, mit dem rund eine Million Juden und andere Nazi-Opfer in den Gaskammern der Vernichtungslager vergast wurden.57
Während es zunächst wirkt, als wäre Degussa durch die Degesch stärker in die Shoah verwickelt als Henkel selbst, müssen auch diese Beziehungen zwischen den drei Unternehmen mehrdirektional gedacht werden. Immerhin war das Familienunternehmen Henkel zum Zeitpunkt des Einsatzes von Zyklon-B in den Gaskammern mit 48 Prozent maßgeblich an der Degussa beteiligt. Entsprechend verwundert es nicht länger, wenn das Unternehmen Henkel als Verbindung der Degussa zum Nazi-Regime bezeichnet wird.58
Wunschdenken
Dies sind dunkle Unternehmensgeschichten, die nicht ignoriert werden können. Alle unmittelbaren Gräueltaten fanden vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs statt, und keine der im Vorherigen skizzierten Informationen ist grundsätzlich verborgen. Im Gegenteil sind sie größtenteils öffentlich zugänglich, mitunter sogar unmittelbar auf den Websites der genannten Unternehmen.59 Als Teil der gesamtdeutschen Aufarbeitung der Nazi-Zeit legen Familien und Unternehmen ihre Verstrickung mit dem Nazi-Regime offen und begegnen auf diese Weise ihrer ererbten Schuld.
Dieser Aufarbeitung vorangegangen war der Prozess der Entnazifizierung in der Nachkriegszeit: Damals wurden Industrielle, Politiker und Offiziere aufgrund ihrer Nähe zum Nazi-Regime und der Shoah vor den Internationalen Militärtribunalen in Nürnberg angeklagt und für ihre Gräueltaten inhaftiert oder sogar hingerichtet. Ohne dieses Moment der Entnazifizierung wäre das moderne Deutschland undenkbar. Die Tatsache, dass diese Unternehmen Teil des modernen Deutschlands sind, setzt also voraus, dass auch sie einen Entnazifizierungsprozess durchlaufen haben. Logisch, oder? Wir werden sehen.
Henkels Persilschein
Wir blicken erneut auf Henkel und betonen: Das zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche und familiengeführte Unternehmen Henkel galt dem Nazi-Regime als Vorzeigeunternehmen. Es profitierte aktiv vom Diebstahl jüdischen Vermögens, einschließlich der Eigentumsanteile an großen Unternehmen. Es war mit fast 50 Prozent an jenem Unternehmen beteiligt, das Zyklon-B herstellte und das das Zahngold von Opfern der Vernichtungslager einschmelzen ließ. Wie es eine deutsche Zeitung zusammenfasste: »Man muss Persil und Zyklon B zusammen denken, wenn man die Geschichte der Degussa im ›Dritten Reich‹ verstehen will.«60
Nach dem Krieg wurden mehrere hochrangige Mitglieder der Familie Henkel und Manager des Unternehmens von der britischen Armee als Kriegsverbrecher inhaftiert.61 Ursprünglich hatte die britische Besatzungsmacht beabsichtigt, die Familie Henkel dauerhaft von ihrer Führungsposition im Unternehmen zu entbinden. Internationalen Beziehungen des Unternehmens in die Vereinigten Staaten und nach England sowie eine umfangreiche Pressekampagne führten jedoch dazu, dass die Unternehmerfamilie ausgesprochen glimpflich davonkam.62 Nach dem Einfrieren des Firmenvermögens gemäß dem Militärgesetz Nr. 52 vom 28. April 1945 »konnte Henkel [später] das in den westlichen Besatzungszonen befindliche Vermögen, dem rund 74,4 Prozent des Stammkapitals entsprach, zu einem überwiegenden Teil sukzessive zurückerhalten«,63 während das im Osten angesiedelte Betriebsvermögen in den dortigen Staaten und bei der sowjetischen Besatzungsmacht verblieb. Durch die 1947 proklamierte Entnazifizierung gelangte das Unternehmen wieder in Familienhand, wobei Jost Henkel unmittelbar nach seiner Entlassung aus alliierter Gefangenschaft zum Geschäftsführer ernannt wurde, eine Position, die er bis zu seinem Tod 1961 innehatte.
Auf ihn folgte Konrad Henkel, der selbst an der Herstellung der chemischen Massenvernichtungswaffe Soman mitgewirkt hatte,64 zusammen mit Richard Kuhn, einem bekennenden Judenhasser und Nazi, der mit dem Hauptverantwortlichen für das Euthanasieprogramm der Nazis zusammengearbeitet hatte und für die Verwendung finanzieller Mittel für tödliche Experimente an KZ-Häftlingen verantwortlich war.65 Ungeachtet dieser persönlichen Verflechtungen von Familienmitgliedern mit dem Nazi-Regime zeigte sich das Unternehmen Henkel uneinsichtig angesichts der Schwere der begangenen Untaten und interpretierte Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter und vollzogene Arisierungen als Ausdruck des eigenen guten Willens und der eigenen Großzügigkeit – nicht aber als Schuldeingeständnis.66
Trotz seiner Nazi-Verstrickungen galt Henkel als »fleckenlos rein«. Tatsächlich wurde ausgerechnet sein Vorzeigeprodukt Persil zum Namenspatron für den offiziellen Entnazifizierungsnachweis, der im Volksmund schlicht »Persilschein« genannt wird. Zwar hatten derlei Entnazifizierungsnachweise dazu dienen sollen, »waschechte« Nazis von Menschen zu unterscheiden, denen eine solche Gesinnung fernlag, doch wurden sie bald Ausdruck einer Praxis, die den wirtschaftlichen Profiteuren und tatkräftigen Unterstützern der Nazi-Verbrechen half, ihre Gewinne zu behalten und ihren guten Ruf zu wahren. Anstelle einer gründlichen Gesinnungsüberprüfung und tiefgreifenden Abkehr von der Nazi-Ideologie und dem zugehörigen wirtschaftlichen und politischen System trat eine vordergründige Reinigungszeremonie, die auch den Schuldigen weiße Westen testierte:
»Mit sogenannten Persilscheinen stellten sich ehemalige Nationalsozialisten untereinander Entlastungszeugnisse aus. Was als politische Säuberung gedacht war, geriet ganz im Gegenteil zu einer Weißwäsche für ehemalige Mittäter und Mitläufer.«67
Ein solcher Persilschein wurde auch der Unternehmerfamilie Henkel ausgestellt, allen Hinweisen auf die Verstrickung des Unternehmens in die Verbrechen des NS-Regimes zum Trotz.
Henkel hat einen Persilschein bekommen, doch die Geschichte zeichnet das Familienunternehmen bis heute als befleckt aus.
Henkel in Unkel: Geteilte Profite – geteilte Mitschuld
Wir bleiben noch einen Augenblick beim Familienunternehmen Henkel: In der kleinen Stadt Unkel am Rhein, etwa 20 km südöstlich der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, wird die Familie Henkel als Inbegriff von Philanthropie und sozialem Engagement verehrt. Fritz Henkel Jr., Sohn und Erbe des Firmengründers, wird für seine industriellen Erfolge ebenso geschätzt wie für sein finanzielles Engagement für die kleine Stadt und ihre 5 000 Einwohner. Und warum sollte Unkel ihn nicht schätzen und ehren? Schließlich hat Fritz Henkel Jr. der Stadt mehrere große Grundstücke als Park- und Erholungsflächen geschenkt. Diese gehören heute zu den wenigen zentral gelegenen Grünflächen der Stadt.
Fritz Henkel Jr. starb 1930 im Alter von 55 Jahren, also vor Hitlers Machtübernahme und bevor sein Familienunternehmen von der Enteignung der jüdischen Bevölkerung oder der Kriegsmaschinerie der Nazis profitierte.******** Die Schenkungen, die er Unkel zuteilwerden ließ, stehen also nicht mit der deutschen Nazi-Vergangenheit in Verbindung. Entsprechend ist es auch keinesfalls verwerflich, diesen Schutzpatron zu ehren, indem Straßen und Parks nach ihm benannt werden.
Doch wenn Unkel die Familie Henkel in jüngerer Zeit ehrt und dabei das Augenmerk auch auf andere Familienmitglieder richtet, lohnt es sich, die Taten der Familie und des Unternehmens in der Nazi-Zeit und darüber hinaus näher zu beleuchten. Zwar vermag ein kurzer Blick auf die Geschichte von Henkel nicht alle historischen Details abzudecken, doch wirft bereits das folgende Schlaglicht zur Unternehmens- und Familiengeschichte die Fragen auf: Wenn ein Familienunternehmen wie Henkel eine unbestreitbare Nazi-Vergangenheit hat, sind dann die einzelnen Familienmitglieder ebenfalls schuldig? Was bedeutet ihre mögliche Schuld für die Kultur der Aufarbeitung in Kleinstädten wie Unkel?
Für Unkel sind der zuvor genannte Mäzen Fritz Henkel Jr., seine Tochter Ilse (1908–1991, verheiratet mit Carl August Bagel) sowie deren Sohn Fritz Bagel (1933–2021) von besonderer Bedeutung. Während Firmengründer Fritz Henkel Jr. die Nazizeit nicht mehr erlebte, war Fritz Bagel ein Neugeborenes, als die Nazis an die Macht kamen. Ilse hingegen erlebte die Nazi-Zeit, die Entnazifizierung und die deutsche Aufarbeitung als Erwachsene. Ihre Biografie erfordert daher besondere Aufmerksamkeit.68
Wir verwenden das Beispiel von Ilse Bagel hier nicht, weil sie sich besonders verwerflich verhalten hätte, sondern weil die Art und Weise, wie sie und das Familienunternehmen Henkel mit der Nazi-Vergangenheit umgegangen sind, symptomatisch sind für die Einstellung vieler Nazi-belasteter Unternehmen in Deutschland. Darüber hinaus ist Ilse Bagel auch ein ideales Beispiel dafür, wie Nazi-Profiteure bis heute von lokalen Funktionsträgern geehrt werden. Indem wir das Schlaglicht auf Ilse Bagel richten, verweisen wir auf das umfassendere Problem, und im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir sehen, wie institutionalisiert dieses Problem wirklich ist.
Die 1908 in Düsseldorf als älteste Tochter von Fritz Henkel Jr. geborene Ilse heiratete 1929 Carl August Bagel, den wir bereits als Teil des Führungsdreigestirns der Firma Henkel während der Nazi-Zeit genannt haben und der 1941 verstarb. Ilse Bagel verbrachte die Zeit der alliierten Bombenangriffe auf Deutschland während des Zweiten Weltkriegs mit ihren vier Kindern in Süddeutschland. Noch vor Kriegsende kehrte sie jedoch in ihre Villa in Unkel zurück, die am 8. März 1945 von amerikanischen Truppen besetzt wurde. Der Besitz wurde beschlagnahmt und die Familie vertrieben. Am 31. März 1948 erhielt die Familie die Villa in einem verwüsteten Zustand zurück.