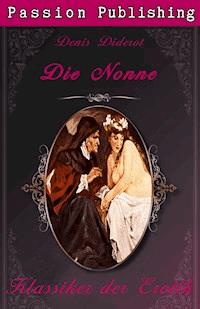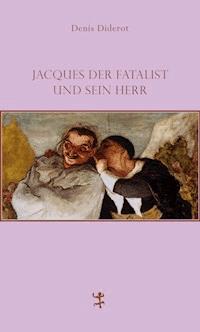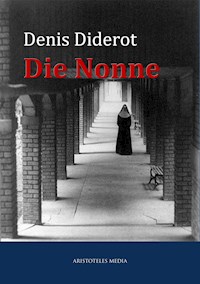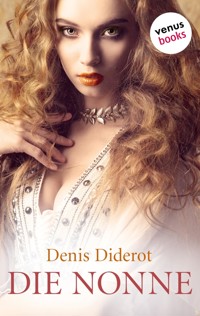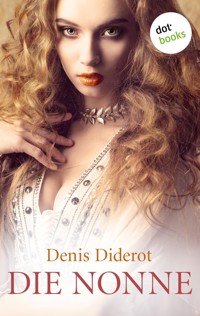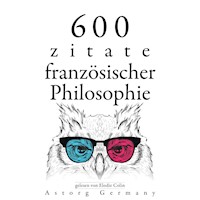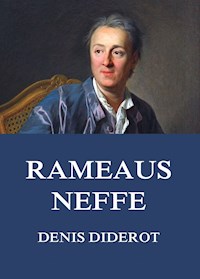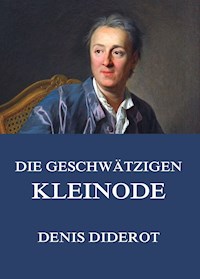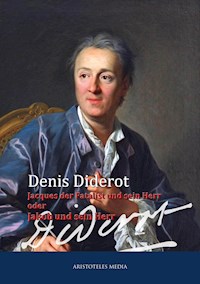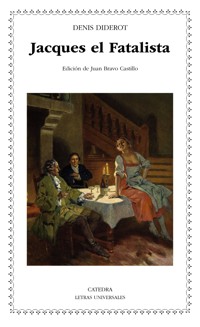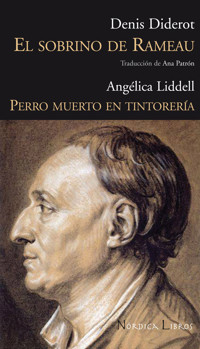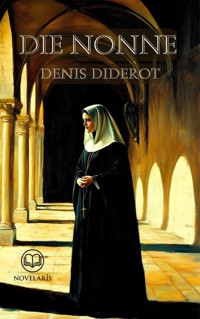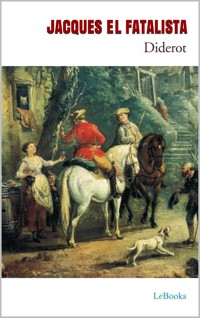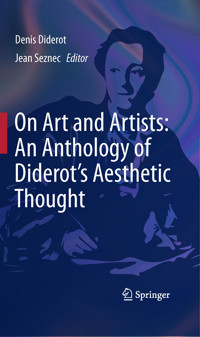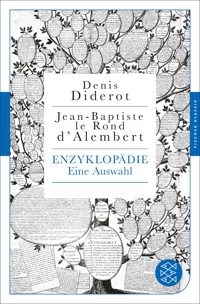
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
1747 begann ein Unternehmen von größter geistesgeschichtlicher Bedeutung: Jean Le Rond d'Alembert und Denis Diderot wagten es, erstmals die Summe des europäischen Wissens zu sammeln und in Form einer Enzyklopädie zu veröffentlichen. Unter Mitarbeit der größten Denkern ihrer Zeit wie u.a. Voltaire oder d'Holbach ging es aber ebenfalls darum, die Programmatik der Aufklärung zu entwickeln und zu verbreiten - »damit«. wie Diderot schreibt, »unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und grlücklicher werden«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jean Le Rond d’Alembert | Denis Diderot
Enzyklopädie
Eine Auswahl
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Coverabbildung: Chrétien Frederic Guillaume Roth, ›Baum des Wissens‹, Weimar, 1769/ullstein bild
Überabeitete Neuausgabe des gleichnamigen Bandes im Fischer Taschenbuchverlag vom Oktober 1989
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402771-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Die Entstehung: Eine schwere Geburt
Die Veröffentlichung: Struggle for life
Diderot, d’Alembert, Jaucourt und Co.
Konzeption und Funktion: Informationsinstrument oder ›Kriegsmaschine‹ der Aufklärung?
Von der Aufklärung zur Revolution?
Titelblatt
Discours préliminaire Vorrede
Agnus Scythicus
Aigle – Adler
Animal – Tier
Art – Kunst
Atomisme – Atomismus
Autorité politique – Politische Autorität
Beau – Schön
Citoyen – Staatsbürger
Droit naturel – Naturrecht
Eclectisme – Eklektizismus
Ecole de Philosophie – Schulphilosophie
Economie ou Œconomie – Ökonomie
Egalité naturelle – Natürliche Gleichheit
Encyclopédie – Enzyklopädie
Fanatisme – Fanatismus
Fermiers – Pächter
Foire – Jahrmarkt
Genève – Genf
Génie – Genie
Grains – Korn
Guerre – Krieg
Histoire – Geschichte
Homme – Mensch (Moral)
Homme – Mensch (Politik)
Impôt – Steuer
Indigent – Bedürftig
Influence – Einfluß
Intendants et Commissaires – Intendanten und Kommissare für Seine Majestät in den Provinzen und Steuerbezirken
Intolérance – Intoleranz
Irreligieux – Irreligiös
Jésuite – Jesuit
Jouissance – Genuß
Juste, Injuste – Gerecht, Ungerecht
Libelle – Schmähschrift
Liberté naturelle – Natürliche Freiheit
Liberté de penser – Denkfreiheit
Luxe – Luxus
Mages – Weise
Misère – Elend
Mœurs – Sitten
Monarchie absolue – Absolute Monarchie
Monarchie limitée – Eingeschränkte Monarchie
Naître – Entstehen
Nègres – Neger
Patrie – Vaterland
Père de l’Eglise – Kirchenvater
Persécuter, Persécuteur, Persécution – Verfolgen, Verfolger, Verfolgung
Peuple – Volk
Philosophie – Philosophie
Pouvoir – Gewalt
Presse – Presse
Prêtres – Priester
Privilège exclusif – Ausschließliches Privileg
Propriété – Eigentum
Pyrrhonienne ou Sceptique – Pyrrhonische oder skeptische Philosophie
Question ou Torture – Folter
Représentants – Vertreter
Révolution – Revolution (Begriff der Politik)
Révolution – Revolution (moderne Geschichte Englands)
Roman
Sarrasins ou Arabes – Sarazenen oder Araber
Sel, impôt sur le – Salzsteuer
Sens commun – Gesunder Menschenverstand
Sensibilité – Empfindsamkeit
Superstition – Aberglaube
Théocratie – Theokratie
Tolérance – Toleranz
Tyran – Tyrann
Vingtième – Zwanzigster, Steuer
Voluptueux – Wollüstig
Anhang
Bibliographie
Quellenverzeichnis
Denis Diderot: Daten zu Leben und Werk
D’Alembert: Daten zu Leben und Werk
Einleitung
Die Entstehung: Eine schwere Geburt
Die Enzyklopädie, das Hauptwerk und Propagandainstrument der Aufklärung, Diderot, ihr rastlos-unermüdlicher Herausgeber, Organisator, geistiger Kopf? Die Anfänge sehen anders, bescheidener aus: Im Frühjahr 1745 erwirbt der Verleger André François Le Breton ein Druckprivileg, um auf einen Vorschlag des Deutschen Gottfried Sell hin eine französische Übersetzung der zweibändigen Cyclopaedia (1728) des Engländers Ephraim Chambers herauszubringen. Für die Übersetzung, die auf fünf Bände veranschlagt ist, soll neben Sell der Engländer John Mills zuständig sein. Doch nach wenigen Monaten schon kommt es aus finanziellen Gründen zum Bruch zwischen diesem und dem Verleger. Le Breton aber hält an der Idee fest, tut sich mit seinen Kollegen Briasson, Durand und David zusammen und läßt ein knappes Jahr nach dem ersten gescheiterten Versuch ein neues Privileg registrieren, wonach es nicht mehr allein um eine Übersetzung der Cyclopaedia, sondern um ein revidiertes und erweitertes Werk geht. Als Herausgeber ist der Abbé Gua de Malves vorgesehen, der aber nach nur einjähriger Tätigkeit im August 1747 wieder entlassen und durch Diderot und d’Alembert ersetzt wird.
D’Alembert, international geachteter Mathematiker und Physiker als Mitglied der Akademie der Wissenschaften und assoziiertes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, konnte den Verlegern als Aushängeschild dienen, während Diderot bis dahin lediglich aufgrund seiner Übersetzungen von Shaftesburys Inquiry concerning Virtue and Merit (1745) und des Medicinal Dictionary von Robert James (1746–1748) für eine solche Aufgabe qualifiziert scheinen konnte. Dagegen waren seine eigenständigen literarischen Leistungen, die Pensées philosophiques (1746), die öffentlich verbrannt werden, und die Lettre sur les Aveugles (1749), die ihrem Autor einen mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt in Vincennes und den Verlegern zusätzlichen Zeit- und Geldaufwand, um ihn wieder herauszuholen, einbringen, dem Unternehmen eher abträglich denn förderlich. Flehentlich bitten die Verleger den Kriegsminister und Direktor des Buchwesens d’Argenson noch am Tage seiner Verhaftung (24. 7. 1749) um baldige Entlassung des Herausgebers der Enzyklopädie:
»Dieses Werk, das uns mindestens 250000 livres kosten wird, und in das wir schon beinahe 80000 livres investiert haben, sollte gerade dem Publikum angekündigt werden. Die Verhaftung Herrn Diderots, des einzigen Literaten, den wir einer solch weitgespannten Unternehmung für fähig halten, und der als einziger den Schlüssel für die gesamte Durchführung besitzt, kann unseren Ruin herbeiführen.
Wir wagen zu hoffen, daß Eure Hoheit sich von unserer Lage rühren lassen und uns die Freiheit des Herrn Diderot gewähren wird.«
Diese und weitere Interventionen beim Kanzler d’Aguesseau und beim Polizeichef von Paris führen endlich zum ersehnten Erfolg, so daß im Oktober 1750 ein Prospekt verteilt werden kann, in dem das auf zehn Bände konzipierte Werk den Subskribenten zum Preis von 280 livres offeriert und die Lieferung bis Dezember 1754 angekündigt wird.
Nicht eines dieser Versprechen jedoch können die Verleger und Herausgeber einhalten: Im Jahre 1772 kosten die 17 Text- und 11 Kupferstichbände der Enzyklopädie 980 livres …
Die Veröffentlichung: Struggle for life
Zunächst aber läuft alles nach Plan und über Erwarten gut. Der erste Band erscheint, wie angekündigt, pünktlich im Juni 1751. Gestützt auf 1400 Subskriptionen riskieren die Verleger eine Auflagensteigerung von 1625 auf 2050 Exemplare. Doch schon mit der Publikation des zweiten Bandes im Januar 1752 gerät das Werk wegen des Skandals um den Abbé de Prades zum ersten Mal in eine Krise: Druck und Auslieferung werden auf königlichen Befehl verboten wegen »[…] mehrerer Maximen, die dazu geeignet sind, die königliche Autorität zu zerstören, Unabhängigkeitsgeist und Gedanken an Aufruhr zu fördern und, verborgen unter dunklen und zweideutigen Begriffen, den Grundstein für Irrtum, Sittenverfall und Unglauben zu legen.« Freilich bleibt das Verbot im Grunde folgenlos: Weder verlieren die Verleger das Privileg, noch werden die Herausgeber behelligt. D’Alembert protestiert dagegen mit Erfolg gegen den königlichen Erlaß und kann im Juli 1752 stolz melden, daß die Affäre um die Enzyklopädie beigelegt sei, so daß der dritte Band mit geringer Verzögerung im Oktober 1753 in wiederum gesteigerter Auflage von 3125 Exemplaren auf den Markt kommen kann und die Verleger ihren geschäftlichen Optimismus in einer weiteren Erhöhung auf 4225 Exemplare vom vierten Band an ausdrücken. In schöner Regelmäßigkeit erscheint das Werk dann bis zum Band sieben im November 1757. Wieder einmal hat also der aufklärungsübliche Mechanismus funktioniert: Der Aufschrei der klerikalen Reaktion und die Unterdrückungsmaßnahmen des Souveräns haben das Werk publizistisch gefördert und zum kommerziellen Erfolg beigetragen.
Doch nun kommt es 1758/59 zur zweiten, weit ernsteren Krise: Entnervt von öffentlichen Angriffen in Zeitschriften und Broschüren gegen seinen Artikel »Genève« tritt d’Alembert im Januar 1758 von seiner Herausgebertätigkeit zurück und kann nur mit größter Mühe von Diderot dazu bewogen werden, wenigstens die ihm übertragenen mathematischen und naturwissenschaftlichen Artikel auch in Zukunft zu liefern. Auch Voltaire zieht sich zurück und fordert Diderot vergeblich auf, es ihm gleichzutun. Was war geschehen? Im Gefolge des Attentats von Damiens auf Ludwig XV. war die Zensur erheblich verschärft worden, und zugleich hatte sich mit einer Welle von Broschüren und Pamphleten nach der Publikation von Helvétius’ De l’esprit im Sommer 1758 der Druck der Enzyklopädiegegner auf die Autoritäten enorm gesteigert. Und diesmal fällt deren Reaktion weit härter aus. Im Januar 1759 untersagt das Pariser Parlament den weiteren Verkauf des Werkes, wenige Wochen später wird auf königlichen Erlaß das Privileg entzogen. Man sollte meinen, daß damit das von höchster absolutistischer Autorität besiegelte Ende verkündet wäre. Weit gefehlt. Zwar verliert die Enzyklopädie mit dem Entzug des Privilegs den damit verbundenen königlichen Schutz, wird aber trotzdem weiterhin geduldet unter der im Ancien Régime üblichen Auflage, daß sie pro forma mit einem ausländischen Druckort auf dem Titelblatt erscheint; der Verkauf geht also weiter, wenngleich die Verteilung in Paris noch für einige Jahre verboten bleibt. Wie schon 1752 konnte das Werk auch diese zweite Krise dank des den Aufklärern freundlich gesinnten Malesherbes überstehen, der in der Nachfolge von d’Argenson als Verantwortlicher für das Buchwesen seinen ganzen Einfluß zugunsten der Enzyklopädie geltend machte. Interessengegensätze und Kompetenzüberschneidungen zwischen den Autoritäten Kirche, Parlament und Königtum, die von der Krone geförderten wirtschaftlichen Interessen des Buchhandels, aber auch persönliche Beziehungen zwischen Diderot und Malesherbes ermöglichen in einem kaum entwirrbaren Knäuel widersprüchlicher Interessen den Fortgang des Unternehmens.
Noch einmal freilich gerät Diderot in helle Aufregung, als er im November 1764 bei der Lektüre seines Artikels »Sarrasins« feststellen muß, daß der eingeschüchterte Verleger Le Breton selbst in die Rolle der nun offiziell nicht mehr tätigen Zensoren schlüpft und zwischen Korrekturen und endgültiger Drucklegung vermeintlich anstößige Sätze, Abschnitte, ja ganze Artikel verschwinden läßt.
Wütend beschwert er sich beim Verleger über diese Selbstzensur:
»Sie haben die Arbeit von zwanzig Ehrenmännern massakriert oder von einem stumpfsinnigen Rohling massakrieren lassen, Männern, die Ihnen ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre Nächte geopfert haben, ohne Lohn, nur aus Liebe zum Guten und zur Wahrheit, allein in der Hoffnung, ihre Ideen publiziert zu sehen und damit ein gewisses wohlverdientes Ansehen zu gewinnen, das ihnen Ihre Ungerechtigkeit und Undankbarkeit nun aber vorenthalten hat. […] Sie haben vielleicht vergessen, daß Sie Ihre ersten Erfolge nicht den gängigen, vernünftigen, üblichen Sachen verdanken; daß es vielleicht keine zwei Menschen auf der Welt gibt, die sich die Mühe gemacht hätten, auch nur eine Zeile Geographie, Mathematik und sogar Kunst zu lesen, und daß das, was man darin gesucht hat und weiterhin suchen wird, die standhafte, kühne Philosophie einiger Ihrer Mitarbeiter ist. Sie haben sie kastriert, zerstückelt, verstümmelt, zerfetzt, gedankenlos, schonungslos, geschmacklos. Sie haben uns fade und platt gemacht. Sie haben das aus Ihrem Buch verbannt, was seine Attraktion ausmachte und immer noch ausmachen würde, das Pikante, Interessante, Neue.«
Damit nicht zufrieden, warnt er ihn noch ausdrücklich vor weiteren Eingriffen, so etwa in einer Randbemerkung ausgerechnet zu seinem Artikel Menace (Drohung). Freilich ist er weder in der Lage, das Gesamtausmaß der Streichungen und Veränderungen zu überblicken, da die Originalmanuskripte verbrannt sind und Le Breton die Korrekturen nicht herausrückt, noch den schon entstandenen Schaden aus dem Gedächtnis zu reparieren. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ein wachsames Auge auf den verbleibenden Rest seiner Beiträge zu werfen und die Drucklegung genau zu verfolgen. Auch heute können wir trotz des Zufallsfundes eines Exemplars der Enzyklopädie mit über 300 Seiten z.T. eigenhändiger Korrekturen Diderots die Eingriffe des Verlegers nicht in toto rekonstruieren, da diese Korrekturbögen nicht unbedingt vollständig sein müssen. Nach dem heutigen Kenntnisstand kann man immerhin konstatieren, daß die philosophische Konzeption und Stoßrichtung des Werkes auch in den letzten zehn Textbänden, die allesamt im Dezember 1765 erscheinen, prinzipiell erhalten bleiben und nur einige weniger gravierende Abschwächungen erfahren.
Mit 11 Bänden Kupfertafeln (1762–1772), fünf Supplementbänden (1776–77) und zwei Indexbänden findet das Werk 1780 nach insgesamt 35 Jahren der Vorbereitung und Publikation seinen Abschluß – mit mehr als einem Vierteljahrhundert Verspätung und zu einem fast um das Vierfache erhöhten Preis und Umfang. Kein Wunder, daß zahlreiche Subskribenten murrten, daß einige unter ihnen sich um einen gewissen Luneau de Boisjermain scharten, der 1769 einen Prozeß wegen der Erweiterungen und Verzögerungen gegen die Verleger in Gang brachte, ihn aber nach zehn Jahren verlor. Für Le Breton und seine Partner war es am Ende ein Sieg auf der ganzen Linie – und das Geschäft ihres Lebens mit einem für das Druck- und Verlagswesen nie dagewesenen Bruttogewinn von 2500,00 livres. Kein Wunder, daß an einem derart lukrativen Geschäft andere Verleger nur gar zu gern partizipieren wollten, zumal der Markt von den 4225 Exemplaren der Originalfolioausgabe längst nicht gesättigt war. Um diesen Markt, auf dem sich schließlich alles in allem fast 25000 Exemplare in vier Folio-, einer Quart- und einer Oktavausgabe absetzen ließen, war ein erbitterter Kampf zwischen Verlegern in halb Europa entbrannt, bei dem die Konkurrenten aus Paris, Lyon, Genf-Neuchâtel, Lausanne-Bern, Lucca und Livorno mit Tricks und betrügerischen Manövern nicht sparten – kein Wunder, war es doch das Geschäft des Jahrhunderts.
Wer aber kaufte im vorrevolutionären Europa die Enzyklopädie und suchte in der Masse der Artikel nach Informationen, ließ sich womöglich von den philosophischen Beiträgen im Sinne der Aufklärung inspirieren oder sah in ihr lediglich ein Prestigeobjekt? Allein in Frankreich waren es wohl über 11000 Kunden, die überwiegend die Quartausgabe kauften, während die Folio- und Oktavausgaben zumeist im Ausland ihre Käufer fanden, letztere besonders in Deutschland, wo der Absatz freilich insgesamt recht schleppend voranging. Während sich die Folioausgaben mit einem Subskriptionspreis von bis zu 1000 livres naturgemäß an eine eng begrenzte, betuchte Leserschaft wandten, trugen vor allem die Quart- und Oktavausgaben zu einer sozialen Öffnung gegenüber einem breiteren Publikum bei, waren sie doch schon um ⅔ bzw. ¾ billiger zu haben. Genauere Aussagen lassen sich allein über die etwa 8000 Subskribenten der Quartausgabe treffen, deren Listen vollständig erhalten sind. Danach konzentrierten sich ihre Käufer besonders auf jene französischen Städte, die über ein Parlament oder Akademien verfügten. Unter ihnen scheinen sich vor allem Juristen, königliche Beamte und Adlige – also die traditionellen Eliten des Ancien Régime – für die Enzyklopädie zu interessieren, während das Erwerbsbürgertum, Händler und Kaufleute, das Hauptwerk der Aufklärung eher links liegen läßt und sich seinen Geschäften widmet: kein überraschendes Phänomen, nach allem, was man über die bescheidenen Bildungsbedürfnisse dieser Schicht im vorrevolutionären Frankreich weiß.
Diderot, d’Alembert, Jaucourt und Co.
Die Überschrift dieses Kapitels deutet es schon an: Das Hauptwerk der Aufklärung war die Gemeinschaftsarbeit einer Gruppe von Literaten im weitesten Sinn – einer »Société de gens de lettres«, wie es auf dem Titelblatt heißt – mit durchaus ungleichgewichtiger Lasten- und Aufgabenverteilung, an der sich nicht nur die »großen« Aufklärer Diderot, Montesquieu, Voltaire und Rousseau beteiligten. Im Gegenteil, Montesquieus eher unfreiwilliger, weil aus dem Nachlaß stammender Beitrag beschränkt sich allein auf einen Teil des Artikels Geschmack; Voltaire steuert ganze 44 Artikel bei und stellt mit Band acht seine Mitarbeit ein; Rousseaus Teilnahme geht, abgesehen von dem allerdings bedeutsamen Artikel Politische Ökonomie, über den Bereich der Musik nicht hinaus. Buffon gar, im Vorwort zum zweiten Band groß angekündigt, ist mit keiner einzigen Zeile vertreten. Dagegen liefert der sonst völlig unbekannte Chevalier de Jaucourt, der Lastesel der Enzyklopädie, mit über 17000 Artikeln etwa ein Viertel des Gesamttextes. Auch wenn sich Diderot schon einmal abschätzig über seinen Hauptmitarbeiter äußert, Kritiker ihn des Plagiats beschuldigen und ihm schludrige Arbeitsweise vorwerfen, so kann doch kein Zweifel an der Aufrichtigkeit und Berechtigung des Lobliedes bestehen, das der Herausgeber in der Vorrede zum achten Band auf ihn anstimmt:
»Was hat er nicht alles für uns getan, besonders in der letzten Zeit? […] Niemals hat es einen so totalen, so absoluten Verzicht auf Ruhe, persönliches Interesse und Gesundheit gegeben. Die mühsamsten und undankbarsten Nachforschungen haben ihn nicht abschrecken können. Unermüdlich hat er sich damit beschäftigt, zufrieden, wenn er den anderen die Last abnehmen konnte. Was an unserer Lobeshymne fehlt, das kann jedes Blatt dieses Werkes ergänzen; nicht eines ist darunter, das nicht die Vielfalt seines Wissens und das Ausmaß seiner Hilfe bezeugte.«
Die von Diderot lobend hervorgehobene Vielfalt seiner Beiträge erstreckt sich auf so verschiedene Bereiche wie Medizin, Politik, Naturgeschichte, Geographie, Geschichte und Literatur. Dabei zählt er noch nicht einmal zu den Mitarbeitern der ersten Stunde wie – neben den Herausgebern – die Geistlichen Yvon, Pestré und de Prades, die anfänglich für Religion, Philosophie und Moral zuständig sind, aber schon 1752 das Handtuch werfen müssen, weil sie allesamt in die Affäre um die von der Sorbonne verurteilte Dissertation des Abbé de Prades verwickelt sind.
Diderot selbst ist ursprünglich für das Gebiet der Künste und des Handwerks verantwortlich, schreibt aber darüber hinaus auch zahllose geographische und Synonymenartikel, läßt sich über Chemie, Medizin, Mathematik, Naturgeschichte aus und zeigt sich in der klassischen Antike und ihrer Mythologie ebenso bewandert wie in Literatur und Ästhetik, Ethik und Grammatik, Religion, Theologie, Geschichte der Kirche und religiöser Sekten; zu den letztgenannten Bereichen und zur Philosophiegeschichte schreibt er die kritischsten und umstrittensten seiner insgesamt über 5000 Artikel.
Auch d’Alembert geht über die ihm zugedachten Wissenschaften Mathematik und Physik mit Artikeln über Literatur und Philosophie hinaus und beschränkt sich erst nach seinem Rücktritt als Herausgeber auf seine eigentlichen Kompetenzen, um keinen Anstoß bei der Obrigkeit mehr zu erregen. Insgesamt schreibt er 1500 Artikel für die Enzyklopädie. Baron d’Holbach steuerte über seine Spezialgebiete der Physik, Metallurgie und Mineralogie hinaus Beiträge über die Institutionen seines deutschen Heimatlandes und Kritisches zur Religion und Politik bei. Die anderen Spezialisten hingegen, wie z.B. Quesnay (Ökonomie), Blondel (Architektur), Rousseau (Musik), Dumarsais (Grammatik), Boucher d’Argis (Recht) bleiben im Großen und Ganzen innerhalb ihrer Zuständigkeiten.
Insgesamt sind bis dato nur 142 Mitarbeiter namentlich bekannt, denen etwa ⅗ aller 72000 Artikel zugeschrieben werden können; die überwiegende Mehrzahl der unbekannten Autoren wird wohl bis auf wenige Zufallsfunde für immer anonym bleiben. Zwar ist die soziale Zusammensetzung der Equipe um die beiden Herausgeber ebenso heterogen wie ihre ökonomische Lage und Berufszugehörigkeit; doch werden zumindest einige Tendenzen erkennbar: Angehörige des Hof- und Schwertadels, der staatlichen Repressionsorgane, aktive Mitglieder der Parlamente, des Klerus wie auch aktive Anwälte und Kaufleute bleiben im Prinzip ausgeschlossen. Auffallend viele Mitarbeiter zählen hingegen zur technischen Intelligenz mit öffentlichen Leitungsfunktionen; überhaupt steht über ein Viertel von ihnen zeitweilig oder dauerhaft in Staatsdiensten; besonders zahlreich sind Gelehrte, Professoren, Literaten, Künstler, aber auch Mediziner. In ihrer Mehrzahl verfügen die Mitarbeiter über Grundbesitz. Über ein Drittel von ihnen gehört einer der Akademien in Paris oder der Provinz an, die im 18. Jahrhundert als Organisationszentren der intellektuellen Elite des Königreiches wie Pilze aus dem Boden schießen.
Welche Bedeutung und Funktion hat nun die Mitarbeit an der Enzyklopädie für die Mitwirkenden? Auch hier gilt es zu differenzieren zwischen jenen, die gerade einmal einen einzigen Artikel beisteuerten, und solchen, die über Jahre hinweg für ein oder mehrere Wissensgebiete zuständig waren, zwischen einem armen Teufel wie Rousseau, der sich seinen Lebensunterhalt mit Notenschreiben verdiente, und einem angesehenen, vermögenden Mann wie dem Baron d’Holbach, der in seinem Salon einen Großteil der »philosophes« um sich scharte. Leider wissen wir aufgrund der nur unvollständig erhaltenen Geschäftsunterlagen Le Bretons über die Entlohnung der Beiträger im einzelnen nur unvollkommen Bescheid. Gewiß ist immerhin, daß die überwiegende Mehrzahl allein für den Nachruhm arbeitete, es sich als Ehre anrechnete, bei dem großen Unternehmen dabei zu sein. Ebenso sicher ist, daß es zumeist nur die ursprünglichen Mitarbeiter waren, die Geld erhielten. Ebenso ist bekannt, daß d’Alembert im Herausgebervertrag 3000 und Diderot 7200 livres versprochen werden, der letztere aber insgesamt 80000 livres an der Enzyklopädie verdient, die über dreißig Jahre hinweg seine Haupteinnahmequelle ausmacht. Dennoch sieht er sich gezwungen, 1765 seine Bibliothek gegen eine jährliche Pension von 750 francs an Katharina die Große zu verkaufen, die ihm allerdings großzügig die Nutzung seiner Bücher auf Lebenszeit überläßt. Während so für den Hauptherausgeber sein Lebenswerk zugleich die wichtigste Existenzgrundlage bildet, wird Jaucourt für die Kärrnerarbeit an seinen 17000 Artikeln mit lumpigen 2750 livres – in Büchern! – entschädigt.
Obwohl die unsichere Quellenlage keine präzisen Schlußfolgerungen gestattet, bestätigen doch die wenigen Beispiele die höchst ambivalente Situation, in der sich die Schriftsteller im 18. Jahrhundert befanden: zwischen den Extremen von aufkommender Professionalisierung und Marktorientierung einerseits und traditioneller Liebhaberei und Fixierung auf den Nachruhm andererseits.
Ähnlichen Extremen begegnen wir in der Einschätzung von »Encyclopédistes« durch die Obrigkeit, etwa durch den Aufseher über den Buchhandel Joseph d’Hémery, der als gewissenhafter Polizist ein Dossier mit 500 Berichten angelegt hat, in denen berühmte Literaten wie auch obskure Skribenten porträtiert sind. Zwar sind ihm grundsätzlich alle Literaten suspekt, doch erscheinen ihm längst nicht alle gleichermaßen subversiv oder regimefeindlich. So bescheinigt er dem schon längst arrivierten Voltaire wenig schmeichelhaft ein satyrhaftes Aussehen und hält ihn für einen schlechten Untertanen, kann aber nicht umhin, ihm zugleich die geistigen Kräfte eines Adlers zu attestieren. Den allgemein respektierten, als Parlamentspräsident sozial hochgestellten Montesquieu charakterisiert er als unendlich geistvollen Mann, als Verfasser reizvoller Werke wie der Persischen Briefe, des Tempels zu Gnidus und des berühmten Traktats Der Geist der Gesetze. Trotz der religions- und gesellschaftskritischen Spitzen der Persischen Briefe, trotz der Frivolitäten des Tempels zu Gnidus, trotz seines Eintretens für Gewaltenteilung im Geist der Gesetze fällt die Würdigung des großen Mannes der Frühaufklärung eindeutig positiv aus. Ganz anders das Bild Diderots: Obwohl zum Zeitpunkt des Berichts schon 36 Jahre alt und verheiratet, ist er für den Polizisten angesichts seiner untergeordneten sozialen Herkunft als Sohn eines Messerschmieds immer noch ein »garçon«, also eigentlich ein unverheirateter junger Mann, dabei »geistvoll«, doch »extrem gefährlich«, weil »Autor von Büchern gegen die Religion und die guten Sitten«. Nicht nur seine Werke, sondern auch sein Lebenswandel und seine Einstellung machen ihn in den Augen der Obrigkeit zu einem gefährlichen Subjekt:
»Er ist ein junger Mann, der den Schöngeist spielt, seine Gottlosigkeit für eine persönliche Errungenschaft hält, äußerst gefährlich. Von den heiligen Mysterien spricht er mit Verachtung und pflegt zu sagen, wenn seine letzte Stunde geschlagen habe, würde er wie alle anderen beichten und die Sakramente empfangen, aber nicht aus Christenpflicht, sondern aus familiären Gründen, weil er fürchte, daß man seinen Angehörigen vorwerfen könne, er sei ohne Religion gestorben.«
Als ebenso suspekt wegen ungeregelter Lebensführung und freigeistiger oder gottloser Schriften gelten d’Hémery die Enzyklopädisten Eidous und Toussaint, deren Mitarbeit seiner Wachsamkeit nicht entgeht. Nirgends freilich sind in seinen Unterlagen Hinweise darauf zu finden, daß er das Unternehmen insgesamt für staatsgefährdend hält, stand es doch zum Zeitpunkt seiner Aufzeichnungen (1748–53) noch unter dem Schutze des königlichen Privilegs.
Wenn wir von solchen Extremen absehen, zu denen zwar einer der beiden Herausgeber, nicht aber das angesehene und am Ende seines Lebens durchaus vermögende Akademiemitglied d’Alembert gehört, dann ist der typische Enzyklopädiemitarbeiter eher ein besitzender Rentenbürger, Mitglied einer Akademie, vielseitig interessiert, gleich aufgeschlossen gegenüber neuen philosophischen Ideen wie technologischen Entwicklungen, ein Mann, der seine Schriftstellerei ernst nimmt, aber nicht als Lebensunterhalt betrachtet – kurz ein respektierter »homme de lettres«.
Da nimmt es nicht wunder, wenn von den 38 Enzyklopädisten, die die Revolution erleben, wenig Revolutionäres zu berichten ist: eine Handvoll wird verhaftet, einer von ihnen guillotiniert, einige verlassen Frankreich oder meiden zumindest Paris. Der aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammende Autor und später zum Akademiesekretär aufgestiegene Marmontel macht schon vor 1793 aus seiner revolutionsfeindlichen Gesinnung keinen Hehl; der Abbé Morellet, Sohn eines Papierhändlers, der es bis zum Direktor der Académie française gebracht hatte, verteidigte vergeblich die altehrwürdige Institution gegen Angriffe der Revolutionäre, die sie im August 1793 schließen; Naigeon, der Lieblingsschüler Diderots, nennt Robespierre ein Ungeheuer, schlimmer als Nero …
Während die Enzyklopädisten als sozial arrivierte Autoren und Mitglieder prestigeträchtiger Institutionen des alten Gesellschaftssystems von der Revolution nichts Positives zu erwarten hatten, entluden gescheiterte Untergrundliteraten und spätere Revolutionäre wie Carra, Collot d’Herbois, Desmoulins, Fabre d’Eglantine, Hébert, Marat ihre Enttäuschung über die ihnen versperrt gebliebenen Aufstiegskanäle in haßerfüllten Pamphleten gegen die »literarischen Aristokraten«. Nachdem diese Untergrundliteraten schließlich selbst an die Macht gekommen waren, verachteten sie die Enzyklopädisten als Repräsentanten des Ancien Régime und behandelten sie entsprechend.
Konzeption und Funktion: Informationsinstrument oder ›Kriegsmaschine‹ der Aufklärung?
Gewiß war die Enzyklopädie zum einen als Nachschlagewerk konzipiert, das, wie der Prospekt angekündigt hatte, »die Leistungen des menschlichen Geistes in allen Disziplinen und in allen Jahrhunderten« dokumentieren sollte. Menschliches Wissen sollte hier aber nicht allein zusammengetragen, sondern systematisiert dargestellt werden. Das Werk sollte nach d’Alemberts Versprechen in der Vorrede »von jeder Wissenschaft und Kunst […] die allgemeinen Prinzipien, auf denen sie basieren, und die wichtigsten Einzelheiten enthalten«. Der Systematisierung des in den alphabetisch angeordneten Artikeln gesammelten Wissens dienen der Stammbaum des Wissens, die hierauf verweisenden Klassifikationsbegriffe der einzelnen Artikel, die sie aufeinander beziehenden Querverweise und gegebenenfalls die systematische Anordnung mehrerer Artikel zu einem Stichwort.
Im Stammbaum ist das figürlich dargestellte Wissen über die drei Hauptfähigkeiten des menschlichen Verstandes: Gedächtnis, Vernunft, Einbildungskraft organisiert, denen als Wissenstypen Geschichte, Philosophie und Dichtung (bzw. Musik, Künste) zugeordnet werden. Ausgangspunkt der Wissensorganisation ist mithin der Mensch mit seinen Fähigkeiten, nicht Gott oder die von Gott eingerichtete Weltordnung. In der Hierarchie dieser Fähigkeiten steht das Gedächtnis auf der untersten Stufe, weil es sein Wissen unmittelbar durch Sinnesempfindungen bezieht, während sich dasjenige der Vernunft zusätzlich über Reflexion vermittelt und damit im Zentrum steht. An der Spitze der Hierarchie steht die Einbildungskraft, kann sie doch über die Nachahmung ihrer Gegenstände hinaus sogar selbst Gegenstände schaffen. Der geringe Stellenwert der Geschichte gründet auf einer Konzeption, welche die Historiographie auf rein empirisches Faktensammeln reduziert. Damit wird implizit als eine Unterordnung der Historiographie auch die »heilige Geschichte« abgewertet, wie überhaupt etwa im Vergleich zu Bacon die Bedeutung der Naturgeschichte gegenüber der Kirchengeschichte erheblich steigt. Diderot und d’Alembert entzaubern die Welt, indem sie die Wunder der Natur nicht mehr göttlichem Eingreifen und Wirken zuschreiben, sondern Göttliches und Weltliches streng voneinander trennen. Demgegenüber wird die zentrale Stellung der Philosophie nicht allein optisch in der figürlichen Anordnung oder in ihrem Bezug zur Vernunft sichtbar, sondern fällt vor allem auch durch den hohen Grad ihrer Ausdifferenzierung auf. Diese zentrale Rolle hatte in Chambers’ System noch die Theologie inne, die hier als Offenbarungstheologie in verdächtiger Nähe von allerlei Aberglauben und magischen Künsten angesiedelt wird. Dennoch ist sie der menschlichen Vernunft untergeordnet als ein Teil der Philosophie, während Bacon Philosophie und Theologie noch getrennt und derart das Geheimnis Gottes vor menschlicher Vernunft noch verschlossen hatte. Damit brechen die Philosophen in einen Bereich ein, der zuvor den Theologen vorbehalten war; theologischen Kritikern gegenüber wie dem Jesuiten Guillaume-François Berthier, der den Wissensstammbaum der Enzyklopädie als Plagiat von Bacons System denunziert, betont Diderot die Originalität des philosophischen Zweiges des Stammbaums; sein Herausgeberkollege spricht dem Jesuiten gar die Kompetenz ab, wenn er die Urteilsfähigkeit in dieser Frage allein einer kleinen Gruppe von Philosophen zuspricht: Mit der Umkehrung der Hierarchie der Wissensbereiche geht ein tiefgreifender Wandel im Selbstbewußtsein und Rollenverständnis ihrer Repräsentanten einher.
Wenn sich dergestalt die Philosophen Zugang zu einem ihnen zuvor versperrten Bereich verschaffen und diesen der kritischen Vernunft öffnen, so ist dies freilich nicht gleichbedeutend mit einer Aufwertung dieses Bereiches. Im Gegenteil: Indem d’Alembert den Bereich des Wißbaren in der Vorrede mit John Locke auf das begrenzt, was sinnlicher Wahrnehmung und Reflexion zugänglich ist, grenzt er mit einem Schlag die christliche Offenbarung aus dem System des Wissens aus. Daraus auch erklärt sich die auffällige Nachbarschaft von Offenbarungstheologie und Aberglauben im Wissensstammbaum. Diese systemische Abwertung der christlichen Religion setzt sich im Inneren des Werkes analog über das Verfahren der Querverweise fort, die Diderot nicht allein als die bedeutendsten Träger enzyklopädischer Ordnung, sondern als das Instrument ansieht, mit dem ein Wandel im traditionellen Denken herbeizuführen ist. In einer privaten Äußerung, einem Brief an seine Geliebte Sophie Volland vom September 1762, zeigt er sich ganz optimistisch, mit der Enzyklopädie dieses Ziel, wenngleich nur langfristig, erreichen zu können:
»Dieses Werk wird gewiß mit der Zeit einen Umschwung in den Köpfen herbeiführen, und ich hoffe, daß dabei die Tyrannen, die Unterdrücker, Fanatiker und Intoleranten nicht gut wegkommen werden. Wir werden der Menschheit gedient haben; aber wir werden schon längst kalter, gefühlloser Staub sein, bevor man uns dafür dankt.«
Freilich nicht die eher harmlose Sorte von Querverweisen, die lediglich Verbindungen von Nachbardisziplinen herstellen, sondern jene, die ganz im Gegenteil nicht zur Einheit beitragen, die erst der Wahrheit Überzeugungskraft verleiht, sind folglich die Hauptwaffen der Aufklärung, wie Diderot in seinem Artikel Enzyklopädie verdeutlicht. Jene »bringen die Begriffe in Opposition zueinander, sie lassen die Prinzipien kontrastieren, insgeheim greifen sie lächerliche Meinungen an, die man offen zu schelten nicht wagen würde, erschüttern sie, stürzen sie um.«
Welche Querverweise sind damit im einzelnen gemeint? Gewiß etwa ein Querverweis im äußerst harmlosen, durchaus orthodoxen Artikel Jesus Christus auf den keineswegs harmlosen, durchaus unorthodoxen Artikel Eklektizismus; oder Verweise auf die Artikel Eucharistie, Kommunion, Altar im Artikel Menschenfresser, selbst wenn hier heidnische Vorwürfe gegenüber der Abendmahlspraxis der frühen Christen als haltlos zurückgewiesen werden. Schon der Verweis als solcher rückt das christliche Abendmahl in die Nähe der Anthropophagie und entwertet das Sakrament auf ebenso subtile wie fundamentale Weise; seinerseits leistet der Artikel Kommunion dieser Entwertung Vorschub, wenn er seitenweise nichts als Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche über Form und Frequenz des Abendmahls referiert. Dasselbe gilt für Eucharistie, eine Rhapsodie von Kontroversen über die Transsubstantiation, die der auch für die anderen Artikel verantwortliche Verfasser, der Abbé Mallet, mit der eher resignativ-skeptischen Bemerkung abschließt:
»[…] wenn man die Vernunft zum alleinigen Schiedsrichter der Grundlage dieses Disputs macht, tut sich zugegebenermaßen ein Abgrund von Schwierigkeiten auf, und wir schreiben weder, um sie zu erneuern noch zu vervielfachen.«
Mit seinem Verzicht auf die Vernunft als Entscheidungskriterium exemplifiziert Mallet an diesem Einzelfall die systematische Ausgrenzung der Sphäre der religiösen Offenbarung aus dem Bereich der Wissens durch die Herausgeber. Zugleich bestätigt er die subversive Kraft des Verweissystems, die freilich der Aufmerksamkeit des jansenistischen Enzyklopädie-Kritikers Chaumeix ebensowenig entgangen war wie dem Pariser Parlament, das sich in seinem Arrêt vom Januar 1759, in dem der weitere Verkauf des Werkes untersagt wird, ausdrücklich auf Diderots eigene Aussagen über die Funktion der Querverweise bezieht, sich über seine freche Offenheit wundert und aus seiner Sicht dem Aufklärer bestätigt: »[…] das ganze in diesem Wörterbuch verstreute Gift findet sich in den Verweisen.«
Nun mag man sich auch heute noch über Diderots Kühnheit wundern, die ja die Zensur geradezu auf den Plan rufen mußte. Doch einschränkend gilt es zu bedenken, daß schon vier Bände auf dem Markt waren, bevor die Öffentlichkeit so eindeutige Informationen über die Funktion der Querverweise erhält. Außerdem sprengt jene subversive Form der Verweise fast immer die Grenzen eines Bandes; innerhalb eines Bandes finden wir dagegen in der Regel nur harmlose Verweise. Da aber die ersten sieben Bände bis zum Entzug des Privilegs immer einzeln den Zensoren vorgelegt werden, weil sie einander in gewissem zeitlichen Abstand folgen, sind den Zensoren die Hände gebunden, es sei denn, sie verfügten im Blick auf zukünftige Bände über prophetische Gaben oder riskierten es im Rückblick auf bereits erschienene, ihr positives Urteil zu revidieren und sich damit lächerlich zu machen.
Kehren wir zur Verdeutlichung des Verfahrens zu unserem Menschenfresser-Artikel zurück. Er stammt aus dem ersten Band (frz. Anthropophages), verweist auf Altar (Autel) aus demselben Band sowie auf Eucharistie und Kommunion aus späteren Bänden. Der Artikel Altar präsentiert sich rein historisch-sachlich, informativ, erwähnt keinerlei unter den Christen strittige Praktiken und Überzeugungen, läßt keinerlei Bezug zum Artikel Menschenfresser erkennen. Dies gilt auf den ersten Blick auch für Eucharistie und Kommunion. Hat sich der Leser aber erst einmal mühsam durch die endlosen Kontroversen, die in diesen beiden Artikeln abgehandelt werden, hindurchgekämpft, und kehrt er dann wieder zum Artikel Menschenfresser zurück, wird er vielleicht ein gewisses Verständnis für die oben erwähnten heidnischen Vorwürfe aufbringen, zumal die frühen Christen selbst ihren Gegnern nur recht »vage Vorstellungen« über das Abendmahl vermitteln konnten, wie es unter Anthropophages heißt.
Wie sich dem französischen Publikum der Frühaufklärung aus der Perspektive der orientalischen Reisenden in Montesquieus Persischen Briefen ihr Königreich merkwürdig verfremdet präsentierte, so gelingt es Diderot drei Jahrzehnte später, mit seinem Verweissystem seine Leser auf Widersprüche in eingefahrenen Denkstrukturen aufmerksam zu machen, sie zur Überprüfung vorgefaßter, fest etablierter Ansichten zu zwingen, um à la longue vielleicht einen Wandel im Denken herbeizuführen – Langzeitwirkung eines schleichenden Giftes? – das scheinen die Verfechter der alten Ordnung zu befürchten.
Den in einem Brief an Sophie Volland propagierten »Umschwung in den Köpfen« hatte der Herausgeber auch in seinem Artikel Enzyklopädie als Hauptfunktion der Verweise herausgestellt. In diesem zentralen Artikel diskutiert er erstaunlich ausführlich Fragen des Stils, der Konzeption, wenn man so will: der Poetik, Merkmale also, die das Wörterbuch erst zu einem Werk machen. Hierfür beansprucht Diderot als Hauptherausgeber offensichtlich die Verantwortung für sich als derjenige, der die – durchaus als positiv dargestellte – Vielfalt der Artikel aus den verschiedensten Disziplinen aus den Federn unterschiedlichster Mitarbeiter einem einheitlichen Stilwillen unterwirft. Dieser Stilwille vereint in sich zwei einander scheinbar widersprechende Anforderungen: herkömmliches Wissen nicht trocken, sondern elegant zu formulieren, zugleich aber modernes Fachwissen allgemeinverständlich zu präsentieren und derart ein möglichst breites Laienpublikum zu erreichen. Damit distanziert er sich kategorisch von gelehrten Foliantenfüllern, denen ein ebenso gelehrtes Fachpublikum es über Jahrhunderte hinweg nachgesehen hatte, wenn diese unverdaulichen Schinken »ohne Genie, ohne Geschmack und ohne Eleganz geschrieben« waren. Das höchste Prinzip dieses einheitlichen Stilwillens bildet die immer und überall gültige Ausrichtung auf den Menschen. Und nicht ohne einen gewissen Stolz kann Diderot am Ende seines Enzyklopädie-Artikels darauf verweisen, daß er mit dieser Ausrichtung und dem darauf abzielenden Stilwillen und Werkcharakter augenscheinlich Erfolg gehabt hat, wenn er von Menschen berichtet, »welche die Enzyklopädie von vorne bis hinten gelesen haben«, – eine heutzutage angesichts aktuell marktgängiger Enzyklopädien und üblicher Lesegewohnheiten kaum nachvollziehbare Erfolgsmeldung. Und doch läßt dieser Stilwille Raum für individuelle Ausprägungen, wie ihn, um nur ein Beispiel zu nennen, Diderots Freund Deleyre in seinem Artikel Fanatismus nutzt, um den »schwärmerischen Stil« seiner ideologischen Gegner zu parodieren und zu karikieren.
Auf gewisse Dogmen, Repräsentanten, Institutionen dieser alten Ordnung wagen die Enzyklopädisten auch den Frontalangriff, attackieren nicht allein Denkstrukturen, sondern auch Inhalte. Das geringste Risiko laufen sie mit Attacken auf Vertreter der Kirche und ihrer Einrichtungen, etwa auf die Jesuiten in dem gleichlautenden Artikel Diderots, als der Orden bereits in Frankreich verboten ist (1761); auf das kirchliche Erziehungsmonopol und -ideal in d’Alemberts Collège; auf die für Ökonomie und Bevölkerungsentwicklung schädliche monastische Lebensführung in Jaucourts Kloster. In dem Maße, in dem sie offizielle Glaubenslehren in Frage stellen und folglich große Risiken zu gewärtigen haben, bemühen sie sich allerdings um eine subtilere Form der ideologischen Kriegsführung, wie sie etwa Naigeon (Unitarier) praktiziert, wenn er den Sozinianismus an der Oberfläche kritisiert, in Wirklichkeit aber preist; oder Diderot, der in Epidélius mit heidnischen Wundern zugleich auch den christlichen Wunderglauben in Mißkredit bringt; oder der Baron d’Holbach, ein wahrer Meister dieser Technik, der in Dutzenden von Artikeln über fremde Völker, Sitten und Gebräuche christliche Dogmen in exotischem Gewande relativiert, in Frage stellt und der Lächerlichkeit preisgibt.
Solange sich die Enzyklopädie noch mit dem königlichen Privileg schmücken durfte, mußte besonders im Bereich der Politik mit höchster Vorsicht verfahren werden: So nimmt es nicht wunder, daß sich die Mehrzahl der Artikel, die sich kritisch mit dem zeitgenössischen politischen System und seiner Praxis auseinandersetzen, auf die letzten zehn Bände konzentrieren, die auf diese offizielle Bescheinigung der Übereinstimmung mit der herrschenden Ideologie verzichten mußten. Immerhin wagt sich Diderot mit seinem Beitrag Politische Autorität (Autorité politique) schon im Eröffnungsband – trotz seiner pflichtschuldigen Reverenz vor dem einheimischen Königtum am Ende des Artikels – weit vor, gilt ihm doch die Zustimmung der Untertanen als Voraussetzung jeglicher politischer Autorität (ähnlich Jaucourt im Artikel Regierung) und verwirft er auf der anderen Seite Gottgewolltheit gleich welcher staatlicher Gewalt. Dagegen erregt Rousseau wahrscheinlich wegen des allzu theoretischen Charakters seiner Überlegungen zur Ökonomie merkwürdig wenig Aufsehen. Zahlreiche spätere Artikel wie Gewalt (Pouvoir), Eigentum (Propriété), Souveräne (Souverains) richten sich mehr oder weniger offen gegen die herrschende Staatsform der absoluten Monarchie; oft wird der konstitutiven Monarchie nach englischem Vorbild der Vorzug gegeben (z.B. Jaucourt im Artikel Tyrannie), ohne daß das Muster von jenseits des Kanals freilich kritiklos propagiert würde (d’Holbach in Représentants).
Kritische Äußerungen gegenüber der zeitgenössischen Regierung bleiben verständlicherweise rar: Ein Artikel wie der über die Intendanten, der diese Institution und das Steuersystem aufs Korn nimmt, bleibt folglich die Ausnahme – und anonym.
Ein besonders uneinheitliches Bild bietet die Enzyklopädie auf dem Gebiet der Ökonomie, wo man sich allenfalls in der Ablehnung der Luxuswirtschaft einigermaßen einig ist, während die vor allem von Quesnay verfochtenen physiokratischen Positionen durchaus keine einhellige Zustimmung finden. Angesichts der Tatsache, daß moderne industrielle Produktionsweisen, Industriezweige und wirtschaftliche Organisationsformen im Frankreich der Aufklärung noch in den Kinderschuhen stecken, kann es nicht verwundern, wenn das Hauptaugenmerk der Enzyklopädisten auf der Landwirtschaft, den Manufakturen und dem Handel liegt. Dennoch bietet das Werk auch im Bereich der Technologie beachtliche Innovationen: Zum ersten Mal wird hier das Bemühen um eine allgemeinverständliche Darstellung von Fachwissen über technische Vorgänge, Abläufe, Verfahren, Werkzeuge usw. spürbar, werden Wissensbarrieren und Zunftschranken durchbrochen, wird das Prinzip Geheimnis durch das Prinzip Öffentlichkeit ersetzt und damit Kommunikation zwischen Theorie und Praxis, Eingeweihten und interessierten Laien möglich. Neu ist auch, daß die Beachtung, welche die traditionell von den Eliten verachteten ›mechanischen Künste‹ erfahren, von der Autopsie bis zum Werkstattbesuch geht. Schließlich vermittelt sich die eigene Anschauung der Bearbeiter über die Kupfertafeln auch dem Publikum, steht die Technologie doch im Mittelpunkt der 2900 »planches«, auch wenn Produzenten von Texten und Abbildungen nicht identisch sind und das Verweissystem zwischen den beiden Medien alles andere als perfekt funktioniert.
Im Vergleich zu ihren Vorgängern in Frankreich und darüber hinaus in Europa bildet die Encyclopédie Diderots und d’Alemberts, sieht man von der Schlampigkeit einzelner Artikel und der insgesamt nachlässigen, fehlerhaften Edition ab, fast in jeder Hinsicht einen erheblichen Fortschritt: Keiner außer Johann Heinrich Zedlers Universallexikon (1732–1754) mit seinen 64 Bänden übertrifft sie im Umfang. Keiner kann sich eines auch nur annähernd vergleichbaren umfangreichen und kompetenten Mitarbeiterstabes rühmen. Keiner informiert über ein derartiges Spektrum des Wissens. Keiner beschäftigte über einen ähnlich langen Zeitraum so viele Druckerpressen in halb Europa und fand ein ähnlich breites Publikum auf dem gesamten Kontinent. Und keiner erregte ein solches Aufsehen in der kritischen Öffentlichkeit und soviel Anstoß bei den Obrigkeiten.
Von daher könnte man geneigt sein, die Encyclopédie als ein Kampfinstrument der Aufklärung zu verstehen, selbst wenn eine große Zahl ihrer Leser dies durchaus nicht so gesehen haben mag. Jedenfalls dürfte seit 1752 so ziemlich jedem Käufer klar gewesen sein, welch ideologischen Sprengstoff er mit seinem Kauf erstand: Ob er in seinem Kopf zündete, war dann seine Sache – Diderot, d’Alembert und Co. hatten das Ihre dazu getan.
Von der Aufklärung zur Revolution?
Wir haben es schon gesehen: Nicht alle 1789 noch nicht verstorbenen Enzyklopädisten überleben die Revolution, wenige begrüßen sie, die wenigsten profitieren von ihr. Mit welchen Augen aber sahen die Revolutionäre und ihre Gegner die Enzyklopädie und die Enzyklopädisten? Robespierre hatte nichts als Verachtung für die »Sekte« der Enzyklopädisten übrig; denn
»[…] sie hatte ein paar schätzenswerte Männer und eine Menge von ehrgeizigen Scharlatanen in ihren Reihen. Mehrere von ihren führenden Köpfen waren einflußreiche Persönlichkeiten im Staat geworden: ohne ihren Einfluß und ihre Politik zu kennen, hätte man keine vollständige Vorstellung von dem, was unserer Revolution vorausging. Auf dem Gebiet der Politik erreichte diese Sekte niemals das Niveau der Rechte des Volkes; auf dem Feld der Moral ging sie weit über die Zerstörung der religiösen Vorurteile hinaus. Ihre Koryphäen wetterten zuweilen gegen den Despotismus und ließen sich von Despoten Pensionen geben; sie schrieben einmal Bücher gegen den Hof und ein anderes Mal Widmungsbriefe an die Könige, Reden für die Höflinge, Madrigale für die Kurtisanen; sie waren stolz in den Schriften und kriecherisch in den Vorzimmern.«
So wenig Robespierre und die Jakobiner auch die Männer um Diderot und ihre Vorreiterrolle anzuerkennen vermochten, so wenig hinderte dies einen Exjesuiten, den Abbé Barruel, in einer dickleibigen Geschichte des Jakobinismus im Jahre 1797, nur fünf Jahre nach dem Urteil des Unbestechlichen, eben diese Vorreiterrolle der Philosophen gegenüber den Revolutionären herauszustellen. Seite an Seite mit Voltaire und Friedrich dem Großen sieht der gute Abbé Diderot und d’Alembert an der Spitze einer Konspiration gegen Thron und Altar, als deren direkte Erben er die Jakobiner ausmacht. Friedrich der Große freilich hätte es sich entschieden verbeten, gerade mit Diderot in einen Topf geworfen zu werden, dessen pazifistische Spitzen gegen ihn und seine Politik er keineswegs goutierte, wie er denn überhaupt nicht gerade ein begeisterter Leser der Enzyklopädie und anderer Werke seines Herausgebers war. Die Abneigung des Philosophen auf dem Königsthron hat freilich wesentlich tiefer liegende Ursachen, wurzelt sie doch in einem grundsätzlichen Mißtrauen gegenüber Volksaufklärung, ein Mißtrauen, das der Preußenherrscher im übrigen mit anderen gekrönten Häuptern teilt. So spricht er sich etwa Luise Dorothea, der Herzogin von Sachsen-Gotha gegenüber im Brustton der Überzeugung aus: »Vorurteile bilden die Vernunft des Volkes«, und zum Abbau dieser Vorurteile und abergläubischen Überzeugungen will der Monarch aus wohlverstandenem Eigeninteresse ebensowenig beitragen wie seine herzogliche Korrespondentin, die ihrerseits grundsätzlich daran zweifelt, daß »dieses dumme Volk« ein Recht hat, »aufgeklärt zu werden«. Und dennoch hat die Herzogin indirekt zur Verbreitung enzyklopädischen Gedankenguts in Deutschland beigetragen – zumindest unter ihresgleichen. Denn sie war die Erstabonnentin der Correspondance littéraire des Diderot-Freundes und glühenden Anhängers der Enzyklopädie Friedrich Melchior Grimm (1723–1807). Immer wieder stellt dieser mit sichtlicher Begeisterung einzelne Bände des Werkes in seiner Zeitschrift eingehend vor, nennt vor allem Diderot als Verantwortlichen für neue Ideen und tiefe Einsichten und die Enzyklopädie insgesamt in einem Atemzug mit Montesquieus Geist der Gesetze und Buffons Naturgeschichte als epochemachende Werke des 18. Jahrhunderts. Und im Rückblick singt die Correspondance littéraire 1779 geradezu ein Loblied auf sie als »das erhabenste Denkmal […], das zu Ehren der Literatur je errichtet worden ist«. Dem Preußenkönig war im Gegensatz zur Herzogin Grimm ebenso zuwider wie Diderot. Die von ihm verächtlich als »Enzyklopädisten« titulierten radikalen Aufklärer zogen sich mit Werken wie d’Holbachs Essai sur les préjugés (1769) endgültig den ingrimmigen Zorn des einstmals von den französischen Philosophen fast einhellig als »Salomon des Nordens« gefeierten Friedrich zu. Denn der Baron hatte sich in dieser Schrift nicht nur vehement für Volksbildung eingesetzt, sondern auch klar herausgestellt, daß neben der Kirche auch die gekrönten Häupter eben diese Volksbildung und -aufklärung im Sinne der Emanzipation von (religiösen) Vorurteilen bewußt und systematisch verhinderten. Und diesem Zorn ließ Friedrich in ironischen Seitenhieben auf Diderot, d’Holbach und Co. freien Lauf, wenn er bekannte, er fürchte deren »enzyklopädische Exkommunikation«, obwohl für ihn das Hauptwerk der Aufklärung letztlich nichts war als »ein Haufen von Paradoxen und leichtfertig vorgebrachten Ideen« – Ideen freilich, die auch philosophisch angehauchte gekrönte Häupter mächtig in Rage bringen konnten.
Diese Ablehnung der Enzyklopädie gilt ganz allgemein für die deutschen Landsleute des Preußenkönigs, zumal nach der Revolution, die nicht nur auf die deutschen Fürsten wie ein Schock wirkte. Zudem stieß – insbesondere die radikale – französische Aufklärung in Kreisen deutscher Literaten und Intellektueller seit etwa 1770 im Zuge der Sturm-und-Drang-Bewegung verstärkt auf Ablehnung. So konnte es nicht ausbleiben, daß gerade auch deutsche Stimmen in den Chor jener einstimmten, welche die Verschwörungsthese des Abbé Barruel nachplapperten. Danach ist die von Diderot und seinen Gesinnungsgenossen betriebene Untergrabung von Moral, Religion und Regierungstreue für den gewaltsamen Umsturz der alten Ordnung in Frankreich verantwortlich. Außenseitern wie Maximilian Klinger blieb es vorbehalten, die Konspirationstheorie ins Reich der Märchen und auf die gesellschaftlichen Widersprüche unter dem Ancien Régime als die wahren Ursachen der Revolution zu verweisen. Ebenso eigentümliche wie überraschende Parallelen zu Robespierres Überlegungen zeigen die Gedanken des berühmten konservativen Kritikers der Französischen Revolution, Edmund Burke, dessen Reflections on the Revolution in France 1790 erscheinen und immense Aufmerksamkeit erregen. Auch der Engländer sieht eine Kabale am Werk, die sich die Zerstörung der christlichen Religion vorgenommen hat, zugleich aber sich nicht scheut, mit einem ausländischen Despoten wie Friedrich II. gemeinsam zu intrigieren oder in echter Demagogenmanier auf der einen Seite sich mit ihrem Eintreten für das Volk zu brüsten und andererseits Hof, Adel und Klerus herabzusetzen. Bei näherem Hinsehen jedoch vermögen diese Parallelen in der Einschätzung weniger zu überraschen; betrachtet man nämlich die spezifische Situation, in der die Intellektuellen und Schriftsteller der Aufklärung sich befanden, so wird deutlich, daß die Verhaltensweisen der Enzyklopädisten den nachfolgenden Generationen, gleich ob im revolutionären Frankreich oder im liberalen England widersprüchlich vorkommen mußten. Zunächst einmal war ein derart gewaltiges Unternehmen wie die Enzyklopädie ohne Unterstützung oder zumindest Duldung der Obrigkeit – oder wichtiger Angehöriger der Machteliten – völlig unmöglich, so daß sich ein gewisses Taktieren der Herausgeber nicht vermeiden ließ; ein solches Taktieren manifestierte sich beispielsweise in der Widmung des Werkes an den Kriegsminister d’Argenson oder in den engen Beziehungen der Herausgeber zu Malesherbes. Insgesamt war nicht allein den Enzyklopädisten, sondern mehr oder weniger allen Aufklärern dieser Zeit eine gewisse Ambivalenz im Verhalten gegenüber den Mächtigen zu eigen; sie schwankten zwischen Unterwürfigkeit und kühner Aufsässigkeit, zwischen völliger Abhängigkeit und relativer Unabhängigkeit. Und gerade um sich einen gewissen Spielraum im Königreich zu verschaffen, griffen Aufklärer wie z.B. Voltaire zu, wenn ihnen der Preußenkönig eine ehrenvolle und lukrative Stellung bot. Dagegen waren jene, die trotz fehlender Autorenrechte und unzureichender Marktsituation sich – freilich eher mangels Protektion denn aus freiem Willen – als freie Schriftsteller versuchten, von vornherein zum Scheitern verurteilt, zumal in den letzten beiden vorrevolutionären Jahrzehnten, als immer mehr hoffnungsvolle junge Provinzler in die kulturelle Metropole Paris drängten, um dort ihr Glück als Autoren zu versuchen, doch meist nichts als Elend und Enttäuschung fanden.
Auch die herabsetzende Bezeichnung der Enzyklopädisten als Sekte bzw. Kabale, die sich wohl darauf bezog, daß sich eine Reihe von ihnen aus den Salongästen des Barons d’Holbach rekrutierte und sich dort regelmäßig traf, kennzeichnet die Lage der intellektuellen Eliten der Aufklärung, denn allein die begrenzte Öffentlichkeit des Salons vermochte den notwendigen Schutzraum für eine relativ freie Entfaltung auch kühner Gedanken zu bieten.
Die frappierendste Übereinstimmung bieten der konservative Engländer und der Revolutionär aus Arras auf dem Gebiet der Religion, wenn auch in den Augen Robespierres die Enzyklopädisten hier lediglich übers Ziel hinausschießen, während Burke geradezu den Antichristen am Werke sieht. Zunächst einmal bilden die hier Angegriffenen in religiöser Hinsicht durchaus keinen einheitlichen Block; die Spannweite ihrer Überzeugungen reicht im Gegenteil vom Katholizismus und Protestantismus über den Deismus bis zum (eher seltenen) Atheismus. Auf der anderen Seite identifiziert man Jakobinertum allzu vorschnell automatisch mit Atheismus: Für den unerbittlichen Moralisten Robespierre ist eine Vernunftreligion wie der Kult des Höchsten Wesens, den er so beharrlich propagiert, unabdingbar zur Aufrechterhaltung der Moral des Volkes. Dort, wo sich Burke und Robespierre widersprechen, ist der Einschätzung des Unbestechlichen zuzustimmen: Die Enzyklopädisten taten sich mit Sicherheit nicht als Vorkämpfer der Rechte des gesamten Volkes hervor, wenn es um soziale Gleichheit geht, galt ihnen doch das Eigentumsrecht als ehernes Prinzip und nur der Eigentümer als rechter Bürger des Staates. Auf der anderen Seite hat der Konservative nicht ganz unrecht, insofern jedenfalls Diderot die bittere Armut und unwürdigen Lebensumstände eines Teils seiner Landsleute beklagt (vgl. den Artikel Indigent – Bedürftig).
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß sich die Revolutionäre weder im allgemeinen noch im besonderen auf dem Felde der Politik auf die Enzyklopädisten beriefen. Wenn sie einen der großen Aufklärer zu ihrem Vorbild erkoren, dann war es Jean-Jacques Rousseau, der soziale Außenseiter, der sich seit 1758 von den Philosophen der Clique um d’Holbach distanziert und zum großen Einsamen stilisiert hatte und dessen Gesellschaftsvertrag zum – nicht immer befolgten – Katechismus der Revolution wurde. Zum Katechismus aber taugte die Enzyklopädie nicht: dazu war sie zu vieldeutig, zu widersprüchlich und – zu unhandlich und teuer.
Discours préliminaire Vorrede
[…] Das Werk, das wir beginnen (und welches wir zu beenden wünschen), verfolgt zwei Zwecke: Als Enzyklopädie muß es die Ordnung und Verkettung des menschlichen Wissens soweit wie möglich darlegen, als theoretisch begründetes Lexikon der Wissenschaften, der Künste und der Gewerbe muß es über jede Wissenschaft und über jede Kunst, sei sie frei, sei sie mechanisch, allgemeine Grundsätze, die ihre Basis sind, und die wichtigsten Details, die deren Gegenstand und deren Gehalt bilden, enthalten. Diese zwei Gesichtspunkte, Enzyklopädie und theoretisch begründetes Lexikon, werden dementsprechend die Gliederung und die Einteilung unserer Vorrede bilden. Wir werden sie in Betracht ziehen, sie einen nach dem anderen verfolgen und über die Mittel Rechenschaft ablegen, durch die man versucht hat, dieser doppelten Zielsetzung gerecht zu werden.
Sofern man nur über die Verbindung nachgedacht hätte, die die Entdeckungen untereinander haben, wäre es einfach gewesen, sich gewahr zu werden, daß die Wissenschaften und Künste sich gegenseitig Hilfe leisten und es folglich eine Kette gibt, die sie verbindet. Aber wenn es schon oft schwerfällt, jede Kunst und jede Wissenschaft im einzelnen auf eine kleine Anzahl Regeln und allgemeiner Begriffe zu reduzieren, so ist es nicht weniger schwierig, die unendlich verschiedenartigen Zweige der menschlichen Wissenschaft in ein einheitliches System zu bringen.
Der erste Schritt, den wir bei diesem Versuch unternehmen müßten, ist, man möge uns diesen Ausdruck gestatten, die Genealogie und die Verbindung unserer Kenntnisse zu untersuchen, die Gründe, die sie erzeugt haben müssen, und die Eigentümlichkeiten, die sie unterscheiden; in einem Wort, zurückzugehen bis zum Ursprung und bis zur Entstehung unserer Ideen. Unabhängig von der Hilfe, die wir aus dieser Untersuchung für eine enzyklopädische Aufzählung der Wissenschaften und der Künste ziehen werden, wird sie am Anfang eines theoretisch begründeten Lexikons des menschlichen Wissens nicht unangebracht sein. […]
Das Gedächtnis, die Vernunft im eigentlichen Sinn und die Einbildungskraft sind die drei unterschiedlichen Formen, mit denen unser Geist auf die Gegenstände seiner Gedanken einwirkt. […] Diese drei Fähigkeiten bilden zunächst die drei allgemeinen Einteilungen unseres Systems und die drei allgemeinen Gegenstände menschlichen Wissens; die Geschichte, die sich auf das Gedächtnis bezieht, die Philosophie, die aus der Vernunft hervorgeht, und die Schönen Künste, die der Einbildungskraft entspringen. Wenn wir die Vernunft der Einbildungskraft voranstellen, erscheint uns diese Anordnung wohl begründet und dem natürlichen Fortschreiten der Operationen des Geistes gemäß: Die Einbildungskraft ist eine schöpferische Fähigkeit […]. D’ALEMBERT
D’Alemberts umfangreiche – hier nur in ganz kurzen Auszügen wiedergegebene – Vorrede bildet gemeinsam mit dem Prospekt, Diderots Artikel Enzyklopädie und dem Wissensstammbaum das theoretische Gerüst des gesamten Werkes.
Der Mitherausgeber insistiert hier insbesondere auf dem Problem, aber auch auf der unbedingten Notwendigkeit einer Wissenschaftssystematik, die er auf die drei grundlegenden Fähigkeiten des menschlichen Verstandes: Gedächtnis, Vernunft und Einbildungskraft, gründet. Wie im Wissensstammbaum werden hier alle Wissenschaften und Künste diesen Fähigkeiten zugeordnet.
Zugleich hebt er als die beiden Grundfunktionen des Werkes Wissensvermittlung und Wissenssystematisierung hervor. Dabei entspringt die systemische Verfassung des Wißbaren nicht mehr einem verborgenen göttlichen Weltplan, sondern ist dem Bauplan der Natur inhärent und von daher menschlicher Erkenntnis zugänglich.
Agnus Scythicus
(Naturgeschichte, Botanik)
[…] Hans Sloane sagt, das Agnus scythicus sei eine mehr als einen Fuß lange Wurzel mit Knollen, aus deren Enden ungefähr drei bis vier Zoll lange Stengel wüchsen, die denen des Farnkrauts ziemlich ähnlich sähen; ein großer Teil ihrer Oberfläche sei von gelblich-schwarzem Flaum bedeckt, der wie Seide glänze, ein Viertel Zoll lang sei und gegen das Blutspucken angewandt werde. In Jamaika, so fügt er hinzu, finde man verschiedene Farnarten, die so dick wie ein Baum würden und mit einem Flaum bedeckt seien, der dem gleiche, den man an unseren Frauenhaarpflanzen bemerkt. Übrigens scheint man eine gewisse Kunstfertigkeit aufzubieten, um ihnen die Gestalt eines Lamms zu geben, denn die Wurzeln ähneln dem Körper und die Stengel den Beinen dieses Tiers.
So führt aller Wunderglaube beim Agnus scythicus zu nichts oder zumindest zu sehr wenig, nämlich zu einer behaarten Wurzel, der man ungefähr die Gestalt eines Lammes gibt, indem man sie entsprechend zurechtbiegt.
Dieser Artikel wird uns auf Gedanken bringen, die nützlicher gegen den Aberglauben und das Vorurteil sind als der Flaum des Agnus scythicus gegen das Blutspucken. Kircher – und nach Kircher auch Julius Caesar Scaliger – schreibt ein wunderbares Märchen, und zwar in jenem gewichtigen und überzeugenden Ton, der Ehrfurcht gebietet. Das sind Männer, deren Einsicht und Rechtschaffenheit gewiß nicht verdächtig sind: alles spricht zu ihren Gunsten. Sie finden Glauben, und bei wem? Bei den ersten Genies ihrer Zeit. Und so bekräftigen plötzlich eine Unmenge von Aussagen, die stärker sind als die ihrigen, alle ihre Worte und bilden für diejenigen, die nach ihnen kommen, eine gewichtige Autorität, der zu widerstehen sie weder die Kraft noch den Mut haben, und das Agnus scythicus gilt dann als ein wirkliches Lebewesen.
Man muß die Tatsachen in zwei Klassen einteilen: in einfache und gewöhnliche Tatsachen und in außergewöhnliche und erstaunliche Tatsachen. Für die einfachen Tatsachen genügen die Aussagen einiger gelehrter und wahrheitsliebender Personen; für die anderen verlangt der denkende Mensch überzeugendere Autoritäten. Im allgemeinen müssen die Autoritäten in einem umgekehrten Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit der Tatsachen stehen; das heißt, sie müssen um so zahlreicher und bedeutender sein, je geringer die Wahrscheinlichkeit ist.
Man muß sowohl die einfachen als auch die außergewöhnlichen Tatsachen noch in vergängliche und beständige unterteilen. Vergänglich sind diejenigen, die nur zum Zeitpunkt ihres Bestehens existiert haben; beständig sind diejenigen, die immer existieren und von denen man sich jederzeit überzeugen kann. Man sieht, daß man den letzteren eher glauben kann als den ersteren und daß die Leichtigkeit, die jeder hat, sich von der Wahrheit oder Unwahrheit der Aussagen zu überzeugen, die Zeugen vorsichtig machen muß und die anderen Menschen dazu bewegt, ihnen zu glauben.
Die vergänglichen Tatsachen muß man einteilen in Tatsachen, die in einem aufgeklärten Zeitalter auftreten, und in solche, die in Zeiten der Finsternis und der Unwissenheit aufgetreten sind. Die beständigen Tatsachen müssen unterteilt werden in solche, die an einem zugänglichen oder an einem unzugänglichen Ort bestehen.
Man muß die Aussagen zunächst in sich selbst betrachten und sie dann miteinander vergleichen; man muß sie in sich selbst betrachten, um festzustellen, ob sie keinen Widerspruch enthalten und ob sie von aufgeklärten und gebildeten Leuten stammen; man muß sie miteinander vergleichen, um zu entdecken, ob die einen nicht ein Abklatsch der anderen sind und ob jene Masse von Autoritäten – Kircher, Scaliger, Bacon, Libarius, Licetus, Eusebius usw. – sich nicht etwa auf nichts oder auf die Autorität eines einzigen Mannes zurückführen läßt.
Man muß berücksichtigen, ob die Zeugen Augenzeugen sind oder nicht, was sie gewagt haben, um sich Glauben zu verschaffen, welche Befürchtung oder welche Hoffnungen sie gehegt hatten, als sie den anderen Tatsachen mitteilten, deren Augenzeugen sie angeblich gewesen waren. Wenn sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um ihre Aussage zu verteidigen, so muß man wohl zugeben, daß sie dadurch große Überzeugungskraft gewinnt. Wie aber wäre es darum bestellt, wenn sie ihr Leben geopfert und eingebüßt hätten?
Man darf die Tatsachen, die sich vor den Augen eines ganzen Volkes abgespielt haben, auch nicht mit denen vermengen, die nur wenige Personen als Zuschauer gehabt haben. Die verborgenen Tatsachen verdienen, sofern sie wunderbar sind, kaum Glauben; dagegen können die offenkundigen Tatsachen, gegen die man früher keinen Einspruch erhoben hat oder gegen die nur von wenigen übelwollenden oder schlecht unterrichteten Menschen Einspruch erhoben worden ist, kaum angefochten werden.
Das ist ein Teil der Prinzipien, nach denen man sich richten muß, um etwas glauben zu können oder nicht, wenn man nicht auf Hirngespinste hereinfallen will und wenn man die Wahrheit aufrichtig liebt. Siehe Gewißheit, Wahrscheinlichkeit usw. DIDEROT
Ein typisches Beispiel für Diderots Verfahren, an unscheinbarem, verstecktem Ort relativ offen sich nicht allein über die Autoritätenhörigkeit vergangener Gelehrtengenerationen lustig zu machen, sondern implizit auch den christlichen Wunderglauben mit den Waffen der Empirie und der kritischen Vernunft zu attackieren. Seine kaum verhüllte, ironisch gefärbte Polemik, auf die das Dictionnaire de Trévoux mit einem Plagiatsvorwurf (!) reagiert, richtet sich besonders gegen den Jesuiten und Universalwissenschaftler Athanasius Kircher (1602–1680), der das Borametz, dessen Zwittercharakter zwischen Pflanze und Tier in der Frühen Neuzeit heftig diskutiert wurde, allerdings durchaus eindeutig ins Reich der Pflanzen verwies. Mit dem Verweis auf den 1752 im 2. Band erschienenen, heftig umstrittenen Artikel Gewißheit (Certitude), in dem sich der Verfasser, der Abbé de Prades, ebenso heftig wie vergeblich bemüht, Diderots in den Philosophischen Gedanken formulierter Skepsis gegenüber den angeblichen Wunderheilungen am Grabe des kurz zuvor verstorbenen Jansenisten Pâris entgegenzutreten, erhält dieser auf der Oberfläche so harmlose, in seiner Argumentation die Pedanterie Cartesianischer Logik nachahmende Beitrag des Herausgebers aktualisierende Brisanz.
Aigle – Adler
(Naturgeschichte)
[…] Der Adler ist ein Vogel, der dem Jupiter seit dem Tage geweiht ist, an dem dieser Gott die Auguren auf der Insel Naxos nach dem Ausgang des Krieges befragt hatte, den er gegen die Titanen führen wollte. Da erschien ein Adler, der für ihn ein glückliches Vorzeichen war. Man erzählt auch, daß ihm in seiner Kindheit der Adler Ambrosia brachte und daß er ihn zur Belohnung für diese Fürsorge später zu den Gestirnen erhob. Auf den Bildnissen Jupiters sieht man den Adler bald zu Füßen des Gottes, bald an seiner Seite und fast immer mit dem Blitzstrahl in seinen Fängen. Allem Anschein nach beruht diese ganze Sage nur auf der Beobachtung des Fluges des Adlers, der sich gern bis zu den höchsten Wolken aufschwingt und sich auch gern im Reich des Donners aufhält. Das war alles, was nötig war, um aus ihm den Vogel des Gottes des Himmels und der Lüfte zu machen und ihm den Blitzstrahl anzuvertrauen. Die Heiden brauchte man nur in Bewegung zu setzen, wenn es ihre Götter zu ehren galt; denn der Aberglaube ersinnt eher die verrücktesten und plumpesten Hirngespinste, als daß er Ruhe gibt. Diese Hirngespinste werden später durch die Zeit und die Leichtgläubigkeit der Völker geheiligt, und wehe dem, der, ohne von Gott zu dem erhabenen und gefährlichen Stand eines Missionars berufen zu sein, seine Ruhe so wenig liebt und die Menschen so schlecht kennt, daß er es auf sich nimmt, sie zu belehren. Wenn ihr einen Lichtstrahl in ein Eulennest fallen laßt, so verletzt ihr nur die Augen der Eulen und erweckt ihr Geschrei. Hundertfach glücklich ist das Volk, dem die Religion vorschreibt, nur wahre, erhabene und heilige Dinge zu glauben und sich nur tugendhafte Handlungen zum Vorbild zu nehmen. Eine solche ist unsere Religion, nach welcher der Philosoph nur seiner Vernunft zu folgen braucht, um zu den Füßen unserer Altäre zu gelangen. DIDEROT
Man schlägt den Sack und meint den Esel – die heidnisch-antike Mythologie lächerlich zu machen, in Wirklichkeit aber die christliche Religion zu meinen, ist eine seit dem Libertinismus des frühen 17. Jahrhunderts in Frankreich geläufige und jedem gebildeten Leser der Aufklärung vertraute Praxis. Vor diesem Hintergrund wirkt die Lobeshymne auf den Katholizismus am Ende des Textes nachgerade wie Hohn.
Animal – Tier
(Enzyklopädische Ordnung: Verstand, Vernunft, Philosophie oder Wissenschaft, Naturwissenschaft, Zoologie)
[…] Das Tier, sagt Buffon in der Allgemeinen und besonderen Naturgeschichte, ist »lebende, organisch gebaute Materie, die empfindet, handelt, sich bewegt, sich ernährt und sich reproduziert. Folglich ist die Pflanze lebende, organisch gebaute Materie, die sich ernährt und sich reproduziert, aber nicht empfindet, nicht handelt und sich nicht bewegt. Das Mineral aber ist tote, anorganische Materie, die nicht empfindet, nicht handelt, sich nicht bewegt, sich nicht ernährt und sich nicht reproduziert. Daraus folgt auch, daß die Empfindung das Hauptunterscheidungsmerkmal für das Tier ist. Aber steht denn fest, daß es keine Tiere ohne das gibt, was wir Empfindung nennen, oder gibt es, wenn wir den Cartesianern glauben, außer uns noch andere Tiere, die Empfindung haben? Die Tiere, behaupten sie, legen Anzeichen dafür an den Tag, aber nur der Mensch besitzt wirklich Empfindung. Verliert übrigens der Mensch nicht zuweilen die Empfindung, ohne daß er aufhört, zu leben oder ein Tier zu sein? Dann schlägt der Puls weiter, vollzieht sich der Blutkreislauf wie vorher, werden alle Lebensfunktionen ausgeübt wie bisher; aber der Mensch empfindet weder sich selbst noch die anderen Wesen. Was ist dann der Mensch? Wenn er auch in diesem Zustand noch immer ein Tier ist, wer hat uns dann gesagt, daß es beim Übergang von der vollkommensten Pflanze zum primitivsten Tier keine Wesen dieser Art gibt? Wer hat uns gesagt, daß dieser Übergang nicht von mehr oder weniger lethargischen, mehr oder weniger tief schlafenden Wesen repräsentiert worden ist, so daß der einzige Unterschied, der zwischen dieser Klasse und der Klasse der übrigen Tiere wie uns bestehen könnte, der wäre, daß sie schlafen und wir wach sind, daß wir Tiere sind, die empfinden, und sie Tiere, die nicht empfinden? Was ist also das Tier?«
Hören wir, welche ausführlichere Erklärung Buffon gibt. Das Wort Tier, sagt er im zweiten Band der Naturgeschichte