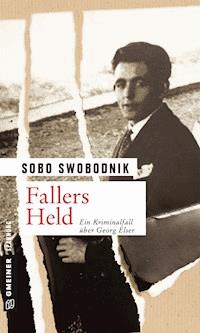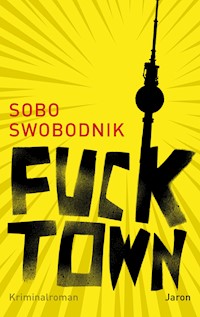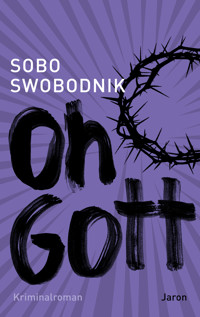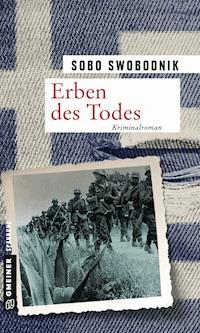
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Kurz hintereinander sterben in einem Seniorenheim mehrere Menschen. Dem Zivildienstleistenden Franz Benedikt Zacher kommen die Todesfälle höchst seltsam vor. Er glaubt nicht, dass es sich dabei um eine zufällige Häufung handelt. Franz fängt an, sich näher für die verstorbenen Bewohner zu interessieren, bis er merkt, dass auch er Teil einer Intrige ist. Seine eigene Vergangenheit und die seiner Familie scheinen mit den Verstorbenen zusammenzuhängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobo Swobodnik
Erben des Todes
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ana Gram / Fotolia.comund © ullstein bild und © Zhax / shutterstock.comISBN 978-3-8392-5386-1
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
eins
Ich war’s nicht. Ich schwör’s. Ich bin unschuldig. Das müssen Sie mir glauben. Ich weiß, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob nur ich es gewesen sein kann. Aber wissen Sie nicht besser als ich, dass der erste Blick allzu oft trügt? Der erste Blick zeigt nur die Oberfläche, bebildert vordergründige Logik. Das Leben ist komplizierter, viel komplizierter. Der Tod hingegen ganz einfach. Ihn nachzuweisen auch. Auf den ersten Blick scheint alles klar – wenn Sie genauer hinschauen, dann bleibt Ihnen aber gar nichts anderes übrig, als zu erkennen, dass es meistens auch anders hätte sein können. In meinem Fall ganz anders. Ich kann alles erklären. Ich werde alles erklären. Alles, was ich jetzt sage, trug sich genau so zu. Auch wenn andere anderes behaupten. Ich weiß, der Staatsanwalt, die Kläger und Zeugen, womöglich der Richter, die Schöffen und Beisitzer, die Zuschauer werden mir nicht glauben. Aber Sie, Sie müssen mir glauben. Wer, wenn nicht Sie?
zwei
Das Seniorenheim Marienstift kenne ich seit meiner Kindheit. Im Alter von sieben muss ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule daran vorbei. Die ersten Jahre besteht das Marienstift für mich nur aus einem hohen Bretterzaun, der mir die Sicht auf etwas nimmt, was offenbar nur im Verborgenen, im Geheimen einen Platz hat. Später bleibe ich oft vor dem Zaun stehen und blicke zwischen den Holzlatten hindurch. Ich sehe ein altes, um die Jahrhundertwende gebautes, riesiges Haus mit einem großen Garten davor. Der Rasen ist gepflegt. Schatten spendende Bäume, die ähnlich alt wie das Haus sein müssen, ragen hoch in den Himmel. Pappeln, Kastanien, Birken. Nahe am Bretterzaun wachsen hoch aufgeschossene Tannen. Auf der aus quadratischen Steinplatten bestehenden Terrasse stehen weiße Liegestühle aus Plastik, dazu passend vereinzelte Tische. Dazwischen Rollstühle. Darin Menschen. Anfänglich, als vielleicht Zehnjähriger, denke ich, es wären Puppen, so unbeweglich sitzen sie in ihren Stühlen. Ich erschrecke geradezu, als ich nach Tagen der Beobachtung eine erste Bewegung wahrnehme. Der Kopf einer Frau fällt zur Seite. Gleichzeitig rutscht das Bein einer anderen Person von der Fußstütze des Rollstuhls. Eine junge Frau in einem weißen Kittel kommt angerannt und richtet den zur Seite gefallenen Kopf wieder auf. Stellt den Fuß zurück auf die Stütze. Von da an weiß ich, es sind keine Puppen. Es sind Menschen. Alte Menschen, die meist völlig apathisch, in dicke Wolldecken eingehüllt vor sich hinstarren. Ab und an brabbelt eine Alte oder schreit laut auf, um sofort wieder zu verstummen. Manchmal lacht eine oder weint scheinbar grundlos vor sich hin. Ich stehe vor dem Bretterzaun und starre durch den Spalt, gleichzeitig angezogen und abgestoßen von so viel Leid, Krankheit und siechendem Verfall. Einmal ertappt mich eine der Schwestern am Zaun und wirft mit Steinen nach mir.
Als ich dann älter werde, meine Stimme plötzlich brüchig ist und ein weicher Flaum auf meiner Oberlippe sprießt, interessiere ich mich immer weniger für die dahinvegetierenden Alten in ihren Rollstühlen. Meine Neugierde gehört von nun an den jungen, geschäftig agierenden Schwestern. Ich stehe nach wie vor am Bretterzaun, mit dem Gesicht nah am Holz, und beobachte durch den Spalt, wie sie in ihren weißen Kitteln, mit anmutigen Bewegungen durch den Garten tanzen. Ja, es ist eine Art Tanz, den sie vor meinen Augen vollführen: mein Schwanentanz. Sie schieben die Rollstühle vom Schatten in die Sonne, dann wieder in den Schatten, bringen Schnabeltassen, Kuchenteller, schwingen Wolldecken in der Luft, wischen Speichelfäden aus den Gesichtern, heben Beine hoch und richten zur Seite gefallene Köpfe wieder auf. Ich tanze mit. Ich schließe die Augen und lege meine Hände um ihre Hüften, schmiege meinen Kopf auf ihre weißen Kittel, drücke mein Gesicht zwischen ihre Brüste und höre ihr Herz schlagen. Ich umkreise sie, glaube ihren Geruch zu riechen – ein Duft aus Schweiß, Haarspray und billigem Parfüm – und werde ganz betört davon. Ich tauche ein in diese, mir bis dahin völlig fremde Welt, aus schüchterner Pennäler-Leidenschaft und naivem Begehren und der Gewissheit, dass noch Wunder geschehen. Meine Fantasie trägt mich auf den flatternden Kittelschürzen fort und katapultiert mich hoch über die Tannenwipfel hinaus und geradewegs in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das nur in meinen Vorstellungen so real wie der Bretterzaun ist. Dennoch bin ich nicht erregt, sexuell erregt, meine ich, so wie Jahre später vielleicht: Ich bin glücklich. Mit jedem Schlag der Schwester-Herzen werde ich weiter fortgetragen. Weg von mir, hin zu ihnen.
Später, als der Flaum auf meiner Oberlippe harten Stoppeln weichen muss und auch die Stimme wie die eines Mannes klingt, ist es nur noch eine Schwester, die meine Blicke anzieht. Sie heißt Annemarie, ist sicher 15 oder 20 Jahre älter als ich, nicht sonderlich hübsch und etwas dicklich. Sie trägt schwarze lange Haare, die zu einem Dutt geflochten sind. Ich weiß nicht, warum gerade sie meine Aufmerksamkeit erregt. Andere Schwestern sind durchaus hübscher, attraktiver, auch jünger als sie. Vielleicht ist es ihr voluminöser Brustumfang, der mir keine Wahl lässt. Ich weiß es nicht. Ein 17-jähriger Junge denkt in anderen Kategorien. Dem Hirn eines 17-Jährigen ist sechs Jahre später nicht mehr beizukommen. Was ich heute noch weiß, ist, dass ich damals in Annemarie verliebt war.
*
Ein Student verlässt, noch ehe die Leiche aufgedeckt ist, den Seziersaal und muss sich übergeben. Allein der Geruch verursacht bei ihm Übelkeit.
»Das ist normal«, sagt Professor Dr. Homberg, der die Irritation seiner Studenten sichtlich genießt.
»Gleich kommen noch welche dazu.«
Er grinst in die bleichen Antlitze der Umherstehenden.
»Beim zweiten Mal werden es dann weniger. Und beim dritten Mal essen Sie nebenbei eine Wurstsemmel. Wetten?!«
Niemand kann sich das in diesem Moment auch nur vorstellen.
»Wenn nicht, haben Sie hier nichts verloren.«
Homberg grinst wieder und blickt jedem Einzelnen von uns für einen kurzen Moment in die Augen. Seine Drohung wird dadurch noch bedeutungsvoller, auch unheimlicher.
»Wer hat von Ihnen schon einmal eine Leiche gesehen?«
Ich bin der Einzige, der schüchtern den Arm hebt.
»Dann ist das für Sie jetzt die zweite.«
Professor Homberg zieht mit einem Ruck das weiße Laken vom Seziertisch. Ich erschrecke. Nein, erschrecken ist nicht der richtige Ausdruck. Ich bin vielmehr überrascht. Es ist Silvia. Oder Marita. Oder Susan. Es ist auf jeden Fall eine von Ralfs Eroberungen, mit der er mich – ich auf meiner Luftmatratze im Flur, er in seinem Zimmer – um den Schlaf brachte. Mit dem Anblick der jungen, hübschen Frau ist sofort wieder ihre anschwellende, rhythmische Atmung, die den Flur entlang hallte, in meinem Kopf zurück. Ihre spitzen Schreie fallen mir ein. Ihr leidenschaftliches »Jaaaa!«. Ich merke, wie sich eine Erektion unter meinem weißen Kittel bemerkbar macht. Aber nicht nur ich betrachte mit wehmütigem Blick diese schöne Leiche.
So ein Mädchen hätte jeder männliche Student, der jetzt um den Seziertisch steht, gern – und nicht nur zum Essen – eingeladen. Auf ihrem Innenschenkel prangt eine geldscheingroße Tätowierung. Es ist ein Edelweiß. Ich denke an das Wettersteingebirge. An Mittenwald. An Opa. An Pfingsten. Ich muss grinsen.
»Das ist nicht zum Lachen«, schreit Professor Homberg. Der Tod ist nicht zum Lachen. Im Angesicht des Todes wird vielmehr alles lächerlich.«
Das ist nicht von ihm, denke ich, der Satz ist nicht von Homberg, und überlege, wer das gesagt haben könnte. Ich komme nicht drauf.
»Ich wollte Ihnen, zumindest beim ersten Mal und wenigstens zu Beginn der Sektion, den angenehmsten Anblick präsentieren, der möglich scheint.«
Das ist ihm gelungen. Die Brüste der Leiche schimmern marmorn. Ihr Bauch wölbt sich wie ein Kuchenteller nach oben. Ihre Haut ist weiß-grünlich. Ihre Schambehaarung zu einem dünnen Strich rasiert. Wie aus Wachs gegossen wölbt sich ihre Vulva unseren Blicken entgegen. Bei manchen Studentinnen füllen sich die Augen mit Wasser. Bei manchen Studenten der Mund. Es ist eine schöne Leiche, eine begehrenswerte Tote. Nekrophilie ist plötzlich eine Option, eine normale Spielart der Sexualität. Homberg ist in meinen Augen sofort verdächtig. Die Blicke meiner Kommilitonen bestätigen meinen Verdacht. Ich schließe kurz die Augen und sehe ihn, bei heruntergelassener Hose, sich an der Leiche vergehen. Ich reiße die Augen wieder auf und denke: Ist Homberg ein Schwein oder bin ich es?
»Schade um dieses Geschöpf könnte man denken«, sagt der Professor und streicht zärtlich mit den Gummihandschuhen über die Haut der Toten. »Oder aber auch: selber schuld. Hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie mehr wollen, als Sie vertragen können: Amphetamine, Derivate, Ecstasy, Atemnot, Herzstillstand, tot.«
Wieder sieht er jedem Einzelnen für einen kurzen Moment in die Augen. Homberg ist nicht nur Mediziner; offenbar fühlt er sich auch in der Rolle des Moralapostels sehr wohl. Der Professor wird mir immer unsympathischer. Die anfängliche Überlegung, dass Homberg uns bei unserer ersten Sektion mit dieser schönen Leiche schonen möchte, verwerfe ich sofort wieder. Ich weiß jetzt, das Gegenteil ist der Fall. Er will uns sogar über das übliche Maß hinaus quälen. Gerade deswegen weil diese Leiche so schön ist, so begehrenswert, wird jeder Schnitt in ihr Fleisch umso schmerzhafter für den Betrachter. Homberg ist ein Sadist. Homberg ist Zyniker. Homberg ist das Schwein! Vielleicht will er aber auch nur von Anfang an die Unfähigen, die Zu-zart-Besaiteten, die Sensiblen unter den Studenten herausfiltern. Dafür scheint ihm jede Methode, jedes Mittel recht zu sein. Als Professor Homberg ein unscheinbares Skalpell an der Kopfhaut der jungen Frau ansetzt und der erste Tropfen Blut über die Stirn der Leiche rinnt, merke ich, wie einige meiner Kommilitonen neben mir die Hände vor den Mund halten und mit unterdrückten Brech-Lauten den Seziersaal verlassen.
Ich kneife die Augen zu und denke an Opa.
*
Die Schulferien verbringe ich immer bei meinen Großeltern im Allgäu. Ich kann es nie erwarten, bis die Schule zu Ende ist und die Ferien endlich beginnen. Noch am selben Tag bringt mich Vater zum Bahnhof, setzt mich in den Zug, der mich zu Opa und Oma schafft. Ich fahre – es ist zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches – allein mit dem Zug von meiner Heimatstadt nach Mittenwald, wo meine Großeltern einen Bauernhof und eine Pension betreiben. Über drei Stunden dauert die Fahrt, während derer ich wie festgeklebt an meinem Fensterplatz sitze und der vorbeifahrenden Landschaft hinterhersehe. Dabei kommen mir die abwegigsten Gedanken in den Sinn, entstehen die absonderlichsten Vorstellungen. Wenn ich ein verlassenes Auto am Waldrand stehen sehe, stelle ich mir vor, es ist der Ort eines Verbrechens. Wenn ich die Augen schließe, höre ich Schreie, sehe Beine laufen und Blut spritzen. Ein abscheuliches Blutbad entsteht in meinem Kopf: 48 Messerstiche, eine zerstückelte Frauenleiche und ein flüchtiger Täter. Vor Angst reiße ich die Augen wieder auf. Das Auto ist verschwunden. Meine Hände sind schweißnass. Mein Blick flackert, die Augen suchen unruhig den Horizont ab. Sehe ich einen verlassenen Koffer auf einem Bahnsteig stehen, erwarte ich in der nächsten Sekunde eine Detonation. Mit jedem Wimpernschlag erahne ich in die Luft fliegende Körperteile. Hände, Arme, Beine, Köpfe verfolgen mich, bis der Zug längst wieder abgefahren und der Bahnhof nicht mehr zu sehen ist. Mein Großvater sagt: »Der Junge hat Fantasie.«
Meine Großmutter wischt mit der Hand vor ihrem Gesicht, was nur »Der spinnt!« bedeuten kann. Ob sie den Großvater oder mich meint, ist unklar. Heute weiß ich, es war nicht Fantasie, es war Aktenzeichen XY. Die Sendung ist dafür verantwortlich, dass ein Auto am Waldrand zum Ort des Verbrechens wird, dass ein Koffer zum terroristischen Anschlag mutiert, dass ein Blick eine Waffe ist, ein Wort töten kann. Damals sehen meine Eltern die Sendung regelmäßig und vergewissern sich am Bösen der Welt. Oft stehe ich im Schlafanzug zitternd hinter der angelehnten Wohnzimmertür und sehe durch den Spalt auf den Bildschirm, wo Eduard Zimmermann um Mithilfe bittet. Ich sehe die nachgestellten Kriminalfälle und höre die Stimme des Sprechers, wie er als Voice-over den Tathergang schildert. Allein der Klang dieser Stimme bereitet mir Albträume. Ich schwöre mir, später im Bett liegend, nie wieder dieser Stimme zu lauschen. Die ganze Nacht liege ich wach, starre zum Fenster und erwarte splitterndes Glas. Und doch ist die Neugierde und Faszination für das unaufgeklärte Verbrechen größer als die Angst, selbst Opfer zu werden; am nächsten Freitag stehe ich wieder am Türspalt.
Überall begegnen mir Gesichter, die auf großen Fahndungsplakaten hinter Eduard Zimmermann hängen. Auf dem Weg zur Schule kommen sie mir entgegen. Im Freibad liegen sie auf der Wiese und blicken jungen Frauen hinterher. Am Kiosk kaufen sie Bier und Schnaps in kleinen Fläschchen. Im Park sitzen sie auf Bänken, trinken das Bier, den Schnaps und rauchen filterlose Zigaretten.
Einmal sitzt mir im Zug eine Frau gegenüber, von der ich schwören kann, dass sie bei Eduard Zimmermann Dauergast ist. Ihr Gesicht kommt mir so bekannt und vertraut vor, als gehöre sie zu unserer Verwandtschaft. In Gedanken bringe ich sie in Zusammenhang mit allen unaufgeklärten Mordfällen der letzten fünf Sendungen. Sie sagt kein Wort, sieht mich nur an. Ich traue mich nicht zurückzuschauen. Es ist mir unheimlich. Ich werde rot. Schließe die Augen und wage mich nicht zu bewegen. Ich stelle mich schlafend und überlege, was zu tun ist. Mir fällt nichts ein. Ich könnte vielleicht aufstehen, das Abteil verlassen und den Schaffner um Hilfe bitten. Er würde mir über den Kopf streicheln, schmunzeln und sagen, ich bräuchte keine Angst zu haben, wir wären gleich da. Schweiß sammelt sich auf meiner Stirn. Ich merke, wie ich zittere. Bemerkt sie es auch? Weiß sie, dass ich weiß, wer sie ist? Wenn ja, was wird sie tun? Alle Tötungsdelikte und Tötungsmethoden der gesehenen Sendungen machen es sich in mir bequem. Messerstiche, Schusswunden und Axthiebe fallen über mich her. Ich möchte schreien. Traue mich aber nicht. Presse die Lippen aufeinander, bis es schmerzt. Ich zwinkere ein ganz klein wenig und sehe, wie die Frau böse grinst. Es ist aus, denke ich, jetzt erwürgt sie mich, erschießt oder ersticht mich. Vielleicht schlägt sie mir auch mit ihrem Stöckelschuh den Schädel ein. Aber ich bin doch noch ein Kind, ein unschuldiges Kind, will ich sagen – bringe aber kein Wort über meine zusammengepressten Lippen. Höre, anstelle meiner Worte, einen lauten, dumpfen Schlag. Ich öffne die Augen. Die Schiebetüre des Abteils ist zugefallen. Die Frau ist verschwunden.
*
Schon kurz nach dem Abitur beginne ich im Wintersemester Medizin in München zu studieren und entziehe mich so vorerst dem Zivildienst. Eigentlich will ich Schauspieler werden oder Dramaturg an einem Theater und hätte mich am liebsten am Studiengang Theaterwissenschaft eingeschrieben. Zwei Wochen bevor meine Eltern tödlich verunglückt sind, besteht mein Vater darauf, dass ich was Anständiges lernen solle. Meine Mutter schlägt Jura oder Medizin vor. Mein Vater Ingenieurwesen. Als beide tot sind, bringe ich es nicht übers Herz, ihren letzten Wunsch zu ignorieren. Die ersten vier Wochen im Wintersemester 1999 ziehe ich zu Ralf nach München-Schwabing. Ralf war mit mir an der Schule in der Theatergruppe. Er verlässt, gegen den Willen seiner Eltern und der Lehrer, die Schule vorzeitig und studiert seit einem Jahr Schauspielerei an der renommierten Otto Falckenberg Schule.
Ich liege auf einer Luftmatratze im Flur und muss fast jede Nacht mit anhören, wie Ralf mit einer anderen Frau vögelt. Am nächsten Morgen sitzen die Frauen – alle meist in meinem Alter, nur im T-Shirt und mit knappem Höschen – in der Küche, schlürfen, lässig ein Bein auf dem Stuhl aufgestützt, am heißen Milchkaffee und blicken mich stolz an, als wollten sie fragen: Na, wie war’s? Gut, hätte ich antworten können, sehr gut, zumindest am Anfang. Anfänglich hole ich mir im Schlafsack liegend regelmäßig einen runter und ejakuliere in eine dreckige Socke, während nebenan das Bett quietscht und der Boden vibriert. Zuletzt kann ich das Gestöhne nicht mehr hören und stopfe mir feuchte Papiertaschentücher in die Ohren. Nach vier Wochen legt mir Ralf einen Zettel mit einer Adresse in Haidhausen auf den Küchentisch und sagt, das wäre vielleicht was für mich. Zwei Tage später ziehe ich nicht weit vom Rosenheimer Platz in eine Einzimmerwohnung um.
drei
Mein Name ist Franz Benedikt Zacher. Ich bin am 6. Juli 1979 geboren. Meine Eltern sind tot. Sie sterben bei einem Verkehrsunfall, als ich 20 bin. Ich studiere viereinhalb Semester lang Medizin in München und mache ein sechsmonatiges Praktikum im Rotkreuzklinikum, bevor ich das Studium vorzeitig abbreche. Danach beginne ich im Sommer 2002 in meiner Heimatstadt in der Oberpfalz den Zivildienst im Senioren- und Pflegeheim Marienstift. Ich beziehe im obersten Stock des Heims ein kleines, möbliertes Zimmer. Mit Fernseher, Dusche und WC auf dem Flur.
*
Opa ist im Fernsehen. Dieses Mal muss ich nicht heimlich im Türspalt stehen. Ich sitze ganz offiziell neben Papa und Mama auf der Couch und sehe Eduard Zimmermann auf dem Bildschirm zu. Ich bin fast 14 Jahre alt und ziemlich angespannt. Ich hänge dem Aktenzeichen-XY-Mann an den Lippen. Es ist ein seltsames Gefühl – eine Mischung aus Stolz und Unbehagen –, mit Erlaubnis der Eltern zu dieser, für mich so späten Stunde eine Sendung ansehen zu dürfen, die eigentlich nur für Erwachsene bestimmt ist. Von der Couch aus betrachtet sieht für mich Ede Zimmermann bildschirmfüllend noch unheimlicher aus. Irgendwie scheint er besorgt zu sein, nachdenklich und auch eine Spur ärgerlich, als wäre auch er böse. Fast so böse wie die Männer und Frauen auf den Fotos, die hin und wieder hinter ihm eingeblendet werden.
»Und nun kommen wir zu unserem zweiten Fall«, sagt Eduard Zimmermann.
Papa zeigt auf den Bildschirm.
»Das ist er.«
Mama seufzt. Opa ist eingeblendet. Ein Bild von ihm, mit Vor- und Nachname darunter und einem kleinen schwarzen Kreuz daneben.
»Ein unaufgeklärtes Verbrechen von Pfingsten vergangenen Jahres beschäftigt die Kriminalpolizei in Mittenwald. Der Mord an dem Mittenwalder Hotelier und Landwirt Franz Benedikt Zacher gibt nicht nur der Kriminalpolizei, sondern auch den Angehörigen und der ganzen Bevölkerung Mittenwalds Rätsel auf.«
Jetzt kommt wieder die Stimme, vor der ich mich so fürchte. Der Sprecher schildert den Tathergang. Dazu sieht man Bilder von Opa. Natürlich ist es nicht Opa selbst, der da auf dem Bildschirm zu sehen ist. Opa ist tot. Es ist ein Schauspieler, der so ähnlich aussieht wie er und der jetzt sein Gewehr putzt und die Patronen einlegt. Der anschließend seinen Janker anzieht, den Hut aufsetzt und sagt: »Ich bin fertig.«
Er steigt die Treppe hinunter und tritt vors Haus, das im Film auch nicht Opas Original-Haus ist. Alles ist nur so ähnlich. Vor dem Haus stehen mindestens ein Dutzend Männer, die genauso aussehen wie Opa. Alle haben sie ihre Jagdkleidung an und tragen ein Gewehr auf dem Rücken. Manche führen einen Hund an einer Leine.
»Auf geht’s!«, sagt einer.
Komisch, denke ich, wo bin denn ich. Ich sehe den zur Hirschjagd aufbrechenden Jägern hinterher. Mich haben sie vergessen. Ich war doch auch dabei. Während ich dem Gedanken hinterherhänge, wieder mal nicht berücksichtigt worden zu sein, kommt ein Bild-Schnitt und man sieht Opa allein auf einem Hochstand sitzen. Das Gewehr liegt abschussbereit über dem Geländer.
»Wo bleibt der verdammte Bock?!«, brummt Opa vor sich hin.
Ich muss schmunzeln.
Mama macht »Pscht!«.
Ich denke, ich hab doch gar nichts gesagt, als plötzlich ein Schuss im Fernseher fällt. Aber nicht der Hirsch wird getroffen. Opa greift sich an die Brust, schwankt und fällt vornüber. Er stürzt in Zeitlupe über das Geländer zum Hochstand hinunter. Mama legt ihre Hand vor den Mund und Papa ballt seine zur Faust im Schoß. Opa liegt im Gras. Er ist noch nicht tot. Seine Augen sehen zum Himmel. Er röchelt leise vor sich hin. Eine vermummte Person taucht auf. Sie nähert sich Opa und bleibt vor ihm stehen, richtet eine Waffe auf ihn und drückt ab. Jetzt röchelt Opa nicht mehr. Der Film ist zu Ende und die fürchterliche Sprecherstimme schweigt. Eduard Zimmermann ist wieder auf dem Bildschirm zurück.
»Ein normaler Jagdunfall war das nicht. Bei näherer Untersuchung der Leiche stellte sich heraus, dass der Hotelier zuerst mit einem Schuss aus größerer Entfernung getroffen und verletzt wurde. Erst mit einem weiteren Schuss aus nächster Nähe mitten ins Herz wurde er getötet. Es gibt keine Indizien, keine Zeugen, niemanden, der etwas gesehen oder gehört hatte. Der Mord wurde von niemandem bemerkt, der an der Jagd beteiligt war. Der Enkel des Ermordeten fand seinen bereits toten Großvater ein halbe Stunde später am Tatort.«
Spätestens jetzt müsste ich kommen, denke ich. Aber nichts. Kein Enkel, kein Ich. Und das mit der Zunge erzählen sie auch nicht. Warum sagen sie nichts über die Zunge?, denke ich, das ist doch wichtig.
»Jetzt werden sie das Schwein kriegen«, sagt Papa, nachdem Eduard Zimmermann die Telefonnummer für sachdienliche Hinweise einblendet und zum dritten Fall wechselt.
»Ab ins Bett«, sagt Mama.
Ich nicke, gebe Papa und Mama noch einen Kuss auf die Wange und verschwinde in mein Zimmer. Ich träume von Opas Zunge.
Am nächsten Tag bin ich in der Schule ein kleiner Held, als wäre ich selbst im Fernsehen gewesen. Ich muss allen ganz genau erzählen, wie das letzte Pfingsten in Mittenwald wirklich war.
»Du warst doch dabei«, sagt Ralf.
Ich nicke stolz und fange an, alles zu erzählen, was ich weiß. Manchmal schummle ich ein wenig und erfinde etwas dazu. Jetzt hängen die Kinder an meinen Lippen, als wäre ich Ede Zimmermann. Von der Zunge sage auch ich nichts.
*
»Kommeno! Kommeno!«
Als ich das Zimmer betrete, krächzt ein Vogel im Käfig.
»Das ist ein Beo«, sagt Schwester Johanna, die mich begleitet. »Eigentlich sind Tiere im Seniorenheim verboten, aber Frau Ada hat sich mal wieder durchgesetzt.«
Johanna zeigt auf das Bett, in dem eine Frau mit lustigen Augen und gekräuselten grauen Haaren liegt. Sie hat das Plumeau bis unter ihr Kinn hochgezogen.
»Frau Ada, ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Wir haben einen Neuen. Das ist Herr Zacher.«
Frau Ada blickt mich freundlich an. Sie lächelt.
»Frau Ada ist auch neu, erst seit ein paar Tagen bei uns.«
»Da haben wir ja was gemeinsam«, sage ich.
Frau Ada nickt.
»Herr Zacher ist Zivildienstleistender und bleibt zehn Monate bei uns.«
Sie streckt unter ihrem Plumeau eine Hand hervor. Die Hand ist übersät von braunen Flecken. Ich greife nach ihr, sie fühlt sich weich an.
»Endlich mal ein Mann im Haus, nicht wahr?«, sagt Johanna und zwinkert mir zu.
Frau Ada lächelt noch immer.
»Sie können auch einfach Franz zu mir sagen.«
»Frau Ada sagt nichts«, sagt Johanna.
Ich sehe sie verunsichert an.
»Frau Ada kann nicht sprechen, nicht wahr, Frau Ada?!«
Frau Ada schweigt.
»Sie ist stumm.«
»Aber verstehen tut sie?«
Sie nickt. Jetzt lächelt sie nicht mehr, dafür aber Johanna.
»Hast du das schon mal gesehen?«
Johanna zeigt mir eine DIN-A5-große Schreibschiebetafel, die auf dem Nachttisch liegt.
»Klar, aus der Kindheit. Man schreibt was drauf, fährt anschließend mit dem Schieber darüber und schon ist es wieder verschwunden.«
»Damit kann Frau Ada mit dir kommunizieren.«
Frau Adas Hand kommt erneut unter dem Plumeau hervor, nimmt den Stift, der an einer Schnur an der Tafel hängt, und schreibt Herzlich willkommen auf die Tafel.
Jetzt lächle ich. Der Beo krächzt wieder »Kommeno, Kommeno«.
»Ist das sein Name?«, frage ich Frau Ada.
Sie nickt.
»So, Schluss jetzt mit dem Gequatsche«, sagt Johanna, »Arbeit wartet. Sie waschen sich erst mal, Frau Ada. Und wir beide machen ihr Bett.« Sie zieht mit einem Ruck das Plumeau über Frau Ada hinweg.
*
Mit 15 gehe ich Schwester Annemarie das erste Mal hinterher. Ich warte, bis sie nach Dienstschluss das Seniorenheim verlässt. Dann folge ich ihr heimlich auf dem Nachhauseweg. Sie wohnt nicht weit vom Heim entfernt in einer Altbausiedlung im vierten Stock gegenüber einem Parkhaus. Die ersten Male stehe ich in der Nähe der Eingangstür und warte, bis das Licht im vierten Stock angeht. Ich blicke nach oben und stelle mir vor, ich könnte fliegen. Alle weiteren Male schleiche ich mich am Pförtner des Parkhauses und seinem gläsernen Kabuff vorbei und renne nach oben auf das Parkdeck. Stundenlang stehe ich auf dem zugigen Deck und starre in das hell erleuchtete Fenster gegenüber. Zuerst ohne, dann mit einem Fernglas, das ich Vater aus seinem Arbeitszimmer entwende. In dieser Zeit bin ich oft krank. Halsschmerzen, Erkältungen, Husten, Schnupfen, manchmal auch Fieber. Öfters wird der Arzt konsultiert. Aber auch er kann sich meine häufigen, immer wiederkehrenden Erkrankungen nicht erklären. Ich freue mich über die Ahnungslosigkeit meiner Umwelt. Auch Schwester Annemarie merkt nichts. Zuerst denke ich, sie wohnt allein. Dann entdecke ich sie zufällig mit einem Mann am Samstagvormittag bei Aldi. Es istihr Freund, wie sich später herausstellt. Er ist älter als sie, fett, hat eine Halbglatze und trägt einen lächerlichen Bart. Er fährt einen Mercedes und ist nur an den Wochenenden zu Hause. An diesen Tagen meide ich das Parkhaus. Mindestens zweimal die Woche stehe ich an den Werktagen auf dem Parkdeck in der Hoffnung, ein paar geheime Blicke von ihr zu erhaschen. Fast immer zieht sie kurz nach Betreten der Wohnung die Vorhänge zu. Nur einmal sehe ich sie fast nackt. Sie telefoniert. Dabei wirft sie nach und nach ihre Kleider von sich. Zuerst kickt sie die Schuhe weg. Dann lässt sie ihren Rock zu Boden gleiten. Ich sehe ihr weißes Höschen mit verblichenen rosa Blumen darauf. Vor dem Fernglas erscheint ein milchiger See mit schwimmenden Röschen. An den Rändern frech hervorlugende Härchen. Speichel sammelt sich in meinem Mund. Ich schlucke ständig. Sie öffnet die Bluse und zieht sie umständlich aus, den Hörer noch immer am Ohr. Ich sehe ihren Büstenhalter. Auch er ist weiß und hat die gleichen Blumen auf dem Stoff. Die großen Brüste sind in Körbchen gezwängt. Lieber Gott, lass sie den BH öffnen, flehe ich und biete ihm als Gegengeschäft, bis auf mein Leben, fast alles an. Annemarie steht nur noch in Unterwäsche vor mir, blickt, weiterhin emphatisch in den Hörer sprechend, aus dem Fenster, als ob sie sich nur für mich ausgezogen hätte. Der liebe Gott hat kein Einsehen. Der liebe Gott ist ein Spielverderber. Sie zieht den Vorhang zu. Bis auf dieses eine Mal bleibt Annemarie für mich nur ein Schatten hinter zugezogenen Vorhängen. Mit der Zeit erregt mich seltsamerweise der auf und ab gehende Schattenriss sogar mehr als die sich selbstgefällig darbietende nackte Haut. So sehr, dass ich mich gezwungen sehe, meine Hose zu öffnen. Ich hole meinen erigierten Schwanz heraus und masturbiere so lange, bis Sperma über das Geländer im freien Fall nach unten spritzt. Es geht jedes Mal sehr schnell.
*
Die Sachbearbeiterin beim Bundesamt für Zivildienst ist irritiert. Sie klingt am Telefon, als ob sie keine Ahnung hätte.
»Moment, ich hole die Akten.«
Ich höre Musik aus der perforierten Muschel. Klassik. Als der erste Satz vorbei ist, denke ich, entweder sie findet die Akten nicht oder das Bundesamt arbeitet mit der Telekom zusammen. Zeit ist Geld. Jede Sekunde kostet Gebühren. Die Minute 40 Cent. Oder 1 Euro. Oder 1,86. Das wird das teuerste Konzert meines Lebens. Ich will auflegen. Ein Knacken hindert mich daran und dann ein lang gezogenes »So!« der Sachbearbeiterin.
Blätter knistern. Ich höre, wie sie sucht. Sie kann meinen Einberufungsbescheid nicht finden.
»Aber ich halte ihn doch in den Händen«, sage ich. »Sie haben ihn mir vor ein paar Tagen zugeschickt.«
»Ich?«, sie klingt, als ob ich sie beleidigt hätte. »Ich bestimmt nicht, wenn dann die Behörde.«
Sie wird ein wenig pampig.
Ich auch. »Wer auch immer.«
»Moment!«
Sie ist wieder weg. Dafür höre ich erneut Musik. Das darf doch nicht wahr sein, die will mich verarschen.
»Hallo, Sie, das ist doch …«
Ich rede auf die Muschel ein, schreie in den Hörer, beschimpfe die Musik.
Die Geigen fiedeln ungerührt weiter. Als ich mich wieder beruhigt habe, höre ich: »Sind Sie noch da?«
»Ja!«
»Ich habe hier die Musterungsunterlagen, Ihre Verweigerung und eine Kopie Ihrer Immatrikulationsbescheinigung. Voraussichtliches Ende des Studiums 2006.«
»Das hat sich geändert. Ich habe das Studium aufgegeben. Ich bin exmatrikuliert.«
»Aber wie sollen wir das denn wissen?«
Zuerst denke ich, sie macht einen Scherz.
»Was gibt es denn da zu lachen.«
Sie meint es ernst.
»Ich weiß nicht, wie Sie das wissen. Aber aus dem Schreiben, das hier vor mir liegt, geht hervor, dass Sie es nicht nur wissen, sondern Konsequenzen daraus ziehen.«
»Was für Konsequenzen denn?«
Offenbar steht sie auf dem Schlauch.
»Dass ich mir bis zum 1. September eine Zivildienststelle suchen soll. Anderenfalls werde mir eine zugeteilt.«
»Ja, wenn das da steht, dann machen Sie mal.«
»Sie meinen, das ist jetzt verbindlich.«
»Ich meine gar nichts. Wenn dann die Behörde.«
»Aber Sie sind doch die Behörde.«
»Junger Mann, werden Sie nur mal nicht frech.«
Ich entschuldige mich leidlich und versuche ihr noch einmal zu erklären, dass der Fehler nicht bei mir liege.
»Welcher Fehler denn?«
Die kapiert gar nichts, denke ich und dann an ihren Schreibtischstuhl, der diesen Arsch den ganzen Tag ertragen muss.
»Könnten Sie mir vielleicht eine Kopie des Schreibens zuschicken?«, fragt sie.
»Wenn’s denn sein muss.«
Ich bin irritiert und knalle den Hörer auf den Apparat.
»Ahnungslose Tussi!«
Es ist das erste Mal, dass mir für Momente der Gedanke kommt, irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Irgendetwas ist hier faul.
*
Großvater holt mich jedes Mal mit dem Pferdewagen vom Bahnhof ab. Er trägt bei jedem Wetter eine Lederhose, Kniebundstrümpfe, Haferlschuhe, Janker und einen Hut mit Gamsbart. Er steht mit ausgebreiteten Armen am Bahnsteig. Ich lasse meinen Koffer stehen und springe ihm um den Hals. Ich drücke meinen Kopf an seine Schulter und schnuppere an seinem langen Bart. Er riecht verwegen nach Rauch, Kuhstall und Bergschluchten. Nie zuvor habe ich so einen betörenden Geruch gerochen. Er kitzelt meine Nase auf angenehme Weise. Opa stellt mich wieder auf die Füße, beugt sich zu mir herunter, legt seine Hände auf meine Schultern und sieht mir augenzwinkernd ins Gesicht.
»Alles klar?«
Ich nicke. Ich bin einerseits eingeschüchtert ob dieser imposanten Erscheinung mit den stechend blauen Augen und dem schönen Bart. Andererseits aber auch froh und ein wenig stolz, bei ihm zu sein. Feine rote Äderchen überziehen seine Wangen. Auf der Oberlippe sind die Barthaare wie zu einem gekringelten Schweineschwänzchen gezwirbelt. Buschige Augenbrauen sprießen über dem bergseeblauen Blick. Aus seinem Mund dringt ein Hauch Eukalyptusduft. Er stammt von einem Bonbon, das Opa immer lutscht, wenn nicht gerade eine Pfeife zwischen seinen Lippen klemmt. Noch immer zu mir heruntergebeugt, greift er in seine Hosentasche und hält mir ebenfalls ein Eukalyptusbonbon vor die Nase. Ich greife danach, wickle es aus und stecke es mir in den Mund. Es schmeckt scharf. Ich glaube gleich verbrennen zu müssen und ziehe frische Luft zur Abkühlung mit geschürzten Lippen in mich hinein, während Opa meinen Koffer in die eine und mich an der anderen Hand nimmt. Ich gehe stolz, innerlich Flammen schlagend, an der Seite dieses großen, starken Mannes über den Mittenwalder Bahnhof. Ab und an bleiben Passanten stehen, blicken uns hinterher oder grüßen respektvoll, woraufhin Opa zurückgrüßt. Am Zeitungskiosk kauft er eine Packung Pfeifentabak und mir einen Lutscher, den ich, nachdem ich das Eukalyptusbonbon heimlich ausspucke, in den Mund stecke.
»Na, ist er wieder da?«, fragt der Kioskbesitzer jedes Mal und reckt seinen Kopf ein klein wenig aus der Luke.
»Siehste doch«, sagt Opa und legt seine Hand wieder auf meine Schulter.
Ich glaube, auch er ist ein wenig stolz. Wie einen vornehmen Hotelgast fährt er mich mit dem Pferdewagen durch Mittenwald, wobei ich immer vorn bei ihm auf dem Kutschbock sitzen darf.
Zu Hause wartet bereits Großmutter mit dem Essen. Es gibt jedes Mal Schupfnudeln mit Sauerkraut und Geselchtes als Begrüßungsessen. Großmutter lädt mir den Teller immerzu so voll, dass ich nach der Hälfte schon satt bin.
»Alles wird aufgegessen«, sagt sie mit ermahnender Stimme und achtet darauf, dass ich nicht vorher den Tisch verlasse. Wenn Oma für kurze Zeit in die Küche verschwindet, hilft mir Opa heimlich, indem er Schupfnudeln, Sauerkraut und Geselchtes von meinem auf seinen Teller schiebt. Dafür liebe ich ihn. Wenn Oma wieder zurück ist, sagt sie: »Der Junge hat aber heute einen großen Appetit.«
Opa nickt und ich grinse verschämt.
Während der ganzen Ferienzeit weiche ich nicht von Opas Seite. Alles, was er macht, mache ich auch. Nur wenn er sich nach dem Mittagessen für eine halbe Stunde auf das Kanapee legt, bleibe ich wach. Ich sitze dann daneben und sehe ihm beim Schlafen zu. Fasziniert starre ich auf sein Gesicht und den gekringelten Zwirbelbart, der sich bei jedem Atemzug bewegt. Beim Einatmen hebt er sich, beim Ausatmen zappelt er wie ein Schweineschwänzchen. Spätestens nach fünf Minuten schnarcht Opa zuerst leise, dann immer lauter. Zuletzt hört es sich an wie das Grunzen einer Sau. Oma sagt dann: »Da hörst du’s, mir glaubt er es ja nie.«
Schlägt Opa nach seinem Mittagsschlaf die Augen auf, ist das Erste, was Großmutter sagt: »Du hast wieder geschnarcht.«
»Das kann nicht sein«, sagt Opa, noch immer verschlafen. »Ich schnarche nie!«
»Frag Franzi«, sagt Oma.
»Und?«, fragt Opa. »Habe ich?«
Ich schüttle zaghaft den Kopf.
»Na, siehst du.«
Beide lachen wir.
»Mannsbilder, vermaledeite!«, brummt Oma und verlässt das Wohnzimmer.
*
Als ich das Büro der stellvertretenden Heimleiterin betrete, bin ich ziemlich aufgeregt. Ich erkenne sie sofort wieder: Annemarie. Sechs Jahre sind vergangen, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Schwester Annemarie ist jetzt Frau Brenner, stellvertretende Leiterin des Senioren- und Pflegeheims Marienstift und unter anderem zuständig für Personalfragen.
»Setzen Sie sich.«
Sie hat sich stark verändert. Sie ist noch dicker, ihre schwarzen Haare sind bereits angegraut und kurz geschnitten. Nur ihr Busen ist derselbe geblieben.
»Nehmen Sie Platz.«
Ich setze mich auf einen Sessel, der vor einem rustikalen Schreibtisch steht. Frau Brenner bleibt stehen. Jetzt wirkt sie noch größer. Und dicker. Sie trägt keinen weißen Kittel mehr. Dafür einen kurzen beigen Rock, der ihre stämmigen Beine nicht gerade vorteilhafter erscheinen lässt. Dazu eine weiße Bluse, unter der sich die Konturen ihres Büstenhalters abzeichnen.
»Eigentlich nehmen wir keine Zivildienstleistenden mehr. Früher schon. Bei 20 Monaten hat sich das noch rentiert. Jetzt, bei nur mehr der Hälfte der Zeit, reicht es gerade mal zur Einarbeitung. Und wenn sie’s dann können, sind sie wieder weg.«
Ich schaue interessiert. Sie geht am Fenster auf und ab, dreht mir den Rücken zu und blickt hinaus. Ich denke an das Parkdeck. Ihr breiter weißer Rücken wird zur Projektionsfläche meiner Fantasie. Wie Dias schieben sich mir detailgenau meine damaligen Ansichten vom Parkdeck aus vor die Netzhaut. Es sind immer wieder dieselben Bilder, die mir noch Jahre später – als ich schon lange in München bin – in den Sinn kommen. Meine Unterwäsche-Göttin! Die Fettringe um den Bauch, die Härchen an den Schenkeln, das tiefe Dekolleté. Frau Brenner dreht sich um. Unter ihren Achseln sind große Schweißflecken. Ich erröte, schlage die Beine übereinander und blicke zu Boden.
»Außerdem hatten wir schlechte Erfahrungen. Denen fehlt meistens die Motivation. Für die Altenpflege hatten die nichts übrig. Ging es doch in erster Linie nur darum, nicht zum Bund zu müssen. Beschwerden der Bewohner und Patienten waren die Regel. Auch die Schwestern kamen meistens mit den Zivis nicht klar.«
Ich blicke wieder auf und signalisiere so, dass sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen muss. Sie schiebt sich eine Lesebrille auf die Nase. Die Brille verleiht ihrem Gesicht einen gebildeten Ausdruck. Sie wirft einen Blick auf die Zettel, die in zwei Stößen akkurat auf dem Schreibtisch abgelegt sind.
»Sie haben Medizin studiert?«
Ich nicke etwas zu energisch, setze zu einem kurzen Vortrag über mein Studium an, den sie, noch bevor das erste Wort meinen Mund verlässt, mit »Gut, sehr gut!« verhindert.
»Sie haben auch schon in einem Krankenhaus gearbeitet?«
»Ja, während des Studiums.«
»Dann können Sie schon einiges?«
»Ich denke schon.«
»Gut, sehr gut.« Sie nimmt die Brille wieder ab und lässt sie zwischen zwei Fingern um die Hand kreisen. Dabei sieht sie mich eindringlich an. Ich merke, wie ich rot werde.
»Wie kommen Sie eigentlich auf uns?«
Jetzt könnte ich ihr vom Parkdeck erzählen, von meinen Träumen, von ihr und mir. Ich fürchte, sie würde es nicht verstehen, mich hinauswerfen lassen.
»Ich bin hier zur Schule gegangen. Mein Schulweg führte jeden Morgen am Marienstift vorbei. Mir ist das Altenheim von frühester Kindheit an ein Begriff.«
»Ach.«
Annemarie Brenner scheint verlegen zu werden. Ein Schimmer Rot legt sich auf ihre Wangen. Sie sieht aus, als würde sie sich erinnern. Etwas brüsk sagt sie: »Ein Altenheim sind wir schon lange nicht mehr.«
Jetzt werde ich ein wenig verlegen.
»Junger Mann, das ist eine Senioren- und Pflegeresidenz, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich hoffe, Sie kennen den Unterschied.«
Pekuniärer Art, denke ich, Altenheime kosten höchstens einen Bruchteil von diesem Laden hier. So wie es aussieht, wird hier ordentlich in die Geldbörsen der Alten gelangt. Der Aufenthalt verschlingt bestimmt nicht nur die Rente, auch das Ersparte geht langsam, aber sicher drauf. Als ob sie meine Gedanken erraten könnte, sagt sie: »Man muss sich das hier leisten können!«
Jetzt nicke ich wieder eine Spur zu engagiert. »Ich habe gleich beim Betreten gemerkt, dass sich das Marienstift verändert hat. Jetzt ist alles viel …«
»Schöner!«
»Ja.«
Frau Brenner steht hastig auf, dreht mir wieder den Rücken zu und geht am Fenster auf und ab. »Sie sagten, Sie haben hier gewohnt?!«
»Ja.«
»Und Ihre Eltern …«
»Sind tot.«
Sie bleibt stehen, schaut mich erstaunt an, als ob ihr plötzlich ein Licht aufgehen würde. Sie blickt zum Fenster hinaus und schweigt. Wieder sehe ich ihren Rücken. Den Büstenhaltersteg. Noch bevor mir der weiße Rücken meine Bildershow liefern kann, fragt sie: »Bei einem Verkehrsunfall?«
»Ja.«
»Schreckliche Geschichte.«
»Ja.«
Sie bleibt noch immer stehen und schweigt. Ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Eine lange Pause entsteht, in der sich auf ihrem weißen Rücken Bilder meiner Teenie-Zeit gegenseitig ablösen. Schließlich dreht sie sich erneut zu mir um.
»Wann können Sie anfangen?«
»Sofort.«
*
»So, nun legen Sie die Leiche auf den Rücken. Den Kopf stützen Sie auf dem kleinen Bock ab. Und jetzt schneiden Sie hier vom Schlüsselbein aus nach unten, so als wäre es ein großes umgekehrtes Y. Jetzt lassen sich die Haut und das Fettgewebe nach außen umklappen. Mit einer Knochenschere knacken Sie dann seitlich die Rippen durch. Der Brustkorb lässt sich wie ein Käfiggitter abheben. Den Darm binden sie an den Enden ab, dann abschneiden und herausheben. Ebenso machen Sie das mit Herz, Lunge und allen anderen Organen. Außerhalb des Körpers werden sie dann untersucht. Anschließend kommen wir zur Entnahme des Gehirns. Stellen Sie sich ein Stirnband vor. Ein Stirnband am Kopf des Toten. Genau entlang dieser Linie schneiden Sie langsam die Kopfhaut auf und greifen dann mit der Hand darunter und ziehen Sie sie dann nach vorn. Jetzt hängt die Kopfhaut wie umgestülpt vor den Augen und der Nase der Leiche. Danach öffnen Sie den Schädel rundherum. Am besten machen Sie das mit einer kleinen Kreissäge. Die Schädelkappe lässt sich einfach abnehmen. Anschließend schieben Sie eine Hand seitlich unter das Gehirn und schneiden es hinten am Gehirnstamm ab. Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen, sonst flutscht es weg.«
Professor Homberg beendet seinen Vortrag und schnalzt die Gummihandschuhe von den Händen.
»Das war Theorie, meine Damen und Herren. Jetzt kommt die Praxis. An die Skalpelle bitte.«
*
Am schönsten ist es bei meinen Großeltern in den Pfingstferien. Oft sind auch Papa und Mama mit dabei. An Pfingsten werden bei Opa jedes Jahr Feste gefeiert. Oben auf dem Berg finden Trachtenumzüge statt. Ein Bierzelt ist aufgebaut und eine Blaskapelle spielt. Für die Kinder gibt es eine Tombola. Leider gewinne ich nie etwas.