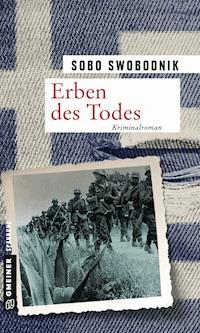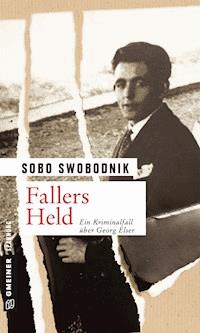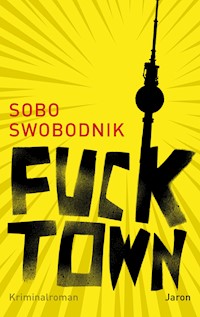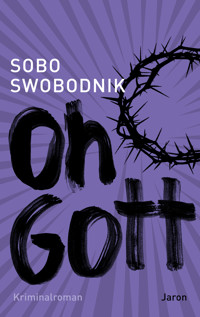
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rebellinnen. Die Berlin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Er ist zurück! Bu, der charismatische, aber leider auch suchtanfällige Ermittler, wird nach fünf Jahren Ausnüchterung in einem schwäbischen Kloster nach Berlin zurückgerufen, um den Kriminalkommissarinnen Mechthild Frisch und Katrin zur Mühlen in einem rätselhaften Fall zu helfen: Ein ermordetes Kind entpuppt sich als ukrainischer Flüchtling, der in einem Kloster in Moabit Schutz gefunden hatte. Und es scheinen noch mehr Kinder verschwunden zu sein. Die Mönche mauern. Bis Bu als Urlaubs-Bruder die Gemeinschaft aufmischt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobo Swobodnik
Oh Gott
Kriminalroman
Jaron Verlag
SOBO SWOBODNIK arbeitet intermedial in den Grenzbereichen und Schnittstellen von Film, Literatur und bildender Kunst. Er schreibt Bücher und Texte, macht Filme und Bilder, wohnt in Berlin und lebt zeitweise auch in Parallelwelten, über die er Bücher schreibt und Texte, Filme macht und Bilder. Er hat keinen Hochschulabschluss, dafür erhielt er zahlreiche Förderungen, Preise und Stipendien.
Sämtliche Figuren dieses Romans sind frei erfunden.
Der besseren Lesbarkeit halber schreiben wir den Genitiv von Bu mit Apostroph.
1. Auflage 2024
© 2024 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlags erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Abbildung: © iStock
Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona
Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-077-9
»Um Himmels willen, wenn Gott bloß sprechen würde …«
Graffito an einer Hauswand in Berlin-Neukölln, in der Nähe der Sonnenallee
Inhaltsverzeichnis
Oh Gott, Gott lügt
Gott wundert sich
Gott zweifelt
Gott fährt Rad
Ziska
Gott erwacht
Mechthild & Katrin
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Mechthild
Gott traut seinen Augen nicht
Bu
Gott traut seinen Augen
Baschar
Gott fährt
Ziska
Gott zwinkert
Bu
Gott postet
Katrin zur Mühlen
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Katrin zur Mühlen
Gott polarisiert
Bu
Gott riecht
Mechthild & Katrin & Bu
Gott verfettet
Ziska
Gott versucht zu verstehen
Katrin & Mechthild
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Raphael
Gott ahnt etwas
Mechthild
Gott fürchtet sich
Baschar
Gott mixt
Florian Dietrichs
Gott kotzt
Ziska
Gott beichtet
Katrin zur Mühlen
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Oleksandr
Gott fremdelt
Bu
Gott ist unterwegs
Ziska
Gott schnüffelt
Bu
Gott ist tot
Baschar
Gott flirtet
Florian Dietrichs
Gott ist ein Fuchs
Bu
Gott zweifelt
Mechthild
Selbstgespräch mit und ohne Gott
Raphael
Gott transzendiert
Bu
Gott kollidiert
Ziska & Bu
Gott schläft
Ziska
Gott macht eine Fliege
Bu
Gott ist gelb
Bu & Raphael
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Florian Dietrichs
Gott beichtet
Raphael & Bu
Gott verbindet
Ziska
Gott geht offline
Baschar
Gott verknotet
Greta
Gott spricht russisch
Florian Dietrichs
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Pater Hieronymus
Gott läuft sich warm
Katrin zur Mühlen
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Novize Maximilian
Gott verhört
Katrin zur Mühlen
Gott verhört ein zweites Mal
Mechthild Frisch
Gott therapiert
Mechthild
Gott brütet
Bu
Gott hat einen Kater
Kolibris
Gott kriegt auf die Fresse
Bu
Gott fliegt
Bu
Gott bestellt
Baschar
Gott weiß nichts
Ziska
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Greta
Gott wird nachdenklich
Mechthild & Katrin & Bu
Gott ist eine Schaltafel
Slavo
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Georg Mühlberger
Gott ist ratlos
Mechthild & Katrin
Gott ist Ultimatum
Ziska
Gott lauscht
Bu
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Pater Bruno
Gott liebt
Mechthild
Gott schweigt und richtet
Novize Maximilian & Pater Bruno
Gott exekutiert
Mechthild & Katrin
Gott scherzt
Bu
Gott tagt
Mechthild & Katrin
Gott baut
Daniil
Gott argwöhnt
Pater Hieronymus
Gott ist schuld
Florian Dietrichs
Gott orakelt
Katrin zur Mühlen
Gott tanzt
Bu
Gott zieht um
Katrin zur Mühlen
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Pathologe
Gott tätowiert
Mechthild & Katrin & der Pathologe
Gott ist frische Luft
Baschar
Gott tanzt erneut
Bu
Gott labert
Ziska
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Ziska
Gott ist Syrer
Baschar
Gott ist ein Überraschungs-Ei
Mechthild & Katrin
Gott sucht und findet nichts
Dr. Georg Mühlberger
Gott ist krank
Baschar
Gott schlägt zurück
Bu
Gott schiebt ab
Mechthild & Katrin & Bu
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Bu
Gott befreit
Bu & Baschar
Gott ist fertig
Gott ist Gott
Gespräch mit mir selbst
Zukunft ohne Gott
Oh Gott, Gott lügt
Hahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha …
– meine Reaktion auf diese Provokation (Gott lügt), diesen bescheuerten und vor allem verlogenen Titel (OH GOTT). Und auf diese unsägliche Kampfansage. (Das kann nur von Menschen kommen.)
Gott bin ich.
Und Gott lügt nie.
Wenn doch, dann ist Gott, also bin ich, am Arsch.
Gott hat den Kontakt verloren.
Zu den Menschen, zur Welt.
Oder sie zu ihm.
Auch umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ich brauche gar nicht mehr zu lügen, da mir ohnehin niemand mehr glaubt.
Gott lügt – das behaupten die Menschen, wenn ich ihnen die Wahrheit über sie selbst erzähle: Gott lügt – müssen sie sagen, damit diese Wahrheit erträglicher ist, erträglicher wird; aber es stimmt nicht. (Das wissen sie natürlich selbst am besten.)
Die Welt, von mir geschaffen, kackt ab.
Pandemie, Klimawandel, Inflation, Energiekrise, Krieg – im Großen.
Mord, Verletzung, Diskriminierung – im Kleinen.
Und ich kann nichts tun. (Selbst wenn ich wollte.)
Ich will aber auch gar nicht.
Das haben sich diese arroganten, anmaßenden, von sich selbst völlig eingenommenen Menschen selbst zuzuschreiben. Sollen sie doch ins Gras beißen. Sollen sie doch ihre Welt zugrunde richten.
Die Erde kommt ohne sie klar.
Ich auch.
Ich bin der Erzähler, um zu zeigen, dass nicht ich, sondern die Sache, die Welt, die Menschen abgefuckt sind.
Wer zuhört, wird begreifen, wird verstehen, wird vielleicht auf den letzten Metern umkehren, aussteigen aus der Spirale von Gewalt und Zerstörung.
Ich fürchte allerdings, dass die meisten nichts checken werden.
Und somit auf der Strecke bleiben.
Meinetwegen.
Ich bin dann mal raus. (Na ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht.)
Noch bin ich drin.
Gott wundert sich
Sein Kopf ist voll mit den Gedanken an das kommende Meisterschaftsrennen in nicht mal einem Monat. Seit einem Jahr trainiert er bereits hartnäckig dafür, drei-, viermal die Woche, bei jedem Wetter, zu den unterschiedlichsten Tageszeiten; seit einem Jahr denkt er nur noch daran.
Auch jetzt.
Er paddelt mit seinem Kanu in der Rummelsburger Bucht. Es ist ein schöner Sommermorgen, kaum dass die Sonne aufgegangen ist und die Vögel wie verrückt zwitschern, als hätten sie sich heute früh besonders viel vorgenommen.
Die meisten Enten hingegen schlafen noch, den Kopf tief in den Federn versteckt. Auch das Wasser gähnt noch benommen vor sich hin, als müsste ihm jeder Paddelschlag erst noch das Leben zurückgeben.
Der junge, durchtrainierte Kanute ist beim morgendlichen Training allein auf dem See unterwegs, als seine Gedanken plötzlich auf Abwege geraten.
Der Grund ist ein menschlicher Körper im kalten Spreewasser, keine Kanulänge von ihm entfernt.
Er unterbricht die Paddelschläge und ist mit den Augen nun ganz beim nackten, steifen Körper, den er im Wasser orientierungslos und verlassen treiben sieht.
Ein Kind, ist der erste Gedanke, der dem Kanuten, einem fünfundzwanzigjährigen bisexuellen BWL-Studenten, durch den Kopf rauscht und das Meisterschaftsrennen in den Hintergrund treten lässt.
Ein totes Kind, denkt er abermals, während er den kleinen Körper aus dem Wasser zieht und über das Kanu hängt wie ein eingefrorenes Hemd.
Während er mit dem Kind an Bord zum Ufer zurückpaddelt, wählt er auf seinem Smartphone die 110.
Kaum ist er am Ufer angekommen, sind die Kriminalhauptkommissarin Mechthild Frisch und die Kriminalpsychologin Katrin zur Mühlen mit einem Heer von Spurensicherinnen, deren weiße Overalls am Ufer leuchten, als hätten sie etwas zu verkünden, bereits zur Stelle.
Auch ihr erster Gedanke beim Anblick der Leiche ist, was Katrin zur Mühlen dann ausspricht. Scheiße, ein Kind, sagt sie, wie man sagt: der Super-Gau!
Und ohne dass Mechthild darauf antwortet, ist auch ihr anzusehen, dass sie mit denselben Gedanken zu kämpfen hat.
Der gewaltsame Tod von Kindern setzt in der Regel nicht nur den Ermittlungsbeamtinnen zu, sondern allen anderen ebenso: den Eltern, der Presse, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft.
Während der tote Junge der Gerichtsmedizin übergeben wird, fahnden zwei Taucherinnen der Berliner Berufsfeuerwehr unter der Wasseroberfläche der Rummelsburger Bucht nach etwas, was über den Toten Aufschluss geben oder Hinweise liefern könnte.
Sie finden nichts.
Wobei das so auch nicht ganz stimmt.
Sie finden einiges, nämlich Fahrräder, Toaster, diverse Küchengeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen, eine Beinprothese, eine Schaufensterpuppe, ganze Wohnzimmereinrichtungen, Autoreifen, Autobatterien, E-Roller und vieles mehr. (Sie finden auch zwei christliche Kreuze mit Jesus, meinem, also dem Sohn Gottes daran hängend. Offenbar hat da jemand seinen Glauben in einem endgültigen Akt der Abkehr im Spreewasser versenkt.)
Aber sie finden nichts, was dem toten Jungen zuzuordnen wäre und etwas über seine Identität verraten könnte.
Dagegen gibt die Obduktion der Leiche zwar nichts über sein Leben, aber viel über seinen Tod preis. Das Ergebnis: Der Junge starb nicht eines natürlichen Todes, sondern wurde ermordet. Ohne Zweifel. Erstickt. In seiner Lunge finden die Gerichtsmedizinerinnen Rückstände aus Polyester, Fasern eines Klebebands. An den Handgelenken zeichnen sich Hämatome ab, die darauf schließen lassen, dass der Junge, während er erstickt wurde, gefesselt war.
Und sonst?
Der Pathologe, ein untersetzter Mann, der aussieht, als sei ihm kein menschlicher Abgrund fremd und der kurz vor der herbeigesehnten Rente steht, sieht Mechthild Frisch und Katrin zur Mühlen an, als wäre der tote Junge eine Glaskugel und er dazu verdammt, für immer aus ihr die Zukunft herauszulesen. Womit er augenscheinlich große Schwierigkeiten hat.
Herkunft? Alter? Lebensverhältnisse?, versucht ihm Katrin zur Mühlen in strengem Tonfall und mit ebenso strengem Gesichtsausdruck auf die Sprünge zu helfen.
Was dem Pathologen ganz und gar nicht zu behagen scheint.
Bin ich Gott?, raunzt er und gibt sich noch eine Spur verschlossener als zuvor.
(Nein, das bin ich, denke ich und weiß, dass er dennoch mehr weiß, als er für den Moment loswerden will.) Man muss wissen, dass jeder Pathologe sich immer auch als Schauspieler geriert, der bestens um Dramatik, Spannungsaufbau und Pointen weiß und den gekachelten, kalt und emotionslos wirkenden Sektionssaal als Bühne gebraucht – und zwar in erster Linie für die eigene Inszenierung und den Beifall der Zuschauerinnen.
Der bleibt ihm bis jetzt von Mechthild Frisch und Katrin zur Mühlen versagt.
Also, legt er nach und rückt mit dem raus, was von der Obduktion als das interessanteste Detail übrig bleibt. (Wie immer zuletzt.)
Der Anus des schätzungsweise zwölfjährigen mitteleuropäischen Jungen weist Verletzungen auf.
Verletzungen?
Mehrere Risse an der Rosette, innere Blutungen an der Darmwand.
Der Pathologe flüchtet sich in Neutralität.
Lässt das auf ein gewaltsames Eindringen in den Anus schließen?, will Mechthild wissen.
Was denn sonst?!
Der Pathologe sieht Mechthild an, als wäre sie nicht die leitende Kriminalhauptkommissarin, sondern sein debiler Praktikant, der gerne an den Fingerkuppen riecht.
Der Junge wurde also vermutlich missbraucht, mischt sich jetzt Katrin zur Mühlen ein, was so klingt wie: So ne Scheiße!
Der Pathologe nickt, als sei das wiederum das Normalste von der Welt, während Mechthild sich erinnert, dass ihr Pathologen im Allgemeinen und dieser hier im Speziellen schon immer suspekt waren.
Spermaspuren?
Der Pathologe schüttelt den Kopf.
Hier geht es nicht nur um Mord, mutmaßt Katrin zur Mühlen, hier geht es, wie es aussieht, auch um Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung. Um Pädophilie.
Verdammt!
Die beiden machen sich auf den Weg, den Sektionssaal, der ihnen nach all den Jahren, in denen sie ihn nach jedem Todesfall aufsuchen müssen, immer noch ein flaues Gefühl in die Magengegend appliziert, zu verlassen, als sie vom Pathologen, der jetzt den letzten Trumpf in seiner miesen Inszenierung zieht, noch einmal gestoppt werden.
Ach, noch was, sagt er und hebt eine kleine Metallschüssel wie eine Monstranz hoch in die Luft. Das hier trug der Junge um den Hals.
Der Pathologe reicht Mechthild die Schüssel, in der eine feine goldene Halskette mit einem ebenso goldenen Anhänger wie ein aufgeschlagenes Buch liegt, das gelesen werden will. (Leider ist das Buch in einer Sprache geschrieben, die die Kommissarinnen nicht beherrschen.)
Was ist das?, fragt Katrin zur Mühlen und zeigt auf den kleinen, vielleicht zwei Zentimeter großen goldenen Anhänger.
Ein Buchstabe, ein V wie Victory.
Der typische Pathologenhumor, denkt Mechthild und sagt Vielleicht der Anfangsbuchstabe seines Vornamens.
Volker?
Valentin?
Vinzenz?
Vitali?
Klitschko!, grätscht der Pathologe dazwischen und fügt wie zur Erklärung hinzu: Der Boxer.
Das ist russisch, sagt Katrin zur Mühlen. Ukrainisch.
Auch bekannt durch die Heiligen Vitalis und Agricola, Märtyrer aus Bologna, drittes, viertes Jahrhundert.
Wieder spielt sich der Pathologe frech und besserwisserisch an die Rampe.
Was du nicht alles weißt?!
Mechthild lässt es weniger anerkennend als verächtlich klingen. Was der Pathologe allerdings nicht zu merken scheint, so selbstgefällig grinst er.
Das ist Vergangenheit, sagt Katrin zur Mühlen und wischt mit der Hand in der Luft herum, als wolle sie die Vergangenheit ein für alle Mal verscheuchen und hinter sich lassen. Aber wir sind knöcheltief in der desaströsen Gegenwart. Nicht früher, nicht irgendwann. Nein, jetzt. Im Hier und Heute. Und das ist: Krieg in der Ukraine. Zerstörung der Ukraine. Flucht aus der Ukraine. Flucht vor den Bomben. Flucht vor dem Tod. Millionen sind unterwegs in den vermeintlich sicheren Westen. Auch und vor allem Frauen –
Und Kinder, ergänzt Mechthild, die Katrins Logik und Psychologie mittlerweile zu durchschauen imstande ist.
Vielleicht ist das ein ukrainischer Junge?
Gott zweifelt
Zuerst werden die Vermisstenanzeigen, von denen es unfassbar viele gibt in Berlin, gesichtet. (Unglaublich, wie viele Menschen einfach so, ohne Spuren zu hinterlassen, verschwinden.)
Nichts.
Offenbar fehlt der tote Junge niemandem.
Mechthild wundert das nicht. Ihr Menschenbild ist nach jahrzehntelanger Polizeiarbeit nicht nur reichlich demoliert und illusionsfrei. Sie weiß mittlerweile auch, dass in dieser herzlosen, egoistischen Gesellschaft, bei der jeder nur an seinen eigenen Vorteil denkt und den Nachteil der anderen ausblendet, so ein Zwölfjähriger selten vermisst wird.
Eltern? Geschwister? Verwandte? Mitschülerinnen? Freunde? Freundinnen?
Vielleicht ist er gar nicht aus Berlin?
Katrin zur Mühlen sagt es und weitet die Vermisstenanzeigen im Handumdrehen auf das gesamte Bundesgebiet aus.
Aber auch da scheint der Junge niemandem zu fehlen.
Schulen, soziale Einrichtungen, Jugendclubs, Heime werden in Berlin befragt.
Wieder nichts.
Schließlich ergreift die Kripo den letzten Strohhalm im Nebel der Ungewissheit und tritt an die Presse heran:
Wer kennt diesen Jungen?
Sein Foto wird in Zeitungen veröffentlicht, in kostenlosen Wochenblättern, beim RBB-Fernsehen, auf den U- und S-Bahn-Monitoren sowie auf Handzetteln, die an Bäumen, Strommasten und Werbeplakattafeln hängen.
Auch die Halskette mit dem V soll zu Hinweisen führen.
Führt sie auch.
Ein anonymer Anrufer, der Stimme nach ebenfalls noch ein Kind, behauptet, der Junge heiße Vadik und stamme aus einem Kinderheim in Moabit.
Das ist die einzige aussichtsreiche Spur, die übrig bleibt und der Mechthild Frisch und Katrin zur Mühlen schließlich nachgehen.
Das Kinderheim im Berliner Stadtteil Moabit gehört, wie sich herausstellt, zu einer Klosterschule. Und diese zu einem Kloster. Des Benediktinerordens. Im Kloster wohnen fünfzehn Mönche: acht Patres, fünf Fratres, der Abt und der Cellerar, der für die wirtschaftlichen Belange des Klosters zuständig ist.
Mechthild und Katrin zur Mühlen nehmen sich zunächst das Kloster vor. Und stoßen da auf eine Wand, so hart, dass jeder Kopf bei Kollision daran zu zerplatzen droht. Eine Wand des Schweigens. Eine Mauer der Ablehnung. Sie treffen auf eine verschlossene klerikale Welt, die denen, die aus der säkularen kommen, offenbar keinen Einlass gewährt.
Klar, wer schweigt, erzählt keinen Mist, sagt Katrin zur Mühlen.
Sie schweigen alle.
Dabei ist es gar kein Schweigekloster. Mir ist nicht bekannt, dass Benediktiner schweigen müssen. Dir?
Der Abt und sein Cellerar streiten ab, den Jungen, der jetzt aus Mechthilds Smartphone heraus die beiden Ordensbrüder vorwurfsvoll anschaut, überhaupt zu kennen.
Als Mechthild anschließend die Kinder im Heim befragt und ihnen ebenfalls das Bild von Vadik zeigt, wird schnell klar, dass die beiden Mönche lügen. (Oder es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.)
Mit ordentlich Dampf unter der Stirn und einer Stimme, die angsteinflößend wirken kann, konfrontiert Mechthild sie noch einmal mit dem Bild des toten Jungen.
Wir wissen nun, dass Vadik ohne Zweifel hier im Kloster, im Kinderheim, gemeinsam mit anderen ukrainischen Kindern, gelebt hat.
Der Cellerar versucht die Peinlichkeit seiner Lüge zu überspielen. Bei so vielen Kindern verliert man schon mal den Überblick und den Einzelnen aus den Augen, nicht wahr?
Der Abt nickt zustimmend, als wäre nicht er der Chef des Klosters, sondern der schlaksige Cellerar, und murmelt leicht debil vor sich hin: Die sehen sich ja alle sehr ähnlich.
Der Cellerar ergreift, als wolle er den Abt aus der Schusslinie bringen, erneut das Wort. Der Junge, also der, wie heißt er nochmal …
Vadik!
Vadik, ja, der ist tatsächlich schon vor langer Zeit von hier, aus dem Kloster weggelaufen.
Interessant, sagt Mechthild, was so klingt wie: Ach, und das fällt Ihnen jetzt erst ein!
Ja, wir wissen auch nicht, wohin er wollte. Manche sagen, zurück in die Ukraine –
Wie sind denn die Kinder überhaupt hierhergekommen?, geht Katrin zur Mühlen dazwischen, was den schlaksigen Cellerar ein wenig aus dem Konzept zu bringen scheint.
Also, wir haben, die Kinder, wir haben sie aus einem Kinderheim in der Ukraine, in der Nähe von Charkiw haben wir sie evakuieren und hierher bringen lassen. Damit sie vor diesem schrecklichen Krieg in Sicherheit sind, verstehen Sie?
Er scheint eine Belobigung von den Kriminalbeamtinnen zu erwarten. Die diese ihm allerdings verwehren.
Der Abt klatscht in die trockenen Hände, als wolle er damit die Unterhaltung beenden oder dem Cellerar doch noch Beifall zollen.
Irgendwie wirken die beiden höchst suspekt, denkt Mechthild und blickt zu Katrin, der ähnliche Gedanken durch den Kopf zu geistern scheinen.
Sonst noch was?
Der Cellerar wirkt, als hätte er es auf einmal sehr eilig und anderes, besseres zu tun, als von neugierigen Kommissarinnen mit unangenehmen Fragen belästigt zu werden.
Synchron schütteln die beiden Kommissarinnen den Kopf. Vorerst nicht.
Auf dem Klosterhof bleiben Mechthild und Katrin noch einmal stehen.
Der Abt und sein Cellerar sind längst wieder in der sie schützenden Trutzburg verschwunden. Dafür tollen jetzt auf dem Klosterhof Schulkinder herum.
Apropos, sagt Katrin, die Kinder wirken irgendwie eingeschüchtert, ängstlich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meinst du nicht auch?
Ja, genauso wie die Mönche nicht ganz koscher scheinen. Vor allem die beiden Pappnasen gerade. Irgendwas liegt hier im Argen.
Wart mal.
Katrin zur Mühlen tippt eine Telefonnummer in ihr Smartphone.
Dann beobachtet sie aufmerksam die tobenden Kinder. Bis es klingelt.
Da, schau, sagt sie und zeigt auf einen vielleicht dreizehnjährigen Jungen, der sein Handy aus der Hosentasche zieht.
Ja?
Gott fährt Rad
Ziska
Sie fahren mit ihren Fahrrädern, fetten Warmhalteboxen und schicken leuchtfarbenen Regenjacken (ihre sind gelb, die anderen türkis, magenta, hellblau und orange) durch die Stadt (bezahlt wird weit unter Mindestlohn) und beliefern die Kundinnen mit Essen, Lebensmitteln und sonstigem, was fürs Leben notwendig scheint.
Der Lieferservice boomt in diesen Zeiten, wo die Restaurants zwischenzeitlich zu No-Go-Areas erklärt wurden. Aber nicht nur Pizza, Pasta, Sushi, indische oder vietnamesische Gerichte haben sie im Angebot, sondern auch banale Lebensmittel, wie sie auch in den Supermärkten darauf warten gekauft zu werden. Auch das Dessert in Form von Drogen, vornehmlich Pillen, liefern sie, nur sie, ein neues Start-up, die Gelben, die Kolibris, frei Haus mit.
Ein Geschäftsmodell, das nicht nur einen exorbitanten Erfolg verspricht, bei dem Geld in Schubkarrenladungen eingefahren wird, sondern das auch aufgrund des ausgefuchsten Systems völlig unter dem Radar der Polizei läuft.
Manche Kundinnen lassen schon mal das Hauptgericht weg und füttern gleich das zentrale Nervensystem mit Tranquilizern, Opiaten und Benzodiazepinen. Valium, Librium, Xanax, Tranxilium, Tavor oder Adumbran fluten dann die Hirne, in denen die kritischen Gedanken und die angststreuenden Sorgen erst mal für eine Weile Pause machen. Sie haben alles im Programm (auch Marihuana, Koks, Crystal Meth, Heroin, LSD, Speed, Ketamin), was den Gebeutelten auf die Sprünge hilft, aber auch den Hedonistinnen das Himmelreich näher rückt und leuchtende Pupillen in die Gesichter zaubert.
Selbst nehmen die Rider das Zeug natürlich auch. (Sonst ist die ganze Scheiße nicht zu ertragen.) Mit den Pillen, richtig dosiert, halten Zuversicht, Leichtigkeit und ein Hang zum Fatalismus Einzug in ihr verkacktes Leben.
Am Morgen nach einer im Lieferdienst auf dem Rad verbrachten Nacht sitzen Ziska und ihre Kolleginnen im Rausch mit wackligen Knien und Rumoren im Bauch, im Mund all die blumigen Versprechungen wie zerfallene Asche, auf den Dächern über Berlin und schauen mit glasigen Augen in eine Zukunft, die vielmehr aus ihnen herausschaut, als wären sie nur mehr Hülle und längst tot. Dabei reden sie mit sich selbst und dem aufmerksam zuhörenden Wind (was nach einem völlig abgehobenen, fast schon fortgeflogenen Dialog mit mir, Gott, klingt): Postpunk und Genderspiele, sagen sie und werfen sich die Wortspiele und Stilblüten wie Gummibälle zu. Im Supermarkt nur Schweine, an der Fleischtheke der Tod mit großem Hallo spiegelnd in der Scheibe – gelähmte Zauberhand spukt in unserem Kopf, wir wollen es wissen, jetzt, sofort und alles. Nekrophile IT-Girls mit medusenhaftem Lächeln, Doppelleben als diabolische Doppelgängerinnen in heteronormativem Pornozwang zwischen Tokio, Thainutten und roten Flecken in der Form des Iran am Hals im bisweilen geschlossenen, aber doch irgendwie illegal geöffneten Kater Blau oder im Falshen Fish, in dem die Hedonistinnen kopfüber untergehen.
Getrocknetes Blut als Schminke im Gesicht, sagt Ziska verschwitzt und abgekämpft, jetzt auf der Bordsteinkante in einer Sackgasse im Wedding, und lässt sich vom Licht des Morgens überschütten. Der Schleier zeigt mehr, als er verbirgt, zeigt mich, dich, uns und mit uns eine Welt, die im Untergehen begriffen ist und umso mehr berührt, mit Fingern eingetaucht im Traum der anderen, der irgendwie nach Arschritze riecht. Meiner, deiner, unserer, der Welt.
Erste Sonnenstrahlen, ein Spritzer Helligkeit und eine Luft, die sich auf der Haut anfühlt wie eine glattrasierte Muschi vor dem Mund.
Beine eilen vorbei in Richtung Büro, in die Werkshallen, Logistikzentren, Verwaltungsgebäude, Workspaces, die Fabriken.
Die Autonomie der Arbeit wird durch das neoliberale System ins Gegenteil verkehrt, sagt sie zu den anderen und klatscht sich mit ihnen ab. Es geht nur noch um Flexibilisierung. Überall Flexibilisierung. Auch Selbstbestimmung wird einzig zur Selbstoptimierung. Die sexuelle Freiheit schlägt um in Konsumierbarkeit. (Für die sie eine entscheidende Rolle spielen.)
Wo ist die Tür, um aus diesem ganzen neoliberalen Scheiß herauszutreten?, fragt sie sich und nickt indifferent hoch zu mir in Richtung Himmel, der so aussieht, als wolle ihr der hereinbrechende Morgen die zerstörerische Vergangenheit um die Ohren hauen.
Ihr verstrahlter Blick sieht sie wie erschöpfte Königinnen mit gelben Kapuzen-Shirts auf dem Thron, zurück von einer kräftezehrenden Schlacht (die Fahrräder stehen wie erschöpfte Pferde daneben, die gelben Transportboxen ebenso), bei der manch Tropfen Blut geflossen und die ein oder andere Träne des Glücks vergossen worden ist.
Unter ihnen sind sie die Sklavinnen ihrer selbst.
Ja, sagt Ziska, und die anderen klatschen erneut in die Hände und sich selbst Beifall.
Sie bleiben noch eine Zeit lang sitzen, in den Ohren noch immer die rollenden Räder und den Beat der vergangenen Nacht, die Bilder im Kopf, die euphorisieren und in denen sie sich bewegen wie unter schwangeren Wattebäuschchen.
Ziska ist froh, zu ihnen zu gehören, endlich mal dazuzugehören. Weil die Einsamkeit und das Alleinsein krank machen.
Sie sitzt auf dem Asphalt, eine Xanax in den Blutbahnen und das Smartphone in der Hand, und sieht sich ein YouTube-Video an, in dem ein Mönch im schwarzen Habit Nazis vermöbelt.
Sie lacht in den Morgen hinaus.
Lacht immer mehr und kann gar nicht mehr aufhören mit dem Lachen.
Gott erwacht
Mechthild & Katrin
Der Inbegriff der Verlogenheit ist die katholische Kirche.
Das weiß ich schon lange.
Die Kirche weiß es auch. (Wer weiß es eigentlich nicht?)
Nur die Menschen scheinen noch immer an diesen Quatsch zu glauben.
Mechthild Frisch, Kriminalhauptkommissarin der Mordkommission, und Katrin zur Mühlen, die Kriminalpsychologin, glauben nicht daran. Beide haben sie ein angespanntes, bisweilen gleichgültiges Verhältnis zur Kirche und allen ihren Institutionen. (Zumindest bis vor Kurzem.)
Die Ermittlungen im Kloster sind ernüchternd bis frustrierend.
Die Mönche zeigen, im Schutz der Kirche, den beiden ihre Grenzen auf. Grenzen, die sie nicht akzeptieren wollen.
Wir müssten die Bude einfach mal hopsnehmen.
Katrin zur Mühlen ist eher von der rustikal-brachialen Sorte und hält damit nicht hinterm Berg.
Ein Durchsuchungsbeschluss ist ausgeschlossen, sagt Mechthild, den kriegen wir bei diesem Ermittlungsstand nie durch.
Einmal durchs Kloster fegen, und wir würden sicher bei den Pfaffen was finden.
Wie stellst du dir das vor?
Die katholische Staatsanwältin schlägt uns die Anfrage um die Ohren. Die glaubt, wir sind komplett verrückt, wenn wir auf dieser Grundlage um einen Beschluss bitten.
Dann müssen wir irgendwie anders da rein.
Katrin, ganz pragmatisch, zieht aus den Zweifeln die Konsequenz.
Sie sehen sich an und wissen beide, wie, und wer dafür einzig in Frage kommt.
Eine Pause entsteht, als ob die eine der anderen nicht zuvorkommen wolle.
Die Pause wird immer länger und die beiden Frauen immer nervöser. Bis Mechthild es nicht mehr aushält und sagt: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Es ist ein Gedanke, den sie, nachdem sie ihn zugelassen hat, gern so schnell wie möglich wieder loswerden würde.
Mein Ernst, dein Ernst. Mechthild, was war, ist vergangen.
Katrin zur Mühlen sagt es, als hätte sie lange dafür geprobt oder die Worte heute Morgen, mit der Kaffeetasse in der Hand, vom Abreißkalender in der Küche neben dem Kühlschrank gelesen.
Es wäre eine Möglichkeit, nicht nur ein bisschen Licht in diesen Fall zu bringen, sondern auch dein und unser Verhältnis mit Bu zu normalisieren.
Der Name steht jetzt wie eine brennende Fackel zwischen ihnen.
Bu!
Wie lange haben sie diesen Namen nicht mehr ausgesprochen? Jahre ist es her.
Und auch jetzt wirkt er noch elektrisierend auf beide. (Wie ein Finger in der Steckdose.)
Vielleicht will ich es gar nicht normalisieren, sagt Mechthild in der Hoffnung, doch noch irgendwie ein Schlupfloch zu finden, um dieser Idee zu entkommen.
(Funktioniert aber nicht.)
Du willst es, entgegnet Katrin und stellt sich ihr breitbeinig in den Weg.
Mechthild wagt nicht zu widersprechen, weil sie weiß, dass Katrin recht hat.
Und wie soll ich das der Staatsanwältin verkaufen?
Sie flüchtet sich aufs Ermittlungsterrain zurück, auf dem sie sich sicherer fühlt. Sicherer als in den Gefühlsdingen, die ihr immer schwer gefallen sind und ihr deswegen auch immer zu entgleiten drohen.
Das schaffst du. Wenn sie dem Durchsuchungsbeschluss schon nicht zustimmt, wird der verdeckte Ermittler das kleinere Übel für sie sein, oder?
Mechthild gibt noch nicht auf.
Wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir Bu da einschleusen?
Wieder dieser Name: Bu.
Wieder dieser innere Stromschlag.
Wieder eine Pause, die nicht nur zum Nachdenken dient. Zumindest nicht für Katrin. Sie hat das alles längst schon durchdacht. Für sie geht es nur noch darum, es Mechthild so plausibel wie möglich zu verkaufen. Damit auch sie beim Nachdenken keine Kopfschmerzen bekommt.
Bu kann doch ganz normal als Bruder im Kloster einchecken. Auf Urlaub quasi.
Urlaub?
Jetzt erlaubt sich Mechthild doch ein kleines Lächeln.
Ja, das ist unter den Klosterbrüdern nicht unüblich. Einmal im Jahr dürfen die auch Urlaub machen. Das wird ihnen vom Abt quasi eingeräumt. Die fahren natürlich nicht für ein paar Wochen nach Malle an den Strand und lassen die Sau raus, sondern verbringen die Urlaubszeit in der Regel in einem anderen Kloster irgendwo auf der Welt.
Ja?
Skepsis, zunächst nur in zwei Buchstaben gefasst, bei Mechthild.
Wie weißt du das? (Dann in dreizehn Buchstaben.)
Ich hatte mal eine ehemalige Novizin als Patientin.
Mechthild ist erstaunt, während für Katrin jetzt der Punkt gekommen ist, die alles entscheidende Frage in den Raum zu werfen: Rufst du ihn an oder ich?
Selbstgespräch mit oder ohne Gott
Mechthild
Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm,
habe ich früher als Kind immer gebetet.
Heute weiß ich, dass ich weder fromm sein, noch in den Himmel will.
Ich will einfach auf Erden ganz bescheiden ein Stück vom Glück abhaben.
Dazu brauche ich keinen Gott.
Gott ist eine Erfindung derjenigen, denen das Weltliche zu wenig ist,
und derjenigen, die in die Zukunft verweisen, damit die Gegenwart besser kontrollierbar bleibt.
Dieses ganze Kirchengedöns zielt doch nur darauf ab, die Schäfchen vom Blöken abzuhalten.
Denn zum Blöken gäbe es genügend Anlass.
Wer den Mund nicht aufmacht, schweigt.
Wer schweigt, ist ungefährlich.
Vielleicht sollten diese gottesfürchtigen Kirchenvertreter und submissiven Gottes-Adepten einfach mal ein Praktikum bei mir, bei der Kripo machen.
Dann würden sie schnell erkennen, dass Gott, wenn es ihn denn gibt, ein ziemlicher Kotzbrocken sein muss, wenn er so viel Gewalttätigkeit und menschlichen Hass zulässt.
Bu ist auch ein Kotzbrocken. Aber ein liebenswerter.
Und mit ihm scheint auch Gott in meinem Leben ein Stück weit, ob ich will oder nicht, zurück zu sein.
Es fühlt sich zumindest so an.
Scheiße, einerseits.
Halleluja, andererseits.
Amen.
Gott traut seinen Augen nicht
Bu
Ich sehe ihn.
Da sitzt er wie ein Fremdkörper, ein abgestürzter Meteorit, ein ausgespuckter Rotzbatzen in der oberschwäbischen Provinz, in dieser völlig ereignislosen Einöde, in der von der Welt abgewandten, vergessenen Ecke, in der sich nur die Natur von ihrer schönsten Seite zeigt: Wälder, Wiesen, Äcker, ein Fluss, sonst nichts. Gar nichts!
Da sitzt dieses deutsch-vietnamesische Wrack in diesem benediktinischen Kloster wie in einem maroden Knast für sündige Verlierer gefangen und harrt selbstvergessen aus.
Ich weiß, dass er nicht im Kloster ist, weil er an mich glaubt. Weil er mir, Gott, huldigt, mich verehrt und sein verkacktes Leben ganz in meinen Dienst gestellt hat.
Er glaubt an gar nichts. (Nicht mal an sich selbst.)
Dieser arme, bemitleidenswerte Tropf, dieser hoffnungslos Verlassene, dieser verirrt Verwirrte war schon immer auf der Seite der Verlierer. (Auch wenn er es selbst nicht wahrhaben wollte.)
Da sitzt er also seit Jahren hinter diesen dicken, modrigen Mauern, nicht um sein Leben der Spiritualität, den Gebeten und dem Glauben zu widmen, sondern einzig und allein weil er seinen Platz im Leben verspielt hat und keinen einzigen Ort außer dem hier weiß, der sein Überleben in der großen, weiten und gefährlichen Welt möglich macht.
Es sind genau 43.803 Stunden oder 1.825 Tage, dass er diesen Anruf erwartet. (Oder vielmehr befürchtet.) Seit er wieder im Kloster ist, seit genau fünf Jahren, hat er Angst vor diesem Klingeln, vor diesem scheppernden alten Telefonapparat, der wie ein Relikt aus einer anderen, vielleicht nicht besseren, aber doch sichereren Zeit anmutet, und vor der Aufforderung eines seiner Klosterbrüder, den Telefonhörer an der Klosterpforte in die Hand und den Anruf entgegenzunehmen.
An diesem frischen Sommermorgen nach der Messe und dem anschließenden Frühstück gemeinsam mit den Brüdern im Refektorium ist es endlich soweit.
Pater Emanuel ruft ihn, sagt, dass ihn jemand sprechen wolle.
Auch ohne dass Pater Emanuel es sagt, weiß er, wer es ist. Er weiß es, weil er die ganze Zeit über, in der er versucht, das Zurückliegende zu vergessen, der Vergangenheit zu entkommen, daran denkt. (Immerzu daran denkt.)
Er denkt an die Stimme, an die Stimmen, die zu diesen Menschen gehören, die er unentschuldbar verletzt hat. Er denkt an die vergangene Zeit, an sein zurückliegendes Leben, das ihm abhandengekommen scheint und aus dem er deswegen wie schon so oft geflohen ist, um sich hier im Kloster, zurückgezogen von der Welt und ihren peinigenden Lastern, wiederzufinden. (Oder zumindest zu suchen.)
Und wenn gar nichts geht, also kein Suchen und Finden, dann ist er einfach nur hier, um zu vergessen.
Er hat sich natürlich nicht gefunden.
Ich weiß, dass er sich nie finden wird. Gleichwohl hat er sich erholt von den ätzenden Wunden, die er sich selbst mit seinen Lastern zugefügt hat. Sie sind zwar mittlerweile verheilt, verschorft, aber noch immer da und zu erkennen.
Für ihn selbst ganz deutlich zu erkennen.
Es bedarf nicht viel, dass der Schorf abfällt, die Wunde wieder aufbricht und der Schmerz wie eine verunreinigte oder besser verrostete Gabel in sein Bewusstsein sticht.
Jetzt ist es soweit. Nach fünf Jahren.
Der Anruf öffnet die Haut. Der Schmerz tritt aus und in ihn ein.
Davor hatte er all die 43.803 Stunden, all die 1.825 Tage, die ganzen fünf Jahre über Angst gehabt.
Natürlich hätte er den Anruf nicht entgegennehmen müssen, hätte er zu Pater Emanuel sagen können, dass er keine Zeit habe, für niemanden zu sprechen sei, seine Ruhe brauche.
Pater Emanuel hätte dafür Verständnis gehabt.
Alle im Kloster hätten dafür Verständnis gehabt.
Er sagt es nicht.
Ein bisschen scheint er auch erleichtert zu sein, ja, auf seinem Gesicht vermag ich eine Spur von Freude zu erkennen, dass ihn nach all der Zeit und der quälenden Befürchtung doch noch der Anruf erreicht.
Bu?
Dieses eine Wort, sein Name, ein ganzes Universum, setzt den einen Dominostein in Bewegung, sodass alle anderen als Anschlussreaktion über ihn, als wäre er nicht der Täter, sondern ab jetzt das Opfer, herfallen.
Alles läuft im Zeitraffer, im Bruchteil einer Sekunde in ihm ab, wie ein Buch, dessen Seiten man blitzschnell durch die Finger gleiten lässt, einem Taschenkino gleich, oder wie ein Film, womöglich aus dem Genre Horror, der vor dem geistigen Auge rasend schnell abläuft:
Fucktown! …
kanonischer Abgesang auf eine Stadt …
mit viel Blood, Sweat and Tears …
ein verdeckter Ermittler, der mit sich selbst und seinen Abhängigkeiten beschäftigt ist …
eine Hauptkommissarin, die in Therapie ist …
eine Kriminalpsychologin, die auf die Hauptkommissarin steht …
Drogendealer …
Stricher …
eine ermordete trans Frau …
ein angezündeter Obdachloser …
eine erwürgte polnische Altenpflegerin …
ein Psychopath, der bei seiner Mutter wohnt und sie pflegt …
Islamisten, die einen Anschlag planen …
der Verfassungsschutz, der ihn verhindern will …
und die FUCKTOWN eben, in der das alles passiert und die zuschaut …
vier Jahreszeiten lang einfach nur zuschaut …
und alles geschehen lässt …
und sich wundert, einfach nur wundert …
FUCKTOWN …
Mechthild? – Bu stoppt die ihn überflutenden Bilder im Kopf mit dem Namen, der Frage, mit Mechthild.
Nein, ich bin’s, Katrin.
Das Gespräch beginnt mit einer Enttäuschung.
Er hatte so sehr gehofft, dass Mechthild ihn anruft. Jetzt ist es nur Katrin, die seine Enttäuschung natürlich bemerkt.
Katrin zur Mühlen ist Psychologin und scheint trotz der Distanz von mehreren hundert Kilometern seine Gefühle erkennen und genau deuten zu können.
Mechthild weiß nicht, dass ich anrufe, lügt sie. Aber wir haben keine andere Wahl, Bu. Und dann: Ich dachte, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, endlich die verbrannte Erde wieder aufzuforsten, Blumen zu säen, dass die hässliche Brache, die unsere enttäuschte Freundschaft hinterlassen hat, wieder ein bisschen Leben und Farbe bekommt und in einem anderen schöneren Licht erscheint.
Bist du jetzt Poetin?
Sie lacht in den Hörer. Es ist ein schönes Lachen.
Bu lacht auch.
Das Eis scheint gebrochen.
Ich habe dich vermisst, Bu.
Er könnte jetzt sagen: Ich dich auch. Und vor allem Mechthild.
Er spart es sich. Und ihr.
Und Mechthild?, fragt er stattdessen.
Sie auch. Sie würde es vielleicht nicht so sagen, aber glaub mir, ich weiß es.
Seid ihr noch zusammen?
Ja, wieder. Wir sind wieder zusammen. Und wir arbeiten beide wieder bei der Berliner Kriminalpolizei. Mechthild ist eine Stufe nach oben geklettert und schmeißt jetzt den Laden, und ich bin jetzt ebenfalls Kommissarin und ihre Stellvertreterin.
Eine Pause entsteht.
Es scheint, als überlege Katrin, was sie noch sagen solle. Oder als müsse sie die nächsten Worte genau abwägen.
Dennoch haben wir ein Problem, Bu. Ein verdammt großes Problem.
Klar, sonst hättest du mich nicht angerufen, sagt Bu, und es klingt dann doch ein bisschen vorwurfsvoll, gekränkt.
Nein, das stimmt nicht. Ich rufe auch, aber nicht nur deswegen an. Ich habe fünf Jahre lang darauf gewartet, dass eine Gelegenheit kommt. Sie kam nie, bis jetzt. Jetzt geht beides zusammen.
Was?
Das Bedürfnis, dich zu sehen und die Vergangenheit hinter uns zu lassen einerseits. Und auf der anderen Seite ein äußerst komplizierter Fall, der uns alle fertig macht und der nur mit deiner Hilfe lösbar zu sein scheint.
Er schweigt, denkt sich: Blödsinn, als ob ich in was für einem Fall auch immer etwas bezwecken könnte. Das ist reine Projektion …
Bu, bist du noch dran?
Er könnte schweigen, für immer. Auflegen, sich davonstehlen, wie er sich fast immer in solchen Situationen davongestohlen hat.
Ja.
Wenn du unserer Beziehung, wenn du der Beziehung zu Mechthild und mir, unserer Freundschaft noch eine Chance, wenn auch nur eine ganz kleine, gibst, dann, dann komm bitte.
Und wenn nicht?, denkt er, sagt es aber nicht.
Stattdessen sagt er: Ich muss das mit meinem Abt besprechen.
Das habe ich bereits.
Was?
Es ist alles vorbereitet. Du musst nur noch Ja sagen.
Gott traut seinen Augen
Baschar
Das Licht ist anders. Seit er hier ist, kommt er mit diesem Licht nicht zurecht.
Er zwinkert die ganze Zeit, was wie ein Tick auf die anderen wirken muss.
Die anderen! Sieht er sie, weiß er, dass er fremd ist, immer fremd bleiben wird.
Trotz Integrationskurs und Deutschkenntnissen.
Sehr, sehr guten Deutschkenntnissen.
Und noch mehr Integrationskursen.
Je besser er deutsch kann, desto fremder fühlt er sich.
Die Fremde ist in ihm, so wie die Heimat, unendlich weit, viertausend Kilometer weit weg von hier, in der Ferne krepiert.
Es sind zwei Seiten einer Medaille, die sich, als wäre sie aus Schokolade, in seinen Händen langsam auflöst – und mit ihr seine Hände, seine Arme, sein Körper und schlussendlich er selbst.
Er fühlt sich nur mehr in den Blicken der anderen existent.
Allein irrt er wie ein angeschossener Hund in der Dunkelheit herum, in der er sich verschwendet auf der Suche nach einem stillen Ort zum Sterben.
Es ist ein Land wie ein Totenstück, schwebend über der Zeit, wie eine zerfetzte, ärmellose Bluse auf einer Wäscheleine bei Regen und pfeifendem Südwind auf dem Friedhof der Gegenwart, verweisend in die traurige Zeit der Zukunft. Irgendwo auf dem Weg werden wir verloren gehen, denkt er.
Es gibt keine Auferstehung der Toten, keine Befreiung von dem Schrecken.
Der Lärm des Krieges wird das Schweigen der Toten nicht überdauern – hat er das nicht irgendwo schon einmal gehört, gelesen, hat es ihm irgendwer erzählt?
Ach so, denkt er, und wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, sage ich:
Halt’s Maul und fick dich selbst!
Oder: Frag Mama, die ist schon tot.
Er hat sich immer vorgestellt, gewünscht, mit offenen Augen erträumt:
Woanders anders werden, durch andere anders sein, anders als andere, und dennoch gleich bleiben:
Gleich heiter,
gleich klug,
gleich gewitzt,
gleich erfolgreich,
gleich schön.
Auch:
Gleich dumm,
gleich abhängig,
gleich getäuscht,
gleich beschränkt,
gleich ausgeliefert –
sich, den anderen, der Welt.
Paris ist ohne ihn Paris, New York New York, Ayasha Ayasha –
und alles auch ein wenig Damaskus, eingenäht in ihm, wie ein Brustbeutel, eine Tasche aus grobschlächtiger Jute, in der ein verlaustes Tier haust, verzweifelt, ein Tier, das strampelt, schreit, eine Ratte, die sich einscheißt aus Angst vor dem, was sie nicht weiß, nicht wissen kann.
Die Ratte in ihm sagt: Halts Maul, du Schwein!
Das Schwein in ihm lacht und fühlt sich bestätigt.