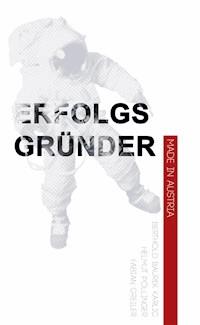
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
25 Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen ihre Geschichte. So unterschiedlich die persönlichen Hintergründe, Ideen und Herangehensweisen sind, eines eint alle Gründer: Der Wille zu gestalten! Das Buch stellt Menschen vor, die für ihre Idee brennen, hohes persönliches Risiko nehmen und die dafür sogar über eigene Belastungsgrenzen hinausgehen. Es sind Menschen, die sooft gegen Mauern rennen, bis sich ihnen ein Weg eröffnet. "Erfolgsgründer made in Austria" ist eine Hommage an den Pioniergeist und das Unternehmertum in Österreich. Es zeigt die vielen Gesichter des Erfolges, macht Mut zur Selbständigkeit und hilft, der eigenen Idee Flügel zu verleihen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
25 Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen ihre Geschichte. So unterschiedlich die persönlichen Hintergründe, Ideen und Herangehensweisen sind, eines eint alle Gründer: Der Wille zu gestalten! Das Buch stellt Menschen vor, die für ihre Idee brennen, hohes persönliches Risiko nehmen und die dafür sogar über eigene Belastungsgrenzen hinausgehen. Es sind Menschen, die sooft gegen Mauern rennen, bis sich ihnen ein Weg eröffnet.
„Erfolgsgründer made in Austria“ ist eine Hommage an den Pioniergeist und das Unternehmertum in Österreich. Es zeigt die vielen Gesichter des Erfolges, macht Mut zur Selbständigkeit und hilft, der eigenen Idee Flügel zu verleihen.
ISBN: 978-3-656-82645-3
BERTHOLD BAUREK-KARLIC HELMUT PÖLLINGER FABIAN GREILER
IMPRESSUM
Lektorat: Michaela Domnanovich Umschlaggestaltung: Katharina Mohn Layout und Satz: Ulli Radl, www.urformat.at E-Book Herstellung: ScienceFactory, ein Imprint der GRIN Verlag GmbH Foto Fabian Greiler: Richard Tanzer
WICHTIGE HINWEISE
Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eventuell entstehende – mittelbare oder unmittelbare, verschuldete oder unverschuldete – Schäden oder andersartige Nachteile, die aufgrund von Äußerungen aus diesem Buch entstanden sind, berechtigen daher nicht zu irgendwelchen Ansprüchen (auch nicht seitens Dritter) gegen die Autoren oder den Verlag und deren Beauftragte, soweit mit den gesetzlichen Regelungen vereinbar. Insbesondere die Haftung der Autoren, des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Angaben richtig, vollständig oder anwendbar sind. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Autoren und Verlag dankbar.
Die Benutzung von Markennamen, Zeichen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass diese frei verwendbar wären.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urherberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
1. Auflage 2014
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Interviews
Robotik & Mechanik
1. Montre Exacte – Christian Umscheid
2. Ego Sports – Mario & Daniel Preining
3. Microtronics – Stefan Pfeffer
4. Spidercam – Jens Peters
Finance & Investoren
5. Wikifolio – Andreas Kern
6. Econob – Marcus Hassler & Markus Schicho
7. 42Angelitos – Christian Leeb
8. Alps Ventures – Markus Pichler
9. Conda – Daniel Horak
B2B-Dienstleistungen
10. mPAY24 – Tom Wolf
11. Gentics – Klaus Schremser & Haymo Meran
12. Sensix – Richard König
13. update – Gilbert Hödl
14. Zeytinoglu ZT – Arkan Zeytinoglu
15. Superevent – Marcel Wassink
16. Spirit Design – Daniel Huber
B2C-Dienstleistungen
17. Usetwice – Markus Heingärtner
18. sms.at – Jürgen Pansy
19. Vision Maker – Verena Thiem
20. karriere.at – Jürgen Smid
21. Runtastic – Florian Gschwandtner
22. courseticket.com – Alexander Schmid
23. Adaffix – Claudia Dreier-Poepperl
24. paysafecard – Michael Müller
25. Young Enterprises – Julian Breitenecker
Epilog
Vorwort
Unternehmensgründungen zählen zu den spannendsten Ereignissen in der Wirtschaft. Sie sind oft Kulminationspunkt langjähriger Vorbereitungsarbeiten, der Anfang einer Abenteuergeschichte oder womöglich der spontan beschlossene Start in eine ungewisse Zukunft. Die beteiligten Personen wie Geldgeber, Berater, Mitgründer verfolgen mitunter unterschiedliche Interessen und gehen oft nur einen Teil des Weges mit den Gründern. Oft sind einzelne Gründerpersönlichkeiten wesentlich für den nachhaltigen Erfolg.
Die Idee zum Buch entstand aus dem Interesse an Startups, bei denen die Idee, das Team oder die Marktfähigkeit des Produktes erfolgversprechend waren. Es kristallisierte sich heraus, dass neben finanziellen Mitteln auch einschlägige Erfahrung und Netzwerkkontakte wichtige Erfolgsfaktoren sind. Gründer und Business Angels stellen daher ein ganz besonderes Ökosystem für den Erfolg dar. Business Angels haben keine lange oder weitreichend dokumentierte Geschichte in Österreich, aber zweifelsohne eine große Zukunft. Institutionen wie die Austrian Angel Investors Association (AAIA) oder das Business Angel Institut leisten hier kontinuierlich Pionierarbeit. Wie wurden erfolgreiche Unternehmensgründungen zu dem, was sie heute sind? Nichts ist einfacher als mit denjenigen zu sprechen, die es bereits geschafft haben. Mit jedem Gespräch verstärkte sich unsere Überzeugung, dass Unternehmensgründer einen ganz besonderen Antrieb haben. Die vielen Gespräche ermöglichten Einblicke in Absichten, Hintergründe und Überlegungen von Personen, die sich durch bloßes Betrachten oder Zuhören nicht erahnen lassen. Was wir sehen und hören hat meist eine Vorgeschichte oder ist das Ergebnis umfangreicher Vorarbeit und des Zusammenwirkens vieler Faktoren.
Als wir, das sind Helmut Pöllinger, Berthold Baurek-Karlic und Fabian Greiler, uns bei einem Treffen im Mai 2013 darüber austauschten war schnell klar: Das Thema ist nicht nur für uns interessant. Wir wollten unsere Ansichten aus eigenen Erfahrungen und die Geschichten verschiedener Unternehmensgründer zusammentragen und mit möglichst vielen Interessierten teilen. So entstand das Projekt Erfolgsgründer made in Austria. Helmut Pöllinger brachte seine über 25-jährige Erfahrung im Management von schnell wachsenden Startups, Gründungs- und Exit-Erfahrung ein, Berthold Baurek-Karlic seine Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung, Gründung und im Management von Startups und Fabian Greiler seine publizistische Erfahrung.
Das vorliegende E-Book oder Buch, wenn Sie sich für die gedruckte Ausgabe entschieden haben, ist das Ergebnis von rund eineinhalb Jahren Beschäftigung mit den unterschiedlichen Aspekten, die Unternehmensgründer erfolgreich mach(t) en. Es sollte kein Lehrbuch werden, sondern eher Dokumentationscharakter haben. Es soll keine Rangliste oder Bewertung sein, sondern eine interessante Zusammenstellung unterschiedlicher Gründer und Gründerinnen in verschiedenen Lebenssituationen. Im Vordergrund standen immer die Menschen, ihre Motivation und Passion und weniger die Unternehmen. Wir freuen uns über Feedback unter www.erfolgsgruender.com.
Das Projekt und insbesondere das Buch wären nicht möglich gewesen, ohne die großartige Unterstützung vieler Menschen. Wir danken Michaela Domnanovich für Ihre Lektorentätigkeit, Ulli Radl für die Layoutgestaltung des Buches und das Projektmanagement der Produktion, Kathi Mohn für die Gestaltung des Buchumschlages, Monika Pichler und Axel Büchner für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Transkripte der Interviews, Judith Büchler für das erste Gegenlesen und nicht zuletzt den vielen Interviewpartnern für die aufgewendete Zeit und Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit uns in sehr privaten Gesprächen zu reflektieren.
Helmut Pöllinger, Berthold Baurek-Karlic und Fabian Greiler im Oktober 2014.
Prolog
Startup-Szene in Österreich
Österreich erkennt zunehmend den Wert einer florierenden Startup-Szene: Gründungen leisten einen entscheidenden Beitrag für die Volkswirtschaft. Hohe Innovationsfähigkeit, großes Wachstumspotenzial, nachhaltige Geschäftsmodelle, neue Produkte und Dienstleistungen sind typische Charakteristika. Junge Unternehmen mit einzigartigen Geschäftsideen sorgen für wirtschaftliche Dynamik. Entrepreneure, die bereits erfolgreich gegründet haben, nehmen eine entscheidende Rolle in der Dynamik des Startup-Ökosystems ein. Sie stehen häufig Jungunternehmern unterstützend zur Seite, indem sie ihre gesammelten Erfahrungen und ihr Know-how weitergeben und damit die gesamtökonomische Entwicklung positiv vorantreiben.1 Startups sind darüber hinaus bedeutend für den Arbeitsmarkt. Junge Unternehmen wachsen im besten Fall sehr schnell und sind laufend auf der Suche nach neuen Talenten. Alleine in Österreich wurden durch Unternehmensneugründungen im Jahr 2013 rund 200.000 Arbeitsplätze geschaffen und die Wertschöpfung des Landes um 8,7 Milliarden Euro erhöht. Aktuellen Studien zufolge werden im Durchschnitt rund sieben Arbeitsplätze pro neugegründetem Unternehmen geschaffen (3,1 direkte und der Rest indirekte Arbeitsplätze durch Vorleistungen und Kaufkrafteffekte).2
Mangel an Risikokapital
Viele Entrepreneure stehen jedoch vor dem Problem der Kapitalbeschaffung. Innovative Ideen alleine bringen noch keinen Erfolg, es braucht auch die nötigen Ressourcen. Die Investition in ein junges Unternehmen ist nicht selten mit hohem Risiko verbunden. In vielen Sektoren liegt die Wahrscheinlichkeit für das Scheitern bei über 90 Prozent. Dieses hohe Risiko gehen Banken meist nicht ein, deswegen müssen alternative Kapitalquellen in Betracht gezogen werden. Um die Finanzierung für ein Projekt zu erhalten, wenden sich viele Jungunternehmer an die zwei bekannten „F‘s“ - „Family and Friends“ - und riskieren darüber hinaus ihre eigenen Ersparnisse. Diese Form der Kapitalbeschaffung wird zumeist in der Vorgründungsphase in Anspruch genommen, in der es keine beratende Unterstützung gibt. Umso wichtiger sind Investoren, die Risikokapital zur Verfügung stellen. Nicht alle Startups brauchen sofort einen Geldgeber, beispielsweise weil sie gleich von Anfang an einen großen Kunden gewinnen konnten. Spätestens in der Expansionsphase werden aber meist weitere Mittel benötigt. Selten sind Geschäftsmodelle so solide und ertragreich, dass sie für ein internationales Wachstum keine externe Finanzierung benötigen. In Österreich werden deshalb rund 70 Prozent der Jungunternehmen durch private Investoren unterstützt.3 Verglichen mit dem US-amerikanischen Markt hat Österreich jedoch noch viel Aufholpotenzial. Viele Startups flüchten noch immer ins Ausland um zu überleben oder zu wachsen. So wurden 2013 nur 0,04 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsproduktes für die Vergabe von Venture Capital aufgewendet. Diese Zahl liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt.4 Ernsthafte Bemühungen in diesem Bereich etwas zu verändern, also neue Fonds aufzulegen, sind aufgrund der strengen EU-Regularien (AIFM-D) noch eher selten, langsam entwickeln sich aber auch hierzulande kapitalstarke und risikofreudige Fonds.
Gründungsspirit in Schulen verankern
Ein weiterer Grund für die im Vergleich mit den Vereinigten Staaten schwach entwickelte Startup-Szene ist das Fehlen einer Kultur des Scheiterns. Die überwiegende Mehrheit der interviewten Startups für den Startup Report 2013 sah eine große Hürde in der niedrigen gesellschaftlichen Toleranz für das Scheitern. Um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Startups zu verbessern, braucht es die bessere Vermittlung von Unternehmertum an Universitäten und Schulen. Nur etwa die Hälfte aller österreichischen Gründer haben mangels geeigneten Angebots vor ihrer selbständigen Tätigkeit entsprechende vorbereitende Kurse an Hochschulen besucht. Deshalb sind Initiativen notwendig, die die wohlvorbereitete Gründungs- und Risikobereitschaft erhöhen. Neben der gesellschaftlichen Akzeptanz sind aber auch Förderungen ein wichtiger Anreiz für die Entwicklung einer florierenden Startup-Szene.
Förderwelt im Überblick
Staatliche Förderungen
Staatliche Institutionen fördern Jungunternehmer bei der Umsetzung ihrer Ideen, wobei sich die Motive und Zugänge grundlegend von jenen der privaten Investoren oder Venture Capital Fonds unterscheiden. Die Beweggründe sind verankert in einer volkswirtschaftlichen Sichtweise. Klein- und Mittelbetriebe sind der Motor der Wirtschaft und fast alle Betriebe eines Landes sind KMUs.5 Die Steigerung von Unternehmensgründungen und die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Effekte sind daher das Ziel von Förderinstrumenten. Durch gezielte Förderungen kann der Wettbewerb angeregt werden und neue Produkte und Dienstleistungen entstehen. Etablierte Unternehmen sind wiederum zu mehr Innovationstätigkeit gezwungen, um langfristig am Markt bestehen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können. Instrumente staatlicher Institutionen sind Steuererleichterungen in den ersten Jahren, Hilfe bei der Bewältigung der Bürokratie, erleichterter Zugang zu Krediten, Haftungsübernahmen, Darlehen und eine Minimierung der Markteintrittsbarrieren.
Business Angels
Business Angels sind informelle Investoren, die die Finanzierungslücke von Startups füllen. Einerseits stellen sie Venture Capital in der ersten Gründungs- und Wachstumsphase zur Verfügung, einer Phase, in der sich die klassischen Fonds noch nicht engagieren dürfen. Andererseits unterstützen sie Unternehmen mit ihrem Wissen, ihren Netzwerken und Kompetenzen, womit gezielt „Smart Money“ zur Verfügung gestellt wird. Business Angels sind eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Investitionsmotiven. Ein offensichtlicher Grund in Startups zu investieren, ist ökonomischer Natur. Aufgrund des hohen Risikos und der Unsicherheiten, die sich bei Produktneuheiten ergeben, fordern sie einen entsprechend hohen Return on Investment (ROI). Dieser ist meist deutlich höher als der Ertrag, der bei etablierten Unternehmen zu erzielen ist. Im Durchschnitt fordern Angelinvestoren einen ROI zwischen 30 und 40 Prozent pro Jahr oder eine Illiquiditätsprämie von rund 10 Prozent gegenüber klassischen Aktienveranlagungen. Die Einschätzung von Kapitalgewinnen bei der Veräußerung der Anteile wird bei dieser Art des Investments stark miteinberechnet, da Dividenden eher selten sind.
Investoren mit dieser Motivlage halten ihre Beteiligungen eher für eine beschränkte Zeitperiode und erhoffen sich schnelle Gewinne. Angels sprechen häufig von dem einen Investment, das weniger erfolgreiche Investments aufwiegen muss. Des Weiteren sehen sie in der Eigenkapitalvergabe eine Möglichkeit, von Steuerbegünstigungen zu profitieren. Business Angels erhalten beispielsweise in den USA und in Großbritannien Steuererleichterungen von bis zu 50 Prozent. Diese Vergünstigungen fördern die Vergabe von Risikokapital. Im deutschsprachigen Raum gibt es dagegen wenig bis gar keine steuerlichen Vorteile für Business Angels, wobei auch bei uns der Ruf nach Steuererleichterungen lauter wird.
Viele Business Angels investieren auch deshalb, weil es ihnen einfach Spaß macht ein Unternehmen aufzubauen. Sie wollen aktiv mit dem Gründerteam arbeiten und sie durch Vermittlung von Kontakten, Weitergabe von Expertise und Zugang zu Netzwerken unterstützen. Oft wir auch der Reiz des Risikos als Grund genannt. Ein weiterer Motivationsfaktor ist die hohe gesellschaftliche Anerkennung. Geldgeber investieren gelegentlich auch aus altruistischen Motiven. Im Vordergrund steht dabei das Wohlergehen der Gesellschaft. Altruistische Investoren bevorzugen Ideen und Projekte, die soziale Missstände oder Probleme adressieren. Zur Gruppe der altruistischen Investoren zählen auch Familienangehörige oder Freunde, die in ein Startup aufgrund der persönlichen Beziehung mit den Gründern investieren. Eine weitere Motivation kann das Streben nach der wirtschaftlichen Belebung einer bestimmten Region sein.
Ganz allgemein und abseits einer bestimmten Motivlage gilt: Kriterien für die Selektion eines Investmentprojekts für Business Angels sind unter anderem die Größe des Investitionsobjektes und des Kapitalbedarfs, der geographische Wirkungsbereich, die Unternehmensphase, die Industrie und Branche, das Risiko, die benötigte Zeit bis zum Exit, das Gründerteam und seine Kompetenzen, das Marktpotenzial, ein nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell, das Produkt oder die Dienstleistung, der langfristige Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die Wettbewerbssituation und die zugrundeliegende Technologie.6 Wichtig ist dabei, dass das individuelle Matching zwischen Investor und Startup stimmt.
Venture Capital Fonds
Risikokapitalgesellschaften sind eine weitere Finanzierungsquelle für Startups. Venture Capital Firmen investieren in Jungunternehmen in der Vorgründungs-, Gründungs- und Wachstumsphase mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstrumenten. Diese Gesellschaften setzen meist Fonds auf, die das Kapital von individuellen Investoren poolen. Das besondere an diesen Fonds ist, dass sie extrem riskant sind und in der Regel nur von professionellen, also erfahrenen, Investoren gezeichnet werden. Venture Capital Fonds bauen in der Regel ein Portfolio mit unterschiedlichen Startups auf, um das Risiko zu diversifizieren. Vorwiegend wird in technologieorientierte und innovative Projekte investiert, die manchmal neben finanziellen Ressourcen auch Beratungsleistungen erhalten. Eigenkapital wird mittel- bis langfristig vergeben, wobei das oberste Ziel darin besteht, durch einen Exit Gewinne zu erwirtschaften. Venture Capital Fonds erwarten im Idealfall signifikante Wertsteigerungen durch den Verkauf oder Börsengang eines Unternehmens. Die meisten Venture Capital Gesellschaften haben vordefinierte Investmentkriterien und Startups werden von den Investmentmanagern mittels Due Diligence Prüfungen genau analysiert. Die Investmentmanager sind im Anschluss für das Monitoring und die Betreuung des Investments verantwortlich. Die finale Entscheidung für eine Beteiligung wird letztendlich durch ein Investmentkomitee getragen, dem der verantwortliche Manager das „Investment Proposal“ vorstellt. Aus einigen Studien geht hervor, dass die Hauptkriterien für eine Investition das Gründerteam und dessen Erfahrungen sind. Daneben spielen die Strategie, das Produkt, die Umsetzung am Markt, individuelle Merkmale wie Investmentgröße und Unternehmensphase sowie die Aussicht auf Gewinne eine wichtige Rolle.7 2013 wurden in Europa mehr als 3.000 Unternehmen mit einer Gesamtsumme von über 3,4 Milliarden Euro8 mit Venture Capital finanziert. Verglichen mit den USA sind die Zahlen für Europa verhältnismäßig gering, 2013 wurden in den USA mit rund 30 Milliarden Dollar und über 4.100 Deals die zehnfache Menge an Risikokapital vergeben.9 Das auf den einzelnen Deal entfallende Kapital ist in den USA drastisch höher, wodurch sich die Erfolgswahrscheinlichkeit der Investments erhöht. Es gilt also nicht nur Masse sondern auch Qualität zu fördern. In Europa nimmt Luxemburg eine führende Rolle im Venture Capital Bereich ein.
Unterschiede bei der Investitionsentscheidung
Die Investitionsentscheidungen von Venture Capital Fonds und Business Angels unterscheiden sich in gewisser Hinsicht, obwohl beide das Ziel verfolgen, Kapitalgewinne durch den Erwerb von Anteilen zu erwirtschaften. Aufgrund der Tatsache, dass Venture Capital Fonds sehr gewinnorientiert investieren, sind finanzielle Prognosen in der Investmententscheidung für sie wichtiger als für Business Angels. Firmen werden bei Venture Fonds häufig an Zielen oder mit Meilensteinen gemessen. Der große Unterschied liegt in der Bewertung der unterschiedlichen Risiken. Wagniskapitalgesellschaften berücksichtigen in erster Linie das Marktrisiko, wie etwa unvorhersehbare, existenzbedrohende Ereignisse durch Konkurrenz, Patente oder rechtliche Restriktionen. Business Angels legen dagegen mehr Wert auf die Fähigkeit des Gründerteams, den vereinbarten Pflichten nachzukommen und die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Sie sind in der Regel näher am Gründerteam und arbeiten manchmal für gewisse Zeit im Unternehmen mit. Das Marktrisiko wird in diesem Fall durch die Kompetenzen der Gründer minimiert. Für Fondsgesellschaften spielt dies nur eine untergeordnete Rolle, da sie bei Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten das Management in Startups austauschen. Studien belegen, dass Business Angels bei der Investitionsentscheidung vor allem auf die passende „Chemie“ mit den Gründern achten und weniger auf die Expertise, da sie selbst aktive Unterstützung mit ihrem Wissen leisten möchten.10
Zusammenfassend investieren Business Angels mehr in die Menschen hinter den Startups und in die gemeinsame Vision. Venture Capital Fonds sehen sich mehr als Beschleuniger und professionelle Partner, wenn es darum geht eine Firma international zu skalieren, mit dem Ziel das Unternehmen zu einem hohen Preis zu verkaufen. Für Unternehmer ist es entscheidend, den richtigen Investor zur richtigen Zeit anzusprechen. Abhängig von der Phase in der sich ein Startup befindet, verhelfen sowohl Venture Capital Fonds als auch Business Angels zum Erfolg.
1 www.austrianstartups.com/VisionenFuerStartupsInOesterreich.pdf
2www.wirtschaftsblatt.at/home/life/dossiers/start_up/1457619/Eine-Neugrundung-bringt-sieben-neue-Jobs
3 Speedinvest Startup Report 2013
4 www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/574792_Mangel-an-Risikokapital-verbaut- Wachstumschancen.html
5 www.kmuforschung.ac.at/index.php/de/
6 “Best Practice Guidance for Angel Groups – Deal Screening”: Shira Cohen; Angel Capital education foundation, 2007
7 “Venture capital and private equity: a review and synthesis”: Mike Writgh, Ken Robbie; Journal of Business Finance & Accounting, 1998 “Trade Offs in the investment decisions of European venture capitalist”: Dan Muzyka, Sue Birley; Journal of Business Venturing, 1996
8 http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/
9 www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=103
10 “What do investors look for in a businessplan? A comparison of the Investment Criteria of Bankers, Venture Capitalists and Business Angels”: Colin Mason, Matthew Stark; International Small Business Journal, 2004
Christian Umscheid
„Als Unternehmen musst du immer die Balance zwischen Ruhe, Qualität und Geld schaffen, denn ansonsten bekommt eine Seite schnell die Oberhand.“ Präzise wie ein Uhrwerk arbeitet Christian Umscheid und erfüllte sich so seinen Traum einer eigenen Uhrenmanufaktur.
© Alfred Wimmer
Kurzbiographie
Christian Umscheid ist ein großer Idealist. Auf den ersten Blick wirkt er zurückhaltend, doch eine Minute später spricht er mit ansteckender Leidenschaft über die Konstruktion von Armbanduhren. Man kann sich fast vorstellen, dass er mit seiner Art Uhren zu bauen, diesen etwas Magisches verleiht. Begonnen hat er seine Karriere bereits im Alter von 15 Jahren an der Fachschule für Präzisions- und Uhrentechnik im niederösterreichischen Karlstein. Seit 30 Jahren treibt ihn diese Leidenschaft an. Zuletzt verantwortete er in Österreich den Service von Audemars Piguet, einem der weltweit renommiertesten Uhrenhersteller. Im Interview spricht er über das kühne Unterfangen, hierzulande eine Manufaktur zu gründen und ermöglicht Einblicke in die höchste Uhrmacherkunst, die nur wenigen Menschen bekannt ist.
Zum Unternehmen
Montre Exacte (ME) wurde 2011 von Christian Umscheid gegründet. Zuvor arbeitete er zwölf Jahre für die Uhrenmanufaktur Audemars Piguet. ME fertigt Uhren in der höchsten Qualitätsstufe, „Haute Horlogerie“, an. Der Standort der vierköpfigen Manufaktur ist im niederösterreichischen Poysdorf. Die erste Uhr von Montre Exacte ist die „weinVierteluhr“, Design und Verarbeitung ist eine Hommage an das Weinviertel.
Erfolgsgründer Interview
Eine Uhrenmanufaktur im Top-Level-Bereich wird nicht jeden Tag gegründet. Wann hast du den Entschluss dazu gefasst?
Christian Umscheid: Jeder Uhrmacher träumt davon, Uhren zu bauen. Konkret ist bei mir der Entschluss vor fünfzehn Jahren geworden. Da habe ich begonnen, meine Kernthemen zu suchen, die ersten konstruktiven Lösungen skizziert und dann habe ich gelernt, das Ganze auch umzusetzen. Ich habe die ganze Schule durchgemacht und das neben meinem Beruf im Reparaturservice bei Audemars Piguet1 in Österreich. Da hat einfach eine Maschine begonnen in mir zu arbeiten und die hat mich dorthin getrieben. Manchmal war das mehr gewollt, manchmal mehr ungewollt, dann hat es Phasen gegeben, in denen ich die Idee habe schleifen lassen, und dann gab es Phasen, in denen ich mich drei oder vier Jahre ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe. 2011 gab es dann die letzte Wegkreuzung für mich. Audemars Piguet hat mir damals angeboten, für sie in der Schweiz zu arbeiten. In der Manufaktur einer der besten Uhrenherstellern der Welt! Für mich war das Ermutigung, dass ich selbst Uhren bauen kann.
Deine Expertise hast du also bei Audemars Piguet erworben?
Umscheid: Zwölf Jahre lang habe ich für AP den Service in Österreich gemacht. Die letzten zwei Jahre war ich technisch so eine Art Problemsucher für die Manufaktur. Wenn eine Uhr nicht funktionierte, wurde sie zu mir geschickt. Ich habe mich da voll rein gearbeitet und immer Lösungen für Probleme gefunden. Das hat sich herumgesprochen und als AP mit einem neuen Uhrwerk qualitative Turbulenzen hatte, war die oberste Geschäftsführung bei mir zu Besuch. Ich wurde beauftragt, Fehleranalysen für sie zu erstellen. Die haben sie mit dem hausinternen Labor abgeglichen und das Ergebnis hat sich zu 90 Prozent gedeckt. Nur hat das Labor ein Jahr dafür gebraucht und ich vier Wochen!
Exaktes Beobachten zeichnet dich aus?
Umscheid: Ja. Ich habe AP immer genau sagen können, wo die Probleme liegen. Der CEO hat mich irgendwann einmal gefragt, woher ich das alles überhaupt weiß. Ganz einfach deshalb, weil ich mir die Produktion zigmal angeschaut habe. Ich habe mir die Werkbänke bei Audemars Piguet angeschaut, wie die Leute arbeiten, ob es ausreichend Ruhe im Atelier gibt und wie die Produktionsprozesse für Uhren und Uhrwerke funktionieren. Daraus habe ich mir meine Meinung gebildet und so habe ich mich auch auf meine eigene Uhrenmanufaktur vorbereitet.
Die du dann 2011 gegründet hast. Wie kam es zu dem Namen Montre Exacte?
Umscheid: Ich wollte immer, dass der Name für etwas steht. Montre ist auf Französisch die Uhr und Exacte steht für die Genauigkeit meiner Uhren. Präzision ist eben der Schwerpunkt in meinem Leben. Ich bin extrem genau.
In Österreich ist es wahrscheinlich extrem schwer, so ein hochpreisiges Nischenprodukt zu positionieren.
Umscheid: Ja, das geht in der Schweiz sicher leichter. Da hast du einfach schon die Infrastruktur. Wir müssen dagegen alles selbst organisieren. Beispielsweise haben wir niemanden gefunden, der ein Uhrenbuch in der gewünschten Qualität herstellen kann. In der Schweiz würde ich das einer kleinen Firma übergeben und die Sache wäre erledigt.
Eine Uhrenmanufaktur ist heute ein High-Tech-Arbeitsplatz. Wie viel kostet es, so ein Unternehmen zu gründen?
Umscheid: Zirka eine Million Euro. Es braucht Geld für Maschinen, Konstruktion und 3D-Design. Da kostet ein Tisch mit Inventar und Tools für einen Uhrmacher schnell 70.000 Euro. Ich nehme nur die hochwertigste Ausstattung, denn ich will keine Bastlerwerkstatt sein.
Wie hast du das finanziert?
Umscheid: Wir haben das Geld ganz klassisch über unsere Hausbank in Poysdorf bekommen. Das ging wirklich schnell, weil man mich hier kennt und ich einen ganz genauen Business Plan vorgelegt habe. Ich habe jeden einzelnen Schritt, von der Produktion bis zur Präsentation neuer Modelle, eingetragen. Da steht zum Beispiel genau drinnen, in welchem Jahr ich welche Uhr produzieren möchte. Für diese Vorbereitung habe ich mir viel Zeit genommen. Die Produktion läuft dafür jetzt wie ein Uhrwerk. Jeder Schritt wurde im Zeitplan eingehalten.
Waren private Investoren nie eine Option?
Umscheid: Doch, ja. Ich habe in der Schweiz fünf Jahre nur mit der Investorensuche verbracht. Damals noch mit zwei Schweizer Partnern. Nur wollten die Investoren bereits nach vier Jahren einen Return on Investment sehen oder oft auch mindestens 51 Prozent am Unternehmen haben. Letzteres wollte ich nicht und ich habe den Investoren erklärt, dass sie nicht schon nach vier Jahren mit Gewinnen aus ihrem Investment rechnen dürfen. Wenn man schon immer solche Ansprüche gestellt hätte, dann gäbe es heute die gesamte Haute Horlogerie nicht mehr. Wäre es den Gründern von Uhrenmanufakturen nicht oft egal gewesen, dass sie lange Zeit nur wenig verdienen, dann gäbe es diese Unternehmen auch nicht. Es braucht da Leute, die das Geld und die Zeit für das Investment haben.
Angebote gab es aber?
Umscheid: Wir haben Investoren vor uns sitzen gehabt, die uns 45 Millionen Euro geboten haben. Dass es nie etwas geworden ist, lag sicher auch daran, dass ich mit meinen damaligen Partnern kein klares Konzept zustande brachte.
Montre Exacte hast du alleine gegründet. Wie lange hast du gebraucht, um das Werk zum Laufen zu bringen?
Umscheid: 2012 habe ich in Poysdorf das ehemalige Postgebäude gekauft. Ich wusste, ich brauche Raum für die Kunden, für die Administration, für das technische Büro und vor allem ein super reines Atelier auf höchstem Niveau. Und es sollte ein historisches und vorzeigbares Gebäude für meine wohlhabenden Kunden sein. Das Postgebäude war ein richtiger Glücksgriff. Nach den Umbauarbeiten haben wir im Juli 2013 darin zu produzieren begonnen.
Bei einer so langen Vorbereitungs- und Produktionsdauer, zahlt sich das für dich finanziell aus?
Umscheid: Schnelles Geld verdient man sicher in anderen Branchen einfacher. Uhrenmanufakturen die schnell aufgestiegen sind, gibt es heute nicht mehr. Als Unternehmen musst du immer die Balance zwischen Ruhe, Qualität und Geld schaffen, denn ansonsten bekommt eine Seite schnell die Oberhand. In den letzten fünfzehn Jahren war das Geld sehr dominant. Bei einigen Uhrenmanufakturen entscheiden etwa die Finanzchefs, wieweit Qualität und Innovation geht. Dadurch wird aber die Historie und Emotion der Unternehmen ausgehungert, weil nur mehr die finanziell besten Modelle gebaut werden. Im Endeffekt bekommst du dadurch aber eine ganz andere Kundschaft, die nach dem Verkauf viel schwieriger zu bedienen ist. Plötzlich hast du Leute, die sich eigentlich gar keine so teure Uhr leisten können und beim Service zu feilschen beginnen. Dann wundert man sich, wenn Jahre später die Kosten für den Service explodieren.
Fertigst du deine Uhren komplett selber an?
Umscheid: Wir arbeiten nach dem gleichen Produktionsprinzip wie ein Großteil der Uhrenindustrie. Ganz wichtig ist, dass wir selbst die Toleranz des Uhrwerks festlegen. Unsere Werkszeichnungen gehen dann in die Schweiz. Dort haben wir die besten Hersteller überzeugen können, uns zu beliefern. Wir bekommen die Teile im Rohzustand geliefert und machen selbst die Vor-, Fein- und Endmontage. Vormontage bedeutet, dass wir selber die Zahnräder einbauen. Genau darin liegt auch die wahre Kunst der Uhrmacherei. So habe ich eine eigene Methode entwickelt, wie die Getriebe zusammengestellt werden.
Das ist ja auch verständlich. Warum selbst produzieren, wenn man es perfekt zuliefern lassen kann?
Umscheid: Der Druck kommt von den Medien. Die berichten, dass die Uhren ja gar keine In-House Produkte sind, weil zugeliefert wird. Ich halte das für eine ganz schlechte Entwicklung. Viele Uhrenmanufakturen können schlicht die Qualität nicht liefern. Deshalb widersetzen wir uns dem Trend und kommunizieren unseren Kunden lieber offen, dass wir zuliefern lassen. Rolex ist heute eine der ganz wenigen Manufakturen, die tatsächlich alles selber macht. Die haben aber auch 60 Jahre hart daran gearbeitet, dass alle produzierten Teile wirklich ausgereift sind.
Dein erstes Modell ist die weinVierteluhr. Wie kam es zu diesem Namen?
Umscheid: Für unsere erste Uhr haben wir eine für uns vergleichsweise einfache Uhr gebaut. Ich wollte eine Uhr für unsere Heimat bauen. Wir haben einen Mechanismus kreiert, der eine Viertelminute zählt. Das Weinviertel wird symbolisch abgefahren. Wir planen auch schon Modelle für andere Viertel und für Wien.
Die weinVierteluhr kostet 3.600 Euro und ist damit ein exklusives Produkt. Wie wird die Uhr am Markt angenommen?
Umscheid: Eine Jahresproduktion ist bereits vorbestellt und das obwohl die Uhr bisher nur als 3D-Modell existiert! Der Vorteil ist, dass mich die Leute kennen und wissen, dass die Qualität passt. Ich will mit dieser Uhr aber auch ganz bewusst die Zielgruppe ansprechen, die heute vielleicht eine Uhr um 200 Euro trägt. Es geht viel darum, die Emotionen zu wecken und ich glaube, mit der weinVierteluhr können sich die Leute wirklich identifizieren. Das macht mich schon stolz, vor allem weil ich immer wieder gehört habe, dass eine Uhrenmanufaktur im Weinviertel nicht erfolgreich sein kann.
Du hast dich nie von deinem Ziel abbringen lassen. Welche Kreationen werden wir in Zukunft noch sehen?
Umscheid: 2015 kommt die ME001 Collection und bis 2017 wollen wir eine Uhr für den Extremsport bauen. Da wird sich zeigen, wie erfolgreich das ist und ob wir mehr ins Extreme gehen oder ob wir auch Uhren im Segment von 15.000 Euro pro Stück verkaufen können oder ob wir mehr klassische Modelle machen werden.
Der Start ist schon mal geglückt. Aus deinen Erfahrungen: Worauf kommt es bei der beruflichen Karriere an?
Umscheid: Als Uhrmacher rede ich natürlich oft mit sehr erfolgreichen Leuten. Und du erkennst in deren Lebensgeschichten fast immer ein Schema: Sie gehen einen klaren Weg und nehmen sich für ihre Ziele sehr viel Zeit.
1 Audemars Piguet (AP) ist eine 1875 gegründete Uhrenmanufaktur. Das prestigeträchtige Schweizer Unternehmen stellt Uhren in der obersten Preisklasse her.
Mario und Daniel Preining
„Als ich am Bike im Wheelie vorwärts zog, wurden mir erst die neuen Möglichkeiten bewusst.“ Daniel (li.) und Mario Preining bauen mit Ego Kits die leistungsstärksten E-Motorsysteme für Mountainbikes.
© sportalpen.com
Kurzbiographie
Die Brüder Mario und Daniel Preining lieben Sport und Action. Weil sie selbst mit dem Mountainbike nicht nur Berge hinunter sondern auch hinauffahren wollten, entwickelten die Linzer einen neuartigen Elektroantrieb für Bikes. 2011 gründeten sie nach dreijähriger Motorenentwicklung mit vier Partnern die Basis für das heutige Unternehmen Ego Sports GmbH. Im selben Jahr gewannen sie den Brand New Award der ISPO, einer renommierten Fachmesse für Sportartikel und Sportmode. Der 1977 geborene langjährige Mountainbike-Profifahrer Daniel Preining sammelte Erfahrungen als Marketingmanager bei TrueSources, einem Beschaffungsdienstleister für Fahrradteile, bei Adidas im Eventmanagement und bei Merida Bikes in der Produktentwicklung. Auch Mario Preining, Jahrgang 1980, sammelte in seiner aktiven Rennzeit viel Branchenkenntnis und erwarb bei Merida Bikes Erfahrungen im Markenaufbau und in der Produktentwicklung.
Zum Unternehmen
EGO Sports baut die weltweit stärksten E-Motorsysteme für Mountainbikes. Mit 3400 Watt ist eine Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h möglich. Der Firmennamen steht für Easy GOing. 2012 wurden rund 300 „Ego Kits“ weltweit verkauft.
Erfolgsgründer Interview
Ego Kits baut die stärksten E-Bike-Motoren der Welt. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Daniel Preining: Aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Ich wollte ein Downhill-Bike haben, mit dem ich aufwärts fahren kann. Bei mir zu Hause am Salzburger Gaisberg war es bisher so, dass ich mit dem Lieferwagen rauffuhr, mit dem Downhill-Rad runter und mit einer Motocross habe ich anschließend das Auto geholt. Sehr umständlich. Ich wollte das ändern und habe mir überlegt, wie das funktionieren könnte.
Den Antrieb für das Bike habt ihr selbst entwickelt. Woher hattet ihr das technische Know-how?
Daniel: Dank unseres Großvaters haben wir uns schon in der Kindheit viel mit Rädern beschäftigt und laufend neues Wissen angeeignet. Mein Bruder Mario und ich sind jahrelang professionell Radrennen gefahren, von Downhill über Dual-Slalom bis hin zu Trial. Als Rennfahrer in diesem Sport musst du ständig das Material anpassen und weiterentwickeln. Mario und ich waren zudem gut zehn Jahre für Merida tätig, dem weltweit zweitgrößten Fahrradhersteller.
Habt ihr von Merida viel Know-how mitgenommen?
Daniel: Bei Merida konnte ich schon 2001 erste E-Bikes ausprobieren. Damals waren aber Batterie und Technologie unausgereift. Ich selbst habe mit Rasenmähermotoren experimentiert, aber diese Motoren sind wenig effizient. 2007 war die E-Technik so weit um damit ein Produkt umzusetzen. Den ersten Prototypen habe ich in drei Tagen und Nächten gebaut. Mario war anfangs skeptisch. Das änderte sich aber rasch, als er sich das erste Mal auf den Prototypen gesetzt und die Kraft am Hinterrad gespürt hat.
Mario Preining: Ich war tatsächlich skeptisch, als mir Daniel 2008 den ersten Prototypen vorstellte. Dazumals hatte Elektro-Mobilität ein total unsportliches Image und galt eher als Hilfs-Technik für ältere Menschen. Also praktisch das Gegenteil von einem Downhill-Bike! Als ich am Bike im Wheelie vorwärts zog, wurden mir erst die neuen Möglichkeiten bewusst. Es war ein Paradigmenwechsel.
Ihr habt dann gemeinsam gegründet?
Mario: Nach unseren beiden Karrieren in der Bikebranche war das sehr naheliegend. Wir können uns gegenseitig voll vertrauen und das gibt Sicherheit.
Daniel: Unser bisheriges Berufsleben ist glückerweise so verlaufen, dass wir das nötige Wissen für eine eigene Firma mitgebracht haben. Mein Bruder kann für mich einspringen und ich für ihn.
Am Ende wart ihr aber ein größeres Gründerteam.
Daniel: Alleine wäre es viel schwieriger gewesen. Du brauchst ein gutes Team, das alle Bereiche abdeckt. Maximilian Baud kümmert sich um das Design und das Marketing. Uwe Strasser bringt viel Know-how in Fotografie, Design und Web ein und Jakob Mannherz ist mit mir gemeinsam für die Technik zuständig. Er bringt viel Erfahrung aus der Automobilbranche mit. Mario ist Geschäftsführer und für die Marke, das Marketing und das Produktmanagement verantwortlich.
Mario: Als großes Gründerteam waren wir von Anfang an schlagkräftig aufgestellt, selbst mit wenig finanziellen Eigenmitteln und noch bevor erste Umsätze generiert wurden. Es war zudem ein großer Vorteil, dass die meisten Teammitglieder schon selbständig und nicht an ein monatliches Fixeinkommen gewöhnt waren. Das kann eine große Umstellung sein.
Wie lange habt ihr vom Prototypen bis zur Marktreife gebraucht?
Mario: Vom ersten wilden Prototypen-Ride 2008 vergingen noch zwei Jahre, bis wir 2010 auf der Eurobike-Messe unseren Antrieb präsentierten und Ende 2011 nach dem ISPO Brandnew Award1




























