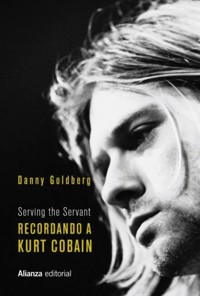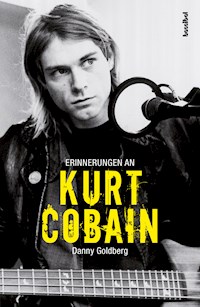
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nachdem sich der Nirvana-Sänger am 5. April 1994 in seinem Haus in Seattle das Leben genommen hatte, war es für Danny Goldberg lange Jahre viel zu schmerzhaft, an Kurt Cobain zu denken. Goldberg hatte den Grunge-Rocker in den entscheidenden Jahren seiner Karriere als Manager betreut und keinen geringen Anteil am weltweiten Erfolg gehabt. In dieser Zeit war er für Kurt vom Business-Berater zum Mentor, Freund und Vertrauten geworden. Cobains Tod, für seine Fans weltweit ein großer Schock, traf auch ihn persönlich hart. Vor kurzem jedoch entdeckte Goldberg beim Sichten der eigenen Archive einen Stoß lange vergessener Dokumente: Fax-Nachrichten, Memos und Briefe, die Kurt ihm während ihrer vierjährigen Zusammenarbeit geschickt hatte. Als Goldberg sich in die alten Materialien vertiefte, reifte in ihm der Wunsch, Kurts Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen als die zahlreichen bisher erschienenen Biografien. Die Legende um die Grunge-Ikone konzentriert sich heute vor allem auf die gequälte Seele, die sich am Leben wundrieb, und auf den problembeladenen Künstler, der mit seinen emotionalen Songs zum Schutzheiligen aller Außenseiter wurde. Sein Manager erlebte Cobain allerdings auch von einer anderen Seite: Als Leadsänger, Leadgitarrist und Songschreiber kontrollierte dieser nicht nur den kreativen Output seiner Band, sondern auch ihr Image, und er wusste genau, wie er die Medien einsetzen konnte, um seine Fans auf genau die Weise zu erreichen, die er sich vorstellte. Kurt war der hochsensibel Image-Schöpfer der ultimativen Anti-Image-Band. In seinem Buch rückt Danny Goldberg daher nicht so sehr Cobains innere Konflikte in den Mittelpunkt, sondern schildert ihn als den genialen Schöpfer eines Kulturphänomens, das eine ganze Generation junger Menschen prägte. Dabei verließ er sich nicht allein auf die Dokumente seiner Sammlung und seine eigenen Erinnerungen, sondern führte zudem zahlreiche Gespräche mit den Schlüsselfiguren in Cobains Leben - mit Musikerkollegen, Familienmitgliedern sowie Medienvertretern - und schuf damit ein facettenreiches, tiefgründiges Porträt einer vielschichtigen Persönlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Aus dem Englischen übersetzt
von Kirsten Borchardt
www.hannibal-verlag.de
Danny Goldberg ist Geschäftsführer und Inhaber der Management-Agentur Gold Village Entertainment. Zuvor war er CEO und Gründer von Gold Mountain Entertainment, als Geschäftsführer für Mercury Records und Atlantic Records tätig und leitete als CEO Air America. Er schrieb zahlreiche Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften wie die Los Angeles Times oder Billboard sowie mehrere Bücher, darunter In Search Of The Lost Chord, Bumping Into Geniuses sowie How The Left Lost Teen Spirit. Er lebt in Pound Ridge, New York.
Impressum
Deutsche Erstausgabe 2019
Titel der Originalausgabe von Ecco, einem Imprint von HarperColins Publishers, NY:
„Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain“
© Daniel Goldberg 2019
Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com
Coverabbildung: © Redferns / Fotograf: Michel Linssen
Übersetzung: Kirsten Borchardt
Lektorat und Korrektorat: Hollow Skai
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-663-6
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-662-9
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Inhalt
Einleitung
Erstes Kapitel: Gold Mountain Entertainment
Zweites Kapitel: Punk Rock 101
Drittes Kapitel: Sub Pop
Viertes Kapitel: Nevermind
Fünftes Kapitel: Die Dinge einfach laufen lassen
Sechstes Kapitel: Courtney Love
Siebtes Kapitel: Internationale
Achtes Kapitel: Heroin
Neuntes Kapitel: Wenn Wünsche wahr werden
Zehntes Kapitel: Vanity Fair
Elftes Kapitel: Citizen Kurt
Zwölftes Kapitel: Incesticide
Dreizehntes Kapitel: In Utero
Vierzehntes Kapitel: Kurt an den Reglern
Fünfzehntes Kapitel: Unplugged
Sechszehntes Kapitel: Abwärts
Siebzehntes Kapitel: Nachspiel
Quellenhinweise
Danksagung
Das könnte Sie interessieren
Widmung
Für meinen Bruder Peter, meine Schwester Rachel und unsere Eltern, Victor und Mimi Goldberg, die Bücher liebten, Schallplatten und ihre Kinder
Im Herbst 2011, während der kurzen Blütezeit von Occupy Wall Street, besuchte ich eines Nachmittags das Basislager der Bewegung, den Zuccotti Park in New York City. Ich war schon fast wieder auf dem Weg nach draußen, als mich ein kleiner, tätowierter Teenager mit gepiercter Augenbraue schüchtern ansprach und fragte, ob ich mich mit ihm fotografieren lassen würde. Damals besuchten viele Prominente das Occupy-Zeltdorf, und ich wandte ein, dass er mich wahrscheinlich mit irgendjemandem verwechselte, aber er schüttelte den Kopf und beharrte: „Ich weiß, wer Sie sind. Sie haben mit Kurt Cobain gearbeitet.“
Unwillkürlich fragte ich mich, ob er überhaupt schon auf der Welt gewesen war, als Kurt sich 17 Jahre zuvor getötet hatte. Was hatte Kurts Musik an sich, dass sie nach so langer Zeit diesen Jugendlichen so berührt hatte? Erfahrungen wie diese Begegnung kennt jeder, der einmal mit Kurt gearbeitet hat. Es ist, als würden seine Anhänger durch die bloße Begegnung mit jemandem, der mit Kurt zu tun hatte, etwas von seinem Geist spüren und sich dann weniger einsam fühlen.
Allerdings ist Kurts Vermächtnis letztlich genau so widersprüchlich, wie er selbst es zu Lebzeiten war. Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, tippte ich den Namen „Kurt Cobain“ in das Suchfeld bei Amazon ein. Neben Postern, Gitarrenplektren, Büchern, Vinyl, Videos und T-Shirts gab es eine „dunkle, ovale, von Kurt Cobain inspirierte Nirvana-Sonnenbrille“, einen Fleece-Bettüberwurf mit Kurt-Cobain-Motiv, ein Kurt-Cobain-Taschenfeuerzeug, einen Abdruck von Kurts Führerschein, eine Pillendose aus Edelstahl, auf deren Deckel Kurt beim Gitarrespielen aufgedruckt war, und eine „Kurt Cobain Unplugged Actionfigur“. Besonders großartig fand ich einen Autoaufkleber mit der Aufschrift: „Ich führe keine Selbstgespräche, ich rede mit Kurt Cobain“. Schade, dass es keinen Sticker gab, laut dem Kurt mit mir gesprochen hätte – den hätte ich sofort gekauft.
Bei der Arbeit an diesem Projekt war mir stets bewusst, dass Kurt mit großem Interesse verfolgt hatte, was über ihn in der Presse stand. Er beklagte sich über Musikjournalisten, die seine Psyche zu analysieren versuchten, und er fand es grässlich, wenn seine Kunst lediglich als gebrochene Spiegelung seiner persönlichen Lebenssituation interpretiert wurde. Dennoch gab er viele hundert Interviews, um das Image, das er für die Band vorsah, so deutlich wie möglich zu transportieren.
Sein künstlerisches Vermächtnis und sein tragischer Selbstmord schufen eine Persönlichkeit, die wie ein Rorschach-Test funktioniert: Wer Kurt kannte, hebt heute meist vor allem jene Aspekte seines Lebens hervor, die das einmal von ihm gefasste Bild stützen. Ich bin da keine Ausnahme. Ich verdanke ihm viel, was meine eigene Karriere betrifft, ich war einer seiner Manager und ein Freund. In meinem Büro betrachte ich oft ein gerahmtes Foto von uns beiden, auf dem er so ein gewisses Funkeln in den Augen hat, dessen Essenz ich mir immer wieder in Erinnerung zu rufen versuche.
Mit der Erinnerung ist es so eine Sache. Viele Details habe ich vergessen. Courtney ging es offenbar ähnlich: Ich hatte mich gerade mit ihr in Verbindung setzen wollen, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, als sie, nachdem sie mit dem Schreiben ihrer Memoiren begonnen hatte, sich aus genau dem gleichen Grund bei mir meldete. 25 Jahre sind eine lange Zeit, und wir werden alle nicht jünger. Eines der größten Probleme besteht für mich darin, dass es sich manchmal schwer feststellen lässt, wo die allgemein bekannte Geschichte endet und wo meine persönliche Erinnerung beginnt. So viele Fakten aus Kurts Leben sind inzwischen in Büchern, Filmen, YouTube-Clips, Box-Sets und Artikeln dokumentiert. Im Internet, das zu Kurts Lebzeiten kaum eine Rolle spielte, findet man heute Seiten mit Set-Listen von fast allen Konzerten, die Nirvana jemals gaben, oft sogar ergänzt um Niederschriften dessen, was die Musiker auf der Bühne zwischen den Songs zueinander sagten.
Einige Ereignisse konnte ich aus meinen Unterlagen rekonstruieren, und davon abgesehen half es mir sehr, mit anderen zu sprechen, mit denen ich in der Zeit meiner Zusammenarbeit mit Kurt zu tun hatte. Wie ich feststellte, hatten viele Leute, die ich deswegen kontaktierte, einerseits große Gedächtnislücken, andererseits einige sehr lebendige, konkrete Erinnerungen, die sie jahrelang als Relikte aus Kurts und ihrem Leben bewahrt hatten. Mir geht es ähnlich; über einigen Stellen meines Gedächtnisses liegt ein vager, impressionistischer Nebel, aber einige Momente stehen mir noch mit beinahe filmischer Klarheit vor Augen. Dennoch sind einige dieser Geschichten durch jahrelanges Weitererzählen inzwischen zu Legenden geworden, und einige Male musste ich feststellen, dass die Lieblingsanekdote eines Bekannten im Widerspruch zu meiner eigenen Erinnerung oder der eines anderen stand.
Abgesehen von dem Eindruck, den er auf Millionen Fans machte, hat Kurt in seinem kurzen Leben Hunderte von Menschen auch persönlich tief berührt. Selbst nach einem Vierteljahrhundert bestehen vielfach noch die alten Gräben – beispielsweise zwischen einigen von Kurts alten Freunden aus den Anfangstagen von Nirvana und Kontakten, die später mit ihm arbeiteten (so wie ich), oder zwischen jenen, die Courtney negativ gegenüberstanden und anderen, die sie mochten (so wie ich). Die meisten, mit denen ich zu meiner Nirvana-Zeit zu tun hatte, waren gern bereit, ihre Erinnerungen an Kurts Leben und seinen Tod zu teilen, aber einige lehnten das auch ab, weil es für sie noch immer zu schmerzhaft war.
Dabei kann ich sie nur zu gut verstehen. In den ersten Jahrzehnten nach seinem Selbstmord mied ich Bücher und Filme über ihn. Erst vor kurzem begann ich, mich intensiv mit jeglichem Material zu beschäftigen, das mir in die Hände fiel. Einige Berichte konzentrieren sich auf die Scheidung seiner Eltern, seine anschließend so unglückliche Kindheit und die Beharrlichkeit, mit der er versuchte, sich im amerikanischen Nordwesten Ende der 1980er Jahre einen Namen zu machen. Kurt selbst hatte mir mehrmals erzählt, wie sehr er sich von seinen Eltern verlassen und wie einsam er sich als Kind gefühlt hatte, aber ich habe den Schilderungen seiner frühen Jahre wenig hinzuzufügen, und ich habe mich bei meiner Recherche nur an Leute gewandt, mit denen ich während meiner Zusammenarbeit mit Kurt in Kontakt stand. Als Kurt und ich uns begegneten, begannen Nirvana schon kurz darauf mit der Arbeit an Nevermind, jenem Album, das die Band nach seinem Erscheinen im September 1991 zu internationalen Superstars machte.
Dieses Buch ist eine subjektive Beschreibung der Zeit, in der ich mit ihm verbunden war, dieser letzten dreieinhalb Jahre seines Lebens, als Kurt Cobain die Werke schuf, für die er heute noch bekannt ist. Nach meiner Auffassung umfasst sein künstlerischer Nachlass weit mehr als Nirvanas größte Hits; ich bin fest davon überzeugt, dass ihm ein Platz auf den obersten Rängen der Rock-Hierarchie gebührt. Anderen Musikern gegenüber war er zudem stets sehr großzügig, und seine Rolle als Person des öffentlichen Lebens nahm er ungewöhnlich ernst. Persönlich war er mir gegenüber sehr freundlich, sowohl im direkten Kontakt als auch auf anderen Ebenen, die sich gar nicht in Worte fassen lassen.
Viele aus Kurts direktem Umfeld empfinden heute noch Zorn darüber, dass er Selbstmord beging. Das respektiere ich, aber ich denke anders darüber. Ich vermisse ihn, und ich werde mich ewig fragen, ob ich irgendetwas hätte tun können, um seinen frühen Tod zu verhindern. Aber soweit ich sagen kann, gibt es weder in der Medizin noch in spirituellen Traditionen oder den Werken großer Philosophen eine Erklärung dafür, weswegen manche Menschen ihr eigenes Leben willentlich beenden und andere nicht. Während des bittersüßen Prozesses, mich an sein Leben und sein Werk zu erinnern, bin ich immer stärker zu dem Schluss gelangt, dass sein Selbstmord kein moralisches Versagen darstellte, sondern auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen war, die weder er noch jemand in seinem Umfeld erfolgreich behandeln oder heilen konnte. („Erkrankung“ verwende ich hier nicht wie ein Arzt, sondern als Platzhalter für eine Macht, die meiner Meinung nach von niemandem kontrollierbar war.)
Ich zählte nicht zu denen, mit denen Kurt Musik machte, ich teilte auch seine tiefe Verwurzelung im Punk Rock nicht, und wir nahmen auch nie gemeinsam Drogen. Dennoch arbeitete ich mit ihm an dem wichtigsten Kreativ-Projekt seines Lebens, einem Werk der internationalen Popkultur, das den Rock völlig umkrempelte und für viele seiner Fans auch das Männlichkeitsbild neu definierte.
Trotz der elenden Zustände, in denen er in seinen schlimmsten Zeiten lebte, und der grotesken Realität seines Todes erinnere ich mich größtenteils auf eine beinahe romantische Art und Weise an Kurts kreative und idealistische Seite. Es gab mindestens eine Begebenheit, bei der ich diesem Impuls blindlings nachgab und dabei viel zu wenig Rücksicht auf die Trauer und die Empfindungen anderer Freunde nahm. Ich hielt die letzte Trauerrede bei der privaten Beerdigungsfeier, die Courtney organisiert hatte, nachdem sein Leichnam gefunden worden war. In Nirvana – Die wahre Geschichte schrieb der britische Rock-Journalist Everett True darüber: „Danny Goldberg hatte bei Kurts Beerdigung eine Rede gehalten, die mir genau vor Augen geführt hatte, wieso der Sänger die Waffen gestreckt hatte. Die Rede hatte nichts mit der Realität oder mit dem Mann, den ich gekannt hatte, zu tun. Er beschrieb Kurt darin als Engel, der in menschlicher Gestalt auf die Erde kam, der für dieses Leben zu gut war, und das war der Grund, weshalb er nur so kurze Zeit bei uns sein konnte. So ein ausgemachter Blödsinn! Kurt war so nervig und schlecht gelaunt und angriffslustig und ungezogen und lustig und langweilig wie wir alle.“
Kurz, nachdem sein Buch erschien, begegneten Everett und ich uns bei einer Musikbusiness-Konferenz in Australien, und wir stellten fest, dass wir mehr gemeinsam hatten als erwartet, was unsere Gefühle für Kurt betraf. Dennoch ist mir bewusst, dass meine Trauerrede einigen anderen ähnlich übel aufgestoßen war wie ihm.
Ich denke, die verschiedenen Sichtweisen enthalten alle einen Teil der Wahrheit. Kurt war eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit. Er litt an Depressionen, er war ein Junkie und ein schöpferisches Genie. Er konnte beißend sarkastisch sein oder in tiefe Verzweiflung verfallen, aber er hatte auch eine ausgesprochen romantische Seite und war sehr überzeugt von der Qualität seines Werks. Kurt war ein bisschen schlampig und chaotisch und hatte sich einen gewissen Blödel-Humor erhalten. Er mochte noch immer denselben Junkfood, den er als Kind gegessen hatte, und er liebte es, den ganzen Tag im Schlafanzug herumzulaufen. Aber seine Gammler-Erscheinung lenkte oft von dem ausgeprägten Intellekt ab, den er besaß.
Mark Kates von Geffen Records, der dort zu den Mitarbeitern zählte, die den engsten Kontakt zu Kurt pflegten, sprach aus, was viele dachten, als er mir mit bewegter Stimme anvertraute: „Zwei Dinge werden bei Kurt oft vergessen. Zum einen, dass er sehr witzig war. Und zum anderen, dass er unglaublich klug war.“
Kurt verachtete Menschen, die ihn nicht respektierten, und er konnte schlecht gelaunt und unangenehm sein, wenn er Schmerzen hatte, aber meistens verströmte er eine Freundlichkeit, wie man sie bei Genies oder Stars selten findet. Die meiste Zeit war er, wenn ich das so sagen darf, ein netter Kerl.
Das besagte Foto von Kurt und mir, das ich immer wieder ansehe, entstand am 6. März 1992 bei einem Konzert, das zwei seiner Lieblingsbands, Mudhoney und Eugenius, im Palace in Los Angeles gaben. Nevermind, das Album, das Nirvana den großen Durchbruch beschert hatte, war im September 1991 erschienen, und in den fünfeinhalb Monaten, die seitdem vergangen waren, war die Popularität der Band mit einem solchen meteorischen Knall explodiert, wie man ihn in der Musikgeschichte kaum jemals erlebt hatte. Auf einzigartige Weise hatten Nirvana die Energie des Punk und die Anti-Establishment-Haltung der Sex Pistols mit Pop-Melodien verschmolzen, und das genau in dem Augenblick, als sich das Rock-Publikum der ganzen Welt genau nach so etwas sehnte. Kurt gab sich in Interviews oft überkritisch und verglich beispielsweise die Pop-Anteile in seinem Songwriting mit den Bay City Rollers, The Knack oder Cheap Trick, aber ich glaube, in Wahrheit ahmte er vor allem die Beatles nach.
Seit die erste Singleauskopplung aus diesem Album, „Smells Like Teen Spirit“, wenige Wochen zuvor erstmals im Radio gespielt worden war, hatte sich für die Band die gesamte Realität auf surreale, abrupte Weise gewandelt. Zu Beginn ihrer Karriere hatten Punk-Ethos und Sparsamkeit ihr Leben beherrscht, und jetzt reisten sie plötzlich nicht mehr im Transporter, sondern mit dem Flugzeug, und sie schliefen in Hotels anstatt bei Freunden auf dem Sofa. Wenn sie jemanden neu kennenlernten, betrachtete der sie als Star und nicht als verkrachte Existenzen.
Vielleicht hatte Bruce Springsteen zwanzig Jahre zuvor etwas ähnliches erlebt, als ihn Born To Run auf die Titelseiten von Time und Newsweek katapultierte und über Nacht berühmt machte, aber selbst beim Boss dauerte es noch einige Jahre, bis er mit The River tatsächlich ein Nummer-1-Album verbuchen konnte und ihm „Hungry Heart“ den ersten echten Pop-Hit bescherte. Bei Nirvana stellten sich Kritikerlob und Pop-Erfolg zur gleichen Zeit ein, und das war umso bemerkenswerter, da die Band aus der in den USA recht kleinen Punk-Szene stammte, für die sich die amerikanischen Rock-Fans in der Regel nicht besonders interessierten.
Musiker bestimmen ihren kulturellen Einfluss stärker selbst als andere Künstler. Von wenigen Einzelfällen in der Autorenfilmszene abgesehen, sind Schauspieler abhängig von den Drehbüchern anderer. Selbst die größten Filmstars, Schriftsteller und Maler haben nicht die Gelegenheit, Abend für Abend vor Tausenden von Bewunderern zu stehen oder sich so unmittelbar in die Köpfe ihrer Fans zu schleichen, wie es bei einem Hit geschieht. Daher ist der Begriff „Rockstar“ von einer besonderen, kraftvollen Qualität. Da Kurt jener seltene Typ Rockstar war, der nicht nur Sex-Appeal oder Unterhaltung verkörperte, sondern noch etwas anderes, betrachteten ihn viele Journalisten und Fans geradezu als Heilsbringer. Es war eine destruktive Sinnestäuschung, die aber auch ihre Vorteile hatte. Kurt war stolz auf das, was die Band erreicht hatte, und es war eine Erleichterung, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben nicht mehr ständig Sorgen um Geld machen musste.
An dem besagten Abend genoss es Kurt, einmal wieder nur Fan zu sein. Mudhoney zählten zu seinen Lieblings-Bands aus Seattle, und er war mit dem Leadsänger, Mark Arm, befreundet. Auch mit Eugene Kelly von Eugenius (die sich früher einmal Captain America genannt hatten, aber von Marvel Comics dazu gezwungen worden waren, ihren Namen zu ändern) verband ihn ein herzliches Verhältnis. Kelly hatte für seine frühere Band, The Vaselines, den Titel „Molly’s Lips“ geschrieben, den Nirvana auf einer frühen Single gecovert hatten. Noch ein Jahr zuvor hatte Kurt zu Arm und Kelly aufgesehen, aber jetzt war er so etwas wie ihr erfolgreicher kleiner Bruder, der sie großherzig anfeuerte.
Obwohl damals mehrmals am Tag Nirvana-Videos auf MTV liefen, wurde Kurt von den anderen Zuschauern nicht bedrängt. Vielleicht lag es daran, dass er mit seinen einsdreiundsiebzig und der durch Skoliose leicht gebeugten Gestalt in der Menge unterging; außerdem zog er sich noch immer so an wie zu der Zeit, als er völlig pleite gewesen war, und mit seinen zerrissenen Jeans und Chucks fiel er überhaupt nicht auf, zumal er keinen Klüngel von Bewunderern oder gar Bodyguards um sich hatte. Dennoch vermute ich, dass einige Fans ihn durchaus erkannten, aber spürten, dass er seine Ruhe haben wollte, um wie sie die Musik zu genießen.
Kurt hatte gerade einen Entzug hinter sich und war, soweit ich das beurteilen konnte, clean. Seine Augen waren klar, und das war ein enormer Kontrast zu dem deprimierten, verdunkelten, leeren Heroinblick, den ich an ihm wahrgenommen hatte, als ich Nirvana bei ihrem Auftritt in der Fernseh-Show Saturday Night Live gesehen hatte. Kurt und Courtney hatten sich beide einer Behandlung unterzogen, und offenbar hatte sie angeschlagen. Zumindest in diesem Moment war er glücklich, da bin ich mir sicher.
In einer Pause standen wir beide unbedrängt in einer Ecke auf der Empore, die Zuschauern mit Gästeliste-Pässen vorbehalten war, und Kurt entdeckte einen Fotografen, legte den Arm um meine Schultern und sagte: „Komm, wir machen ein Foto“, als ob er gewusst hätte, dass es ein Augenblick war, den ich nicht vergessen wollte.
Courtney war bereits schwanger und kurz zuvor mit Kurt in eine neue Wohnung in der Alta Loma Terrace in den Hollywood Hills gezogen, und Kurt kam nun kurzfristig der Gedanke, dort nach dem Konzert noch eine Party zu geben. Er hatte viel Spaß an der Vorstellung, einmal so zu tun, als sei er wirklich erwachsen. Die Wohnung war schwer zu finden. Das Haus lag in einem verwinkelten Gebiet von kleinen Gässchen und konnte nur zu Fuß über Treppen oder einen Fahrstuhl erreicht werden. Damals hatte kaum jemand GPS, und Kurt hatte keine Wegbeschreibung gegeben, von daher kamen nur sehr wenig Leute, aber dennoch war die Stimmung großartig. Es war schön zu sehen, dass sich Kurt und Courtney zumindest kurzzeitig wirklich wohl in ihrer Haut fühlten. Diese friedliche Zeit dauerte jedoch nicht lange. Nur eine Woche später gab Courtney der Journalistin Lynn Hirschberg das erste einer Reihe von Interviews für ein Porträt im Vanity Fair, das bei seinem Erscheinen die Welt der beiden völlig aus den Angeln hob und dessen negative Auswirkungen noch jahrelang spürbar blieben.
Als Kurt und ich uns kennenlernten, war ich 40 und er 23. Wäre er noch am Leben, wären wir heute beide Männer mittleren Alters, aber damals war ich alt und er jung. Kurt befand sich noch in dem Stadium, in dem sich Rockmusikern in ihren Songs und ihrer Haltung stark davon beeinflusst zeigen, wie man sich als Teenager gefühlt hat. Ich hingegen war ein abgewichster Veteran mit zwanzig Jahren Rockbusiness-Erfahrung, mit einem Kind, einer Hypothek und einem Job in einem großen Unternehmen. Im Jahr zuvor hatte ich bei der Grammy-Verleihung einen echten Höhepunkt meiner bisherigen Karriere erlebt, als mich Bonnie Raitt, die den Preis für das beste Album erhielt, in ihrer Dankesrede erwähnte. Kurts Persönlichkeit hingegen war geprägt von der Punk-Szene des amerikanischen Nordwestens, die dem Establishment mehr als kritisch gegenüberstand und die für konventionelle Showbiz-Rituale wie Preisverleihungen nur Verachtung übrighatte.
Kurt hatte ein feines Gespür dafür, wie er alle Aspekte der Rockmusik miteinander in Einklang bringen konnte. Er schrieb die Musik und die Texte für Nirvana. Er war der Leadsänger und der Leadgitarrist. (Bei den meisten Rock-Bands teilen sich mehrere Bandmitglieder diese Aufgaben, wie Jagger und Richards bei den Rolling Stones oder Page und Plant bei Led Zeppelin. Abgesehen von Kurt war Jimi Hendrix das einzige Mitglied in einer Superstar-Band, der all das allein übernahm.) Kurt kontrollierte bei der Produktion der Nirvana-Aufnahmen jedes Detail. Er entwarf die Cover selbst, gestaltete sogar viele der Band-T-Shirts und schrieb die Rohfassungen der Drehbücher für die Musikvideos.
Nevermind, jenes Album, das Nirvana den Durchbruch brachte, hat sich inzwischen über 15 Mio. mal verkauft, aber der bloße kommerzielle Erfolg birgt ebenso wenig einen Schlüssel für Kurts Geheimnis wie eine Auflistung seiner musikalischen Fähigkeiten. Er war ein ausgezeichneter Gitarrist, aber beileibe kein Hendrix. Seine Stimme war kein bisschen gekünstelt, sondern hemmungslos und wild und konnte sowohl Verletzlichkeit als auch Kraft transportieren, aber die Rock-Szene hat viele große Sänger hervorgebracht. Auf der Bühne verstand er das Publikum zu fesseln und mitzureißen, aber es gab dennoch andere, dramatischere Frontmänner. Er zählte zu den wenigen Songwritern, die wussten, wie man poppige Songstrukturen mit Hard Rock verbindet, aber das beherrschten auch die Rolling Stones und einige andere Bands. Er war ein besserer Texter, als er selbst zugeben wollte, erreichte aber nicht die Qualität eines Bob Dylan oder Leonard Cohen. Er war ein Moralist, aber kein Kreuzritter.
Kurts Bewunderung für die Beatles schloss auch die holistische Beziehung mit ein, die vor allem John Lennon mit der riesigen Fan-Gemeinde aufgebaut hatte. Mir erschien es, als ob Kurt die gesamte Bandbreite seines öffentlichen Daseins als Kunst betrachtete, jeden Live-Auftritt, jedes Interview und jedes Foto. So kritisch er dem Ruhm generell auch gegenüberstand, so sehr war er dennoch bereit, ihn effektiv zu nutzen. Er zählte zu den wenigen Künstlern in der Rock-Geschichte, der simultan durch verschiedene kulturelle Ausdrucksformen kommunizierte: durch die Energie des Hard Rock, die Integrität des Punk, die ansteckende Vertrautheit von Pop-Songs und den inspirierenden Appeal eines sozialen Bewusstseins. Anfang der Neunziger hatte Kurt zudem jene Rolle inne, die Allen Ginsberg, als er Jahrzehnte zuvor über Bob Dylan sprach, als „die unkonventionelle Fackel der Erleuchtung und Selbstermächtigung“ bezeichnet hatte.
Aber der verklärte Blick, den beispielsweise der Jugendliche zeigte, der mich im Lager von Occupy Wall Street ansprach, ist auf etwas anderes zurückzuführen: Kurt brachte anderen Menschen, vor allem den Außenseitern, eine einzigartige Empathie entgegen. Er konnte den Fans das Gefühl vermitteln, dass es eine Kraft im Universum gab, die sie so akzeptierte, wie sie waren. Sie hatten den Eindruck, als würden sie ihn wirklich kennen – und umgekehrt er sie auch.
Meiner Meinung nach findet sich ein vergleichbares Phänomen nicht im Bereich des Rock, sondern eher in den Romanen von J.D. Salinger, besonders in Der Fänger im Roggen. Ähnlich wie in jenem literarischen Klassiker der 1950er Jahre gab Kurts Werk den Underdogs ihre Würde zurück und knackte dabei derart den Code der Massenkultur, dass Millionen sich darin wiederfinden konnten. Die Reagan-Ära, die Kurts Generation und die damalige Indie-Szene maßgeblich prägte, ist schon lange vorbei, aber auch 25 Jahre nach Kurts Tod ist es sein poetisches, ungefiltertes Verständnis für den Schmerz der Jugend, das junge Menschen dazu bringt, Nirvana-T-Shirts zu tragen, weil für sie damit ein gewisses Statement verbunden ist.
Kurt war viel mehr als die Summe seiner Dämonen. Eine Zeichnung in einem seiner Tagebücher trug die Bezeichnung „die vielen Stimmungen des Kurdt Cobain: Baby, Pissy, Bully, Sassy“ – übersetzt in etwa „Baby, Nervensäge, Grobian, Wirbelwind“. (Damals probierte er noch verschiedene Schreibweisen seines Vornamens aus.) In einem Artikel in der Zeitschrift Spin zum zehnten Jahrestag von Kurts Tod bezeichnete ihn John Norris als „Punk, Popstar-Helden, Opfer, Junkie, Feministen, Rächer-Nerd, Klugscheißer“.
Kurts langjähriger Bandkollege und Freund Krist Novoselic sagte mir vor kurzem: „Kurt konnte unglaublich nett und der beste Mensch der Welt sein, dessen Reaktionen mich oft unglaublich berührt haben, aber manchmal war er auch wirklich gemein und hinterhältig.“
Auf mich wirkte Kurt manchmal wie ein verwirrter Weiser vom anderen Stern, aber ebenso wie ein sehr fokussierter Kontroll-Freak, ein verletzliches Opfer körperlicher Schmerzen oder gesellschaftlicher Ablehnung, ein doppelzüngiger Junkie, ein liebender Ehemann und Vater oder ein aufmerksamer Freund. Manchmal wechselte er in Sekunden von paranoid zu übernatürlich selbstbewusst, und er wusste durchaus die Werbetrommel für sich selbst zu rühren. Mal war er ein sensibler Außenseiter, ein selbstkritischer Normalo, der stille, aber unbestreitbare Mittelpunkt der Aufmerksamkeit oder ein verzweifelter Kindmann, für den das Leben keine Bedeutung zu haben schien. Kurt vermittelte seine Gefühle oft ohne Worte. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an die verschiedenen Gesichter, die er zeigen konnte: gestresst, amüsiert, gelangweilt, genervt, zugewandt und gebend. All das konnte man in seinen durchdringenden, blauen Augen lesen.
Im Laufe der Jahre habe ich mich vor allem mit Kurts Rolle als Künstler beschäftigt. Als er noch klein war, ging seine Familie davon aus, dass er später vielleicht einmal Grafiker werden würde, und er beschäftigte sich bis zu seinem Tod mit Zeichnungen und Skulpturen. „Ich war der beste Künstler von Aberdeen“, sagte er mir einmal mit einem schiefen Lächeln, „aber ich glaube, in einer großen Stadt oder draußen in der Welt hätte ich keinen Eindruck hinterlassen. Für dieses Level reichte es bei mir nicht.“ In der Musik, auf die sich seine Kreativität in erster Linie konzentrierte, sah es anders aus: In diesem Bereich war er außergewöhnlich, und das wusste er. Als ich Kurt kennenlernte, strahlte er die stille Überzeugung aus, dass seine Musik von einer ganz besonderen Güte war, und darin bestärkten ihn sein gesamtes Umfeld und auch andere Musiker.
Vermutlich sind die meisten Leser dieses Buches Nirvana-Fans, aber hin und wieder stoße ich immer noch auf Leute, die nicht begreifen, was an der Band so großartig gewesen sein soll. Geschmäcker sind verschieden, und wir alle fühlen uns auch später im Leben latent zu jenen Dingen hingezogen, die wir schon in der Schulzeit mochten.
Wie groß Kurts Einfluss war, lässt sich quantitativ vielleicht allenfalls mit den Statistiken des Streaming-Dienstes Spotify belegen, der seit 2008 Musik anbietet, als Kurts Tod schon 14 Jahre zurücklag. Hier ist eine Aufstellung der weltweiten Zugriffszahlen seit den Anfangstagen von Spotify auf die beliebtesten Songs von Kurt und seinen Zeitgenossen, aber auch vielen vor und nach Nirvana aktiven Künstlern (die Zahlen stammen aus dem Mai 2018):
Madonna, „Material Girl“ – 56 Mio.
Prince, „Kiss“ – 80 Mio.
N.W.A., „Straight Outta Compton“ – 113 Mio.
Pearl Jam, „Alive“ – 116 Mio.
Bruce Springsteen, „Dancin’ In The Dark“ – 126 Mio.
Soundgarden, „Black Hole Sun“ – 139 Mio.
2Pac, „Ambitionz Az A Ridah“ – 144 Mio.
U2, „With Or Without You“ – 210 Mio.
Foo Fighters, „Everlong“ – 210 Mio.
R.E.M., „Losing My Religion“ – 229 Mio.
Radiohead, „Creep“ – 257 Mio.
Dr. Dre, „Still D.R.E.“ – 275 Mio.
Green Day, „Basket Case“ – 282 Mio.
Michael Jackson, „Billie Jean“ – 353 Mio.
Guns N’ Roses, „Sweet Child O’ Mine“ – 358 Mio.
Nirvana, „Smells Like Teen Spirit“ – 387 Mio.
Das nur so nebenbei.
Für die amerikanische Originalausgabe dieses Buches habe ich den Titel „Serving The Servant“ gewählt, als Hommage an einen Song, den Kurt für das Album In Utero schrieb, nachdem Nirvana plötzlich kommerziell so unglaublich erfolgreich geworden waren. Besonders bekannt ist seine erste Zeile: „Teenage angst has paid off well“, die Teenager-Angst hat sich gut bezahlt gemacht – ein Seitenhieb auf den enormen Erfolg von Nevermind. Kurt erklärte außerdem, dass der Text teilweise auch ein Versuch war, sich über die Beziehung zu seinem Vater Don klarzuwerden, zu dem er keinen Kontakt mehr hatte (und den ich zum ersten und einzigen Mal bei Kurts Beerdigung traf). Für mich spiegelt der Titel, der wörtlich mit „dem Diener dienen“ übersetzt werden kann, wie es war, mit Kurt zu arbeiten – er war der Diener einer Muse, die nur er sehen und hören konnte, aber deren Energie er in eine Sprache übertrug, mit der sich Millionen identifizierten. Meine Aufgabe und die anderer Mitarbeiter war es, ihn im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei zu unterstützen.
Kurt und ich begegneten uns zum ersten Mal im November 1990 in Los Angeles. Er und die anderen Mitglieder von Nirvana, Krist Novoselic und Dave Grohl, trafen mich und meinen jüngeren Partner, John Silva, im Büro unserer Agentur Gold Mountain Entertainment auf dem Cahuenga Boulevard West ganz in der Nähe von Universal City.
Die ersten Worte, die ich von Kurt jemals hörte, war ein aus tiefstem Herzen kommendes „auf gar keinen Fall“: Damit beantwortete er meine Frage, ob die Band bei Sub Pop bleiben wollte, dem unterfinanzierten, aber äußerst renommierten Indie-Label aus Seattle. Dort waren ihre ersten Aufnahmen erschienen, so auch ihr Debütalbum Bleach, das in der Punk-Szene so hohe Wellen geschlagen hatte, dass nun die großen Plattenfirmen versuchten, die Band von dort wegzulocken.
Bei diesem Gespräch schwieg Kurt zunächst und überließ Krist das Reden. Aber seine entschiedene Antwort gab mir einen ersten Hinweis auf die Dynamik innerhalb der Band. Dave war ein virtuoser Rock-Schlagzeuger, der Nirvana musikalisch auf eine ganz andere Ebene führte. Krist hatte die Band einige Jahre zuvor mit Kurt gegründet und war mit ihm, was Politik und Kultur anging, meist einer Meinung. Die drei machten gemeinsam brillante Musik und waren sich auch darüber einig, dass die Band sowohl in die Indie- als auch in die Rock-Szene passen könnte, aber Kurt hatte in allem das letzte Wort.
In den frühen Tagen des Rock’n’Roll hatten sich Manager häufig nicht unbedingt durch Kompetenz und Ehrlichkeit ausgezeichnet. Elvis Presleys Manager, Colonel Tom Parker, galt als manipulativer Strippenzieher, der seinen berühmten Klienten ausnutzte und ihn wie ein Kind behandelte, während er sich weit über Gebühr die eigenen Taschen füllte. Der erste Manager der Beatles, Brian Epstein, hatte ein sehr gutes Verhältnis zur Band und war der erste Geschäftsmann, der erkannte, dass er ein ganz besonderes Juwel vor sich hatte, aber rückblickend betrachtet fehlten ihm Fachwissen und Erfahrung, um für ihre Karriere das Optimum an Einkommen und Einfluss herauszuholen.
Später wurde die Bezeichnung „Manager“ für die verschiedensten Tätigkeiten benutzt, je nach Dienstleister und Künstler. Bei Schauspielern übernehmen oft die Agenten jene Art von Karriereberatung, die in der Musikszene den Managern obliegt. Booker hingegen kümmern sich nur um die wichtige, aber überschaubare Aufgabe, Auftritte zu arrangieren, und haben nur selten viel mit Plattenfirmen, Musikverlegern oder Medienstrategien zu tun: Darum kümmern sich die Manager. Musikmanager dienen als Bindeglied zwischen den Künstlern und ihren Anwälten und Steuerberatern, aber auch den Bookern, vor allem dann, wenn eine Tournee durch verschiedene Teile der Welt ansteht und es gilt, die Vielzahl von Optionen gegeneinander abzuwägen. Mark Spector, der über mehrere Jahrzehnte Joan Baez als Manager betreute, sagte einmal über den Job: „In dieser Position laufen alle Fäden zusammen, und man trägt die ultimative Verantwortung.“
In einigen Fällen fungieren Manager auch als persönliche Berater und Testpublikum für kreative Ideen. Meinen ersten Eindruck von diesem Beruf bekam ich in Don’t Look Back, einem Dokumentarfilm über Bob Dylan, in dem dessen Manager Albert Grossman dabei zu sehen war, wie er voller Begeisterung höhere Auftrittsgagen für seinen Schützling aushandelte. Für mich als jugendlichen Zuschauer war allerdings noch entscheidender, dass Grossman offensichtlich in die Witze, die Dylan auf Kosten uncooler Zeitgenossen machte, bestens eingeweiht war. (Don’t Look Back war übrigens einer von Kurts Lieblingsfilmen.)
Anfang der Siebziger arbeitete ich kurze Zeit für Grossman, und später übernahm ich die Promotion für sein Bearsville-Label. Er vermittelte immer noch den Eindruck, als sei er in jede Menge cooler Geheimnisse eingeweiht. Angeblich handelt Dylans Song „Dear Landlord“ von ihm, vor allem die Zeile „If you don’t underestimate me, I won’t underestimate you.“ (Wenn du mich nicht unterschätzt, unterschätze ich dich auch nicht.) Grossman gelang es, die Macht von Plattenfirmen, Talentagenturen, Konzertpromotern und Medien zugunsten seiner Klienten, zu denen auch Janis Joplin und The Band zählten, zu beschneiden – so war beispielsweise er es, der Columbia Records verbot, Dylans sechs Minuten langes „Like A Rolling Stone“ auf das radiofreundliche Format zu kürzen, auf dem die Top-40-Sender in der Regel bestanden. Der Song wurde dennoch ein riesiger Hit.
Ein anderes frühes Vorbild war Andrew Loog Oldham, dessen Name mir zum ersten Mal begegnete, als ich die Liner Notes früher Rolling-Stones-Alben wie December’s Children (And Everybody’s) las. Damals managte Oldham die Stones nicht nur, er produzierte auch ihre Alben. Was war das für ein Typ, fragte ich mich, und wie konnte ich an einen solchen Job herankommen?
Mein Mentor im Musikgeschäft wurde schließlich Led Zeppelins Manager Peter Grant, für den ich mit Anfang zwanzig arbeitete. Grant ging in der Unterstützung seiner Künstler noch einen Schritt weiter als Grossman. Als ehemaliger Profi-Wrestler von 130 Kilo mit derbem Cockney-Akzent wirkte er einschüchternd genug, um seinen Schützlingen ein wesentlich größeres Stück vom musikalischen Kuchen zu sichern, als Künstler je zuvor erhalten hatten. Bis dahin hatten viele Veranstalter den Künstlern 50 Prozent der Nettoeinnahmen ihrer Konzerte gezahlt. Grant bestand auf 90 Prozent, und damit änderte sich das Geschäft von Grund auf. Ich machte mir seine Einstellung schnell zu eigen: Scheiß auf alle anderen. Es zählt allein, was die Band will.
Der Ausdruck „Manager“ führt ein wenig in die Irre, weil er ein wenig so klingt, als hätten wir unseren Klienten etwas zu sagen, dabei ist es genau anders herum. Wir bieten eine Dienstleistung, und der Künstler ist der Boss. Einige Jahre nach Kurts Tod wurden Andrew Loog Oldham und ich Freunde. Wir tauschten uns über unsere Künstler aus und sprachen darüber, wie sich unsere Arbeit in den Sechzigern und in den Neunzigern darstellte. Oldham (der übrigens auch Grossman als eines seiner Vorbilder nennt) orakelte dabei: „Man ist nur dann ein ausgefuchster Manager, wenn man einen Künstler betreut, der einen selbst ebenso weit nach vorn bringt wie umgekehrt.“ Colonel Parkers gibt es heute nur noch sehr wenige.
Auch Kenny Laguna, der seit mehr als 25 Jahren Joan Jett managt, bewundere ich sehr. Für ihn hält unsere Arbeit, wie er mir einmal sagte, immer wieder eigentümliche Höhen und Tiefen bereit: „Es ist ein seltsamer Job. An einem Tag habe ich eine Besprechung mit Senator Schumer, weil Joan an einer Veranstaltung des Außenministeriums mitwirken soll, und am nächsten versuche ich herauszufinden, wie man einen Fleck aus ihrem Orientteppich rausbekommt, weil dort die Katze hingemacht hat.“
Da selbst die besten Künstler oft sehr unsicher sind, neigen Manager dazu, ihre Klienten in Watte zu packen, was manchmal zu kontraproduktiven Beschönigungen führt. In Shut Up And Sing, einer Dokumentation über die Dixie Chicks, gibt es eine Szene, in der die Band ihren Manager Simon Renshaw fragt, wie sehr es ihre Karriere beeinträchtigen könnte, dass Sängerin Natalie Maines die Haltung von Präsident George W. Bush zu Beginn des Golfkriegs hart kritisiert und damit viele republikanische, patriotische Fans verprellt hat. Renshaw erklärt ganz gelassen, dass der Aufschrei, wenn überhaupt, nur kurz sein und keine großen Auswirkungen haben würde – ein Irrtum, denn die Anwürfe aus dem rechten Lager verfolgten die Chicks noch das ganze nächste Jahr. Dennoch, ich hätte unter den Umständen genau dasselbe gesagt – schließlich fand das Gespräch unmittelbar vor einem Auftritt statt.
Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn ein Künstler etwas moralisch Untragbares oder Selbstverletzendes tut, dann hat man die Pflicht, ihn davon abzubringen, aber üblicherweise steht man auf der Seite seines Schützlings. Die Manager, denen ich nacheifern wollte, hatten eine idealisierte Version ihrer Klienten in den Köpfen, die sie sowohl dem Künstler selbst als auch dem Rest der Welt vermitteln wollten. Nach dem Konzert eines meiner Klienten fragte mich ein Freund einmal: „Du würdest ihm wahrscheinlich nicht sagen, dass sein Programm zu lang ist, oder?“ Ich erwiderte: „Das würde ich noch nicht einmal mir selbst eingestehen.“
Mitte der Achtziger, als ich Mitte dreißig war, gründete ich meine eigene Agentur Gold Mountain (die englische Übersetzung von Goldberg), und die ersten, für die wir arbeiteten, waren Belinda Carlisle und Bonnie Raitt. 1990 waren wir so gut im Geschäft, dass ich unseren Kader um Künstler erweitern wollte, die ein jüngeres Publikum ansprachen. Mir war nicht entgangen, dass die gegenkulturellen Strömungen in der Musikszene eine immer größere Rolle spielten und längst nicht mehr nur Rock-Kritiker und College-Radiosender interessierten. In den USA nannten wir das immer noch Punk, ein Phänomen, das ich in den Siebzigern zwar wahrgenommen, aber mit dem ich mich nie sehr beschäftigt hatte. Daher heuerte ich John Silva an, der schon mit Ende zwanzig Kritikerlieblinge wie House Of Freaks oder Redd Kross managte. Silva war ein echter Musik-Nerd, der von Fanzines und Vinyl-Singles besessen war. Er kannte viele einflussreiche Persönlichkeiten aus der Punk-Szene, die sich in den Jahren zuvor herausgebildet hatte, und hatte sogar einmal eine Zeitlang mit Jello Biafra, dem legendären Sänger der Dead Kennedys, zusammengewohnt. Davon abgesehen passte Silvas Engagement und sein Ehrgeiz perfekt zu meiner eigenen Arbeitseinstellung.
Nach einigen Monaten unserer Zusammenarbeit übernahmen wir das Management von Sonic Youth, die kurz zuvor bei DGC Records unterschrieben hatten, einem neuen Label-Imprint von Geffen. Die Band hatte zuvor lediglich mit Indie-Plattenfirmen gearbeitet und suchte Unterstützung im Umgang mit den Mechanismen der Musikindustrie, während sie ihr erstes Major-Album Goo vorbereitete.
Sonic Youth genossen dank der Alben und EPs, die sie in den vorangegangenen acht Jahren eingespielt hatten, in der Indie-Szene großen Einfluss und Respekt. Ihr Leadgitarrist Thurston Moore, ein jungenhafter, einsfünfundneunzig großer Typ mit scharfem Verstand, war von den ungewöhnlichen Gitarrenstimmungen des Avantgarde-Komponisten Glenn Branca ebenso beeinflusst wie vom Punk Rock. 1981 hatte Moore die Bassistin und Sängerin Kim Gordon geheiratet, die als ehemalige Kunststudentin die Gegenkultur aus ähnlich intellektualisiertem Blickwinkel betrachtete. Der Gitarrist und Sänger Lee Ranaldo und der Drummer Steve Shelley teilten eine Reihe von musikalischen Vorlieben mit ihren Bandkollegen. Sie alle verbanden die subversive Begeisterung für die Punk-Rebellion mit einer Stilsicherheit und Intelligenz, die ihnen überall in der stark zersplitterten Indie-Welt Freunde und Bewunderer eingebracht hatte.
Mir wurde schnell klar, dass Kim und Thurston ihre Finger am Puls einer Musikszene hatten, die mir bisher verschlossen geblieben war, und daher verbrachte ich so viel Zeit wie möglich mit ihnen. Sie sahen sich selbst innerhalb ihrer Gemeinschaft nicht nur als Künstler, sondern auch als Förderer, und sie gaben regelmäßig jungen Bands die Möglichkeit, sie auf Tour zu begleiten und sich dabei einem größeren Publikum zu präsentieren – beispielsweise auch Nirvana. Kurt betrachtete den Gitarristen als einen seiner Mentoren. In seinen Tagebüchern finden sich viele Einträge mit dem Hinweis „Thurston anrufen“. Als Silva mich zum ersten Mal auf das Trio aus Seattle aufmerksam gemacht hatte, war ich noch zögerlich gewesen, da es normalerweise sehr zeitintensiv war, neue Künstler aufzubauen, und es dementsprechend lange dauerte, bevor sie uns ein Honorar zahlen konnten. Auf Silvas Drängen hin rief Thurston mich an und schlug vor, dass ich es trotzdem mit Nirvana versuchen sollte, und Gott sei Dank hörte ich auf ihn.
Erst im Juni 1991, drei Monate, bevor Nevermind erschien, sah ich Nirvana zum ersten Mal live, bei einem Gig im Vorprogramm von Dinosaur Jr. im Hollywood Palladium. Über die Jahre hatte ich schon unzählige Konzerte gesehen und war daher in der Regel ziemlich abgeklärt, aber dieser Auftritt haute mich um. Zwar waren die meisten Leute wegen des Headliners gekommen, aber Kurt gelang es trotzdem, eine Beziehung zum Publikum aufzubauen, und das, ohne auf die üblichen Klischees zurückzugreifen. Mir erschien es, als sei er in der Lage, seine innersten Gefühle so zu vermitteln, dass sofort ein Gefühl von Intimität entsteht. Bis heute kann ich nicht genau beschreiben, was er tat – nur, wie es sich anfühlte. Es war eine Form der Rock-Magie, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Zwar hatte ich noch keine Vorstellung von dem kommerziellen Tsunami, der uns bevorstand, aber ich wusste eins: Dass ich großes, großes Glück hatte, mit Nirvana arbeiten zu dürfen.
Damals war Gold Mountain eine Management-Agentur mittlerer Größe, die etwa 25 Mitarbeiter beschäftigte und ein paar Dutzend Künstler betreute. Für viele von ihnen leistete ich in erster Linie Organisationsarbeit, aber zu einigen entwickelte ich eine persönliche Beziehung. Und an diesem Abend erkannte ich, dass Kurt für mich eine viel größere Bedeutung haben würde, als ich zuerst geahnt hatte. Als ich nach dem Gig nach Hause fuhr, verglich ich meine aufkeimende Bewunderung für Kurt mit der unbeirrbaren Loyalität, die Peter Grant Jimmy Page entgegengebracht hatte. Ich war begeistert.
In den Jahren nach Kurts Tod hat man mich oft gefragt, wie er denn „wirklich so war“. Nun, manchmal gelang es mir allenfalls, ihn wie durch ein dunkles Glas zu betrachten, das nur Teile seiner Persönlichkeit preisgab, während mir andere verschlossen blieben. Es gab Augenblicke, in denen ich unglaublich leicht zu ihm durchdrang, und andere, in denen ich den Eindruck hatte, dass ich aufgrund seiner angespannten Gefühlslage in seiner Gegenwart unglaublich leisetreten musste. Abgesehen von seinem bereits erwähnten, kaleidoskophaften Charakter gab es bei Kurt immer noch eine verborgene Seite, und dort lag zum Teil auch das künstlerische Genie, das er buchstäblich nicht erklären konnte, aber auch eine tiefe Verzweiflung, gespeist aus einem Schmerz, der zu unerträglich war, um nach außen getragen zu werden.
Von Anfang an war der Band, Silva und mir genau bewusst, welches sensible Gleichgewicht die Band bewahren musste, um die bereits bestehende Fangemeinde nicht zu verprellen und dennoch neue Zuhörer zu gewinnen. Wir hatten keine Ahnung, dass es schon bald Millionen sein würden, aber die jüngsten Erfolge von Jane’s Addiction und Faith No More hatten deutlich gezeigt, dass es viele hunderttausend Rock-Fans gab, die sich zwar bisher noch nicht sehr mit Punk beschäftigt hatten, sich aber nach etwas sehnten, das musikalisch und kulturell mehr zu bieten hatte als die damals populären Rock- und Metal-Bands mit ihren Latexhosen und toupierten Haaren. Es war ein neues, junges Publikum, das sich zum einen für die Gegenkultur interessierte und zum anderen nach Musik suchte, die eine gewisse emotionale Tiefe mitbrachte.
Eine ganze Reihe kleinerer Entscheidungen, die wir im ersten Jahr trafen, waren darauf ausgerichtet, dieses Gleichgewicht zu erhalten, aber Kurt und ich spürten nur selten das Bedürfnis, das ausführlich zu diskutieren. Wir hatten eine ähnliche Grundeinstellung, die sofort für eine enge Verbundenheit sorgte, und auch wenn Kurt später in Interviews Überlegungen zu diesem Thema gern weiter ausformulierte, vermittelte er mir viele seiner Einstellungen in Halbsätzen, indem mit den Augen rollte, das Gesicht verzog oder lächelte. In einer wirklich guten Beziehung zwischen Künstler und Manager muss nicht alles ausgesprochen werden: Man ist sich über die gemeinsamen Ziele klar und verwendet die gesamte Energie auf ihre Umsetzung.
In seinen Tagebüchern schrieb Kurt: „Laut Punk Rock ist nichts heilig. Für mich aber ist die Kunst heilig.“ Dennoch machte er mir deutlich, dass er sich dem Punk in vielen Aspekten emotional tief verbunden fühlte; ihm war es wichtig, was die Menschen aus dieser Subkultur von ihm hielten.
In den 1970ern, als die Ramones und ihre Zeitgenossen die erste Punk-Rock-Welle lostraten, hatte ich in New York gelebt und bereits im Musikgeschäft gearbeitet. Ursprünglich hatte ich als Rock-Kritiker angefangen, aber dann schnell gemerkt, dass meine wahren Talente im Bereich Promotion lagen. Damals war ich mit vielen Journalisten befreundet, die von der Punk-Szene rund um das CBGB besessen waren, und mir gefiel zwar die Energie und auch einiges von der Musik, aber ich war mehr daran interessiert, einen Fuß in die Tür der Mainstream-Musikindustrie zu bekommen. Nachdem es mir gelungen war, einen Job bei Led Zeppelins Label Swan Song zu ergattern, kümmerte ich mich nicht mehr groß um Punk.
Jetzt erkannte ich, dass ich in diesem Bereich dringenden Nachholbedarf hatte, denn wenn ich Kurt als Künstler verstehen wollte, dann musste ich den Kontext der Kultur kennen, die ihn als Heranwachsenden inspiriert hatte, der er Anfang zwanzig noch angehörte und von der er jene Werte übernommen hatte, die er in seinem Abschiedsbrief als „Punk Rock 101“ bezeichnete.
Dem Journalisten Robert Hilburn sagte Kurt 1993: „Ich litt als Kind schwer an Depressionen. Es gab eine Zeit, da weinte ich mich jede Nacht in den Schlaf. Oder ich versuchte, die Luft anzuhalten, damit mein Kopf explodiert, weil ich dachte, dann würde es ihnen endlich leidtun. Damals dachte ich oft, ich würde nicht einmal einundzwanzig.“ In Michael Azerrads Buch Nirvana – Come As You Are sagt Kurt über seine Kindheit: „Ich dachte immer, ich sei adoptiert, und man hätte mich auf einem Raumschiff gefunden. Ich wusste, dass noch Tausende anderer Alien-Babys hier ausgesetzt worden waren, und inzwischen bin ich auch einigen davon begegnet. Eines Tages werden wir herausfinden, weswegen wir eigentlich hier sind.“
Das Gefühl, nicht dazuzugehören, vertiefte sich zusätzlich, da Kurt in der konservativen Holzfällerstadt Aberdeen im US-Bundesstaat Washington aufwuchs, wo er mit seiner sensiblen Künstlerseele schnell zum Außenseiter wurde. Die einzige Band aus Aberdeen, die in der amerikanischen Punk-Szene eine gewisse Beachtung gefunden hatte, waren die Melvins, die persönlich wie auch musikalisch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die frühe Karriere von Nirvana darstellten. Damals kamen selten mehr als ein paar hundert Zuschauer zu einem Punk-Gig, und daher war es für die Fans oft leicht, anschließend mit der Band ins Gespräch zu kommen. Der Leadsänger der Melvins, Buzz Osborne (auch bekannt als King Buzzo), machte Krist Novoselic auf die Indie-Band Flipper aufmerksam, und als ich 2018 mit Krist sprach, schwärmte er noch immer von dem Erweckungserlebnis, das er als Teenager beim ersten Hören des Flipper-Albums Generic gehabt hatte.
1984, mit sechzehn, sah Kurt sein erstes Melvins-Konzert. Wenig später stellte Buzz ein Punk-Mixtape für Kurt zusammen, auf dem sich auch Songs von Black Flag und Flipper befanden. Kurt war völlig fasziniert, hörte die Cassette monatelang jeden Tag und sang die Texte mit. Dem Musikkritiker John Savage sagte er, dass ihm damals zwar die Musik von Mainstream-Rockern wie Led Zeppelin und Aerosmith teilweise durchaus gefiel, aber dass ihm die Texte größtenteils zu eindimensional waren. „Es war oft total sexistisch, wie darin von ihren Schwänzen und von Sex die Rede war. Das hat mich gelangweilt.“ Punk hingegen berührte Kurt; diese Songs spiegelten seine eigene Haltung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Mit großer Erleichterung stellte er fest, dass er zumindest in dieser Hinsicht nicht völlig allein dastand. Es gab eine andere Welt auf diesem Planeten, und er war fest entschlossen, dazuzugehören. Wenig später machte Buzz Kurt und Krist miteinander bekannt. Im Jahr darauf spielte der Melvins-Drummer Dale Crover auf den ersten Nirvana-Demos mit. Und noch ein paar Jahre später stellte Buzz den Kontakt zwischen Dave Grohl und Nirvana her.
Punk-Fans lieben ihre Musik mit absoluter Leidenschaft, und eingeweihte Kreise diskutieren mit fast religiösem Eifer darüber, welche Band aus welchen Gründen gut ist und wie sich Punk überhaupt definieren lässt – Fragen, zu denen ich mich mangels tieferer Einblicke nicht äußern kann. Wenn ich hier über die Musik schreibe, die Kurt in seinen Jugendjahren prägte, dann gebe ich lediglich Wissen wieder, das ich mir als Außenstehender aneignen konnte.
Der Punk der Siebziger, die Subkulturen, die in New York und rund um die Sex Pistols in London entstanden, interessierten Kurt nur am Rande. Er und Krist waren auf der Highschool mit der darauffolgenden Punk-Generation in Berührung gekommen, die in den 1980ern in kleinen Nischen in den USA florierte. Es war eine Szene, die ungeachtet ihrer bescheidenen Größe aus leidenschaftlichen Fans bestand, für die es keine Rolle spielte, dass die Protagonisten von der Musikindustrie weitgehend ignoriert wurden.
In den Jahren 1980 und 1981 – einige Jahre, bevor Buzz das besagte Mixtape für Kurt zusammenstellte – brachten Flipper, R.E.M. und Hüsker Dü ihre ersten Singles heraus, Mission Of Burma und Minor Threat veröffentlichten ihre ersten EPs, die Dead Kennedys und die Replacements ihre ersten Alben, Henry Rollins stieß zu Black Flag, und Sonic Youth und die Butthole Surfers wurden gegründet. Die Alben dieser Künstler tauchten in den vielen „Top 50“-Listen auf, die Kurt in seinen Tagebüchern zur Erläuterung von Nirvanas Einflüssen anlegte. Von diesen Bands sprach er gelegentlich mit einer Bewunderung, die an einen Katechismus erinnerte. Im Gegensatz zu den etablierten Rock-Bands, die sich meist schon in den 1960ern oder 1970ern gegründet hatten, betrachteten die Bands der Independent-Szene kommerziellen Erfolg nicht als Maß aller Dinge und standen der populären Musikkultur zwiespältig gegenüber.
Black Flag waren eine der ersten Bands, die Kurt live erlebte, und wie viele ihrer Zeitgenossen spielten sie schnell und laut. Greg Ginn von Black Flag hatte SST Records ins Leben gerufen, um zunächst einmal die Platten seiner eigenen Band zu veröffentlichen, aber im Laufe der Achtziger wurde SST die Heimat vieler anderer Musiker, die Kurt liebte. Ray Farrell arbeitete lange bei SST und wurde schließlich von Geffen Records angeworben, ein Jahr, bevor Nirvana dort unterkamen. Bei ihrem ersten Treffen sagte Kurt wehmütig zu Farrell: „Um auf SST zu erscheinen, hätte ich getötet.“
SST-Bands bekamen jedoch keine Auftritte in Clubs, die traditionell eher ein Mainstream-Rock-Publikum anzogen, da sie in den konventionellen Musikmedien, an denen sich die Talent-Einkäufer orientierten, kaum stattfanden. Daher mussten SST und andere Indie-Labels wie das von den Dead Kennedys betriebene Alternative Tentacles andere Veranstaltungsorte ausfindig machen, beispielsweise Versammlungssäle von Veteranenorganisationen, in denen es meistens noch nie ein Konzert gegeben hatte. Im Zuge dessen schufen junge Promoter ein alternatives Netz von Auftrittsorten, das wiederum dazu beitrug, die Subkultur, in der sich Nirvana später einnisteten, weiter zu stärken.
Krist erinnert sich gern an die frühen Nirvana-Tourneen durch diese Clubs. „Für uns lief ja sonst nichts. Wir hatten einen Transporter, und in dem bretterten wir über den Highway. Wir fuhren nach Florida, wir fuhren nach Kanada. Wir waren schweineglücklich. Außerdem bekamen wir auch noch ein paar hundert Dollar jede Nacht, und das war für uns richtig viel Geld.“
Kurt ließ sich nicht nur von der Musik, sondern von der gesamten Punk-Kultur inspirieren. Die meisten Künstler, die er toll fand, wurden von den kommerziellen Radiosendern so gut wie nie gespielt, und die Platten wurden von den großen Handelsketten nicht geführt; es gab sie meist nur in kleinen, unabhängigen Plattenläden, die vielen Punk-Fans ein zweites Zuhause wurden. In diesen Geschäften lagen auch billig produzierte Punk-Fanzines aus, die eine ganz bestimmte Ästhetik transportierten und eine Anti-Establishment-Haltung propagierten. Zu den einflussreichsten zählten Flipside, das schon seit 1977 erhältlich war, und Maximum Rocknroll, das seit 1982 vertrieben wurde. (Die großen Magazine wie der Rolling Stone ignorierten die Indie-Szene der Achtziger oder erwähnten sie allenfalls am Rande. Diese Lücke füllte zunächst nur Creem, das Kurt als Jugendlicher abonniert hatte, und später auch Spin, das 1985 ins Leben gerufen wurde.)
Punk fand davon abgesehen nur noch in einem Medium statt: im College-Radio. Die Airplay-Charts dieser Sender wurden für das College Media Journal (CMJ) zusammengefasst, das ab 1982 den New Music Report veröffentlichte, der für aufstrebende Künstler aus dem Indie- und Punk-Underground sehr wichtig wurde.
In den Achtzigern bildeten sich verschiedene Strömungen in der Szene heraus. „Es war Punk, wenn man seine eigenen Wege ging“, sagt Farrell. In ihren Texten orientierten sich viele Künstler am Minimalismus der Ramones, aber nach und nach ließen immer mehr Songwriter breiter gefächerte musikalische Einflüsse und beißende Kritik an Politik und Gesellschaft in ihre Songs einfließen. Ian MacKaye von Fugazi und Jello Biafra von den Dead Kennedys beeinflussten Kurt in seinen politischen Einstellungen stark.
Die Indie-Bands verband weniger ein einheitlicher musikalischer Stil als vielmehr die gemeinsame Außenseiterrolle. Sonic Youth, die bald zu Mentoren der Szene aufstiegen, standen beispielsweise in ihrer Ästhetik der New Yorker Kunstszene näher als den Sex Pistols. Diese so unterschiedlichen kreativen Geister teilten einen Wertekanon, den Kurt später in den Mainstream-Rock transportierte: Musik zu machen, die einem persönlich etwas bedeutete, die anderen Künstler der Gemeinschaft zu unterstützen und eine Beziehung auf Augenhöhe zum Publikum aufrecht zu erhalten.
Einer der Widersprüche in meiner Beziehung zu Kurt lag darin, dass ich eng mit zwei Phänomenen verbunden war, die Punk grundlegend ablehnte: Hippies und Major-Labels.
Das Wort „Hippie“ hatte man zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kreisen unterschiedlich interpretiert. Hatte man lange Haare in den Sechzigern noch als Ausdruck von Rebellion betrachtet, waren sie in den Achtzigern Teil der konventionellen Macho-Rock-Uniform geworden, wie sich an den zahlreichen Glam-Metal-Bands zeigte, deren Musiker ihre Mähnen mit viel Haarspray in Form brachten. Es gab sogar Punk-Konzerte, bei denen Männer mit langen Haaren von betrunkenen Zuschauern körperlich angegriffen und als „Hippie“ beschimpft wurden.
Einige von Kurts Vorbildern vertraten eine offenere Einstellung. Sie hatten begriffen, dass äußere Symbole schnell veraltet wirken oder vom Mainstream gekapert werden konnten, aber dass die Kunst jeder Generation von einem gewissen Idealismus durchdrungen war, auch die frühe Hippiekultur. Greg Ginn von Black Flag hatte sich mehr als 75 Konzerte von Grateful Dead angesehen, und Ian MacKaye von Fugazi kannte den Woodstock-Film in- und auswendig. Mark Arm nahm Bob Dylans „Masters Of War“ als Protest gegen den ersten Golfkrieg als Single auf. Mike Watt von den Minutemen zitierte Creedence Clearwater Revival als politische Band (unter anderem wegen des Antikriegssongs „Fortunate Son“) und wies darauf hin, dass CCR mit ihren Flanellhemden auch in modischer Hinsicht Vorläufer der Indie-Szene gewesen waren. Vor Nirvana hatten Kurt und Krist in einer CCR-Coverband gespielt. Green River, die Band, in der neben Mark Arm von Mudhoney auch die späteren Pearl-Jam-Mitglieder Stone Gossard und Jeff Ament gespielt hatten, war nach dem gleichnamigen CCR-Album benannt worden.
Kurt identifizierte sich mal mit Hippies, mal mit Hippie-Hassern. Kurz vor der Veröffentlichung von Nevermind berichtete ihm John Rosenfelder, ein junger Promoter, den wir alle Rosie nannten, viele der Kiffertypen bei den College-Sendern, die sonst Psychedelic Rock hörten, seien von „Smells Like Teen Spirit“ begeistert. Kurt erwiderte abfällig: „Ich hätte gern ein Batikshirt, das mit dem Blut von Jerry Garcia gefärbt wurde.“ Bei anderen Gelegenheiten erinnerte sich Kurt allerdings ganz nostalgisch daran, wie er an Jimi Hendrix’ Grab in Seattle gesessen und Bier getrunken hatte.
Der Song „Territorial Pissings“ auf Nevermind beginnt mit Textzeilen aus „Get Together“, einem Titel aus den Sechzigern, der vor allem in der Version der Youngbloods bekannt wurde. Als wollte er die darin geäußerte Utopie der Hippie-Hymne verspotten, singt Krist mit verzerrter Stimme: „Come on people now/smile on your brother/everybody get together/try to love one another/right now.“ Viele Rock-Kritiker werteten das Intro als Zeichen dafür, dass Nirvana nichts für die Zeit von Peace & Love übrig hatten.
Krist jedoch sagte mir, dass sie keinesfalls die in dem Song angesprochenen Ideale niedermachen wollten, sondern sich vielmehr bitterlich darüber beklagten, dass die meisten Baby-Boomer sich von ihren hehren Zielen abgewandt hatten, als sie älter und einflussreicher wurden. Den ausführlichsten Kommentar dazu gab Kurt in einem Interview mit der brasilianischen Tageszeitung O Globo: „Der Song handelt von Leuten, die zusammenkommen, um etwas Cooles auf die Beine zu stellen, um etwas Neues zu versuchen, und die damit das genaue Gegenteil der Leute sind, die ich in ‚Territorial Pissings‘ porträtiere. Wir wollten den Typen, der den Song geschrieben hat, nicht beleidigen. Das Konzept, positiv zu denken und einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, wurde von den Medien vereinnahmt und der Lächerlichkeit preisgegeben.“
Dass Kurt bei vielen frühen Nirvana-Gigs rituell seine Gitarre auf der Bühne zertrümmerte, war nicht misszuverstehen; er parodierte damit ganz offen Pete Townshend von The Who, der das seit 1964 bei Konzerten tat, nachdem seine Band ihre Sechziger-Hymne „My Generation“ gespielt hatte. Ihr Drummer Keith Moon hatte daraufhin oft auch noch sein Schlagzeug umgestoßen, was Dave Grohl am Ende vieler Auftritte ebenfalls begeistert kopierte.
Die Zerstörung von Instrumenten passte perfekt zum Anarchismus des Punk. Kurts Faszination für die Beatles hingegen war bei den Künstlern der Subkultur, aus der Kurt stammte, eher ungewöhnlich. Wie Thurston Moore mir sagte, sprachen die Nirvana-Musiker oft augenzwinkernd vom „B-Wort“, als müsse man sich ein kleines bisschen dafür schämen, die Fab Four zu hören – möglicherweise, weil die Beatles dem kommerziellen Erfolg stets sehr positiv gegenübergestanden hatten.
Nirvanas widersprüchliche Einstellung zur Gegenkultur der Sechziger brachte den britischen Rock-Kritiker Jon Savage zu der Annahme, dass bereits der Name Nirvana „einen sarkastischen Seitenhieb auf die Pietät der Hippies darstellte“, obwohl Kurts Erklärung für die Namensgebung tatsächlich respektvoll auf die spirituelle Herkunft des Wortes abhob.
Als Nirvana beim britischen Reading Festival als Headliner auftraten, gab es jede Menge „Fuck Woodstock“-T-Shirts im Publikum. Kurt und Krist erklärten mir allerdings beide, dass sie radikale Sechziger-Aktivisten wie Abbie Hoffman und Timothy Leary bewunderten und es sehr bedauerten, dass ihre eigene Generation keine vergleichbaren Vordenker hervorgebracht hatte. Und während viele Punk-Musiker sich die Köpfe rasierten oder einen Irokesenschnitt trugen, hatten die Jungs von Nirvana Langhaarfrisuren, mit denen sie in Woodstock kaum aufgefallen wären.
Weihnachten 1991 schenkte ich Kurt und Courtney eine gebundene Faksimile-Ausgabe des kompletten San Francisco Oracle, der während der 18 Monate seines Erscheinens die wichtigste Hippie-Zeitung der Stadt gewesen war. Wenig später erklärte Kurt in einem Interview, die Haight-Ashbury-Gemeinde hätte schon 1967 erkannt, dass sie ihre Bedeutung verloren hatte – das zeige bereits ein „Tod den Hippies“-Marsch, über den der Oracle ausführlich berichtet hatte.
Aus meinem eigenen Babyboomer-Blickwinkel erschien die Punk-Rebellion lediglich wie eine Neuauflage des jugendlichen Aufbegehrens, das Der Wilde