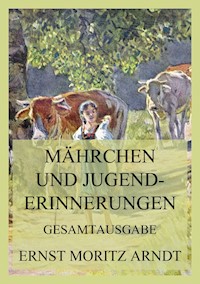Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
In diesem Band beschreibt Arndt sein wechselvolles Leben, unter anderem auch sehr detailliert seine Kindheit auf der Insel Rügen.
Das E-Book Erinnerungen aus dem äußeren Leben wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erinnerungen aus dem äußeren Leben
Ernst Moritz Arndt
Inhalt:
Ernst Moritz Arndt – Biografie und Bibliografie
Vorrede des Herausgebers.
Erinnerungen aus dem äußeren Leben.
Zugabe.
Erinnerungen aus dem äußeren Leben, E. M. Arndt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604028
www.jazzybee-verlag.de
Ernst Moritz Arndt – Biografie und Bibliografie
Deutscher Patriot, wurde 26. Dez. 1769 in Schoritz auf der Insel Rügen geboren, die noch schwedisch war, und starb 29. Jan. 1860 in Bonn. Sein noch als Leibeigner geborner Vater, damals Inspektor auf einem Gute des Grafen Malte-Putbus, ließ ihn die gelehrte Schule zu Stralsund besuchen. Seit 1789 studierte er zuerst in Greifswald, dann in Jena, neben der Theologie mit Vorliebe Geschichte, Erd- und Völkerkunde, Sprachen und Naturwissenschaften. Nachdem er eine Zeitlang in der Heimat als Kandidat und Hauslehrer zugebracht hatte, machte er 1798–99 eine größere Reise nach Österreich, Oberitalien, Frankreich und zurück durch Belgien und einen Teil von Norddeutschland, die er in den »Reisen durch einen Teil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs« (Leipz. 1804, 4 Bde.) beschrieb, nachdem er schon 1800 eine Schrift »Über die Freiheit der alten Republiken« herausgegeben hatte. Nach seiner Rückkehr habilitierte sich A. Ostern 1800 in Greifswald als Privatdozent der Geschichte und Philologie, verheiratete sich mit der Tochter des Professors Quistorp, die ihm aber bald wieder durch den Tod entrissen ward, und erhielt, nachdem er sich ein Jahr (1803/1804) in Schweden aufgehalten, 1805 eine außerordentliche Professur. Die 1803 erschienene »Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen« zog ihm zwar Klagen mehrerer adliger Gutsbesitzer zu, bestimmte aber den König von Schweden. 1806 die Leibeigenschaft und die Patrimonialgerichte in Vorpommern aufzuheben. Aus derselben Zeit datiert das Schriftchen »Germanien und Europa« (1803), worin A. die von Frankreich drohenden Gefahren beleuchtete. Andre Schriften aus diesen Jahren handeln über die Sprache und die Erziehung. Unter dem Druck der politischen Verhältnisse gab er 1806 den ersten Teil seines großen Werkes: »Geist der Zeit« (6. Aufl. des Ganzen Altona 1877) heraus, der die kommenden Ereignisse prophetisch voraus verkündete und das deutsche Volk zum Kampf gegen Napoleon aufrief. A. selbst arbeitete damals in der schwedischen Kanzlei zu Stralsund. In jener Zeit hatte er mit einem schwedischen Offizier, der geringschätzig von Deutschland gesprochen, einen Zweikampf, in dem er schwer verwundet wurde. Nach der Schlacht bei Jena floh er nach Schweden und fand dort eine Anstellung, die ihm Zeit ließ, den zweiten Teil des Werkes »Geist der Zeit« auszuarbeiten, der 1809 in London erschien und im feurigsten patriotischen Schwung auf die Wege hinwies, auf denen allein Deutschland aus der Erniedrigung erlöst werden könne. Der Sturz seines geliebten Königs Gustav IV. bewog ihn 1802, nach Deutschland zurückzukehren und sich nach Berlin zu begeben. In dem patriotischen Kreise des Buchhändlers Reimer empfing er hier mannigfache Anregung, doch lebte er, da er von Napoleon geächtet war, nicht ohne Gefahr. 1810 konnte er zwar nach dem Friedensschluß zwischen Frankreich und Schweden sein altes Amt in Greifswald wieder antreten, aber schon im Januar 1812 begab er sich wieder nach Berlin, Breslau, Prag und knüpfte überall mit den hervorragendsten preußischen Patrioten enge Beziehungen an. Er war, erfüllt von der Vorstellung, daß Preußen seinen politischen und patriotischen Forderungen gerecht werden könne, ganz Preuße geworden. Stein berief ihn zur Förderung seiner auf die Befreiung Deutschlands gerichteten Pläne zu sich nach Petersburg, und mit ihm kehrte A. nach der Niederlage Napoleons nach Deutschland zurück. Jetzt begann erst eigentlich seine durchgreifende Wirksamkeit. In zündenden Worten, in immer neuen Gedichten, Flugschriften und Ausrufen aller Art rief er das Volk zu den Waffen. Unermeßlich ist der Einfluß, den er auf die Befreiung Deutschlands gewann durch: »Was bedeutet Landwehr und Landsturm?«, den »Deutschen Volkskatechismus«, »Über Entstehung und Bestimmung der deutschen Legion«, »Grundlinien einer deutschen Kriegsordnung« und die Schrift »Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze«, »Über Volkshaß und über den Gebrauch einer fremden Sprache« (1813), »Über das Verhältnis Englands und Frankreichs zu Europa« (1813), »Noch ein Wort über die Franzosen und über uns« (1814). In dem Schriftchen »Das preußische Volk und Heer« (1813) schildert er mit beredten Worten, wie Preußen aus tiefstem Sturz wieder auferstanden sei durch zwei Mittel, welche die Staatsleiter mit wahrer Umsicht angewendet: »den Geist freizulassen und das Volk kriegsgeübt zu machen«. Seine schönen Kriegs- und Vaterlandslieder, erschienen in zwei Sammlungen: »Lieder für Deutsche« (1813) und »Kriegs- und Wehrlieder« (1815), sachten die Begeisterung mächtig an. Sie gingen später in die vollständigern Ausgaben seiner »Gedichte« (zuerst Frankf. 1818, 2 Bde.; Ausgabe letzter Hand, Berl. 1860; 2. Aufl. 1865; Auswahl 1889) über. Noch 1813 veröffentlichte er einen dritten Teil seines Werkes »Geist der Zeit«, worin er die Grundzüge eines neuen, zeitgemäßen Verfassungszustandes in Deutschland gab, die er weiter ausführte in der Schrift »Über künftige ständische Verfassungen in Deutschland« (1814). Der Vertretung des Bauernstandes widmete er eine besondere Schrift (1815). Während die deutschen Heere auf französischem Boden kämpften, ließ er Flugblatt auf Flugblatt ausgehen, so: »über Sitte, Mode und Kleidertracht«, »Entwurf einer deutschen Gesellschaft«, »Blicke aus der Zeit in die Zeit«, »Über die Feier der Leipziger Schlacht«, sämtlich von 1814, dann »Friedrich August von Sachsen«, »Die rheinische Mark und die deutschen Bundesfestungen«, beide von 1815. Seine publizistische Tätigkeit konzentrierte er in der Zeitschrift »Der Wächter«, die er 1815–16 zu Köln herausgab. 1817 veröffentlichte er seine »Märchen und Jugenderinnerungen« und den 4. Teil vom »Geist der Zeit«. 1818 wurde er Professor der Geschichte an der neubegründeten Universität zu Bonn, nachdem er 1817 die Schwester Schleiermachers, Nanna (gest. 16. Okt. 1869), als zweite Gattin heimgeführt hatte. Seine akademische Wirksamkeit war indessen von kurzer Dauer. Nach Beginn der Demagogenverfolgungen infolge von Kotzebues Ermordung wurden wegen des vierten Bandes des »Geistes der Zeit« und wegen Privatäußerungen im September 1819 Arndts Papiere in Beschlag genommen, er selbst im November 1820 von seinem Amt suspendiert und im Februar 1821 die Kriminaluntersuchung wegen demagogischer Umtriebe gegen ihn eröffnet.
Sie hatte kein Resultat: Arndts Forderung einer Ehrenerklärung wurde nicht erfüllt, er ward aber auch nicht für schuldig erklärt, sein Gehalt ihm gelassen, die Erlaubnis, an der Universität Vorlesungen zu halten, jedoch nicht wieder erteilt. Eine Schilderung des Prozesses gab A. später selbst in dem »Notgedrungenen Bericht aus meinem Leben, aus und mit Urkunden der demagogischen und antidemagogischen Umtriebe« (Leipz. 1847, 2 Bde.). In den folgenden Jahren schrieb er: »Nebenstunden, Beschreibung und Geschichte der Shetländischen Inseln und Orkaden« (Leipz. 1826); »Christliches und Türkisches« (Stuttg. 1828); »Die Frage über die Niederlande« (Leipz. 1831); »Belgien und was daran hängt« (das. 1834); »Leben G. Aßmanns« (Berl. 1834); »Schwedische Geschichten unter Gustav III. und Gustav IV. Adolf« (Leipz. 1839); »Erinnerungen aus dem äußern Leben« (3. Aufl., das. 1842). Ein tiefer Schmerz traf ihn 1834 durch den Verlust seines Sohnes Wilibald, eines blühenden Knaben von 9 Jahren, der in den Fluten des Rheins ertrank. Es war einer der ersten Regierungsakte Friedrich Wilhelms IV., A. wieder in sein Amt einzusetzen und ihm seine Briefe und Papiere zurückgeben zu lassen. Die Universität wählte A. 1841 zum Rektor. Es erschienen nun: »Versuch in vergleichenden Völkergeschichten« (2. Aufl., Leipz. 1844); »Schriften für und an seine lieben Deutschen« (das. 1845–55. 4 Bde.), eine Sammlung seiner kleinen politischen Schriften; »Rhein- und Ahrwanderungen« (Bonn 1846). 1848 ward A. von dem 15. rheinpreußischen Wahlbezirk in die deutsche Nationalversammlung gewählt und hier durch feierliche Huldigung der ganzen Versammlung begrüßt. Doch beschränkte sich seine Beteiligung an den Verhandlungen auf kurze, aber kräftige Reden im Sinne der konstitutionell-erbkaiserlichen Partei; er war auch Mitglied der großen Deputation, die dem König von Preußen die deutsche Kaiserkrone anbieten sollte. Am 30. Mai 1849 trat er mit der Gagernschen Partei aus der Versammlung aus und zog sich wie der in die Stille seines akademischen Lebens zurück. Aber den Glauben an eine bessere Zukunft Deutsch lands verlor er nicht; dieser Glaube leuchtete aus seinen »Blättern der Erinnerung, meistens um und aus der Paulskirche in Frankfurt« (Leipz. 1849), der letzten größern poetischen Gabe von ihm, sowie aus seinem »Mahnruf an alle deutschen Gauen in betreff der schleswig-holsteinischen Sache« (1854), dem Büchlein »Pro populo germanico« (Berl. 1854), der an mutigen »Blütenlese aus Altem und Neuem« (Leipz. 1857) und der Schrift »Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn H. K. Fr. vom Stein« (Berl. 1858, 3. Aufl. 1870). Wegen einer angeblich den General Wrede und das bayrische Militär beleidigenden Stelle in letzterm Werk ward A. vor das Schwurgericht in Zweibrücken geladen und, da er nicht erschien, in contumaciam zu Gefängnisstrafe verurteilt. Noch völlig rüstig, feierte er unter allgemeiner Teilnahme 1859 seinen 90. Geburtstag. – A. war kein Genie, kein großer Dichter und Gelehrter, auch kein großer Staatsmann, aber voll Begeisterung für die erhabensten Interessen der Menschheit und voll edelster Hingebung für die Sache des Volkes, ein mannhafter Charakter, der noch als Greis den Idealen seiner Jugend mit Jünglingsfeuer anhing. Wie er durch seine Schriften und Lieder die Befreiung Deutschlands von der Fremdherrschaft höchst wirksam unterstützt hatte, so suchte er in der Zeit der Reaktion das Verlangen und Streben des Volkes nach dem großen Ziel der nationalen Einheit furchtlos und mit Feuereifer aufrecht zu erhalten, »wie ein altes gutes deutsches Gewissen« die Verzagenden stärkend, die Schwankenden in der Treue befestigend, die Feinde des Rechten und Guten mit der Wucht seines heiligen Zornes niederschmetternd. Daher blieb er, obgleich die Zeit viele seiner Ansichten überflügelt hatte, gleichsam das Banner, um das auch die jüngern Generationen der Vaterlandsfreunde sich scharten. Sein Inneres und Äußeres spiegelte in seltener Reinheit die Eigenschaften, die den deutschen Mann zieren: eine feste, energische Gestalt, ein reiches, poetisch gestimmtes Gemüt, sittlichen Ernst und Strenge, heiße Liebe zu Freiheit und Vaterland. 1865 wurde ihm in Bonn ein Bronzedenkmal (von Afinger) errichtet; seinem Andenken ist auch der 111 m hohe Turm auf dem Rugard auf der Insel Rügen (1873) gewidmet. Von einer Sammlung seiner Hauptschriften erschienen 6 Bände (Leipz. 1892–96). Arndts Biographie schrieben Langenberg (neue Ausg., Bonn 1869), Baur (5. Aufl., Hamb. 1882), Rehbein u. Keil (Lahr 1861), Schenkel (2. Aufl., Elberf. 1869), Thiele (Gütersl. 1894). Seine »Briefe an eine Freundin« (Charlotte v. Kathen) wurden herausgegeben von Langenberg (Berl. 1878), die »Briefe W. v. Humboldts und Arndts an Johanna Motherby« von H. Meisner (Leipz. 1892). Vgl. auch »E. M. A., Lebensbild in Briefen« (hrsg. von Meisner u. Geerds, Berl. 1898).
Vorrede des Herausgebers.
E. M. Arndts »Erinnerungen aus dem äußeren Leben,« die auf folgenden Blättern zu neuem, unverändertem Abdruck kommen, waren längere Zeit im Buchhandel völlig vergriffen. Sie sind zuerst im Jahr 1840 erschienen, und diese Schilderung seines vielbewegten Lebens, die der Siebenzigjährige seinem Volke bot, fand solche Teilnahme, daß noch in demselben Jahr eine neue Auflage nötig wurde, welcher 1843 eine dritte, durch einige Zusätze und Anmerkungen vermehrte, folgte. Nach letzterer ist der folgende Abdruck genommen; ich habe nur einige Erinnerungen Arndts aus seiner Jugendzeit, die er an anderem Orte veröffentlicht hatte, hinzugefügt und einige Erklärungen gegeben, wo Personen und Ereignisse erwähnt werden, die dem Gedächtnis der heute Lebenden fremd geworden sind.
Von besonderer Lebendigkeit und Frische ist die Erzählung Arndts in der Schilderung seiner Jugendzeit, und in der That sind diese »breiten Bilder längst verschienener Tage« nicht nur ergötzlich, sie sind auch lehrreich in kulturgeschichtlicher Beziehung und dürften wohl Goethes berühmten Schilderungen des reichsstädtischen Lebens in »Dichtung und Wahrheit« an die Seite gestellt werden, wie verschiedene Lebenskreise sie auch zeichnen. Sie allein würden schon hinreichen, dem Buch einen dauerliben Wert zu verleihen. Von noch größerem Interesse und höherer Bedeutung als Geschichtsquelle sind Arndts Erinnerungen freilich in ihren späteren Teilen, namentlich aus der Zeit der Freiheitskriege. Seine glühende vaterländische Begeisterung, die sich in seinen Schriften offenbarte, brachte ihn in Beziehung zu den meisten hervorragenden Patrioten jener Tage. Auch seine nahe Verbindung mit Stein wurde durch diese Gesinnung veranlaßt, und gab ihm wieder Gelegenheit, die Ereignisse jener Jahre aus der Nabe zu betrachten und manches zu erfahren, was ferner Stehenden verborgen blieb. Bei seiner Reise nach Petersburg sah er Rußlands Kriegsrüstungen im Sommer 1812, er sah den Eindruck, den der Brand von Moskau in der russischen Hauptstadt hervorbrachte, er sah endlich die furchtbaren Spuren des Rückzuges der großen Armee und erlebte in Königsberg die begeisterte Erhebung der braven Ostpreußen mit, während er selbst durch zahlreiche Flugschriften und Gedichte den flammenden Zorn gegen die Unterdrücker in aller Herzen schürte. Er folgte den siegreichen Heeren der Verbündeten bis an den Rhein, fand im Sommer 1818 eine Anstellung als Professor der Geschichte an der neu gegründeten Universität Bonn und wurde mit Jahr 1820 zum Dank für seine patriotische Wirksamkeit von den Demagogenverfolgern des Hochverrats verdächtigt und von seinem Amt suspendiert. Alles das erzählt der Alte in seiner schlichten, treuherzigen Weise – manchmal freilich auch mit hohem Pathos – und läßt dann eine Darlegung seiner politischen und socialen Grundsätze und Ansichten folgen, die Zeugnis ablegt von seinem klaren Blick und seiner tiefen Einsicht. »In damaliger Zeit galten seine Forderungen freilich vielen für revolutionär; wir haben die Erfüllung fast aller erlebt. Was sein Eifer damals nicht durchsetzte, ist der nächsten Generation lebendig geworden, und viele seiner Worte klingen uns jetzt wie die Mahnungen eines Sehers.«1
Es bleibt noch übrig, einiges über Arndts spätere Lebensjahre zu sagen. Als Friedrich Wilhelm IV. am 7. Juni 1840 zur Regierung gekommen war, beeilte er sich, soweit möglich, das an dem treuen Patrioten begangene Unrecht wieder gut zu machen. Der siebenzigjährige Greis wurde wieder in Amt und Würden eingesetzt und wieder auf den Lehrstuhl berufen, der ihm zwanzig Jahre früher verschlossen worden war. Er wurde, wie er sagt, von dieser Nachricht wie von einem Blitzstrahl getroffen, mehr erschreckt als erfreut. Lange Jahre hatte er »in einem nebelnden und spielenden Traum, unter Kindern, Bäumen und Blumen verloren,« nun sollte er in einem Alter, in dem andere die wohlverdiente Ruhe genießen, noch einmal wieder anfangen zu wirken und zu lehren. Wahrlich ein schwerer Entschluß. Aber um nicht trotzig und verbittert zu erscheinen, nahm er die Gnade seines Königs an und begann seine Lehrthätigkeit von neuem. Mit größter Freude wurde dies Ereignis im Volk und unter seinen Amtsgenossen begrüßt, und Arndt im folgenden Jahr zum Rektor der Universität gewählt. Jetzt regte sich auch seine Feder wieder in altgewohnter Weise. Er gab eine neue vermehrte Auflage seiner Gedichte heraus, er verfaßte seine »Erinnerungen aus dem äußeren Leben« und schrieb einen »Notgedrungenen Bericht aus seinem Leben,« worin er sich vor seinem Volk gegen die Anklage revolutionärer Bestrebungen rechtfertigte. Er sammelte seine vielfach zerstreuten kleineren Aufsätze und Flugschriften unter dem Titel: »Schriften für und an seine lieben Deutschen« und fügte noch vielfach Neues hinzu.
Als das hoffnungsreiche Jahr 1848 anbrach, trat der alte Freiheitskämpfer auch wieder auf den Plan. Vier rheinsche Wahlkreise hatten ihn als ihren Vertreter zum Frankfurter Parlament gewählt, auch von jemer Heimatinsel Rügen war ihm ein Mandat angeboten. Er nahm für Solingen an und schloß sich dem rechten Centrum, der preußischen Erbkaiserpartei, an. In Preußen hatte er während der Freiheitskriege die für die Zukunfst belebende, erhaltende und schirmende Macht Deutschlands erkannt; als man daher zur Wahl eines deutschen Kaisers schritt, konnte er nicht zweifelhaft sein, wem er seine Stimme zu geben habe. Er gehörte auch zu der Deputation, welche Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone anzutragen hatte. Sie wurde zurückgewiesen, und die Aufgabe des Parlaments war damit gescheitert. Am 20. Mai 1849 erklärte Arndt in Gemeinschaft mit 76 anderen, darunter Dahlmann, Gagern, Beseler, seinen Austritt aus der Nationalversammlung und kehrte in seine Heimat zurück. Aber trotz dieses Fehlschlages verlor er die Hoffnung auf die Zukunft seines Volkes nicht. Preußen war ihm der zukünftige Hort, der Bannerträger Deutschlands. In einem seiner letzten Bücher » Pro populo Germanico« (1854) heißt es: »Licht, Klarheit, Tapferkeit, hellste geistige Mutigkeit, dieses nordliche lutherische Erbteil, ist das eigentliche preußische Leben; Licht, Kunst und Wisseschaft heißt die Inschrift der Fahne, unter welcher Preußen groß vorangeschritten ist und größer fortschreiten wird ... Hier ist nicht bloß auch ein wenig Deutschland – wie die Prediger des Großdeutschlands uns scheltend und prahlend von der Donau her zurufen – hier ist das rechte Deutschland, jenes Deutschland, welches einmal das große Deutschland werden und heißen wird.« Diese Zuversicht begleitete ihn bis an das Ende seines Lebens, und wenn er auch in Wirklichkeit das neue deutsche Kaiserreich nicht mehr erblicken sollte, im Geiste hat er es vorausgeschaut.
Am Weihnachtstage des Jahres 1859 feierte er unter Beteiligung von ganz Deutschland seinen 90jährigen Geburtstag; am 29. Januar 1860 drückte ihm seine treue Gattin die Augen zu.
An zwei Orten, an denen seine Seele besonders hing, zeugt ein Denkmal von der Liebe und Verehrung des deutschen Volkes für diesen guten Menschen und tapferen Kämpfer für Freiheit und Recht: auf Rügen, wo seine Wiege stand, und am Ufer des Rheins, in Bonn, wo er sein thatenreiches Leben beschlossen hat.
Dr. phil. Robert Geerds.
Erinnerungen aus dem äußeren Leben.
Ich steh, ich steh auf einem breiten Stein,
Und wer mich lieb hat, holt mich ein.
Diesen Spruch habe ich in der lieben Heimat oft gesprochen in den Tagen, wo es mir noch lustig deuchte, im Pfänderspiel eine hübsche Dirne anzulocken und von ihr mit einem Kusse von dem festen Platze erlöst zu werden. Es lag nämlich im Mittelalter in der alten herrlichen Stadt Stralsund auf dem alten Markt ein sogenannter breiter Stein, umweit einer andern Stand- und Schaustelle, dort Kak, anderswo Pranger genannt. Dieser breite Stein hatte weiland gedient wie letzt die Kanzel zu allerlei feierlichen Ausrufungen und Verkündigungen, namentlich: wann hohe Ehrenstellen in der Obrigkeit besetzt werden sollten, wurden sie dem Volke durch Ausrufungen von jener Stelle bekannt gemacht; Verlöbnisse wurden dort verkündigt, Verlobte stellten sich in Feierkleidern dahin und ließen unter Pauken- und Trompetenschall ihre Namen erklingen und so jedermänniglich zu Einrede und Einwand auffordern.
Auf eine ähnliche Weise meine ich mich hier auf dem breiten Stein hingestellt zu haben und nicht an seinem Nachbar, wenn ich auch nicht glaube, daß mir wie mit Jugendglück die liebebrennenden Herzen mit Küssen entgegenfliegen werden. Ich habe in einzelnen dünnen Linien die Umrisse meines öffentlichen Lebens hingezeichnet, meines Lebens, Wollens und Wirkens als demscher Mann und Bürger. Beruf dazu hatte ich schon deswegen genug, weil es öffentlich vielfältiglich angefochten worden ist. Danton, ein wälsches Ungeheuer, hat einmal das große Wort gesprochen: Mein Name sei geschändet! nur sei das Vaterland gerettet! Aber doch, wenn es nicht die allerhöchsten Dinge gilt, wer mögte sich freiwillig schänden und anprangern lassen? was hätte das liebe Vaterland des Gewinn, daß irgend eines seiner Kinder unverdient für einen Schurken oder Narren gälte? Darum stelle ich mich hier auf den breiten Stein und rufe: Hier steh ich, ein redlicher und verständiger Mann. Ist einer, der meint, mich davon auf die Nachbarstelle hinüberstoßen zu können, der komme! Ich lebe noch, und will ihn bestehen.
Die meine Schicksale kennen, verstehen die Meinung dieser Verkündigung. Weiter wüßte ich über diese Umrisse nichts zu sagen, als daß in Beziehung auf die Schilderung meiner jugendlichen Jahre manches vielleicht zu breit ausgeführt scheinen mögte. Ich glaube nicht, daß mich hier mit einer gewissen Breite der Darstellung die Geschwätzigkeit des Alters beschlichen hat, sondern eine sehr natürliche Luft an vergangenen Dingen, die nicht bloß für mich vergangen sind. Jene Menschen und Dinge, ja das ganze Leben der Jahre von 1780 und 1790 stehen schon gleich ein paar Jahrhunderten von uns geschieden, so ungeheure Risse haben die letzten fünfzig Jahre durch die Zeit gerissen. Ich bilde mir ein, jene breiten Bilder seien gleichsam als Bilder längst verschienener Tage auch den Jetztlebenden ergötzlich.
Ich selbst? was bin ich, was bin ich nicht unter jenen nun längst verblaßten Bildern? Wie ich gesagt habe, ein fliegendes Blatt unter Millionen fliegenden Blättern, die auf dem Ocean der Zeiten fortschwimmen, bis sie auf immer versinken. Aber ich sehe keinen Grund, warum dieses Blatt, Schmutz bewerfe? Der Sonnenstrahl der Ehre jedes einzelnen ist auch dem Vaterlande heilig; alles Übrige ist gleichgültig. Vergessen auch die Menschen geschwind, Gottes Liebe vergißt kein Stäubchen in seinem All. Man kann von der Menschheit und ihrer heiligen unendlichen Bestimmung, auch von der Bestimmung jedes einzelnen Sterblichen nicht hoch genug denken; und doch, wenn man sich die Pilgerwanderung des Einzelnen auf diesem trugvollen neblichten Planeten, wie er umhertappt und an allen Ecken und Enden anstößt und selten den rechten Pfad findet, in der Wirklichkeit klar vorstellt, dann singt man darüber den Spruch des alten Heiden Pindar: Was ist einer? was ist er nicht? eines Schatten Traumbild ist der Mensch.
Bonn, den ersten des Hornungs 1840.
Am Schlusse des zweiten Weihnachtstages des Jahrs nach der Erscheinung unsers Herrn Jesu Christi 1769 habe ich zuerst das Licht dieser Welt erblickt, und zwar als ein Wohlgeborner und Hochgeborner, und nach der Meinung Einiger auch als ein Glücklichgeborner. Wohlgeboren konnte ich heißen, weil ich stark und gesund an das Licht dieser Welt fiel, zumal ich schon mit dem neunten Monat meines Alters gelaufen bin, was einige meiner Söhne mir nachgemacht haben; Hochgeboren, weil das Haus meiner Geburt damals durch eine hohe stattliche Treppe und durch Jugendlichkeit und Schönheit ein sehr ritterliches und hochadliches Ansehen hatte, und in seinen Sälen und Gemächern mit Geschichten der griechischen Mythologie, ja mit dem ganzen Olymp, Jupiter und Juno mit Adler und Pfau an der Spitze, verziert war; Glücklichgeboren, weil Glaube und Aberglaube den an hoben Festen Hervorgekommenen allerlei Vorzügliches und Wundersames, als da sind Wahrsagen, Gespenstersehen u.s.w. beizulegen pflegt.
Es hätte sich aber leicht begeben können, daß ich ein recht Unwohlgeborner geworden wäre. Einige Wochen vor dem Ziel meiner Ankunft auf Erden war nämlich in der Festung Stralsund vor dem Tribseeer Thore ein Pulverturm1 aufgeflogen, der die nächsten Gassen und Hunderte von Menschen zerschmettert hatte. Dieser Knall war längs dem Meere auf drei Stunden Weite mit so fürchterlicher Gewalt bis Schoritz durchgeklungen, daß ich darüber in der Mutter aufgeschreckt worden, und sie in der Angst wegen meiner ungeuöhnlichen Sprünge gefürchtet hatte, ihr würde was Ungrades geschehen. Sie pflegte mich zur Erinnerung daran, wann ich zu wild war, wohl zuweilen den wilden Pulverjungen zu schelten. Doch legte sie als fromme Christin an solche Dinge eben keine Bedeutung, obgleich sie für die Bedeutung meines Namens Ernst ritterlich gekämpft und den Namen Philipp, den der Vater von meinem Herrn Paten beliebte, niedergesiegt hatte: wie denn die Frauen in solchen Dingen gewöhnlich zu siegen pflegen.
Wie es nun auch um alle diese Geborenheiten stehen mag, die Wahrheit bekennend muß ich aussagen, daß der Stamm, aus welchem ich entsprossen bin, unter anderm niedrigen Menschengesträuch ganz tief unten an der Erde stand, und daß mein Vater kein viel besserer Mann war, als der Vater des Horatius Flaccus weiland, nämlich ein Freigelassener. Er hieß Ludwig Nikolaus Arndt und war zu jener Zeit Verwalter der sogenannten Schoritzer Güter. Meine Mutter hieß Friederike Wilhelmine Schumacher. Jene Güter, von welchen meine Geburtsstätte Schoritz der Hauptsitz war, bestanden aus einem halben Dutzend größerer und kleinerer Höfe und einigen Bauerdörfern, und mein Vater war eine Art Oberverwalter und führte den Namen Herr Inspektor, und seine nächsten Unterleute hießen Schreiber. Dieser Besitz und ein großer Teil der Güter auf der angränzenden Halbinsel Zudar waren weiland Lehen des rügenschen adlichen Geschlechts der von Kahlden. Ein sehr reicher Herr von Kahlden hatte das damals noch junge und schöne Haus auf dem Rittersitze Schoritz um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gebaut, seinen schönen Besitz aber um die Zeit des siebenjährigen Krieges an einen General Grafen von Löwen verkauft, schwedischen Statthalter über Pommern und Rügen, und hatte dafür andere große Güter in Pommern wieder erworben. Er war aber durch Krieg und unverständige Wirtschaft zuletzt in schlechte Umstände geraten und mußte nun hier in Schoritz, wo er den schönen Hof und Garten und mehrere Parks gebaut und angelegt hatte, eine Rolle spielen, welche der Volksglaube gewöhnlich Solchen beilegt, die durch schwere und gräuliche Unfälle gegangen sind. Mir hat er die ersten kalten und heißen Gespensterschauer durch den Leib jagen müssen: denn er machte in einem grauen Schlafrocke, mit einer weißen Schlafmütze auf dem Kopf und ein paar Pistolen unter dem Arm abendlich und mitternächtlich häufig die Runde auf seinem Hofe, indem er zwischen den beiden Scheunen über den Damm, der auf das Haus hin führte, langsam in das unterirdische Haus und die Keller marschierte und von da herausschreitend durch das Gartenthor ging, wo er die Bienenstöcke musterte und dann verschwand. Dieser war das Gespensterschrecken; aber ein zweites gespenstisches Schrecken, womit der abenteuernde Mund des Gesindes meine und meiner Brüder jugendliche Phantasie fütterte, waren ein paar mächtige goldige Wasserschlangen, welche in dem großen Teiche hinter der Scheune hausen und den Kühen gelegentlich die Milch absaugen sollten. Von dem General Löwen hatte die Güter der Graf Malte PutbusA2 gekauft, aus dem vornehmsten und ältesten Rittergeschlecht in der ganzen schwedisch-pommerschen Landschaft, Erblandmarschall des Fürstentums Rügen und Präsident der Regierung in Stralsund.
Mein Vater, im Jahr 1740 geboren, war der Vorjüngste von vielen Geschwistern und Sohn des unterthänigen Schäfers Arndt zu Putbus und Darsband. Der Vater dieses Schäfers war nach der Familienüberlieferung ein geborner Schwede, als schwedischer Unteroffizier ins Land gekommen, und hatte sich in ein Bauerwesen der Herrschaft Putbus eingeheiratet. Mein Vater war, da der Schäfer in seiner Lage leidlich wohlhabend war, und da sein viel älterer, auch schon zu einigem Wohlstand hinaufgekommener Bruder Hinrich seine Jugend unterstützte, fleißig zur Schule gehalten worden und hatte den Unterricht des Kantors und Küsters Jahn zu Vilmnitz bei Putbus genossen, eines seinen alten Mannes, dessen ich mich aus meiner Kindheit noch wohl erinnere, und der für einen sehr vorzüglichen Orgelspieler und Rechnenmeister galt. In dieser Schule hatte mein Vater eine tüchtige Rechnenkunst und eine vorzüglichste Handschrift gewonnen, so daß sein Herr, der Graf, ihn zu einem Haidereiter, wie man sie damals in Rügen nannte, oder einem kleinen Förster bestimmte, und ihn, da er ein hübscher rüstiger Bursche war, als seinen Jäger in Geschäften und auf Reisen mit sich nahm. Nun brach der siebenjährige Krieg aus, und der Graf ward zu einer Art Generalintendanten des schwedischen Heers ernannt, das übers Meer kam und die vielen Feinde des großen Friedrich von Preußen vermehren sollte. Da der Graf die Redlichkeit und Anstelligkeit des Jünglings erkannt hatte, so gebrauchte er ihn nicht nur in seiner Kanzlei als Schreiber, sondern auch zu mancherlei zum Teil gefährlichen und mißlichen Sendungen, namentlich zur Geleitung von Geldfuhren von Hamburg her u.s.w., und nahm ihn später auf mehreren Reisen nach Stockholm mit. Auf diese Weise ging mein Vater von seinem achtzehnten bis fünfundzwanzigsten Jahre durch eine tüchtige Schule des Lebens und hatte sich bei dem Aufenthalte in großen Städten und unter fremden Menschen, obgleich nur ein dienerlicher Mann, die Art eines gebildeten und gewandten Mannes zugeeignet. Bei seinem Herrn aber hatte er schon in den ersten Jahren seines Dienstes die Gunst gewonnen, daß er ihn frei ließ und ihn zu Hause in Putbus in Geschäften der Landwirtschaft und Schreiberei gebrauchte, bis er ihn zum Inspektor der Schoritzer Güter machte.
Meine Mutter, im Jahr 1748 geboren, war die Tochter eines kleinen Ackerbesitzers und Landkrügers in dem Kirchdorfe Lanken, eine Meile von Putbus. Auch sie hatte eine bessere Erziehung genossen, als man von der Lage ihrer Eltern erwarten durfte; denn sie war mehrere Jahre mit den Kindern eines reichen Pächters zu Garstitz bei Lanken, Namens Bukert, mit unterrichtet worden, und hatte aus der Schule die Anfänge von für die damalige Zeit ganz hübschen Kenntnissen zu Hause gebracht, so daß man sie zu den gebildeten Frauen rechnen konnte. Sie und ihre Geschwister waren überhaupt geistig sehr begabte Menschen mit mancherlei seinen Talenten, besonders zu Saitenspiel, Gesang und Bildnerei und allerlei sinnigen und ergötzlichen Erfindungen. Sie war aber wohl die Krone von allen, ernst, fromm, sinnig und mutig, und durch keine Geschicke so zu beugen, daß sie die Klarheit und Besounenheit verloren hätte. Sie steht mir noch heute mit ihren schönen, großen, blauen Augen und ihrer prächtigen breiten Stirn, als wenn sie leibte und lebte, lebendig gegenüber.
Schoritz war denn höchst anmutig hart an einer Meeresbucht gelegen, welche die Halbinsel Zudar von der größeren Insel abschneidet; ein neues noch glänzend geschmücktes Haus; ein großer Blumengarten und mehrere Baumgärten; dicht daran eine ganz kleine Halbinsel, die aber bei hoher Sturmflut oft zu einer Insel ward, mit hohen Birken und Eichen beflanzt, worauf wir unsre Sommerspiele zu halten pflegten; gegen Osten des Hofes ringsum ein prächtiger Eichenwald, in welchem Tausende von Ackerraben ihren horstenden Wohnsitz zu haben pflegten; ein Viertelstündchen weiter der größere Wald Krewe. Auch sind mir aus diesen Tagen noch mehrere Freuden erinnerlich, besonders die freundlichen Gaben, welche zwei Menschen uns Kindern fast allwöchentlich zutrugen. Der erste war mein Oheim und Pate Moritz Schumacher, damals Verwalter des Hofes zu Putbus. Dieser segelte oder ritt nie nach Stralsund oder Greifswald, ohne daß er bei uns etwas abweges ansprach und Gebäck und Süßigkeiten und anderes Schönes aus seiner Tasche schüttelte. Der zweite war ein alter preußischer Hauptmann von Wolke aus Hinterpommern, der mit seinem grauen Gemahl auf dem Schoritzer Nebengute Silmnitz eine halbe Stunde von uns wohnte. Noch heute schwebt mir das alte gutmütige und rosig heitere Gesicht dieses Greises vor, der fast alle Abende zu uns kam und mit dem Vater eine Partie Karten oder Damenbrett spielte. Am besten aber hatten wir Kinder es, wenn er den Vater nicht zu Hause traf; dann nahm der freundliche Alte mich und meinen Bruder Karl auf die Kniee, und erzählte uns Kriegs- und Mordgeschichten und andere wundersame Abenteuer, worauf wir mit unbeschreiblicher Luft horchten. An Sonntagen erschien dann auch die Frau Hauptmannin, immer im vollen Staat nach der damaligen Weise, und der Alte dann meistens in Montur, mit herrlich gepuderter Perücke, den Degen an der Seite und die silbernen Sporen an den Stiefeln. An solchen Galatagen und vorzüglich an den hohen Festen bescherte er den Kindern sehr reichlich, und mit Recht schwebt sein liebes Bild nach mehr als sechzig vertidenen Jahren als das Bild eines milden und freundlichen Christengels vor meinen in Wehmut dämmernden Augen. Denn dieser gute Greis war neben den Gaben auch ein Friedensengel und hat mich und meinen Bruder Karl öfter von verdienter Züchtigung befreit.
In Schoritz wurden also die ersten Kinderspiele durchgespielt. Es war im Jahre 1775 oder 1776, da zog der Inspektor Arndt von Schoritz ab, eine halbe Stunde weiter, und ward nun sein eigener unabhängiger Herr. Der Graf verpachtete nämlich diese Güter an meehrere Pächter, und mein Vater ward Pächter von Dumsevitz und Ubechel nebst einigen Dienstbauren. Weder er noch die Mutter hatten zu solchem Unternehmen hinreichendes Vermögen. Freunde in Stralsund, deren Vertrauen er verdient hatte, schossen ihm dazu die nötige Summe vor.
Wir wohnten nun zu Dumsevitz fünf oder sechs Jahre, ich meine, bis zum Jahre 1780. Wir waren ein Viergespann von Buben, und es kam hier bald noch eine Dirne und ein Knabe hinzu; sodaß in Dumsevitz das halbe Dutzend voll ward, das späterhin noch um zwei Geschwister vermehrt werden sollte. Dies hier sind die Jahre der aufdämmernden Kindheit, und aus diesen sind mir die anmutigsten und idyllischesten Lebensbilder übriggeblieben, und auch glaube ich, sie haben meine glücklichsten Tage enthalten. Was nun das Äußere betrifft, so waren wir freilich aus dem Palast in die Hütte versetzt. Dumsevitz war ein häßlicher, zufällig entstandener Hof, mit einem neuen aber doch kleinlichen Hause; indessen doch hübsche Wiesen und Teiche umher, nebst zwei sehr reichen Obstgärten, und in den Feldern Hügel, Büsche, Teiche, Hünengräber, alles in dem unordentlichen aber romantischen Zustande eines noch sehr unvollkommenen und ursprünglichen Ackerbaues. Die Natur war, mit Goethe zu reden, gottlob noch nicht reinlich gemacht und ihre ungestörte Wildheit mit Vögeln, Fischen, Wild und Herden desto lustiger: auch streiften wir, dem fröhlichen Jäger, dem Vater und seinen Hunden folgend, oft darüber hin. Das hatten wir alles zu genießen, behielten aber Schoritz, wo uns ganz nahe befreundete Leute wohnten, und das nahe Silmnitz, worauf Ohm Moritz Schumacher als Pächter gezogen war, eigentlich immer noch als unsere Heimat, weil die Nachbarn und Nachbarskinder immer wöchentlich, oft auch täglich zusammenliefen. Dies geschah am meisten in dem Walde Krewe, wovon ein Teil zu Dumsevitz gehörte, und worin wir bei der Vogelfängerei und Vogelstellerei meistens freundlich, zuweilen auch feindlich zusammenstießen. Wir hatten überhaupt ein glückliches Leben. Es war die zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre nach dem siebenjährigen Kriege eine stille heitere Zeit, und die Menschen fühlten sich außerordentlich wohlig und wählig, und ließen bei Besuchen, Zusammenkünften und Festlichkeiten und bei Reisen zu entfernten Verwandten die Kinder an allem freundlich mitteilnehmen. Das Beste aber war, daß wir mit keinem frühen Lernen gequält wurden und auch diese Dumsevitzer Jahre noch so spielend durchspielen durften. Das hatte seinen guten Grund.
Es hatte nicht seinen Grund in der Ansicht oder in dem Willen der Eltern, sondern in den engen und kleinen Umständen derselben. Es gab keine Schule in der Nähe, und ein rechter studierter Hauslehrer wäre ihnen zu teuer geworden. Einmal kam freilich einer an, ein alter verlegener Kandidat, Sohn eines Kantors in der Stadt Bergen, Namens Herr Krai. Ich erinnere mich dieser Krähe noch mit Schaudern. Er war früher mit unserm werten Hausfreund, Herrn Pastor Krüger zu Swantow, mehrmals als Gast bei uns gewesen, wo wir über seinen wunderlich zugeknöpften Rock und seine gelbe Perücke gelacht hatten: ein langer, dürrer und griesgrämiger Mensch mit einer ungeheuren Nase und tiefliegenden schwarzen Augen. Welche Angst aber, als er wirklich bei uns einzog und uns in seinem kleinen Zimmer zusammenkniff! Da waren die wilden Vögel eingefangen. Aber diese Angst nahm glücklicherweise ein baldiges Ende. Er verließ unser Haus zu unserm Jubel etwa noch acht Tagen, indem er meinem Vater in einem Briefe erklärte: er könne nicht bleiben, wo man dem Lehrer der Kinder so wenig Achtung erweise, meine Tante Sophie habe ihn einen guten Morgen kaum angeknixt, und meine Mutter habe gestern statt Herr Krai, wie sich gebühre, lieber Krai gesagt.
Indessen liefen wir doch nicht wie die rohen Wildlinge herum, sondern wurden, wie ich noch meine, für dieses Alter vom sechsten bis zehnten Jahre recht gut erzogen. Man höre:
Mein älterer Bruder Karl – ich war der zweite – ward auf ein paar Jahre nach Stralsund geschickt, wo er im Hause des ältesten Mutterbruders, Friedrich Schumacher, wohnte und in die Schule ging. Ich ueiß noch, welch Erstannen und Schrecken wir hatten, und wie sich die Geschichte bald in brüderlichen Spaß auflöste, als der Junge nach einem halben Jahre einmal zu Hause kam und anfangs nicht anders als in hochdeutscher Zunge sich mit uns zu unterreden herabließ. Denn das Hochdeutsche waren wir bisher nicht anders als von den Kanzeln oder beim Vorlesen aus Büchern oder bei feierlichen Gelegenheiten in den ersten Bewillkommnungen der Besuchenden zu hören gewohnt gewesen. Wir blieben aber dabei gar nicht hinter ihm: nämlich ich und Bruder Fritz, der dritte in der Reihe. Die Eltern hielten den Herbst und Winter, wo sie am meisten Muße hatten, ordentlich Schule mit uns; Schreiben und Rechnen lehrte der Vater, und die Mutter hielt die Leseübungen und machte unsere jungen flatternden Geister durch Erzählungen und Märchen lebendig, die sie mit großer Anmut vorzutragen verstand. Das Lesen ging aber in den erten Jahren fast nicht über Bibel und Gesangbuch hinaus; ich möchte sagen, desto besser für uns. Sie war eine fromme Frau und eine gewaltige Bibelleserin, und ich denke, ich habe die Bibel wohl drei, viermal mit ihr durchgelesen. Das Gesangbuch mußte auch fleißig zur Hand genommen werden und den Samstag Nachmittag mußten die Jungen unerlaßlich entweder ein aufgegebenes Lied oder das Sonntagsevangelium auswendig lernen. Das geschah, weil sie eine sanfte und liebenswürdige Schulmeisterin war, mit großer Freude und also mit großem Nutzen. Muße aber hatte sie ungeachtet einer nicht starken Gesundheit, der vielen wilden Kinder und der großen Wirtschaft, die mit Sparsamkeit geführt werden mußte, mehr als die meisten anderen Menschen. Wann alles längst vom Schlaf begraben lag, saß sie noch auf und las irgend ein frommes oder unterhaltendes Buch, ging selten vor Mitternacht zu Bette, und war im Sommer mit der Sonne wieder auf den Beinen. Weil ich nun auch ein solcher Kautz war, der selbst im Knabenalter wenig Schlaf bedurfte und deswegen Lerche (Lewark) zugenannt war, so habe ich in jenen Kindertagen und auch später noch manche Abende und Nächte bis über die Gespensterstunde hinaus mit ihr durchgesprochen und durchgelesen.
Weil ich diese Leserei der Vergangenheit hier im Gedächtnisse wieder überlese, so füge ich sogleich hinzu, was für diese Zeit dahin gehört. Es war wenigstens auf der Insel Rügen damals noch die Zeit des ungestörten christlichen Glaubens, und meine guten Eltern und die Base Sophie, meiner Mutter jüngste Schwester, welche mit uns lebte, waren treue fromme Menschen. Sie hatten in dem Magister Stenzler, dem Großvater des jetzigen Professors Stenzler in Breslau, Pastor in Garz, einen vorzüglichen Prediger und Seelsorger. Keinen Sonntag ward die Kirche ohne den gültigsten Grund versäumt, bei schlechtem Wetter hingefahren, bei schönem und im Sommer hingegangen, wo der Vater denn seine älteren Buben neben sich herlaufen ließ. Diese durften aber auch bei keiner Katechismusprüfung in der Nachmittagskirche nicht fehlen, sondern mußten zum zweitenmale über Feld laufen. Wenn der Vater dann nicht mitging, so gab er uns seinen alten Großknecht zum Führer, einen christlichen biblischen Mann, Jakob Nimmo mit Namen, der mein besonderer Beschützer war. Weil ich kleiner zehnjähriger Junge mich nämlich damals eines sehr guten Gedächtnisses erfreute und großen Eifer und viel Belesenheit in der Heiligen Schrift hatte, so prangte ich durch die Stelle, die mir der Herr Magister eingab, bei der Kinderprüfung in der Kirche an der obersten Stelle, und hatte viel größere Jungen und Dirnen, unter andern auch meinen älteren Bruder Karl und ein paar große Fräulein mit mächtigen Lockengerüsten, eine von der Lanken und eine von Barnekow unter mir. Weil ich nun beim Aufsagen und Vorlesen große Zuversicht hatte, und es da, wie blöde ich sonst auch war, wie aus einer Trompete aus mir herausklang, so rechnete der alte treue Jakob sich das gleichsam zu seiner Ehre an, und ging wie triumphierend mit mir zu Hause.
Frühling und Sommer gingen freilich nicht ganz ohne Schule hin, indessen war die Schule unter den Gespielen in Feld und Wald und auf Wiesen und Haiden und unter Blumen und Vögeln wohl die beste. Doch ließ der Vater uns nicht immer bloß wild und wie aufs liebe Ungefähr herumlaufen, sondern wußte es meistens so einzurichten, daß wir bei dem Herumspringen und Herumspielen irgend etwas auszurichten und zu bestellen hatten. In der Zeit aber, wo auf dem Lande alle Hände angestrengt zu werden pflegen, mußten wir älteren Buben nach unsern kleinen Kräften auch schon mit heran, nämlich in der Zeit der Saat und der Ernte, vorzüglich in der letzteren. Da ward ich wohl zuweilen ein göttlicher Sauhirt oder Kuhhirt und mein Bruder Karl, der Rossetummler, der eigentlich den mir abgestrittenen Namen Philipp hätte haben sollen, ein flinker Rossehüter. Ich erntete wegen meiner sorgsamen Gewissenhaftigkeit nicht mißznhüten auch hier Lob ein, und noch leuchten mir die ersehnten glänzenden Abendröten, wo ich fröhlich meine Kuhherde in den Hof trieb und dann geschwind in der Dämmerung noch auf einen Äpfel- oder Kirschbaum kletterte, wo ich süße Beute für mich wußte. Meistens aber hatte die freundliche Base Sophie schon für mich gepflückt und aufgehoben.
Unser gewöhnliches Kinderhausleben ward durch die Sitte der damaligen Zeit, durch die Umstände der Familie und durch den Charakter der Eltern bestimmt. Die Sitte war damals beides feierlich und streng, und Kinder und Gesinde wurden bei aller Freundlichkeit und Gutherzigkeit der Eltern und Herrschaften immer im gehörigen Abstande gehalten. Es ward selbst in den untern Ständen im allgemeinen eben so sehr, als man sich jetzt lotterig oder ungezogen gehen läßt, nach einer gewissen Vornehmigkeit und Zierlichkeit gestrebt. Der Vater war von Natur zu gleicher Zeit heftig und lebhaft und freundlich und mild, tummelte und beschäftigte die Jungen meist draußen herum, im Hause aber überließ er sie, wie es in diesem Alter sein mußte, fast ganz der Mutter. Die Mutter war von Charakter ernst und ruhig und eine Seele, die auf Schein und Genuß gar keinen Wert legte, auch kein Bedürfnis davon hatte. Diese Frau, welche ihre irdischen Sorgen und Geschäfte so treu und eifrig erfüllte, lebte doch fast wenig von irdischer Luft und irdischem Stoff. Kein Kaffee, kein Wein noch Thee ist fast jemals über ihre Lippen gekommen, Fleisch hat sie wenig berührt, sondern sich von Brot, Butter, Milch und Obst ernährt. Dieses mäßige Leben ward auch für die Kinder zur Regel gemacht, und wir älteren Bursche sind fast streng erzogen worden. Eben so wenig ward uns in Beschuhung und Bekleidung Weichlichkeit gestattet. War bei einem Nachbar, auch wohl bei einem Freunde, der wohl auf einer Meile Entfernung von uns wohnte, etwas zu bestellen, der Vater schrieb das Briefchen, das zahme Rößlein ward gesattelt, der Junge drauf gesetzt, und ohne Mantel und Überrock, es mochte Sonnenschein oder Regen und Schneegestöber sein, mußte er mit seinem Gewerb fortgaloppieren. Ja der Vater noch jung und kräftig, fühlte mit unserer Pimplichkeit kein weichliches Mitleid. Fuhr er im Winter Stunden weit mit klingendem Einspännerschlitten zu Verwandten oder Freunden, so mußten die älteren Buben zur Seite oder hinten aufhocken, und, wenn sie fror, nebenbei springen, um sich zu erwärmen. Ja, mich erinnert's, wie ich als ein Junge von neun oder zehn Jahren im fremden Hause auf einem Stuhl oder Bett eingeschlafen lag, während die Männer Karten spielten; wie der Vater mich dann um elf oder zwölf Uhr nachts aufrüttelte und ich schlaftrunken in den Schlitten hinaus mußte; wie er dann zum Spaß recht absichtlich mehrmals umwarf, daß ich mich im Schnee umkehren mußte; wie ich denn auch immer alert sein mußte, wenn wir durch Koppeln und Dörfer kamen, die Schlagbäume zu öffnen. Wehe mir, wenn ich, mich aus dem Schnee herauswühlend, eine weibisch plinsende Gebärde gezeigt hätte!
Was nun Beschädigungen, Zerreißungen und Verletzungen an Kleidern und Leibern und andere dergleichen Nöte betraf, welche die Jugend sich selbstwillig oder gar mutwillig ohne Auftrag zugezogen hatte, so mochte sie zusehen, sie vor den Augen des Vaters zu verstecken, geschweige, daß sie bei ihm Hilfe oder Mitleid hätte suchen können. Kam dergleichen zufällig vor sein Angesicht, so ward neben Schmerz und Not Mutwille und Unvorsichtigkeit noch gebührlich gezüchtigt. Böse Fälle von Bäumen oder Pferden, Versinkungen in Wasser und unter Eis und Wiederherausreißungen, wie alltäglich waren solche Geschichten! Ich erinnere mich, daß ich eines Tages, als Ohm Schumacher aus Stralsund und Magister Stenzlers nebst vielen Damen bei uns waren, und wir Kinder unsre Sonntagskleider angezogen hatten, auf dem Teiche an der Bleiche durchs Eis einbrach und schon einmal versunken war, als mein Bruder Karl mich beim Schopf faßte und herauszog. Ich machte mich nun mit den nassen triefenden Kleidern in die Gesindestube, wo ich an dem warmen Ofen meine Oberfläche leidlich abtrocknete. In diesem Zustande mußte ich, als es dunkel geworden, in dem Gesellschaftszimmer erscheinen. Die Männer spielten L'hombre; die Frauen saßen am Theetisch, und eine las aus dem SiegwartA3 vor; und ich Armer stand scheu und bange, irgendwie berührt oder befühlt zu werden, an der dunkeln Ofenecke, so sehr als möglich vom Lichte abgekehrt, und blinzelte über die Schultern der Frauen zuweilen mit auf die Bilder des Romans, aber meine Seele zag te und mein Leib zähneklappte. Da erschien meine Retterin, die gute Tante Sophie; sie fühlte zufällig meinen nassen Rock, zog mich ins Nebenzimmer, erfuhr mein ganzes nasses Abenteuer und erbarmte sich meines Elends. Flugs war ich ausgekleidet, mit einem warmen Hemd angethan, und so ins Bett. Die nassen Kleider wurden getrocknet und geebnet, und den andern Morgen erschien ich zierlich und wohlgemut wieder in der Gesellschaft. Die Base aber hatte unter dem Titel von Zahnweh, wovon ich als Kind schon genug geplagt worden bin, mein Wegschleichen entschuldigt.
Ich habe eben gesagt, daß damals alles nach einer gewissen Vornehmigkeit und Zierlichkeit strebte. Dies ging durch alle Klassen durch bis zu denen hinab, welche an die alleruntersten grenzen. Mein Vater war der Sohn eines Hirten, ein Freigelassener, der bei einem großen Herrn gedient und durch die Gunst der Umstände sich ein bißchen aus dem Staube herausgebildet hatte. Er war ein schöner stattlicher Mann und hatte sich durch Reisen und Verkehr mit Gebildeten so viel Bildung zugeeignet, als ein Ungelehrter damals in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Er war an Verstand und Lebensmut vielen überlegen, und war in vielen Dingen geschickter, schrieb sein Deutsch und seinen Namen richtiger und schöner, als die meisten Landräte und Generale jener Zeit. Kurz, er war ein hübscher anständiger Mann, wenigstens für das Ländchen Rügen, wie die Menschenkinder dort damals miteinander verkehrten, und hielt mit den würdigsten Geistlichen, Beamten uud kleineren Edelleuten der Nachbarschaft Umgang. Man behalf sich da, wie die arme Zeit, wo alles äußerst wohlfeil und das Geld also sehr teuer war, mit der leichten nordischen Gastlichkeit, welche in unserer Landschaft durch die schwedischen Sitten, woran sie sich in anderthalb Jahrhunderten hatte gewöhnen müssen, vielleicht im ganzen Norddeutschland die frohherzigste war. In Jagd, Spiel und Verkehr ging alles auf das freundschaftlichste und herzigste miteinander um. Von den Geistlichen waren die Herren Stenzler und Krüger, von den benachbarten Edelleuten einige von Kahlden vom Zudar und ein von der Lanken öfter in unserm Hause. Mein frommer und freundlicher alter Christengel von Wolke war leider schon seit einigen Jahren wieder in sein hinterpommersches Kassubien gezogen.
Versteht sich, daß die Jungen des Pächters Ludwig Arndt Pächterjungen blieben, arme kleine Geelschnäbel, die in eigengemachten Jäckchen und Höschen und in geflickten Schnürstiefelchen vor den Herren ihre Bücklinge machen mußten. Aber die armen Schelme mußten doch schon ihre Bücklinge machen, und wie! Bei alltäglichen Gelegenheiten ging es alltäglich her, aber bei festlichen Gelegenheiten, bei Feierschmäusen, Hochzeiten u.s.w., was waren das für Anstalten und Zurüstungen auch bei so kleinen Leuten, als die Meinigen waren! Ich erzähle aus den Jahren 1770 und 1780. Also stehe es!
Es ging bei solchen Gelegenheiten in dem Hause eines guten Pächters oder eines schlichten Dorfpfarrers ganz eben so her, wie in dem eines Barons oder Herrn Major Von, mit derselben Feierlichkeit und Verzierung des Lebens; aber freilich steifer und ungelenker, also lächerlicher und alberner. Es war nur der Perückenstil oder der heuchlerisch welsch und jesuitisch verziertichte und vermanierlichte Schnörkel- und Arabeskenstil, der von Ludwig dem Vierzehnten bis an die französische Umwälzung hinab gedauert hat. Noch lächelt mir's im Herzen, wenn ich der Putzzimmer der damaligen Zeiten gedenke. Langsam feierlich mit unlieblichen Schwenkungen und Knicksungen bewegte sich die rundliche Frau Pastorin und Pachterin mit ihren Mamsellen Töchtern gegeneinander, um die Hüften wulstige Poschen geschlagen, das oft falsche dicht eingepuderte Haar zu drei Stockwerken Locken aufgetürmt, die Füße auf hohen Absätzen chinesisch in die engsten Schuhe eingezwängt, wacklig einhertrippelnd. Die Männer nach ihrer Weise ebenso steif, aber doch tüchtiger. Bei diesen hatten die großen Bilder des siebenjährigen Krieges den wälschen Geschmack etwas durchbrochen. Man mochte mit Recht sagen, es waren die komischen Transfigurationen Friedrichs des Zweiten und seiner Helden. Mächtige Stiefeln bis über die Kniee aufgezogen, schwere silberne Sporen daran, um die Kniee weiße Stiefelmanschetten, in den Händen ein langes spanisches Rohr mit vergoldetem Knopf, ein großer dreieckiger Hut über den steif einpomadisierten und eingewächseten Locken und der langen Haarpeitsche – da war doch noch etwas Männliches darin. – Und die Jungen? Selbst diese kleinen unbedeutenden Kreaturen mußten schon mit heran. O es war eine schreckliche Kopfmarter bei solchen Festlichkeiten. Oft bedurfte es einer vollen ausgeschlagmen Stunde, bis der Zopf gesteift und das Toupet und die Locken mit Wachs, Pomade, Nadeln und Puder geglättet und aufgetürmt waren. Da ward, wenn drei bis vier Jungen in der Eile fertiggemacht werden sollten, mit Wachs und Pomade draufgeschlagen, daß die hellen Thränen über die Wangen liefen. Und wenn die armen Knaben nun in die Gesellschaft traten, mußten sie bei jedermänniglich, bei Herren und Damen, mit tiefer Verbeugung die Runde machen und Hand küssen.
Das Possierlichste bei diesen Abkonterfeiungen und Nachkonterseiungen des seinen und vornehmen Lebens war noch der Gebrauch der hochdeutschen Sprache, welcher damals in jenem Inselchen auch für etwas Überaußes und Ungemeines galt und auch wohl gelten mußte, weil wenige damit ordentlich umzugehen verstanden, ohne dem Dativ und Akkusativ in einer Viertelstunde wenigstens einige hundert Maulschellen zu geben. Es gehörte nämlich unerläßlich zum guten Ton, wenigstens die ersten fünf bis zehn Minuten der Eröffnung und Versammlung einer Gesellschaft hochdeutsch zu radebrechen; erst wenn die erste Hitze der feierlichen Stimmung abgekühlt und die ersten Beklemmungen, welche der Überfluß von Komplimenten verursacht, über einer Tasse Kaffee verseufzt waren, stieg man wieder in den Alltagssocken seines gemütlichen Plattdeutsch hinunter. Auch französische Brocken wurden hin und wieder ausgeworfen, und ich weiß, wie ich mich in mir erlächelte, als ich das Wälsche ordentlich zu lernen anfing, wenn ich an das Wun Schur! Wun Schur! (Bon jour) und à la Wundör! (à la bonne heure!), oder an die Fladrun (flacon), wie das gnädige Fräulein B ihre Wasserflasche nannte, zurückdachte, und wie die Jagdjunter und Pächter, wenn sie zu Roß zusammenstießen, sich mit solchen und ähnlichen Floskeln zu begrüßen und vornehm zu bewerfen pflegten.
Ich galt in diesen Tagen für einen treuen, gehorsamen und fleißigen Jungen, aber zugleich für einen ungestümen und trotzigen, für einen solchen, der gern seinen eigenen Weg ging. Mein Bruder Karl war ein leichter, gewandter und liebenswürdiger Wildfang, zu Roß und zu Fuß der Kühnste und Geschwindeste, später im Jünglingsalter so geschwind, daß er im Laufe nie seinesgleichen gefunden hat. Fritz, zwei Jahre jünger als ich, war mild und gleichmütig, ein geistiges Kind und körperlich noch sehr zart. Die anderen waren klein. Ich war zugleich trotziger und blöde als beide und konnte von Fremden ihnen gegenüber daher leicht ins hintere Register gestellt werden.
Große Angst habe ich meinen guten Eltern in Dumsevitz einmal gemacht; in wirklicher Lebensgefahr bin ich dort zweimal gewesen.
Die Angst. Es war einen Abend, einen jener thaulosen Abende, wo man beim Mondschein wohl bis zehn elf Uhr das Korn noch einzufahren pflegt. Die Arbeit war geendet, Menschen und Kreaturen zu Hause, und die meisten auch schon zur Ruhe – siehe! da fehlte, als man die Köpfe überzählte, meine Kleinigkeit. Eine halbe Stunde geduldete man sich meiner Abwesenheit, weil man gewohnt war, daß ich schon in jenem Alter auf eigenen Wegen und Stegen wohl einsam auch im Dunkeln umherstrich; endlich aber ward man unruhig, und als es gegen die Mitternacht ging, stellte sich der ängstliche Gedanke ein, ich möchte in irgend einen Teich gefallen, übergefahren sein, oder gar das Gräßliche, ich sei vielleicht in der Scheune irgendwo im Stroh eingeschlafen und von rasch übergeworfenen Garben zugedeckt und lautlos und klagelos erstickt. Alles lief nun suchend umher. Meiner Base Sophie fiel ein, sie habe mich den vorigen Abend, wo die Binderinnen umweit dem Dorfe Preseke Gerste banden, im Mondschein längs dem Meeresstrande hingehen und dort lange am Ufer sitzen und gegen die pommerschen Gestade und den reizenden Vilm hinschauen sehen; vielleicht sitze ich dort wieder und erlustige Herz und Augen. Da war sie denn hingelaufen und hatte an dem Ufer weithin jeden Dornbusch und Distelbusch durchstöbert, ob ich etwa dahinter versteckt oder eingeschlafen sei. Aber vergebens. Nach langem und vergeblichem Suchen waren aus der liebenden Brust und dem hellen Munde Klagegetön und Weherufe hervorgebrochen und endlich bis zu dem verlorenen Schläfer hingeklungen. Ich war nämlich plötzlich und gespenstisch, durch die Mondscheinnebelgestalten hinstreichend, neben ihr erschienen und hatte ihr bei ihrem Erstaunen einen alten Hagedornbaum, wie sie in Rügen in den Feldern hie und da sehr groß und kraus stehen, gezeigt, wo der müde Junge sich abendlich hingehuckt hatte und eingeschlafen war. Sie riß mich nun mit geschwindesten Schritten zu Hause. Ich langte bald vor dem richterlichen Angesicht der Eltern an, kam aber diesmal, da der Zorn durch die Angst zermalmt war, mit leisen Verweisen davon.
In Lebensgefahr bin ich gewesen: das eine Mal, als ich unter das Eis geraten war, und mein Bruder mich faßte und herausholte; das zweite Mal, als nichts Geringeres als ein Wagenrad mir über den Kopf gelaufen war. Ich hatte mich nämlich auf einem großen vierspännigen Erntewagen ins Feld fahren lassen, war beim Zurückfahren des beladenen Wagens neben dem Knecht auf das Beipferd gestiegen, und bei einem Sprunge desselben herabgefallen – und siehe ein Rad des Wagens war mir hinter dem Ohre so über den Kopf gegangen, daß Haut und Haar blutig abgestreift worden. Doch war dem Knaben der Schädel nicht zerbrochen, sondern er blutete nur tüchtig. Wahrscheinlich hat, wie so oft im Fahren geschieht, das Rad, das mich nicht voll treffen sollte, erst einen Sprung über einen Stein und also halb in der Luft leichthin über meinen Kopf gemacht; sonst bleibt es unbegreiflich. Hier salbte und wusch die gute Tante mich wieder, damit ich nicht anderswo gewaschen würde. Als die Wunde vernarbte, durfte die Begebenheit unschädlich erzählt werden.
Dies waren Unfälle, und dergleichen nebst anderen Nöten mögen wohl mehr über unsere Köpfe hergefahren sein; aber sie sind längst vergessen, und es tauchen aus jener jetzt so fernen Vergangenheit nur Bilder von Freudenerinnerungen auf. Nur eine einzige bittere Erinnerung nahm ich mit, und zwar die Erinnerung der ersten lügenhaften Ungerechtigkeit, die an mir gefrevelt ist, und die auf lange hin einen tiefen Stachel in mir zurückgelassen hat. Denn des Unrechts, das ein lieber freundlicher Vater den Kindern ein paarmal mit dem Stock und der Rute angethan hat, und das nach dem Brauche jener Zeit ein ziemlich allgemeines Unrecht war, will ich nur kurz gedenken. Dieses Unrecht bestand darin, daß der kleine Trotzkopf, wenn er gezüchtigt ward, nicht weinen noch viel weniger für die erlittene Strafe sich bedanken und handküssen wollte; weswegen er in Verhältnis gegen seine thränenreicheren Brüder gewöhnlich die doppelte Bescherung erhielt.
Es war Herbstjahrmarkt zu Gartz. Die ganze Dumsevitzer Familie war bei dem Herrn Magister Stenzler zu Mittag genesen und fand sich nachmittäglich um den Kaffeetisch der alten verwitweten Pastorin Magisterin von Brunst sitzend, deren Mann vorlängst auch Pfarrer des Städtchens Gartz gewesen. Dort in dem vollsten Gewimmel von Damen und Herren, als der Herr Magister mich vorzeigte und als einen fleißigen Schüler lobte, erhob sich aus dem Kreise der Damen eine damals noch junge rosige und mit den schönsten schwarzen Muschen auf den Wangen gezierte und mit Federbüschen und seidenen Bändern den Kopf umflatterte Mamsell, die Schwester der Frau Magisterin Stenzler, Mamsell Dittmar aus Greifswald, und machte gegen mich die förmliche Anklägerin. Der Gegenstand der Anklage war aber folgender: Mein Bruder Karl und ich traten, wenn wir vormittags in die Kirche gingen, häufig in dem Hause des Herrn Magisters ab, wurden auch oft zu Mittag da behalten, um nachmittags in das Katechismusexamen zu gehen, und dann den Rest des Sonntags mit dem Sohn des Hauses, Lorenz Stenzler, und einigen Junkern von Kahlden, welche gewöhnlich auch da waren, zu verspielen. Da ging es denn natürlich in dem Garten des Herrn Magisters, auf dem alten Gartzer Schloßwall der weiland heidnischen Festung Carenza und bis in den Wuld von Rosengarten hinein lustig und wild jugendlich und knabenlich her. Hühnernester und Eier in Scheunen und auf Speichern, Vogelnester in Hecken und Wäldern, Igel und Gewürm unter Sträuchern und Blumen suchen, und was anderer Jungenheit und Knabenheit mehr ist, nebst wilden Sprüngen und Spielen – das alles fehlte natürlich nicht. Nun hatte man aber einige Tage vor dem Jahrmarkt in dem Garten des Herrn Magisters gefunden, daß mehrere hinter einem kleinen Schuppen stehende Mistbeetenfenster zertreten waren, und die Spuren von Knabenfüßen daneben. Davon stand in der Gesellschaft zufällig die Rede, und die rosige schwarzbemuschte Mamsell fuhr heraus: »Wer das gethan hat, ist nicht zweifelhaft, das ist der wilde Monsieur Moritz, der immer wie ein loses Füllen daherspringt und mit so kecken Sprüngen über die Büsche und Blumen wegsetzt.« Mit diesen Worten wiesen ihre Blicke auf mich, so daß ich selbst den Unbekannten in dem Kreise gezeigt ward. Auch meine Eltern schienen der Aussage Glauben beizumessen; nur die Tante Sophie rief eben so zuversichtlich, als die Anklage gesprochen hatte, in die Gesellschaft hinein: »Nein, der Moritz hat es gewiß nicht gethan, der ist wohl wild, aber er pflegt nicht gern etwas zu beschädigen.« Der Moritz aber, der die Glaszerbrecher wohl kannte (Bruder Karl und Herr Lorenz Stenzler waren beim Balgen auf das Mistbeet gefallen) ging wie ein beschneiter Hund von dannen, und machte sich in den Stall zu dem Kutscher, um so unbemerkt und unsichtbar als möglich zur Zeit der Abfahrt zu den übrigen in den Wagen zu steigen. Zu Hause gab es denn des Abends noch eigne Scheltungen und Warnungen, wogegen ich weiter nichts thun konnte, als meine Unschuld beteuren, jedoch ohne die Verbrecher anzugeben.
Dies begab sich, wie ich meine, in dem letzten Jahre unsers Dumsevitzer Lebens und sank tief in mein Herz. Ich weiß, daß ich nimmer ins Hans und in die Gesellschaft zu bringen war, wenn die Frau Magisterin und ihre muschige Schwester uns besuchen kamen, sondern mich so lange zu den Hirten oder in die benachbarten Bauernhäuser, besonders zu meinem Spielgesellen Ludwig Starknois verlief, und mich dort so lange enthielt, bis ich vermutet oder erlauscht hatte, daß die grauenvollen Menschen weg waren. Selbst gegen den verehrten und freundlichen Herrn Magister ward ich etwas scheu, weil ich meinte, er hätte bei der Anklage, die selbst meine gute Eltern verlegen und stutzig machte, meine Verteidigung übernehmen müssen.
So waren hier in Dumsevitz bei Gartz die ersten Knabenjohre verflossen. Im Jahre 1780, wenn ich mich recht erinnere, zog mein Vater von Dumsevitz ab in die südwestliche Ecke der Insel, eine Meile von Stralsund, wenn man das zwischenströmende Meer mitrechnet. Er übernahm zwei sundische Güter, Grabitz und Breesen, nebst zwei Bauerndörfern, Giesendor und Gurvitz, deren Bauern Hofdienst leisteten, oder vielmehr er kaufte sich das noch auf vier Jahre rückständige Pachtrecht derselben mit einer ganz bedeutenden Summe von einem Obersten von Schlagenteufel. Der Vater dieses Obersten war im Munde des Volks fast zu einer mythischen Person geworden. Er war ein Hüter der Schafe gewesen, wie mein Großvater seliger, und es war dem jungen Hirten gelungen, sich eine gute Nacht unter die mondscheinlichen Tänze der Unterirdischen einzuschleichen und einem der kleinen Lilliputter sein unverlierbares Käppchen nebst Glöckchen, woran das Glück ihres Daseins geknüpft ist, zu entreißen. Das hatten die kleinen Leute von ihm mit großen Schätzen wiedergelöst, und dafür hatte er sich das Gut Grabitz gekauft, welches, ich weiß nicht, durch welche Verhandlung, aus seiner Hand in den Besitz des Klosters St. Jürgen vor Rambin gekommen war. Genug, der Schäfer war plötzlich reich und Eigentümer eines hübschen Gutes und endlich Edelmann geworden. Seine Söhne waren in herzoglich braunschweigische Dienste getreten, und mehrere derselben hatten als Offiziere in den brauuschweigischen in Englands Sold gegebenen Regimentern gegen die junge nordamerikanische Freiheit gefochten. Einige von ihnen, worunter auch der Oberst, kauften sich später Rittergüter in Pommern. Mit einem derselben, dem Major von Schlagenteufel, einem sehr würdigen Mann, begegnete mir eine Josephsgeschichte, die mich hätte eitel machen können. Als er aus Amerika zurückkam, besuchte er seine Heimat und auch seine Geburtsstelle Grabitz, und ließ sich meines Vaters Fünfzahl von Buben vorführen. Nach der Musterung griff er mich heraus, und sagte zum Vater: »Wenn Sie mir einen der Jungen schenken wollen, nehme ich diesen.« Neben mir stand mein Fritz, ein ganz anderer Kerl, aber damals kränklich und winterweich; und ich errötete in mir, und fühlte, daß der Herr Major sich vergriffen hatte.
Die Güter Grabitz und Breesen mochten etwa zwölf bis dreizehn Last jährlicher Aussaat haben; das hübsche Dorf Giesendorf stieß dicht an Grabitz. Die Gegend war nicht so romantisch als die um Schoritz und Dumsevitz, welche gleichsam schon die Augrenze der paradiesischen Meerbuchten und Wälder von Putbus sind. Indessen wir waren gottlob wieder ans Meer gekommen, fanden reichliche Obst- und Blumengärten, und auch noch ein paar Wäldchen, die Lau2 bei Grabitz, den Tannenwald bei Breesen, und den größeren noch näheren Tannenwald an dem Kloster St. Jürgen vor Rambin. Wir hatten die Herrlichkeit des Binnenmeeres fast mächtiger als bei Schoritz und Dumsevitz. Es bildet nämlich das Meer von dem Gellen bei Barhöft3 und Pron an der pommerschen Küste und von der Insel Hiddensee ab einen drei bis vier Stunden tiefen und drei bis eine Stunde breiten Busen, wohinein die Ostsee bei Nord- und Nordoststürmen gewaltig zurückschlagend strömt. Unser Grabitz lag auf einer kleinen Erhöhung an fetten weitgestreckten Wiesen und Weiden, die längs einem halben Dutzend Höfen und Dörfern weit am Strande hinlaufen. Wir hatten bei mächtigen Stürmen die schauerliche Freude, daß sich die Wogen etwa fünfzig Schritt von unserem Hofe heranwälzten. Alle Wiesen waren dann ein einziger unendlicher See, und welche Wonne, wenn solches im Dezember oder im Januar geschah und ein geschwinder Frost die Wasser in metallfestes und metallspiegeliges Eis verwandelte!