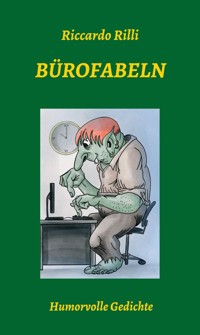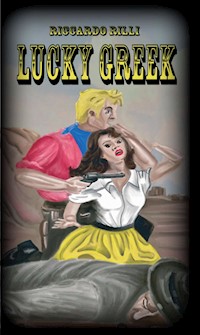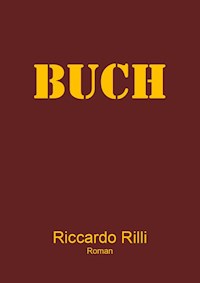4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen an eine Kindheit zwischen Vernachlässigung und Missbrauch. Paula Baumann erzählt ihre Vergangenheit in diesem sehr persönlichen Buch eindringlich, offen und ungeschönt. Es ist die Aufarbeitung ihres Schicksals, das sie auch heute noch, vierzig Jahre später, nicht zur Ruhe kommen lässt. Riccardo Rilli verarbeitet die ursprünglich tagebuchähnlichen Aufzeichnungen zu einer mitreißenden Erzählung über ihre tragischen Erlebnisse, und wie diese bis in die Gegenwart hineinwirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
P. Baumann & R. Rilli
Erinnerungen eines vergessenen Mädchens
© 2016 P. Baumann & R.Rilli
Umschlag, Illustration: Riccardo Rilli
Lektorat, Korrektorat: Richard Götz
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-8776-4
e-Book
978-3-7345-8778-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Namen und Handlungsorte wurden aus Personenschutzgründen verändert.
Vorwort
Zwei Welten
Die ersten Jahre
Die Fenstergeschichte
Gedanken 2006
Ein Traum I
Erfahrungen mit dem Tod
Ein Traum II
Kontakt zu meiner Schwester
Legasthenie
Gedanken 2007
Ein Traum III
Etwas Positives
Der Anfall
Die späteren Jahre
Weggenommen
Gedanken 2008
Ein Traum IV
Ein Geheimnis
Die Geburtstagsfeier
Kein Kind
Gedanken 2009
Seidentücher
Missbrauch
An Vater
An Mutter
Das Leben ist nicht das, was man gelebt hat, sondern das, woran man sich erinnert und wie man sich erinnert, um davon zu erzählen. Das ist das Leben.
Gabriel Garcia Márquez (1927-2014)
Vorwort
Der vorliegende Text ist eine Biografie, aber auch wieder nicht. Basis für dieses Werk sind die Aufzeichnungen von Paula Baumann, die sie in unregelmäßigen Abständen (manchmal mit mehreren Jahren Pause) zu Papier gebracht hat. Das Buch besteht aus Fakten, aber hauptsächlich aus Erinnerungen, Emotionen und Anschauungen. Ich möchte hierzu einen kleinen Ausschnitt aus „Elementarteilchen“, einem Roman von Michel Houellebecq, zitieren. Der Protagonist des Buches sagt:
„Du verfügst über Erinnerungen aus verschiedenen Augenblicken deines Lebens. Diese Erinnerungen tauchen in unterschiedlicher Form auf; du siehst im Geist immer wieder Gedanken, Motivationen und Gesichter vor dir. Manchmal erinnerst du dich nur an einen Namen, wie zum Beispiel diese Patricia Hohenweiller, von der du mir eben erzählt hast und die du heute garantiert nicht mehr wiedererkennen würdest. Manchmal siehst du wieder ein Gesicht vor dir und bist unfähig, irgendetwas damit zu verbinden. Alles, was du zum Beispiel über Caroline Yessayan weißt, hat sich mit großer Genauigkeit auf jene wenigen Sekunden verdichtet, in denen deine Hand auf ihren Schenkeln lag. […] Die Geschichte, die du ausgehend von deinen Erinnerungen rekonstruieren kannst, ist eine stimmige Geschichte.“
Genauso verhält es sich mit diesem Buch.
Mein bescheidener Beitrag bestand darin, die Fülle an Erinnerungen zu sortieren und in eine möglichst zusammenhängende, lesbare Form zu bringen. Manchmal, vor allem bei Berichten von hoch emotionalen Geschehnissen, war es nötig, Sätze umzuformulieren, da im Originaltext starke Gefühle bestimmend waren und die Inhalte für den Leser nur schwer nachvollziehbar gewesen wären.
Bei der Bearbeitung des Textes habe ich mich darum bemüht, ihn weitestgehend so zu lassen, wie er war. Ihm seine Aussage, die Seele nicht zu nehmen. Die Emotionen am Leben zu erhalten. Mancher Lektor würde sich wahrscheinlich ob einiger Formulierungen die Haare raufen, aber das ist Paula Baumann, wahrhaftig und ungeschönt, zum Zeitpunkt, an dem sie sich hingesetzt, erinnert und aufgeschrieben hat, was sie belastete. In den Augenblicken der Erinnerung war sie im Damals, in der Welt ihrer Kindheit. Sie sagte mir einmal: „Ich habe richtige Sätze im Kopf, mit einer Stimme. Und dann schreibe ich das einfach auf.“
Sich in die dunklen Abschnitte seines Lebens zurückzuversetzen und schlimme Erlebnisse nochmals zu durchleben, als passierten sie gerade, verdient Hochachtung. Es bedarf Mut und Entschlossenheit, die ich dadurch würdigen wollte, indem ich zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen mein kleines Scherflein beitrug.
Das Buch folgt in weiten Teilen keiner Chronologie. Nur wenige Abschnitte zeichnen den Verlauf ihres Lebens in der richtigen Reihenfolge nach. Manche Kapitel erzählen einzelne Erlebnisse, andere behandeln für sie wichtige Themen. Dazwischen finden sich Bereiche, die ihre Gedanken im jeweiligen Jahr der Aufzeichnung abbilden.
Ich denke, es ist mir gelungen, trotz der Unterschiedlichkeit und der Fülle an Text, ein Werk zu gestalten, das in sich geschlossen und spannend zu lesen ist. Ich wünsche Ihnen dabei angenehme Stunden. Allerdings wage ich nicht zu unterschreiben, dass Sie immer Spaß an der teilweise schweren Lektüre haben werden. Aber so ist eben das Leben.
Riccardo Rilli
Zwei Welten
Das Leben hat mich – Ich habe kein Leben!
Ich lebe in zwei Welten.
Die eine ist die, in der das Leben mich hat. In der ich nach außen hin eine nette Person abgebe. Ich bin freundlich, hilfsbereit, fürsorglich, hübsch. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich eingebildet bin, denn das bin ich bestimmt nicht. Das ist die Welt, in der ich einen Freund habe, in der ich arbeite. Wo man Kollegen und Kolleginnen hat, mit denen man sich in Gesprächen über Dinge austauscht und einfach miteinander arbeitet. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr nette, verständnisvolle Kollegen und Kolleginnen habe. Ich bin sehr froh darüber, in dieser menschlichen Gruppe zu sein. Es sind vorwiegend Männer und eine Frau. Mich stört das Geschlechterverhältnis nicht. Ich war sieben Jahre lang in einer reinen Frauenabteilung. Aber hier fühle ich mich wohler.
Die andere Welt ist die, in der ich kein Leben habe.
Das ist die, in der ich sehr viel nachdenke. Wo mir viel Verschiedenes einfällt, das mich traurig macht. Worauf ich keine Antworten habe. In der Welt werde ich mit vielen Dingen meines Lebens konfrontiert, mit denen ich nicht fertig werde. Zum Beispiel, was den Missbrauch durch meinen Stiefvater betrifft.
Meine Eltern sind geschieden. Wie gesagt, bin ich jetzt in einer fast reinen Männerabteilung, aber das stört mich nicht. Im Gegenteil. Ich fühle mich hier wohl. Wie soll ich das beschreiben? Ich versuche hier, im übertragenen Sinn, das kennenzulernen, was ich nie erfahren durfte. Eine normale „Mann, Vater, Frau, Tochter“-Beziehung. Hier habe ich für mich die Möglichkeit entdeckt, diese Dinge kennenzulernen. Wir sind fünf Tage die Woche rund 40 Stunden zusammen. Da ich kein Zuhause hatte, wo ich das lernen konnte, sehe ich hier die Gelegenheit, es jetzt nachzulernen, um mit mir besser umgehen zu können. Es ist sehr schwierig für mich, denn ich habe kein Selbstbewusstsein und kein Selbstvertrauen. Ich bin mir ständig unsicher, egal was ich mache oder denke.
Es sind schon sehr früh Dinge in meinem Leben passiert, die mir mein Selbstbewusstsein genommen haben. Ich erinnere mich da an eine Geschichte:
Ich bin 1968 geboren. Zu meiner Zeit, in den 70ern, hat mich der Krampus bis in mein Kinderzimmer, bis unter mein Bett verfolgt, und mir die Kette nachgeschmissen. Ich hatte furchtbare Angst. Meine Mutter holte mich unter dem Bett hervor und ich musste zur Eingangstür gehen, denn dort stand der Nikolo, der von mir verlangte, dass ich ihm ein Gedicht aufsagte. Ich weiß noch genau, ich hatte furchtbare Angst und weinte wie ein Schlosshund. Ich dachte, der Nikolaus wüsste, dass ich Bettnässerin war und ich habe mich geschämt und fürchterlich geweint. Ich sagte mein Gedicht auf und bekam das Krampussackerl, das mich nicht interessierte. Ich lief weinend in mein Zimmer, warf mich auf mein Bett und heulte, weil ich mich vor all den Leuten so geschämt hatte. Das werde ich nie vergessen. Es hat mich kaputt gemacht.
Oder: Ich war schon sehr früh ihm Kindergarten. Bei den Kinderfreunden im 21. Wiener Gemeindebezirk. Meine Mutter war geschieden und sie musste arbeiten. Wie man aus den oberen Zeilen weiß, war ich Bettnässerin. Im Kindergarten machte ich die Erfahrung, dass wenn man in die Hose gemacht hat, muss man sich auf den Gang stellen und darüber nachdenken, warum man es gemacht hatte und nicht vorher aufs Klo gegangen war. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das nicht spüre, wenn ich aufs Klo muss. Aber mir hat niemand geglaubt. Die Tante Marianne hat mir öfters den Hintern ausgehauen, weil ich in die Strumpfhose gemacht hatte und ich keine weitere zum Wechseln mithatte. In meiner Kindergartenzeit ging es immer nur darum, dass ich in die Hose machte. Meine Mutter ging mit mir zu Ärzten. Aber organisch haben sie nichts gefunden.
Laut den Informationen meiner Mutter wurde ihr gesagt, dass sie mir ab 17 Uhr nichts mehr zu trinken geben sollte. Dann sollte sich das bessern. Ich habe sehr lange Zeit ins Bett gemacht. Meine Mutter schimpfte sehr viel mit mir, weil sie dauernd die Bettbezüge wechseln musste. Meine Mutter meinte, das wäre deswegen gewesen, weil ich eifersüchtig auf meine Schwester war, die damals, 1979, geboren wurde. Ich glaube mich aber daran zu erinnern, dass ich das bestimmt nicht in der Hauptschule gemacht habe. Nicht wegen meiner Schwester. Sondern schon im Kindergarten bis in die letzten Jahre der Volksschule, da ich zu diesem Zeitpunkt von meinem Stiefvater missbraucht wurde.
Meine Eltern haben sich vor der Kindergartenzeit scheiden lassen. In der Zeit habe ich mir auch sehr oft in die Hose gemacht. Also noch Früher als gedacht.
Jedenfalls haben sie im Kindergarten daran gearbeitet, mein Selbstvertrauen zu brechen.
Einmal habe ich einen Jungen in die Schulter gebissen. Er hatte mir den Sessel weggezogen, während ich mich setzte, und ich war derart erschrocken, dass ich mich umdrehte und ihm, ohne irgendwas dabei zu denken, in die Schulter biss. Daraufhin musste ich mich mit einem Maulkorb vorm Mund in die Kanzlei des Kindergartens setzen und warten, bis mich meine Mutter abholte. Sie wurde von dem Vorfall informiert. Stundenlang musste ich am Gang stehen, mit dem Korb am Mund, und warten, bis meine Mutter von der Arbeit kam. Dann gingen wir nachhause und meine Mutter fragte mich, warum ich das gemacht hätte. Ich weiß es heute nicht mehr. Meine Mutter hat geschimpft und mir gesagt, dass ich das nicht mehr machen solle. Denn so etwas täte man nicht.
Ab diesen Zeitpunkt wusste ich, dass ich mich nicht wehren darf, wenn mir etwas zustößt, was ich nicht möchte. Somit hab ich jahrelang meiner Mutter verschwiegen, dass mich mein Stiefvater begrabscht und zu sexuellen Handlungen genötigt hat. Bis zu meinem 16. Lebensjahr. Denn ab da ging meine kleine Schwester in die Schule und da hatte ich Angst um sie, dass sie das Gleiche durchmachen muss wie ich. Und das wollte ich nicht.
Begonnen hat es, als ich acht Jahre alt war. Es kam nie zu einer Anzeige, da es damals in den 80ern nicht üblich war, über solche Dinge zu sprechen. Mir wurde von meiner Mutter sogar gesagt, dass man das nicht jedem erzählen soll. Wie auch immer, es war damals so. Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Sie hat sich zwar von ihm getrennt und scheiden lassen, aber das half mir nicht. Ich fühlte und fühle mich noch immer unverstanden. Er hat mich belästigt und zu bestimmten Handlungen genötigt. Er hat mich beschworen, dass es unser Geheimnis bleiben muss, und wir es nicht der Mama sagen dürften, weil sie sich sonst aufregte.
Ich hatte tatsächlich Angst vor meiner Mutter. Dass sie mir gegenüber handgreiflich würde.
Einmal musste sie in der Volksschule zur Lehrerin, weil ich blaue Flecken hatte und der Lehrerin gesagt hatte, dass mich meine Mama geschlagen hätte. Das ist schlimm!
Über den Missbrauch wurde auch später, als ich älter war, nicht gesprochen. Meine 10 Jahre jüngere Schwester Claudia wusste es sehr lange nicht. Sie erfuhr es erst mit etwa 20 Jahren. Aber zu meiner Schwester kommen wir später nochmals zurück.
Diese Sache kommt öfter in mir hoch, weil ich das noch in mir trage und nicht damit umgehen kann. Ich verdrängte es viele Jahre und versuchte, es zu vergessen. Aber wirklich aufgearbeitet habe ich es nicht. Ich hasse ihn dafür so sehr, das kann sich niemand vorstellen. Mittlerweile ist er Tod. Aber so früh zu sterben ist unfair. Auch wenn er mir das angetan hat. Wenn ich daran denke, spüre ich eine Bedrängnis, ein Unwohlsein, das ich nicht mag, nicht will.
Ich war im Zwiespalt. Ich wollte, dass es aufhört und es meiner Mutter sagen. Doch ich konnte nicht, weil sie sich dann aufgeregt hätte, laut geworden wäre, und herumgeschrien hätte. Es hätte mir Angst gemacht und sie hätte sich vielleicht von ihm getrennt, obwohl Claudia noch klein war, und ich hätte ihr damit ihren Papa weggenommen. Das wollte ich ihr keinesfalls antun. Ich wollte ihr nicht wehtun, ich wollte ihr den Papa nicht wegnehmen. Ich wusste, wie das ist, wenn man keinen Papa hat und wollte nicht, dass sie so traurig ist wie ich. Ich habe ihrzuliebe die ganze Zeit geschwiegen. Sie versteht es auch heute noch nicht, was es heißt, sich für jemanden so aufzuopfern, dass man einiges passieren lässt, was man nicht will, und es einige Jahre einfach verdrängt. Sie ist wie meine Mutter. Eiskalt, ohne Gefühl und hat kein Interesse an mir.
Es kann manchmal verwirrend klingen, weil ich einfach drauflos schreibe, wie und was ich mir denke oder was in mir vorgeht.
Es tut mir gut, dass ich diese Seiten habe, um mir alles von der Seele schreiben zu können. Das ist für mich wie ein Buch oder einfach leere Seiten, die mir zur Verfügung stehen und denen ich erzählen kann, was mir so einfällt. Vor allem finde ich gut, dass diese Seiten kein Ende haben. Das heißt, ich kann schreiben und schreiben solange ich will und so viel ich will. Vor einem Jahr habe ich angefangen auf Papier zu schreiben. Doch ich musste mir jedes Mal ein liniertes Heft suchen, damit ich gerade schreibe. Die Linien helfen mir sehr. Ich habe mir die einzelnen Seiten herausgenommen. Ich habe nicht direkt im Heft geschrieben, sondern ich habe mir die Seiten herausgenommen und sie einzeln beschrieben. Im Laufe der Zeit hatte ich sehr viele lose, voll beschriebene Seiten. Die habe ich natürlich aufgehoben. Aber das war mir mit der Zeit etwas zu unübersichtlich und zu ungenau. Hier brauche ich mir die Seiten nur aufzurufen, und schon hab ich alles, was mich beinhaltet.
Was mir auch auffällt, ich schreibe in verschiedenen Zeiten. Oder aus verschiedenen Perspektiven. Aber ich sehe diese Seiten als Spiegel aller Facetten, die ich an mir habe. Oder erzählen möchte. Ich schreibe auch gerne mit der Tastatur.
Obwohl, als ich in die Büroschule ging, hat mir Maschineschreiben große Probleme gemacht. Da ich Legasthenikerin bin, habe ich mir immer schwergetan mit Links und Rechts. Und ich musste Blindschreiben lernen. Das war der reinste Horror für mich. Meine damalige Lehrerin hatte es wirklich nicht leicht mit mir. Ich hatte viele, viele Tests zu machen, damit wenigstens einer positiv ausging und damit ich im Zeugnis eine positive Note bekam. Ich hatte zuhause eine mechanische Schreibmaschine, mit der habe ich sehr viel geübt. Ich habe Zeitungsartikel abgeschrieben, um besser zu werden und zu lernen. Das ging, aber sobald ich in der Schule war und einen Test machen musste, war alles Geübte wieder weg. Ich war immer sehr nervös, total angespannt und ich hatte Angst, zu versagen. Was meistens auch passierte. Ich war oft sehr verzweifelt, wenn ich Tests im Maschineschreiben gehabt habe.
Heute ist das ganz anders. Ich finde, heute kann ich ganz gut Blindschreiben und Spaß macht es mir mittlerweile auch. Die Rechtschreibung ist noch nicht in Ordnung, aber dafür habe ich ja am Computer ein Rechtschreibprogramm, das mir hilft. Wenn ich etwas falsch schreibe, wird das vom Rechner unterwellt und ich kann herumprobieren, bis es richtig ist. Dann schau ich mir das Wort an und versuche, es mir zu merken, falls ich es das nächste Mal wieder benützen möchte. Damit es dann gleich richtig ist. Ja, so mach ich das! Somit versuche ich, dazuzulernen. Doch nun genug über „Schreibtechnik und Schreibmaschine.“
In dieser zweiten Welt bin ich nach wie vor ein kleines Kind und möchte auf all meine Fragen Antworten haben. Und da ich sie nicht habe und nicht bekomme, kann ich die beiden Welten nicht zu einer realen Welt verbinden.
Ich weiß, dass ich einige offene Probleme mit mir herumtrage und mir viele Fragen nicht beantwortet werden. Ich möchte aber versuchen, auf die mir noch offenen Fragen selbst Antworten zu finden. Vielleicht ist das für mich zu wenig. Aber wenn ich mir selbst Antworten auf meine Fragen finde, dann kann ich möglicherweise damit umgehen.
Ich möchte es so gerne lernen, damit umzugehen. Mit allem, was mir passiert ist. Ich bin sehr traurig, dass ich nur diese Seite von mir kenne und eigentlich nichts anderes. Ich kenne keine schönen Zeiten, die ich mit Mutter oder Vater verbracht hätte. Es gibt einfach keine. Ich finde einfach keine und das macht mich traurig. Sehr traurig. Ich bin total verbittert. Ich bin in einem Gedankenstrudel verloren und finde nicht heraus.
Es ist auch für andere schwer, mir herauszuhelfen, denn ich vertraue eigentlich niemandem. Mir fällt es schwer, jemand zu vertrauen oder mich ihm anzuvertrauen. Ich hatte niemanden, den ich vertrauen konnte. Die Menschen, bei denen ich glaubte, ihnen vertrauen zu können, haben mich immer enttäuscht. Mittlerweile kann ich es nicht mehr einschätzen, und merke gar nicht, wem ich vertrauen kann. Ich behalte immer alles für mich und versuche, alles unter Kontrolle zu bringen. Ich kann und darf niemanden etwas geben, sonst könnte ich enttäuscht werden. Und das Gefühl will ich auf keinen Fall mehr spüren. Darum lass ich nichts los. Ich kann nichts loslassen, sonst bin ich verloren.
So bin ich in mir selbst gefangen. Ich kann es kontrollieren, aber das ist für mich sehr anstrengend und ich denke mir: „Das kann doch nicht das reale Leben sein? Dass ich mich in mir gefangen halten muss, weil es für mich keinen Menschen gibt, dem ich vertrauen kann. Der mir Liebe gibt, mir Zuneigung gibt, mich auffängt.“
Ich habe das Gefühl, dass ich für meinen Freund zu anstrengend bin, weil ich bestimmt kein einfacher Mensch bin. Dauernd lebe ich in der Vergangenheit. Wenn das jemand nicht nachfühlen kann, ist es schwer zu verstehen.
Ich bin krank. Ich möchte lernen, mit dieser Krankheit umzugehen. Ich bin ein Kind, das in der Kindheit ungeliebt blieb, als Jugendliche missbraucht und als junge Frau allein gelassen wurde. Ich musste rasch selbstständig sein. Ob ich wollte oder nicht.
Ich wurde sehr früh allein gelassen. Ich konnte nie frei entscheiden. Nie sagen, wann ich niemanden mehr brauche oder wann ich ausziehen möchte. Das konnte ich nie selbst entscheiden. Ich konnte auch nicht mit den Menschen darüber diskutieren. Mir wurde gesagt, dass es so ist, und dass es so gemacht wird. Was anderes gab es nicht.
Wenn ich nicht nachgegeben habe, wurde mir gesagt: „Du kommst ins Heim! Du kannst ja Maria fragen, wie es dort ist. Sie kann Dir bestimmt etwas darüber erzählen!“
Vor dem Kinderheim hatte ich Angst. Maria, die 10 Jahre jüngere Schwester meiner Mutter, war in einem Heim, und ich denke mir, dass sie bestimmt von dort weg wollte, weil es eben nicht so toll war.
Also dachte ich mir: „Warum sollte ich dort hingehen, wenn Maria von dort immer weggehen wollte?“ Wozu sollte ich sie fragen? Sie hätte mir ohnehin nur erzählt, dass es dort beschissen war. Also habe ich immer das gemacht, was meine Mutter gesagt hat, obwohl ich nicht wollte. Für sie war das selbstverständlich.
Ich habe niemals Lob bekommen. Für rein gar nichts. Kein Lob von meiner Mutter. Mit ihr musste ich leben. Sie hat nie verstanden, was ich wirklich brauchte. Sie wusste es NIE. Sie hatte keine Ahnung von mir. Sie hat auch heute keine Ahnung von mir.
Aber vielleicht beginnen wir mit der Erzählung einfach einmal ganz von vorn:
Die ersten Jahre
Ich wurde 1968 geboren. Kurz darauf wurde festgestellt, dass meine linke Hüfte nicht ganz okay ist, und dass ich meinen Kopf stark nach links halte. Das rührte wahrscheinlich daher, dass ich eine Steißlage hatte. Jedenfalls bekam ich gegen die Hüftgelenksprobleme rund sechs Monate lang eine Hüftspreize, wie es eben damals vorgeschrieben war. Trotz der Spreizhose konnte ich bereits einen Monat vor meinem ersten Geburtstag laufen.
Wegen meinem Schiefkopf mussten meine Eltern den Schädel immer auf die rechte Seite drehen, sobald sie merkten, dass er nach links fiel. Es wurde mir von meiner Mutter später gesagt, dass meine linke Halssehne kürzer sei als die rechte, und wenn sie mir den Kopf auf die rechte Seite drehten, sollte es besser werden.
Ich weiß, meine Mutter wollte mich nicht. Damals, 1968, war es verboten, eine Abtreibung machen zu lassen. Es war strafbar. Wäre es damals schon möglich gewesen, hätten sich meine Eltern bestimmt dafür entschieden. Erst 1975 wurde es unter bestimmten Voraussetzungen legal. Dann ging meine Mutter abtreiben, denn nach mir hätte sie wieder ein Kind bekommen, vielleicht sogar Zwillinge, aber das wollte sie nicht. Noch nicht.
Ich war ein Kind von Eltern, die sich nur so nannten, weil ich ihnen geboren wurde. Doch im wahren Leben hatte ich nie Eltern. Ich war etwa eineinhalb Jahre alt, als sie sich scheiden ließen. Also noch sehr klein. Meine Mutter war erst 19, als ich zur Welt kam. Mein Vater war damals 21. Ich lebte bei meiner Mutter. Mein Vater war ausgezogen.
Mein Vater holte mich, wie es bei der Scheidung vereinbart wurde, alle 14 Tage am Wochenende zu sich, und am Sonntagnachmittag brachte er mich wieder nachhause zu meiner Mutter. Als ich noch ganz klein war, bekam ich das nicht mit, später schon. Ich weiß noch, dass mich mein Vater oder seine neue Freundin Barbara abgeholt haben und wir fuhren dann zu Oma Ursula, der Mutter meines Vaters. Dort war auch Tante Christel, Ursulas Schwester. Sie war sehr nett.
Ich war weder viel bei meiner Mutter, noch bei meinem Vater. Wenn ich bei meinem Vater war, dann waren wir immer einigen Stunden bei Oma Ursula. Oder bei der Tante. Oder ich war bei Barbara. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mit mir einen ganzen Tag verbracht hätte. Das gab es nicht.
Bei meiner Mutter war es dasselbe. Entweder war ich bei meinem Opa Ernst, dem Vater meiner Mutter, oder in Grünfeld, bei meiner Oma Renate, der Mutter meiner Mutter. Die beiden waren ebenfalls geschieden und lebten getrennt. Oder ich war bei Tante Carmen, der Schwägerin meiner Mutter. Oder bei der Freundin meiner Mutter, Rosemarie. Oder sie hat mich alleine in der Wohnung gelassen. Für mich war nie wer da. Wenn, dann immer nur kurz.
Unter den vielen Leuten gab es keine richtige Bezugsperson. Das fehlte mir sehr. Es verfolgt mich heute noch und macht mich fertig. Nicht zu wissen, wo man hingehört. Zu wem ich gehöre. Durch diese Erlebnisse konnte ich mich nie festigen, denn ich hatte nirgendwo Halt. Also ist es doch gleichgültig, ob ich da bin, oder nicht.
Meine Tante Maria erzählte einmal, dass ich, als ich noch sehr klein war, immer an meinem Vater klebte. Sie sagte: „Du hast ihm kaum Ruhe gelassen. Immer wolltest Du bei ihm sein. Oft bist Du ihm damit auf die Nerven gegangen. Aber er war immer für Dich da.“
Jetzt denke ich mir, als mein Vater von uns weggegangen ist, war für mich nur mehr die Mutter da. Und daher habe ich mich an meine Mutter angehängt. Ich glaube, so ist es eben bei Kleinkindern, dass sie sich anhängen wollen, damit sie wissen, wo sie hingehören.
Meine Mutter wollte das aber nicht. Entweder musste sie weg, oder sie hat mich weggegeben zu Oma Renate oder Opa Ernst, oder sonst zu jemandem. Nur bei Ihr durfte ich nicht sein. Als Kleinkind hat sie mich weggegeben und als Jugendliche ist sie von mir weggegangen. Ich hatte keinen Halt und konnte mich nicht anhängen. In meinem weiteren Leben hing ich dann immer sehr bald an meinen jeweiligen Partnern. Von einem zum anderen, obwohl ich gedemütigt, ausgenutzt, geschlagen, belogen und betrogen wurde.
Ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich habe mein Leben so gelebt, weil mir sehr viel fehlte. Ich war nicht dumm und ich bin auch nicht dumm. Mir wurde einfach nicht beigebracht, wie man liebevolle Beziehungen lebt. Solche Sachen selbst zu lernen, wie soll das gehen? Wenn ich nicht weiß, was mir fehlt und was ich lernen soll?
Zum Beispiel musste ich zwischen 1973 und 1975 regelmäßig zu Oma Ursula. Sie wirkte immer sehr kalt und streng. Ich musste bei meiner Oma immer nach dem Essen schlafen gehen. Ein Mittagsschläfchen halten. Ich bekam immer reichlich zu Essen. Nach dem Mittagsschläfchen gab es eine Jause und dann gingen wir auf den Friedhof. Ich wusste nicht so richtig, was ein Friedhof ist. Ich sah die großen Steine. Da standen Namen darauf. Davor befanden sich Kerzen und wenn sie bei manchen Steinen nicht brannten, haben meine Oma Ursula oder die Tante Christel eine angezündet. Dann sind wir gestanden und haben uns minutenlang den Stein angesehen. Meine Oma nahm oft ein Taschentuch aus ihrer Tasche, weil ihr die Nase lief. Das habe ich beobachtet. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass es immer sehr kalt war. Ich denke, es war meistens Winter.
Oder ich musste zu Tante Christel. Sie hatte am Ziegenberg ein kleines Gartenhäuschen. Dort war ich oft. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass mein Vater da gewesen wäre und mit mir spielte. Ich habe keine Erinnerung daran, dass mein Vater je irgendetwas mit mir gemacht hätte.
Meine Mutter hat mich immer und immer wieder abgeschoben. Wie gesagt, ich war alle 14 Tage bei meinem Vater. Und bei der Oma Ursula. Ich war bei Tante Christel. Ich war öfter bei meinem Opa Ernst, der wohnte etwas außerhalb von Wien. Ich war noch vor der Volksschule bei der Tante Carmen und Onkel Herbert. Ich war bei der Annika, der Tochter von Rosemarie. Ich war bei der Oma Renate in Grünfeld. Meine Tante Maria war bei mir in Wien und musste auf mich aufpassen, wenn meine Mutter wegging.
Da hatte ich immer das Gefühl, verlassen und verloren zu sein. Ich konnte mich immer gut über schlimme Dinge retten. Das konnte ich. Es hat mich nie jemand anderer gerettet. Dieses Gefühl fehlt mir. Dass jemand für mich da ist und mir manches normal und in Ruhe erklärt. Meine Mutter hat immer sofort laut geschrien oder geschimpft. Das mag ich heute noch nicht, wenn Leute laut werden, wenn jemand etwas nicht versteht oder nicht einsieht. Wenn sie sich, wie man so sagt, „lautstark unterhalten“. Das macht mir mächtig Angst. Da zucke ich zusammen, das kann sich niemand vorstellen. Mir bleibt die Luft weg, weil ich nicht genau weiß, was im nächsten Moment passiert. Ob irgendetwas geflogen kommt, was mich treffen könnte, oder Ähnliches.
Wenn ich daran denke, fällt mir ein, dass meine Mutter und mein Stiefvater 1976 oder 1977 einen riesen Streit hatten, wobei einige Sachen in der Wohnung herumflogen. Zum Beispiel ein altes Bügeleisen. Quer durchs Vorzimmer. Es zertrümmerte den großen Spiegel. Ich hatte große Angst.
Meine Mutter rief: „Paula, ruf die Polizei!“ Mein Stiefvater sagte: „Nein, brauchst Du nicht. Wir hören gleich auf.“ Und sie wieder: „Ruf die Polizei!“ Er: „Nein, brauchst Du nicht!“ Das ging einige Male hin und her. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte nur Angst um meine Mutter. Sie war die Einzige, die ich hatte. Wenn er sie umbrächte, was passierte dann mit mir? Wo käme ich hin? Ich wusste es nicht. Das machte mir riesengroße Angst.
Ich ging aus der Wohnung ins Stiegenhaus. Den Streit hörte man bis auf den Hausflur. Frau Kiefer vom ersten Stock, wir wohnten damals noch auf Stiege eins im Erdgeschoss, ist zu mir gekommen und sagte: „Paula! Paula, komm rauf! Komm! Wenn Du willst, kannst Du vorübergehend bei uns bleiben.“ Frau Kiefer war die Mutter von Martina und Martin. Ich kannte sie gut und sie mich auch. Sie war lieb, nett und fürsorglich. Sie hat sich immer um ihre Kinder gekümmert und sie hatte sie sehr lieb. Sie waren für sie alles.
Ich ging zu Kiefers, weil ich wusste, dass ich mich dort wohl fühle und gut aufgehoben bin. Nach einiger Zeit habe ich mitbekommen, dass die Polizei da war und sich die Sachlage etwas beruhigt hatte. Ich kam zurück in die Wohnung und sah, wie mein Stiefvater im Wohnzimmer am Sessel saß und meine Mutter auf der Lehne neben ihm. Die Polizisten fragten, ob jemand verletzt sei.
Da sagte mein Stiefvater: „Ja, ich habe einige Kratzer.“ Der Polizist fragte, ob jemand eine Anzeige machen wolle. Da sagten beide: „Nein, nein, das war nur ein Streit zwischen Eheleuten. Das kommt bestimmt nicht mehr vor.“
Ich dachte mir, wieso lügen die? Sie streiten doch sehr oft, schreien sich an und schimpfen. Warum lügen die? Aber was sollte ich sagen? Sie waren die Erwachsenen.
Na ja, weiter im Text.
Zu meinem Vater hatte ich, wie gesagt, den typischen Zwei-Wochen-Kontakt. Das ging fast zehn Jahre so, von 1972 bis 1982. Wie sollte ich ihn da kennenlernen, oder er mich? Wie hätte er mir an zwei Wochenendtagen seine Liebe geben und zeigen können? Vielleicht hat er sich bemüht und ich habe es nicht gesehen oder gespürt.
Ich habe als Kind mitbekommen, dass er eine neue Frau hat. Barbara. Die beiden wollten mich nicht oder konnten mich nicht brauchen, denn sie waren mit sich selbst beschäftigt. Neue Liebe und so. Außerdem habe ich mir gedacht, sie muss mich nicht lieb haben. Sie ist ja nicht meine Mutter. Bei meiner Mutter allerdings dachte ich mir, sie muss mich lieb haben. Ich bin ihr Kind und sein eigenes Kind hat man immer lieb. Aber das war bei meiner Mutter nicht so.
Wenn ich am Wochenende meinen Vater besuchte, war meistens oder fast immer seine Freundin da. Ich war nie alleine mit meinem Vater. Als er mich einmal von meiner Mutter abholte, fuhren wir zu seiner Freundin ins Spital, wo sie arbeitete. Barbara war Krankenschwester. Wir blieben solange, bis sie nachhause gehen durfte. Dann fuhren wir zur Wohnung meines Vaters. Es war schon dunkel. Ich musste dann bald schlafen gehen. Ich verbrachte meinen Besuch also im Krankenhaus, obwohl ich gesund war.
Ein anderes Mal holte mich mein Vater und ich war wieder bei ihm in der Wohnung. Die Schwester seiner Freundin, Inge, war auch da. Wir machten gemeinsam gebackene Champignons zum Mittagessen. Das war lustig für mich! Endlich hat jemand etwas mit mir gemacht!
Mein Vater ließ mich oft mit Barbara alleine, weil er viel Wandern ging. Manchmal ist er auch 10 Kilometer gelaufen. Da musste ich immer mit seiner Freundin auf ihn warten. Ab und zu bin ich die 10 Kilometer gegangen und habe Medaillen bekommen, aber mein Vater war nicht bei uns. Er war immer weiter vorn, weil er manche Streckenteile gelaufen ist.
Als mein Vater und seine Frau Barbara ein Baby bekommen haben, war ich dann sowieso nicht mehr wichtig für die beiden. Ich war neun, als mir aufs Auge gedrückt wurde, dass ich seit Juni einen kleinen Bruder hätte, den ich hin und wieder sehen würde. Mein Vater und meine Oma Ursula haben sich sehr über den Bub gefreut. Der Stammhalter war da. Ich war das dann ja wohl nicht. Also war ich wieder weg vom Fenster. Ich war zweitklassig und plötzlich entdeckten sie, dass ich als große Schwester einsetzbar war. Ich sollte oder musste auf den Kleinen schauen, solange ich bei ihnen war, weil man das als große Schwester machte.
An einem Besuchswochenende waren die Frau meines Vaters und mein kleiner Bruder Philipp in der Lobau, einem Auengebiet im östlichen Wien. Er war noch ein Baby. Barbara spannte einen kleinen Sonnenschirm auf, damit der Kleine nicht in der heißen Sonne lag. Ich sollte den Schatten der Sonne beobachten und darauf achten, dass kein Sonnenstrahl auf die Füße oder auf den Popo von Philipp käme, denn sonst bekäme er einen Sonnenbrand, und das war und ist für Babys nicht gesund.
Ich sah den Kleinen vielleicht zwei Tage von 14 und sollte eine „große Schwester“ sein? Das verstand ich nicht. Wie sollte das gehen? Ich hatte zurzeit selbst gerade große Probleme und konnte mit niemand darüber reden. Oder besser gesagt, ich durfte nicht darüber reden. Das wurde mir verboten. Mit neun Jahren. Mein Problem war mein Stiefvater.
Aber ich passte auf, damit ich alles richtig machte und dem Kleinen nichts passierte. Mein Vater war allerdings kaum da.
Ich weiß nur, dass mein Vater, seine Freundin und ich hin und wieder schwimmen gegangen sind, oder dass er mich zum Tischtennis mitgenommen hat, was er vereinsmäßig betrieb. Aber da waren auch immer andere Menschen. Barbara oder die Oma Ursula. Ich war nie alleine mit meinem Vater. Er hat nie allein mit mir etwas unternommen. Ich fühlte mich nicht gut, nicht erwünscht, als würde ich nur geduldet werden.
Ich war oft sehr traurig, wenn er mich nachhause zu meiner Mutter gebracht hat, denn ich habe mir immer erhofft, er würde einmal mit mir allein sein. Wenn er mit mir im Auto gefahren ist, oder mit der Stadtbahn, seinerzeit, oder mit seinem Roller, dann waren wir alleine. Aber das war für mich viel zu kurz, denn dann musste ich schon wieder nachhause zu meiner Mutter, und das wollte ich überhaupt nicht.
Ich habe meinen Vater sehr vermisst. Ich habe mir oft gewünscht, dass er da ist, bei mir, und mich in seine Arme nimmt. Ich habe immer auf ihn aufgesehen. Ich war immer voller Hoffnung, dass ich mehr von ihm bekomme als diese Wochenenden, Geburtstage und Weihnachten.
Ich war in den Ferien nie bei ihm. Ich war nie mit ihm und seiner Familie auf Urlaub. Weder im Sommer noch im Winter. Ich wurde nie richtig in diese Familie eingeführt. Ich war immer nur ein Ausstellungsstück.
Man zeigte mich her und sagte: „Bist Du groß geworden! Wie gefällt es Dir in der Schule?“ Oder: „Na, was sagst Du zu Deinem kleinen Bruder? Freust Du Dich?“
Ich wusste nie, was ich sagen sollte, denn ich kannte ihn kaum und lebte nicht mit ihm zusammen. Ich wusste eigentlich gar nichts von ihm.
Ich sagte dann immer: „Ja, ich freue mich!“ Wusste aber in dem Moment nicht, was das bedeutete. Doch die Reaktion bei den anderen war okay für mich, somit dachte ich mir, dass das die richtige Antwort war. Doch wie schon gesagt, ich wusste nicht, was es bedeutete. Aufgrund der Erziehung sagte man das eben. Ich habe das einmal von meinen Freundinnen gehört, die haben das auch gesagt, wenn sie jemand gefragt hat. Also habe ich mir gedacht, ich sage das auch. Aber was das bedeutete, wusste ich nicht.
Meine Mutter suchte sich immer wieder einen neuen Freund. Dafür ließ sie mich oft alleine in der Wohnung. Ich hatte solche Angst. Ich weinte, fühlte mich verlassen, hatte Angst, dass sie vielleicht nie wieder zurückkommen würde. Einmal heulte ich beim Fenster hinaus, bis die Polizei kam und mich mitnahm. Irgendwann in der Nacht kam meine Mutter und holte mich vom Kommissariat ab.
Warum hat mein Vater mich eigentlich nicht zu sich genommen, als die Fürsorge ihn informierte, dass meine Mutter nicht genug auf mich aufgepasst hat? Als ich am Fenstersims gesessen bin und geheult habe?
Für mich ist das die „Fenstergeschichte“. Was da genau passierte, und wie es weiterging, erzähle ich gleich.
Jedenfalls gingen damals einige Männer bei meiner Mutter ein und aus. Für mich war es zu viel, dauernd andere Männer zu sehen. Mit einem hatte sie Sex im Wohnzimmer. Auf dem Klappbett. Ich stand im Türrahmen der Kinderzimmertür und sah, wie Herr Hirsch auf meiner Mutter lag. Plötzlich kam der Egon Buchholz, der damalige „feste“ Freund meiner Mutter, herein. Der war ganz schön sauer. Er machte den Kasten im Wohnzimmer auf, der gegenüber dem Bett stand, nahm sich einen Koffer heraus, und packte sein Gewand hinein. Er sprach nicht viel. Er sagte nur zu meiner Mutter: „Lass mich in Ruhe. Ich gehe und aus.“
Ich war überrascht. Ich war sehr angespannt und wusste nicht, was da vor sich ging. Den Egon fand ich sehr nett. Er hat mit mir öfter etwas unternommen. Er hatte einen großen Hund, mit dem er immer sehr viel spazieren ging, und da durfte ich mit. Seine Mutter war auch eine nette Frau. Ja, ich mochte die beiden. Der Hund hieß Samba, das weiß ich noch. Es war ein Deutscher Schäferhund. Sein Auto war ein Kombi.
Doch plötzlich stand ich da, keine Ahnung, um was es ging, Egon packte seine Sachen und meine Mutter sagte: „Nein, geh nicht. Lass es Dir doch erklären! Das ist nicht das, was Du glaubst. Bitte, geh nicht!“
Ich dachte mir: „Warum weint sie? Was ist denn passiert?“ Herr Hirsch hat sich in der Zwischenzeit rasch angezogen und ist in den ersten Stock hinaufgegangen, denn da wohnte seine Mutter. Herr Hirsch trug eine Brille. Er sah immer streng und steif aus. Den mochte ich irgendwie nicht. Seine Mutter war nett, aber er war irgendwie komisch.
Nachdem Herr Hirsch aus der Wohnung gegangen war, sah mich meine Mutter in der Tür stehen. Sie sagte zu mir: „Was machst Du da? Geh sofort ins Zimmer und leg Dich hin.“
Ich habe gefragt: „Was ist da los? Warum geht er?“
Sie sagte: „Was habe ich gerade gesagt? Du sollst in Dein Zimmer gehen, und Dich ins Bett legen! Es ist nichts! Und jetzt geh schlafen! Geh schon!“
Ich wusste überhaupt nicht, was jetzt noch passieren würde. Ich bin in mein Bett gegangen und habe in mein Polster hinein geweint. Ich war so traurig, weil der Egon gegangen ist. Mit einem Koffer in der Hand. Ich wusste, ich würde den Hund Samba nie wieder sehen. Und seine Mutter auch nicht.
Weiter in meiner Kindheit. Meine Mutter hatte eine Freundin namens Rosemarie. Die wiederum hatte eine Tochter, Annika. Sie war ungefähr so alt wie ich. Wir wurden Freundinnen. Rosemarie und Annika wohnten bei der Mutter von Rosemarie in der nächsten Straße, im Eckhaus ganz oben. Meine Mutter und ihre Freundin gingen oft miteinander weg. Ich war dann bei Annika und ihrer Oma. Ich durfte dort schlafen, damit meine Mutter mit Rosemarie weggehen konnte. Meine Mutter war nicht da für mich. Ich war zu der Zeit noch nicht in der Schule, also war ich noch klein. Ich hatte immer große Angst, dass mich meine Mutter alleine ließ und einfach nicht mehr kommen würde. Das war nach der Fenstergeschichte. Sie ließ mich immer bei anderen Menschen. Sie brachte mich in den Kindergarten. Sie holte mich wieder ab.
Manchmal war ich das letzte Kind, das auf der Bank im Vorraum saß und wartete, bis mich meine Mutter abholte.
Meine Mutter hatte dann einmal einen neuen Freund. Sein Name war Gerhard. Wir bekamen einen Hund. Einen Boxer. Sein Name war Jago. Wir zogen in den 22. Bezirk, in den vierten Stock ohne Lift. Der Hund war sehr schlimm. Der machte alles kaputt und zerbiss alles. Die Couch, die Schuhe, die Tür, einfach alles. Man musste ganz schnell mit ihm runter auf die Wiese gehen, sonst machte er Lulu oder Kacka ins Stiegenhaus und das durfte nicht sein, denn dann musste man es mit der Küchenrolle oder mit Klopapier wegwischen. Da er noch jung war, war es schwierig, den richtigen Moment zu erwischen, damit er die vier Stockwerke noch aushält. Aber so war das nun mal. Der Gerhard hat sich einen Hund eingebildet und meine Mutter hat dem zugestimmt. Ich durfte mit ihm Gassi gehen und sie durfte ihm das Fressen geben und sich darüber ärgern, dass er alles kaputt machte.
Gerhard war die Ruhe selbst und hatte Freude daran, sagen zu können: „Ich habe einen Hund.“ Er war immer ein wenig komisch. Er war oft betrunken. Er hatte dann immer einen ganz langsamen Augenaufschlag und verdrehte die Augen. Das war richtig unheimlich. Es war komisch, unangenehm. Ich wusste oft nicht, ob er jetzt bald einschläft, oder was auch immer. Keine Ahnung. Denn wenn meine Mutter die Eingangstüre aufsperrte, war er hellwach. Das mochte ich nicht. Das machte mir Angst und ich wollte weg.
Ja, schon in jungen Jahren wollte ich weg. Hielt es zuhause kaum aus. Daran kann ich mich erinnern. Es muss nach der Fenstergeschichte gewesen sein, da wir auf der Stiege eins, unter den Kiefers, lebten. Vielleicht um 1973, ich muss vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Aber ich kann mich gut daran erinnern. Da bin ich abgehauen.