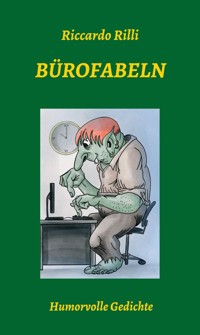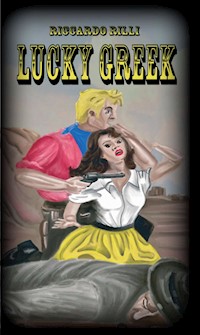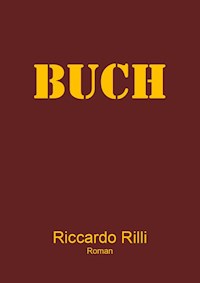Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Eine, die ich soeben erlebte und die mich auf die Frage brachte: Bin ich ein Held?" Ein kleiner Beamter hat ein Problem: Er muss eine wichtige Botschaft notieren und findet keinen Kugelschreiber. Es beginnt die Suche nach einem geeigneten Stift. Die Erlebnisse auf der Reise veranlassen den Staatsdiener, über sich nachzudenken. Lesen Sie die zwölf Abschnitte der klassischen Heldenreise nach Joseph Campell und erleben Sie, wie ein einfacher Kugelschreiber die Welt eines Menschen verändern kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Riccardo Rilli
Der Kugelschreiber
Eine klassische Heldenreise
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
PROLOG
ABSCHNITT 1 – DER RUF
ABSCHNITT 2 – DIE WEIGERUNG
ABSCHNITT 3 – DER AUFBRUCH
ABSCHNITT 4 – AUFTRETEN VON PROBLEMEN
ABSCHNITT 5 – HILFE
ABSCHNITT 6 – DIE ERSTE SCHWELLE
ABSCHNITT 7 – FORTSCHREITENDE PROBLEME
ABSCHNITT 8 – INITIATION UND TRANSFORMATION
ABSCHNITT 9 – VERWEIGERUNG DER RÜCKKEHR
ABSCHNITT 10 – VERLASSEN DER UNTERWELT
ABSCHNITT 11 – RÜCKKEHR
ABSCHNITT 12 – HERR DER ZWEI WELTEN
Weitere Werke des Autors:
Impressum neobooks
PROLOG
Ich erzähle ihnen eine Geschichte. Eine, die ich soeben erlebte und die mich auf die Frage brachte: Bin ich ein Held? Die Definition eines Helden ist eine Person mit herausragenden Eigenschaften. Mit Hilfe seiner Fähigkeiten vollbringt er Leistungen, die kein anderer zustande bringt. Heldentaten. Der Recke ist schön, stark und geschickt. Oder er besitzt geistige Kompetenzen, die jenen der Normalsterblichen überlegen sind. Eine weitere Deutung besagt, dass Helden Taten für andere, oder für eine bestimmte Idee vollbringen. Letztere ist, meiner Meinung nach, differenziert zu sehen. Kriegshelden, zum Beispiel, gaben ihr Leben für andere. Für eine Vorstellung, die nicht die ihre war. Sie fallen, weil sie in den Krieg gezwungen wurden. Sie opfern sich weder heldenhaft noch freiwillig. Ohne die Leistungen herabwürdigen zu wollen, sind sie per Definition echte Helden? Was ist mit den Helden des Alltags? Die meisten haben keine herausragend hübsche Gestalt oder besondere Stärke. Sie besitzen keines der körperlichen Attribute, die man Recken nachsagt. Ihre Taten sind das Ergebnis von Einsatzbereitschaft, Aufopferung und Mitgefühl. Was, wenn jene Eigenschaften ebenfalls fehlen? Wenn der vermeintliche Held weder anatomisch ansprechend, noch charakterlich vorzeigbar ist? Womit wir bei mir wären.
Ich bin zweiundvierzig Jahre und Single. Ich bin kein Scheusal. Ich fände eine Frau, wenn ich wollte. Das Leben mit einem Mädchen zu teilen, ist eine unerträgliche Vorstellung. Tagein, tagaus wäre jemand um meine Person herum. Beobachtete mich und gäbe Ratschläge. Wie die Arbeitskollegen. Ich arbeite in einem Amtsgebäude mit über sechshundert Mitarbeitern. Es vergeht nicht ein Tag, an dem Kollegen oder Kolleginnen kommen, die Dinge von mir brauchen. Ich habe nichts gegen sie. Ich verabscheue Menschen grundsätzlich. Gott sei Dank gibt es das Zimmer, in das ich mich zurückziehen kann. Ich bin nicht in der Lage mir vorzustellen, warum die Leute mit mir sprechen. Mein Verhalten ist unauffällig, das Äußere nicht aufdringlich. Ich bin klein, dünn und trage blaue Jeans, Hemd und weiße Turnschuhe. Die kurzen, dunklen Haare frisiere ich zu einem Seitenscheitel, der Flaum in meinem Gesicht stellt einen Dreitagebart dar. Ein Durchschnittstyp. Ich spreche niemand an, stelle keine Fragen und erledige die mir aufgetragene Arbeit als Sachbearbeiter mit Ruhe und Verlässlichkeit. Punkt. Mehr gibt es über mich nicht zu sagen.
ABSCHNITT 1 – DER RUF
„Erfahrung eines Mangels oder jähes Erscheinen einer Aufgabe.“
Wie begann meine Heldenreise? Ich saß im Büro, die große, weiße Tür geschlossen. Abgeschieden von der Außenwelt. Ich war früh am Morgen gekommen, um zu arbeiten. Acht Dienststunden und ich könnte die Arbeitsstelle kurz nach dem Mittagessen verlassen. Mit Hilfe dieser Zeiteinteilung vermied ich Kontakt mit meinem Zimmerkollegen, der später kam und länger blieb. Ich lehnte mich zurück und ließ die Lehne des schwarzen Schreibtischsessels hin und her wippen. Der Computer startete. Der blaue Schein des Monitors erhellte den dunklen Raum. Das Deckenlicht, vier blendende Neonröhren, hatte ich nicht eingeschaltet. Ich genoss die Ruhe, die Anonymität, die das unbeleuchtete Zimmer bot. Die heimelige Atmosphäre fände mit dem Eintreffen des Kollegen ein jähes Ende. Meine langen, schlanken Finger suchten die Tastatur auf der Arbeitsplatte des Schreibtischs, die in Buche furniert war. Ich tippte das Passwort ein und wartete, bis ich angemeldet wurde. Bald durfte ich mich auf die Statistiken stürzen. Meine Arbeit bestand aus Tabellen. Ich setzte Zahlen in Kästchen und wertete sie aus. Die Listen betrafen unzählige, verschiedene Arbeitsbereiche und andere Fachabteilungen gaben sie in Auftrag. Ich erhielt die Daten und erstellte Tortengraphiken, Balkendiagramme und Beschreibungen in Beamtenprosa. Meine Tätigkeit fand keine Anerkennung. Lieferten die Statistiken für die Abteilungen günstige Ergebnisse, wurden sie unkommentiert hingenommen. Bei unvorteilhaften Summen hielt man mir eine schlechte Auswertung vor. Der Großteil meiner Ergüsse blieb ungelesen auf irgendeinem Schreibtisch liegen. Ich betrachtete den silbergrauen Telefonapparat neben dem Monitor. Am Morgen waren wenige Kollegen im Haus. Um einen zufälligen Anruf auszuschließen, stellte ich das Telefon auf Anrufbeantworter. Den Apparat meines Zimmerkollegen ließ ich unangetastet. Wenn er käme und das Telefon wäre umgestellt, könnte ich die erste Auseinandersetzung des heutigen Tages nicht verhindern. Ein vermeidbares Übel. Ich beschloss, es zu ignorieren, sollte der Apparat läuten. Das musste reichen. Die anderen Mitarbeiter wussten, dass er später zu arbeiten begann. Sie riefen ihn nicht an. Sein Schreibtisch stand meinem Gegenüber. Die Monitore waren derart aufgestellt, dass wir den Blickkontakt vermieden. Sie bildeten eine moderne Barriere. Auf dem Tisch des Kollegen stapelte sich das Papier. Neben den aktuellen Tabellen lagen veraltete Ausdrucke, Sportzeitungen und Automagazine. Ich kämpfte Stunde um Stunde, dass die Papierflut nicht auf meine aufgeräumte Tischplatte übergriff.
Wolfgang Koller war zehn Jahre nach mir geboren und in seiner Freizeit vielbeschäftigt. Er schleppte den großen, schlanken Körper ins Fitnesscenter, zum Radfahren und im Sommer zum Schwimmen. Er ging in Bars, ins Kino und wechselte Freundinnen wie andere Unterwäsche. Koller war attraktiv. Die dunklen Haare hatten einen modernen Schnitt und er war mit Jeans, Hemd und Sportsakko bekleidet. Der rasierte Kiefer war breit und seine dunkelbraunen Augen leuchteten. Ein typischer Held, der ebenso ungelesene Statistiken erstellte, wie ich. Wenn er nicht telefonierte. Oder das Büro verließ, um soziale Kontakte im Amt zu pflegen. Seine Bezeichnung für die Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, bei denen sie das eine oder andere Bier tranken. Abgabetermine kümmerten ihn wenig. Nach Genauigkeit fragte er nicht. Er schrie in den Telefonhörer, lachte laut und viel und beglückte mich mit Geschichten aus seinem Leben, ohne dass ich es wissen wollte. Dauerten die Gespräche am Telefon längere Zeit, begann mein Herz zu rasen. Ich war gezwungen, die Arbeit zu unterbrechen und abzuwarten, bis er ging, was keine fünf Minuten nach dem Auflegen passierte. Der Geruch des penetranten Parfums blieb im Raum. Es erinnerte an seine aufdringliche Anwesenheit, während der er versuchte, seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Wenn er nicht sprach, rückte er seine Gestalt mit ständigen Schnaufen durch die verstopfte Nase in den Bereich meiner Achtsamkeit.
Ich hatte zwei Stunden. Dann stieße er krachend die Tür auf, schaltete das Neonlicht ein, stellte seine Sachen mit einem Poltern auf den Tisch und verschwände zum Frühstück. Zeit genug, um mir einen Überblick über die heutige Arbeit zu verschaffen, einen Kaffee zu kochen und ihn in angenehm einsamer Dunkelheit zu genießen. Ich blätterte durch die neuesten E-Mails. Mir kam ein Gedanke. Die Worte drängten in meinen Geist und ich hielt es für erforderlich, sie aufzuschreiben. Ich wusste, es waren Sätze, die die Welt lesen sollte. Ich verspürte das Verlangen, mich mitzuteilen. Mein Wissen, das mir jäh ins Gehirn schoss, mit der Gesellschaft zu teilen. Von einem Augenblick auf den anderen erschien es mir unaufschiebbar. Ich wollte das Textverarbeitungsprogramm öffnen und tippen. Ich erkannte, dass der Text handgeschrieben werden musste. Er verlöre die Lebendigkeit, die Ausstrahlung, bestünde er aus elektronischen Buchstaben auf einem Monitor ohne Seele. Ich brauchte einen Stift. Die Worte mussten mit einem Schreibstift geschrieben werden. Auf dem Schreibtisch lag kein Kugelschreiber. Ich sah in den silbergrauen Rollcontainer, der zwischen meinen und den Beinen des Tisches stand. Ich öffnete jede der vier Laden. Nirgens ein Stift. In einem modernen, papierlosen Büro, in dem Arbeitsabläufe elektronisch vonstattengingen, verwendete man kein herkömmliches Schreibmaterial. Kollers Pult war nicht papierlos. Er hatte mit Sicherheit einen Kugelschreiber. Ich stand auf und durchpflügte die Stöße auf seinem Tisch. Ich fand einen Radiergummi, eine leere Flasche Mineralwasser, eine schmutzige Kaffeetasse, eine Skateboard fahrende Ente aus einem Überraschungsei, benutzte Taschentücher und keinen Kugelschreiber. Ich wurde zunehmend nervös. Ich musste die Gedanken zu Papier bringen, solange sie mir gegenwärtig waren. Die Sache kam mir zu wichtig vor, um sie an einem Stift scheitern zu lassen. Hektisch öffnete ich die Laden des Rollcontainers meines Kollegen, der nicht versperrt war. Ich fand Schreibblöcke, Autozeitungen, eine Dose mit Eiweißpulver, eine Flasche des penetranten Parfums und keinen Kugelschreiber. Ich durchsuchte den Kasten mit den Schiebetüren, in dem sich bunte Ordner mit alten Tabellen befanden, und den Garderobenschrank. Im ganzen Büro war kein Stift zu finden. Wie sollte ich die Worte aufschreiben, wenn ich kein Schreibwerkzeug hatte? Keinen Kugelschreiber, keinen Bleistift, keinen Filzschreiber, keinen Faserstift, keinen Füllhalter, keinen Leuchtstift? Ich kratze mich am Kinn und dachte nach. Ich brauchte einen Kugelschreiber. Ich musste mir einen besorgen. Ein Mangel. Eine Aufgabe.
ABSCHNITT 2 – DIE WEIGERUNG
„Der Held zögert, dem Ruf zu folgen, weil es gilt, Sicherheiten aufzugeben.“
Ich stand vor meinem Schreibtisch, der schwarze Sessel hinter mir, und starrte den Monitor an. Um den Kugelschreiber zu besorgen, der von größter Wichtigkeit war, musste ich das sichere Büro verlassen. Der dunkle Raum, das Habitat für vierzig Stunden die Woche, die risikofreie Unterkunft, die mich vom Treiben des Büroalltags fernhielt, war meine schützende Höhle. Von der Heizung erwärmt, bildete er ein angenehmes Gegenstück zu den kalten Gängen vor der weißen Tür. Die Dunkelheit bot Schutz vor der grellen Wirklichkeit des restlichen Hauses. Sollte ich den Text, die Botschaft, mit dem Computer schreiben und ausdrucken? In einer Schriftart, die meiner Handschrift glich? Reichte das, um die Seele des Geschriebenen zu erhalten?