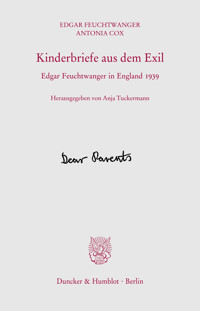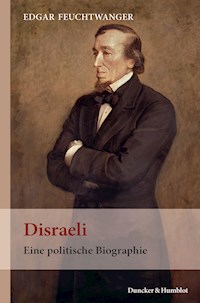25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Sprache: Deutsch
Edgar Feuchtwanger, 1924 in München geboren, Sohn des Verlegers Ludwig und Neffe des Schriftstellers Lion Feuchtwanger, erzählt von seiner Kindheit in Deutschland und seinem Leben in England. Als jüdisches Kind erlebte er den Alltag im Dritten Reich, aber auch die großen Zeitereignisse – Röhmputsch, Annexion Österreichs, Sudetenkrise – aus besonderer Perspektive: Seine Eltern wohnten gegenüber von Hitlers Privatwohnung. Nach Kristallnacht und Inhaftierung seines Vaters im KZ Dachau wurde Edgar, 14 Jahre alt, 1939 nach England geschickt. Dort wurde er in Institutionen der englischen Oberschicht – zunächst in einer berühmten Public School in Winchester und nach dem Krieg in Cambridge – erzogen. Als Historiker arbeitete er in der Erwachsenenbildung und wurde Universitätsprofessor. Seit 50 Jahren ist er mit der Tochter eines britischen Generals verheiratet. Feuchtwanger schildert nicht nur Erlebnisse der Vorkriegs- und Kriegsjahre, sondern auch seine Eindrücke bei Besuchen und Begegnungen im Deutschland der Nachkriegszeit. Aus dem Blickwinkel des Zeitzeugen und Historikers gibt das Buch einen persönlichen Einblick in zwei Länder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
EDGAR FEUCHTWANGER
Erlebnis und Geschichte
1935, im Alter von elf Jahren
Im Frühjahr 2010
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Edgar Feuchtwanger, 2009
Für die deutsche Ausgabe alle Rechte vorbehalten © 2010 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-13185-3 (Print) ISBN 978-3-428-53185-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-83185-2 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ƀ
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorbemerkung
Als ich im Jahr 1924 in München zur Welt kam, sah meine Zukunft nicht gerade rosig aus. Keine elf Monate zuvor hatte Hitler versucht, in der bayerischen Landeshauptstadt die Macht zu erringen, um von dort aus den Marsch auf Berlin anzutreten. Der Putsch im Bürgerbräukeller scheiterte damals, aber wenige Jahre später wurde Hitler in Berlin zum Kanzler ernannt und schwang sich rasch zum allmächtigen Diktator auf. Das bedeutete für mich und die Meinen eine unmittelbare Bedrohung.
Kurios und zugleich erschreckend war die Tatsache, dass meine Eltern nur ein paar hundert Meter von Hitlers Privatwohnung entfernt lebten. So konnte ich als Kind sein Kommen und Gehen beobachten. Fatale Nachbarschaft, die mich zum Zeugen und Beobachter, aber auch zum Betroffenen machte. Hitlers Politik zwang meine Familie zur Auswanderung, und so wurde ich Historiker in einem anderen Land, nach einer erstaunlichen Schicksalswende.
Mochten Gegenwart und Zukunft damals auch trüb erscheinen, auf unsere Vergangenheit konnten wir stolz sein. Ich stamme aus einem wohlbekannten deutsch-jüdischen Familienverband, der seit Jahrhunderten in Bayern verwurzelt war, und zwar in Franken wie auch in der Landeshauptstadt. Und in der neuesten Zeit spielten einige Verwandte eine herausragende Rolle in der deutschen Öffentlichkeit. Mein Vater Ludwig Feuchtwanger war Geschäftsführer eines renommierten Verlags mit einer langen Geschichte. Mein Onkel Lion, der ältere Bruder meines Vaters, war einer der bekanntesten Schriftsteller im Deutschland der Weimarer Republik. Er hatte Hitlers Zorn erregt, als er in seinem Roman Erfolg ein satirisches Porträt von ihm entwarf, nämlich als Automechaniker mit geringer Geisteskraft, aber mit einem gewissen Talent als Demagoge und [6] Volkstribun, der es verstand, seine Zuhörerschaft in den Münchner Bierkellern in hysterische Begeisterung zu versetzen.
Die große Veränderung in meinem Leben begann im November 1938, in der so genannten „Reichskristallnacht“, als mein Vater verhaftet und für sechs Wochen im Konzentrationslager Dachau interniert wurde, was uns zwang, Deutschland zu verlassen. Ich wurde im Februar 1939 nach England geschickt, meine Eltern folgten zwei Monate später. Im Frühherbst, der mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 zusammenfiel, war ich wieder in der Schule, nun allerdings im Winchester College, als englischer „public schoolboy“. So wurde ich in England zum Hochschullehrer, übernahm Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung wie an der Universität, verfasste Bücher zu zeitgeschichtlichen Themen. In dieser Eigenschaft bin ich häufig nach Deutschland zurückgekehrt und konnte die Entwicklung meiner einstigen Heimat verfolgen.
Als ein Jude und als ein Feuchtwanger im Jahre 1924 in Deutschland zur Welt zu kommen, war keine besonders gute Voraussetzung für ein langes und relativ friedliches Leben, wie ich es dann doch entgegen aller Wahrscheinlichkeit geführt habe. Den Vornamen Edgar erhielt ich nach dem jüngsten Bruder meiner Mutter, der 1918 im Krieg in der Nähe von Amiens gefallen war. Inmitten der unglücklichsten Umstände des Jahrhunderts verlief mein Lebensweg noch einigermaßen glimpflich. Mein Leben hat nicht nur eine große Zeitspanne umfasst, sondern sich auch in zwei Ländern abgespielt. Meine Erinnerungen reichen zurück bis zu den dramatischsten Momenten des 20. Jahrhunderts, von denen ich einigen aus ungemütlicher Nähe beigewohnt habe. Danach habe ich zum Glück weniger stürmische Zeiten erlebt, die gleichwohl, aus großem Abstand gesehen, einige radikale und bemerkenswerte Veränderungen mit sich brachten.
Winchester, im Mai 2010
Edgar Feuchtwanger
Inhaltsverzeichnis
1.
Idylle mit Schatten
2.
Mein berühmter Onkel
3.
Die Manns und andere Emigranten
4.
Die Welt meines Vaters
5.
Jüdisches Leben
6.
Der Nachbar
7.
Leben und Schulzeit im Dritten Reich
8.
Bedrohung und Flucht
9.
Länderwechsel
10.
Eine englische Erziehung
11.
Kriegsfolgen und Kriegsdienst
12.
Als Student im Nachkriegs-Cambridge
13.
Universität und Erwachsenenbildung
14.
Erste Rückkehr nach Deutschland
15.
Musikalisches Intermezzo
16.
Unterwegs in Deutschland
17.
Andere Länder
18.
Akademisches Leben in England und in Deutschland nach 1968
19.
Fin de Siecle
20.
Persönliches
1. Idylle mit Schatten
Der Name Feuchtwanger, der für die meisten Menschen englischer Zunge unaussprechlich ist, kann als „feuchte Wange“ gedeutet werden, und so hat mein Onkel Lion gelegentlich Wetcheek als literarisches Pseudonym verwendet. Es gibt aber auch andere Deutungen dieses Namens.
Feuchtwangen ist ursprünglich der Name einer kleinen Stadt im Frankenland, die an der Sulzach liegt, etwa 50 Kilometer nördlich der Donau, nicht weit von Rothenburg ob der Tauber entfernt. Im Altdeutschen bedeutet dieser Name wohl eher „Fichtenanger“ als „feuchte Wiese“. Ich habe den Ort einmal aufgesucht; er verfügt über zwei große Kirchen, eine schöne Altstadt und vor allem über ein sehenswertes mittelalterliches Kloster, in dessen Kreuzgang in jedem Sommer ein Theaterfestival stattfindet. Auch Stücke von Lion sind dort gespielt worden.
Ich besitze ein Foto, auf dem ich unter einer Gedenktafel stehe mit der Inschrift: „In dieser Straße lebten bis 1555 die Vorfahren des Schriftstellers Lion Feuchtwanger.“ Nicht vermerkt ist dort, dass die Juden im Jahr 1555 aus dem Ort vertrieben wurden, auch nicht, was vor diesem Datum geschah. Die Vertriebenen zogen 40 Kilometer weiter in nordöstliche Richtung, nach Fürth, wo es eine große jüdische Gemeinde gab. Als im 18. Jahrhundert Familiennamen verpflichtend wurden, nannten sie sich nach ihrer nicht vergessenen Herkunft „Feuchtwanger“. Mitte des 19. Jahrhunderts sind einige Familienmitglieder nach München gezogen, wo sie rasch erfolgreich waren, die einen im Bankgewerbe, die anderen – meine Vorfahren – mit einer Margarinefabrik im Stadtteil Haidhausen. Erst in der Generation meines Onkels und meines Vaters kamen geistige Berufe hinzu.
[10] Von Zeit zu Zeit kehre ich zu meinen Ursprüngen zurück. So habe ich im März 2007 zum ersten Mal nach fast 70 Jahren mein Kinderzimmer wiedergesehen, in dem ich in meinen ersten acht Jahren die meiste Zeit verbracht habe. Ich kam in Begleitung von Beate Siegel, die inzwischen Bea Green hieß und in London lebte. Sie war eine Jugendfreundin, die damals, als wir beide etwa acht Jahre alt waren, oft zu uns nach Hause kam, wenn ihre Eltern zum Skifahren waren.
Im Jahr 2007 wurden wir von Michael Verhoeven gefilmt, dem bekannten deutschen Regisseur, und zwar in der Wohnung, die bis 1939 meinen Eltern gehört hatte. Seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatte meine Großmutter dort gewohnt. Bei diesem Besuch wurden wir von den jetzigen Nutzern der Räume beobachtet, den Angestellten einer Anwaltskanzlei, die dort ihre Büroräume eingerichtet hatte. Anwesend war auch ein Herr Knoll, der Enkel oder Großenkel der Dame, der in den Zwanziger Jahren das Haus gehört hatte und die von der Vermietung der Wohnungen lebte. Herrn Knoll gehört das Haus noch immer, und auch er lebt von der Vermietung. Seine Wurzeln lagen im ländlichen Bayern, seine Urgroßmutter zum Beispiel lebte auf dem Land, und er sprach einen Dialekt, den man heute nur noch selten hört, der mir als Kind aber sehr vertraut gewesen war. Jene Urgroßmutter muss eine weitblickende Frau gewesen sein, denn sie investierte ihr Geld in Immobilien zu einer Zeit, als die Angehörigen der deutschen Mittelschicht ihre Ersparnisse durch die große Inflation gleich nach dem Ersten Weltkrieg dahinschmelzen sahen.
Eine andere, aber ähnliche Rückkehr zu den Wurzeln meiner Kindheit geschah einige Zeit früher, Anfang der achtziger Jahre. Zum ersten Mal nach einem halben Jahrhundert kehrte ich zurück in das Haus meines Onkels Heinrich Rheinstrom, des älteren Bruders meiner Mutter. Es lag in Schwalten im Allgäu, etwa 100 Kilometer südwestlich von München und war das Eldorado meiner frühen Jahre gewesen. Das Haus lag auf einer Anhöhe und war vor dem Ersten Weltkrieg von einem der führenden Architekten, Richard Riemerschmid, als Beispiel für ein modernes Landhaus errichtet worden. Die Gegend war da[11]mals von der Landwirtschaft geprägt und noch völlig unberührt von der modernen Welt. Aus den zwei Ecktürmen des Hauses schaute man zu den Alpen hinüber und sah Neuschwanstein, das weiß schimmernde Märchenschloss, das der unglückliche König Ludwig II. erbaut hatte. Schon als Kind wusste ich von König Ludwig II., der damals als verrückt galt, heute aber höchstens als etwas überspannt angesehen wird. In Oberbayern war er allgegenwärtig. Neuschwanstein war des Königs extravaganteste Hinterlassenschaft; längst ist es eine Ikone mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Bayerische Tourismus-Industrie.
Zum Haus gehörte ein kleiner See, und dort spielten, schwammen und ruderten wir den ganzen Tag. Als ich 50 Jahre später wieder dorthin kam, begleiteten uns Chris, Ruth-Janet und Antonia, meine älteste Tochter. Chris war die schottische Frau meines Vetters Walter Feuchtwanger, der dreimal das Land gewechselt hatte, Ruth-Janet war beider älteste Tochter. Walter war im Jahr 1950 nach München zurückgekehrt, um die Bank neu zu gründen, die bis 1938 dem anderen Zweig der Familie gehört hatte. Seine Familie war die Anlaufstation für alle Feuchtwangers, die in den Nachkriegsjahren München besuchten. Als ich nach 1980 Schwalten wiedersah, war das Haus ein Feriendomizil in öffentlichem Besitz. Es sah fast unverändert aus, und der See wirkte sauber und friedlich wie eh und je. Da niemand zu sehen war, zogen sich Antonia und Ruth-Janet aus und sprangen ins Wasser.
Als ich noch ein Kind war, konnte man diesen Ort nur schwer erreichen. Dort gab es nur einen einzigen Autobesitzer, den man um Hilfe bat, wenn man viel Gepäck oder schwere Gegenstände zu transportieren hatte. Ich erinnere mich genau an den Tag, als sein Auto unterhalb des Hauses von der schmalen Straße in einen Graben rutschte. Man rief kräftige Männer herbei, die mit Hilfe von Holzbalken das Auto aus dem Graben bugsierten. Für mich als Fünfjährigen war das eine aufregende Sache.
Viele Sommer verbrachten wir am Starnberger See, der näher bei München liegt. Dort badeten wir bei Schloss Possenhofen, [12] wo Sisi aufgewachsen war, eine Kusine von Ludwig II. und spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich. Auf der anderen Seeseite, unweit einer Anlegestelle des Radschaufeldampfers, der auf dem See kreuzte, lag Schloss Berg, in dessen Nähe Ludwig ertrank. Man hatte den König abgesetzt und in dem Schloss internieren wollen. Er zog den Nervenarzt, der auf ihn Acht geben sollte, mit sich ins nasse Grab. War es wirklich ein Selbstmord, wie die offizielle Darstellung besagt? Oder hatte man ihn als wahnsinnig erklärt und dann ermordet, weil seine gewaltigen Geldausgaben dem Bayerischen Staat zuviel wurden? Heute markiert ein Kreuz am Ufer den fatalen Ort, der sein finsteres Geheimnis wohl nie preisgeben wird.
Die wichtigsten Orte meiner frühen Jahre bergen für mich nicht nur idyllische Erinnerungen, denn immer ist der schlimme Anstrich der Zeitgeschichte beigemischt. Das gilt auch für Oberföhring, das heute wie andere nördliche Vororte Münchens eingemeindet wurde. Dort besaßen die Bernheimers ein Haus. Lise, die Tochter der Bernheimers, hatte Richard Rheinstrom geheiratet, den jüngeren Bruder meiner Mutter. Sein Schwiegervater Ernst Bernheimer sowie dessen Bruder Otto besaßen den damals vermutlich größten Kunsthandel in Deutschland, der seinen Sitz in einem palastähnlichen Gebäude in der Stadtmitte hatte. Die Nachfahren Otto Bernheimers leiten die Firma auch heute noch. Zur Firma der Bernheimers gehört inzwischen auch „Colnaghi“, der bekannte Kunsthandel in der Londoner Bond Street, der einst auch das Werk von J. W. Turner auf den Markt gebracht hatte.
Oberföhring war von einem großen Park umgeben. Ich besitze noch Fotos, die mich darin als kleines Kind zeigen, beim Spielen mit meiner Kusine Ingrid, der Tochter meines eben erwähnten Onkels Richard und seiner Frau Lise. Ingrid war das einzige Enkelkind von Ernst Bernheimer. Mit uns war Karli, Lises jüngerer Bruder, das zweite Kind der Bernheimers. Jeder von uns hatte sein eigenes Kindermädchen. Karli, der an dem Down-Syndrom litt, war eigentlich Ingrids Onkel, also eine Generation älter, benahm sich aber immer noch wie ein Kind. Um ihn kümmerte sich ein besonders geschultes Kindermädchen, das ihm in [13] allem half, aber Ingrid und ich waren uns dessen kaum bewusst. Karli lebte länger als andere Personen, die zu jener Zeit an dieser Behinderung litten. Ich erinnere mich daran, dass ich ihn in den fünfziger Jahren wiedersah – da war er über 40 Jahre alt –, als meine Mutter und ich in München die Witwe Ernst Bernheimers besuchten, im Rahmen unserer ersten Rückkehr seit dem Krieg. Karli war sehr liebevoll, umarmte meine Mutter und nannte sie „Tante Erna“. Er war auch sehr höflich und wohlerzogen, und man konnte sich gut mit ihm unterhalten.
Sein Überleben warf ein bezeichnendes Licht auf seine Eltern und seine Schwester Lise, meine angeheiratete Tante. In einer Zeit großer Unmenschlichkeit wäre Karli von den Nazis als geisteskrank und also „lebensunwert“ umgebracht worden, noch ehe er dieses Schicksal als Jude erlitten hätte. Die Bernheimers hielten an ihm fest, als ihr Reichtum ihn nicht länger beschützen konnte. Sie mussten mit ihm in Kuba Zuflucht suchen, das einzige Land, das damals bereit war, eine Familie mit einem Down-Syndrom-Kind aufzunehmen, und nur um Karli bei sich behalten zu können, gingen die Bernheimers dorthin, für sie ansonsten kein sehr passender Aufenthaltsort. Irgendwann nach 1945 kehrten sie nach Deutschland zurück. Lise lebte in München bis zu ihrem Tod in den achtziger Jahren, vor allem, weil sie Karli nicht allein lassen wollte, der in den siebziger Jahren starb. Ihre Tochter, meine Kusine Ingrid, wanderte aus in die Vereinigten Staaten, heiratete dort und bekam drei Töchter, die allesamt in Amerika blieben.
Ein anderer bayerischer See, an den wir zuweilen fuhren, war der Walchensee, an dem die Eltern meiner Jugendfreundin Beate Siegel ein Haus besaßen. Ihr Vater Michael gilt noch heute als ein Mann, der sehr früh und sehr tapfer der Nazityrannei entgegentrat. Er war Rechtsanwalt und beschwerte sich bei der Polizei, weil einer seiner Mandanten unrechtmäßig in so genannte „Schutzhaft“ genommen wurde. Das geschah im März 1933, als noch nicht alle begriffen hatten, dass die Herrschaft des Rechts buchstäblich über Nacht aufgehört hatte.
Michael Siegel wusste sicherlich Bescheid, aber er beschloss mutig, an der Fiktion des Fortbestands der Legalität festzuhal[14]ten. Das Ergebnis war, dass er von der SA zusammengeschlagen und in zerrissenen Kleidern durch die Straßen geschleift wurde mit dem Plakat: „Ich bin ein Jude und will mich nie mehr bei der Polizei beschweren.“ Das Foto von dieser Demütigung ist oft abgedruckt worden.
Ich erinnere mich, dass ich Michael Siegel kurze Zeit nach diesem Ereignis gesehen habe. Sein Gesicht war noch schwer gezeichnet. Seine Tochter Bea Green hat mir später erzählt, dass man ihr damals – sie war ein Kind von acht Jahren – das wirkliche Geschehen verschwiegen hatte und dass die Wunden ihres Vaters glücklicherweise nicht lebensbedrohlich gewesen waren. Im Übrigen war er ein zäher Mann und wurde über 90 Jahre alt. Gleichwohl erschütterte dieser Vorfall unseren kleinen Kreis und hätte bedeutend ernster genommen werden müssen, als wir es damals aus Unverstand taten.
Noch an einen anderen Vorfall denke ich im Zusammenhang mit dem Walchensee, der uns Kindern eher komisch erschien, in Wahrheit aber ein weiteres Anzeichen dafür war, welchen Bedrohungen wir entgegengingen. Wir hatten dort ein Haus für die Sommerferien gemietet, als plötzlich zwei Männer in Zivil auftauchten und sich als Mitglieder der Politischen Polizei auswiesen, die erst später in Gestapo (Geheime Staatspolizei) umbenannt wurde, denn die Abkürzung PoPo galt bald als unpassend. Die Polizisten ließen uns wissen, dass sie eine Hausdurchsuchung machen wollten. Während sie das taten, wurden für sie in der Küche Butterbrote mit Sardellenpaste vorbereitet.
Sie hatten aber das Haus bald wieder verlassen, wohl weil sie nichts entdeckt hatten, und spazierten durch den Garten. Wir Kinder gingen hinter ihnen her, um ihnen die Brote mit der Sardellenbutter zu bringen, aber sie waren etwas zu schnell für uns, und so fiel, während wir sie einzuholen trachteten, von Zeit zu Zeit ein Brot vom Tablett auf den Boden. Dass dort viele Fichtennadeln lagen, die in der Paste stecken blieben, fanden wir sehr komisch. Wir vermuteten, dass unser Haus durchsucht wurde, weil wir Feuchtwangers waren, mein Vater war der Bruder von Lion, der den Nazis als rotes Tuch galt, von Hitler und Goebbels an abwärts.
[15] In Wahrheit war mein Onkel mütterlicherseits der Grund für die Hausdurchsuchung, der schon erwähnte Professor Heinrich Rheinstrom, Rechtsanwalt und Besitzer des Hauses in Schwalten. Genau wie Lion hielt er sich im Januar 1933 zum Glück im Ausland auf, und meine Mutter ging von Zeit zu Zeit in seine leerstehende Villa in München, um Dinge mitzunehmen, die sie ihm nach Paris schicken konnte. Das hatte Verdacht erweckt.
Die Vorfahren meiner Mutter, die Rheinstroms, stammten aus der Pfalz, und viele ihrer Verwandten wohnten in jener Gegend am Rhein, wie schon der Familienname besagt. Es ist eines der ältesten Siedlungsgebiete von Juden in Mitteleuropa, dessen Ursprünge in der Römerzeit liegen. Zu den antiken Gebäuden, die die Zeiten dort überstanden haben, gehören jüdische Ritualbäder, die man noch heute besichtigen kann. Dass einmal seit Jahrhunderten in Deutschland ansässige und im deutschen Kulturleben tief verwurzelte Familien wie die Rheinstroms oder die Feuchtwangers vertrieben würden, war eigentlich unvorstellbar, war eine Verrücktheit.
Ich erinnere mich an eine andere Begebenheit, diesmal wieder am Starnberger See. Nicht weit vom Seeufer entfernt gab es im Städtchen Berg eine Bäckerei und Konditorei, die von der Familie Graf betrieben wurde. Oskar Maria Graf, der Bruder des Betreibers, war damals der wohl bekannteste Schriftsteller unserer Heimat, der aber auch außerhalb Bayerns anerkannt war und überall als typisch bayerisch galt. Er war ein leidenschaftlicher Gegner der Nazis und musste gleich nach der Machtergreifung ins Exil gehen. Im Mai 1933 schrieb er aus Wien einen berühmt gewordenen Brief, in dem er sich darüber beschwerte, dass man bei den Bücherverbrennungen seine Werke vergessen habe. Damit habe man ihm die Ehre verweigert, dass seine Bücher dem Autodafé der Nazis zum Opfer gefallen seien, obwohl er doch immer die Wahrheit geschrieben habe.
Der Bruder des Autors lebte weiterhin als Bäcker in Berg, und wir gingen in seine Konditorei, wohl um unsere Solidarität zu erweisen. Bei einem Besuch begrüßte er meinen Vater mit [16] besonderem Überschwang und rief in breitestem Bairisch aus: „Herr Doktor, mir ha’m Brüder!“ Brüder zu haben wie Oskar Maria Graf oder Lion Feuchtwanger war im Dritten Reich keine besonders gesunde oder gemütliche Angelegenheit.
Es gab aber noch andere literarische Bezüge in unserer damaligen Umgebung. Anfang der 30er Jahre mieteten wir gelegentlich eine Wohnung in einer Fischerhütte in Seeheim am Starnberger See, etwas südlich von Berg, ebenfalls auf der Ostseite des Sees. Diese Gegend war nicht so entwickelt wie die Westseite, denn hier führte keine Eisenbahn entlang. Die Wohnung, die wir mieteten, gehörte den Wedekinds, ursprünglich vielleicht sogar Frank Wedekind persönlich. Er war ein bedeutender Autor und eine führende Persönlichkeit der Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg. Er starb 1918. Die Gestalt der Lulu, die von Alban Berg zur Opernfigur gemacht wurde, war eine Erfindung Wedekinds.
Nicht weit von seinem Haus entfernt stand eine Villa, die einem berühmten Sänger der Münchner Oper gehörte. Seinen Namen habe ich vergessen, ich weiß aber noch, dass er den Titel „Kammersänger“ führte, denn in Deutschland führten sogar Opernsänger Titel, was mir, vom englischen Blickwinkel her, auch heute noch sonderbar vorkommt. Er war dadurch aufgefallen, was aus unserer Sicht unerträglich war, dass er in der Schlussszene von Richard Wagners Meistersingern eine riesige Hakenkreuzfahne auf die Bühne brachte.
In meine Klasse ging der Adoptivsohn eines anderen berühmten Kammersängers, nämlich von Julius Patzak. Für Kenner alter Aufnahmen hat sein Name immer noch einen guten Klang.
Als ich fünfzig oder sechzig Jahre später an die Ostseite des Starnberger Sees zurückkam, fiel mir auf, wie sehr sich alles verändert hatte. Heute, wo jeder ein Auto hat, ist es voll von Leuten aus München oder anderswoher, die einen Tagesausflug hierher machen, in den Restaurants speisen, schwimmen oder auf dem See rudern. An manchen Stellen sieht es aus wie in einem Vorort von München. In meiner Kindheit war die See[17]straße noch nicht asphaltiert. Auf mich wirkte es so, als hätte Oberbayern am Ende des 20. Jahrhunderts etwas erlebt, was jeder Einwohner von Südengland auch kennt, nämlich eine Verstädterung, wenn auch das Landleben in England doch sehr anders war und die Verstädterung viele Jahrzehnte früher eingesetzt hatte.
Ein anderer häufiger Ausflug nach Oberbayern während meiner Kindheit, der mit literarischen Reminiszenzen verbunden ist, führte auf die Konradshöhe, bei Baierbrunn, im Isartal. Dort wohnte Gertrud von le Fort, auch Baronin le Fort oder „die Baronin“ genannt. Sie war die bedeutendste katholische Dichterin im Deutschland jener Jahre. International wurde sie bekannt durch eine ihrer Novellen, Die Letzte am Schafott, aus der Georges Bernanos ein Drama machte, das wiederum als Vorlage für die Oper Gespräche der Karmeliterinnen von Francis Poulenc diente.
Mein Vater kannte die Baronin, weil sie eine Zeitlang Assistentin von Ernst Troeltsch gewesen war, eines jener bedeutenden Professoren, deren Werke mein Vater als Verleger bei Duncker & Humblot betreute. 1926, drei Jahre nach dem Tod von Troeltsch, konvertierte sie in Rom zum Katholizismus. Sie stammte aus einer mecklenburgischen Adelsfamilie, Nachfahren der Hugenotten, die nach der Widerrufung des Ediktes von Nantes Frankreich verließen und in preußische, aber auch in russische Dienste traten.
Ich glaube nicht, dass mir damals die Ausflüge auf die Konradshöhe viel Spaß gemacht haben. Denn man musste lange Strecken auf staubigen Wegen zu Fuß gehen, und die Baronin von le Fort war eine unverheiratete Dame von über 60, der eine andere unverheiratete Dame als Gefährtin diente, das war nun wirklich keine kinderfreundliche Umgebung. Mein Vater nannte die Baronin zuweilen „die Plüschene“, wahrscheinlich weil sie Samtkleider trug und in ihrer ganzen Art etwas „Plüschenes“ hatte.