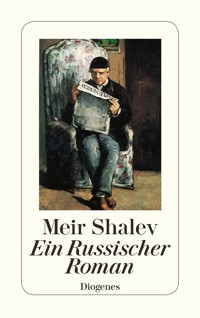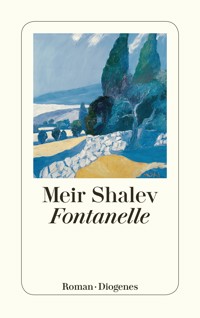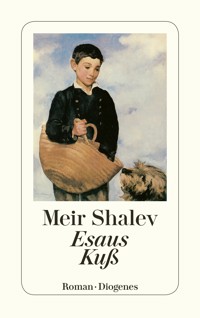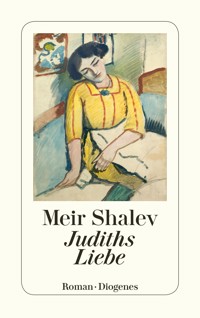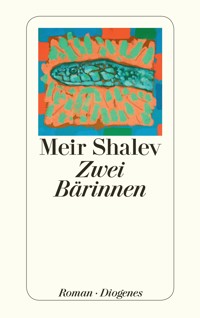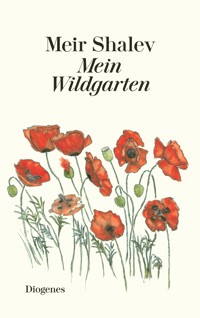21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Itamar, ein äußerst gutaussehender Mann, lebt in den USA und kommt jedes Jahr zurück nach Israel, um seinen Bruder Boas zu sehen. Wie es ihre Tradition ist, verbringen die Brüder einen Abend zusammen, trinken und erinnern sich an die Eltern. Doch diesmal erzählt Itamar Boas von seiner Nacht mit einer Frau, die ihn in ihr Haus zwischen Olivenhainen gelockt und in ein vertracktes erotisches Spiel verwickelt hat. Eine überraschende Geschichte über Familie und Verstrickung, Liebe und Sehnsucht, Schönheit und Einsamkeit, Begehren und Widerstreit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Ähnliche
Meir Shalev
Erzähl's nicht deinem Bruder
Roman
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Diogenes
Im Gedenken an Refi, Refaella Shir,
meine geliebte Schwester, die nicht mehr ist.
1
Einmal, in einer kleinen Tel Aviver Straße, deren Namen ich vergessen habe, erschienst du mir andeutungsweise in einer anderen Frau. Sie kam mir entgegen mit deinen Schritten, ließ mich deine Gestalt sehen, und mir blieb schier das Herz stehen, meine Füße hörten auf zu gehen. Meine Hände nahmen kurz die Brille ab – Kurzsichtige wie ich werden verstehen, warum – und setzten sie rasch wieder auf.
»Du hast Reset gemacht«, höre ich Boas im Geist zu mir sagen.
»Etwas in der Art«, erwidere ich, »und ich schreibe eine Geschichte. Stör mich nicht.«
Da begriff ich bereits, dass nicht du es warst, aber manchmal überholt der Körper das Bewusstsein, kommt das Fleisch der Seele zuvor. Meine Lippen lächelten die Frau ganz von alleine an, und meine Augen fixierten sie.
Sie erwiderte überrascht meinen Blick: »Kennen wir uns?«
»Nein, Verzeihung, es kam mir nur kurz so vor.«
»Ich verstehe. Sie hielten mich für eine andere.«
Verlegen gestand ich: »Gewissermaßen. Sie sehen dieser anderen Frau ein bisschen ähnlich.«
Und insgeheim, zu mir: Idiot!
»Ja«, sagte sie, »diesen Satz kenne ich, habe ihn schon öfter gehört.«
»Tut mir leid«, sagte ich.
Und insgeheim, zu mir: Wie blöd kann man bloß sein.
»Schon in Ordnung, ich bin diese Verwechslungen gewohnt, anscheinend sehe ich vielen anderen Frauen ähnlich«, erwiderte sie. Und nach einer kurzen, nachdenklichen Pause: »Oder ich stoße immer wieder auf Männer, die ein und dieselbe Frau nicht vergessen können.«
»Das war ein schöner Satz«, sagte ich, »eines Tages werde ich ihn vielleicht verwenden.«
»Gern geschehen«, gab sie zurück, »dieser schöne Satz ist ein Geschenk von mir. Sie dürfen ihn verwenden, wann immer Sie Lust haben.«
»Danke«, sagte ich. »Das ist ein schönes Geschenk.«
»Sie auch.«
»Ich verstehe nicht«, stellte ich mich dumm.
»Sie haben sicher schon von vielen Frauen gehört, dass Sie ein sehr gut aussehender Mann sind.«
»Hoppla …«, rief Boas, diesmal in Person, in meinem Hotelzimmer. »Und schon wieder ist es unserem Schööönen passiert, noch eine Frau flirtet mit ihm. Auf offener Straße, im Geschäft, bei der Arbeit, auf einer Party und wer weiß, wo sonst noch.«
Boas ist mein kleiner Bruder. Wir haben beide die Sechzig überschritten, und er ist nur zwei Jahre jünger als ich, aber so nenne ich ihn gern. Und von dieser Frau, die einen Moment Michal glich – da, jetzt habe ich deinen Namen ausgesprochen und niedergeschrieben –, erzählte ich ihm, als wir zusammensaßen, bei einem meiner Besuche in Israel, und auch im Geist, wenn ich mich zum Schreiben hinsetzte, in meinem Haus in den Vereinigten Staaten.
Ich wurde wütend: »Was für eine Party denn? Ich geh nicht auf Partys, und ich mag es nicht, wenn du mich Schöööner nennst, in diesem ekelhaften Tonfall deines Vaters.«
»Unseres Vaters«, sagte Boas, »er war auch dein Vater, falls du es wieder mal vergessen haben solltest.« Er leerte sein Glas auf seine unausstehliche Weise, in einem großen Schluck, und lachte auf: »Aber weiter, erzähl von dieser Frau. Seid ihr zu ihr gegangen oder zu dir ins Hotel? Und wie habt ihr’s getrieben? Du auf ihr oder sie auf dir?«
»Wir sind weder zu mir noch zu ihr gegangen, und wir haben auch nichts getrieben. Lass das bitte.«
Es war spätabends. Wir saßen auf dem Balkon meines Hotelzimmers, am Meer, das unsichtbar, aber vorhanden war, sich im Dunkeln wälzte wie ein großes Tier. Wir tranken Gläschen um Gläschen von dem Feigenschnaps, den ich zu diesen Treffen immer mitbringe, kosteten von den Mezze, die Boas in Tel Aviv gekauft hatte, und unterhielten uns. So machen wir es jedes Mal, wenn ich nach Israel komme – wir verabreden uns zu einer »Nacht der Brüder«, wie wir sie nennen, die nur uns gehört. Nur meinem Bruder und mir, uns beiden allein.
Wir reden und erzählen dann vom Untergang der Sonne bis zu ihrem Aufgang, essen und trinken – »saufen, um genau zu sein«, sagt Boas’ Frau Maya –, betrinken uns still, langsam und gründlich und reden: über meine Frauen und seine Frau, über die Kinder, die ich nicht habe, über seine Tochter und seinen Sohn, und über meine Mutter und seinen Vater, wie ich sie für mich hartnäckig nenne, denn er zog Boas vor und sie mich.
Der Alkohol löst unsere Zungen, spült unsere Herzen durch, ölt unsere Stimmbänder. Boas und ich sind unterschiedliche, aber eng vertraute und liebende Brüder. Die Erinnerungen steigen auf, und da wir Söhne unserer Eltern sind, sind sie zahlreich und mächtig. Doch vor einigen Jahren, in der Brüdernacht 2010, habe ich ihm eine Geschichte erzählt, die nichts mit unserer Familie zu tun hat, über eine Nacht, die ich zwanzig Jahre zuvor, 1990, erlebt habe. Ich erzählte ihm von einer Frau, die ich an jenem Abend kennenlernte, von unserer Begegnung und von dem, was danach in ihrem Haus geschah – einem einsamen Haus irgendwo im Scharon, inmitten eines Gewirrs von Feldwegen, zwischen Zitrushainen, Gemüsebeeten und Avocadoplantagen.
2
Mein Name ist Itamar Diskin. Ich bin 1945 in Jerusalem geboren und lebe schon seit fünfunddreißig Jahren in den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr komme ich für einige Wochen auf Besuch nach Israel, immer im Frühherbst, miete ein Auto und übernachte in einem Hotel am Meer. Nicht in Tel Aviv, wo Boas und Maya wohnen, sondern in Herzliya oder Netanya.
Maya grummelt: »Warum nimmst du unsere Einladung nicht an und wohnst bei uns? Wir sind deine ganze Familie.« Aber ich beharre darauf. Ich möchte die beiden nicht mit den nächtlichen Gewohnheiten des alten Junggesellen stören, der ich über die Jahre geworden bin: Schlafengehen »mit den Hennen« und Aufwachen »mit den Hähnen«, zumal nach einem Flug aus den USA, Musikhören zu den verrücktesten Nachtstunden, mitternächtliches Eiswürfelklirren im Shaker und im Glas, nächtliche Betätigung der Klospülung, Rausgehen zum Morgenlauf und schnaufende Rückkehr.
Auch in Amerika jogge ich jeden Morgen, und wenn ich in Israel bin, schwimme ich gegen Abend noch im Meer. So auch dieses Mal. Bei meiner Rückkehr vom Strand strömten drei junge Frauen und zwei junge Männer in knappen, tropfenden Badesachen zu mir in den Hotelfahrstuhl, drängten sich lärmend rein wie bei euch hier üblich, Boas. Ich drückte meine Badetasche an die Brust, aber ein Tropfen, der an der Nasenspitze eines der Kerle hing – Wasser? Schweiß? –, schwoll an, schwankte, und wie in Zeitlupe – die ich auch im Kino zum Kotzen finde – fiel er runter, prallte auf meinen Fuß, lief über meine Haut und verschwand wie davon aufgesaugt.
Eine der jungen Frauen fixierte mich und fragte: »Sag mal, bist du nicht ein Filmschauspieler? Kann es sein, dass ich dich mal im Kino gesehen habe?«
Ich setzte das beste Hollywood-Lächeln auf, das ich zuwege brachte, und antwortete in meinem amerikanischsten Englisch, dass ich nicht Hebräisch spräche. Ich hörte sie gerade noch darüber rätseln, wer ich sein könnte, da hielt der Fahrstuhl schon auf meiner Etage. Ich schlängelte mich raus, steuerte geradewegs mein Zimmer an und ging unter die Dusche.
Lange stand ich unter dem Wasserstrahl. Reinigte mich von dem Lärm der Worte und dem Schmutz des Tropfens, wusch Sand und Salz des Meeres ab. Beim Anziehen überlegte ich, ob ich mich zum Abendessen bei Boas und Maya einladen oder mir einfach nur etwas aufs Zimmer bestellen sollte, und nickte schließlich – verwirrt vom Zeitunterschied zwischen meinem Wohn- und meinem Heimatland – bekleidet auf dem Bett ein.
Ich schlief kurz und schlecht, und als ich aufwachte, war es bereits dunkel im Zimmer. Im ersten Moment begriff ich nicht, wo ich war. Ich kam hoch, setzte die Brille auf, blickte aus dem Fenster und sah in der Nähe Männer und Frauen vor einer Bar stehen, trinken, reden, aus und ein gehen. Lachen schallte von dort, nicht zu laut, sondern entspannt und freundlich, wie die Stimmen alter Bekannter.
Meine Kleider waren von dem kurzen Schlaf ganz zerknittert. Ich zog mich um, musterte mich im Spiegel, fuhr mit demselben Fahrstuhl wieder runter – erleichtertes Aufatmen: Jemand hatte bereits den Boden aufgewischt – und ging dorthin.
Die Bar war klein und angenehm, eine richtige Kiez-Kneipe. Durch den Zigarettenqualm, die süßlichen Parfüms und penetranten Rasierwasser, die Frauen und Männer gern auf ihre Mitmenschen loslassen, drangen liebliche Düfte nach gutem Essen. Sie hingen so in der Luft, wie Essensdüfte es tun sollen: wie die Farben einer Flickendecke, einander berührend, aber nicht verfließend.
»Bist du sicher, dass dort geraucht wurde?«, hakte Boas nach. »Bei uns in Israel ist Rauchen in Restaurants verboten.«
Boas hat viele Jahre in der Marine gedient. War ein Chief, ein Maschinenraumoffizier in der U-Boot-Flotte. Der Dienst dort, hat er mir mal erzählt, erforderte von ihm, auf alle Einzelheiten zu achten, genau hinzuhören und hinzusehen. Unter dem Meeresspiegel verhindert diese Eigenschaft Unfälle und rettet Leben. Doch über dem Wasser, auf einem Hotelbalkon, bei Delikatessen und der zweiten Flasche Boukha-Schnaps, wirkt sie lächerlich.
»Boas, du bist jetzt nicht auf deinem U-Boot«, sagte ich. »Such nicht auch in meiner Geschichte nach Lecks und Defekten.«
»Reg dich nicht auf«, beschwichtigte er.
»Ich habe dir ja gesagt, die Geschichte ist vor zwanzig Jahren passiert. Damals durfte man in Bars und Restaurants noch rauchen.«
»Zwanzig Jahre? Das ist ein Jahr nach Mutters Tod«, stellte er fest.
»Stimmt. In dem Jahr bin ich zweimal hergekommen, im Herbst wie immer und dann nochmals im Frühling, zu ihrem ersten Todestag.«
Die Tische waren alle schon besetzt, aber an der Bar saßen nur zwei Paare. Ich setzte mich in einigem Abstand zu ihnen an die Wand und sah mich um. Mit behutsamen Blicken, die nirgends hängen blieben, gewiss nicht starrten, Blicke, mit denen ein fremder Mann in einem Territorium, das nicht seines ist, die Einheimischen betrachtet. Besonders, wenn er ein auffallender Mann ist und weiß, dass auch sie ihn anschauen, ihre Vermutungen anstellen und Geschichten daraus spinnen.
Bald traf mich ein spezifischer Blick aus den Augen einer Frau, die älter war als ich. Ich schätzte sie auf sechzig.
»Wie alt warst du da noch mal?«
»Ich hab dir doch gesagt, es war vor zwanzig Jahren, 1990, also war ich fünfundvierzig.«
Sie saß an einem Ecktisch in Gesellschaft einer jungen Frau. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit hielt ich sie für Mutter und Tochter, ein Gespann, wie man es manchmal sieht: eine strahlende, ältere Mutter und ihre blasse jüngere Ausgabe.
Sie nahm mich immer wieder ins Visier. Oft schon hatte ich diesen prüfenden Blick gesehen. Und obwohl ich ihn kannte, erschauerte ich und nahm die Brille ab. Nicht, um mein Äußeres zu verändern, sondern weil bei so kurzsichtigen Augen wie meinen das Absetzen der Brille die Gesichter der Mitmenschen kontur- und ausdruckslos macht und sie verstummen lässt. Sie schweigen nicht völlig, aber ihr Lärm verebbt, wird zum fernen Rauschen unsichtbarer Wellen.
»Wie wenn Mutter ihr Hörgerät rausgenommen hat«, sagte Boas.
»Bei Mutter war das etwas komplizierter«, erwiderte ich.
Der Barmann kam zu mir. Ich bestellte einen Grappa.
»Die Bruschette gehen aufs Haus«, erklärte er und stellte einen Teller neben mein Glas.
Ich dankte ihm, trank einen Schluck und begann langsam zu essen. Ein paar Minuten später erhob sich die Nebelgestalt der älteren Frau und ging hinter den Tresen. Ihren Gesichtsausdruck konnte ich nicht erkennen, aber Gesten und Haltung verrieten mir, dass sie an der Kasse telefonierte.
Ein kurzes Gespräch, und schon kam sie auf mich zu, wurde immer klarer, löste sich aus den Nebelschleiern.
»Guten Abend«, sagte sie.
»Guten Abend«, gab ich den Gruß zurück. Ich setzte die Brille wieder auf und sagte: »Jetzt erkenne ich Sie auch. Sie sind die Dame, die an dem Tisch dort in der Ecke gesessen hat.«
»Ich bin auch die Wirtin, und Sie sind ein neuer Gast. Ich wollte wissen, ob es Ihnen hier gefällt.« Zu diesen Worten füllte sie mir Grappa nach.
»Ja, sehr«, sagte ich, »danke.«
»Es ist nicht wegen Ihrer schönen Augen. Wir haben noch Happy Hour, da steht Ihnen der zweite Drink zu, und ich hoffe, Sie sind zufrieden und kommen wieder.«
»Wohl leider nicht so bald. Ich lebe nicht in Israel.«
»Darf ich Sie um etwas bitten?«
»Gern«, erwiderte ich.
»Ich bitte Sie, nicht gleich wegzugehen, sondern noch ein Weilchen zu bleiben, denn bald wird eine Frau herkommen, die Sie gern treffen möchte.«
»Ich versteh nicht«, sagte ich. »Hat sie mich hier gesehen? Kenne ich sie?«
»Nein, was bist du naiv«, warf Boas ein. »Die Wirtin hat doch bei der angerufen und erzählt, dass ein gut aussehender Fremder allein an der Bar sitzt und sie sich beeilen soll, ehe eine andere ihn abschleppt. Du hast ja selbst gesagt, dass sie telefoniert hat, bevor sie dich ansprach.«
»Schade, dass du nicht dabei warst, um mir zu sagen, was ich tun soll«, gab ich zurück.
»Die Betreffende ist nicht hier und hat Sie nicht gesehen«, antwortete die Wirtin. »Ich habe Sie gesehen und ihr am Telefon geraten herzukommen.«
»Genau, was ich gesagt habe«, erklärte Boas. »Vielleicht solltest du doch auf deinen Bruder hören.«
»Nicht, weil du so klug bist, Boas«, sagte ich. »Jene Nacht war einfach sehr wirr für mich, wie du noch verstehen wirst, aber ich präsentiere sie dir als Geschichte, und Geschichten ordnen die Wirklichkeit.«
»Ist mir zu hoch«, sagte er. »Ich bin ein einfacher Mensch. Ein Ingenieur. Kein Mann der Geschichten, sondern einer der Planskizzen, der Materialstärken, der menschlichen Stärken vielleicht auch ein bisschen, aber vor allem der Druck-, Zug- und Antriebskräfte.«
»Ist das ein Dienst, den Sie allen Gästen anbieten?«, fragte ich sie.
»Gute Frage«, sagte Boas. »Und ich errate schon, worauf diese Geschichte hinausläuft. Vermutlich liege ich in ein paar Minuten bereits unter dem Bett von dir und von der, die dich kennenlernen wollte, und kriege ein paar Brosamen ab, die herunterfallen.«
»Nein«, antwortete die Wirtin, »wir kennen uns schon viele Jahre und stehen uns nahe. Früher war ich die jüngere Freundin ihrer Mutter, heute bin ich ihre ältere Freundin, und ich wollte ihr eine Freude machen. Ein fremder Mann, der sehr gut aussieht, sitzt allein bei mir in der Bar und trinkt Grappa. Du solltest kommen und ihn kennenlernen, habe ich ihr gesagt.«
Ihre Augen schweiften über meinen Körper, betrachteten Gesicht, Brust und Hände, wanderten zu den Schenkeln hinunter, die sich von selbst aneinanderdrückten.
»Benachrichtigen Sie sie jedes Mal, wenn ein schöner Mann Ihre Bar betritt?«, fragte ich.
»Nein.« Sie lachte. »Außerdem ist noch nie jemand Ihres Formats reingekommen. Es ist nicht nur Ihre Figur, es ist auch Ihr Kleidungsstil.«
»Danke«, sagte ich.
»Gibt es eine Frau, die Sie einkleidet?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete ich.
»Gibt es eine Frau, die Sie auszieht?«
Boas prustete los: »Eine tolle Frau, diese Barbesitzerin. Wieso hast du mich in den zwanzig Jahren seither nie mal dort hingeführt?«
»Weil ich selbst nie wieder hingegangen bin. Weder in diese Bar noch in jenes Hotel.«
»Sie ist wirklich eine hübsche junge Frau, und ich kann Ihnen versichern, dass sie Sie nicht langweilen wird«, erklärte die Wirtin. »Außerdem brauchen Sie sich keine Gedanken über den ersten Satz zu machen, den Sie zu ihr sagen wollen. Ihr Aussehen genügt.«
»Da hat sie recht«, meinte Boas. »Erinnerst du dich noch, was Mutter über dich gesagt hat?« Und schon sagte er mit der speziellen Miene, die er immer aufsetzt, wenn er unsere Eltern imitiert: »Itamars Schönheit wird ihm alle Türen öffnen, wird alle Mauern aller Jerichos vor ihm einstürzen lassen … Komisch, nicht wahr. Wir beide sind schon über sechzig, alte Waisen, und wie sehr leben Vater und sie noch in uns.«
»Jetzt gehen wir schwanger mit ihnen«, sagte ich.
»Dann los, sollen sie bald geboren werden«, sagte Boas, »sollen sie zur Welt kommen, groß werden und uns in Ruhe lassen.«
3
Meinen Namen, Itamar, hat mir meine Mutter gegeben, die auch stets darauf achtete, ihn feierlich auf der letzten Silbe zu betonen. Aber die meisten meiner Freunde und Bekannten – sie sind nicht zahlreich, muss ich gestehen – nennen mich Ita. Ita mit Betonung auf der ersten Silbe, wie Pita. So hatte mich Boas im Alter von zwei Jahren genannt, und dieser Kleinkindername ist an mir hängen geblieben.
Wenn ich jemand Neues kennenlerne, stelle ich mich als Itamár, in der feierlichen Betonung meiner Mutter, vor und füge auch unseren Familiennamen Diskin an, der gut zu meinem Bruder und seinem Vater passt und weniger zu ihr und mir. Aber die meisten neuen Bekannten bevorzugen, sobald sie sie einmal gehört haben, die Koseform.
Meine Mutter, die stolz auf den eigens für mich ausgesuchten Namen war, tadelte mit biblischem Zorn jeden, der ihn zu Ita verkürzte: »Zerstörer und Verwüster! Ich habe dir so einen schönen Namen gegeben, und die hacken ihn in der Mitte ab.« Doch am Ende fand sie eine überraschende Lösung, sowohl in der Form als auch, weil sie eine gewisse Kompromissbereitschaft offenbarte, was bei ihr eher selten vorkam. Sie erklärte, sie würde diese Kurzform akzeptieren, wenn man sie mit dem hebräischen Buchstaben Tet statt mit Tav schriebe, oder in lateinischen Buchstaben mit zwei T. »Das ist komisch«, sagte ich ihr einmal, als ich größer war, »und es macht auch keinen Unterschied. Diese Abkürzung schreibt und liest doch keiner, man sagt und hört sie bloß.« Aber sie beharrte: »Du wirst groß werden, wirst Briefe von Mädchen bekommen, und alles Geschriebene wird letzten Endes Wirklichkeit.« So forsch und entschieden war sie, dass ich auch jetzt noch, Jahre nach ihrem Tod, Itta wie sie es wollte mit Tet oder zwei T schreibe, wenn ich versuche, diese Geschichte niederzuschreiben.
»Du hast mir nicht gesagt, dass du schreibst«, bemerkte Boas.
»Weil das kein richtiges Schreiben ist. Ich halte ein paar Geschichten und Szenen fest, um sie nicht zu vergessen, das ist alles.«
Anders als unsere Mutter habe ich nie gegen den Kosenamen aufbegehrt, den Boas mir gegeben hat, und auch seine Schreibweise hat mich nicht groß beschäftigt. Überhaupt neige ich nicht zu Protesten und Streitereien. Ich liebe das Leben ruhig, das Krumme gerade und die Wellen flach. Aber als ich etwas größer wurde, bekam der Name »Itta« den unerträglichen Zusatz »der Schöne«. So, »Itta der Schöne«, nennt man mich in meiner Abwesenheit, und wer es in meiner Anwesenheit tut, will mich provozieren oder sehen, wie ich meinen Ärger bezwinge, verlegen und beherrscht.
»Wie Mutter immer sagte: Itamar ist das Kalb, das Abraham den Engeln vorgesetzt hat. Ein zartes und gutes Jungrind. Widerspricht nicht und macht keine Probleme.«
»Schon gut«, sagte ich, denn ich mochte weder den Vergleich noch ihre Erklärung dazu, aber Boas ließ nicht locker und zitierte sie weiter: »Vor lauter zart und gut wird er’s manchmal schwer und schlecht haben.«
»Ich habe es nicht schwer, und es geht mir gewiss nicht schlecht, Boas«, brauste ich auf.
Ich bin nicht der einzige Mensch, dem man ein solches Adjektiv an den Namen hängt. Manche werden »der Lange«, »der Böse«, »der Liebe« genannt, aber ich habe die Bezeichnung nicht nur bekommen, weil ich gut aussehe, sondern auch weil ich sonst keine besonders hervorstechenden Eigenschaften besitze. Ich bin zum Beispiel weit schöner als klug oder dumm, mutig oder feige, und die meisten Menschen, die ich kenne, sind vernünftiger oder verschlossener, jähzorniger oder versöhnlicher, lustiger und schlagfertiger als ich. All diese Eigenschaften brauchen jedoch eine Gelegenheit und eine gewisse Zeit, um entdeckt zu werden, aber »ihr Schönen«, wie Michal gern sagte, »habt diese Fahne, die über euch flattert, euch kennzeichnet und ankündigt, noch ehe ihr den Mund aufmacht.«
»Du bist auch schön«, sagte ich ihr damals.
»Du bist viel schöner als ich«, erwiderte sie lachend, »und wenn wir zusammen auf der Straße gehen, gucken alle nur dich an.«
»Aber ich bin bloß von außen schön, und du bist so klug und so besonders und hast tausend Schichten«, wandte ich ein.
Fünfunddreißig Jahre sind vergangen, seit wir uns getrennt haben und ich in die Vereinigten Staaten fuhr, eine Reise, die ursprünglich lindern und heilen sollte und dann dazu führte, dass ich dort blieb. Fünfunddreißig Jahre, in denen ich sie nicht gesehen habe, aber die Zeit – ich spüre eindeutig ihren Verlauf – beließ sie weiter an meiner Seite. Fünfunddreißig Jahre, in denen ich ihren Geburtstag stets an meinem gefeiert habe, denn durch einen wunderbaren Zufall sind wir beide am selben Tag desselben Jahres geboren, ich allerdings eine Stunde früher.
Als wir das entdeckten, sagte sie: »Wie schön zu wissen, dass wir am selben Tag zur Welt gekommen sind.« Doch ich maulte: »Als ich geboren wurde, war ich eine geschlagene Stunde ohne dich, aber als du geboren wurdest, war ich schon da und wartete auf dich.«
Sie lachte schallend, umarmte mich und sagte: »Du Dummerchen, so muss es sein«, und: »Itta, du Romantiker, was soll bloß aus dir werden?« Und mir traten die Tränen in die Augen.
»Du bist total bekloppt«, sagte Boas und kippte sein Glas in einem derben Zug, indem er den Kopf zurücklegte. Ich sagte schon: Ich mag es nicht, wenn er so trinkt, aber zu dieser Abendstunde konnte ich mir Bemerkungen noch verkneifen.
»Einmal habe ich es deinem Vater erzählt«, fuhr ich fort, »und der hat mir gesagt: Es ist sehr gut, wenn ein Ehepaar, oder überhaupt Familienmitglieder, an ein und demselben Tag geboren sind.«
»Unserem Vater«, korrigierte mein Bruder mich wieder.
»Das ist sehr gut«, hat mir unser Vater erklärt, »so könnt ihr sparen. Eine Geburtstagsparty für beide macht weniger Ausgaben.«
»Er war schon ziemlich geizig«, sagte Boas. »Auf jeden Fall gemessen an dem Geld, das er verdiente. Erinnerst du dich noch, wie er im Haus rumlief und die Lampen löschte?«
»Die Glühbirnen«, korrigierte ich ihn.
»Aber in diesem Punkt hatte er recht. Es ist wirklich schade, dass ihr nicht zusammengeblieben seid«, sagte Boas, »denn wie ich euch zweie kenne, dich zumindest …«
»Wie ich euch zwei kenne«, berichtigte ich ihn, »nicht zweie, ein Glück, dass Mutter schon tot ist und dein Hebräisch nicht hört.«
»Ich beherrsche mich und geh nicht drauf ein«, sagte er. »Was ich sagen wollte: Wie ich euch zweie kenne, sterbt ihr bestimmt auch am selben Tag, und wie ich Vater kenne, hätte er sicher gesagt, eine Beerdigung und Trauerwoche für zweie macht auch weniger Ausgaben.«
Wir beide, Michal und ich, sind fünfundsechzig Jahre alt. Ich lebe in Charlottesville, Virginia, USA, und fahre jedes Jahr nach Israel. Sie lebt in Tel Aviv und reist viel in der Welt herum. Manchmal sehe ich ein Foto von ihr im Internet, wie sie noch einen Wissenschaftspreis oder Ehrentitel verliehen bekommt, manchmal mit ihrem Mann, ihren beiden Töchtern – die ältere, eine Kinderärztin, sieht ihr so ähnlich, dass es wehtut –, und den vier Enkelkindern.
Mir schaudert, wenn ich sehe, was die Jahre ihr angetan haben. Ich selber bin – wie sie es, als wir jung waren, vorausgesagt hat – weitgehend vom Zahn der Zeit verschont geblieben: Mein Haar hat sich mit etwas Grau geschmückt, ist aber immer noch dicht. Meine Zähne sind vollzählig und makellos, meine Haltung ist aufrecht, und ich habe keine Spur von Bauchansatz. Nur ein paar kleine Härchen lugen mir neuerdings aus Ohren und Nasenlöchern, und mein Friseur versengt sie mit der blau schimmernden Flamme eines in Spiritus getränkten Wattebauschs.
»Beruhigen Sie sich, Mr Diskin«, sagt er und grinst angesichts der Angst, die mir jedes Mal ins Gesicht geschrieben steht, »erinnern Sie sich an unsere Herkunft. So macht man es doch bei uns im Middle East.«
Mein Friseur ist ein Immigrant aus dem Libanon. Alle zwei Wochen suche ich seinen Barbershop auf, eine kleine nahöstliche Insel im so amerikanischen Charlottesville. Er reicht mir zur Begrüßung ein Glas mit Wespentaille, breiten Hüften und üppigem Busen, voll mit süßem Tee, und wenn ich es ausgetrunken habe, nehme ich die Brille ab und überlasse meinen Kopf seiner Pflege.
Er ist ein Friseur alter Schule, bearbeitet mein Haar mit klappernden Scheren, raschelndem Kamm und wisperndem Messer und beäugt mich spöttisch: Warum ich meine Brille denn in der Hand behalte, statt sie auf die Ablage unter dem Spiegel zu legen. Er schneidet und kämmt und sengt, und danach fährt er mir mit einer großen, weichen Bürste über den Nacken, massiert meinen Schädel mit duftenden Essenzen, klopft mir auf die Wangen, kneift sie leicht und befindet: »Tamaam – perfekt!«
Ich setze rasch die Brille wieder auf, und die zwei verschwommenen Flecken in dem großen Spiegel verwandeln sich wieder in ihn und mich.
»Es ist angenehm, einen Mann zu bedienen, der so aussieht wie Sie«, sagt er wie bei all meinen vorigen Besuchen. »Vielleicht fotografiere ich Sie und stelle Ihr Bild ins Schaufenster?«
Doch der Mann, der so aussieht wie ich, lehnt erneut höflich ab, lächelt erneut in den Spiegel. Da bin ich. Sehe entschieden so aus wie ich. Da sind die Falten – fein und wenig –, die in meinem Gesicht dazugekommen sind, sie verleihen mir einen trügerischen Ausdruck von Weisheit und Tiefe. Da ist auch meine hohe Stirn, da sind meine Augen, goldgrün und trügerisch.
Meine hohe Stirn täuscht, weil sie eine Empfindsamkeit andeutet, die ich nicht besitze, und meine Augen täuschen, weil sie trotz ihrer reizvollen Farbe extrem kurzsichtig sind, weshalb ich sie bei jedem Besuch in Israel von Dr. Levin, meiner Augenärztin, untersuchen lasse. Ich schreibe dies, weil auch meine Kurzsichtigkeit zu meinen wichtigen Eigenschaften gehört. Wie mein Aussehen ist es ein körperliches Merkmal, kein seelisches oder geistiges, aber diese beiden Dinge haben meinen Lebenslauf mehr bestimmt als alles andere. Auch die Geschichte, die ich hier zu schreiben versuche, wäre ohne sie nicht passiert.
Wie dem auch sei, ohne meine Brille kann ich nicht einmal mein Gesicht im Spiegel des Friseurs erkennen, auch nicht meinen Bruder, mein eigen Fleisch und Blut, wenn wir auf dem Balkon meines Hotelzimmers sitzen und uns unterhalten. Manchmal stelle ich bei mir zu Hause ein Experiment an: Ich nehme die Brille ab und gehe auf den großen Spiegel am Ende des Flurs zu, um herauszufinden, aus welcher Entfernung ich mich selbst erkenne. Würden diese Augen die verstrichene Zeit überwinden, falls ich dir, Michal, zufällig oder nicht zufällig begegnete?
Manchmal, allein vor diesem Spiegel, rede ich mit mir selbst. Meist still im Herzen, aber gelegentlich entschlüpfen auch einige Worte meinem Brustkorb: Was bist du mehr, Itamar, schön oder kurzsichtig? Und dann versuche ich herauszufinden, ob ich mit Brille besser aussehe oder ohne. Aber das kann ich nicht vergleichen, denn wenn ich sie abnehme, muss ich sehr nahe an den Spiegel treten, und bei diesem geringen Abstand verändern sich die Gesichtszüge.
Nicht nur ich kann mich da nicht entscheiden. Oft habe ich diese Bitte gehört, zumeist aus dem Mund einer Frau: »Nimm einen Moment die Brille ab, Itta« – oder Itamar, je nachdem, wie nahe wir uns stehen oder welche vermeintliche Nähe sie prüfen möchte –, »ich will mal sehen, wie du schöner bist, ob mit Brille oder ohne.«
»Itta mit Brille sieht ganz anders aus als Itta ohne, aber beide sind schön«, hatte Michal einmal zu Boas und Maya gesagt und lachend hinzugefügt: »So habe ich zwei schöne Männer, aber das ändert nicht viel, denn nicht seine Brille entscheidet, sondern ich.«
»Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters?«, fragte Maya, die Michal nie gemocht hatte und unverhohlen froh war, als wir uns trennten. »Sogar eure Mutter hat gesagt: ›Michal ist zu stark und zu klug für unseren Itamar, mit einem Leidenskelch wird sie ihn tränken‹«, zitiert sie Boas und mir bis heute Mutters Worte.
»Es ist viel einfacher«, sagte Michal, »stell dich bitte einen Moment neben mich.«
Ich stellte mich einen Moment neben sie, bitte schön, wie ich alles tat, worum sie mich bat.
»Seht ihr?«, fragte sie. »Spürst du’s, Itta? Sobald du mir nahekamst, wurdest du viel schöner. Wenn du neben ihn trittst, Maya, wird das nicht passieren.«
»Michal, du übertreibst«, sagte ich.
»Ich übertreibe bei allem. Bei meiner Arbeit, bei meinen Plänen, und auch bei der Liebe übertreibe ich. Soll ich damit aufhören? Normal sein?«
4
»Dann sind Sie eine Art Heiratsvermittlerin?«, fragte ich die Barwirtin. »Führen Ihrer jungen Freundin schöne Männer zu?«
»Nein«, sagte sie. »Vor ein paar Tagen hat sie hier gesessen, genau auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen, und wir haben uns unterhalten. Sie fragte mich, ob ich mal mit einem schönen Mann zusammen gewesen sei, mit einem wirklich schönen Mann, Miss Universe, hat sie gesagt. Ich bejahte, tatsächlich sei ich mal mit so einem Mann ausgegangen, und es sei sehr angenehm gewesen. Es ist angenehm, in so ein schönes Gesicht zu schauen, wenn man Körper an Körper liegt, ihn zu spüren und zu denken: Mein Gott, ich bin mit Endymion höchstpersönlich im Bett.«
»Wer ist Endymion?«, fragte Boas.
»Das habe ich auch gefragt, und sie antwortete, Endymion sei der schönste Mann in der griechischen Mythologie.«
»Geht mir am Arsch vorbei, dieser Endymion«, blaffte Boas. »Ich belämmere andere Leute auch nicht mit irgendwelchen Treibriemen und Ventilen, da sollen die mir gefälligst nicht mein Hebräisch korrigieren und mit der griechischen Mythologie rumprahlen …«
»Sie erzählte mir, sie hätte mal einen schönen Mann kennengelernt«, fuhr die Wirtin fort, »einen richtig gut aussehenden, der sie jedoch gar nicht beachtet habe, und seither sei ihr die Lust geblieben.«
»Auf diesen bestimmten oder allgemein auf einen schönen Mann?«
»Sie hat es besser ausgedrückt als wir beide: Ich habe seither eine ungestillte Leidenschaft. Ich muss diese Sache irgendwann zum Abschluss bringen.«
»Aha, sie ist also eine von denen, die was abhaken wollen«, erwiderte ich. »Sich einen schönen Mann angeln, ihn vorzeigen, mit ihm angeben, schaut, wen ich hier habe, und zum nächsten übergehen.«
»Kein Grund, wütend oder gar arrogant zu werden«, gab sie zurück. »Nicht alle haben es so leicht wie Sie. Zeigen Sie Respekt für ungestillte Leidenschaften und für die Menschen, die sie empfinden. Wenigstens einmal das schöne Gesicht eines Mannes aus Kussdistanz sehen, hat sie gesagt. Und gelacht: Ein einziges Mal … Worum habe ich denn schon gebeten?«
»›Worum habe ich denn schon gebeten‹, das ist Mayas Ausdrucksweise«, bemerkte Boas.
»Und ich habe ihr gesagt«, fuhr die Wirtin fort, »aus Kussdistanz ist es verschwommen. Zu nah dran. Man sieht nichts aus dieser Entfernung.«
»Bei mir nicht, nicht mit meinen Augen«, wandte ich ein. »Aus der Nähe sehe ich besser als alle anderen.«
»Was gibt’s da so viel zu erklären? Wie sich ein Mann mit einer sehr schönen Frau fühlen kann, genau das will sie mal mit einem schönen Mann erleben. Und dann sind Sie heute reingekommen, und ich habe die Freundin angerufen und auch sofort zu meinem Koch gesagt, er soll keinen Knoblauch auf die Bruschette tun, die ich zu Ihrem Grappa bei ihm orderte.«
»Die denkt wirklich an die kleinsten Dinge«, sagte Boas, »das ist gut. Wenn man einen Plan hat, muss man nicht nur an die Einzelheiten denken, sondern auch an alles, was ihn zu Fall bringen könnte.«
»Gut«, sagte die Wirtin, »es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, zum einen, weil Sie wirklich ein angenehmer Anblick sind, und zum anderen, weil ich tatsächlich etwas von einer Heiratsvermittlerin habe.«
»Auch Vater hat sich als Vermittler bezeichnet. Erinnerst du dich, Itta?«
»Vermittle Fleisch an Mäuler, bringe Münder an Euter«, deklamierten wir gemeinsam, in seinem Tonfall.
»Und wenn Ihre Freundin mir nicht gefallen sollte?«, fragte ich die Wirtin.
»Sie wird drüber wegkommen. Das könnte auch umgekehrt passieren, man kann nie wissen.«
»Okay«, sagte ich, »in Ordnung.«
»Eine schlechte Entscheidung«, meinte Boas. »Du hättest ablehnen sollen.«
»Eine gute Entscheidung«, sagte die Wirtin. »Schalom und danke und verzeihen Sie die Störung. Wenn Sie das nächste Mal auf Heimaturlaub kommen, würde ich mich freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich werde Ihnen dann nicht mehr ins Leben reinfunken und Ihnen auch Knoblauch auf die Bruschette geben.«
»Ehrlich gesagt mag ich keinen Knoblauch, unabhängig von Ihrer Vermittlung.«
»Und ich biete Ihnen jetzt keinen Grappa mehr an, weil Sie vielleicht noch ein bisschen Auto fahren müssen heute Nacht.«
Sie kehrte an ihren Tisch und zu ihrer Tochter zurück und warf mir hin und wieder einen halb ermunternden, halb prüfenden Blick zu: als müsste sie sich vergewissern, dass ich nicht erschrocken war, nicht plötzlich aufsprang und weglief.
»Und vor allem, dass du nicht plötzlich hässlich geworden warst«, sagte Boas.
Ohne dass sie dem Barmann ein Wort gesagt hatte, servierte er mir ein Gläschen kaltes Mineralwasser, einen Espresso und dazu ein Marzipanhäufchen, in dem eine geschälte Mandel steckte – nicht der passendste Abend, um mich an dich zu erinnern, Michal, an deinen Venushügel, deine Bittersüße, deinen Mandelduft.
»Warum bist du wirklich dageblieben, Itta? Warum bist du nicht aufgestanden und gegangen?«, fragte Boas.
»Wärst du gegangen?«
»Vielleicht. Bin nicht sicher. Ich bin aber auch verheiratet und habe eine Familie zu beschützen. Und es hängt wohl von tausend anderen Dingen ab, die einem in den Tagen zuvor und an dem Abend selbst passieren.«
Ich schwieg.
»Jedenfalls, da sind wir nun, beide schon über sechzig«, fuhr er fort. »Kaum zu glauben. Zwei alte Frachtschiffe, die nirgends hinkommen ohne Lasten im Bauch und ohne all die barnacles, die das Leben uns an den Körper geklebt hat.«
»Ohne was?«
»Barnacles. Ein Seemannsausdruck. Das sind die Muscheln und Algen und der ganze Dreck, die an den Schiffen festkleben. Du hast mir keine Antwort gegeben. Warum bist du dageblieben? Warum hast du auf sie gewartet?«
»Keine Ahnung«, sagte ich, »es war nicht das erste Mal, dass mich jemand verkuppeln wollte, aber so wie an jenem Abend war ich noch nie angesprochen worden. Ich war neugierig.«
»Und ist die Frau gekommen? Ist sie wirklich aufgetaucht?«
»Na klar. Sonst hätte ich dir keine Geschichte zu erzählen.«
»Und was hast du so lange gemacht?«
»Hab gewartet. Warten ist auch eine Arbeit. Manche Menschen schieben dabei Überstunden.«
Und im stillen Herzen: Ich habe gewartet. Mir Möglichkeiten ausgemalt. Habe die Freiheit des Reisenden gespürt, die seine Fremdheit ihm verleiht. Und mich wie gewohnt mit meinem sarefet unterhalten – meinem Zwerchfell. »Wer ist nach wem benannt?«, fragte ich. »Du nach den sar’afim – den Gedanken – oder die nach dir?«
Anscheinend hatte ich die letzten Worte laut gesagt, denn Boas fragte: »Redest du viel mit ihm?«
»Mit wem?«
»Wenn ich den letzten Satz richtig verstanden habe, dann mit deinem Zwerchfell.«
»Ich rede mit all den Freunden und Freundinnen in meinem Körper. Mit den Daumen, mit den Ohren, mit dem Darm, aber das Zwerchfell ist der Einzige, der mir antwortet.«
»Ich rede vor allem mit meinem Penis«, sagte Boas. »Er beklagt sich: Warum hat man mich dir angehängt und nicht deinem Bruder Itamar.«
»Na, ich bittich, Boas«, sagte ich, und wir beide lachten, denn so hatte unser Vater, Buchstaben verschluckend, »Na, ich bitte dich« gesagt.
»Ich reagiere nicht auf solche Provokationen«, fuhr ich fort. »Außerdem ist der Penis das langweiligste und einfältigste Glied unseres Körpers. Das Zwerchfell ist viel klüger und interessanter.«
5
Die Minuten vergingen. Nach etwa einer Viertelstunde erhob sich die Wirtin mit ihrer Tochter, sie sagte noch etwas zu dem Barmann und etwas zu einem der Kellner, schenkte mir ein kleines Lächeln und nickte zum Abschied. Ich streckte ihr den triumphierend erhobenen Daumen entgegen wie ein Pilot und kam mir albern, um nicht zu sagen, wieder idiotisch vor.
»Kummer seiner Mutter, wie Mutter dich manchmal genannt hat«, bemerkte Boas.
Ich blieb sitzen, schob einen Krümel Marzipan nach dem anderen in den Mund und beschnupperte meine Fingerspitzen, wie in den Zeiten mit Michal, als ich mich nicht wusch, wenn wir miteinander geschlafen hatten, um ihren Duft noch einige Stunden zu bewahren.
Die Bar leerte sich nach und nach, und während ich überlegte, ob ich bleiben oder ins Hotel zurückkehren sollte, kam die Frau herein, auf die ich wartete. Sie hielt kurz am Eingang inne, schenkte mir dann ein breites Lächeln, vielleicht etwas zu breit, und schien ein wenig erstaunt zu sein. Anscheinend war ich anders als der Mann, den sie sich vorgestellt oder gewünscht hatte.
Sie war von mittlerer Größe und Statur und, die Wirtin hatte nicht gelogen, hübsch. Ihr glattes braunes Haar gefiel mir auf Anhieb, denn es endete in ihrem Nacken genau wie bei Pony Hütchen, dem Mädchen aus Erich Kästners Emil und die Detektive, in das ich mich mit elf Jahren verliebte.
Sie kam auf mich zu. Ich erhob mich vom Stuhl und blickte sie an, ihre aufrechte Haltung und ihren ruhigen Gang. Es ist gut, wenn der erste Blick, den man auf einen Menschen wirft, ihn im Gehen trifft, und noch besser ist es, wenn der Mensch auf einen zugeht. Der Körper erzählt dann von seiner Selbstachtung, seinem Verhältnis zur Umgebung, seinem Leben in Frieden oder Unfrieden mit seinem Besitzer, mit seinen Gliedmaßen, mit anderen Körpern, mit sich selbst.
Nun blieb sie nahe vor mir stehen. Sie trug eine glatte, grünliche Leinenhose mit scharfer Bügelfalte, von der Sorte, die unsere Mutter als »gute Hose« bezeichnet hätte, und darüber eine ebenfalls adrette weiße Hemdbluse aus Baumwolle, die ihre Haut kaum berührte. Ihr Gesicht war ungeschminkt, der Mund ausdrucksvoll, die Stirn strahlend. Braune Mandelaugen. Ein feiner, angenehmer Geruch nach unparfümierter Seife umwehte sie.
Ich fragte mich, was wohl der erste Satz sein würde, den sie an mich richtete. Oder erwartete sie vielleicht, dass ich das Gespräch eröffnete?
»Maya hätte gefragt, was für Schuhe sie trug.«