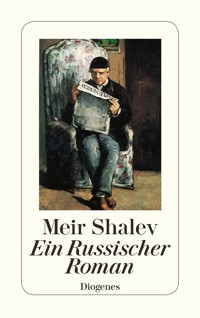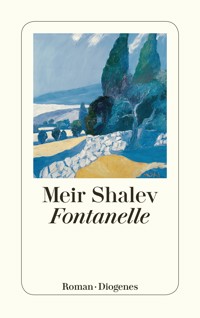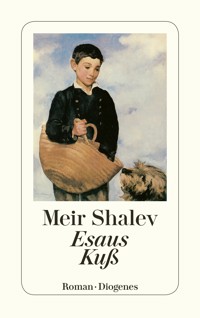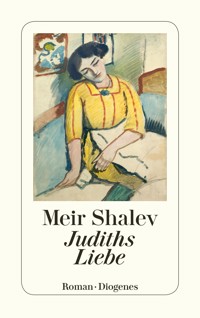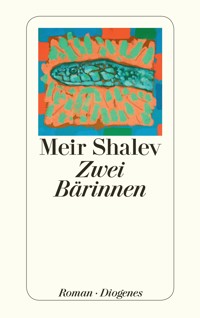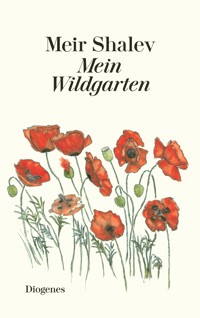11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Wenn einen fünfzig Finger, zehn Augen und fünf scharfzüngige Münder mit ihrer Liebe verfolgen, hat Mann wirklich Grund, in die Wüste zu fliehen. Und seis nur, um mit dem Pick-up die staubigen Pisten entlangzufahren, Wasserrohre zu kontrollieren und verstopfte Ventile zu erneuern oder mit dem einzigen Freund und Kollegen, dem Zauberer Vaknin, mal ein paar Worte zu wechseln. "
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Ähnliche
Meir Shalev
Im Hausder Großen Frau
Roman
Aus dem Hebräischen vonRuth Achlama
Titel der 1998 bei
Am Oved Publishers, Tel Aviv,
erschienenen Originalausgabe:
›Bebejto bamidbar‹
Copyright © 1998 by Meir Shalev
Die deutsche Erstausgabe erschien 2000
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Kees van Dongen,
›Der Finger an der Wange‹, 1910
Copyright © 2014, ProLitteris,
Zürich
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23326 1 (5.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60356 9
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 1
DA BIN ICH
Da bin ich, zitternd auf dem Wasserspiegel der Grube: Eine Million blonder Haare drängen sich auf dem Kopf. Die Stirn ist niedrig und glatt, viele, viele milchweiße Zähne schimmern im schiefen, lächelnden Mund.
»Rafael, wann wirst du endlich groß?« fragt meine Mutter.
»Rafinka, wann stirbst du endlich?« erkundigt sich meine Großmutter.
»Wann gesellst du dich endlich zu uns?« forschen unsere vier Männer – Vater, Großvater und die beiden Onkel, die im Flur an der Wand hängen und auf mich warten.
»Raful, du Affe, du häßlicher!« lacht meine Schwester. »Warum bist du weggegangen? Hast du’s so schlecht bei uns gehabt?« ›Häßlicher‹ sagt sie, wie alle Frauen der Familie.
Und meine beiden Tanten, die rote und die schwarze, nicken mit den kurzgeschorenen Köpfen und sagen kein Wort. Auf und nieder, immer wieder, nicken sie in schweigender Übereinstimmung. Die eine bejaht ernst, die andere tut es ihr lächelnd nach, auf-ab, ab-auf, in dem Gleichtakt, den die gegenseitige Nähe, das Schicksal und die Jahre sie gelehrt haben.
Zu dieser kleinen Wassergrube – nie habe ich die Spuren eines Fremden an ihrem Rand gesehen, weder verloschene Asche noch Reste einer Mahlzeit – flüchte ich alle paar Tage, wann immer meine Arbeitsroute mich in ihre Nähe führt. Es ist eine tiefe, runde Grube, ein kleines, verstecktes Wüstennymphäum im Schatten steiler Felswände, das auch im Sommer den Großteil seines Wassers bewahrt.
[6] Eine geheime Grube ist es. Nicht mal Rona – meiner früheren Frau, jetzigen Geliebten und künftigen Katastrophe – habe ich offenbart, wo sie sich befindet, aber einmal habe ich sie dorthin gebracht.
»Mach die Augen zu, Rona«, bat ich sie. »Du sollst nicht sehen, wo wir hinfahren.«
»Vertraust du mir? Ich könnte ja mogeln«, sagte sie und blinzelte mich durch flatternde, fast geschlossene Lider an.
»Habe ich eine andere Wahl, als dir zu vertrauen?«
»Hast du. Du kannst mir die Augen verbinden.«
Ein paar Kilometer westlich der neuen Bohrstelle halte ich an und blicke mich um. Kein Mensch weit und breit. Ein kleiner Anlauf, und der Pick-up hüpft über die Steinschwelle am Eingang des schmalen Seitentals. Ein kurzes Aufschaben am Boden, und schon bin ich hinter dem Felsausläufer verborgen. Wer jetzt den Hauptweg entlangfährt, sieht weder den Wagen noch mich.
Da ist die Talbiegung, da sind die nackten weißen Felsen. Alle meine alten Bekannten heißen mich freudig willkommen. Seid gegrüßt, ihr zwei zerzausten Akazien, Gruß auch dir, kleiner Vogel mit dem schwarzen Schwänzchen, der du scheinbar unschlüssig zwischen ihnen hin und her flatterst, wann wirst du dich endlich für die eine oder andere entscheiden? Ich stelle den tuckernden Motor ab, bringe das rauschende Funksprechgerät zum Verstummen, und die große Stille breitet sich aus. Es ist eine sanfte und tiefe Stille, wie die Stille meines Kopfes, wenn er zwischen ihren Brüsten ruht.
Eine Weile bleibe ich so stehen, gewöhne Körper und Sinne ein, bis dann – wie die Sterne der Wüste, die nach Einsetzen der Dunkelheit einer nach dem anderen aufleuchten – die ersten Geräusche den Vorhang des Schweigens durchbrechen: Zuerst zwitschert der kleine Vogel, das Schwarzschwänzchen, mir ins Ohr. Danach saust die Luft in meinen Lungen. Und dann rauscht mir das Blut in den Adern.
[7] Da ist der schwarze Stein, dort der große Felsbrocken, den eine urzeitliche Flutwelle hierher geschwemmt hat. Abwärts, abwärts stürzte das Wasser, reißend und singend und sprengend und gischtend strömte es in die ersehnten Gründe hinab. Früher, in der Schule, hatten wir mal einen alten Physiklehrer, der sich dermaßen für die Wunder der Schwerkraft begeisterte, daß er Newtons Formeln vergaß und anfing, uns Legenden zu erzählen.
»Im Herzen der Erdkugel sitzt ein alter Mann und zieht und zieht und zieht«, erklärte er. Und da er selbst alt war, begann er, mit den Händen imaginäre Stricke zu ziehen, und setzte eine äußerst angestrengte Miene auf, dank deren ich die Dinge sehr gut in Erinnerung behalten habe. Wer wüßte besser als du, meine Schwester, daß ich im allgemeinen vergeßlich bin. Worte und Fakten entfallen meinem Gedächtnis wie Münzen einem löchrigen Beutel. Warum in Erinnerung behalten, was sich neu erfinden läßt? Aber Gerüche und Bilder, Geschmacksnuancen und Berührungen sind meinem Gedächtnis eingeprägt wie Inschriften einem Grabstein.
Als mit meinen zweiundfünfzig Jahren der älteste unter allen Männern, die in unserer Familie lebten und starben, bin auch ich ein großer Verehrer der Schwerkraft geworden. Aber ich glaube nicht an die Kraft der anziehenden Körper, sondern an das Bestreben der angezogenen Körper, abwärts, abwärts zu rutschen und zu stürzen, hinunterzufließen und sich an der allertiefsten Stelle zu sammeln, dem Ort, an dem Ruhe ist.
Nur Bachkiesel sind es, die unter meinen Füßen knirschen. Und schon erfaßt Begierde mein Herz und lenkt meine Schritte. Da ist der Pilz aus Felsgestein, dort sind die beiden mächtigen Steinblöcke, die es fertiggebracht haben, vom Felsen auf den Talboden zu poltern, da ist der dritte, der mitten am Hang an einer Schwelle hängengeblieben ist und seither dort wartet, in wütendem Flehen: Bring mich ins Rutschen, Rafael, versetz mir einen Stoß, stürze mich der Erlösung entgegen.
[8] Ungeduldig und atemlos erklimme ich die Felsstufen. Hier habe ich gesagt: »Paß auf, Rona, da ist ein großer Stein.« Hier habe ich sie an der Hand gefaßt, hier erklärt: »Das wär’s, wir sind angelangt, du kannst die Binde von den Augen nehmen.«
Aber Rona sagte, sie bliebe gern so, es genüge ihr, die Hand ins Wasser zu stecken und sich zu vergewissern, daß ich nicht gelogen hatte, daß dort wirklich ein Wasserloch war, und an seinem Rand wolle sie mit mir schlafen. »So, mein Geliebter, mit dem Lappen über den Augen, um in Erinnerung zu behalten, daß ich mit dir hier gewesen bin, in blindem Vertrauen.«
Noch ein paar Schritte, und ich beuge mich über den verschwiegenen Grund. Da ist die Wasserfläche, da ein bebendes Kräuseln, da bin auch ich, aus der Tiefe widergespiegelt. Hast du mich erwartet, Rafael? Hast du dich nach mir gesehnt? Mückenlarven fliehen aus Furcht vor meinem Körperschatten, und weit über mir, am Ende des Felskamins, ist das runde Auge des Firmaments.
Sieh mich an, blaues Himmelsauge, der ich geboren bin, dir entgegenzusteigen, sieh mich an, da ich mich aus den Tiefen zu dir aufschwinge. Sag auch du: Wann wirst du endlich groß, Rafael? Wann stirbst du endlich, Rafael? Wann gesellst auch du dich dazu?
ICH BIN OHNE VATER AUFGEWACHSEN
Ich bin ohne Vater aufgewachsen, ohne Onkel oder Großvater, in einem Haus mit fünf Frauen – meiner Mutter, meiner Großmutter, meinen beiden Tanten und dir, meiner kleinen Schwester, der Xanthippe –, fünf weiblichen Wesen, die mich erzogen, liebkosten, päppelten, mir Erinnerungen erzählten und mich vor die Wand im Flur stellten.
Dort, auf kalkweißem Hintergrund, hängen die vier Bilder unserer vier Männer. Da sind sie: unser Rafael, Großvater Rafael, [9] der Großmutters Mann gewesen ist. Unser David, einst unser Vater und Mutters Mann. Unser Edward, der mit der roten Tante verheiratet war und eine weiße Ratte hatte, die ihm immer auf der Schulter saß und auch hier auf dem Bild dort sitzt. Und unser Elieser, Onkel Elieser, Veterinär, Autodidakt, der frühere Mann der schwarzen und der Bruder der roten Tante. Alle vier sind, wie alle Männer unserer Familie, durch allerlei seltsame Unfälle vorzeitig ums Leben gekommen. Alle vier wurden nebeneinander an die Flurwand gehängt und mit dem Titel ›unser‹ versehen, den die Frauen jedem von ihnen nach seinem Tod beigaben.
Zweimal wöchentlich mischte Großmutter mir eine Reinigungslösung aus Essig mit Wasser verdünnt. »Das Mittel, das sie im Konsum verkaufen, kostet ein Vermögen«, schimpfte sie. Mit dem Wort ›Vermögen‹ bezeichnet sie einen Preis, der ihr überhöht erscheint, das heißt eigentlich jeden Preis, den jemand zu verlangen wagt. Sie wies mich an, eine alte Zeitung in die Lösung zu tauchen und damit die vier Bilder zu polieren.
»Wäre doch schade, einen Lappen zu vergeuden«, erklärte sie. Sie hatte haufenweise Lappen auf dem Balkon, aber die waren für Notzeiten gedacht (»oif nit zu badarfen«, erklärte sie, »auf daß man ihrer nicht bedürfen möge«), und mit alten Zeitungen kann man nicht nur das Glas über den Konterfeis unserer Männer blank reiben, sondern auch Fenster putzen oder Stiefel und Mantelfutter auspolstern für die Flucht im Schnee, der immer just an dem Tag fällt, an dem die Kosaken ein Pogrom veranstalten, und debattier du mal nicht mit mir, du kleine Xanthippe, es tut überhaupt nichts zur Sache, daß es hier weder Kosaken noch Schnee gibt, hier gibt es Araber und Sand, was haargenau aufs gleiche herauskommt.
Ich blies dann den Staub von den Bildergläsern und wienerte sie mit Essigwasser und Zeitungspapier, bis man sie vor lauter Blankheit nicht mehr sah. Aber ich wußte, daß sie noch da [10] waren, und ebenso wußten es die vier Männer dahinter, die mich anblickten, samt der weißen Ratte von unserem Edward, und auf mich warteten, jeder in seinem Rahmenviereck, jeder wehmütig hinter seinem Glas.
»Fertig«, sagte ich dann zu Großmutter. »Kann ich noch was putzen?«
»Nein, Rafinka, es ist nicht gut, wenn ein Junge Frauenarbeit tut.«
»Ich muß Pipi machen«, versuchte ich einen anderen Weg der Annäherung. »Darf ich auf eure Toilette?«
»Nein, Rafinka, es ist nicht gut, wenn ein Junge Pipi auf dem Frauenklosett macht.«
Die fünf Frauen krönten wie Blütenblätter meinen Stuhl, umstanden wie Schachsoldaten meine Wiege, beugten sich wie Bachweiden über meine Badewanne.
»Wüßtest du, wie ein Mann besser aufwachsen könnte?« fragten sie immer wieder.
»Nein«, antwortete ich, geübt, gehorsam und bereitwillig, »wüßte ich nicht.«
Auch jetzt – mit zweiundfünfzig Jahren bist du heute der älteste aller Männer, die in deiner Familie leben und gelebt haben, sage ich mir immer wieder – besuchen sie mich noch gelegentlich in meinem Haus, in der Wüste. Sie bringen mir was zu essen mit, mustern mein Gesicht, prüfen die Gesundheit meines Zahnfleisches und die Sauberkeit meiner Schränke, machen ihre Bemerkungen und interessieren sich für alle meine Angelegenheiten. Öfter brauche ich auch ihr gutes Gedächtnis und vor allem deins, Schwester, brauche dich als Spiegel und Anker, Kompaß und Zielscheibe: um mich zurechtzufinden, um durchzukommen, um mir diese Geschichte zu erzählen, die es nun zu erzählen gilt, ehe ich ebenfalls sterbe.
»Warum bist du weggegangen, Raful?«
»Wann kehrst du zurück?«
[11] »Hast du’s denn so schlecht gehabt bei uns?«
Ich kenne in der Wüste einen Ort, an dem sich dem Auge eine riesige einheitlich wirkende Fläche darbietet, die jedoch von tiefen, verborgenen Schluchten zerklüftet ist. Schatten verbergen ihre Tücken, Felsnasen ihre Schönheiten, und die heiße Luft läßt bebende Trugbilder über ihr entstehen. So geht es auch dir, meine Schwester: Die Worte erinnerst du, die Geheimnisse kennst du, aber die Fingerpfade auf meiner Haut? Die Weidespuren meiner Liebe? Die ausgetrockneten Wasserlöcher? Die Feuersteinhügel meines Zorns?
DIE GESCHICHTE MEINES LEBENS
Die Geschichte meines Lebens ließe sich, wie die Lebensgeschichte eines jeden Menschen, zu tausend Zeitpunkten und an hundert Orten beginnen:
Man könnte vom Augenblick meiner Geburt in Jerusalem an einfach und geradlinig erzählen, so schlicht und gerade wie die Wasserrohre, die ich hier in der Wüste überwache.
Man könnte vom Tag meiner Eheschließung mit Rona an – meiner früheren Frau, jetzigen Geliebten und künftigen Katastrophe, wie ich mir immer wieder sage – erzählen, von ihrem Elternhaus, im Schatten zweier verbundener Kiefernwipfel, mit Tiefenbohrungen und Messerschnitten.
Man könnte vom Tag meines Todes in dieser Wüste an – obwohl er noch zögert, wird er zweifellos eintreffen – im Rückwärtsgang erzählen, blindlings und mit stolpernden Beinen.
So oder so, mein Leben ist, wie das eines jeden Menschen, einfacher als die Geschichte seines Verlaufs. So will ich bei der ersten Begegnung unserer Eltern beginnen.
Meine Mutter war aus der Moschawa Kinneret nach Jerusalem gekommen und besuchte das David-Jellin-Lehrerseminar. Mein Vater, der einige Jahre später bei einem Manöverunfall [12] umkam – er wurde beim Nachtlager seiner Reserveeinheit von den Ketten eines Panzers überrollt –, war aus Tel Aviv gekommen und studierte an der medizinischen Fakultät der Hebräischen Universität auf dem Skopusberg. Wie einfach sind diese Anfänge: nur ein Muskelspannen vor dem Flug. Nur ein bebender Wink, eh das Geheimnis sich lüftet. Ein Blinken vor dem Sensenschwung und dem Vergießen von Blut.
Und wie verwickeln sich die Fortsetzungen: Jedes Jahr bei der Gedenkfeier für Vater (»Warum hält man Gedenkfeiern nur für Männer, die gestorben sind?« hast du einmal gemeint und vorgeschlagen: »Laß uns für Raful doch mal zu Lebzeiten eine Gedenkfeier halten, damit er sich schon dran gewöhnt«) ruft Mutter sich jene Begegnung in Erinnerung. Da sie häufig laut denkt und sich laut erinnert, genau wie sie manchmal auch ihre Bücher laut liest, kommen wir jedesmal in den Genuß, all die bekannten Details von neuem zu hören und zu rekapitulieren. Und da ihr alterndes Gedächtnis, wie ein immer weniger begangener Pfad, sich zusehends verändert – alte Spuren verwischen, neue Pflänzchen sprießen –, dürfen wir uns mit ihrer Hilfe auch an Dinge erinnern, die nie gewesen sind, und gemeinsam mit ihr Dinge vergessen, die waren, aber nicht mehr sind.
Es war ein kalter, klarer Wintertag damals. Vater kam in großer Eile aus der Buchhandlung Igarta – »heute ist das die Buchhandlung Jordan«, erklärt Mutter jedesmal jedem, der es genau wissen will – und erblickte sie. Sie stand unter der großen Zypresse auf dem Zionsplatz – »heute ist es ein Eukalyptus«, bemerkt meine Schwester jedesmal wieder nachsichtig – und las ein eben gekauftes Buch, freute sich an der Verbindung der Worte und an der Nähe des mächtigen Baums, seinem Schatten und seinem Duft, die sie an ihr Elternhaus in der Moschawa Kinneret erinnerten. Heute kann man den Eukalyptusduft nicht mehr riechen, denn er wird längst vom Gestank der Busse, dem Schweißhauch der wimmelnden Menschenmenge und den Urin- und [13] Mülltonnengerüchen verschluckt, aber ›in früheren Tagen‹ – so nennt Mutter die Mandatszeit – war es noch möglich.
Meine Mutter liest gern. Lesen ist überhaupt ihre Lieblingsbeschäftigung, wobei sie immer Eselsohren in die Seiten macht, statt ein Lesezeichen einzulegen. Manche Bücher kann sie einfach nicht zu Ende lesen, und dann sagt sie: »Es ist mir unangenehm, mittendrin aufzuhören, Rafi, könntest du dieses Buch für mich fertiglesen? Hier, genau an dieser Stelle, hab ich’s aufgegeben. Lies von der Seite mit dem letzten Eselsohr an weiter.« So hat sie es in meiner Kindheit bei sich zu Hause getan. Und heute bringt sie die beschämten, mit Eselsohren versehenen Bücher zu mir ins Haus, und ich lese sie hier in der Wüste zu Ende.
Ihr Vater, Großvater Rafael – neununddreißig Jahre alt war er bei seinem Selbstmord und damit einer der jüngeren Toten der Familie –, hatte ihr die Buchstaben und Vokalzeichen beigebracht, als sie noch keine drei Jahre alt war. Innerhalb kurzer Zeit konnte sie alle erkennen und singen, und da hängte Großvater Rafael ihr Zettel mit den Namen jedes Gegenstands, Geräts, Baums oder Geschöpfes auf, die sich in Haus und Hof befanden, also: TISCH, SCHRANK, KUH, VATER, TOPF, TÜR, REUVEN, WASSERHAHN und ZYPRESSE.
Der Zettel REUVEN wurde dem großen Bruder ans Hemd geheftet, ›unserem Reuven‹ laut Großmutter, Mutter und der schwarzen Tante, die immer wieder voll Kummer und Liebe von ihm reden. Seine Frau, Tante Jona, hatte ihm als Mitgift Rinderherden und jenes Reitpferd mitgebracht, das ihn schließlich vom Rücken warf. Onkel Reuvens Kopf zerschellte auf einem Basaltblock im Bachbett des Javne’el, und erst als zwei Tage später die schwarzen Punkte am Himmel zu kreisen begannen, gingen die Suchenden an die Stelle darunter und fanden seinen Leichnam.
»Und an Großmutter?« fragte die schwarze Tante.
»Was an Großmutter?« Die schwarze Tante spuckte einen Dattelkern aus, der im Bogen davonflog, an der weißen [14] Flurwand abprallte und sich seinen verstreuten Brüdern am Boden zugesellte.
»Hat er auch Großmutter einen Zettel mit GROSSMUTTER angehängt?«
»Nein, Rafael, Großmutter heftete er den Zettel MUTTER an. Sie war damals nur unsere Mutter, nicht deine Großmutter.«
Mutter war ein aufgewecktes Kind. ›Meine Gescheite‹ nannte ihr Vater sie, und da sie im richtigen Alter war – »für alles gibt es ein richtiges Alter«, sagt die rote Tante –, bahnten sich Beziehungen zwischen ihr und der geschriebenen Sprache an. Die Buchstaben sahen ihr wie Figuren aus, die Wörter wie Zeichnungen, sie wollte keine Geschichten mehr erzählt bekommen, sondern sie nur noch selbst lesen oder neben dem Vorleser sitzen, mit in die Seiten gucken und die Lektüre mit den Augen verfolgen.
»Ich muß die Worte sehen«, erklärte sie jedem, der sich erbot, ihr eine Geschichte vorzulesen.
Dank eines ausgeprägten Wortgedächtnisses und scharfen Sprachgefühls, zweier Dinge, die sie leider dir, nicht mir vererbt hat, gelang es ihr, auch den Sinn von Worten zu erraten, die sie nicht kannte.
»Nach ihrer Form«, sagte sie jedem, der sich wunderte. »Was, seht ihr’s denn nicht?«
»Also los, schreib dem Mädchen ein schweres Wort auf«, forderte Großvater Rafael neu eintreffende Besucher auf. »Schreib ein Wort, das auch Erwachsenen nicht so geläufig ist.«
»Das ist was mit Pferden«, sagte Mutter, als jemand ihr ›Steigbügel‹ hinschrieb.
»Das ist was hier herum«, sagte sie auf das Wort ›Schärpe‹ und legte mit triumphierender Miene die Hände an die Taille.
Und das Wort ›Bock‹ spricht sie bis heute mit Umlaut aus, ›Böck‹, denn so hat es ihr Vater sie ursprünglich gelehrt, und so hat es sich ihrem Gedächtnis eingeprägt.
[15] Mit vier Jahren las sie schon freudig und fließend, und die Hauptnutznießerin ihrer Leselust war die Nachbarstochter, ein Mädchen ihres Alters namens Rachel Schifrin, die ihre gute Freundin wurde.
»Und euch?« fragte ich die schwarze Tante. »Hat sie auch dir und Onkel Reuven Geschichten vorgelesen?«
»Nein.«
»Aber sie ist doch eure Schwester.«
»Unser Reuven war schon groß und hat die ganze Zeit in der Landwirtschaft gearbeitet, und ich wollte nicht. Obwohl ich groß gewachsen bin, mag ich keine Geschichten.«
Die schwarze Tante hat eigenartige Begriffe vom Lauf der Welt und ihrer Geschöpfe: »Ich versteh nicht, wie ein blonder Bursche so gut in Mathematik sein kann«, staunte sie einmal über einen ihrer Verehrer, und von einem anderen Jüngling sagte sie: »Obwohl er Höhenangst hat, spielt er schön Geige.«
Mutter las der Nachbarstochter und sich selbst Geschichten vor, und ihre jüngere Schwester sprang im Hof und auf den Feldern herum, ließ sich in Raufereien ein, spielte, kletterte auf Bäume, genau wie sie es noch Jahre später tat, als sie herangewachsen und – dank meiner – die schwarze Tante geworden war.
Sie konnte großartig mit der Hirtenschleuder zielen, die sie einem arabischen Hirten geklaut hatte, als er im See badete. Und obgleich sie schon damals Vegetarierin aus Überzeugung war und sich hauptsächlich von Gemüse und Datteln ernährte, war sie bereit, Tauben abzuschießen, die auf dem Ziegeldach des Kuhstalls spazierten, denn Großmutter, die schon damals ein überzeugter Geizhals war, sagte ihr, wenn sie Tauben für die Ernährung der Familie schösse, bräuchte man nicht die Hühner zu schlachten, die im Hof herumliefen.
Großvater Rafael, unser Rafael, wiederum war ein überzeugter Selbstmörder. Ein paar Jahre später erhängte er sich und hinterließ seiner Frau nichts als Schulden, mir den Namen und [16] allen Frauen der Familie die große Streitfrage: Ist der Selbstmord eines Mannes ein natürlicher Tod oder ein Unfall? Das ist eine gewichtige und interessante Frage, Schwesterherz, aber nicht deswegen habe ich das Haus verlassen. Nicht aus diesem Grund.
GROSSMUTTER HAT EINE SCHILDKRÖTE
Großmutter hat eine Schildkröte namens Penelope. Die schwarze Tante hatte sie ihr aus dem Geröllfeld mitgebracht, das sich damals an der Grenze unseres Wohnviertels erstreckte. Heute stehen dort Wohnhäuser und eine große Talmudschule, aber damals haben wir ›Bodenberührung verboten‹ gespielt, mit Sprüngen von Fels zu Fels, und die schwarze Tante veranstaltete dort Lagerfeuer für die Kinder des Viertels und sammelte Kuhfladen, um ihren Garten damit zu düngen.
Großmutter hatte sich die Schildkröte zum sechzigsten Geburtstag gewünscht.
»Eine Schildkröte? Wieso das denn?« fragte Mutter verwundert, und die rote Tante verzog angewidert das Gesicht zu ihrer berühmten Gleich-erbrech-ich-alles-was-ich-eben-gegessen-habe-Miene.
»Die will ich nun mal haben«, sagte Großmutter, die im allgemeinen ein konservativer, durchschaubarer und schlichter Charakter ist und sich sonst weniger durch Natur- als durch Geldliebe auszeichnet.
Die schwarze Tante sagte: »Was ist denn hier schwer zu kapieren? Nach ihren Töchtern ist eine Schildkröte das am nächstbilligsten zu haltende Lebewesen.«
Aber Mutter und die rote Tante bedrängten sie weiter mit Fragen, warum es denn nun gerade eine Schildkröte sein solle, worauf Großmutter gestand: »Weil es in meinem Alter ein angenehmes Gefühl ist, jemanden im Haus zu haben, der älter ist als man selbst.«
[17] Mutter warf einen einzigen Blick auf die Schildkröte und sagte dann, obwohl sie einen gewölbten Bauch habe, würde der Name Penelope für sie passen. Nach der Anzahl der Quadrate auf ihrem Panzer und ihrem schlechten Orientierungssinn schlossen die Frauen, daß Penelope mindestens zwanzig Jahre älter als Großmutter sein müsse, das heißt, heute etwa hundertzwanzig Jahre.
Trotz ihres hohen Alters, ihrer Langsamkeit und ihrer Dummheit – drei Eigenschaften, mit denen alle Schildkröten gesegnet sind – wurde Penelope ein wahres Spieltier, und sie ist mir jetzt eingefallen, weil sie ungeduldig um uns herumlief – soweit eine Schildkröte überhaupt Ungeduld an den Tag zu legen vermag –, als ich Großmutter über Mutters Freundin, Rachel Schifrin, ausfragte.
»Sie war ein verwöhntes Mädchen«, schnaubte Großmutter verächtlich, »und sogar werktags trug sie Schabbatkleider.«
Dieser Punkt, das Tragen von Schabbatkleidern am Werktag, erschien ihr als unverzeihliche Sünde, die nicht nur Verschwendung, sondern auch Hochmut anzeigte. Tatsächlich kam Rachel Schifrin den Kindern der Moschawa nicht nahe und half ihren Eltern nicht in Haus und Hof. Stundenlang saß sie daheim auf der Terrasse, im Schatten des Fikusbaums, und spielte mit ihren Puppen.
Herr Schifrin, Rachels Vater, war nach dem Ersten Weltkrieg eingewandert. Er und seine Frau waren groß, schlank und hellhäutig und wurden wegen ihrer natürlichen Eleganz von allen Nachbarn mit ›Herr‹ und ›Frau‹ angeredet. Sie sahen sich sehr ähnlich, aber das Land Israel mit seinen Menschen, seiner Natur und seiner Sonne meinte es unterschiedlich gut mit ihnen. Herrn Schifrin schenkte es Freude und Wohlempfinden, Frau Schifrin brachte es Falten und Sorgen ein. Die Hitze, der Staub, die Fliegen und die schwarzen Basalthäuser der Moschawa trübten ihren Sinn. Nach kurzer Zeit wurde sie eine »verbitterte Frau«, [18] meinte Großmutter, oder vielleicht Mutter, ich weiß es nicht mehr.
»Verzeihen Sie mir die Bemerkung, Frau Schifrin« – Großmutter zeigte auf die kleine Rachel –, »aber wir sind nicht in dieses Land gekommen, um Nichtstuer heranzuziehen!«
In diesem Punkt predigte Großmutter übrigens nicht nur, sondern ging auch mit gutem Beispiel voran. Sie hielt ihre Töchter – Mutter und die schwarze Tante – auf Trab und gönnte auch sich keine Ruhe. Wenn wir in meiner Kindheit in der Küche zusammensaßen, ich und die Große Frau – so nannte ich bei mir die fünf Frauen, die mich großzogen, dich und Großmutter und Mutter und die zwei Tanten –, und uns unterhielten, schüttete Großmutter schnell fünf kleine Linsenhaufen auf den Tisch und befahl den Frauen, sie beim Reden zu verlesen.
»Man braucht nicht bloß müßig herumzusitzen und zu quatschen«, erklärte sie. »Man kann beim Reden auch was tun.«
»Ich will auch«, bat ich.
Aber Großmutter ließ mich keine ›Frauenarbeit‹ machen, ebensowenig wie sie mir erlaubte, das ›Frauenklosett‹ zu benutzen. Sie redeten und verlasen, ich richtete ein Auge auf ihre Hände und ein Ohr auf ihre Lippen, und Worte, Erinnerungen und Geschichten schwirrten durch die kleine Küche, während Steinchen, Erdkrümel und Wildsamen sich zu fünf winzigen Hügeln sammelten und verlesene Linsen von fünf Händen zu dem einen sauberen orangefarbenen Hügel geschoben wurden, der in der Tischmitte anwuchs.
Frau Schifrin erboste sich über Großmutters Worte und erwiderte, es genügten die Schäden, die »dieses Land« ihr selbst beigebracht hätte, und es sei nicht nötig, daß auch die Hände »meiner kleinen Rachel« Schrunden und Schwielen bekämen und auch ihre Haut in der Sonne schwarz verbrenne.
»Mein Leben ist schon zerstört«, sagte sie, »aber für das Mädchen werde ich einen kultivierten Bräutigam finden, der sie von [19] hier fortführt. Nicht einer von euren kleinen Wildfängen, die Senfkraut mampfen, mit Kühen reden und barfuß herumlaufen wie die Araber.«
Frau Schifrin war naiv und wußte nicht, daß ihr und ihrer Tochter ein weit größeres Unheil als Hautkratzer oder ein barfüßiger Bräutigam bevorstand.
Als Mutter anfing, im Hof zu sitzen und sich selbst Geschichten vorzulesen, wurde Rachel Schifrin neugierig, ließ ihre Puppen auf der schattigen Terrasse zurück und trat ans Geländer, um besser zu hören.
Mutter, erfreut über die Annäherung des herausgeputzten Mädchens, senkte ein wenig die Stimme, worauf die Nachbarstochter von der Terrasse in den Garten hinunterging und so tat, als schnuppere sie an den Blumen. Mutter wurde noch leiser, und Rachel Schifrin fing an, die Latten des Zauns zwischen den beiden Höfen aus der Nähe zu betrachten, schlüpfte schließlich zwischen zweien hindurch, und nach ein paar weiteren wohligen Momenten des Flüsterns und Verlockens, Annäherns und Einfangens saßen die beiden Mädchen schon Schulter an Schulter, die eine lesend – beziehungsweise lasend, wie Großmutter sagt –, die andere lauschend.
Als die Geschichte zu Ende war, lud Rachel Mutter ein, bei ihr auf der Terrasse mit den Puppen zu spielen, und so wurden sie Freundinnen – zuerst aus dem wechselseitigen Bedürfnis des sprudelnden Mundes und des dürstenden Ohres heraus und in den nächsten Tagen und Wochen aus wahrer Liebe und Herzensverbundenheit.
»Und wo ist sie heute?«
»Weggefahren.«
»Wohin?« fragte ich, obwohl ich die Antwort schon kannte.
»Zu einem berühmten Arzt nach Wien. Sie ist hingefahren und nicht zurückgekehrt.«
»Warum suchst du sie dann nicht?«
[20] »Ich denke an sie und erinnere mich an sie und sehne mich nach ihr. Das mache ich.«
»Und wenn sie zurückkommt?«
»Dann schließe ich sie in die Arme und küsse sie und lese ihr eine Geschichte vor und liebe sie.«
Viele Tage verbrachten die beiden zusammen, saßen im Schatten des Fikus oder auf dem Bett und hatten sich so lieb, daß bei Schuleintritt – »wir sind Hand in Hand hingegangen«, erzählte Mutter, »und haben uns nebeneinandergesetzt« – Rachel Schifrin sich weigerte, dort lesen und schreiben zu lernen, und auch den Grund nicht verhehlte: »Wenn ich lesen kann«, sagte sie, »liest du mir keine Geschichten mehr auf dem Bett vor.«
2
ZURÜCK ZUR ERSTEN BEGEGNUNG
Zurück zur ersten Begegnung unserer Eltern. Vater verließ die Buchhandlung Igarta, die heute Buchhandlung Jordan heißt, ging an Mutter vorbei, die im Schatten des Eukalyptus stand und las, machte auf dem Absatz kehrt, ging ein zweites Mal an ihr vorüber, drehte wieder, heftete den Blick auf sie, ging noch einmal hin und her, und beim vierten Mal faßte er Mut und fragte sie, welches Buch sie lese.
»Er ist nahe bei mir stehengeblieben, aber den Schatten des Baumes hat er nicht betreten, denn er war ein höflicher junger Mann«, erzählt Mutter, wobei sie sofort hinzufügt: »Dieser Baum steht bis heute auf dem Zionsplatz«, damit entsprechend Interessierte genau zu dem bewußten Treffpunkt pilgern können.
Sie lächelte ihn an, nicht nur seiner guten Manieren wegen, sondern weil sie sofort sah, daß sie beide genau gleich groß waren.
[21] »Du meinst gleich klein, Mutter, nicht gleich groß«, spottet meine Schwester, die mich und unsere Eltern um mindestens einen halben Kopf überragt.
Und ehe sie ihm noch antwortete, lud Vater sie in demselben kühnen Schwung in das Café auf der anderen Seite des Platzes ein – das, wie das Kino daneben, nicht mehr da ist – zu Tee mit Zitrone und einem Gebäck namens ›Schnecke‹, das dort heute nicht mehr gebacken und nicht mehr gegessen wird, sondern nur noch langsam durch die Sehnsüchte alter aschkenasischer Jerusalemer kriecht, die sich in ihren Träumen daran erinnern.
»Wir haben dort gesessen, Tee mit Zitrone getrunken und uns unterhalten. Zuerst über das Buch, das ich gelesen hatte, dann über andere Bücher, und zum Schluß hat jeder über sein Meer geredet. Unser David hat vom Mittelmeer gesprochen und ich vom Kinneret-See, und dabei haben wir so gelacht, daß zwei englische Offiziere empört aufgestanden und gegangen sind.«
Danach sagt sie seufzend: »Und am Ende sind wir in Jerusalem geblieben. Ohne jedes Meer, aber zusammen.«
»Siehst du«, sagt meine Schwester, »hättest du nicht mit ihm Tee getrunken und über das Meer geredet, wäre er heute noch am Leben. Ich wäre nicht geboren worden, aber er würde wenigstens leben.«
»Ich weiß nicht, was besser wäre«, erwidert meine Mutter ihr trocken und fügt verwundert hinzu: »Von wem hast du diese Schlechtigkeit geerbt? Weder ich noch Vater sind derart schlecht.«
»Ich bin nicht so schlecht, wie du meinst«, antwortet meine Schwester, »und du, entschuldige mal, bist nicht so gut, wie du meinst, und bei unserem David, wenn ich dich erinnern darf, ist es schon ziemlich egal, ob er gut oder schlecht war.«
»Xanthippe!« ruft Mutter. »Eine Straßenkötertochter und eine Müllkatzenschwester, das habe ich.«
»Prima, Mutter, häng ein Schild draußen hin: TIERHEIM.«
[22] Vater und Mutter heirateten im Haus von Freunden, liehen Geld und leisteten die erste Anzahlung auf eine Wohnung in einem Wohnbauprojekt, mit dessen Bau man damals gerade begonnen hatte. Unterdessen mieteten sie sich ein Zimmer in einem einzelnen Steinhaus am Rand des Viertels Romema, am nordwestlichen Zaun des biblischen Zoos.
»Und in jenem Haus wurde Rafael empfangen«, beendet Mutter die Geschichte, nimmt ihr Buch, schlägt die Seite mit dem letzten Eselsohr auf und steht auf.
»Die Gedenkstunde ist zu Ende!«
Die Zuhörer – meine Großmutter, meine Schwester, die beiden Tanten und noch ein paar Verwandte und Freunde, die Vater nach so langer Zeit noch in Erinnerung haben und zu jedem Todestag kommen – werden von jener Feierlichkeit ergriffen, die Worte wie ›Gedenkstunde‹ und ›Empfängnis‹ verbreiten, während Mutter sich in derselben feierlichen Stimmung wieder in das Zimmer-mit-Licht zurückzieht, Vaters früheres Arbeitszimmer, in dem heute das Licht nicht mehr ausgeschaltet wird, weil Mutter dort Bücher liest und Oblaten knabbert und die ganze Nacht aufbleibt.
JEDEN MORGEN TRENNTEN SIE SICH
Jeden Morgen trennten sie sich, um dem Studium und der Arbeit nachzugehen. Vater ging nach Osten, zur medizinischen Fakultät auf dem Skopusberg. Mutter ging nach Westen ins Viertel Bet Hakerem zum Lehrerseminar. Und das Haus, eben jenes, in dem Rafael empfangen wurde, blieb auf seinem Fleck stehen und wartete auf ihre Rückkehr. Manchmal, wenn ich meine Bohrungen, Pumpen und Röhren verlasse und aus der Wüste heraufkomme, um die Große Frau zu besuchen – dich und Mutter und die rote Tante und die schwarze Tante und unsere hundertjährige Großmutter (»Ich werde nicht sterben, ehe ich dich nicht im Grab [23] sehe, Rafinka«, erklärt sie mir jedesmal geflissentlich) –, statte ich auch ihm einen Besuch ab.
Der biblische Zoo ist bereits an einen anderen Ort verlegt worden, und an Stelle von Affengeschrei und Pantherknurren hört man jetzt nur menschliche Klagelaute aus dem nahen Bestattungshaus, die mich bei meinen Rundgängen um das Haus begleiten. Ich habe nie dort gewohnt und es nie betreten, aber darin wurde ich ›empfangen‹ – trotz aller Vergeßlichkeit kann ich dieses bombastische Wort nicht vergessen –, und seine Inneneinteilung ist mir wohlbekannt, denn sie wurde mir nicht nur in Worten geschildert, sondern einmal auch auf ein Blatt Papier skizziert.
Drei Zimmer hatte es. Das nordöstliche Zimmer hatten meine Eltern gemietet, worauf meine Mutter sofort die Fensterläden grün anstrich. In den anderen beiden Räumen, die stets verschlossen waren, hielt der Hausherr Kunstbände, wissenschaftliche Werke und Belletristik versteckt.
Der Hausherr war ein ultraorthodoxer Jude aus dem Ungarnviertel, und Mutter erzählte, daß er ab und zu nach Einbruch der Dunkelheit verstohlen ins Haus kam, um dort mit seinen verbotenen Büchern allein zu sein. Er las sie nicht mehr, da er sie schon alle auswendig kannte, lüftete aber ihren Kerker, blätterte die Seiten auf, beschnupperte und entstaubte sie und stellte offene Schälchen mit Eukalyptusöl hin, dessen strenger Geruch, wie er Mutter erklärte, Mäuse fernhielt und Motten tötete.
»Und vor allem sah er nach, ob auch kein Wort aus ihnen getürmt war«, lachte Mutter. »Worte, die nicht gelesen werden, flüchten letzten Endes, suchen sich andere Augen.«
Jahre später fand ich überrascht heraus, daß der Hausherr aus diesen Geschichten kein anderer als Herr Brison war, Milchmann Brison, der jeden Morgen in unserem Viertel die Runde machte. Ich fand es schwer, den legendären Bücherfreund aus Mutters Erzählungen mit der lächerlichen Gestalt des alten Milchmanns [24] in Einklang zu bringen, konnte aber nicht leugnen, daß es sich um ein und dieselbe Person handelte. Das war einer der ersten Beweise für den Hang der Dinge, sich zu verquicken, zu versickern und zu anderen Zeiten an anderen Orten in unvorgesehenen Lecks wieder zu Tage zu treten.
Da Milchmann Brisons Gestalt jetzt sehr klar vor meinen Augen auftaucht, will ich noch ein paar Details über ihn schreiben, damit sie nicht verblassen und vergehen wie viele andere auch. Da ist er, schiebt seinen mit Kannen beladenen Wagen, ruft laut schallend in aschkenasischem Hebräisch »Cho-low!« – Milch – durch die Treppenhäuser und gießt die Töpfe und Krüge voll, die die Frauen ihm herausgestellt haben. Auf diese beiden verträumten o-Laute seines Rufes, das ›cho‹ und das ›low‹, sowie auf die übrigen Säulen der Gerüche, Laute und Bilder stütze ich nun behutsam meine weiteren Erinnerungen. So sammeln sich an den Akazienwurzeln allerlei Stroh und Spreu, die bei Überschwemmungen herangespült werden, Reisig, Astwerk und Kieselsteine bleiben hängen und damit vorm Abdriften ins Vergessen bewahrt.
Sommers wie winters ging Milchmann Brison mit ausgetretenen schwarzen Lederstiefeln, geflicktem schwarzem Mantel und verbeultem schwarzem Hut umher. Wir Kinder des Viertels liefen ihm nach und sangen: »Frummer, Dummer, in’n Himmel kumm er!«, aber er rügte uns nicht.
Wenn er mit seiner Milchkanne zu uns kam, bat er öfter, Großmutter oder meine kleine Schwester möchte zu ihm herauskommen, nicht Mutter oder eine der Tanten, denn junge Witwen weckten Furcht und verbotene Gelüste bei ihm, oder – noch wahrscheinlicher – eine zu wohlige Verbindung von beidem.
Vor allem fürchtete er Mutters wilde schwarze Schwester, bei der das kurze dunkle Haar, der taufrische Salbeigeruch, den sie in den frühen Morgenstunden an sich hatte, und die Umrisse der [25] felsenharten Brüste, die einst die Pyjamajacke unseres Eliesers, ihres verstorbenen Mannes, zu durchlöchern gedroht hatten, ihn dazu brachten, die meiste Milch neben statt in den Topf zu schütten.
»Warum gehst du nicht zu ihm raus, Raful?« schlug meine Schwester vor. Aber die anderen Frauen kamen ihr sofort mit dem bekannten Spruch: »Wieso das denn? Rafael braucht keine Frauenarbeit zu tun.«
Doch ich will hier von Milchmann Brison ablassen, denn ich möchte noch später von ihm und seinen Kannen erzählen, und da ich mir einen Startpunkt gesetzt habe und ein Mann der Röhren, Bachbetten und Ströme, nicht der Brandungen und Strudel bin, will ich mich möglichst nicht zum Vorausgreifen verlocken lassen, damit ich meine Lebensgeschichte nicht etwa erst dann erzähle, wenn ich schon gestorben bin.
Zurück also zum Zimmer meiner Empfängnis, zu dem Haus am alten biblischen Zoo. Als ich vor einigen Jahren aus der Wüste heraufkam, um die Große Frau zu besuchen und meine Erinnerungen an den Steinen ihrer Entstehungsorte zu schärfen, pilgerte ich auch wieder zu dem bewußten Haus. Und plötzlich, viele Jahre nach Mutters grünem Anstrich, ging der eiserne Laden an der Wand des alten Zimmers meiner Eltern auf, und eine barbusige junge Frau erschien im Fenster. Sie sah mich vor dem Haus stehen und gucken, erschrak, lächelte und wich augenblicklich zurück, klappte den Laden zu und verschwand. Noch einen Moment tanzte der Laut des Zuklappens auf meinem Trommelfell, noch einen Moment leuchteten ihre Brüste in der Luft, wie zwei Glühbirnen, nachdem man die Augen schließt, dann vergingen auch sie.
Zuweilen sinne ich, was wohl geschehen wäre, wenn ich an den Laden gepocht hätte, doch am Ende tröste ich mich, in der Annahme, daß der Laden vermutlich geschlossen geblieben wäre, und wozu all dieser Tumult, Rafi, he? Wozu, Rafinka? Du hast [26] es besser bei uns, Raful, du brauchst dieses ganze Chaos nicht. Wozu willst du dir so was an den Hals hängen? Ja, so ist es gut, Rafael, beruhige dich.
DER ZOOBAU
Der Zoobau und die Belegung seiner Käfige waren damals in vollem Gang. Tag für Tag kam ein Kleinlaster vom Skopusberg, dem vorherigen Zoostandort, und entlud dort schlappschwänzige Pfauen, kälteblasse Papageien und apathisch dreinblickende Affen. Auch ein großer Tiger, dem die Verblüffung übers ganze Gesicht geschrieben stand und dem eine dreckige Binde von einer Pfote baumelte, traf ein. Ein Löwe, der bessere Zeiten gekannt hatte, wurde narkotisiert und in seinen Käfig gerollt, und zwei kleine syrische Bären begannen nachts aus ihren neuen Betongruben zu brüllen.
Die Zimmerwand meiner Eltern grenzte an das Gehege der ›Königshirsche‹. King George – »Seine Majestät King George V.«, verbessert die rote Tante, die unserem Edward im Gouverneurspalast bei Sir Alan Cunningham höchstpersönlich angetraut worden war – hatte diese Hirsche von seinem Jagdsitz geschickt, als Geschenk für die Einwohner Jerusalems.
Riesig, rötlich und bildschön waren sie mit ihren eleganten hellen Flecken und den herrlichen Geweihen, und obwohl ich Onkel Edward nie anders als an der Flurwand gesehen habe, wo er mit unseren übrigen Männern hängt, stelle ich ihn mir seit jeher als einen solchen Hirsch vor, der – wenn auch hellhaariger und ohne weiße Flecken auf dem Rücken – auf einer saftig grünen Wiese grast, denn auch er war Engländer, und auch ihn hatte der englische König als Geschenk ins Land Israel geschickt. Nur nicht für all seine Einwohner, sondern für eine einzige Frau.
Wenn die Affen nachts im Dunkeln angstgeplagt schrien, [27] wachte meine Mutter auf, hörte das rastlose metallische Klirren und wußte, daß die beiden Hirschböcke, der große und der kleine, mit geschlossenen Augen wieder und wieder ihre mächtigen Leiber gegen die eisernen Gitterstäbe warfen.
»Jerusalem ist für Tiere noch schlimmer als für Menschen«, schrieb sie auf einen ihrer Zettel. Damals verstreute sie Zettel für Vater, ihren toten Ehemann, heute tut sie es für mich, ihren stöbernden Sohn. Und am Morgen, jeden Morgen, öffnete sie den Eisenladen vor dem gemeinsamen Zimmer, eben den Laden, der immer noch da ist, verschlossen und grün, als hätte ihn nach ihrer pinselnden Hand keine weitere Hand angefaßt, nicht einmal die Hand einer jungen, barbusigen Frau, und rief die Königshirsche heran.
Die Hirsche kamen dann leichtfüßiger als Kühe, aber schwerfälliger als Gazellen angelaufen und drängten sich vor ihrem Fenster, hoben die großen Köpfe und hechelten mit den Zungen. Mutter, die wegen ihrer kleinen Statur auf Zehenspitzen auf einem umgekehrten Scheuereimer stand, lehnte sich aus dem Fenster, so daß sie beinah in das Gehege fiel, und gab ihnen mit ausgestrecktem Arm und roten Wangen trockene Brotkanten sowie Grapefruit- und Gurkenschalen, damit die Hirsche die Hälse reckten und sie ihnen die hübschen feuchten Schnauzen und violett geschürzten Lippen streicheln konnte.
Vor Jahren einmal, als ich Soldat war und auf Urlaub kam – auch damals bei Nacht, auch damals aus der Wüste – und meine Großmutter und meine Schwester und meine rote Tante und meine schwarze Tante schon selig schliefen und nur Mutter, wie immer, auf war und las und im Zimmer-mit-Licht ihre Oblaten knabberte, sagte sie mir plötzlich, nun sei ich schon erwachsen genug, um zu erfahren, wie und wann ich empfangen worden sei.
Offenherzig und erstaunlich detailliert erzählte sie. In jenem Morgengrauen, begann sie, hätten die Königshirsche solchen [28] Krach gemacht, daß sie nicht einschlafen konnte, und als auch die Kirchenglocken der Stadt in das Klirren der Gefangenen eingefallen seien, habe sie den Hals an die Lippen meines Vaters gedrückt – »die damals noch lebendig waren, Rafael, und so warm und weich vom Schlaf« –, habe seine Hand genommen, sie auf ihren Bauch gelegt, ihr Bein über seine ruhenden Hüften geschoben und ihn so umarmt – »da, mit genau dieser Hand« – und ihn gerüttelt, bis er aufwachte und sie umschlang.
So erzählte sie. Mir und nicht dir, vielleicht weil sie wußte, wie viel du behältst und wie vergeßlich ich bin.
»Die Leute gehen an alle möglichen Orte, bloß um sich sehnsuchtsvoll zu erinnern, Rafael«, sagte sie. »Hier sind wir spazierengegangen, hier haben wir uns geküßt, hier hast du mir geholfen, von der Terrasse zu springen, hier ist dir die Sandale gerissen und ich habe sie mit zwei Mimosendornen geflickt… Aber ich brauche nirgendwohin zu laufen. Nicht mal jenes Haus habe ich aufgesucht, seitdem dein Vater umgekommen ist.«
Ihre Hände waren in Bewegung, fuhren von ihren Oberschenkeln herauf, zögerten am Zwerchfell und spreizten sich dann selbstgewiß vor ihren Augen: »Auch ans Grab gehe ich nicht. Es genügt mir, meine Finger hier anzugucken, die ihn gestreichelt haben, an meinen Hals hier zu fassen, den seine Lippen küßten, unser Körper ist der beste Ort für Erinnerungen, nicht wahr? Du bist schon ein großer Bursche, Rafael, bist Soldat, da kann man dir schon solche Dinge erzählen, nicht? Warum lächelst du so? He?«
Ich lächelte, weil nur Vergeßliche wie ich genau zu erfassen vermögen, wovon sie redete, genau die Erinnerungen wahrnehmen, die nicht im Kopf, sondern im Körper gespeichert werden, diejenigen, die in Trommelfell und Netzhaut einsinken, sich in den müden Muskelfasern sammeln und an Bauchwänden und in Nasenhöhlen ablagern. Da sind sie: Trupp auf Trupp marschieren sie in ihren Triumphzügen durch meinen Körper, laufen die [29] knöcherne Wirbelsäule hinab, poltern mit tausend eisenbeschlagenen Sohlen über die Rippen, prüfen die Nieren und kichern.
Auch jetzt lächle ich, denn Vergeßliche wie ich, deren siebartiges Hirn nichts auffängt, kennen nur diese Art Gedächtnis, alles andere sind weiße Zwischenräume: die Wandstücke zwischen den Bildern, die Hautpartien zwischen den Berührungen, die ruhigen Abschnitte zwischen den Klängen, den Streicheleinheiten, den Geschmacksempfindungen und den Gerüchen. Verzeih mir diese Kette bestimmter Artikel, Schwester. Aber es gibt nichts Besseres zur Gedächtnisstärkung als eine Reihe bestimmter Artikel.
SIE VOLLFÜHRTEN EIN LANGSAMES LIEBESSPIEL
Sie vollführten ein langsames Liebesspiel am frühen Morgen, schläfrig noch, und danach stand Mutter mit einem wissenden Gefühl der Dringlichkeit auf, wie jenem, das Vögel beim Nestbau überkommt, und erklärte, sie wolle zu der neuen Wohnsiedlung gehen, die sich gerade im Bau befand.
»Ich möchte sehen, wie unsere Wohnung vorankommt«, sagte sie zur größten Verwunderung meines Vaters.
»Jetzt? Bald wird es Morgen. Wir müssen studieren gehen«, sagte er.
»Wenn du jetzt aufstehst, David, schaffen wir es hin und zurück«, drängte sie ihn. »Es ist noch genug Zeit.«
Sie wuschen sich, tranken Tee, zogen sich an und verließen das Haus. Klein und wendig, kürzten sie über taunasse Brachflächen ab, die sich damals zwischen den Stadtvierteln hinzogen, passierten Abud-Levis großen Steinmetzhof, zwischen dessen Steinstapeln schon kleine Feuer brannten, über denen sich derbe Steinmetzhände wärmten, und gingen von dort hinunter an der Mauer des aschkenasischen Altersheims entlang, von dem heute keine Spur mehr übrig ist – seine hohen Kiefern sind [30] abgehauen und verfeuert, seine Steine abgetragen und für neue Häuser verwendet, seine Alten begraben und zu Staub geworden.
Dann, am Abhang des Hügels, auf dem seinerzeit das Irrenhaus ›Esrat Naschim‹ gleich an der Einfahrt zur Stadt stand – als Prophezeiung und Warnschild für alle, die ihre Tore betraten –, hielt meine Mutter inne und sagte: »Da, von hier aus kann man gut sehen, David. Hier wollen wir uns auf einen Felsblock setzen und gucken.«
Unter ihnen lag ein kleines Wohnviertel mit roten Ziegeldächern und links davon ein Busdepot. Die Depotarbeiter hatten bereits die Motoren der Chausson-Busse angelassen und fuhren mit ihnen hin und her, die widerlichen Auspuffgase noch kalter Motoren trübten den klaren Morgen.
Erste Hahnenrufe schallten aus dem Wadi Lifta herauf, ließen den Osten gelblichrosa werden. Die Luft hatte sich schon etwas erwärmt, die unschönen Gerüche einer erwachenden Stadt begannen sie zu besudeln, und ein grauenhafter Kinderschrei gellte plötzlich von fern.
»Was ist das?« fragte Vater entsetzt.
»Das kommt von dort«, antwortete Mutter und zeigte auf ein großes Gebäude, »aus dem Waisenhaus.«
Fenster gingen auf. Schlafzimmer spien ihren Mief aus. Und gegenüber auf dem von weißlichgrauen Wegen durchschnittenen Geröllhang kletterte ein kurzes, schmales Sträßchen, armselig anzusehen und voller Schlaglöcher, zu einem einzelnen Gebäude hinauf, das umgeben war von Zypressenflammen, stacheligen Palmen und einer Mauer mit rostigem Stacheldraht oben auf. Das war die ›Blindenschule für die Kinder Israels‹, neben der ich einmal aufwachsen und mit deren blinden Kindern ich später spielen sollte. Von der Blindenschule an wurde die Straße zur Staubpiste, die sich höher und höher schraubte, ohne daß jemand ihr Ende kannte. Entweder war sie verweht oder im fernen Himmel [31] und den bläulichen Bergen aufgegangen, die sich verschwommen von ihr abhoben.
Ein Jahr später, als die Wohnsiedlung schon stand und wir darin wohnten – ich war ein paar Monate alt, du warst noch nicht geboren, Vater und Onkel Elieser lebten noch, Onkel Edward war schon umgekommen, aber die rote Tante wohnte noch nicht bei uns –, saß Mutter nachts auf und schrieb bebilderte Briefe an ihre Mutter und ihre schwarze Schwester. »Hier wohne ich«, schrieb sie. »Das ist die Blindenschule, das die Irrenanstalt und das da das Waisenhaus.« Dazu zeichnete sie die Gebäude und den Weg, der sich vom einstigen Königsweg zum Pfad von damals und vom damaligen Pfad zur heutigen großen Straße gewandelt hat.
»Das ist Jerusalem«, schrieb sie, »eine Stadt der Blinden, Waisen und Verrückten.« Dazu zeichnete sie die verwischten Spuren der Könige und Rösser, der Bauern und Esel und der Feldherren, die, jeder zu seiner Zeit, den Weg beschritten hatten, und zu jedem Bild schrieb sie Erklärungen und skizzierte Pfeile, sehr ähnlich den Planskizzen von Nachum Gutman in den alten, in blaues Leinen gebundenen Heften der Kinderzeitung Davar lejeladim. Bis heute stehen sie auf dem Regal unterm Fenster im Zimmer-mit-Licht, und Mutter kannte sie, wie viele seinerzeit, in- und auswendig.
»Wunderbare Briefe hat sie mir geschrieben«, sagte die schwarze Tante, faltete die Bögen zusammen und schob sie in ihr Stoffsäckchen zurück. »Damals hat sie mich geliebt, hat mich nicht gehaßt wie heute.«
»Sie haßt dich nicht«, sagte ich. »Manchmal ist sie ein bißchen böse auf dich, weil du ihnen Blamagen machst.«
»Was für Blamagen?«
»All deine Männergeschichten.«
»Du verstehst gar nichts, Rafael. Dank unser wirst du etwas von anderen Männinnen verstehen, aber uns verstehst du nicht [32] und wirst du nie verstehen, auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst.«
Die schwarze Tante hatte recht, und wie jeder Rechthaber, der von seinem Recht überzeugt ist, irrte sie auch ein bißchen: Ich wuchs so gut auf, wie ein Mann nur aufwachsen kann, bin erwachsen und älter geworden, und verstehe doch weder sie und die übrigen Frauen der Familie noch »etwas von anderen Männinnen«.
EIN GARTEN ERSTRECKTE SICH
Ein Garten erstreckte sich hinter der Blindenschule, und Mutter sah von ihrem hohen Aussichtspunkt eine ferne Frauengestalt auf seinen verschlungenen Kieswegen wandeln.
Unter unerwartetem Herzklopfen folgte sie ihr mit dem Blick. Die Frau kam an einen kleinen grünen Zierteich, der wie ein offenes Auge, umwimpert von Schilfrohr und Trauerweiden, mitten im Garten lag, und blieb an seinem Rand stehen. Groß und aufrecht war sie, aber wegen der Entfernung wußte meine Mutter nicht, ob sie blind war oder sehen konnte, und ein unerklärlicher Schauder durchzuckte sie.
Laute Schreie, »Aufstehen! Aufstehen!«, gellten aus der Blindenschule. Die Frau wandte sich um und ging ins Haus zurück, und kleine graue Lastwagen, die mit Menscheneifer schon früh zur Arbeit angetreten waren, tuckerten bereits über die Staubpiste, ächzten unter der Last von Bausteinen, Baukies und Gerüststangen. Maurerrufe erschallten, und trotz der Entfernung hörte man sehr klar und nahe das Schaben und Rühren, wenn die Schaufeln und Spaten gegen die Behälterwände schürften.
»Schade, daß sie nicht mit Stein bauen«, sagte unser David.
»Du mit deinem Stein«, spottete sie.
»Dein Vater war begeistert von dem Jerusalemer Gestein, Rafael, vielleicht weil er von Tel Avivs Sandboden herkam.«
[33] Sie, die vom Basalt des Jordantals und den schwarzen Häusern daraus kam, sagte, sie hätte genug von Steinhäusern und vor allem von denen Jerusalems, die sich hochmütig über ihre Bewohner erhöben. Manchmal finde ich ihre beschriebenen Zettel in den Büchern liegen, die ich für sie fertiglese – allerlei Gedanken, die sie gewälzt und ihrem verstorbenen Mann und ihrem stöbernden Sohn hinterlassen hatte. »Wegen dieses Jerusalemer Steins«, schrieb sie auf einem, »gibt es in dieser Stadt kein einziges neues Haus. Jedes Haus in Jerusalem ist schon ein altes Haus, ehe es fertiggebaut ist.«
»Siehst du, David«, sagte sie und sog genußvoll den kühlen Hauch frischen Mörtels und Kalks ein, »nur ein Haus aus Hohlblocksteinen ist ganz neu. Häßlich, aber neu. Riech mal, wie gut, bis hierher weht dieser Geruch.«
»Hier wird alles neu sein«, erklärte sie. »Und ich werde hier einen Mandelbaum und einen Santa-Rosa-Pflaumenbaum und zwei Granatapfelbäume pflanzen, einen süßen und einen sauren, und Reuven bringt mir dann Säcke voll schwarzer Erde aus der Moschawa, und ich stecke Frühlingszwiebeln und säe Veilchen ein, und Löwenmäulchen werde ich ziehen und scharfen Paprika und Petersilie und Tomaten.«
»Ich, ich, ich«, sagte Vater lächelnd. »So viele Pläne und so viele Ichs.« Mutter lachte und wollte ihm schon etwas antworten, aber plötzlich knarrte eine kleine Eisenpforte, eine rostige Öffnung tat sich in der Mauer des Irrenhauses auf, und ein magerer, barfüßiger Mann kam affenartig herausgeschossen und preschte die Staubpiste in Richtung Sonnenaufgang entlang.
Sand- und Kieshaufen lagen am Weg verstreut. Der Mann nahm die erste Biegung, duckte sich, kniete nieder und ging hinter einem Haufen in Deckung.
»Was macht er?« fragte Mutter.
»Er flieht. Bald wird man herauskommen und ihn fassen«, sagte Vater. »Laß uns hier weggehen.«
[34] Aber Mutter lächelte den Verrückten, der den Seiten eines ihrer Romane entschlüpft zu sein schien, neugierig an. Sein langer, gebeugter Körper erbebte von unterdrücktem Krokodilslachen, sein dreckiger Nacken lechzte förmlich danach, gekratzt zu werden, und seine roten Augen zwinkerten bittend, sein Versteck nicht preiszugeben.
»Vielleicht müßte man reingehen und ihnen sagen, daß er hier ist«, sagte Vater. Aber da schossen schon zwei Pfleger in wehenden Kitteln aus dem Tor und setzten dem Entflohenen nach. Sie bemerkten ihn nicht, stürmten an dem Haufen, hinter dem er verborgen saß, vorbei und setzten ihren schwerfälligen Lauf fort.
Als die beiden Verfolger hinter dem Hügel verschwunden waren, erhob sich der Irre aus seinem Versteck, klopfte sich den Staub aus den abgerissenen Kleidern, und trat in langsamem, feierlichem Siegestanz den Rückweg in die Anstalt an, machte Verbeugungen und winkte mit beiden Armen seinen Gefährten zu, die an den Fenstergittern hingen und vor Freude heulten.
»Guten Morgen, gnä’ Frau«, sagte er und drehte sich, als er an Mutter vorbeiging, einmal lächelnd um sich selbst. »Sind Sie auch hier?«
Dann verengten sich seine Pupillen auf Skalpellspitzengröße und starrten auf ihren Bauch: »Viel Glück, gnä’ Frau, möge es zu guter Stunde ein Sohn werden.«
Ein Schauer durchzuckte sie. Plötzlich begriff sie, daß sie schwanger war, daß sie zwei Stunden zuvor empfangen hatte, an eben diesem Morgen, und die Knie wurden ihr weich.
»Hau bloß ab!« rief Vater, richtete sich zu seiner vollen kleinen Größe auf und wedelte drohend mit der Hand. Aber der Mann machte ihm einen verächtlichen Bückling, so wie Diener, die größer als ihre Herrschaften sind, faßte sich an den Hintern und sang: »Viel Glück der Mutter, viel Glück dem Kind, ich heiße Sima und lauf nun geschwind.«
[35] Danach dienerte er erneut, machte sich davon und verschwand hinter dem Eisentor des Irrenhauses, und nur seine irritierenden Worte blieben dort schwarz und schwankend in der Luft hängen, wie die schwarzen Wüstenkrähen, die vor den Felswänden und an den Bergspitzen im Gegenwind schweben.
LANGSAM, LANGSAM
Langsam, langsam, im gemütlichen Tuckertakt des Dieselmotors, begleitet vom gelblichbraunen Schwarm der Hornissen und vom ewig hungrigen Blick der Krähen, fahre ich mit meinem Pick-up von Reservoir zu Reservoir, von Bohrstelle zu Bohrstelle, von Ventil zu Ventil. In Geröllwüstengebieten halte ich ab und zu an, steige aus dem Wagen und gehe zu Fuß über die von großen Gesteinsbrocken übersäten Flächen.
Diese Wüste eignet sich nicht für Streitrösser und Rennpferde, ihre Pfade taugen für die weichen Schritte der Kamele und den gemächlichen Gang der Hirten. Die Steine knirschen unter meinen Schuhen. Meine Augen spähen. Ich forsche nach den kleinen Geheimzeichen, die die Wüste für ihre Kenner birgt, und nach den Resten der Pfade, die sie ihren Liebhabern bietet.
In den Bergen schlängelt sich immer nur ein Weg mit der Mäßigkeit dessen, der sich im Recht weiß, hinan, aber in der Ebene verzweigt er sich in einzelne Arme, die auseinanderlaufen, wettstreiten und wieder zusammentreffen, doch wie die Lebensläufe unserer Männer und wie die Bachrinnen in den breiten Wadis gelangen sie schließlich allesamt ans gleiche Ende. Von den Felsspitzen und aus der Vogelschau erkennt man sie leicht, aber aus der Augenhöhe des Wanderers sind sie nicht immer zu sehen, so muß das spähende Auge sich mit dem Fuß beraten, der gemütlich ausschreiten möchte, und mit dem Verstand, der Logik sucht, und mit dem Herzen, das gern langsam schlagen will.
[36] Häufig entdeckt der Fuß die Wahrheit vor dem Auge, denn sobald er den Weg betritt, wird er ruhig, und der ganze Körper beruhigt sich mit ihm. Schon lächeln Knie und Knöchel, und die Laute des Berstens, die zuvor die Schritte begleiteten, werden angenehmer und weicher in den Ohrlabyrinthen. Das ist der Zeitpunkt, voll durchzuatmen, den Kopf zu heben und das Auge sehen zu lassen, was es vorher nicht sah. Die Steine des Weges sind schon unter den Füßen der Vorgänger zerbrochen, wer weiß, wann. Da sind sie, kleiner als die normalen Steine der Ebene, glatter und staubiger auch, und daneben helle Fleckchen nackter Erde.
Sobald ich die blasse Spur des Pfades erkenne, wundere ich mich, wieso ich ihn vorher nicht sah. Jetzt entschlüpft er mir nicht mehr. Ich beschreite ihn, meine Lungen saugen seine Ruhe ein, und meine Augen halten Ausschau nach hübschen Steinen, um sie Onkel Abraham mitzubringen, dem Steinmetzen Abraham, meinem Freund und Wohltäter.
Hatte ich Abraham schon erwähnt? Wenn ich vor Jahren als Kind mal den zehn haltenden Armen, zehn suchenden Augen und fünf rufenden Mündern der Großen Frau entfliehen wollte, fand ich in seinem Hof Unterschlupf. Abraham teilte sein Brot mit mir, schnitt mir etwas von seinen Erinnerungen ab, und von Zeit zu Zeit sagte er: »Wenn du mal groß bist und herumkommst und einen schönen Stein siehst, dann bringst du ihn mir, ja, Rafael?«
Ich sagte: »Ja, Onkel Abraham«, und ich halte Wort. Wann immer ich einen schönen Stein in der Wüste sehe, ob klein oder groß, hieve ich ihn auf die Ladefläche des Pick-ups, und wenn ich nach Jerusalem hinauffahre, um die Große Frau zu besuchen, gehe ich auch bei Steinmetz Abraham vorbei und bringe ihn ihm mit.
[37] NEUN MONATE
Neun Monate nach jenem Morgen wurde ich geboren, und fünf Jahre nach meiner Geburt ging Vater zum Reservedienst, kam bei einem Unfall ums Leben, und aus ›Major Dr.David Mayer‹ wurde ›unser David‹.
Alle bedauerten es sehr, aber niemand war überrascht. »In manchen Familien kommt Geld zu Geld, und in unserer Familie kommt Tod zu Tod«, erklärte Großmutter, deren Pedanterie und Wissen in diesen beiden Dingen in der Familie berühmt war.
Ihr fehlte es nicht an Männern und Todesfällen, um ihre Thesen zu beweisen: Ihr Mann, unser Rafael, hatte sich in Kinneret im Kuhstall aufgehängt. Ihr Sohn, unser Reuven, war vom Pferd gestürzt. Ein Haifaer Neffe war genau an seinem achtundvierzigsten Geburtstag mit dem Motorrad gegen einen dicken Baum gefahren. Der Mann ihrer Nichte hatte mit sechsundvierzig sein Leben ausgehaucht, als ihm bei einem Schulausflug seiner ältesten Tochter eine versehentlich gelöste Kugel die Leber zerriß. Ein anderer Verwandter – »was für ein schöner Junge er gewesen ist, der Krassawez von Petach Tikwa« – war mit vierundvierzig Jahren einem Stromschlag erlegen, in der Druckerei, die er von seinem Vater geerbt hatte, nachdem dieser wiederum rund fünfundzwanzig Jahre früher eben dort gestorben war: Eine riesige Papierrolle war von einem Laster gerollt und hatte ihn unter sich erdrückt.
Häufig erzählten die Frauen Geschichten über die merkwürdigen Todesarten ihrer männlichen Angehörigen, und meine Schwester sagte mir, sie wetteiferten miteinander, bestimmten sogar ihre eigene Stellung und Bedeutung nach dem Maß der Grausamkeit, Unvorhersehbarkeit und Schmerzhaftigkeit sowie nach der Blutmenge, die ihre Ehemänner, Brüder, Söhne und Onkel vergossen hatten. Mir gefällt übrigens besonders der Unfall eines Bruders meiner Großmutter, der einen Stromschlag [38] erlitt, als er das schöne Kleid seiner Tochter bügelte, die zu einem Rendezvous gehen wollte. Jahrelang hatte er ihr nicht erlaubt, mit ihren Verehrern anderswo zusammenzukommen als daheim im Wohnzimmer, bei weit offener Tür und in Anwesenheit eines Elternteils oder der großen Schwester. Aber eines Tages – kein Mensch weiß, warum – hatte er in einem Sinneswandel dem Flehen der Tochter und den Argumenten ihrer Mutter nachgegeben, ja war nun derart umgestimmt, daß er sich hinstellte, um das Kleid zu bügeln, das sie zu dem Treffen anziehen wollte.
Mutter und Tochter saßen da und lächelten einander zu. Aus dem Nebenzimmer hörte man die Beine des Bügelbretts beim Aufstellen quietschen, hörte das Rascheln des ausgebreiteten Kleides und das leise Zischen des Dampfes aus seinen Falten, dann den jähen Schrei, gefolgt vom Aufschlag des Bügeleisens, und zum Schluß das Fallen des Leibes, abwärts, abwärts in präziser Reihenfolge: Knie, Ellbogen, Schulter, Schädel schlugen nacheinander am Boden auf. Und nach Ende des Trauerjahrs heiratete die Waise ihren Geliebten, bitterlich weinend und in dem Kleid, das erhalten geblieben war: halb gebügelt, halb kraus, und auf dem Rücken ein schwarzer Fleck.
»Siehst du, Rafinka. So was passiert, wenn Männer Frauenarbeit machen«, sagte Großmutter
»Wäre er nicht so gestorben, dann eben anders«, bemerkte meine Mutter.
Und wenn ich unter einer meiner Akazien sitze, um mich auszuruhen oder mir Tee aufzubrühen, nehme ich manchmal einen dürren Zweig und male unseren kleinen Stammbaum in den Sand. Da sind Großvater und Großmutter. Da ihre Kinder: Onkel Reuven, Mutter und die schwarze Tante zweigen von ihnen ab. Tante Jona neben Onkel Reuven, Onkel Elieser neben der schwarzen Tante, und neben ihm auch seine Schwester, die rote Tante mit ihrem Edward. Neben Mutter setze ich Vater ein und darunter mich ohne Rona und dich, alte Jungfer, allein. Das ist [39] der ganze Baum, mit den lebendigen Frauen, den toten Männern und mit mir, dem Wundermann Rafael: Der Tod, der sorgfältig die reifen Männer im Obstgarten unserer Familien pflückt, hat mich vergessen. Mit zweiundfünfzig Jahren bin ich älter, als meine Onkel, mein Großvater und mein Vater je wurden.
Da bin ich, zittere im Wasserspiegel der Mulde. Ein rundes blaues Himmelsauge über mir, lebe ich und betrachte mein Spiegelbild.
»Ich fürchte sehr, Rafinka wird an Altersschwäche sterben.«
Großmutters hundertjährige Züge sind sehr ernst, aber du, meine Schwester, brichst ungehemmt in Lachen aus. Auch ich lächle, aber ohne deinen Spott und Humor, zum einen, weil wir zwei sehr verschieden sind, und zum andern, weil es um mich geht. Um mich, meinen Leib und mein Leben.
Da bin ich: Mein Haar ist blond und voll, aber meine Augen ermüden. Die Muskeln sind stark und gewandt, aber die Eingeweide liegen matt und schlaff hinter ihren Wänden. Die Leber wiegt schwer, die Därme möchten sinken, abwärts, abwärts rutschen, am Grunde ruhen, das Herz – sich zu Boden ergießen, das Blut – stauen… Nur diese jungen Bauchmuskeln halten, wie Söhne, die ihre alten Väter zum Turnen zwingen, – kein Mensch weiß, wozu – alles an Ort und Stelle fest.
»Wozu?« frage ich, über die glatte Wasserfläche gebeugt.
Und das Spiegelbild läßt das Gesicht seines Erzeugers erbeben: »Wozu, Rafael, wozu das alles, he?«
3
SEINERZEIT ENDETE JERUSALEM
Seinerzeit endete Jerusalem abrupt. Hier gleich hinter der Wand war die Grenze. Eine klare, argwöhnische Linie. Auf der einen Seite die Wohnsiedlung mit ihren Insassen, ein armseliger [40] kleiner Konsumladen und zaghafte Zierbeete, auf der anderen Seite verschlagen lauernde Tiere und die zähen Dornen und Disteln des Brachlands. Bis hierher Stadt und Straße und Mensch, von hier an Felsgrund, Ödland und Gebirge.
Eine wahre Grenze mit allem Drum und Dran. Soll ich dich erinnern? Zuweilen hörte man sogar Kampfrufe: arabische ›Barud!‹-Schreie zur Warnung vor Felssprengungen, das Kreischen des Sperbers, das Zischeln der Karbonarschlange und das Stampfen einer Walze. Hüben Häuser und Gehsteige, Wäscheleinen und fahles elektrisches Licht, drüben Wildnis und Stein, Schakale und Disteln.
An Sommermittagen wurden die Felsen glühend heiß, um Mitternacht barsten sie, im Winter sammelten sich dazwischen kalte, klare Lachen, auf deren Grund langsam grüne Gräser wedelten und deren Wasser vor Krötenschleim ätzte. Gottesanbeterinnen machten dort Beute, Maulwürfe strebten der Gartenerde zu, und manchmal sauste ein Rudel verwilderter Hunde vorbei in unermüdlichem Lauf gen Norden, im Schlepptau einen Schwall von Mordlust und Grauen.
Drei große Gebäude überragten das Wohnviertel meiner Kindheit, wie Wachsoldaten in drei Himmelsrichtungen: das düstere, festungsartige Waisenhaus, die mit Schloß und Riegel verrammelte Irrenanstalt und am nächsten, ganz bei unserem Haus, die Blindenschule, umgeben von ihrem verbotenen Garten samt Mauern und Zypressen. Jedes Gebäude hatte seine Insassen. Jedes Gebäude hatte seine Schreie. Jedes Gebäude hatte seine Mauern und Riegel.
Gewissermaßen im Schatten ihrer Mauern ging der Bau des Wohnviertels voran, und bald auch füllten sich die grauen Betonwände mit Leben und Gerüchen und Menschengewimmel. Plattnasige Kleinlaster, von Planen überwölbt, schnauften alsbald den Staubweg herauf. Vorher waren die Soldaten zu den Schlachtfeldern gefahren, jetzt verfrachteten sie Tisch und Stuhl, Bett und [41]