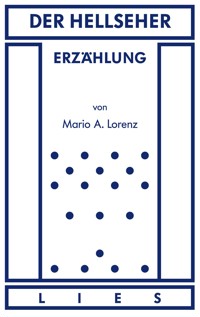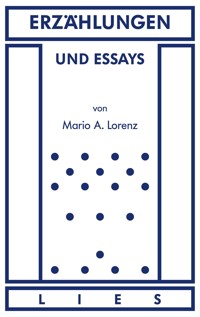
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band "Erzählungen und Essays" handelt hauptsächlich vom Rechnen. Das jedoch immer auch im Zusammenhang mit Spiritualität und einer grundsätzlichen Kritik an der gängigen Perspektive auf das Mathematische.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
ERZÄHLUNGEN
Die Suche nach dem Bösen
Die Falle
ESSAYS
Logik oder Realität
Ist die Welt magisch?
Der Zweifelswahn
Der Neue Mensch
Also sprach die Zunge
Das Schlichte in der Gestaltung
Der Erbfehler
ERZÄHLUNGEN
Die Suche nach dem Bösen
Wer nach dem Bösen sucht, zu dem wird es kommen, und wer das wissen will, der wird es erleben.
Der Lehrer schaute immer strenger, und in seinen Augen spiegelte sich noch immer nichts anderes als alles das, was man dem armen Schüler von zuhause aus in der Form von Angst mitgegeben hatte. Was nun wieder, wenn er die Aufgabe nicht richtig lösen konnte, was dann? Er konnte sich kaum auf das Gefragte konzentrieren, aber um so mehr tauchten in seinem Inneren ganz andere Fragen auf, und jetzt, das wußte er, mußte er etwas antworten, denn der Lehrer würde nicht ewig Zeit haben. Doch dieser unterbrach seine Gedanken: Ich wiederhole: was ist nun vier und zwei! Und diese Wiederholung klang plötzlich ganz freundlich, allein schon weil es eine Wiederholung war, denn der Schüler wußte gar nicht, ob der Lehrer überhaupt schon einmal etwas wiederholt hatte. Schon gar nicht mehr, ob gerade für ihn. Natürlich wußte er, daß selbst diese Freundlichkeit nur gespielt gewesen sein mußte, spätestens wenn er nachhause kam, hätte man das schon entsprechend organisiert, und jeder hätte sofort gesehen, daß Schule nichts mit Freundlichkeit zu tun hatte oder gar mit etwas, worüber es sich scherzen ließe. Der Schüler, Rolf Büttner war sein Name, wollte also eine Antwort geben, eigentlich hatte er schon längst eine: Vier und zwei ist vier und zwei. Rolf selbst hatte schon vergessen, zu wem er eigentlich sprach, sah seine Klasse im Hintergrund verschwommen da sitzen, der gute Lehrer würde ihn schon gehört haben, tröstete er sich selbst. Doch dieser hatte gedacht, er mache einen Scherz: und was ist es wirklich? Ich meine natürlich, wie viel? Die Klasse war längst abgelenkt, sie hatte die Antwort für Unsinn gehalten, froh, doch wenigstens etwas von der Zeit gespart zu haben, in der einer von ihnen selbst drankommen konnte. Doch Rolf fuhr fort, als hätte er noch nicht einmal begonnen: zu einem zwei und vier würde ich mich noch breitschlagen lassen... Doch jetzt nahm der Lehrer diesen Unsinn persönlich, bei einem Kollegen hätte sich das vielleicht keiner getraut, er mußte vorsichtshalber jetzt strenger wirken. Sechs! sprach er die richtige Antwort jetzt klar und fest aus, so daß jeder es für eine Sekunde lang hören mußte, selbst die Abgelenkten und Rechenschwachen in den hinteren Reihen. Ob diese Antwort nun vom Schüler gegeben wurde oder vom Lehrer selbst, war dabei völlig egal, sie brillierte jetzt einzig durch ihre Richtigkeit.
Büttner, nun abgespeist mit der Antwort, war allerdings nicht zu beruhigen, er war schon so lange in der ersten Klasse und dieses Mal erst wirklich dabei: wenn vier und zwei oder zwei und vier oder wie man es nennt, also wenn das sechs ist, dann ist es doch schon sechs, und man müßte es nicht mehr ausrechnen, jedes Ausrechnen wäre nur ein Fehler, ganz egal, welche Antwort man geben würde. Dann schwieg Büttner noch eine Weile, wie um das Gesagte mit einem fetten, aber lautlosen Stift zu unterstreichen. Der Lehrer schaute ihn an, nur das, sonst regte er sich nicht, und in der Blöße seiner Kindheit dachte Rolf schon, das sei so etwas wie das Ende der Mathematik, wenn er es auch noch nicht so ausdrücken konnte. Doch der Lehrer sah nur aus, als ob er gegrübelt hätte, er war in Wirklichkeit sehr wütend geworden, und einige Schüler im Hintergrund schienen das bereits lustig zu finden, man hätte nicht gewußt, wen man für dieses Lustige zuerst hätte bestrafen müssen: Rolf, du kannst sehr wohl eine schlechte Kopfnote bekommen für den Clown, der du ganz gerne gewesen wärst, aber um die Rechnung wirst du heute nicht herumkommen, ich werde so etwas nicht noch belohnen. Also: Rechenweg! Er sagte nur das Wort Rechenweg, jeder wußte, was das war, und er sagte es, als ob er in Rolf Büttner den Teufel gesehen hätte. Was keiner wußte, das war ein Trick. Wenn der Lehrer wirklich streng sein mußte, dann sah er einen an und stellte sich vor, den Teufel vor sich zu haben. Seine Mutter hatte da so ein abscheuliches Bild, im Hintergrund der Teufel, vor dem er solche Angst hatte, als er selbst noch ein Kind war. Dieser Teufel konnte sich sogar bewegen, man mußte nur an ihn denken und ein Kind dabei ansehen. Sicher, das war etwas makaber, aber der Lehrer war nun schon so alt und wußte sich nicht anders zu helfen. Alles änderte sich immer schnell, selbst wenn ein Kind sich nicht änderte, dann sollte doch mindestens nach einem oder zwei Jahren eine neue Klasse kommen, und wieder war alles anders. Da lobte er sich doch seine Mathematik, die doch immer blieb wie sie war, selbst wenn es keinen gegeben hätte, der wußte, wie sie war, so war sie trotzdem wie sie war. Er war Lehrer, aber, was keiner wußte, nicht wegen der Schule, sondern nur wegen der Mathematik, die seine heimliche Leidenschaft war, heimlich, obwohl er bei jeder Gelegenheit stolz erwähnte, Mathematiklehrer zu sein. Wirklich klar war ihm das selbst nie gewesen.
Kam jede Veränderung nicht nur einer Aufforderung gleich, gerade diese wieder gleich zu machen wie ein guter alter Handwerker mit einem Hobel? Also stellte sich der Lehrer vor Büttner in eine andere körperliche Position und wartete auf einen Rechenweg. Solch ein Rechenweg war immer etwas wie eine Strafe, wie wenn einer sein Vertrauen verspielt hatte und dann die richtige Antwort gab und der Lehrer dann ausrief: Zufall! In der ersten Klasse konnte das schon passieren, daß eine Antwort Zufall war. Meist wurde ohnehin nur bis neun gerechnet. Da war es manchmal fast schwieriger, die falsche Antwort zu finden. Außerdem, richtig oder falsch, was machte das, wenn man erst einmal das Vertrauen des Lehrers verspielt hatte. Die Antwort konnte sonstwo hergekommen sein, von einem schmutzigen Zettel, vom Tischnachbarn, nur nicht aus der Mathematik heraus. Büttner schaute seinen Lehrer erwartungsvoll an. Wieviel Zeit würde er ihm für den Rechenweg geben? Sicherlich, auch das hätte man berechnen können, wenn es Mathematik gewesen wäre. Aber es hatte nun einmal keinen Rechenweg gegeben, also sah Büttner sich gezwungen, für seinen Lehrer einen auszudenken, denn noch einmal sich verweigern konnte er auf keinen Fall, das hätte furchtbaren Ärger gegeben. Nun, Herr Clown, wie sieht es aus? fragte der Lehrer, als ob es gelte, sich nach der Gesundheit eines Freundes zu erkundigen, Rechenweg? Der bereits siebenjährige Rolf Büttner befand sich nun wirklich in Bedrängnis, aber wenn er nur eines wußte, bewußt oder unbewußt, dann war das, in dieser Situation keinesfalls zu widersprechen. Er mußte so rasch wie möglich wieder eine Art Ernst herstellen, und jedes Widersprechen wirkte dabei nur lächerlich. Er rannte plötzlich in eine Ecke des Klassenraumes, in der er ein Häufchen Holzkugeln in einem tönernen Übertopf wußte, die er sich in seine Hand schüttete, gierig, als ob sich einer mit einer Überdosis Schlaftabletten aushelfen müßte. Er hatte so etwas schon einmal in einem Film gesehen, ohne daß er verstand, was es darstellen sollte. Überhaupt wurde er oft von dem Gefühl beherrscht, einer würde ihn wie ein Erzähler durch sein Leben begleiten und ihm alles erklären, ohne dabei auf den Punkt kommen zu müssen, als ob gerade dieser Punkt peinlichst gemieden werden müßte, weil er doch so unwesentlich sei. Büttner, der von seinem Lehrer bisher nicht daran gehindert wurde, war mit den Holzkugeln zum Pult geeilt, auf dem er sie sogleich in wohltuender Ordnung platzierte. Schon das brachte ihm eine gewisse Anerkennung ein, wie er spürte. Zumindest die Geräuschlosigkeit in dem großen Raum galt nur ihm. Und er begann zu sprechen: hier sind vier. Eins, zwei. drei. vier. Und drüben sind zwei. Eins-zwei, wie die Zwei ausführlich heißt, mit vollem Namen sozusagen. Wenn wir das alles jetzt vergessen und etwas schummeln und aus den beiden Kugelhäufchen eines machen, dann zählen wir bis sechs. Aber wehe dem, der auch nur eine Kugel mehrfach zählt! Der Lehrer, der bisher verstummt war, nickte wohlwollend: Wirklich beeindruckend, dieser lückenlose Weg, aber wieso sagst du etwas von Schummeln? Wir rechnen hier und schummeln nicht. Eigentlich hast du dir für das Ganze eine glatte Fünf verdient, und die bekommst du auch. Ist das nicht gerecht? Nicht geradezu vollkommen? Beim ersten Mal will ich nichts gehört haben, aber danach wird es ernst, wenn das Wort schummeln irgendwo auftaucht, ist die Prüfung für dich gelaufen. Ich kann nun einmal keine Fehler gutheißen, jedenfalls nicht wenn es grundlegende sind. Also, der Rechenweg? Aber da kam wieder der Clown hervor, der Büttner zeit seines Lebens gewesen war, und dieser sollte dem Lehrer den Rechenweg schuldig bleiben. Er wollte noch in aller Ruhe die beiden Kugelhäufchen wieder trennen, um sie dann vor aller Augen wieder zusammenschieben zu können. Allenfalls bewältigte er das Trennen. Er hatte Schwierigkeiten mit dem Plus. Ihm war, als ob ihm die Energie abhanden gekommen sei, die er noch benötigte, um endlich die Perlen zusammenzurücken und die Note Eins für sich zu kassieren. Nun gut, Schluß jetzt! sprach endlich der Lehrer. Er tat das nicht etwa mit der Stimme eines Erlösers, eher mit der eines Wärters, der die Tür zu einem kleinen Paradies für immer schloß, als ob es die Tür zu einem großen wäre. Büttner konnte das nicht so ganz ernst nehmen, aber schon schellte die Pausenglocke mit dem grellen schneidenden Ton, mit dem sie immer alles scharf abschnitt, was sich in der Klasse an Zeit abgespielt hatte. Wieder begann dieses Drängeln zum Ausgang, dem nur beizukommen war, indem man den ersten Sturm, eigentlich den ganzen, schlicht abwartete, um dann in Ruhe hinauszugehen. Aber da war keine Ruhe, immer wieder ging Büttner das Wort im Kopf herum: Komm nur nicht mit einer Fünf heim. Aber wenn er nicht heimgekommen wäre, wo hätte er bleiben können? Er hatte in eine andere Mathematik flüchten wollen, natürlich unbewußt, wie sich versteht, aber es gab da gar nichts, was ihm hätte nutzen können. Also ging er genau dorthin, wohin er nicht gehen wollte, denn irgendwann hätte es so oder so Ärger gegeben. Und irgendwann würde alles vorbei sein.
Die Mutter sagte gar nichts. Nur: Note? Sie schien ihrem Sohn anzusehen, daß etwas nicht stimmte. Diese Stimmung, diese Chemie in der Luft, wie ein Narkosemittel, aber wie ein extrem feines, und dieses Brennen der Angst, wie aus einer Spritze. Irgendwann sollten sie Chemie bekommen, das war wie Biologie, nur wurde es gehandhabt wie Mathematik, das wußte Rolf von seinem älteren Bruder, der es irgendwoher gehört hatte. Da sollte es Atome geben. Sie waren unspaltbar, und wenn man sie dennoch spaltete, blieb nicht mehr viel von ihnen übrig. Es sollte sein wie wenn man mit Würstchen rechnete anstelle mit Zahlen, nichts durfte da durcheinander gebracht werden. Das war eine neue Mathematik, viel logischer als die alte, aber das gab es erst ab der fünften Klasse. Fünf! rief Rolf Büttner ganz laut, wie einer, der nichts zu verbergen hatte, mehr brachte er nicht heraus. Jede weitere Reaktion der Mutter war überflüssig. Sie mußte furchtbar enttäuscht gewesen sein, wobei diese Enttäuschung keineswegs eine Überraschung sein konnte, zu oft hatte sie ihm gedroht, bloß nicht mit einer Fünf heimzukommen. Als sie nach zehn oder zwanzig Minuten ihre Fassung einigermaßen zurück erhalten hatte, da hatte sie nur noch gesagt, sie habe es gewußt. Sie habe es immer gewußt. Das hatte sie bei jeder Fünf gesagt, was der ganzen Angelegenheit noch etwas Glaubwürdiges verlieh, auch wenn erst diese eine Fünf in einem Hauptfach erteilt worden war. Wenn jemand über ein dreiviertel Jahr verteilt sechsmal hintereinander aussagt, etwas Bestimmtes gewußt zu haben, dann muß er es auch gewußt haben, daran gab es für Rolf keinen Zweifel. Während die Mutter hilflos dastand, wurde der Vater, als er von der Fünf hörte, ziemlich wütend, redete etwas von einer unbürokratischen Lösung und holte einen Stock hervor. Irgendetwas wollte er ihm einprügeln, während Rolf ihm seinen Hintern herausstreckte. Danach war alles ganz still, es war beinahe eine vornehme Stille, die immer eintrat, wenn etwas in sich abgeschlossen war. Auch die Schmerzen waren ganz schnell wieder vergessen. Aber da war noch etwas. Warum wurde jemand gezwungen, solche Schmerzen in seinem eigenen Körper zu erzeugen und dann noch mit Absicht und dann noch mit bester Absicht? Von da an wußte Rolf Büttner, daß auch mit ihm etwas nicht stimmen konnte, wie auch immer er in die Sache verwickelt war. Kein Jesus konnte nun mehr helfen, denn Büttner wußte nicht, was genau er zu bereuen hatte. Es mußte einen umgekehrten Messias geben, keinen, der für andere das Kreuz trug, sondern einen, der sich an Rolfs Stelle gefreut hat, um dessen Leben einen Sinn zu geben.
Der war jetzt nicht da, auch wenn es, alles in allem, eine wohltuende Stille war, die sich ausgebreitet hatte, wenn auch eine, die Büttner selbstverständlich nicht genießen konnte. Wenn sich andere allerdings freuten, etwa die Kinder der Nachbarn, wenn sie eine Zwei heimgebracht hatten, dann verstärkte das nur noch sein Leiden. Ständig wurde er mit diesen Leuten verglichen, als ob ihm nicht nur seine eigenen Fehler vorgehalten werden sollten, sondern ebenso das, was andere richtig gemacht hatten, wofür er nun bei allem Verständnis nichts konnte. Dabei dienten gerade die Kinder immer als ein umgekehrter Messias. Die Eltern und schon gar die Großeltern hatten immer wieder gesagt, daß es ihnen gut ginge, wenn es nur ihren Kindern gut ginge. Doch Rolf Büttner erging es nicht gut, da half auch nicht, daß ihm die Vorwürfe mit guter Absicht verabreicht wurden oder daß sie absurd waren oder daß sie am Ende nie da waren, weil sie noch nicht einmal in der Vorstellung wirklich existierten und keiner sie im Nachhinein gemacht haben wollte. Das mit den Schlägen war ein Mechanismus. Sie folgten einem physikalischen Gesetz, so wie alles einem solchen physikalischen Gesetz folgte. Sie waren nicht der Wille eines Einzelnen. Das wurde schon deshalb deutlich, weil ständig gepredigt worden war, man würde das alles nicht gerne tun, ungern tun, ja man würde es hassen. Auch der gewitzte Clown aus der Schule, der immer alles wußte, konnte da nichts ausrichten, die Schläge hatten einen ausschließlich physikalischen Charakter, selbst wenn sie auf die Psyche wirken mochten, folgten sie den natürlichen Gesetzen der Physik.
Und selbst die Psyche als solche, wenn es sie überhaupt als solche gegeben hatte, war nur diesen natürlichen Gesetzen unterworfen, niemals konnte die Rechnung ohne das Banale gemacht werden, das am Schluß darüber entschied, ob etwas existierte oder nicht, ja es schien geradezu darüber zu richten, so viele Argumente konnte es vertreten. Wenn einem Techniker eine Maschine um die Ohren flog, dann dachte diese Maschine nicht lange darüber nach, sie flog einfach, und genügend passende Argumente dafür würden sich danach immer noch finden. So oder so waren diese Argumente, zu allem Überfluß, schon immer da gewesen, sie durften nur vorher nicht in Erscheinung treten. Wenn alles Wissen immer da wäre, das wäre nicht zu ertragen. Noch schlimmer wäre allerdings, wenn alles Gedachte oder Gewünschte sich auf der Stelle wie von selbst realisieren würde, auch wenn das schön klingt, aber man könnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil sich jede Viertelsekunde, mit jedem neuen Gedanken, die ganze Welt ändern würde. Das wäre natürlich etwas gewesen, wenn Büttner sich ein Paradies herbeiwünschen könnte. Wahrscheinlich war das sogar möglich, man mußte nur etwas länger daran denken, als eine Viertelsekunde, vielleicht zehn Jahre, und wenn man älter war, vielleicht dreißig Jahre.
Während seiner Pubertät hatte Rolf Büttner die Bodenhaftung verloren, er dachte nur noch daran, was in seinem Alter alles möglich war. Aber er hatte auch gar keine andere Möglichkeit, als sie zu verlieren, schließlich war auch das nur reine Physik. Er hatte nun längst Unterricht in Chemie, doch von nah betrachtet war diese auch nichts anderes als die Physik oder die Mathematik, denn es gab keine Chemie, die der Mathematik Vorschriften machte und so weiter. Der Mathematikunterricht setzte sich ohne Einschränkungen fort, als hätte es nie eine Chemie gegeben. Büttner dachte jetzt nur noch an seine Zukunft, wenn auch in anderer Weise als seine Eltern an seine Zukunft gedacht hatten. Wenn er in der Zukunft war, dann war er von der Gegenwart entrückt, ja seine Zukunft schien dann schon jetzt da zu sein. Diese Zukunft drückte auf das Jetzt wie ein wuchernder Tumor auf das Gehirn drückt. Die Zukunft hatte die Gegenwart geradezu erobert, da war nichts mehr zu machen. Zudem war Rolf Büttner von der Sorte, die sich ohne Mühe auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren konnten, was ihn in der Schule aber ebenso behinderte wie die Zukunft. Wenn er sich auf zwei Dinge konzentrierte, erhielten seine Handlungen und Worte etwas Irres, als ob alles von ihm Gesagte richtig sei, er jedoch, als der Sprechende, nicht wirklich da wäre. Er funktionierte plötzlich. Er funktionierte, bis ihm die Maschine um die Ohren flog, ja das Funktionieren war ihm zur Besessenheit geworden, sogar seine Herzenswünsche funktionierten. Was waren das schon für zwei Dinge, die er mit Perfektion gleichzeitig durchführte? Nun gut, er tat das was er sollte, die ewige Schule, und das was er wollte, die Vorbereitung auf eine Zukunft als genialer Zeichner, Philosoph, der seinem kargen Leben mit Gewalt einen Sinn abringen wollte, ein Gramm Gold auf hundert Felsen. Ständig tat er sich in dem Unterricht hervor, spielte das Kind vom Nachbarn, das so gut war, nur um am Ende heimlich die Zeichnungen und Pläne weiter auszuarbeiten, die er unter den Schulbüchern versteckt hielt. Später dann hatte er gar nichts mehr versteckt, denn daß er beides gleichzeitig betrieb, sollte nur seine Genialität sichtbar machen. Dabei war das Ganze nicht viel mehr als das Stricken einer älteren Frau vor dem Fernseher, der die Nachrichten sendete. Zwei Dinge auf einmal. Gut. Was Rolf Büttner nicht wußte: er konnte nicht eigentlich zwei Dinge gleichzeitig, sondern zwei Leben. Das Sollen und das Wollen. Er wußte keine andere Befreiung aus dieser Situation, denn das eine schien ohne das andere nicht zu funktionieren. Eigentlich funktionierte gar nichts. Seine Eltern mußten ihn nun bremsen, was er zuvor zu wenig getan hatte, das war plötzlich zu viel geworden. Er wollte nur noch Spitzenreiter sein, ängstlich angesichts der Vorstellung, mit seinem Bündel von Herzenswünschen vollständig in der Bedeutungslosigkeit versinken zu müssen. Er war so oder so schon nicht mehr da gewesen, irgendwo in der Zukunft verschwunden.
Doch dann kam das vorläufige Ende. In der Psychiatrischen Anstalt wußte er schon gar nicht mehr, wo er war, auf seinem Bettlaken stand es drauf, er las es, wußte wieder, wo er war, wo man ihn soeben hingebracht hatte. Obwohl ihm diese Banalität, zugegeben, eine Stütze werden sollte, verstand er nicht ganz den Sinn. Hatte er doch schon über längere Zeit keinen Ausweg mehr gesehen, als nun selbst der Messias sein zu müssen, der ihm immer gefehlt hatte, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Teufel oder Messias, Tod oder Leben, Hölle oder Paradies, es ging nur eines, er hatte sich entscheiden müssen. Aber nicht zwischen zwei Dingen, die er wollte, sondern höchstens zwischen zwei Wahrnehmungen. Also konnte ihn nur eine der beiden Wahrnehmungen retten: der Messias. Und er setzte alles daran, dieser Wahrnehmung zu folgen. Sie war jetzt seine einzige Chance, sich vor sich, vor den eigenen Vorstellungen zu schützen. Immer wenn Büttner von seinen Wünschen erzählte, wurde er zusammen mit diesen Wünschen in das Reich der Phantasie gerückt, allein schon weil es Wünsche waren, Träume, die von sich aus schon unwirklich sein mußten. Man hatte sich von ihm immer eine physikalische Funktion erhofft, eine wie die Funktion des Stockes auf seinem Hintern, banal, aber um so eher überzeugend. Allein schon das Nachdenken über diese Realität war verboten. Realität war überhaupt etwas gewesen, über das man nicht nachdachte, sonst wäre es ja über die längste Zeit eine Realität gewesen. Gleichzeitig war immer zu hören, das alles sei, damit etwas aus dir wird! Offensichtlich existierte man noch nicht einmal körperlich oder auf ähnlich banale Weise. Wie furchtbar war nur dieses Sein und dieses Haben, wohin nur mit den Empfindungen, die ja doch immer da waren. Nun gut, man hatte sie selbst zu verantworten, wie es immer hieß, man war seines Glückes Schmied, auch wenn es kein Glück zum Schmieden gab, der Schmied war immer da. Was, wenn dieses Selbst, dieser Schmied, nicht mehr da war, nur noch ein Ich ohne jeden Schutz, ohne sich selbst, einfach nur dieses Ich? Dann war das Ich das Schlimmste. Der Teufel. Der arme Teufel. In der Psychiatrischen Anstalt hatte man jedem mehr oder weniger das Haldol gegeben, ein Neuroleptikum, das im Stande war, einem sein Selbst wiederzugeben und den Zustand des rein körperlichen Umherlaufens zu beenden. Diese Substanz war nichts anderes als die chemische Reaktion auf bestimmte Vorgänge in der Seele. Der Körper verlangte so sehr nach diesem Mittel, daß es geradezu erfunden, zumindest entdeckt, werden mußte. Physikalisch wäre der bessere Ausdruck dafür. Man wunderte sich immer wieder über die Austauschbarkeit dieses Stoffes. Ob man es aus der einen oder aus der anderen Flasche nahm, es blieb immer Haldol. Waren denn die Seelen auch so austauschbar? Ob man sie aus dem einen oder dem anderen Körper nahm, es war immer die Seele?
Aber warum darüber verzweifeln, wenn es ohnehin keine Seele gab. Eine Seele war auch nichts anderes als der Traum oder der Wunsch. Gerade der Wunsch zeigte, daß er seinem Wesen nach nur eine Negativform sein konnte, die innen hohl war und die danach verlangte, erfüllt zu werden, um sogleich wieder zu vergehen. Der berühmte Chirurg, der bei seiner Arbeit nie eine Seele gefunden hatte, war da aus einem anderen Holz geschnitzt, und das Haldol selbstverständlich auch. Das Haldol, im Gegensatz zum Chirurgen, der auch nur ein Mensch ist, bietet gleich eine ganze Kette von Molekülen, sogar aus Ringen, ohne die es kein Haldol ist. Sicher, auch der menschliche Körper besteht aus allerlei Substanzen, aber sie machen ihn nicht aus. Wenn man sich beispielsweise einen Arm abtrennt, lebt man weiter wie zuvor, den menschlichen Körper gibt es praktisch gar nicht. Das Haldol dagegen, wenn es Haldol ist, bleibt authentisch. Im Chemieunterricht hatte man derartige Strukturformeln betrachten können. Man hatte sich allgemein immer gefragt, wozu Gott diese originellen Gebilde geschaffen hatte, selbst wenn man diese Originalität aus der Natur schon kannte und selbst wenn man in diesem Alter allgemein nicht an Gott glaubte. Aber es fiel einem keine andere Frage ein, um seiner Ratlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Büttner hingegen hatte das weniger beeindruckt, zu sehr war er in seiner eigenen Welt versunken, um noch irgendetwas anzuerkennen. Er selbst war schon das Haldol, wie er dachte. Sein Inneres zwang das Haldol, zu ihm zu kommen, ja überhaupt erst zu entstehen. Nicht die Nägel machten Löcher in die Hände des Messias, sondern die künftigen Löcher in ihnen hatten die Nägel angezogen.
Rolf Büttner, der Messias, der nicht wußte, wohin mit sich, hatte schon so viel Ich um seine Mitte gesammelt, daß es unerträglich wurde. Denn nichts konnte mehr an ihn heran außer jener chemischen Substanz, deren Ringe seine Klassenkameraden so bewundert hatten. Dabei beinhaltete das Haldol nur eine Idee und sonst gar nichts. Das war die Idee, trotz allem Vorhergehenden, in Betracht zu ziehen, nun doch nicht der Messias zu sein. Denn wenn man es wäre, dann wäre man es doch auch! Wenn vier und zwei sechs wäre, dann wäre es das doch auch! Aber da war nichts. Nicht einmal ein paar Löcher in Händen oder Füßen. Ganz zu schweigen von einer Aura oder von jeder erdenklichen Flugfähigkeit. Nicht einmal diese banalen Dinge konnten aufgewiesen werden, und wie dann erst etwas tatsächlich Authentisches, das man sich nicht selbst hätte zufügen können? Das war die Idee, die in der Substanz steckte, die ihre Entwickler Haldol nannten. Das kam von Haloperidol, einer Kette von Zufällen, die dieses Molekül gebildet hatte. Selbst wenn vier und zwei zwei und vier wäre, dann wäre es das auch! Büttner wurde klar: er hatte das Haldol bekommen, und jetzt stand er vor der Idee, wieder der alte sein zu können, ohne weitere Ideen, ohne die ewige Suche nach Auswegen. Wieder das Kind zu sein, das er wenige Jahre vor seiner Einschulung noch gewesen war, nein, vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres möglicherweise. Nichts mußte er da anerkennen, um es wahrzunehmen. Und nichts mußte er denken, um schließlich einen Gedanken zu fassen, nichts vorher erst wünschen, um sich daran erfreuen zu können. Doch die Idee des Haldol hatte über die Wochen auch alles andere aus seinem Kopf gefegt, der nun leer war. Er war kaum anders zu beschreiben als mit dem Wörtchen leer, denn es waren keine Gedanken darin zu finden. Nun gut, sicherlich dachte der Mensch immer an etwas, aber es waren da eben noch keine Gedanken, keine Ideen, eher Anleitungen, etwas zu tun, sinnlose, aber spontane Bewegungen auszuführen. Die Gedanken, die vorher da waren, hatten eher jede Bewegung verhindert, alles kritisiert bevor es da war. Doch die Schule war noch nicht fertig. Als Büttner dort wieder auftauchte, wollte seine innere Leere doch recht gut passen zu der Banalität des Unterrichts. Das Ganze wurde um so mehr um seinen Sinn gebracht, je deutlicher wurde, daß er seiner langen Erkrankung wegen das jetzige Jahr ohnehin wiederholen müßte. Der ganze Unterricht, in dem er momentan saß, war zu allem Überfluß jetzt auch noch ungültig geworden. Das war wie in der Grundschule, wo man denken konnte, der Katholische Religionsunterricht sei ungültig, sofern man evangelisch war.
Die Ungültigkeit und die Vergeblichkeit des Lebens hatte Büttner zu früh getroffen. Er konnte noch nichts damit anfangen. Die Vergeblichkeit hatte allerdings für ihn immer ein Leitmotiv besessen, und das war die Erlangung der Reife, des Abiturs, wie sie offiziell genannt wurde. Mit dieser Reife sollte alles Bisherige hinfällig und jeder falsche Sinn sinnlos werden. Sie war das Stadium, in dem einem alle Wege offenstehen sollten, wenn man offiziellen Quellen glauben wollte oder mußte. Natürlich, dieses Stadium sollte sich nur über einen winzigen Zeitraum erstrecken, wenn es überhaupt spürbar sein sollte, aber das wußte Büttner damals noch nicht so genau. Dann sollte ihn seine eigene Berufswahl in neue Zwänge hineinbringen, wo man als Kind doch immer mit einigermaßen hohem Selbstbewußtsein hätte sagen können: man zwingt mich eben! Als Rechtfertigung für alles: man zwingt mich eben! Gut, man war damals noch nicht so selbstbewußt. Das Selbstbewußtsein reichte gerade aus, um sich selbst fertig zu machen, in Grübeleien zu versinken, aber nicht um zuzugeben: man hat mich gezwungen. Es war einem unangenehm, gezwungen zu werden und das zuzugeben, doch wie sehr würde man sich das noch zurückwünschen. Äußere wie innere Zwänge beherrschen das Leben bereits seit der ersten Bewegung. Alles ist mathematisch vorbestimmt, von den anderen Wissenschaften ganz zu schweigen. Aber ein Kind braucht Eltern. Etwas Konkretes, auf das es diese Vorbestimmung schieben kann, etwas und jemanden, das und der es zwingt, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Ohne Eltern konnte es kein Kind geben, vielleicht für ein paar Tage, aber nicht länger.
Und das alles obwohl Büttners Mutter ihm immer eingeredet hatte, daß es ihn nicht gab. Das hätte sie ganz selbstverständlich nie so gesagt, obwohl sie ständig davon sprach, daß es dieses oder jenes nicht gab, gerade wenn es um Wünsche ging. Wünsche waren nicht da, um eine Realität einzuleiten, wozu auch eine neue Realität, wenn man schon genug von der alten hatte. Wieviel wollte man denn noch davon, die vorhandene bot doch genug Schwierigkeiten. Wenn alle Wünsche sofort automatisch erfüllt würden, dann könnte man das auch ganz leicht erkennen. Diesen letzten Satz konnte jedoch selbst die gute Frau Büttner nicht wissen. Er setzte zu viel Phantasie voraus, aber sie konnte ihren Sohn mit ihren Worten, zumindest theoretisch, auf den richtigen Weg bringen. Und Worte waren ja nur Theorie, und was der gute Sohn daraus machte, war allein seine Sache. Wünsche gab es überhaupt nur, wenn sie aus der Praxis kamen, wie der Vater sagte, und in diesem Moment hießen sie dann auch nicht mehr Wünsche, sondern irgendwie anders. Meinetwegen hießen sie dann Fehler, weil einem dabei etwas fehlte oder schlicht Irrtümer oder das, von dem man etwas dachte oder etwas ähnlich Unsinniges, das heißen konnte wie es wollte, weil es eh nicht mehr da war und auch nie dagewesen ist. Realität konnte nur erzeugt werden, wenn man ganz und gar sachlich blieb. Die gewünschte Realität war nicht die Realität der Träume. Sie war sozusagen vielmehr die Realität der Realität. Dennoch wußte jeder in der Nachbarschaft und überall, daß man diesen Satz so nicht sprechen konnte, weil er kein Satz war. Unsinnig war er deswegen noch lange nicht. Wieviele Sätze waren grammatisch korrekt und doch ohne jeden Sinn gewesen! Realität war Realität, mit oder ohne diesen Satz. Wenn auch einem Rolf Büttner das Gleichzeichen fehlte, so wie ihm in der Grundschule das Plus gefehlt hatte, diesem verrückten Hund. Wenn nun einmal die Mathematik die Mathematik war, dann mußte man sie auch mathematisch behandeln. Selbst einfachste Sätze wie dieser wollten dem verrückten Hund nicht so recht in den Kopf gehen. Wo er doch sonst für jeden Unsinn offen zu sein schien. Das machte Büttner zu einem Rätsel, wenn auch nicht zu einem logischen. Man hatte es eher mit einem Rätsel zu tun, vor dem Eltern und Großeltern stehen konnten, ohne es lösen zu wollen, um nicht selbst in dieses Rätsel hineingezogen zu werden, ohne jemandem dabei helfen zu können. Daß es sie genau so wenig geben sollte wie ihn, war ihnen eine furchtbare Vorstellung, ja sie konnten es sich noch nicht einmal vorstellen, wenn nicht gerade Rolf leibhaftig vor ihnen stand.
Diese seltsame Art der Leibhaftigkeit ist ihm immer angedichtet worden. Er war einer, der das Unmögliche verkörperte. Er konnte es nur verkörpern, denn möglich machen konnte er es ja nicht. Und dieser ganze Irrsinn konnte, wie seine Eltern meinten, nur dadurch geschehen, daß er sich selbst unsinnigerweise weh tat. Da war der Unsinn eines Schmerzes, der zu nichts führte. Normalerweise hatte der Schmerz immer zu etwas geführt, aus Schaden wurde man klug und so weiter. Rolf Büttners Schmerz jedoch erschien als vollkommen unsinnig. Er war völlig lächerlich und kaum mehr existent gewesen als Büttner selbst. Aber jetzt hatte er seine Reife, und es ging buchstäblich um seine Existenz. Die anderen aus seiner Klasse hatten indes schon zuvor existiert. Selbst die Schlechtesten unter ihnen hatten noch funktioniert und der Realität immerhin mit Realität begegnen können. Gott war dabei gewesen, sie in das Buch des Lebens zu schreiben, auch wenn niemand eine Ahnung davon hatte, was das nun schon wieder bedeuten konnte, Gott war eben ein Mysterium, weswegen es ja auch Theologiestudium hieß. Jede Art verschrobenen Denkens würde überhaupt jetzt gutgeheißen, solange sie einen Universitätsabschluß oder Geld hervorbrachte. Mit dem eigenen verschrobenen Denken hatte man hingegen meistens weniger gute Erfahrungen gemacht. Wie auch immer, es hatte die Zeit der großen Universitäten begonnen, von der kaum einer des Jahrgangs unberührt blieb. Allein die unglaubliche Liste der angebotenen Fächer mußte jedes weitere Denken ins Absurde führen. Man konnte doch immer nur eine Sache denken, und jetzt diese Fächer alle auf einen Blick! Wie sollte das funktionieren! Jedes weitere Denken konnte keine Klarheit bringen, nur zeigen, was man alles gerade nicht mehr denken konnte, weil es schlichtweg zu viel war. Selbst der Professor, der alles im Kopf hatte, konnte da nicht mehr funktionieren, das würden selbst die Büttners glauben, wenn sie diese Liste denn einmal angesehen hätten. Dabei war an der Universität alles logisch gewesen, zumindest auf den ersten Blick. Und dazu alles schön in Fächern geordnet. Das eine hätte das andere ergeben müssen. Da war nichts Leibhaftiges. Nichts was es nicht gab oder so. Doch was immer Herr Rolf Büttner studieren würde, so hatte er eines erlebt: die letzte Antwort auf jede Frage, wenn es sie gegeben hätte, wäre die Strukturformel von Haloperidol gewesen oder zumindest von einer ähnlichen Medizin, und banaler und klarer konnte nichts je werden. Büttner studierte denn auch mehrere dieser Fächer, wie das üblich war, welche genau, das tat nichts weiter zur Sache. Er begegnete seinen ehemaligen Kameraden, aus der einen wie aus der anderen Schulklasse, und jede der Begegnungen war wie ein Heimkommen zu einer Familie früherer Tage. Jetzt nochmal in der ersten Klasse sein, mit dem Wissen von heute, wie hätte man da dieses Wissen anerkannt, selbst wenn keiner es verstanden hätte! Allein schon die mathematischen Formeln, die man im Kopf hatte und sie sogar anwenden konnte! Wie wäre man in einen unwirklichen Himmel hinein gelobt worden, wie viele Klassen hätte man überspringen können als Wunderkind! Noch einmal zurück in die erste! Nur diese kleine zeitliche Korrektur, die durch das Überspringen der Klassen ohnehin schnell wieder ausgeglichen wäre! Die Menschen wären bei einem, man wäre nicht allein mit dem ganzen Ballast. Aber das war jetzt zu spät. Die Reife war da, und der riesige Universitätscampus hatte sich vor ihm ausgebreitet. Zunächst war vollkommen egal, wohin er ging. Er würde schon zurechtkommen, wenn er erst zu einem Anfang gefunden hätte. Diese Art der Gleichgültigkeit machte das Gelände zu einem einzigartigen Raum, in dem man sich einerseits frei bewegen konnte, andererseits aber nur einem gewissen, aber noch unsichtbaren Schicksal zu folgen hatte.
Büttner erinnerte sich genau daran, wie er bei einem Psychiater vorstellig wurde, der ihn über alles gelobt hatte, wie gut und wie treffend er seinen Krankheitszustand beschreiben konnte, ja diesem Zustand sogar beikommen konnte, wenn auch nur in der Theorie. Allerdings erhielt er statt einer guten Zensur lediglich das was alle bekommen hatten, und das war Haldol oder eine ähnliche Medizin. Das mit der guten Zensur hatte er sich natürlich nicht selbst ausgedacht, es war ihm allenfalls zufällig eingefallen, er hatte natürlich danach getrachtet, die Krankheit endlich beim Schopf packen zu können, sie mit einem Wort oder mindestens mit wenigen Worten zu beschreiben und gleichzeitig ungültig zu machen. Hatte nicht Jesus persönlich nur ein Wort gesprochen und die Seele gesund gemacht? Und hatte nicht er auch gesagt, daß wir größere Wunder vollbringen könnten als er? Doch Büttner war nicht einmal gelungen, eine banale Formel wie die des Haldol zu finden. Auf dem Wege der Geisteswissenschaften hätte das ebenso möglich sein müssen wie auf dem Weg der Chemie, jedenfalls wenn man die Fächer nicht ganz so ordentlich einteilte, nicht ganz so kleingeistig und unsinnig, aber das Haldol war erfunden, es war zu spät. Überhaupt würde man irgendwann vor der Weggabelung stehen, entweder weiter zu forschen, ob man selbst etwas erfinden konnte oder diese Erfindung irgendwann bei einem anderen finden zu wollen. Eigentlich gab es so gut wie nichts Neues, dafür war das Universum zu groß geworden, es war längst zu spät, man könnte vielleicht noch über das Universum forschen, aber dieser Bereich interessierte Büttner nun gar nicht. Der Name Universität erinnerte schon ein wenig an das Universum, wie auch immer man es betrachten mochte. Allein dieser Name oder dieser Titel lohnte ein näheres Hinsehen. Es hatte freilich mit der langen Liste an Fächern zu tun, die gerade dort endete, wo sie von neuem zu beginnen schien, denn selbst ein Professor oder gar eine Kraft der Verwaltung beherrschte diese Liste kaum auswendig. Allein dieses Wort Universität hatte alles schon für sich, wie auch das Haldol seine Wirkung schon für sich hatte, ohne einer Theorie zu bedürfen. Das hieß noch lange nicht, daß es eine derartige Theorie nicht gab, und vielleicht hatte sogar Büttner selbst sie im Sprechzimmer seines Psychiaters gefunden, aber beim Haldol zählte einzig die Wirkung und nicht der Rechenweg, wie sein alter Lehrer es genannt hätte. Der verrückte mit seinem Rechenweg. Er hatte die Kinder wirklich verrückt gemacht. War der überhaupt noch am leben? Hatte er nur sein Wissen mit ins Grab genommen oder zu einem großen Teil auch dessen Gültigkeit! Der guten Frau Büttner war so etwas egal. Die Noten auf den Zeugnissen änderten sich nicht dadurch, daß ein alter Lehrer starb. Wäre er doch gestorben, bevor er einen mit seinem Rechenweg verrückt gemacht hatte, durch eine kleine Zeitverschiebung. Wenn er früher geboren wäre, hätte das alles schon wieder ausgeglichen, aber es war zu spät.
Rolf Büttner studierte für einige Semester, gelangte zu dieser oder jener Erkenntnis, keine war so überzeugend wie das Haldol, und machte am guten Ende einen Abschluß, der dem der Reife täuschend ähnelte. Diesesmal wußte er wenigstens einige Dinge, die er künftig nicht machen wollte, so schlau war er immerhin geworden, aber ein Haldol, also etwas, was es war, hatte er nicht in Sicht. Außer, daß er endgültig wußte, das Haldol oder etwas ähnliches wohl zeit seines Lebens einnehmen zu müssen. Auch war ihm endlich egal geworden, wer dieses Haldol erfunden hatte. Hauptsache, es wirkte. Es wurde 1958 von einem Bert Hermans synthetisch hergestellt, wie er inzwischen herausbekommen hatte, und es war wirklich vollkommen egal. Er, Büttner, der Leibhaftige, trug die Struktur des Haldols in sich, in seinem Leib, und es gab nichts, das wirkungsstärker hätte sein können. Was wäre das Medikament ohne den Leib, und was wäre Christus ohne den Leib! Seine Wunder konnte praktisch jeder erzeugen, die waren jetzt nicht so wichtig. Was hatte die Mutter, die Büttner in ihrer Abwesenheit, wenn er ganz allein war, scherzhaft die Mutter Gottes nannte, über den Leibhaftigen gesagt? Büttner würde sich geradezu benehmen wie er? Geradezu aussehen wie er? Oder elend aussehen wie Christus? Er, Büttner, sei eine Strafe Gottes für sie gewesen? Wenn er eine Strafe für seine Mutter war, dann war das die größte Anerkennung. Die Mutter erkannte damit seine Schuld als die ihre an, wenn auch nur äußerlich, aber Büttner hatte das viel zu spät erkannt. Er hatte lange nicht erkannt, welche Freiheit diese Äußerlichkeit ihm die ganze Zeit über verliehen hatte. Er hätte niemanden an sich heranlassen müssen. Nichts wäre ihm geschehen. Das war nur zu vergleichen mit der Wirkung des Haldol, die galt, ohne daß der Empfänger dieser Medizin daran glauben mußte, ja selbst ohne daß er deren chemische Formel kennen mußte. Er mußte nicht einmal wissen, daß es Medizin war, so groß war die Gnade. Als Büttner zum erstenmal diese Medizin empfing, hatte er geglaubt, vor Gott persönlich zu stehen, in der Tat, der Psychiater hatte einen langen Bart, der auch noch viel später durchaus seinen Bestand haben sollte. Er hatte geglaubt, die heilige Kommunion zu empfangen, sein eigenes Blut zu trinken, Jesus Christus zu sein, damit eine Identität zu verfolgen, die die einzige und die letzte Antwort war auf den Satz „Ich bin der Teufel“. Das war nicht die letzte Antwort auf eine Frage, sondern auf eine Aussage, auf eine Feststellung, da mußte man fest bleiben. Jede Abweichung hätte da jeden Selbstmord überflüssig gemacht.
In dem Becher war aber nicht Büttners eigenes Blut, Gott sei Dank, es war das Haldol. Nur das Haldol, kein Blut, kein Leib, noch sonst etwas. Der Messias, wenn er denn noch in Büttners Leib war, hatte ganz anders gewirkt. Das Haldol war, wenn er ehrlich war, das allererste, das er tatsächlich zu Christi Gedächtnis getrunken hatte, kein Wein, kein Traubensaft, nichts anderes. Und es sei ihm verzeihen, daß er bei Christus an sich selbst gedacht hat, denn wer tat das eigentlich nicht! Er dachte wirklich nur an sich selbst. Keine Kirche, kein Priester, keine Gemeinde, kein Wissender und auch kein Gläubiger, wie ihn sich eine gutbürgerliche Gemeinde nur vorstellen konnte. Eigentlich gar nichts, wie Frau Büttner es genannt hätte. Und doch war Jesus Christus mitten unter ihnen: da war der Arzt, da war Büttner, und da war Christus. Dann gab es noch einen Pfleger, der Büttner abgeführt hatte wie einen Verbrecher und von dem dieser deshalb glaubte, er müsse der Teufel sein, aber dieser Pfleger gehörte ebensowenig dazu wie die Blumenvase oder die besorgten Eltern im Hintergrund der Szene. Es konnten doch nicht alle dazugehören. Was war denn mit den anderen Menschen der Welt, möglicherweise von außerhalb der dicken Mauern, sollten sie alle dazugehören? Büttner war alleine mit seiner Szene. Nur er konnte wissen, was jetzt dazugehörte. Er hatte die Autorität. Wenig später schon die Erleuchtung: Er war ein normaler Mensch. Das war keine Erleuchtung, eher eine Verdunkelung. Jesus hatte sein Kreuz nicht getragen, damit es der Mensch nicht mehr tragen mußte. Er hatte es zu uns Menschen getragen. Büttner saß in der Falle. Er wußte das zuerst nicht und dachte, wenn er dem Arzt seinen bürgerlichen Namen sagte, anstatt Andeutungen bezüglich Jesus von Nazareth zu machen, könnte er die Klinik schnell wieder verlassen. Es dauerte auch gar nicht lange, bis er wieder nach diesen Lappalien gefragt wurde: Wie heißen? Wann geboren? Büttner, zuvor noch davon genervt, gab bereitwillig Auskunft. Nie war er so banal in seinem Denken wie jetzt, er wollte einfach heraus aus dieser Klinik, dieser Psychiatrie, deren Bezeichnung er noch nicht kannte, sie war ihm immer als die Irrenanstalt beschrieben worden. Doch es war zu spät. Der Arzt nickte wohl anerkennend, machte allerdings keine Anstalten, ihn in irgend einer Form zu entlassen, im Gegenteil, er tat einfach, als ob nichts wäre, wie eine Person, die einem ein ungültiges Zeugnis aushändigte. Büttner kam auch nicht auf den Gedanken, nach einem Entlassungstermin zu fragen. Erst am nächsten Tag, als seine Eltern plötzlich wieder vor ihm standen, als hätte jemand zeitlich etwas korrigiert, erfuhr er von diesen, sie hätten mit dem Arzt gesprochen, und er hätte gesagt, das Haldol wirke zwar, aber es sei gefährlich, es zu plötzlich wieder sein zu lassen. Als Büttner den Arzt endlich fragte, wie lange er denn nun bleiben müßte, war die Antwort Ein paar Wochen. Das war ja nun recht schön, aber er wußte noch nicht, wie sich ein paar Wochen mathematisch auswirken konnten. Außerdem waren jetzt die Nebenwirkungen des Haldol aufgetreten, er konnte kaum noch denken, kaum noch sein, nicht wegen eines süßen Schlafes, sondern wegen der Hölle. Es war wirklich die Hölle, die er da sah, und diese Version der Wahrheit hatte noch über Jahrzehnte Bestand. Büttner befand sich in einer Wirklichkeit, in der kaum noch etwas war, aber es war auch kein Nichts da, sondern ein Leiden, von dem man nicht spürte, woher es gekommen sein mochte. Der ganze Kopf schien sich zu verkrampfen. Irgendwann wurde es besser, wann, wußte er später nicht mehr. Aus den Wochen wurden Monate. Christus hatte gewirkt, aber auch deutlich gemacht, nicht bis auf die Geschlossene gekommen zu sein, auch wenn Büttner immer versuchte, sich das einzureden. Jesus hingegen, wer immer das war, benahm sich eher wie einer, der so oder so überall war und deshalb keinen persönlichen Besuch anstrengen müßte. Das war nur Erinnerung, es mußte nicht hundertprozentig stimmen, eine andere Erinnerung hatte man nicht.
Büttner stand also vor der Universität, wußte nicht recht, wie es weiterging, er wollte es auch nicht mehr so dringend wissen, er war nicht mehr in der Psychose, in der man ihm jede Bewegung sagen mußte oder in der er von vorne herein unsinnige Bewegungen machen mußte. Und wer mochte der Erzähler sein, der in Büttners Kopf war und ihm alles erklärte? Der schon in der Grundschule immer bei ihm war. Es war niemand. Nur, daß sich alles von selbst erklärte, sobald es zu spät war. Der Mensch war so geschaffen, daß er immer alles hinterher wußte. Bloß in seltenen Fällen wußte er vorher schon etwas. In einigen Augen war das nicht Wissen, sondern Zufall. Wenn man den Zufall vorhersagen konnte, das war schon eine feine Sache. Heilige trieben so etwas bis zum Äußersten. Sie durften den Betroffenen oft nicht einmal davon erzählen, weil es ihnen hätte schaden können. Ansonsten war der Mensch eher darauf ausgelegt, immer zu spät zu sein. Die Heiligen konnten einiges mehr, praktische Dinge und durchaus auch Dinge, die Frau Büttner für unsinnig, ja für schädlich gehalten hätte. An zwei Orten gleichzeitig sein, mehrere parallele Leben führen, Regenwürmer retten, alle diese Sachen. Rolf Büttner bewunderte an diesen Heiligen meistens ihre Art, zu tun, als ob nichts wäre, obwohl viele von ihnen doch von ihrem Heiligsein lebten. Es gab Bücher über sie und Zeitungsartikel, und wenn einer sie persönlich traf, taten sie, als ob sie körperlich gar nicht da wären, man sah nur einen vollkommen normalen Körper, den man allenfalls an dessen vollkommener Unauffälligkeit als den eines Heiligen erkannte. Gerade Menschen wie Frau Büttner, die an Heilige immer nur theoretisch, allenfalls auf religiöse Art, geglaubt hatten, vertrauten diesen Heiligen auf eine erstaunlich unvoreingenommene Weise, wenn es an wichtiger Stelle um die Wiederherstellung des Normalen ging. Das konnte eine schwere Krankheit betreffen, aber auch nur die Wahrnehmung einer Krankheit oder die Schwierigkeit, mit der man eine solche Krankheit zu tragen hatte. Wo immer man eine übernatürliche Normalisierung zu erwarten hatte, sollten Heilige mit im Spiel sein. Für den jungen Büttner war das, was er erlebt hatte, eine Krankheit gewesen, zu viel Leid hatte sie ihm gebracht. Und er war dankbar für seine Diagnose, die alles so normal erscheinen ließ, als würde es für alles eine Schublade geben, gegen das kein Kraut gewachsen war. Auch Frau Büttner sah die seltsamen Zustände als eine Krankheit an, schon wegen des seltsamen Verhaltens ihres Sohnes, aber auch und vor allem, weil eine Krankheit etwas war, gegen das man doch kämpfen konnte. Die äußerlich erkennbare Aufgabe eines Heiligen war selbstverständlich die Beseitigung der Krankheit, sobald ein Betroffener ihn aufsuchte. Das funktionierte meistens auch recht gut, wenn es ein echter Heiliger war. Die Krankheit war dann von jeden Symptomen befreit, als ob man den armen Patienten gereinigt hätte. Er war jetzt ein ganz anderer als der Kranke, der er noch vor wenigen Wochen gewesen ist.
Das Kreuz hingegen, das zu tragen war, konnte einem auch der Heilige nicht abnehmen. Wenn der Heilige stigmatisiert war, waren seine Wundmale dann die Symptome einer Krankheit oder war er nur besonders gesund, besonders vital, sprudelnd von frischem Blut? Oder war alles am Ende nur inszeniert, von jemandem, der schon vorher alles wußte? Die Hauptsache schien immer darin zu bestehen, daß der Heilige seinen Patienten heilte. Wie, das war vollkommen egal, mit dem Patienten mochte geschehen, was wollte. Wenn anschließend wieder Normalität hergestellt war, mußte man ihn nicht einmal fragen, wie es ihm gehe, denn wenn alles normal war, wieso dann noch fragen? Wenn der Patient doch blühend ausgesehen hatte, mit roten Wangen und so weiter, warum ihn noch mit einer solchen Frage beleidigen! Ja wenn alles normal war, durfte der Patient sogar weiter krank sein, es war gewissermaßen seine Privatsache, wie krank er nach der Behandlung noch sein wollte, solange die nur erfolgreich war. Die Wundmale der Heiligen, sicher waren das Krankheiten, wenn man sie als solche ansah, und wenn man sie als Wunder ansah, waren sie halt Wunder, das sagte beides schon das Wort Wunde. Überhaupt war wichtig, was das Wort sagte und nicht, was jemand anderer sagte, es sei denn, dieser jemand war selbst ein Heiliger oder sonst etwas. Als Rolf Büttner mit seiner Mutter von dem Heiligen kam, den er damals über alles verehrte, damals, als er gerade die Reife hatte, sprachen die Nachbarn nur Gutes von ihm, so blühend sah er aus. Früher hatte man ihm immer gesagt, die Nachbarn sagten viel Schlechtes über ihn, und wenn sie Gutes sagten, meinten sie selbstverständlich das Gegenteil. Für bare Münze nehmen konnte man das nicht. Wieso sollten sie etwas Schlechtes sagen, wenn sie etwas gut fanden? Höchstens, um einen zu ärgern. Büttner bekam nichts davon mit, was diese Nachbarn angeblich alles sagten, es interessierte ihn im Einzelnen auch nicht. Wahrscheinlich war er zu dumm und zu faul, was lediglich sein Abitur halbwegs verschleiern konnte. Wenn man schon die Reife benötigte, um seine Dummheit zu verschleiern, dann muß es schon schlimm sein mit einem. Wahrscheinlich konnte man das gesamte Bürgerliche Verzeichnis jeglicher guter Eigenschaften hernehmen, falls man so etwas fand, und nichts davon wäre erfüllt worden. Nachbarn sollen sehr geschickt sein im Auffinden und in der Beschreibung negativer Eigenschaften, schlimmer als der wohlwollende Lehrer oder der Arzt oder selbst als der strenge, aber gutmütige Heilige. Das sagte schon das Wort Nachbar. Der Nachbar war jemand, meistens ein Mensch, manchmal eine ganze Gruppe, der oder die einen umzingelt hatte oder vielleicht schon da war, bevor man seinerseits das Licht der Welt erblickte. Er saß immerzu in seinem Haus, wenn der eine nicht da war, dann erzählte ihm der andere etwas, der im Haus geblieben war. Der Nachbar kam immer erst danach. Davor kam immer der, der gerade vom Nachbarn beobachtet wurde. Der Nachbar lebte immer ganz für den Nachbarn. Ein guter Nachbar war immer ein Nachbar. Und so weiter. Was dachte ein guter Nachbar?
Büttner trieb sich als Student überall herum, weil er nirgendwo dazugehörte. In seinem Studienfach fühlte er sich nie zuhause. Je mehr er irgendwo zuhause war, um so mehr spürte er das Gegenteil, nämlich, wie viel ihm noch zum Zuhause fehlte. Das Studium drohte, endlos zu werden wie die Schule. Er konnte das nicht noch einmal durchhalten. Also blieb er ein Student. Obwohl er strebsam arbeitete, war ihm das alles gar nicht wichtig, denn nur so konnte er arbeiten. Eines nach dem anderen. Später einmal ein Heiliger werden, so verrückt es klang, war vielleicht die seine wahrscheinlichste Zukunft. Wie konnte er zu entsprechenden Stigmata gelangen? Wenn ihm wie durch einen Zufall oder gerade durch einen solchen Zufall etwas Schweres auf seine Hand gefallen sein würde, das wäre vielleicht ein Anfang. Aber beide Hände und Füße? Jesus hatte doch mindestens vier Löcher dort. Büttner mußte seine Risikobereitschaft erhöhen, da half nichts. Er arbeitete neben dem Studium nur selten an Orten, an denen es gefährlich war, aber als er sich steigerte, dauerte es insgesamt nur zwei Jahre, bis er genügend Wunden zusammen hatte. Alles was nicht in der Mitte seiner Hände oder Füße war, ließ er verheilen. Den Rest, um den es ja ging, konservierte er mit Phenol. Diese konservierten Wunden sollten denn auch kein Ende mehr nehmen.
Eine der Wunden bestand tatsächlich aus einem Loch, das seine Hand vollständig durchlief. Alle diese Wunden allerdings hatte er sich nicht selbst beigebracht, sie waren doch bei der Arbeit entstanden, wie bei der guten Frau Holle. Er nahm lediglich ein wenig Einfluß darauf, was wieder heilte und was nicht. Wenn man seine Stigmata anschaute, so verdankten sie ihre Existenz einem unglaublichen Zufall. Wie konnte es sein, daß er genau an den Körperstellen einen Unfall hatte, an denen auch Jesus Wunden aufwies! Nun würde man sagen, nun gut, Büttner hatte doch überall Wunden oder Narben, warum dann nicht auch dort, wo sie Jesus hatte? Aber wenn man Büttners vier Wundmale einmal für sich betrachtete, ganz für sich, ganz auf diese Male konzentriert, so bedeuteten sie ohne jeden Zweifel einen unglaublichen Zufall, und nicht mehr viel Glaube war noch nötig, um das zu erkennen. So lief er auf dem Universitätsgelände umher, in der Hoffnung, bald auch innerlich so auszusehen, wie er es äußerlich nun tat. Stolz trug er seine Zufälle auf der Haut, dezent verborgen unter jeweils einem Handschuh oder während des Sommers unter gewickelten Binden, die jederzeit rasch zu öffnen waren, um nach den Wunden zu sehen. Wenn er alles etwas fester band, wurde es nicht nur im Juli oder im August etwas zu warm, sondern er hatte auch mehr Schmerzen. Auch diese Schmerzen waren echt, denn es gab auf der Welt nichts Echteres als den Schmerz. Und weshalb sollte er sich einen solchen Schmerz antun, wenn sich nicht etwas ganz Ernstes dahinter verbergen konnte! Es war das blühende Leben, das da in seinen Wunden sprudelte, und das wußte er. Wenn ihn jemand darauf ansprach, zögerte er meistens, diese Binden zu öffnen, war sich nicht sicher darüber, was in einem solchen Fall richtig sein würde, prüfte genau jede Reaktion seiner Betrachter, während er alles langsam aufwickelte, selten zeigte er die eigentliche Wunde, meistens ließ er sie gerade noch verhüllt, leicht überdeckt von einem mit etwas von seinem Blut befleckten Stück Stoff. Er beging dabei nicht den Fehler, denen die Wunde zu zeigen, die am wenigsten an ihn glaubten. Sie hätten ihn so oder so nur ausgelacht. Ihnen gegenüber war er besonders scheu gewesen, aber die Gläubigen, wie er diese mangels eines anderen Ausdrucks nannte, durften oder mußten oftmals alles sehen. Berühren durften hingegen auch sie nichts, denn das wäre einer Art der Manipulation gleichgekommen. Die Ungläubigen, auf der anderen Seite, konnten nie wirklich sagen, weswegen sie nicht an Rolf Büttner glaubten, denn sie bekamen ja nie etwas zu sehen. Büttner hatte sich diese Vorgehensweise in langjähriger Praxis angeeignet und war davon überzeugt, daß andere Heilige nichts anderes taten. Jeder von ihnen mochte das auf seine ganz eigene Weise tun, das Prinzip hingegen war immer das selbe.
Es gab noch einen weiteren Grund, weswegen Büttner sich an den Wunden nicht berühren ließ. Er wollte Jesus Christus gewissermaßen nicht nachmachen, war er doch selbst nur ein Heiliger, jedenfalls keiner, der den Menschen den Glauben schenken konnte. Etwas Ähnliches zu denken, wäre nun wirklich anmaßend gewesen. In der kargen Studentenbude, in der alles nur vorübergehend war, allem etwas Vorübergehendes anhaftete, waren Büttners Wunden die einzige Unterhaltung. „Ich leide gern“ hatte Pater Pio immer gesagt, und was blieb einem auch in diesem trostlosen Studentenleben übrig außer dem Leiden. Selbstverständlich ging er auf Feste, hatte auf der Universität genügend zu tun, doch jeder vermeintliche Trost unterstrich in seiner ganzen Unwirklichkeit nur die Trostlosigkeit. Ihm war, als ob er in einer Geschichte lebte, in der nur die Geschichte wahr gewesen ist, und nicht die Figuren, die in dieser Geschichte ihr Dasein zu fristen hatten. Rolf Büttner saß Nacht für Nacht mit seinen Malen auf dem schmalen Bett, ohne zu wissen, ob er an sich glauben sollte. Manchmal löste er sogar eine Binde, um nach seiner eigenen Wunde zu sehen, obwohl er ihren Schmerz doch spürte. Willst du groß an Bedeutung sein oder willst du glücklich sein, so lautete in seinen Tagen immer die Frage. Nun, da er nicht glücklich sein konnte, dann mußte er eben groß sein, falls wenigstens das möglich war. Die Einsamkeit in Büttners Bude bestand nicht eigentlich in einem Mangel an Menschen. Es war völlig egal, ob diese Menschen sich in seiner Bude oder im Nebenzimmer oder im Nebenhaus aufhielten oder wie viele Wände noch dazwischen waren. Es ging eher darum, daß Büttner mit seinen Vorstellungen, mehr noch mit seinen Bedürfnissen, völlig alleine war. Büttner kannte das, wenn man ganz alleine war, mit niemandem im Kopf, der ansatzweise in die selbe Richtung gegangen war, im Gegenteil, mit einem Haufen Menschen, die alle die andere Richtung verfolgten, als ob dort das Glück auf sie warte. Wo konnte man da bleiben! Ja es war sogar so, daß nicht einmal ein eigener Gedanke verfügbar war, der einen halbwegs unterstützen konnte. Büttner fühlte sich dann als eine Art Negativ, das überhaupt nur da war, um den jeweils anderen Menschen möglich zu machen. Diese Einsamkeit, schon das Wort war falsch, machte ihn geradezu erpreßbar, denn man mußte ihm nur etwas in Aussicht stellen, was