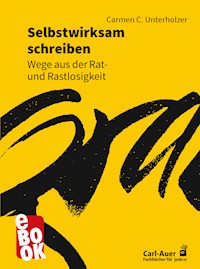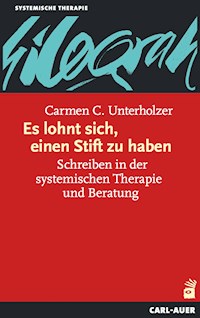
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Therapie
- Sprache: Deutsch
"Ich kann allen Psychotherapeuten und Beratern dieses Buch ans Herz legen – den Systemikern wie auch allen anderen, die sich für den therapeutischen Einsatz des Schreibens interessieren." Kirsten von Sydow "Carmen C. Unterholzer widmet sich in ihrem jüngst erschienenen Buch dem Schreiben als Werkzeug in der systemischen Therapie. Das Buch bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern besticht vor allem durch die vielen praxisnahen Beispiele und die persönlichen Erfahrungsberichte der Autorin. Es lohnt sich also nicht nur, einen Stift parat zu haben, es lohnt sich auch, dieses Buch im Portfolio zu haben." Silke Grabenberger, Systeme Schreiben und heilen! Erzählungen gehören zu jeder Psychotherapie. Ist es ein Unterschied, ob Klient:innen in der Therapie "nur" reden oder ob sie auch schreiben? Obwohl viele Menschen zur Feder greifen, weiß man wenig darüber, wann Schreiben hilft, wann es schadet, wie Texte gestaltet sein müssen, um heilsame Effekte hervorzubringen. Carmen C. Unterholzer positioniert das Schreiben innerhalb der systemischen Therapie und leuchtet das Verhältnis zwischen Literatur und Therapie aus. Sie zeigt, wie andere therapeutische Ansätze das Schreiben einsetzen und präsentiert die Vielfalt schriftlicher Interventionen in der systemischen Psychotherapie. Die Autorin arbeitet Ideen aus, wann welche Textgattung in welchem Veränderungsprozess für Klienten sinnvoll sein könnte und wie therapeutisches Schreiben im Einzelsetting und in Gruppenpsychotherapien eingesetzt werden kann. Viele Beispiele aus der therapeutischen Arbeit geben Einblick in die Praxis und bestätigen den berühmten Satz von Gertrude Stein: Es lohnt sich einen Stift zu haben. Die Autorin: Carmen C. Unterholzer, Dr.in phil, Psychotherapeutin, systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie am Institut für Systemische Therapie, Wien; Lehrtherapeutin für systemische Familientherapie in der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Studien und Forschung, Wien (ÖAS); Weiterbildung in Poesie- und Bibliotherapie (Fritz-Perls-Institut, Düsseldorf) und Hypnotherapie (nach Milton H. Erickson); Lehrtätigkeit an den Universitäten Innsbruck und Klagenfurt; Leiterin von Seminaren, Coaching- und Supervisionstätigkeit im Bildungs- und Sozialbereich. Arbeitsschwerpunkte: therapeutisches Schreiben und andere kreative Methoden in der systemischen Psychotherapie, systemische Gruppenpsychotherapie, Essstörungen, Depression, Burnout, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Achtsamkeit, Schreibcoaching.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Für Ruth, meine Schwester
Die Arbeit an diesem Buch wurde durch die Autonome Provinz Bozen, Abteilung deutsche Kultur, finanziell unterstützt.
Carmen C. Unterholzer
Es lohnt sich, einen Stift zu haben
Schreiben in der systemischen Therapie und Beratung
2017
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jorg Fengler (Koln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Potsdam)
Dr. Roswita Konigswieser (Wien)
Prof. Dr. Jurgen Kriz (Osnabruck)
Prof. Dr. Friedebert Kroger (Heidelberg)
Tom Levold (Koln)
Dr. Kurt Ludewig (Munster)
Dr. Burkhard Peter (Munchen)
Prof. Dr. Bernhard Porksen (Tubingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Koln)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Koln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Munster)
Jakob R. Schneider (Munchen)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Koln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlagfoto: Collage © Uwe Göbel
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2017
ISBN 978-3-8497-0176-5 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8071-5 (ePUB)
ISBN 978-3-8497-8059-3 (PDF)
© 2017 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten aus der Vangerowstraße haben, können Sie unter http://www.carl-auer.de/newsletter den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH Vangerowstraße 14 · 69115 Heidelberg
Tel. +49 62216438 - 0 · Fax + 49 62216438 - 22
Vorwort
Als begeisterte Leserin, wissenschaftlich Schreibende und jahrzehntelange Tagebuchschreiberin kenne ich die heilsame Wirkung des Lesens und des Schreibens. Das Schreiben hat mich schon oft aus Bedrücktheit oder innerem Chaos gerettet. Aufgrund dieser Erfahrungen setze ich gerne Schreibübungen bei meinen Klienten ein. So habe ich Carmen Unterholzers Buch »Es lohnt sich, einen Stift zu haben« mit großem Interesse und noch größerem Gewinn gelesen. Ich habe viele Anregungen erhalten, von denen meine Klienten in Zukunft profitieren werden, ebenso wie ich selbst. Ihr Überblick über Theorie, Praxis und Forschung zum Heilsamen des Schreibens ist fundiert, umfassend und sehr gut lesbar. Die Autorin beschränkt sich dabei nicht nur auf die systemischen Interventionen, sondern berücksichtigt auch Schreibinterventionen anderer Therapieverfahren. Anhand vieler berührender Beispiele zeigt das Buch, wie man Briefe, Manifeste oder Erzählungen in Einzel- und Gruppenpsychotherapie und Beratung einsetzen kann. Inspirierend fand ich unter anderem die Idee, Klienten in der Therapie anzuregen, selbst einen Abschlussbericht oder Brief zu schreiben, um Erfolge zu verankern. Oder die Idee, Klienten zum Therapieabschluss zu bitten, ein Selbstporträt zu verfassen und darauf zu achten, wie sich ihre Selbstbeschreibungen im Vergleich zum Beginn der Therapie verändert haben. Die Autorin stellt überzeugend dar, wie wichtig es ist, an entstandenen Texten weiterzuarbeiten und dabei inhaltliche Veränderungen wie Fokusverschiebung und Perspektivenwechsel oder formale Veränderungen wie den Wechsel der Erzählform, des Tempus oder des Erzähltempos vorzunehmen.
Carmen Unterholzer illustriert ihre Arbeit mit einer Vielzahl von eindrucksvollen Fallbeispielen, sodass es nicht nur eine intellektuelle Freude ist, ihr Buch zu lesen – ihr Buch berührt auch emotional. Als Systemikerin arbeitet sie selbstverständlich ressourcenorientiert, vergisst darüber aber nicht, dass »Menschen … mit der Schwere ihrer Geschichten gesehen, gehört und verstanden werden« wollen (Seite 115). Es geht darum, »Opfergeschichten umzuwandeln in Entwicklungs- oder Bewältigungsgeschichten« (Seite 135) –, um einen behutsamen Prozess der Weiterentwicklung alter, belastender Muster hin zu konstruktiveren.
Das Buch hat mir aber nicht nur persönlich und als Therapeutin gefallen – es hat mich auch als Wissenschaftlerin angesprochen. Denn Carmen Unterholzer beschreibt den Forschungsstand zum Thema samt eigener Forschungsarbeiten und geht differenziert auf Fragen von Indikation, Kontraindikation und differenzieller Indikation ein, wie etwa den Einsatz von Schreibübungen bei Menschen mit Traumafolge- oder Essstörungen. Insofern gilt also: Schreiben und therapeutische Schreibübungen fördern – nicht immer, aber häufig – Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, Kohärenz und soziale Integration, sie helfen dabei, dysfunktionale Muster zu erkennen, funktionalere Muster zu entwickeln und zu verankern und kreatives Potenzial zu mobilisieren.
So kann ich dieses Buch nur allen (angehenden) Psychotherapeuten und Beratern ans Herz legen – den Systemikern wie auch allen anderen, die sich für den therapeutischen Einsatz des Schreibens interessieren.
Kirsten von Sydow
Hamburg, im Januar 2017
Einleitung
Macht es einen Unterschied, ob Klienten1 in der Therapie »nur« reden oder ob sie auch schreiben? Falls ein Unterschied feststellbar ist, worin besteht er? Wenn ich Schreiben in der Therapie einsetze, wie kann ich es effektiv nutzen? Kann therapeutisches Schreiben auch kontraproduktiv sein? Fragen wie diese treiben mich seit Jahren um, ausgelöst durch zweierlei: zum einen durch berufliche Erfahrungen mit Schreiben in therapeutischem Kontext, zum anderen durch persönliche Erfahrungen mit Schreiben – in Krisen, bei Ambivalenzen, als Mittel zur Selbstreflexion. Für mich bedeutet Schreiben Nähe zu mir. Anaïs Nin formuliert es treffend (Nin 1974, S. 214):
»Wir schreiben […] um unser Bewusstsein vom Leben zu vertiefen […] Wir schreiben, um das Leben zweimal zu kosten: im Augenblick und in der Rückschau […] Wir schreiben, um unser Leben zu transzendieren, um darüber hinauszugreifen. […] Wir schreiben, um unsere Welt zu erweitern, wenn wir uns stranguliert fühlen, eingeengt und einsam.«
Schreibend kann ich die Zeit anhalten, ich kann innehalten und nachdenken, nacherzählen, nachempfinden – eben das Leben ein zweites Mal kosten. Schreibe ich nicht, zerrinnt mir das Leben zwischen den Fingern.
Viele Menschen schreiben und damit meine ich, sie schreiben mehr als ihren Einkaufszettel oder Zahlen auf einen Zahlschein. Es verschafft ihnen – so wie mir – Erleichterung, bringt Klarheit, unterstützt sie, wenn sie sich entscheiden müssen. Schreibend ordnen wir Gedanken, die ansonsten auf uns einstürzen würden. Schreibend entdecken wir Auswege aus scheinbaren Sackgassen, schreibend eröffnen sich neue Perspektiven. Gut, könnten wir sagen, das schaffen wir auch, wenn wir nur reden, also mündlich. Aber die Rede ist flüchtig – gesprochene Gedanken verschwinden. Schreiben wir Erkenntnisse hingegen auf, dann sind sie festgehalten: Schwarz auf weiß stehen sie da, jederzeit nachlesbar. Und das ist wichtig, denn oft vergessen wir in Zeiten der Krise unsere Stärken, wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse.
Denke ich ans Schreiben, weckt das sofort Erinnerungen an erste, frühe Schreiberfahrungen. Schnell taucht ein bestimmtes Erlebnis auf: die Erfindung des Kaugummis. Die Geschichte der künstlichen Kaumasse oder besser, meine Fantasien dazu, sind eng mit meiner Schreibgeschichte verbunden. Meine Volksschullehrerin mochte mich nicht besonders, ich spürte ihre Abneigung, vernahm ihren beißenden Spott. War es, weil ich eine Städterin und als neu Zugezogene im Dorf ein Fremdkörper war oder weil ich die Schule nicht so wichtig nahm, das Spielen interessanter fand? Doch dann brachte sie uns ein Aufsatzthema mit, an dem ich entbrannte: »Wie der Kaugummi entstand.« Ich, sonst eine eher zurückhaltende Schreiberin, erfand die Geschichte eines ausgetretenen Turnschuhs auf der Flucht vor Mr. Wrigley. Die Lehrerin hatte mir nicht nur mangelnde Fähigkeit zur Integration unterstellt, sondern auch wenig Fantasie zugetraut. Der Text überraschte sie, sie gab ihn mir zurück mit der Bemerkung: »Hätt’ ich gar nicht von dir erwartet.« Von nun an war sie freundlicher zu mir. Ich erfuhr erstmals, dass man am Schreiben entflammen kann und dass Texte wirken, etwas verändern können.
Das Schreiben ließ mich nicht mehr los, ich wollte dranbleiben. Das Studium der Germanistik sollte mir diese Nähe garantieren. Aber spätestens als ich die ersten Seminararbeiten verfasste, merkte ich: Das hat mit dem, was ich mit Schreiben verbinde, mit Lust, Kreativität, Lebendigkeit nicht mehr viel zu tun. Nach Abschluss des Studiums arbeitete ich als Journalistin. Ich verfasste Porträts über Liesl Karlstadt, Marieluise Fleißer, Elfriede Jelinek, ich interviewte Verlegerinnen, Künstlerinnen. Die Flowgefühle, die die kindliche Schreiberin empfand, stellten sich wieder ein. Doch der hohe Produktionsdruck, die schlechten Arbeitsbedingungen und die ungesunde Lebensweise ließen die Freude am Schreiben mit den Jahren seltener werden, bis ich eines Tages feststellte: Das Schreiben macht so keinen Spaß mehr.
Also absolvierte ich eine mehrjährige, poesietherapeutische Ausbildung und entwickelte anschließend Konzepte für Schreibgruppen. Ich war erstaunt über die große Nachfrage – es schien gerade so, als hätte ich eine Marktnische entdeckt. Schreibend hatten Teilnehmer die Möglichkeit, Themen, die sie beschäftigen oder belasten, zu bearbeiten. Gruppen wie »Mutter – Tochter«, »Arbeiten – das ganze Leben?« oder »Geschichte(n) meines Lebens« laufen auch nach vielen Jahren noch mit großem Erfolg. Bereits zu Beginn meiner schreibtherapeutischen Tätigkeit fiel mir die hohe Wirksamkeit auf, das Feedback der Teilnehmer bestätigte meinen Eindruck. Viele berichten nach einem Wochenendseminar oder auch Monate später, welch starken Effekt das Schreiben über die Mutterbeziehung oder über das Verhältnis zur Arbeit hatte.
Dem poesietherapeutischen Curriculum folgte eine Ausbildung zur Psychotherapeutin2 der Fachrichtung »Systemische Familientherapie«. Nun konnte ich alle meine unterschiedlichen Talente und meine verschiedenen beruflichen Ausbildungen und Erfahrungen – Literaturwissenschaft, Journalismus, Poesie- und Psychotherapie – zusammenführen und nutzen. Seit Jahren verknüpfe ich die systemische Psychotherapie mit Schreibinterventionen. Während ich es in den ersten Berufsjahren noch recht unsystematisch einsetzte, stieg mit zunehmender Erfahrung das Verlangen nach methodischem Vorgehen. Es entstand das Bedürfnis, mich wissenschaftlich mit therapeutischem Schreiben in der systemischen Psychotherapie zu befassen und seinen gezielten Einsatz zu erforschen. Ich begann meine eigene Praxis verstärkt zu reflektieren und zu systematisieren. Wer selbst begeistert schreibt, wer die vielfältigen Wirkungen des Schreibens am eigenen Leib erfährt, unterliegt der Gefahr zu denken: Das, was mir hilft, gilt auch für andere. Kenneth Gergens Warnung (Gergen 2002, S. 31) kam mir in den Sinn: »Je mehr wir jedoch von der Wirklichkeit und Wahrheit unserer eigenen Überzeugungen ausgehen, umso mehr missachten wir alternative Wirklichkeiten.« So entstehen blinde Flecken. Ganz ausschließen können wir sie nie, aber wir können sie minimieren. Deshalb holte ich immer häufiger Feedback von meinen Klienten ein: Wie sinnhaft erleben sie die Schreibinterventionen? Wo liegt der Unterschied zwischen mündlichen und schriftlichen Interventionen? Welche Wirkungen stellen sie fest? Wie sich dabei zeigte, geht therapeutisches Schreiben in seinen Wirkungen weit über das Sich-von-der-Seele-Schreiben hinaus.
Dass Erzählungen Gegenstand der Therapie sind, ist, spätestens seit sich der narrative Ansatz etabliert hat, eine Selbstverständlichkeit. Doch dass aus mündlichen Erzählungen Texte werden, ist noch wenig untersucht worden. Fachleute unterschiedlichster Disziplinen klagen gebetsmühlenartig über das hauchdünne empirische Eis, auf dem sie sich bewegen, wenn sie schreibtherapeutisch arbeiten. Obwohl viele Menschen zur Feder greifen, wissen wir wenig darüber, wann Schreiben hilft, wann es schadet, wie Texte gestaltet sein müssen, um heilsame Effekte hervorzubringen. Diese Diskrepanz ist auffallend. Es ist, als läge ein äußerst fruchtbares Feld vor uns, aber nur wenige beackern es. Nur wenige beforschen es. Schreibtherapeutisch arbeiten hingegen viele.
»Es lohnt sich, einen Stift zu haben«3 sucht nach Antworten auf die aufgeworfenen Fragen. Das Buch zeigt die Vielfalt schriftlicher Interventionen und ihre Einsatzmöglichkeiten in der systemischen Psychotherapie. Beispiele aus meiner therapeutischen Arbeit geben Einblick in meine Praxis.
Wie es sich fügte. Zur Struktur des Buches
Kapitel 1 fragt nach Parallelen zwischen den beiden Systemen Literatur und Therapie und ihren relevanten Umwelten. Wie nutzen Therapeuten Literatur? Statt von Frau Meier erzählen sie von Effi Briest, statt von Familie Müller von den Brüdern Karamasow. Dies deshalb, weil Literatur und Therapie um ähnliche Themen kreisen: um Konflikte, schwieriges Lieben und den Tod. Wie profitieren Schriftsteller von der therapeutischen Wirkung von Literatur? Ein Blick zurück in die Antike, in die deutsche Klassik und in die Gegenwart zeigt: Literatur wurde schon immer eine heilende Wirkung zugeschrieben.
Kapitel 2 wirft einen Blick über den systemischen Tellerrand. Es ist nicht die systemische Therapie, die federführend bei der Entwicklung des therapeutischen Schreibens war. Integrative Kollegen waren weiter, haben eine eigene Methode, die Poesie- und Bibliotherapie, entwickelt. Wie arbeiten andere therapeutische Schulen mit Schreiben? Welche Herangehensweisen wählen systemische Therapeuten, wenn sie schreiben oder ihre Klienten zum Schreiben motivieren?
Was ich in Kapitel 2 abgrenzend zu anderen Ansätzen skizziere, vertiefe ich in Kapitel 3. Hier zeige ich Varianten, wie wir systemische Methoden schreibend umsetzen können. Kapitel 4 präsentiert das Spektrum der Textsorten, auf die wir zurückgreifen können. Geläufig im therapeutischen Kontext ist der Brief oder das Tagebuch, seltener kommen der Beipackzettel, die Gebrauchsanweisung oder das Drehbuch zum Zug.
Kapitel 5 und Kapitel 6 gewähren Einblick in meine konkrete therapeutische Praxis: Zunächst führe ich vor, welche Schreibinterventionen ich in der Einzeltherapie einsetze, dann, in Kapitel 6, konzentriere ich mich auf das Schreiben in Gruppen. Anhand zweier Konzepte, »Geschichte(n) meines Lebens« und »Arbeit – das ganze Leben«, zeige ich beispielhaft die Verknüpfung von systemischen Ansätzen mit schreibtherapeutischen Interventionen. Leser bekommen zum Beispiel Antworten auf die Fragen: Wie führe ich Schreibübungen ein? Wann setze ich welche Textgattung ein?
»Die Kraft des Gestaltens«, Kapitel 7, widmet sich Form- und Gattungsfragen, die für das therapeutische Schreiben relevant sind. Ist es sinnvoll, Klienten vorzuschlagen, ihre Texte zu überarbeiten? Wann empfiehlt es sich, sich eines Textes nochmals anzunehmen, und worauf können Klienten und Therapeuten bei einer Überarbeitung achten? Es gibt Situationen, in denen man lieber nicht zum Stift greifen, die Tastatur unberührt lassen sollte, Situationen in Therapien, in denen es besser ist, wenn das Wort flüchtig bleibt, wenn es nicht »festgeschrieben« wird. Kapitel 8 umreißt Nachteile und unerwünschte Nebenwirkungen schriftlicher Interventionen.
Was meint die Wirkungsforschung zu alledem? Kapitel 9 widmet sich abschließend dieser Frage. Was ist bisher bereits bekannt, was kann noch ergänzt werden? Hier kommen meine Klienten verstärkt zu Wort. Sechzehn von ihnen, die eine Hälfte Teilnehmer von Schreibgruppen, die andere Einzelklienten, wurden mittels Tiefeninterviews befragt. Obwohl die Anliegen in den beiden Gruppen unterschiedlich sind – Teilnehmer von Gruppen kommen wegen des speziellen Themas in die Gruppe, Einzelklienten suchen mich mit konkreten Leidenszuständen auf –, eint sie die Erfahrung, Schreiben als Ressource zu entdecken. Die einstündigen Tiefeninterviews wurden transkribiert und auf die unterschiedlichen Wirkungen therapeutischen Schreibens hin analysiert.
Der Buchtitel »Es lohnt sich, einen Stift zu haben« weist eine bildliche Nähe zum händischen Schreiben auf, eine für viele recht antiquierte Form, etwas schriftlich festzuhalten. Ein »digital native« wählt sein Tablet, seinen Laptop oder sein Smartphone, um beispielsweise Beobachtungen zwischen den Therapiesitzungen festzuhalten oder die Quintessenz einer Stunde zu formulieren. Solange wissenschaftliche Studien nicht dem händischen Schreiben einen eindeutigen Vorteil bestätigen, schließt der Titel – schon der Anschlussfähigkeit wegen – beide Varianten ein.
Die Erkenntnisse dieses Buches sind als vorläufig zu betrachten. »Es lohnt sich, einen Stift zu haben« präsentiert in diesem Sinne Perspektiven und Schritte meines Vorgehens, die sich in der Zusammenarbeit mit Klienten als sinnvoll erwiesen haben – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1 Auf Wunsch des Verlages wird in diesem Buch darauf verzichtet, jeweils die männliche und die weibliche Form (hier: Klientinnen und Klienten) anzuführen. Gemeint sind jeweils beide Geschlechter, unabhängig davon, ob die männliche oder die weibliche Form benutzt wird.
2 Das österreichische Psychotherapiegesetz beschränkt den Zugang zur Ausbildung zum Psychotherapeuten nicht auf Mediziner und Psychologen.
3 »Es lohnt sich einen Stift zu haben« ist ein Zitat von Gertrude Stein. Es stammt aus dem Gedicht »A Little Love of Life«, enthalten in »Stanzas in Meditation and Other Poems«. New Haven, Yale University Press 1956. Die Verszeile wurde von Renate Stendhal übersetzt und ist erschienen in: Stendhal, R. (Hrsg.) (1988): Gertrude Stein. Ein Leben in Bildern und Texten. Arche (Zürich), S. 191.
1 Therapie und Literatur – eine enge Beziehung4
Ich wollte doch keine Literatur schreiben,
sondern einen Haltfinden.
Herta Müller
1.1 Literaturproduktion mit therapeutischen Nebeneffekten
Schreiben wirkt therapeutisch – viele Autoren betonen dies immer wieder. Als die Lyrikerin und spätere Nobelpreisträgerin für Literatur, Nelly Sachs, siebzehnjährig an einer lebensbedrohlichen Anorexie erkrankte, legte der behandelnde Psychiater ihr nahe, dem Kummer Worte zu verleihen. »Er kann als Arzt und Freund die junge kranke Nelly Sachs dahin führen, ihre Verzweiflung in Worte zu fassen und dadurch selbst den Weg aus Leid und Selbstzerstörung zu finden«, schreibt Sachs’ Biografin Gabriele Fritsch-Vivié. »Selbstbefreiung durch das Wort« nennt es Gudrun Dähnert, eine Freundin von Sachs (Fritsch-Vivié 2010, S. 39). Damals entstehen Sachs’ erste Gedichte. Die Halbjüdin entkommt Jahre später nur knapp den nationalsozialistischen Mördern, lebenslang verfolgen sie ihre Schatten. Ihre psychische Erschütterung bringt sie öfter in psychiatrische Krankenhäuser. Sachs bannt die Geister der Vergangenheit in Gedichten. Krisenzeiten gelten als ihre literarisch produktivsten Phasen.5
Ruth Klügers erste lyrische Texte entstehen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Es sind hermetische Gedichte, verfasst in strengem Versmaß. Jahrzehnte später mutmaßt die Autorin, sie seien »ein poetischer und therapeutischer Versuch, diesem sinnlosen und destruktiven Zirkus, in dem wir untergingen, ein sprachlich Ganzes, Gereimtes entgegenzuhalten« (Klüger 1992, S. 125). Klügers lyrisches Schaffen vermittelt ihr die Illusion, das Chaos um sie herum in den Griff zu bekommen. Die mörderische Unordnung zum Verschwinden zu bringen war nicht möglich, aber: »Ich hab den Verstand nicht verloren, ich hab Reime gemacht« (ebd., S. 127).
Äußerungen von Schriftstellern, Schreiben habe therapeutische Kraft, sei Bewältigungshilfe und »Überlebensmittel«, finden wir zahlreich in der Literatur. Von Ernest Hemingway ist die Aussage überliefert, seine Corona – eine amerikanische Schreibmaschine – sei seine Therapie gewesen. Für Nathalie Sarraute und Hilde Domin ist Schreiben ein Akt der Befreiung von Zwängen und vom Funktionieren-Müssen. »Schreiben«, so Domin, »setzt das Innehalten voraus, das Sich-Befreien vom ›Funktionieren‹« (Domin 1995, S. 11).
Bei Orhan Pamuk, Robert Schindel und Herta Müller ist es die Bannung ihrer Ängste. Der Lyriker Schindel formuliert es in seiner Erich-Fried-Preisrede so (Schindel 1995, S. 138): »Wenn ich Angst habe, suche ich ein Gehäuse für die Angst, ein Wort, einen Satz […] so verdanke ich der Angst meine Schreiberei.« Dem Protagonisten seines Romans »Gebürtig« legt er die poetische Variante dieser Selbstaussage in den Mund (ebd., S. 19): »Wenn ich Angst hab, schreib ichs auf, sagte er. Dann ist die Angst im Wort und springt von dort den Leser an, und ich gehe wieder am Donaukanal entlang, und vergnügt bin ich wieder geworden.« Auch für den türkischen Autor Orhan Pamuk, Nobelpreisträger für Literatur 2006, gibt die Angst den Impuls zum Schreiben. »Immer wenn ich mich bedroht fühle, gehe ich in die andere Welt, in die der Literatur. Vielleicht haben auch die Drohungen der letzten fünf Jahre bewirkt, dass mein neues Buch 600 Seiten lang ist«, erzählt er in einem Interview (Mayer 2008, S. 25). Herta Müller nennt ähnliche Motive (Müller 2014, S. 42): »Ich musste mich meiner selbst vergewissern, die Ausweglosigkeit um mich herum machte mir so eine Angst. Und die Angst ließ sich durchs Schreiben zähmen.« Um mit sich und der Welt zurechtzukommen, um sich mit ihr zu versöhnen – deshalb schreibt der Schweizer Autor Adolf Muschg, der sich in seinen Frankfurter Vorlesungen mit dem Spannungsverhältnis von Literatur und Therapie auseinandersetzt (Muschg 1981, S. 58).
1.2 Literatur im Dienste der Heilung
Seit es die Literatur gibt, existiert die Idee, sie besitze Heilkräfte. Erste Hinweise finden sich bereits um 4000 vor Christus. Im alten Ägypten sollen Leidende dazu angeregt worden sein, ihre Qualen auf Papyrus festzuhalten, das Schriftstück in einer Flüssigkeit aufzulösen und diese zu trinken. Die so einverleibten Worte sollen zur Heilung beigetragen haben (Reiter 1997, Mazza 2003).
Belege für die These, das geschriebene Wort sei heilsam, gibt es zuhauf: Die alten Griechen erkoren mit Apollon ein und denselben Gott für die Dichtkunst und die Heilkunst (Petzold u. Orth 1995, S. 24); Bibliotheken galten als Heilstätten der Seelen – so die Bibliothek im ägyptischen Theben (Leven 2005, S. 154) – oder als Seelenapotheke – so die Stiftsbibliothek St. Gallen. Aristoteles fordert in seiner Poetik von Tragödien eine kathartische Wirkung. Bei der Betrachtung tragischer Ereignisse sollen Zuschauer von Affekten wie Furcht und Mitleid befreit werden. Cicero, Seneca und Augustinus verfassten Trostbriefe. Sie und andere Autoren schreiben solche Briefe nicht nur zur eigenen Entlastung, sondern auch gezielt für Menschen in Not (Petzold u. Orth 1995, S. 25). Die »reinigende Funktion«, die Tragödien innewohne, greift Gotthold Ephraim Lessing Mitte des 18. Jahrhunderts erneut auf. In seiner »Hamburger Dramaturgie« schreibt er, die Tragödie solle Mitleid und Furcht in »tugendhafte Fertigkeiten« umwandeln. In der poetologischen Abhandlung »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« formuliert Friedrich Schiller Ende des 18. Jahrhunderts, Literatur wirke gegen die »Verkrüppelung der Seele«.
Nicht nur Dichter, auch Psychiater und Psychologen haben früh erfahren, dass das Verschriftlichen von aufwühlenden Ereignissen und Erlebnissen heilsam sein kann. Benjamin Rush, Vater der amerikanischen Psychiatrie, nutzt bereits im ersten Spital, das in den USA entsteht – im Pennsylvania Hospital –, kreative Methoden in seiner Arbeit. Seine psychisch angeschlagenen Patienten motiviert er zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Schreiben. Die Texte publiziert Rush dann in der spitalseigenen Zeitung »The Illuminator« (ebd., S. 28).
Einer der ersten, die in Europa die Überzeugung teilen, Schreiben helfe, ist Pierre Janet. Der Zeitgenosse Sigmund Freuds zählt zwischen 1890 und 1930 zu Frankreichs renommiertesten Psychiatern. Es ist die Hoch-Zeit der Hypnose. Sie gilt als Königsweg bei der Behandlung psychopathologischer Phänomene wie multiple Persönlichkeit oder Hysterie. Janet postuliert, alles was der Mensch erlebe, schreibe sich ins Gedächtnis ein, er vergesse nichts. Allerdings seien Erinnerungen nicht immer zugänglich, besonders unangenehme, traumatische versperrten sich dem Bewusstsein. Um das »Unterbewusste« – so die von Janet verwendete Bezeichnung – ins Bewusstsein zu holen, hält er Patienten im Halbschlaf, in Trance oder unter Hypnose zum Schreiben an. Dies hilft ihm bei der Erstellung genauer Psychogramme. Aber nicht nur diagnostischen Zwecken soll die »écriture automatique« dienen, sie soll auch eine heilsame Funktion für die Patienten haben. Durch das »unterbewusste«, das automatische Schreiben sollen Erlebnisse und Erinnerungen, die für die Schreibenden bis dahin nicht zugänglich waren, ins Bewusstsein geholt und verarbeitet werden (Ellenberger 2005, S. 490).
Neu ist das Schreiben unter Trance nicht. Seine Wurzeln liegen ein halbes Jahrhundert früher – in der Spiritismuswelle Mitte des 19. Jahrhunderts. Spirituelle Medien führten damals die Feder. Janet holt das Schreiben aus den Reihen der Medien und Geister zurück und führt es in die Medizin ein (Langlitz 2005, S. 23). Allerdings spielt die »écriture automatique« in Janets Arbeit lediglich eine Nebenrolle. Es sind andere, die ihr zu Ruhm verhelfen: die Surrealisten. Die Vertreter dieser antibürgerlichen Kunstrichtung, entstanden gegen Ende des Ersten Weltkrieges, wollen schreibend und malend in die Tiefen des Unbewussten eintauchen und das Unwirkliche, das Traumhafte der Wirklichkeit festhalten. Sie nutzen das automatische Schreiben, um das Denken, das planende Überlegen auszuschalten und imaginative Momente freizusetzen. Gleich einem Film, der sich im Kopf abspiele, werden die Sprunghaftigkeit und die Unstrukturiertheit der Gedanken festgehalten. Stocken die Gedanken, wird der Schreibfluss nicht unterbrochen, sondern das letzte Wort – permanent schreibend – wiederholt. André Breton definiert 1924 das automatische Schreiben im »Ersten Manifest des Surrealismus« als »Denk-Diktat ohne jede Kontrolle der Vernunft« (Breton 1996, S. 26).
Von ersten Ansätzen hin zur Schreibtherapie
Pierre Janet hatte das Hôpital Salpêtrière bereits verlassen, sich von der Hysterie und der Hypnose ab- und der Verhaltenspsychologie zugewandt, als der Exilrusse Vladimir N. Iljine 1922 in Budapest seine psychoanalytische Ausbildung bei Sándor Ferenczi beginnt. Iljine ist eine treibende Kraft bei der Integration des Schreibens in die Therapie, maßgeblich beeinflusst vom Psychoanalytiker Ferenczi. Dieser, ein Schüler Sigmund Freuds, gilt als Enfant terrible der Psychoanalyse. Er arbeitet bereits damals mit für die Psychoanalyse untypischen Methoden, indem er Patienten zum dramatischen Spiel oder zu poetischen Versuchen auffordert. Vladimir N. Iljine greift Ferenczis Ideen aufund entwickelt daraus Anfang des 20. Jahrhunderts das »therapeutische Theater«. Er weiß (zitiert nach Kerklau 2001, S. 89): »Je vielfältiger die Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten, desto nachhaltiger werden die Selbstheilungskräfte des Menschen stimuliert.« Ganz gezielt setzt Iljine das Schreiben in therapeutischen Sitzungen ein. Um wichtige Erkenntnisse, nennenswerte Veränderungen oder neue Erfahrungen zu verankern, fordert er seine Patienten auf, nach der Stunde Texte zu verfassen. Hilarion Petzold, einer der Mitbegründer der integrativen Therapie, ist sein Schüler. Er erinnert sich (Petzold u. Orth 1995, S. 27): »Diese ›Szenarien‹ hatten oftmals den Charakter von Kurzgeschichten, epischen Gedichten oder Sketchs. Zuweilen ermutigte Iljine auch dazu, Gefühle, Gedanken, Fantasien unmittelbar in Texten auszudrücken.« Iljine fordert seine Patienten überdies auf, »zu Träumen und nach Sitzungen mit dramatischer Therapie Texte abzufassen.«
Mit dem systematischen Einsatz von Lesen und Schreiben in der Therapie beginnt die »moderne« Schreibtherapie, die sich ab den 1960er-Jahren in den USA entwickelt. Entscheidendes dazu beigetragen hat Eli Greifer. Der Pharmazeut, Anwalt und Schriftsteller sammelt bereits in den frühen 1920er-Jahren als freiwilliger Helfer im Creedmoor State Hospital in New York wichtige Erfahrungen mit der heilsamen Wirkung von Gedichten. Der Begriff »Poetry Therapy« soll auf Greifer zurückgehen. Wirklich überprüfen kann er seine Einsichten erst dreißig Jahre später, als ihm die beiden Psychiater Jack J. Leedy und Sam Spector die Möglichkeit bieten, im Cumberland Hospital schreibtherapeutische Gruppen zu leiten. Als Greifer 1966 stirbt, ist Leedy vom Nutzen der Schreibtherapie überzeugt (Leedy 1995, S. 245): »Sie hilft ihnen [den Patienten; Anm. C. U.], ihre emotionalen Störungen leichter zu ertragen, fördert den Heilungsprozess und die Entwicklung einer Lebensphilosophie, die einem angemessenen Umgang mit dem persönlichen Unglück Vorschub leistet.« Leedy gründet 1966 in New York das »Poetry Therapy Center« und drei Jahre später die »Association for Poetry Therapy«. Ein weiterer wichtiger Proponent der amerikanischen Poesietherapie ist der Lyriker und Psychologe Arthur Lerner. Er gründet 1973 das »Poetry Therapy Institute« in Los Angeles und veröffentlicht 1978 eines der wichtigsten Standardwerke der Schreibtherapie, »Poetry in the Therapeutic Experience«.
Ilse Orth und Hilarion Petzold sind die Pioniere der Poesie- und Bibliotherapie im deutschsprachigen Raum. An der »Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit« – dem Fritz-Perls-Institut im nordrhein-westfälischen Hückeswagen –, einem Ausbildungsinstitut für integrative Psychotherapie, organisieren sie seit 1972 Lehrgänge für Poesie- und Bibliotherapeuten. 1984 gründen engagierte Psychotherapeuten, Ärzte und Sozialarbeiter die »Deutsche Gesellschaft für Poesie- und Bibliotherapie«, alle zwei bis drei Jahre finden Symposien zum Austausch in Forschung, Lehre und Praxis statt. In der Schweiz bemüht sich die »Interessengemeinschaft Poesie- und Bibliotherapie« seit dem Jahr 2000 um die Vernetzung aktiver Schreibtherapeuten. Einmal jährlich treffen sie sich zur Weiterbildung und zum kollegialen Austausch.
1.3 Die Erzählung als Medium in der Therapie
So wie Milton H. Erickson aus vielerlei Gründen Anekdoten in die Therapie einfließen ließ, nutzen viele Therapeuten literarische Texte: Sei es, weil sie beispielhaft Schicksalhaftes beleuchten oder mögliche Wege zeigen, mit Problemen umzugehen. Johann Wolfgang von Goethe schildert in seinem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« in mannigfachen Details die Verzweiflung seines Protagonisten, Elfriede Jelinek charakterisiert in »Die Klavierspielerin« ein grausames Unterdrückungsverhältnis zwischen Mutter und Tochter, Doris Lessing zeichnet in »Das goldene Notizbuch« kenntnisreich den Kampf zweier Frauen gegen herrschende Geschlechterverhältnisse nach. Themen wie die beschriebenen sind Therapeuten wohlbekannt – Klienten kommen mit ähnlichen Problemen zu ihnen. Literatur und Therapie kreisen um ähnliche Inhalte. In der Therapie aber müssen Lösungen erst erarbeitet werden, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten hingegen präsentieren für Klienten oft aufschlussreiche Entwicklungen, neue Einsichten oder Auswege. Das macht sie in Therapien so beliebt und lässt Kollegen immer wieder Bücher aus ihren Regalen ziehen.
In Therapiestunden sitzen neben dem Wiener Psychotherapeuten Konrad P. Grossmann und seinen Klienten fiktive Gestalten aus Romanen von Salman Rushdie, John Irving oder Leo Tolstoi. Literarische Texte erhalten den Status alternativer Wirklichkeiten und zeigen so beispielhaft Auswege aus scheinbar hoffnungslosen Lagen. Die Wiener Kollegin Ulrike Russinger zitiert Corinna Sorias »Leben zwischen den Seiten« (Russinger 2001, S. 136): Der Roman zeige, wie die Protagonistin mit der psychischen Erkrankung ihrer Mutter zu leben lernt – nicht zuletzt durch die Flucht in Winnetous Welt oder in Schillers und Rückerts Balladen, wenn sie sich durch psychotische Schübe ihrer Mutter bedroht fühlt. Romane böten Anregungen dafür, wie Probleme bewältigt und Leiden transformiert werden können.
Geschichten statt Systeme
Spätestens seit narrative Ansätze in den 1980er-Jahren Einzug halten und einen Paradigmenwechsel von Systemen zu Geschichten (Freedman u. Combs 1996, S. 1) einleiten, spielen Erzählungen in der Psychotherapie eine wesentliche Rolle. Wirklichkeit wird, so Michael White und David Epston, unter anderem über Erzählungen, die in Familien und anderen sozialen Kontexten verbreitet werden, konstruiert und weitergegeben. Der narrative Ansatz in der systemischen Therapie fokussiert auf diese Geschichten. Klienten erzählen, was sie belastet, kränkt, einengt. Der Grundtenor dieser Geschichten ist defizitorientiert, ausweglos und hoffnungsarm. Dominante Erzählungen zu irritieren, Brüche und Ausnahmen sichtbar zu machen, alternative Geschichten einzuführen, die ressourcenorientiert sind und den Handlungsspielraum der Klienten vergrößern – dies ist der Sinn narrativer Therapie. Problemgeschichten sind dichte, gesättigte Erzählungen, über die Jahre des Erzählens detailreich geworden und wohlgestaltet. Erarbeiten wir alternative Geschichten, bleiben sie oft blass, karg, ohne Konturen und Details. Die neuen, ungewohnten Geschichten müssen mit Leben gefüllt werden. Jill Freedman und Gene Combs sprechen in diesem Zusammenhang vom Verdichten der Handlung (ebd., S. 195; Übers. C. U.): »Den Plot verdichten. […] Wir haben festgestellt, dass Wiederholungen und Gründlichkeit – vor allem beim (1) Erfragen von Details, beim (2) Einbeziehen mehrerer Menschen und beim (3) Einbeziehen verschiedener Perspektiven – extrem hilfreich sind.«
Um zu zeigen, wie das funktionieren kann, nehmen Freedman und Combs Literatur zu Hilfe. Sie habe die Sogkraft, die sie sich von alternativen Erzählungen wünschen. Als anschauliches Beispiel präsentieren sie J. D. Salingers Buch »Franny and Zooey« (Salinger 1961). Salinger lasse durch das Gestalten von Details eine Welt vor den Augen der Leser entstehen und involviere sie in diese (ebd., S. 94; Übers. C. U.):
»Ein Weg, Menschen sicher zu möglichst detailreichem Erzählen einzuladen, besteht darin, sie nach den mannigfachen Erfahrungsweisen zu fragen. […] J. D. Salinger beschreibt sowohl, was Lane denkt, als auch, was er tut, was er fühlt sowie was er denkt.«
Dieses Verdichten von Geschichten hat sich für mich zu einem Leitgedanken entwickelt, der wesentlich für meine therapeutische Arbeit wurde. Wie später genauer beschrieben, schlage ich Klienten sehr häufig vor, erste, zarte Stimmen der Veränderung in Texten zu stärken, ihnen Gewicht zu verleihen durch zahlreiche Details und durch sprachliche Aufmerksamkeit. Doch dazu später mehr (Kapitel 7.3).
1.4 Therapeutische Interventionen literarisch explizieren
Literatur entfaltet, was im therapeutischen Diskurs mühsam erarbeitet werden muss. Erkläre ich die Methode des Externalisierens, greife ich zu einer Textstelle aus Wilhelm Genazinos Roman »Ein Regenschirm für jeden Tag« (Genazino 2001) oder zu Textstellen aus dem Roman »Die Zumutung« (Gruber 2003). Ihre literarische Form der Personifizierung von Emotionen oder Zuständen ist um vieles gelungener und prägnanter als Beispiele aus meiner Praxis.
Konrad P. Grossmann arbeitet mit Vorliebe mit Dostojewski. Eine Textstelle aus dem Roman »Die Brüder Karamasow«, die er unter narrativ-therapeutischen Gesichtspunkten analysiert, dient als Ersatz für einen Therapiedialog. Wie eröffnet der Protagonist das Gespräch, wie führt er Unterschiede ein, wo löst die heilsame Lösungsgeschichte die beschwerliche Problemgeschichte ab? Literatur »birgt sowohl in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht eine Fülle von Anregungen und Erweiterungen für die Psychotherapie« (Grossmann 2000, S. 95). Und nicht zuletzt sei der Roman eine »literarische Verdichtung« (ebd., S. 94) menschlicher Erfahrungen. Therapeut und Klient entwickeln gemeinsam Lösungsgeschichten – ähnlich wie die Literatur nutzen sie dabei Fiktion. »Der therapeutische Dialog und damit einhergehende Akte des Handelns und Schreibens ermöglichen es, dass ein Klient und ein Therapeut in gemeinsamer Autorschaft Texte kreieren, von welchen beide hoffen, dass sie mit Problemauflösung und besserem Leben für den Klienten einhergehen.« (ebd., S. 161)
Literatur statt abstrakter Erklärungen
Psychotherapeuten verwenden in ihren Publikationen häufig statt abstrakter Erklärungen Textstellen aus Romanen und Erzählungen. Verdeutlicht beispielsweise Paul Watzlawick Lesern, was »reframen« bedeutet und dass sich, wenn Geschehnisse in einen anderen Rahmen gestellt werden, oft leichter mit ihnen leben lässt, zitiert er aus Mark Twains »Tom Sawyer« (Watzlawick 1997, S. 138). Toms Tante straft ihn nach einem seiner zahlreichen Streiche. Den Gartenzaun streichend ist er der Schadenfreude seiner Freunde ausgesetzt. Er wäre nicht Tom Sawyer, ließe er das widerspruchslos über sich ergehen. Klug wie Twain seinen Protagonisten entwirft, verkauft Tom die Strafe seinen Freunden als großes Privileg. Daran teilhaben darf nur, wer zahlt. Tom Sawyer liegt geldzählend in der Sonne, den Zaun streichen die Freunde, die ihn zuvor belächelt haben.
Wenn es um Wirklichkeitsanpassung, um Konstruktivismus und Psychotherapie geht, bemüht Paul Watzlawick ein weiteres Mal die Literatur. So zu tun, als ob etwas real wäre – damit haben selbst streng objektive Wissenschaftsdiziplinen wie die Mathematik oder die Physik gute Erfahrungen gemacht: Sie haben die imaginäre Zahl i eingeführt und gelangen trotzdem zu ganz praktischen, ganz konkreten Ergebnissen. Um seiner Begeisterung für die schwer nachvollziehbare Wechselwirkung zwischen dem Imaginärem und dem Konkretem Ausdruck zu verleihen, zitiert Watzlawick den jungen Törleß aus Robert Musils Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«, der im Mathematikunterricht zum ersten Mal auf die Zahl i trifft (Musil 1957, S. 71): »Das eigentlich Unheimliche ist mir aber die Kraft, die in solch einer Rechnung steckt und einen so festhält, dass man doch wieder richtig landet.«
Kommunikationsstrukturen verdeutlicht Watzlawick mithilfe von Edward Albees Drama »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« (Albee 1986). Anhand des Bühnenklassikers veranschaulicht er Systemeigenschaften, Rückkoppelungs- und Metakommunikationsprozesse. Das Theaterstück sei in mancherlei Hinsicht wirklicher als die Wirklichkeit und praktikabler, meint Watzlawick, schließlich stehe die gesamte »Anamnese« zur Verfügung. Dieses Beispiel sei dem Leser auch zumutbarer als seitenlange Transkripte von Familieninterviews (Watzlawick 2007a, S. 138 f.).
Watzlawick ist nicht der Einzige, der die Literatur zu Hilfe nimmt, um komplexe Ideen, Techniken oder Ansätze zu vermitteln. Günther Bamberger verdeutlicht Lesern das konstruktivistische Prinzip, auf dem die systemische Therapie aufbaut, indem er aus Max Frischs »Homo Faber« zitiert. Er bezieht sich dabei auf jene Stelle, an der der Protagonist von seiner Freundin erfährt, sie sei schwanger. Er reagiert auf ihre Eröffnung, sie reagiert auf ihn. Beide kommen in ihren jeweiligen Interpretationen des anderen zu völlig konträren Auffassungen. So unterschiedlich könne man scheinbar konkrete Fakten interpretieren und unterschiedliche Wirklichkeiten konstruieren. »Die ganze Romanliteratur lebt von der Dynamik des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Realitäten, in denen Menschen sich eingerichtet haben«, so Bamberger (2010, S. 21).
Als der Familientherapeut Richard C. Schwartz Anfang der 1980er-Jahre in Illinois seine systemische Therapie mit der inneren Familie (Internal Family Systems Therapy) entwickelt, bemüht er William Shakespeares »Viel Lärm um Nichts« und illustriert damit die Vielfalt menschlicher Identität (Schwartz 1997, S. 61). Um die Vorstellung einer einheitlichen Persönlichkeit zu irritieren, lässt er Hermann Hesses »Steppenwolf« sprechen (zit. nach ebd., S. 27): »Denn es ist ein, wie es scheint, eingeborenes und völlig zwanghaft wirkendes Bedürfnis aller Menschen, dass jeder sein Ich als eine Einheit sich vorstelle. Mag dieser Wahn noch so oft, noch so schwer erschüttert werden, er heilt stets wieder zusammen«. Die Multiplizität unserer Psyche unterstreicht er mit den Worten des amerikanischen Lyrikers Walt Whitman (ebd., S. 51): »Widersprech’ ich mir selbst? Nun gut, so widersprech’ ich mir selbst. (Ich bin weiträumig, enthalte Vielheit.)«
1.5 Vergleichbare Voraussetzungen
Michael White nennt Parallelen zwischen dem Verfassen von Literatur und der therapeutischen Praxis. Sich auf den amerikanischen Psychologen und Kognitionswissenschaftler Jérȏme Bruner berufend, vergleicht er die großen Schriftsteller mit Klienten, welche »die fesselnden Dilemmata ihres Lebens auf eine Weise neu erzählen, die Neugier auf das menschliche Potenzial weckt und das Spiel der Fantasie anregt« (White 2010, S. 76). Erzählen im therapeutischen Kontext öffne ebenfalls Raum für andere, für neue Perspektiven, die Erfahrungen verstehbar machen.
Nicht nur das Erzählen von Neuem verbindet Therapie mit Texten – eine weitere Parallele sind Leerstellen und Lücken, meint White. Schriftsteller arbeiten in ihren Romanen mit Lücken oder Leerstellen, die Leser mit ihrer Fantasie und ihren Erfahrungen füllen. Therapeuten motivieren ihre Klienten, »‹untergeordnete‹ Erzähllinien« stärker zu gewichten und Ausnahmen vom Problem, vernachlässigten Erlebnissen oder leisen inneren Stimmen größere Bedeutung zu verleihen (ebd., S. 80). Die Leerstelle in der Literatur füllen die Leser mit ihrer Vorstellungskraft, die Leerstelle in der Therapie ist Ausgangspunkt für alternative Geschichten.
Dichter »spielen« wie Kinder, meint Sigmund Freud (Freud 1978, S. 128). Das Spiel, so Adolf Muschg, verbindet Kunst und Therapie. Die Kunst treibe ihr Spiel mit dem Entsetzen, »weil (auch die Therapie weiß es) dem Entsetzen oft nur noch das Spiel beikommt – denn das Spiel allein schafft jenen Bewegungsraum, der das Gefühl aus seiner Erstarrung befreit« (Muschg 1981, S. 134). Auch Therapeuten regen Klienten zum »Spielen« an. Was sind die Als-ob-Interventionen wie die Wunderfrage anderes als Einladungen zum »Spiel«? Wenn wir Klienten dazu ermutigen, sich eine Zeit lang getrennt vom Symptom zu sehen, ihre Störung zu externalisieren, werden wir zu Spielleitern, um den erstarrten Problemraum aufzubrechen, um den Bewegungsraum für Klienten und Therapeuten zu vergrößern.
Polyvalente Wirklichkeiten
Helmut Hauptmeier und Siegfried J. Schmidt beschreiben Literatur in ihrer »Einführung in die empirische Literaturwissenschaft« als gesellschaftliches Handlungssystem. Als solches weist es, wie andere Systeme, eine Außen-Innen-Differenzierung auf sowie typische Funktionen, die von keinem anderen System erfüllt werden. Bei der Frage nach der Außen-Innen-Differenzierung konzentrieren sich die beiden Literaturwissenschaftler auf Konventionen. Diese kennzeichnen Systeme, regulieren »das Handeln, ›im Inneren‹ […] und [grenzen] es, ›nach außen‹ vom Handeln in anderen Systemen [ab]« (Hauptmeier u. Schmidt 1985, S. 13).
Zwei Konventionen und Normen gelten für alle Systeme – die Tatsachen-Konvention und die Monovalenz-Konvention. Wer in unserer Gesellschaft etwas behauptet, muss dies so tun, dass man entsprechend dem geltenden Wirklichkeitsmodell abwägen kann, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. Die Äußerung muss also die Tatsachen-Konvention erfüllen. Der Monovalenz-Konvention zufolge wird von dem, der etwas behauptet, erwartet, dass seine oder ihre Aussage so eindeutig wie möglich ist, also monovalent.
Im System der Literatur werden diese Konventionen allerdings von zwei anderen überlagert: Wer im Literatursystem handelt, kümmert sich nicht darum, ob seine oder ihre Aussage als falsch oder wahr gilt, sondern darum, ob sie »poetisch wichtig« ist (ebd., S. 17): »Nicht die auf das gesellschaftlich gültige Wirklichkeitsmodell bezogene ›Wahrheit‹ macht einen Text […] zu einem literarischen Text, sondern seine als poetisch wichtig festgestellten und bewerteten Qualitäten.« Literarische Texte können entsprechend der Polyvalenz-Konvention von Lesenden ganz unterschiedlich interpretiert werden (ebd., S. 18): »Nicht Eindeutigkeit von Beziehungen auf das sozial geläufige Wirklichkeitsmodell ist das Ziel des Literatur-Produzenten, sondern produktive, poetisch bewertbare Bedeutungs- und Bewertungsmöglichkeiten, die Literatur-Rezipienten unter verschiedenen Bedingungen auf jeweils subjektiv optimale Weise realisieren (können).« Die Tatsachen-Konvention und die Monovalenz-Konvention werden im Literatursystem von der Ästhetik-Konvention und der Polyvalenz-Konvention überlagert.
Polyvalenz ist auch eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Psychotherapie. Für systemische Psychotherapeuten kann die Welt ihrer konstruktivistischen Sichtweise wegen nicht eindeutig sein. Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeiten. Die Welt ist mehrdeutig, polyvalent. Dieses Wissen gehört zu unseren Grundvoraussetzungen.