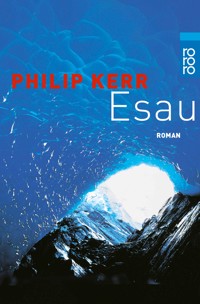
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Thriller: Gibt es den Yeti doch? Jack Furness, ein kalifornischer Bergsteiger, will einen der höchsten Gipfel Nepals bezwingen. In einer tückischen Eiswand stürzen er und seine Begleiter ab. Doch in einer Gletscherspalte macht Jack einen aufsehenerregenden Fund ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Philip Kerr
Esau
Thriller
Über dieses Buch
Ein atemberaubender Thriller: Gibt es den Yeti doch? Jack Furness, ein kalifornischer Bergsteiger, will einen der höchsten Gipfel Nepals bezwingen. In einer tückischen Eiswand stürzen er und seine Begleiter ab. Doch in einer Gletscherspalte macht Jack einen aufsehenerregenden Fund …
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman, «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024
Copyright (c) 1997 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Esau» Copyright (c) 1996 by Philip Kerr
Covergestaltung Cathrin Günther, Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-02252-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Charles Forster Kerr
Aber Esau mein Bruder
ist ja ein haariger Mann,
und ich bin ein glatter Mann.
1. Mose 27,11
Erster TeilDie Entdeckung
Fehlende Bindeglieder und die Frage der
Verwandtschaft des Menschen mit dem Tierreich
sind immer noch von so viel magischem Glanz
umgeben, daß es wohl immer schwer sein
wird, das vergleichende Studium lebender oder
fossiler Primaten von den Mythen zu befreien, die das
unbewaffnete Auge aus einem Wunschbrunnen
der Träume hervorzaubern kann.
Solly Zuckermann
Eins
Großes geschieht, wenn Mensch und Berg sich treffen.
William Blake
Wie ein Schwarm von Brautschleiern, Überreste einer Gigantenhochzeit im Himmel, hingen die scharfen Muster der Eisfalte, tief in die Wand des Machhapuchhare eingegraben, im blendenden Schein der Nachmittagssonne hoch über dem Dröhnen in seinem Kopf. Mühsam suchten seine Fußzehen Halt an der senkrecht aufsteigenden Eiswand. Unter den Steigeisen an seinen Füßen lag der gähnende Abgrund des Südlichen Annapurnagletschers. Der schwere Rucksack ließ seinen Rücken schmerzen. Dreizehn Kilometer hinter ihm erhob sich der Gipfel des Annapurna wie ein gigantischer Krake über die Ebene. Nicht daß er der Versuchung nachgegeben hätte hinunterzublicken. Solange er damit beschäftigt war, mit einem Eispickel, der in sechstausend Meter Höhe immer schwerer wurde, Hand- und Fußgriffe in die Wand zu schlagen, hatte er keine Zeit, entspannt im Seil zu hängen und die Aussicht zu genießen. Wenn ein Gipfel zu besteigen war, interessierte ihn die Landschaft nicht; besonders dann nicht, wenn es sich um einen Gipfel handelte, dessen Besteigung offiziell verboten war.
Die Ausländer nannten ihn den Fischschwanzgipfel, als wollten sie betonen, auf wie viele Arten der gewundene verwinkelte Berg sich menschlichem Zugriff entziehen konnte. Dem Vorschlag eines sentimentalen britischen Aussteigers folgend, der es 1957 nicht geschafft hatte, den Gipfel zu erreichen, hatte die Regierung von Nepal angeordnet, daß der Machhapuchhare, ein Berg, dreimal so groß wie das Matterhorn, auf ewige Zeit rein und unberührt bleiben solle. Infolgedessen war es inzwischen unmöglich geworden, die Genehmigung zur Besteigung des schönsten und herausforderndsten unter allen Gipfeln rund um das Annapurna-Schutzgebiet zu bekommen.
Die meisten Bergsteiger hätten es aus Angst vor den Folgen dabei bewenden lassen. Gefängnisstrafen und Geldbußen konnten verhängt werden; zukünftige Expeditionsgenehmigungen konnten verweigert werden; die Bereitstellung von Sherpas konnte versagt werden. Aber für Jack waren dieser Berg und das Verbot, ihn zu besteigen, zu so etwas wie einer persönlichen Beleidigung und Herausforderung in einem geworden; hatte er doch öffentlich angekündigt, alle größeren Gipfel des Himalaja bezwingen zu wollen. Und sobald sein Partner und er ihre offiziell genehmigte Besteigung der Südwestwand des Annapurna vollendet hatten, beschlossen sie, sich ohne Genehmigung an seine Besteigung zu machen. Es sollte eine Blitzbesteigung werden, und das Ganze hatte wie eine gute Idee geklungen, bis das schlechte Wetter zuschlug.
Er zog sich von einer der Stufen hoch, die er in den Fels geschlagen hatte, streckte den Eispickel nach oben und schlug ihn in die Eiswand.
Es war schlimm genug, dachte er, daß man die Besteigung des Kangchenjunga ein paar Meter unterhalb des Gipfels abbrechen mußte, um die heilige Höhe nicht zu entweihen. Aber daß es einen Berg geben sollte, den man überhaupt nicht besteigen durfte, war einfach undenkbar. Warum sollte man sich überhaupt ans Bergsteigen machen, wenn nicht um den Gesetzen und Vorschriften der Ebene zu entgehen? Jack war es gewohnt, daß ihm jemand erzählte, dieser Berg oder jene Wand seien unbesteigbar. Meistens war es ihm gelungen, zu beweisen, daß sie unrecht hatten. Aber daß man ihm verbot, einen Berg zu besteigen, und daß es auch noch eine Regierung war, die das tat – das war etwas anderes. Soweit ihr Verbindungsmann in Katmandu informiert war, befanden sie sich immer noch auf dem Annapurna. Sie hatten sich das Schweigen ihrer Sherpas mit teuren Bestechungsgeldern erkauft. Jack ließ sich von niemandem sagen, wo er klettern durfte und wo nicht.
Allein der Gedanke machte ihn wütend genug, daß er den Pickel noch energischer schwang. Ein Schauer von Eiskrümeln und Schmelzwasser sprühte ihm ins Gesicht. Erst als er eine Stufe unter seinem Stiefel bröckeln spürte, hielt er inne, um sein Gleichgewicht wiederzufinden und vorsichtig eine neue Eis-schraube einzusetzen.
Das war gar nicht einfach, wenn man Wollhandschuhe von Dachstein trug.
«Wie kommst du voran?» rief ihm sein Partner von fünfzehn oder sechzehn Metern weiter unten zu.
Jack antwortete nicht. Nach dem Aufstieg in der Eiswand taten ihm alle Muskeln weh. Mit letzter Kraft hielt er sich mit einer Hand an der Wand fest und versuchte, die Schraube ins Eis zu drehen. Seine Finger waren taub vor Kälte. Wenn er nicht bald aus dieser Wand herauskam, riskierte er ernsthafte Erfrierungen. Er hatte keine Zeit zu erklären, wie er vorankam. Oder daß er nicht vorankam. Wenn sie nicht bald oben waren, würden sie in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Die Tage, die sie in einem Zelt in der Wand verbracht hatten, hatten wertvollen Brennstoff gekostet. Jetzt reichte er nur noch für einen, allenfalls zwei Tage, und ohne Brennstoff konnten sie keinen Schnee für ihren Kaffee schmelzen.
Endlich saß die Schraube fest, und er konnte seinen Arm entlasten. Was hätte er nicht alles für fünf Minuten bei seinem Chiropraktiker zu Hause in San Francisco gegeben! Er atmete die dünne Bergluft in tiefen Zügen ein und versuchte, das Pochen in seiner Schläfe zur Ruhe zu bringen.
Jack konnte sich an keinen anstrengenderen Aufstieg im Eis erinnern. Selbst der Annapurna war ihm nicht so schwierig vorgekommen. Je näher er dem Gipfel kam, desto mehr ähnelte der Machhapuchhare einem Turm, weniger einem Fischschwanz als einer Speerspitze, die ein gigantischer unterirdischer Krieger durch den Boden hochgetrieben hatte. Es gab keinen Zweifel: Wandbesteigungen in großer Höhe waren die letzte Herausforderung für jeden modernen Alpinisten. Und die gotischen Kirchtürme des Machhapuchhare, steil wie der steilste New Yorker Wolkenkratzer, stellten die endgültige Herausforderung dar. Was für ein Narr er doch war! Jetzt kam es erst einmal darauf an, die Besteigung zu Ende zu bringen, bevor die Behörden entdeckten, was er tat.
Das Hämmern in seiner Schläfe schien nachzulassen.
Nur daß ihm jetzt ein seltsames Pfeifen in den Ohren zu Be-wußtsein kam. Zuerst ähnelte es einem Hörsturz, dann wurde es lauter und immer lauter, bis das Pfeifen sich in das Donnern eines Kanonenschusses von einem Kriegsschiff in einer fernen Bucht verwandelte. Das Pfeifen wurde zu betäubendem Donner, und er fragte sich, ob er unter irgendwelchen unheildrohenden Auswirkungen höhenbedingten Druckmangels litt: einem Lungen-ödem etwa oder sogar einer Gehirnblutung.
Einen kurzen und grauenhaften Augenblick lang hörte Jack, wie die Schrauben, die ihn an der Felswand hielten, im Eis knirschten. Der ganze Berg erbebte, und Jack schloß die Augen.
Ein, zwei Sekunden vergingen. Das Geräusch verebbte irgendwo über ihm auf dem Gletscher. Er blieb in der Wand. Der Atem, den er, ohne es zu merken, angehalten hatte, entwich seinen aufgesprungenen Lippen als hörbarer Ausdruck der Dankbarkeit und Erleichterung, als er die Augen wieder öffnete.
«Was zum Teufel war das?» rief ihm Didier von weiter unten in der Eiswand zu. «Einen Augenblick hatte ich das Gefühl, daß mir gleich schlecht wird.»
«Gut, daß du es auch gehört hast», sagte Jack.
«Klang, als käme es von irgendwo auf der anderen Seite des Bergs. Was war das?»
«Ich würde sagen, ein bißchen weiter nördlich.»
«Eine Lawine vielleicht?»
«Dann aber eine verdammt große», sagte Jack.
«Hier oben sind alle Lawinen groß.»
«Könnte sogar ein Meteoriteneinschlag gewesen sein.»
Jack hörte, wie Didier lachte.
«Scheiße», sagte Didier. «Als ob das alles nicht schon gefährlich genug wäre. Jetzt muß der Allmächtige auch noch mit Steinen nach uns werfen.»
Jack stieß sich von der Wand ab, legte sich ins Seil und warf einen Blick auf die überhängenden Eismassen über seinem Kopf.
«Scheint okay zu sein», rief er.
Vor seinem inneren Auge tauchte das Bild der Lawinenspur auf, die Didier und er unter dem Grat gesehen hatten, auf dem sie sich jetzt befanden: eine unerfreuliche Erinnerung an das Risiko, das er und sein französisch-kanadischer Partner eingingen.
«Wir werden es früh genug erfahren», fügte er leise hinzu.
Eine Woche bevor sie im Annapurna-Schutzgebiet angekommen waren, um ihre Zweimannbesteigung des zehnthöchsten Bergs der Welt – und dann seines verbotenen Zwillingsgipfels – mit minimaler Ausrüstung zu beginnen, war eine viel besser ausgerüstete deutsche Expedition an der Südwand des Lhotse, des schwarzen Gipfels, der das berüchtigte Südjoch mit dem Everest verband, von einer Lawine in den Abgrund gerissen worden. Es hatte sechs Tote gegeben. Ein Sherpa, der den Unfall beobachtet hatte, erzählte, eine ganze Eisnadel von ein paar hundert Tonnen Gewicht sei über ihnen eingestürzt.
Um sich vor ähnlichen Eisschlägen zu schützen, hatte Jack zunächst eine Route seitlich des Grats eingeschlagen, aber jetzt war er genau in der Gefahrenzone. Über ihm hielt nichts als der Frost einen riesigen Eisklumpen am Felsen fest.
Wenn der Haufen abstürzte, sagte er sich, war es aus mit ihnen. Um sich von der Gefahr abzulenken, versuchte er sich an den Namen des griechischen Helden zu erinnern, den Zeus dazu verurteilt hatte, in alle Ewigkeit einen schweren Felsblock den Hügel hochzuwälzen. Da der Stein ständig wieder herabrollte, nahm die Aufgabe kein Ende. Wie hieß er doch gleich?
Aber noch während der Gedanke durch Jacks Kopf ging, wehte ein langer Geisterfinger aus lockerem Puderschnee von der Kante des Überhangs herab und vermischte sich mit der dünnen Wolkenspur, die über den makellos blauen Himmel zog. Ein wenig davon sprühte Jack ins Gesicht und erfrischte ihn wie ein Hauch von Eau de Cologne. Er leckte die kühle Feuchtigkeit von den aufgesprungenen Lippen, hob den Eispickel und begann, den nächsten Handgriff auf der gefährlichen Route zu hacken, die er geplant hatte. Sein Weg würde ihn zur Kante des Grats, weg von der Drohung eisiger Vernichtung führen.
Er hielt inne, als Hunderte von kleinen Eis- und Schneescherben wie winzige todessüchtige weiße Lemminge vom Berggrat herabstürzten, und als ihr Ansturm endlich nachließ, merkte er, daß das Pochen in seiner Schläfe wieder eingesetzt hatte.
«Sisyphos», mumelte Jack, der sich plötzlich an den Namen des Griechen erinnerte, und beendete die Arbeit an seinem Handgriff. «Es war Sisyphos, der Listenreiche.» Eine Ewigkeit immer neuer Möglichkeiten. So jedenfalls schien es. Der Felsen über Jacks Kopf konnte nur einmal herabstürzen. Und damit wäre es dann auch erledigt. Der endgültige Sturz der Menschheit. Er zog ein Stück Seil durch die Kletterhaken und bewegte sich weiter an dem vereisten Felsgrat hoch.
«Je früher ich unter diesem Bastard raus bin, desto besser.»
Seine Ohren fingen wieder an, ihn zu täuschen. Diesmal war es, als sei er plötzlich taub geworden. Jack blieb auf der Stelle stehen und wiederholte seine letzten Worte. Aber es war, als hätte der Berg sie verschlungen. Er fühlte, wie seine Stimme im Mund vibrierte, aber er hörte keinen Laut. Es war, als würde jedes Geräusch auf der Eis wand in ein geheimnisvolles Vakuum gesogen. Es herrschte Totenstille wie vor einem Sturm, und das Gefühl von Bedrohung war überwältigend.
Er sah nach unten und rief Didier etwas zu, aber wieder wurde ihm das Wort aus dem Mund gerissen und ging im Donnergrol-len unter. Eine Sekunde später warf der Berg achselzuckend Tausende von Tonnen Schnee und Eis von sich, und der blaue Himmel verschwand hinter dem eisigen schwarzen Vorhang einer gewaltigen Lawine.
In eine gewaltige Kumuluswolke von erstickendem Schnee und feuchtem Dunst gehüllt wie ein alttestamentarischer Prophet, spürte Jack, wie ein eifernder Gott ihn vom Felsaltar der Berghöhe riß.
Er schien eine Ewigkeit zu fallen.
Im Bauch des weißen Wals gefangen, ohne Anzeichen für das, was außerhalb der wirbelnden Welt seines Körpers geschah, spürte er weder Geschwindigkeit noch Beschleunigung, nicht einmal Gefahr. Nichts als die überwältigende Macht der Elemente. Es war, als halte ihn der Winter in eisernem Griff gefangen. Nur die Kälte hielt seine Glieder zusammen, und wenn er unten ankam, würde er schmelzen und verschwinden wie Jack Frost.
Fast ebenso plötzlich, wie sie begonnen hatte, schien sich die Richtung der Lawine zu ändern, und Jack, der den zunehmenden Druck rund um seinen Körper fühlte, verfiel in instinktive Schwimmbewegungen. Er stieß sich mit den Beinen ab, streckte die Arme aus und bemühte sich, an eine imaginäre Oberfläche aufzutauchen.
Dann hörte alles auf. Es gab nur noch Dunkelheit und Schweigen.
Seine Beine waren frei, aber sein ganzer Oberkörper war schneebedeckt. Mühsam kroch Jack rückwärts und ließ sich auf den harten Felsboden fallen. Ein paar Minuten lang blieb er betäubt und blind im Schnee liegen. Er entdeckte, daß er die Arme bewegen konnte, und befreite Nase, Mund, Ohren und Augen vom Schnee. Er sah sich um und entdeckte, daß er sich in einem Bergschrund befand, einer tiefen horizontal verlaufenden Gletscher-spalte. Der Eingang zum Bergschrund war schneeverweht, aber das Licht, das sich seinen Weg durch den Schnee bahnte, schien darauf hinzuweisen, daß er nicht allzu tief verschüttet war.
Das Seil lag immer noch eng an Jacks Taille an. Es führte durch die Schneebarriere. Er zog kräftig daran. Aber noch während er sich seinen Weg durch den Schnee bahnte und das Seil aufrollte, wurde ihm klar, daß Didier tot sein mußte. Schon daß er selbst noch am Leben war, war unwahrscheinlich genug.
Nachdem er ein paarmal ruckartig daran gezogen hatte, blieb ihm das ausgefranste Seilende in der Hand. Ein Blick durch die Öffnung des Bergschrunds auf den schneeverwehten Abhang genügte, um seine schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Es war eine große Lawine gewesen. Der ganze untere Gletscher war aus einer Höhe von sechseinhalbtausend Metern auf das Lager Nr. 1 gerutscht, das sie auf einem Rognon in einer Höhe von etwas über fünftausend Metern errichtet hatten. Die Sherpas im Lager hatten genausowenig Überlebenschancen gehabt wie Didier.
Irgendwie hatte die Lawine ihn genau an die Mündung des Bergschrunds getragen. Wäre er in einem anderen Winkel gelandet, hätte der Aufprall auf den harten Fels ihn getötet. Statt dessen hatte ihn der Bergschrund vor dem tödlichen Eisschutt beschützt, der jetzt den Weg zurück über die Nord wand zum Rognon und zum Lager verdeckte.
Jack war es übel vor Schrecken, und zugleich verspürte er Begeisterung darüber, daß er dem Unglück unversehrt entkommen war. Er setzte sich und fing an, Schnee und Eis aus seinem Jackeninneren zu entfernen. Zugleich dachte er darüber nach, was er als nächstes tun sollte. Nach seiner Schätzung mußte das Lager Nr. 2 am unteren Ende der Felswand etwa fünfhundert Meter tiefer liegen. In einer Höhe von fünftausendfünfhundert Metern lag es genau da, wo die Felswand sich über den Gletscher erstreckte, und das konnte die beiden Sherpas vor dem Schlimmsten bewahrt haben, obwohl sie sicher viel tiefer verschüttet waren als er.
Dennoch wußte er, daß er den Abstieg nicht vor Einbruch der Dunkelheit bewältigen konnte. Er hatte sein Funkgerät verloren, und die Abstiegsroute war zu schwierig, um sie kurz vor Sonnenuntergang in Angriff zu nehmen. Außerdem hatte er noch einen Rucksack mit Vorräten auf dem Rücken, und es war ihm klar, daß das Beste, was er tun konnte, der Versuch war, die Nacht im Bergschrund zu verbringen und sich frühmorgens an den Abstieg zu machen.
Jack legte den Rucksack ab und richtete sich mühsam auf, um sein Schlafquartier für diese Nacht zu besichtigen. Beinahe hätte ihn einer der vielen langen Eiszapfen aufgespießt, die von der gewölbten Decke über ihm hingen und sich wie die Zähne eines prähistorischen Raubtiers in die Dunkelheit der Höhle bohrten. Der Wurfspieß aus Eis brach ab und zerschellte am Boden.
Er öffnete den Rucksack und zog eine Taschenlampe heraus.
«Nicht ganz der Standard des Vier Jahreszeiten», sagte Jack. Und dann fiel ihm wieder ein, daß die Höhle genausogut sein Grab hätte werden können.
Wenn sie nur mit der Südwestwand des Annapurna zufrieden gewesen wären. Den meisten Bergsteigern hätte das gereicht. Ihr eigenes Glück war ihnen zum Verhängnis geworden, denn ihre Besteigung des Annapurna hatte bei so gutem Wetter stattgefunden, daß sie in der Hälfte der vorgesehenen Zeit damit fertig geworden waren. Wäre da nicht sein Ehrgeiz gewesen, wären Didier Lauren und die Sherpas unten auf dem Gletscher vielleicht noch am Leben.
Er setzte sich und ließ das Licht der Taschenlampe über die Höhlenwände wandern.
Der Bergschrund hatte die Form eines liegenden Trichters. Am Eingang war er vielleicht zehn Meter weit und sieben Meter hoch. Nach hinten verengte er sich zu einem Tunnel mit einer Weite von vielleicht anderthalb Metern.
Es blieb ihm viel Zeit, und er beschloß nachzusehen, wie weit der Tunnel sich in den Berg hineinbohrte. Er kroch bis ans Ende der Höhle und ließ den hellen Strahl der Halogenlampe in die dunkle Öffnung fallen.
Jack wußte, daß der Himalaja die Heimat von Bären und Languren, vielleicht sogar von Leoparden war, aber er hielt es für unwahrscheinlich, daß sie sich an einem so schwer zugänglichen Ort weit über der Baumgrenze niedergelassen haben sollten.
Auf allen vieren begann er, den Tunnel entlangzukriechen.
Nach etwa hundert Metern nahm der Tunnel eine Wendung nach oben. Er erinnerte ihn an die Grabkammer der Königin in der Großen Pyramide von Gizeh: kein Trip für Ängstliche, für klaustrophobisch Begabte oder orthopädisch Behinderte. Nach kurzem Zögern entschloß sich Jack, weiterzumachen und herauszufinden, wie tief die Höhle wirklich war.
Zum größten Teil gehörte das Gebirge zur präkambrischen Kontinentalkruste des Nordrands des indischen Subkontinents und bestand aus Schiefer und kristallinem Fels. Aber hier im Bergschrund und näher am Gipfel war es Muschelkalkstein aus einer Zeit, als das höchste Gebirge der Welt noch auf dem Grund des seichten Thetysmeers lag. Die paläozoischen Ablagerungen hatten sich seit Beginn der Bergbildung im Himalaja vor fünfundfünfzig Millionen Jahren um zwanzig Kilometer gehoben. Jack hatte auch schon gehört, daß es Teile der Bergkette gab, die sich immer noch um bis zu einen Zentimeter im Jahr erhöhten. Der Everest, den Didier und er ohne Sauerstoffmaske bezwungen hatten, war fast einen halben Meter höher als der Everest, den Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing 1953 bestiegen hatten.
Die Steigung des Tunnels nahm ab, und gleichzeitig hob sich die Decke, so daß er wieder aufrecht stehen konnte. Jack ließ den gebündelten Strahl der Taschenlampe senkrecht nach oben fallen und stellte fest, daß er sich in einer riesigen Grotte befand. Er konnte gerade noch sehen, daß die Decke außerhalb der Reichweite seiner Taschenlampe lag, und kam zu dem Schluß, sie müsse mindestens dreißig Meter hoch sein.
Er stieß einen lauten Schrei aus und lauschte der Geometrie des Echos, das seine Stimme von den unsichtbaren Wänden und der unsichtbaren Decke abprallen ließ. Vom Widerhall in einer kalten dunklen Echokammer verstärkt und verlängert, drang ihm der Klang bis in die Knochen. Wenn er allein nach dem Klang ging, hätte er nicht in einer Grotte unter dem Machhapuchhare stehen brauchen, sondern im zum Himmel aufragenden Langhaus einer verfallenen und vergessenen gotischen Kathedrale, die zum verborgenen Thronsaal eines geheimnisvollen und gefährlichen Bergkönigs geworden war. Das Kirchenschiff, das einst dazu bestimmt gewesen war, die menschliche Stimme im Gebet und im Loblied zu Gott im Himmel hinaufzutragen, war jetzt von Grabesstille erfüllt.
Wie lange hatte hier Schweigen geherrscht, bevor er die Ruhe des Berges durch seine Anwesenheit entweiht hatte? War er das erste menschliche Wesen, das seit der Entstehung des Himalaja vor anderthalb Millionen Jahren die Höhle betreten hatte?
Erst hielt er das, was er im künstlichen Licht seiner Taschenlampe sah, für einen Felsbrocken, und es dauerte ein wenig, bevor seine Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten und erkannten, was es war, das seinen Blick in starrer Ruhe erwiderte. Vom feuchten Lehmboden der Höhle sah ihm das verknöcherte Gesicht eines melonengroßen, nahezu vollständigen Schädels entgegen.
Er fiel auf die Knie und machte sich sofort daran, mit behandschuhten Fingern Staub und Schutt von seinem Fund zu wischen. Jack wußte, daß der Himalaja reich an Fossilien war. Nur wenige Kilometer weiter, am Nordhang des Dhaulagiri, des siebthöchsten Bergs der Welt, hatte er einst ein Ammonshorn gefunden, ein spiralförmiges Weichtier aus einer Zeit von vor einhundertfünfzig oder zweihundert Millionen Jahren. Muktinath war für seine Fossilien aus dem späten Jura bekannt. Im Westen hatte man im Churen Himal in Nepal und in den Hügeln von Siwalik in Nordpakistan zahlreiche wichtige hominide Fossilien gefunden. Aber dies war das erste Mal, daß Jack selbst einen Fund gemacht hatte.
Er hob den Schädel auf und betrachtete ihn im Schein seiner Taschenlampe gründlich. Der Unterkiefer fehlte, aber im übrigen schien er in bemerkenswert gutem Zustand zu sein. Der Oberkiefer war fast vollständig erhalten, und die Schädeldecke wies keine Sprünge auf. Der Schädel war größer, als er am Boden ausgesehen hatte, und einen Augenblick lang dachte er, sein Fundstück könne von einem Bären stammen, bis ihm auffiel, daß die typischen großen Eckzähne fehlten. Der Schädel wirkte hominid, und nachdem er ihn noch ein paar Minuten eingehend untersucht hatte, war er sich dessen ganz sicher. Aber er hatte keinerlei Vorstellung davon, ob das, was er betrachtete, mit irgendeinem der hominiden Fossilien verwandt war, für die der Himalaja bekannt war, ja ob es sich auch nur überhaupt um ein Fossil handelte. Das war kein Gebiet, auf dem er sich besonders gut auskannte.
Er dachte an den einen Menschen auf der Welt, der ihm alles, was es über den Schädel zu wissen gab, würde erzählen können. Die Frau, die einmal seine Geliebte gewesen war und die sich beharrlich weigerte, ihn zu heiraten, war eine bekannte Paläoanthropologin an der University of California in Berkeley. Für ihn war sie einfach Swift. Vielleicht würde er ihr seinen Fund schenken. Zweifellos würde sie den Schädel mehr zu schätzen wissen als irgend etwas anderes, das er ihr als Andenken aus Nepal versprochen hatte, einen Teppich, zum Beispiel, oder ein Thangka.
Fast konnte er die unmoralischen Ratschläge hören, die Didier ihm gegeben hätte.
«Typisch Didier», sagte Jack traurig. «Aber vorher sollte ich noch über das kleine Problem nachdenken, wie ich von diesem Berg herunterkommen soll.»
Mit dem Schädel in den Händen kehrte Jack zum Eingang des Bergschrunds zurück. Er inspizierte seinen vollgestopften Rucksack und entschied, daß irgend etwas zurückbleiben mußte, wenn er den Schädel mit ins Tal schaffen wollte. Aber was? Jedenfalls nicht der Schlafsack. Nicht der Erste-Hilfe-Kasten. Weder die Socken noch die Notrationen oder die Kamera, eine Nikon F 4.
Er fing an, den Rucksack auszupacken.
Eine halbvolle Flasche Macallan Malzwhisky fiel ihm in die Hände. Ganz abgesehen davon, daß Didier und er ihn gerne tranken, war Whisky ein angenehmeres Mittel gegen Erfrierungen als gefäßerweiternde Medikamente wie Ronicol. Bergsteigen in großer Höhe war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Alkoholgenuß sich aus medizinischen Gründen rechtfertigen ließ. Und jetzt lag ein Notfall vor.
Jack setzte sich auf den Boden und öffnete die Flasche. Dann brachte er einen Toast auf seinen Freund aus und machte sich daran, sie zu leeren.
Zwei
Dem Helm von grünem Stahl sei Dank …
Robert Lowell
«Indien.»
Das Telefon klingelte.
«Pakistan.»
Wieder klingelte das Telefon. Ein Mann drehte sich im Bett um.
Wenn das Telefon in den letzten Wochen nachts geklingelt hatte, hatte es meist mit den sich ständig verschlechternden Beziehungen zwischen den beiden Erbfeinden zu tun gehabt.
Der Mann wand sich unter der Bettdecke hervor, knipste die Nachttischlampe an, griff zum Hörer und lehnte sich gegen die gepolsterte Kopfstütze. Ein schneller Blick auf die Uhr belehrte ihn, daß es in Washington D.C. jetzt Viertel nach vier Uhr früh war. Aber seine Gedanken waren anderswo, fünfzehntausend Meilen entfernt. Auf dem indischen Subkontinent war es jetzt der Spätnachmittag eines heißen Sommertags, und die Verlautbarungen indischer und pakistanischer Politiker heizten die Atmosphäre zusätzlich auf. Sie und die schreckliche Möglichkeit, daß einer von ihnen auf die Idee kommen könnte, ein nuklearer Präventivschlag gegen den Gegner sei die beste Chance, einen immer noch nicht erklärten Krieg zu gewinnen.
«Perrins», sagte der Mann gähnend, obwohl er hellwach war. Dafür hatte eine kräftige Magenverstimmung als Folgeerscheinung eines späten Abendessens auf dem Potomac an Bord der Präsidentenyacht Sequoia gesorgt.
Er lauschte der ernsten Stimme am anderen Ende der abhörsicheren Leitung aufmerksam und stöhnte.
«Okay», sagte er. «Ich bin in einer halben Stunde da.» Er legte den Hörer auf und fluchte leise.
Seine Frau war wach und blickte ihn beunruhigt an.
«Doch nicht etwa …?»
«Gott sei Dank, nein», sagte er und schwang die Beine aus dem Bett. «Jedenfalls noch nicht. Aber ich muß trotzdem ins Büro. Meine Anwesenheit ist dringend erforderlich.»
Sie warf die Bettdecke beiseite.
«Kein Grund, warum du aufstehen müßtest», sagte er. «Schlaf weiter.»
Sie stand auf und warf einen Morgenrock über.
«Ich wollte, ich könnte schlafen, Liebling», sagte sie. «Aber nicht nach dem Abendessen. Mir ist zumute, als sei ich wieder schwanger. Schwanger und über die Zeit.» Sie machte sich auf den Weg in die Küche. «Ich mache Kaffee.»
Perrins schlurfte verschlafen ins Badezimmer und stellte sich unter die eiskalte Dusche. Kaltes Wasser und Kaffee dürften das einzige sein, was er an diesem Tag für sein Herz tun konnte; und gestern war es genauso gewesen.
Fünfzehn Minuten später war er angezogen und stand auf der Veranda des Backsteinhauses, gab seiner Frau einen Abschiedskuß und stieg auf den Rücksitz der schwarzen Cadillac-Limousine, die sein Büro nach Alexandria geschickt hatte, um ihn abzuholen.
Weder der Fahrer noch der bewaffnete Leibwächter auf dem Vordersitz neben ihm sprachen auf der Fahrt über den Henry G. Shirley Memorial Drive nach Norden ein Wort. Sie waren beide daran gewöhnt, zu sprechen, wenn man sie etwas fragte, wie Perrins es von den Leuten erwartete, die ihn seit einem Jahr fuhren und beschützten. Sie wußten, daß ein Mann, der im Morgendämmern zu einer Sitzung im Pentagon unterwegs war, wichtigere Dinge im Kopf hatte als die ungewöhnlich kalte Witterung oder die Baseballergebnisse.
Südlich vom Nationalfriedhof in Arlington machte die Straße eine Biegung nach Osten, und der vertraute Betonklotz des größten Bürogebäudes der Welt wurde sichtbar. Perrins fand es nur angemessen, daß das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten sein Hauptquartier in Sichtweite der Amerikaner hatte, die im Krieg gefallen waren.
Der Cadillac setzte ihn vor einem der vielen Eingänge des Pentagons ab, und er machte sich auf den Weg ins Gebäude. Manchmal kam es ihm vor, als sei im Pentagon alles fünffach vorhanden: fünf Seiten, fünf Stockwerke, fünf konzentrische Wandelgänge und ein fünf Morgen großer Hof in der Mitte. Möglicherweise saßen ja, als er ankam, auch bereits fünftausend von den fünfundzwanzigtausend Angestellten des Pentagons an ihren Schreibtischen, obwohl es erst fünf Uhr früh war. Jedenfalls wirkte das Gebäude belebt.
Die Forschungsabteilung war im Abschnitt 4C956 untergebracht, und obwohl es offiziell eigentlich gar nicht existierte, war das Amt für Weltraumsysteme, wie es gelegentlich auch genannt wurde, unter dieser Adresse leicht zu finden. 4 bedeutete den vierten Stock, C den Wandelgang C. Wandelgang A blickte auf den Hof, und Wandelgang C war in der Mitte. 9 bedeutete Flur Nr. 9, und 56 war die Nummer der Bürosuite.
Perrins begab sich direkt in den Konferenzraum, wo schon eine Anzahl von Männern und Frauen, einige davon in Militäruniform, aber alle mit ernster Miene, auf Bill Reichhardt, den Leiter der Forschungsabteilung, warteten. Der betrat den Raum wenige Sekunden nach Perrins.
Reichhardt war groß, hager und grauhaarig. Er trug einen dunklen dreiteiligen Anzug, der genauso düster wirkte wie sein Gesichtsausdruck, und eine Brille im Stil von James Joyce, die Perrins an Gregory Peck in einem Fernsehfilm über die katholische Kirche zur Nazizeit erinnerte.
Reichhardt nahm seinen Platz am Kopf des Tischs ein, schenkte Perrins ein verkniffenes Lächeln und nickte dann einem schlanken Mann mit Brille zu, der einen dunkelgrauen Anzug trug und dessen hängende Schultern, glänzender Kahlkopf und fromm gefaltete Hände ihn aussehen ließen wie einen Priester, der den Herrn um seinen Segen für ihre Zusammenkunft bat. Perrins selbst als gläubiger Baptist hatte seine Gebete schon im Auto gesprochen.
«Also gut, Griff», sagte Reichhardt mit heiserer Stimme und zog den Hemdkragen vom Adamsapfel, als sei ihm außer dem Ärger darüber, daß man ihn aus dem Bett geholt hatte, noch etwas im Hals steckengeblieben. «Fang schon an!»
Der Mann, der wie ein Priester aussah, räusperte sich und fing an zu sprechen:
«Ich gehe davon aus, daß alle hier Anwesenden sich der Situation bewußt sind, wie sie aus den neuesten Meldungen der Satellitenbeobachtungsstation Cheyenne Mountain hervorgeht», sagte er. «Die Einzelheiten finden sich in den Berichten, die vor Ihnen auf dem Tisch liegen. Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen mitteilen, daß der Situationsbericht inzwischen sowohl von der norwegischen Satellitenkontrollstation in Tromsö wie von den Franzosen in Toulouse bestätigt worden ist.»
«Mein Gott», sagte irgend jemand, «wissen wir, wie es dazu gekommen ist?»
«Bisher haben wir keinerlei neue Informationen darüber erlangen können.»
«Griff», fragte jemand in Marineuniform, «wie sensibel ist das Material, über das wir sprechen?»
«Wir reden von Sicherheitsstufe SCI.»
SCI bezeichnete in allen Behörden der USA die höchste Geheimhaltungsstufe, nur für Angelegenheiten von kaum vorstellbarer Bedeutung, und stand für sensitive compartmental intelligence oder «abteilungsinterne Geheiminformation».
«Also was nun?» fragte jemand in Armeeuniform.
Reichhardt blickte von seinem Notizblock auf und hob die Augenbrauen.
«Was meinst du, Griff? Irgendwelche klugen Vorschläge?»
«Ich würde einen Aufklärungsflug in niedriger Höhe vorschlagen. Wir sollten die Gegend von ein paar U2-Maschinen überfliegen lassen. Aufklärungsflüge rund um die Uhr.»
«Alvin?» Reichhardt sah jetzt einen der Luftwaffenoffiziere an.
«Also mir würde der Materialschutz Sorgen machen. Ich meine das Flugzeug. Das Problem mit der U2 ist, daß sie keine besonders kräftige Maschine ist. Sie ist einzig für lange Flüge in geringer Höhe und bei niedrigen Geschwindigkeiten konstruiert. Man konnte sie schon in den frühen Sechzigern, als die Russen Gary Powers erledigten, leicht abschießen.» Er zuckte die Achseln. «Und heute erst recht. Andererseits …»
Perrins nickte zustimmend.
«Nach meiner Einschätzung», sagte er und unterbrach seinen Vorredner, «werden beide beteiligten Seiten nicht begeistert sein, wenn sie irgendeine Art militärischer Einmischung seitens der Vereinigten Staaten in der Gegend bemerken. Die Inder halten uns für die natürlichen Verbündeten Pakistans. Das Problem ist natürlich, daß es, seit die ganze Geschichte angefangen hat, die Chinesen waren, die die Pakistanis unterstützt haben, und nicht wir. Wenn eine dieser U2-Maschinen abgeschossen wird, könnte das unsere Chance beeinträchtigen, als Vermittler einen Frieden auszuhandeln.»
«Haben wir das vor?» fragte Reichhardt. «Wollen wir als Vermittler einen Frieden aushandeln?»
«Wir haben keinerlei strategische Vorteile davon, wenn ein Krieg ausbricht, Bill.»
Reichhardt nickte bedächtig mit dem Kopf, betrachtete aufmerksam den Umschlag des Berichts, der vor ihm lag, und klopfte mit der Spitze seines Bleistifts so lange darauf herum, bis sich die Punkte zu einer neuen Konstellation zusammenfügten.
«Arvin? Du sagtest: ‹andererseits›. Also?» gab er dem Mann von der Luftwaffe sein Stichwort.
«Wenn es andererseits um erstklassige Luftaufnahmen geht, gibt es nichts, das besser geeignet wäre als die U2. Wenn wir uns darauf beschränken würden, nur ganz wenige Missionen zu fliegen, das aber bei optimalem Wetter, wenn, sagen wir einmal, weniger als 25 Prozent des Aufklärungsgebiets wolkenverhangen sind, könnte ich mir ein schnelles Resultat wesentlich besser vorstellen.»
«Natürlich haben sie dann bessere Bodensicht», wandte Perrins ein, «aber das gilt umgekehrt auch für die dortigen Flugabwehrgeschütze.»
«Dagegen kann man nichts machen», sagte Reichhardt ärgerlich. Er warf Perrins einen Blick zu und fuhr fort: «Ich verstehe, was du meinst, Bryan, aber kurzfristig gesehen werden wir das Risiko wohl eingehen müssen.»
«Deine Entscheidung, Bill.» Perrins zuckte die Achseln.
«Alvin? Sorgen Sie dafür, daß die U2-Maschinen schnellstens einsatzbereit sind.»
«Jawohl!»
«Kennwort …», Reichhardt klopfte sich mit dem Bleistift gegen die Zähne. «Irgendwelche Vorschläge? Ich würde lieber auf ein Kennwort aus dem Computer verzichten. Die Dinger sind so verdammt blödsinnig, daß ich sie mir nie merken kann.»
«Wir wär’s mit Ikarus?» sagte Perrins.
«Wohl kaum», entgegnete Reichhardt lächelnd. «Hieße das nicht das Schicksal herausfordern?»
Perrins erwiderte sein Lächeln gespielt harmlos.
«Wir wollen doch nicht, daß unsere Flügel schmelzen. Nein, wir nennen das Unternehmen Bellerophon. B-E-L-L-E-R-O-P-H-O-N.» Wieder lachte er leise und fügte dann hinzu: «Wenn du nicht weißt, wer das war, schlag nach, Bryan. Bellerophon ist auf dem Rücken des Pegasus in den Himmel geflogen.» Er lachte selbstgefällig. «Das sind die Vorteile eines Harvardstudiums.»
Perrins, der in Yale studiert hatte, nickte stumm. Die Tatsache, daß Zeus eine Bremse geschickt hatte, die das Pferd stach, und daß Bellerophon vom Pferd gefallen war, lag ihm auf der Zunge, aber er hielt sich zurück und beschloß, sein Wissen für die nächste Sitzung aufzusparen. Wenn es den U2-Maschinen gelang, etwas aufzuspüren, würde sich ohnehin niemand mehr für das Kennwort interessieren. Und wenn der Einsatz erfolglos blieb, konnte er Reichhardt immer noch an die wahre Bedeutung des Namens erinnern, als wäre sie ihm gerade erst eingefallen. Kindisch, aber befriedigend. Beim Nachrichtendienst war man dankbar für kleine Freuden. Besonders wenn man das Pentagon ärgern konnte.
Drei
Gottes erster Fehler: Der Mensch hatte keine Freude an den Tieren. Er machte sie sich untenan und wollte selbst kein Tier sein.
Friedrich Nietzsche
Das Gebiet der East Bay jenseits der Bay Bridge an der Schnellstraße, die aus San Francisco herausführte, umfaßte die Bezirke Alameda und Contra Costa. Oakland und Berkeley waren die naheliegendsten Ziele für einen Reisenden. Obgleich die beiden Städte praktisch nahtlos ineinander übergingen, trennte eine weniger offensichtliche Grenze als eine Hügelkette die Arbeiterstadt Oakland mit ihrem belebten Hafen von ihrer wohlhabenderen Nachbarstadt im Norden. Berkeley war eine Studentenstadt, und die University of California beherrschte ihre Hügel. Einige aufgeklärte Intellektuelle betrachteten Berkeley als die wichtigste Brutstätte des Geistes westlich von Chicago und nannten es das Athen der pazifischen Küste. Aber für die meisten Amerikaner – und gewiß für diejenigen, die sich an die Friedensbewegung der späten Sechziger und frühen Siebziger erinnern konnten – war Berkeley immer noch das Zentrum des Radikalismus. Drogen, Demos und Tränengas über dem People’s Park.
Die Wirklichkeit sah anders aus. Fast drei Jahrzehnte nachdem die Universität die größten Massenverhaftungen in der Geschichte Kaliforniens erlebt hatte, war Berkeley ruhiger geworden. Auf der Sproul Plaza vor dem Sather Gate, dem Eingang zum ältesten Teil des Campus, konnte man immer noch Aktivisten und Flugblattverteiler treffen. Aber für Doktor Stella Swift war Berkeley eine kleine Universitätsstadt und wies alle Vorzüge und Nachteile einer kleinen Universitätsstadt auf. Und nicht viel von dem, was in Berkeley als radikal galt, hätte den echten Linken imponiert, die Stella in ihrer Jugend als einzige Tochter zweier Leuchten der sozialistischen Bewegung erst in Australien und dann in England kennengelernt hatte. Swifts Vater Tom, Philosophieprofessor in Melbourne, Australien, und Schriftsteller, und ihre Mutter, Judith, eine erfolgreiche Künstlerin, war die Tochter Max Bergmanns, eines der Gründer der liberal-marxistischen Frankfurter Schule. Noch bevor sie das Studium der Humanbiologie in Oxford aufnahm, hatte Stella alle Zelebritäten der internationalen sozialistischen Szene kennengelernt, entdeckt, daß die Welt ihrer Eltern sie langweilte, und ihr ein für allemal genauso endgültig abgeschworen, wie einer der jungen Demonstranten, die auf der Sproul Plaza Flugblätter gegen die Nahostpolitik der Vereinigten Staaten verteilten, die konservativen Werte seiner Eltern ablehnte.
Sie überquerte den Platz im Schatten eines Glockenturms, den man den Campanile nannte, weil er angeblich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bekannteren Campanile von San Marco in Venedig trug, obwohl ihr diese Ähnlichkeit nicht so recht einzuleuchten vermochte, und dachte darüber nach, daß es ihr als Ausländerin ohne Wahlrecht leichtfiel, sich nicht um Politik zu kümmern und sich auf Forschung und Lehre zu konzentrieren. Eben deshalb hatte sie sich ursprünglich dazu entschlossen, ihr Graduiertenstudium der Paläoanthropologie in Berkeley aufzunehmen.
Den größten Teil ihres Arbeitstages verbrachte Stella Swift in der Kroeber Hall im Südosten des Universitätsgeländes. Sie betrat das Gebäude und machte sich auf den Weg zu einem der Hörsäle im ersten Stock, wo sie schon ein paar Dutzend Studierende des Grundstudiums erwarteten.
Sie legte die Aktentasche vor sich auf den Tisch und warf einen geringschätzigen Blick auf einen ihrer Studenten, einen zu groß geratenen Burschen namens Todd, der damit beschäftigt war, ostentativ ein Männermagazin zu lesen.
«Was lesen Sie da, Todd?» fragte Swift und stellte sich hinter ihn an den Tisch. «Pauken Sie Humanbiologie? Keine schlechte Idee. Soviel ich weiß, ist das eines Ihrer schwächsten Fächer.»
Einer von Todds Freunden lachte wiehernd und stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Swift nutzte diese kurzfristige Ablenkung, um ihm die Illustrierte aus den bananengroßen Fingern zu reißen, und begann nachdenklich darin zu blättern.
Todds Freund stieß ihm noch einmal den Ellbogen in die Seite, als wolle er ihn zu etwas anstacheln.
«Wenn Sie schon fragen», grinste Todd. «Da war eine Frau, die mich an Sie erinnert hat, Doktor Swift.»
«Wirklich?» fragte Swift kühl zurück. «Aufweicher Seite?»
«Seite zweiunddreißig.»
«Eines muß man sagen», bemerkte sie beim Umblättern. «Es ist tapfer von Ihnen, ein Blatt wie Penthouse mit aufs Universitätsgelände zu bringen, Todd. Hoffentlich hat Sie jemand über Ihre Rechte belehrt.»
«Über meine was?»
«Es gibt eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der zufolge jeder Verdächtige bei seiner Festnahme über seine Rechte belehrt werden muß.»
«Das hat er aber auch nötig», griente Todds Kumpel.
Swift fand die Seite und widmete sich aufmerksam der angeblichen Ähnlichkeit.
«Nun?» sagte Todd. «Was meinen Sie?»
Das Mädchen auf der Doppelseite war groß und grünäugig und hatte üppiges rotes Haar. Ihre Nase war zu lang, aber sie wirkte distinguiert, ja sogar intelligent und hatte einen breiten, sinnlichen Mund. Die Figur war üppig, aber Swift fand ihre eigenen Beine besser. Wenn sie von der Playmate-Pose und dem obszön scharlachroten Fingernagel absah, der das Höschen so beiseite schob, daß dem Betrachter ein großzügiger gynäkologischer Einblick gewährt wurde, konnte Swift eine kaum zu leugnende Ähnlichkeit entdecken.
«Sie erinnert Sie also an mich, Todd?»
«Ein bißchen.»
Swift warf ihm die Illustrierte wieder zu, drehte sich zur Tafel, griff zur Kreide und fing an, in gut lesbaren Großbuchstaben zu schreiben. Als sie fertig war, zeigte sie auf das Wort an der Tafel und sagte: «Und daran erinnern Sie mich, Todd.»
Mit gerunzelter Stirn buchstabierte Todd das Wort.
«Acanthocephalus», sagte er. «Was zum Teufel ist das?»
«Gut, daß Sie fragen, Todd», sagte Swift und lächelte ihm zu. «Der Acanthocephalus oder Kratzer ist ein weit verbreiteter Parasit, der zahlreiche Fischarten befällt. Ein stachelköpfiger Wurm, der zufällig ein ungewöhnliches physisches Merkmal mit Ihnen teilt.»
«Und zwar?»
«Seine Geschlechtsteile sind erheblich größer als sein Gehirn.»
Todd lächelte verwirrt, und der Rest des Kurses brach in schallendes Gelächter aus.
Swift wartete, bis das Gelächter nachließ und die Aufmerksamkeit der Studenten sich wieder auf die Dozentin richtete. Manchmal hatte der akademische Unterricht einiges mit primitiven Stammesriten gemein. Etwa dann, wenn man, um die angestammte Führungsrolle zu bewahren, einen Rivalen im Angesicht der gesamten Sozialgruppe herausfordern und besiegen mußte. Die gelegentlichen Kraftproben mit jungen männlichen Stammesmitgliedern wie Todd machten ihr Spaß. Daß sie die Siegerin blieb, erhöhte ihre Möglichkeiten, ihre didaktischen Ziele bei allen ihren Hörern durchzusetzen. Jetzt, da sie sicher war, die volle Aufmerksamkeit der Studenten gewonnen zu haben, beschloß Swift, die einleitenden Sätze ihres Vortrages zu ändern und, ausgehend von ihrem Witz über den Acanthocephalus, einen improvisierten Übergang zu finden.
«Allem zum Trotz, was Todd möglicherweise glaubt», sagte sie, «existieren die Geschlechtsorgane des Menschen nicht isoliert vom Rest seiner biologischen Struktur. Ihre Entwicklung ist unlösbar mit der Art verbunden, wie weibliche Menschen gebären, mit der Größe des menschlichen Gehirns und unserer Fähigkeit, Werkzeuge zu schaffen. Und unser idiosynkratisches Fortpflanzungsverhalten ist – selbst dann, wenn es so ungewöhnlich ist wie das Sexualverhalten, das Todd an den Tag legt, und weniger dominante Männchen auf den Status von reinen Zuschauern beim Fortpflanzungsprozeß reduziert – genauso wichtig wie unser größeres Gehirnvolumen, wenn es um den Versuch geht, die verschiedenartige Entwicklung von Menschen und Menschenaffen zu erklären.
Ich sage bewußt ‹um den Versuch›, denn die Frage nach dem Ursprung des homo sapiens, also von Menschen wie Ihnen und mir, ist unter uns Paläoanthropologen umstritten, und das Beweismaterial ist im wörtlichen Sinne fragmentarisch. Man könnte die einzelnen Fragmente mit Puzzlesteinen vergleichen, nur daß wir nicht einmal sicher sind, daß sie alle zum gleichen Bild gehören. Es gibt mehr als ein Puzzle und viele Steinchen, und sie sind in heilloser Unordnung.
So wissen wir in Wirklichkeit genausowenig, warum unser Gehirn so groß ist, wie es ist, wie wir wissen, warum der menschliche Penis größer ist als derjenige eines Gorillas. Jawohl, Todd, sogar Ihr Penis. Und wenn der Penis des Menschen größer ist als der des Gorillas, warum sind dann die menschlichen Hoden kleiner als die eines Schimpansen? Ist das nur ein Nebeneffekt der regeren Fortpflanzungstätigkeit des Schimpansen? Oder hat der Mensch die kleineren Hoden entwickelt, um den aufrechten Gang zu erleichtern?»
Swift setzte sich auf die Tischkante und zuckte die Achseln.
«Es gibt eine Menge Theorien, aber die ehrliche Antwort muß lauten, daß wir es ganz einfach nicht wissen. Genausowenig wissen wir, was wirklich zuerst kam: der zweifüßige Affe oder der intelligente Affe. Was in der frühzeitlichen Umwelt zwang eine bestimmte Affenart dazu, ein wesentlich vergrößertes Gehirn zu entwickeln? Vergessen Sie nicht, daß es keinen notwendigen Zusammenhang zwischen Gehirnvolumen und Intelligenz gibt. Betrachten Sie zum Beispiel das Gehirngewicht zweier berühmter Dichter. Walt Whitmans Gehirn wog bloß 1247 Gramm, während Byrons Gehirn 2325 Gramm, also beinah doppelt soviel, wog. Aber heißt das, daß Byron ein doppelt so guter Dichter war wie Whitman? Doch wohl kaum.
Und dennoch hätte es keinen Sinn, daß wir ein Gehirn haben, das ungefähr viermal so groß ist wie das eines Schimpansen, wenn uns das keine signifikanten Vorteile verschaffte. Schließlich verlangt Ihr Gehirn Ihrem Körper eine Menge Energie ab, um es in Betrieb zu halten. Obwohl es nur zwei Prozent Ihrer Körpermasse ausmacht, verbraucht das menschliche Gehirn die unglaubliche Menge von zwanzig Prozent der verfügbaren Energie Ihres Körpers. Es gibt einen Grund, warum der Mensch zusätzliche Gehirnkapazität entwickelt hat, aber genau was der Grund war, ist offen.
Letztlich sind die großen Menschenaffen keine besonders erfolgreiche Gruppe unter den Primaten gewesen, wenn man sie mit ihren engsten Verwandten, den Cercopitheciden oder Altweltaffen, vergleicht. Im Gegensatz zu ihrer Entwicklungsgeschichte ist die der Menschenaffen eine Geschichte abnehmender Artenvielfalt. Aus den erhaltenen Fossilien können wir schließen, daß sich die Menschenaffen schon im Mittleren Miozän vor zehn bis fünfzehn Millionen Jahren auf dem absteigenden Ast befanden, als es erheblich mehr und differenziertere Arten von kleinen langschwänzigen Affen gab als Menschenaffenarten.
Wenn wir das Wissen um unsere Abstammung vom Affen vergessen und uns in eine Zeitmaschine begeben könnten, um fünf oder sechs Millionen Jahre in die Vergangenheit ins Mittlere Pliozän zu reisen, würden wir entdecken, daß damals die Langschwanzaffen die dominierenden Primaten auf der Erde waren, schon weil es so viele von ihnen gab. Man hätte sogar annehmen können, sie hätten eine bessere Chance gehabt, den Planeten zu erobern, und ihre größeren, langsameren Knöchelgänger von Verwandten, die sich durch Armschwung bewegten, hätten sich in eine entwicklungsgeschichtliche Sackgasse verlaufen.
Aber wenn wir uns dann in unsere Zeitmaschine zurückbegeben und uns ein paar hunderttausend Jahre in die Zukunft bewegen könnten – wie weit genau wir gehen müßten, darüber ist unter den Paläoanthropologen ein heftiger Streit ausgebrochen -, würden wir einen bestimmten zweifüßigen Menschenaffen entdecken, der ein beträchtliches Entwicklungspotential aufweist und weiterer Beobachtung wert ist.
Die Frage, warum gerade diese eine Gattung einer numerisch erfolglosen Art sich plötzlich so spektakulär entwickelt hat, beunruhigt die Wissenschaft, und gewiß gibt es kein interessanteres Thema für uns. Aber die Frage nimmt noch größere Bedeutung an, wenn wir uns darüber klarwerden, wieviel vom Menschenaffen in uns steckt. Nicht nur in Todd, sondern in uns allen.
Einige von Ihnen wissen vielleicht noch, daß Kopernikus 1540 die Ergebnisse seiner astronomischen Beobachtungen veröffentlichte und damit ein für allemal das überlieferte ptolemäische Weltbild stürzte, in dem Sonne und Sterne sich um die Erde bewegten. Sie haben allen Grund, die Tatsache merkwürdig zu finden, daß es noch einmal vierhundert Jahre dauern sollte, bis die Paläoanthropologie imstande war, die herrschende anthropozentrische orthodoxe Lehre aus den Angeln zu heben, für die der Mensch das unvermeidliche und endgültige Ziel der irdischen Entwicklung war. Heute wissen wir, daß es ein Irrtum war, den Evolutionsprozeß als ein ständiges Fortschreiten zu betrachten, als eine Art von unaufhaltsamem Fließband, das am Ende das höchste Wesen, den Menschen selbst, produziert. So einfach geht es in der Natur nicht zu. Und je eher es Ihnen gelingt, sich vom Mythos eines entwicklungsgeschichtlichen Fortschritts zu befreien, dem der Menschenaffe nicht mehr ist als ein unterlegenes Wesen, das sein ehrgeiziger Vetter auf dem Weg zu seinem eigenen, von Nietzsche beschriebenen Schicksal überholt hat, desto eher dürfen Sie sich wahre Paläoanthropologen nennen. Deshalb möchte ich die verbleibende Zeit auf die Betrachtung unserer Verwandtschaft mit dem Menschenaffen verwenden.
1962 war es nicht mehr Johnny Weissmuller, der Tarzan spielte, sondern Jock Mahoney. Ich bin nicht ganz sicher, wer die Rolle seines treuen Freundes, des Schimpansen Cheetah, übernommen hatte. Jedenfalls war, wo es um schauspielerisches Talent ging, kein großer Unterschied festzustellen. Immerhin konnte man seine Skepsis kurzfristig vergessen und die von Edgar Rice Burroughs aufgestellte Behauptung akzeptieren, daß Mensch und Großaffe einander ähnlich genug seien, daß ein Mensch unter Affen aufwachsen und, wenn er einmal erwachsen ist, zu ihrem Herrscher werden könne.
Etwa zur gleichen Zeit griff ein Wissenschaftler namens Morris Goodman etwas wieder auf, das mehr oder weniger in Vergessenheit geraten war: die Entdeckung des Biologieprofessors George Nuttall aus Cambridge, daß man die genetische Verwandtschaft von höheren Primaten anhand der chemischen Analyse der Blutproteine feststellen kann. Indem er Nuttalls Methode der Untersuchung von Eiweißkörpern im Blutserum anwandte, entdeckte Goodman, daß die Immunkörper von Menschen und Schimpansen nahezu identisch sind. Damals glaubte jedermann, außer möglicherweise Tarzan und Cheetah, ein Schimpanse habe mehr mit einem Gorilla gemeinsam als mit einem Menschen. Aber Goodman konnte beweisen, daß das ganz einfach falsch war.
Seitdem haben Molekularanthropologen wie Vince Sarich und Allan Wilson an dieser Universität unter Einsatz von Methoden, die den von Goodman angewandten weit überlegen sind, Goodmans erstaunliche Entdeckung quantifizieren können.»
Swift trank einen Schluck Wasser und erklärte dann, wie es unter Verwendung von Albumin, einem häufigen Bluteiweiß, möglich war, so geringe Unterschiede wie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer von hundert Aminosäuren zu messen und so in der Praxis eine genaue Abgrenzung einer Spezies gegen eine andere auf der Grundlage von DNA-Messungen vorzunehmen.
«Die Zahlen sind beeindruckend», sagte sie, «und irgendwo auch recht schockierend. Während die DNA-Werte zwischen zwei Arten von Fröschen um bis zu acht Prozent voneinander abweichen können, beträgt der DNA-Unterschied zwischen einem Menschen und einem Schimpansen nur eins Komma sechs Prozent. Ganze eins Komma sechs Prozent.»
Sie schrieb die Zahl an die Tafel und machte dann eine Pause, damit die Studenten sich die Statistik einprägen konnten. Sie schüttelte den Kopf, als sei sie immer noch davon beeindruckt. Sie war beeindruckt.
«Wissen Sie, das ist weniger als der DNA-Unterschied zwischen zwei Gibbonarten, zwischen einem Pferd und einem Zebra, zwischen einem Hund und einem Fuchs, hauptsächlich aber zwischen einem Schimpansen und einem Gorilla. Mit anderen Worten, wir haben mehr mit einem Schimpansen gemeinsam als der Schimpanse mit einem Gorilla.
Eins Komma sechs Prozent ist nicht gerade viel, wenn es den Unterschied zwischen einem Schimpansen und Aristoteles, Shakespeare, Michelangelo, Mozart, Wagner, Picasso oder Einstein zu erklären gilt. Aber ihre Leistungen sind vielleicht noch beeindruckender, wenn man sie unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Vielleicht erinnern Sie sich an Sir Arthur Stanley Eddingtons Behauptung, daß eine unbegrenzte Anzahl von Affen, die auf Schreibmaschinen einprügelt, imstande sein müßte, alle Bücher in der Bibliothek des Britischen Museums zu schreiben. Tatsache ist aber, daß alle Bücher in der Bibliothek des Britischen Museums von Menschen geschrieben wurden, die achtundneunzig Komma vier Prozent ihrer genetischen Grundausstattung mit einem Schimpansen gemeinsam haben.
Jared Diamond, Physiologieprofessor an dieser Universität, hat für die Interpretation des Menschen als dritte Schimpansenart plädiert. Von einer Schule der Taxonomie ausgehend, die sich selbst als Kladistik bezeichnet und verlangt, daß die Klassifikation von Lebewesen einheitlich, objektiv und auf genetischem Abstand basierend vorgenommen werden sollte, plädiert Diamond dafür, daß Schimpansen, Gorillas und Menschen zur gleichen Gattung gehören. Und, sagt er, weil unsere Gattungsbezeichnung homo zuerst da war, sollte sie zoologische Priorität genießen. Daraus ergibt sich das anthropozentrische Resultat, daß wir nunmehr nicht von einer, sondern von vier Arten der Gattung homo auf der Erde ausgehen müssen: dem normalen Schimpansen, dem Zwergschimpansen, dem Menschen selbst und einer etwas entfernter verwandten Art, dem Gorilla.
Das ist gar keine so schlechte Idee, wenn wir daran denken, wie die ersten Exemplare von Menschenaffen zu ihrem Namen kamen. Angeblich geht das Wort ‹Schimpanse› auf ein angolanisches Wort zurück, das ‹falscher Mensch› bedeutet. Orang-Utan heißt auf malaiisch ‹Waldmensch›. Das Wort ‹Gorilla› kommt zwar zum erstenmal in einem griechischen Text vor, soll aber in einer afrikanischen Sprache ‹wilder Mensch› bedeuten. Vielleicht ist es ja nur das lateinische und griechische Vokabular, das uns vergessen läßt, wer und was diese Lebewesen sind. Denken Sie einmal darüber nach!
Vier verschiedene Menschenarten, wo wir bisher glaubten, es gäbe nur eine. So viel zu der bei Astronomen und Kosmologen so beliebten Frage: Sind wir allein? Offenbar lautet die Antwort: Nein! Wir sind nicht allein, und wir sind nie allein gewesen.
Vielleicht ist einigen unter Ihnen bekannt, daß eine Anzahl afrikanischer Länder sich bei ihren Versuchen, die ständig abnehmende Anzahl von Gorillas und Schimpansen vor Wilderern zu schützen, auf Professor Diamonds Argumente berufen und die Strafbestimmungen über Mord so geändert haben, daß auch diese neu entdeckten Arten der Gattung homo eingeschlossen sind. In diesen Ländern wird die Tötung eines Gorillas demnächst als Mord gelten, so daß den Täter die volle Schwere des Gesetzes trifft. Das ist gewiß lobenswert. Aber man sollte auch nicht vergessen, daß der homo sapiens nicht die einzige Spezies der Gattung homo ist, die Massenmord an der eigenen Art verübt. Jane Goodall hat beschrieben, wie sie über mehrere Jahre hinweg eine Gruppe von Schimpansen beobachtet hat, die von einer anderen Gruppe systematisch ausgerottet wurde. Goodall führte die Tatsache, daß es so lange dauerte, die Gruppe auszurotten, ausschließlich auf das Fehlen wirksamer Mordwerkzeuge zurück, wie sie der homo sapiens so hervorragend herzustellen weiß. Diane Fosseys Arbeiten über Gorillas legen den Verdacht nahe, daß der durchschnittliche Menschenaffe – besonders im Kindesalter – die gleiche Gefahr läuft, von einem Artgenossen umgebracht zu werden, wie der durchschnittliche Amerikaner.
Wie schon gesagt: Es ist der Werkzeugbesitz, der den Menschen zum erfolgreichsten Mörder auf unserem Planeten macht. Aber was kam zuerst, größeres Gehirnvolumen oder Werkzeuggebrauch? Man könnte meinen, ein gewisses Gehirnvolumen sei eine Voraussetzung für die Herstellung wirksamer Werkzeuge. Aber das Zeugnis der Fossilien beweist keinen derart eindeutigen Zusammenhang. Vielleicht überrascht es Sie zu erfahren, daß der Neandertaler vor vierzigtausend Jahren ein größeres Gehirn besaß als der moderne Mensch, aber die Werkzeuge der Neandertaler waren nicht besonders weit entwickelt. Dennoch glaube ich, daß das größere Gehirnvolumen des Neandertalers – etwa drei Prozent mehr als unser eigenes Gehirn – das Vorurteil widerlegt, nur weil er eine fliehende Stirn besaß, sei der Neandertaler irgendwie dumm gewesen. Aber wozu die ganze zusätzliche Gehirnkapazität diente, weiß niemand.
Was immer es war, das die Trennung zwischen Mensch und Affe, die wir gern den großen Sprung nach vorn nennen, verursacht hat, Gehirnkapazität oder Werkzeugherstellung, der Grund kann in nicht mehr als eins Komma sechs Prozent unserer Gene liegen. Vielleicht sollten Sie ja nach dieser Stunde einmal darüber nachdenken, was der Grund wohl sein mag. Mit Sicherheit werden die Theorien, die Ihnen möglicherweise einfallen, weder gültiger noch weniger gültig sein als das, was bisher irgend jemand vorgebracht hat. Wie Sie höchstwahrscheinlich bald alle selbst entdecken werden, gibt es in der Welt der Paläoanthropologie wenig Gewißheit. In der Tat rechnen wir sie zwar zu den Naturwissenschaften, aber sehr viel Wissenschaftliches hat sie nicht zu bieten. Die empirische Methode spielt bei dem, was wir betreiben, nur eine geringe Rolle.»
Swift warf einen Blick auf die Uhr, und im gleichen Moment ertönten vom Campanile auf der Sproul Plaza die einundsechzig Glocken des Glockenspiels. Dreimal täglich wurde hier ein zehnminütiges Konzert gegeben. Diesmal war es das Mittagskonzert, das das Ende ihrer Vorlesung ankündigte. Ihre Studenten begannen bereits aufzustehen und ihre Notizblocks und Bleistifte wegzuräumen. «Okay», sagte sie, gegen die aufkommende Unruhe ankämpfend, «machen wir Schluß für heute. Denken Sie an das, was Matt Cartmill von der Duke University einmal gesagt hat. Er meinte, alle Wissenschaften seien seltsam, aber die Paläoanthropologie sei eine der seltsamsten.»
«Das ist wohl wahr», knurrte Todd vor sich hin. «Gerade wollte ich mich mit der Idee anfreunden, daß ich ein Affe bin.»
«Ich glaube nicht, daß dir das schwerfallen sollte», bemerkte eine Studentin spitz. «Ich habe dir beim Essen zugesehen, Todd.»
Todd grinste gutmütig.
«Aber vier verschiedene Menschenarten?» meinte er kopfschüttelnd. «Vielleicht ist das ja für eine von euch eine gute Nachricht. Vielleicht kriegt sie ja dann doch noch einen Kerl ins Bett. Aber wenn ihr mich fragt, ich finde das beunruhigend. Denkt mal darüber nach! All die Schimpansen und Gorillas im Zoo. Ich meine ja nur: Wenn die mal rausfinden, daß sie gar keine Tiere sind. Wenn sie die Verfassung lesen oder so. Das gibt vielleicht Ärger.»
«Erkenne dich selbst und wag nicht, Gott zu prüfen, der Menschheit eignes Studium ist der Mensch.»
Kaum hatte sie ihn als sechzehnjähriges Schulmädchen das erste Mal gelesen, schon war Alexander Popes Vers aus dem Versuch über den Menschen für Swift zum bestimmenden Motto ihres Lebens geworden. Ihr kam es vor, als habe sie sich schon immer für den Ursprung des Menschen interessiert, und ihre frühreife Neugier auf Sex und die Formen der menschlichen Fortpflanzung wurde bald von dem fundamentaleren Streben verdrängt, ihr eigenes genetisches Erbe zu entdecken.
Und dennoch hatte es später einen Augenblick in ihrem Leben gegeben, an dem sie eine Offenbarung im Stil des zwanzigsten Jahrhunderts erfahren und entdeckt hatte, daß sie ihr Leben «der Menschheit eignem Studium» widmen wollte. Vielleicht war es nur angemessen, daß dieser Augenblick angesichts einer symbolischen Offenbarungsszene eingetreten war. Als der Affe in Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum mit äußerster Vorsicht den Monolithen berührt und die Fähigkeit erworben hatte, Werkzeuge und Waffen herzustellen, hatte er auch Swifts jugendliche Phantasie angerührt. Dies war der Augenblick, in dem Swift unter den Klängen der Straussschen Fanfaren ihren Lebensweg vor sich liegen sah.
Heute, Jahre nach dem Beginn ihrer eigenen intellektuellen Odyssee, war das Rätsel um den großen Sprung der Menschheit nach vorn – das genetische Geschenk, das den homo sapiens vor allen anderen Lebewesen auszeichnet – noch immer ein ebenso undurchdringliches Mysterium wie Kubricks düsterer Monolith. Und im Grunde blieb das Mysterium genau das gleiche.
Die Spaltung zwischen dem Neandertaler und dem homo sapiens hatte sich vor erst zweihunderttausend Jahren zugetragen – einem Dreißigstel der Zeit, die notwendig gewesen war, um Menschenaffen und Menschen voneinander zu trennen-, und der Unterschied im Chromosomensatz betrug weniger als ein halbes Prozent; und dennoch hatte der Neandertaler da versagt, wo der homo sapiens erfolgreich gewesen war.
Warum?
Kein Meißel konnte den ebenholzschwarzen Granit des Mysteriums auch nur ankratzen.
Die herrschende Erklärung für die Trennung zwischen Neandertaler und homo sapiens, daß nämlich der moderne Mensch sich den Evolutionsvorteil der Sprachentwicklung zunutze machen konnte – die Paläoanthropologie legte heute keinen besonderen Wert mehr auf den Menschen als werkzeugherstellenden Mörderaffen, der Kubrick so fasziniert hatte -, warf nur ein um so größeres Geheimnis auf.
Welche spezifische anatomische Entwicklung, die dem modernen Menschen seine Sprachfähigkeit verlieh, hatten die Neandertaler nicht mitgemacht?
Der Heimweg führte sie die steile Euclid Avenue hoch.
Swifts Haus, ein Fachwerkhaus im Landhausstil, das aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammte, schien der bewaldeten Landschaft wie von selbst entsprossen. Darin glich es vielen der Häuser der Northside von Berkeley, einem ruhigen, grün bewachsenen Vorort, der bei Selbständigen und Akademikern beliebt war. Das Haus war teuer gewesen, und es waren die Skulpturen ihrer Mutter – ihre monumentalen Bronzestatuen erzielten in den Galerien von London und Manhattan hohe Preise -, die es bezahlt hatten.
In der Geborgenheit ihres hellen, mit Pflanzen bestandenen Ateliers mit seiner Büchergalerie und dem Stutzflügel angelangt, zog Swift das Telefon aus dem Stecker, streckte sich auf dem Sofa aus und rauchte eine beruhigende Zigarette. Sie war keine regelmäßige Raucherin. Tabak hatte für sie eine ähnliche nahezu medizinische Bedeutung wie für die Indianer Nordamerikas. Die beruhigende Wirkung, die sie suchte, konnte sie mit wenigen Zügen aus der Marlboro zwischen ihren Fingern erreichen, bevor sie die Zigarette wieder ausdrückte. Die schweren Goldringe an ihren Fingern ähnelten den Klappen eines Saxophons. Sie war noch mit der Planung des restlichen Nachmittags beschäftigt, als sie einschlief …
Erschreckt wachte Swift auf und sah auf die Uhr.
Es war fünf Uhr.
Der Nachmittag war gelaufen.
Die Türklingel summte ein paarmal wie eine zornige Wespe, als betätige sie jemand schon länger. Wer konnte es sein? Einer ihrer Studenten? Vielleicht einer ihrer Kollegen? Ihr Nachbar, der sich über ihr Klavierspiel zu nächtlicher Stunde beschweren wollte?
«Scheiße.»
Swift schwang die langen Beine vom Sofa und überquerte den Fußboden aus poliertem Eschenholz, um auf den Knopf der Sprechanlage zu drücken.
«Wer ist da?» seufzte sie mit finsterer Miene.
«Jack», sagte die Stimme.
«Jack?» wiederholte sie benommen. «Welcher Jack?»
«Mein Gott, Swift! Wie viele Jacks kennst du denn? Jack Furness natürlich.»
«Jack?»
Swift quietschte laut vor Freude und betätigte den Türöffner. Rasch kontrollierte sie ihre Erscheinung in dem schweren vergoldeten Spiegel in der Diele und nahm zwei Stufen auf einmal, als sie die Treppe heruntersprang, um die Tür aufzureißen.
Jack stand in aufrechter Haltung, fast in Habtachtstellung, vor der Tür und hielt einen großen viereckigen Kasten unter dem muskulösen Arm. Er trug ein marineblaues Polohemd, eine sportliche braune Tweedjacke und ein Grinsen im Gesicht, das so breit und glänzend war wie seine Armbanduhr. Er war dünner als in ihrer Erinnerung, fast ein wenig hager. Sein wettergegerbtes Gesicht zeigte die Spuren der Entbehrungen, die er auf seiner Himalajaexpedition ertragen hatte. Aber über ein paar Zeilen im Online Service von C N N und im San Francisco Chronicle von voriger Woche hinaus, denen zu entnehmen war, daß die Zwei-Mann-Expedition zur Besteigung aller Gipfel des Himalaja innerhalb eines Jahres mit einer Katastrophe geendet hatte und daß Didier Lauren in einer Lawine umgekommen war, wußte sie wenig über die Tragödie, die ihm zugestoßen war.
Swift stürzte sich in Jacks Arme und drückte ihn eng an sich, bevor sie sich zurückzog und ihm einen anklagenden Blick zuwarf.
«Jack», schalt sie ihn, «was hättest du gemacht, wenn ich nicht zu Hause gewesen wäre? Warum hast du nicht angerufen?»
«Habe ich. Dein Telefon ist nicht im Stecker.»
«Ja, aber warum hast du nicht von Nepal aus angerufen? Oder mir geschrieben? Oder dich über E-Mail gemeldet?»
Er zuckte die Achseln. «Eine Zeitlang hatte ich eigentlich niemandem etwas zu sagen. Du weißt, was geschehen ist?»
«Der Chronicle hat etwas darüber gebracht», sagte sie. «Aber es stand nicht viel mehr drin als das, was der Nachrichtendienst auch gebracht hatte. Der Bericht sagte nur, daß Didier von einer Lawine getötet worden ist und daß du überlebt hast.» Sie schloß ihn wieder in die Arme und zog ihn ins Haus.
«Nicht nur Didier», sagte er. «Außer ihm sind noch fünf Sherpas gestorben.»
«Mein Gott, wie schrecklich für dich!»
«Genau das war es. Schrecklich.»
«Ich bin froh, daß du am Leben bist, Jack», sagte sie und schloß die Tür.
Sie führte ihn ins Wohnzimmer, schob ihn in ein großes tiefes Sofa und holte ihm einen Drink. Seinen Lieblingswhisky. Einen Macallan.
«Seit wann bist du wieder im Lande?»
«Seit gestern.»
«Gestern? Und dann hast du so lange gebraucht, um mich zu besuchen?»
«Also eigentlich war es gestern abend. Am späten Abend. Und ich war todmüde.»
Jack leerte sein Glas in einem Zug und sah sie lange an. Sie sah noch besser aus, als er sie in Erinnerung hatte. Ihre Beine waren sonnengebräunt und wohlgeformt. Sie kreuzte sie, als sie sich ihm gegenüber auf einen kleinen harten Stuhl setzte.
«Keine Konkurrenz in Sicht?» fragte er. «Ich meine, für heute abend?»
«Nein, heute abend nicht.»
«Gut. Kann ich mir noch einen Drink holen?»
«Natürlich.»





























