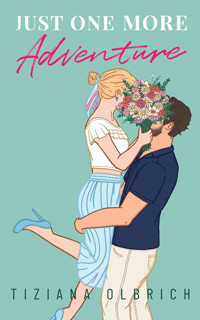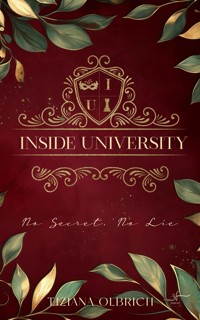2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe? Kann ihr gestohlen bleiben! Wenn er das doch bloß auch akzeptieren würde. Als Caro vor einigen Monaten zur Universität aufbrach, schwor sie sich, ihrer Schwester und ihrem besten Freund den Rücken zuzukehren. Doch nun muss die verschlossene Einser-Studentin zurück in ihre Heimatstadt und sich ihrer Vergangenheit stellen. Liebe kann ihr gestohlen bleiben – wenn ihr bester Freund Jo das bloß auch akzeptieren würde. Währenddessen hat ihre jüngere Schwester Kira ganz andere Sorgen. Als wäre es nicht schon schwer genug als eine der größten Video-Bloggerinnen im Licht der Öffentlichkeit aufzuwachsen, verliebt sich die Teenagerin ausgerechnet in ihren größten Konkurrenten. Plötzlich steht nicht nur ihre Gefühlswelt Kopf, auch ein Hackerangriff setzt schlagartig ihre Karriere aufs Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ESCAPE THE ORDINARY
TIZIANA OLBRICH
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Danksagung
Rezept für Suzes winterliche Apfel-Zimt-Berliner
Caros und Kiras Weihnachtsplaylist
Die Opposite Worlds Dilogie
Über die Autorin
© Tiziana Olbrich, Löpentinstraße 1, 30419 Hannover, 2019
Redaktion: The Author Edit
Coverdesign: Carmen L. Rodríguez Fukumoto
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
ISBN 978-1-099-31482-7
Für all jene, die sagten, ich schaffe das nicht.
Für all jene, die sagten, ich schaffe das.
KAPITELEINS
Caroline
Mir bleiben nur noch wenige Minuten bis zur Abgabe, da hört mein Herz plötzlich auf zu schlagen. Erst verdunkelt sich nur meine Sicht, sodass ich die Fragen auf dem fünfseitigen Prüfungsbogen kaum entziffern kann. Dann wird mir auf einmal schwarz vor Augen. Bubumm. Bubumm. Bubumm.
In meinen Ohren rauscht das Blut und statt der eifrigen Notiergeräusche meiner Kommilitonen, höre ich mit einem Mal nur ein dumpfes Rauschen.
Bubumm. Bubumm. Bu–
Meine Brust schmerzt.
Bumm.
Der eben noch pochende Herzschlag setzt mit einem Mal aus und Atemnot stattdessen ein. Meine Glieder werden schwach und ich sacke zur Seite. Ich rechne mit einem harten Aufprall. Mache mich innerlich bereit für den lauten Ruf der Sirenen. Warte, auf die wärmende Nähe meiner Kommilitonen, die sich besorgt über meinen leblosen Körper beugen und verzweifelt versuchen, meinen Puls zu finden.
Stattdessen nehme ich einen leichten Windzug wahr, als jemand an mir vorbeiläuft und mir – wie kann er es wagen, sieht er nicht, in was für einer Notsituation ich mich hier gerade befinde? – einfach den Prüfungsbogen entreißt. Zornig schlage ich die Augen wieder auf und blicke in das ausdruckslose Gesicht meines Professors.
»Moment mal!«, rufe ich empört aus. »Ich bin doch noch gar nicht fertig.«
Schnell wende ich mich auf meinem Stuhl und versuche, nach den Zetteln zu greifen. Aber Mitgefühl gehört nicht zu Professor Burghardts Stärken und er läuft desinteressiert weiter zum nächsten Tisch.
»Tut mir leid, Fräulein. Wenn Sie mit der gegebenen Zeit nicht zurechtkommen, sollten Sie sich die Teilnahme an meinem Seminar besser noch einmal durch den Kopf gehen lassen«, verhöhnt mich seine nasale Stimme.
Versagerin, werfe ich mir selbst vor.
Gedankenverloren kratze ich an dem Tintenfleck auf meinem Finger und blicke enttäuscht auf die Arbeitsfläche meines Tisches. Ich kriege gar nicht richtig mit, wie auch die letzten Studenten den Raum verlassen. Erst als ich den Blick des Professors auf mir spüre, sehe ich auf und bemerke, dass nur noch wir beide übrig sind. Er wendet sich von mir ab, um die Prüfungsbögen in einen Ordner einzusortieren. Burghardt ist so groß, dass er sich in einer krummen Haltung über den Schreibtisch beugt, um die ausgebreiteten Zettel ordentlich zu sortieren. Seine Kleidung wirkt eine Spur zu groß, doch es scheint ihn nicht zu kümmern, dass er in seiner dunkelgrünen Cordhose und dem dazu passendem Jackett mit Tweed-Ärmeln versinkt. Würde er sich nicht so altbacken kleiden und wäre nur einen Tick weniger überheblich, wäre er kein schlechter Fang. Immerhin ist er schon mit Anfang 30 als Jungprofessor angestellt und hat gerade seine Promotion abgeschlossen. Er muss also so einiges auf dem Kasten haben. Schätze ich. Wirklich kümmern tut es mich nicht. Der Professor reibt sich über sein schmales Gesicht. Die Wangen sind übersät mit nachwachsenden Stoppeln. Er wirkt erschöpft.
»Nun kommen Sie, Caroline.« Er lächelt mir aufmunternd zu. »Sie haben mit Sicherheit auch Besseres zu tun und wollen nicht den restlichen Nachmittag hier herumzusitzen.«
Er spricht so leise und monoton, als würde er die Worte nur mit großem Widerwillen von sich geben. Ebenso abrupt wendet er sich wieder von mir ab. Ohne eine Antwort abzuwarten, eilt er mit großen Schritten davon. Merkwürdiger Kauz.
»Wenn Sie wüssten.« Ich seufze, dabei ist er längst außer Hörweite. Widerwillig packe ich meine Sachen zusammen und mache mich ebenfalls auf den Weg nach draußen.
Okay, ich gebe es zu, ihr habt mich ertappt.
Ich habe mir nur vorgestellt, einen Herzstillstand zu erleiden. Aber ganz ehrlich, es sagt ja wohl einiges aus, wenn ich euch versichere, dass eine mögliche Herzattacke nicht einmal das größte Übel des heutigen Tages wäre. Wenn Ihr wüsstet, was mir nachher noch bevorsteht, würde sicherlich keiner von euch ein höhnisches Grinsen auf dem Gesicht tragen. Oder gar über mich lachen. Nein, ihr würdet das verstehen.
Es sei denn, ihr seid so herzlose Biester wie meine Schwester, aber davon gehe ich mal nicht aus. Nun, ich hoffe es zumindest. Auf eine weitere Blamage kann ich gut und gerne verzichten, davon hatte ich in letzter Zeit schon genügend. Euch kann ich es ja verraten, nicht wahr?
Irgendwie hatte ich mir das Leben an der Universität glamouröser vorgestellt. Ich dachte, wenn ich endlich Zuhause ausziehe und einen Neustart in eine Stadt wage, in der mich niemand kennt, würde sich alles andere wie von selbst regeln. Aber dem ist nicht so. Zwar plagen mich keine tratschenden Mitschüler mehr, doch auf dem Weg zum nächsten Seminar führe ich noch immer lieber Selbstgespräche in meinem Kopf, statt mich mit den umstehenden Kommilitonen zu unterhalten. Wenn es mir bloß nicht so schwerfallen würde, auf andere zuzugehen. Den nächsten Seminarraum betretend bin ich noch immer in meiner eigenen Gedankenwelt versunken.
Herzstillstand, Ertrinken, Ersticken.
Ach, wenn mich nur irgendetwas davor bewahren könnte, heute Abend nach Hause fahren zu müssen.
Kira
Nur noch wenige Meter trennen mich von meinem Ziel, da baut sich auf einmal eine große Gestalt vor mir auf. Abrupt bremse ich meinen Laufschritt ab, um nicht mit der breiten Brust vor mir zu kollidieren.
»Ich sag´s jetzt einfach!« Die Brust vor meinen Augen schwillt vor Stolz an, die dazugehörige Stimme ist rau und es folgt ein lautes Ausatmen. Noch bevor ich der Stimme ein Gesicht zuordnen kann, folgt bereits ein kehliger Laut: »Du gefällst mir.«
Verwundert über diese unerwartete Direktheit wandert mein Blick hoch. Ein breiter Hals gefolgt von einem stoppeligen markanten Kinn erscheint in meinem Sichtfeld. Eine leicht schiefe Nase, die offensichtlich schon einmal gebrochen gewesen ist und schließlich treffe ich auf eisblaue Augen, die die Haut in meinem Nacken kribbeln lassen.
O hallo Sexy, schießt es mir durch den Kopf. Für solche Augen würde so manche Frau alles geben. Und ja, ich meine genau das – sie würden sich die Kleider vom Leib reißen, sich ... okay, ich schweife ab. Aber meine Güte diese Augen.
Der kühle See wird noch unterstützt durch ein charismatisches dunkles Brillengestell, das ihm automatisch einen gewissen Look verleiht. Der siegesgewisse Gesichtsausdruck hält mich jedoch davon ab, meinen Gelüsten Taten folgen zu lassen. Denn in den gerade einmal drei Sekunden, die sein Begrüßungsversuch bisher andauert, hat der Typ mir bereits zweimal auf die Brüste gestarrt. Statt Augenkontakt aufzubauen, ist er damit beschäftigt, meinen Körper abzuscannen. Resigniert lehne ich mich zur Seite, will mich an ihm vorbeischieben, aber den Plan habe ich ohne „Mister I-Like“ gemacht.
»Ich sagte, du gefällst mir«, ertönt die Stimme, die ich bis vor wenigen Sekunden noch nie zuvor gehört habe, mir aber jetzt schon mächtig auf den Geist geht.
»Kein Interesse«, erwidere ich und begebe meinen Blick auf die Suche nach der Türklinke, die noch immer von seinem breiten Kreuz versteckt wird. Meine aufkeimende Wut ignorierend sieht der Typ mich erwartungsvoll an. Als habe er soeben eine immense Leistung vollbracht und warte nun auf einen Belohnungskeks. Oder zumindest meine begeisterte Zustimmung, denn eins ist ja wohl klar – die steht ihm seiner Ansicht nach auf alle Fälle zu.
»Nichts für ungut, aber dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit«, wende ich höflich ein, werde jedoch durch ein erneutes Aber du gefällst mir!, unterbrochen. Hat seine Schallplatte einen Riss?
Was zum Teufel will dieser Typ bloß von mir.
Entnervt wende ich mich ab und sehe aus dem Augenwinkel, wie sich meine Mannschaftskolleginnen ein paar Meter neben mir das Lachen verkneifen. Seufzend bringe ich einen leisen Dank zustande und hoffe, dass es sich damit hat und er endlich verschwindet. Aber pronto, bitte!
Der Liker starrt mich einfach weiter an. Mir rinnt der Schweiß vom Training den Rücken hinunter und ich verliere allmählich die Geduld. Ich bin kein Ausstellungsstück in einem Museum, dessen Zeit man einfach so beanspruchen kann.
»Darf ich mal vorbei?«, unterbreche ich seine Tagträumereien nun etwas energischer.
»Ach zier dich nur, dann wird die Freude später umso größer, wenn du dich mir hingibst«, säuselt der Liker und beugt sich dabei gefährlich nahe zu mir herunter. Sein heißer Atem an meinem Ohr lässt mich unangenehm erschaudern. »Warts nur ab, Süße. Bisher hat es noch jeder gefallen.« Er zwinkert mir selbstsicher zu. Nicht nur seine Worte lassen mich stutzen, sondern die Art wie er sie sagt. Wie kann jemand ein Kompliment so abfällig und selbstherrlich klingen lassen? Mit Sicherheit hat noch nie jemand das Wort gefallen benutzt, während sein Tonfall gleichzeitig ein so großes Missfallen im Gegenüber ausgelöst hat. Er fasst mein Zögern als Einladung auf. Zu meiner Abscheu flammt Triumph in seinen Augen auf. Na, da ist sich aber einer sicher mich bereits fest am Haken zu haben – Vollidiot!
Sollte es je auch nur den Hauch einer Chance gegeben haben, dass ich auf diesen Kerl reinfallen könnte – mich gar auf ein Treffen mit ihm einlassen würde – hat er sich spätestens mit diesem Kommentar seine Tour versaut. Gelassen lehnt er sich mit den Händen in den Hosentaschen an der Wand und gibt mir damit endlich wieder die Aussicht auf die Umkleidetür frei.
»Nun, ich müsste dann mal wieder«, wende ich mich entschlossen ab. »Ich habe es eilig.«
»Halt!«, ruft er, noch bevor ich mich auch nur einen Zentimeter bewegen kann. Genervt sehe ich ihn erneut an und ziehe meine linke Augenbraue hoch.
»Ja, übrigens. Ich bin der Nils.« Er tippt sich an sein breites Glasgestell, um seine Brille wieder ein Stück auf der Nasenwurzel nach oben zu schieben. Modell pseudo-coole Fensterglasbrille. Von wegen charismatisch, wenn der nicht aufpasst, hat er gleich nur noch zwei zerbrochene Hälften an seinen Ohren hängen. Ganz ruhig, Kira, ermahne ich mich. Fieberhaft suche ich nach einer eleganten Möglichkeit, ihn erfolgreich abzuwimmeln. Das Training für die Hockey-Schulmannschaft findet donnerstags immer vor dem Mittagessen statt und meine Pause ist mir echt zu schade, um sie mit irgendeinem Vollidioten zu vergeuden. Eher vergeblich werfe ich meinen Mitschülerinnen einen hilfesuchenden Blick zu, aber die fühlen sich in ihrer tuschelnden Traube wohl. Da kann ich wohl lange auf Unterstützung warten.
»Ah ja, nun schön«, setze ich zum Gegenangriff an. »Wie gesagt, ich muss jetzt wirklich los. Man sieht sich.«
Energisch drücke ich ihn zur Seite und bete innerlich, dass ich endlich unter meine wohlverdiente Dusche springen darf. Aber der Liker lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Vielleicht sollte ich ihn lieber Mister Zecke nennen, so sehr wie er sich an mir festgebissen hat.
Nein, Schluss damit.
Ich will ihm gar keinen Namen geben.
ICH WILL EINFACH NUR, DASS ER VERSCHWINDET!
Jetzt, verdammt noch mal.
»Ja, man sieht ... also wann gehst du mal mit mir aus?«, wagt er es tatsächlich, zu fragen, und greift nach meinem Arm, um mich festzuhalten. Mir entgleiten nicht nur meine Gesichtszüge, sondern auch der Hockeyschläger. Das klirrende Geräusch des auf dem Boden aufschlagendem Schläger mischt sich mit dem Gekicher der anderen. Hohl hallt das Gelächter von den grauen Wänden der Eingangshalle zu mir hinüber. Ich schaue zur Tür der Jungenumkleide und überlege, ob ich einen Sprint hinlegen soll, um der Situation schnellstmöglich zu entgehen. Ich bin echt schnell, wenn ich will. Zwar nicht die schnellste Läuferin im Team, das ist Anna, aber meine Füße sind auch ziemlich flott. Da ich allerdings nicht riskieren will, einen Tadel wegen unerlaubten Betretens zu kassieren, noch scharf drauf bin, mich die nächsten Wochen mit dieser Story aufziehen zu lassen, bleibt mir nichts anderes übrig, als schärfere Geschütze aufzufahren. Zumal ich mir nicht sicher bin, ob der Typ nicht dreist genug ist, um einfach weiter vor der Umkleide zu warten, bis ich wieder herauskomme. Ich meine, wie lange kann man es schon in einer nach Schweiß und alten Socken muffelnden Sportumkleide aushalten? Die einzig vernünftige Antwort lautet: Nicht länger als unbedingt notwendig!
Ich greife nach dem Schläger und wende mich wieder dem Typen vor mir zu. Ich setze mein kühlstes Lächeln und den berühmt berüchtigten bis-hierher-und-nicht-weiter-Freundchen-Gesichtsausdruck auf, den ich in den letzten Monaten zur Genüge perfektioniert habe. Aber Mister Zecke weicht nicht einen Millimeter von mir zurück. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich muss ihm vor versammelter Mannschaft einen Korb geben und kann nur hoffen, dass die Auseinandersetzung nicht gefilmt und später auf irgendeiner sozialen Plattform auftaucht.
»Ich sage das nur einmal, also hör mir gut zu. Denn ich habe wirklich keine Lust, hier weiter meine Zeit zu verschwenden. Meine Antwort ist Nein. Verstanden?«, zische ich ihm zu. Hastig bücke ich mich nach meinem Schläger und überlege, ob ich vielleicht einfach durch seine Beine hindurch abhauen sollte. Einen Versuch wäre es wert. Vielleicht ist seine Reaktionszeit langsam genug, um mir einen Ausweg zu ermöglichen. Der einzige Ausweg, wenn man bedenkt, wie meine persönliche Zecke meine abweisenden Worte gekonnt ignoriert.
»Ja, also wann gehen wir mal einen trinken? Meinetwegen auch einen Kaffee, falls du nichts Alkoholisches willst, oder wir könnten …«, setzt er wieder an und ich verliere endgültig die Geduld mit ihm.
Mit einer schnellen Armbewegung reiße ich den Hockeyschläger hoch und ziele auf ein Stückchen Wand knapp oberhalb seiner Schulter. Ein lauter Knall ertönt. Er weicht erschrocken zur Seite und gibt die Tür frei.
»Es mag dir vielleicht noch nicht aufgefallen sein, Mister. Aber ich bin zum Training hier. Also das Einzige, was ich im Moment will,ist eine Dusche und sonst nichts. Also,nein danke.«
Einen kurzen Moment sehe ich ihm noch sehr bestimmend in die Augen, um meinen Standpunkt ein für alle Mal klarzumachen.
Dann wende ich mich mit schlotternden Knien ab, um endlich in der Umkleide zu verschwinden und aus meinen Trainingsklamotten zu pellen. Ich setze eine betont neutrale Miene auf und ziehe von dannen. Während ich die Zahlenkombination meines Schließfaches eingebe, rast mein Puls noch immer, als läge ein Kilometer-Sprint hinter mir. Die Umkleidetür geht erneut auf und meine Mannschaftskolleginnen rauschen in den viel zu kleinen Raum, um sich ebenfalls umzuziehen.
»Ach, so übel war der doch gar nicht.« Nora lehnt sich spöttisch grinsend an den Spind neben mir und wartet auf eine Reaktion, um mich weiter zu piesacken. Sie ist zwar meine beste Freundin, aber manchmal würde ich ihr echt gerne ein riesiges Klebeband über ihr Plappermaul kleben, nur um vor ihren zügellosen Kommentaren verschont zu bleiben.
»Klar, wenn man drauf abfährt zum Statussymbol eines selbstverliebten Trottels degradiert zu werden. Nur zu, ich steh eurer Traumhochzeit nicht im Wege. Aber bevor ich mich auf ein Ätz-Date mit so einem Typen einlasse, verbringe ich meine Zeit lieber mit deinem Cousin Timmi«, werfe ich ihr neckisch entgegen, während ich mir das Top über den Kopf ziehe, und den verschwitzen Sport-BH in die große Sporttasche zu meinen Füßen werfe.
Ich weiß, dass das fies klingt, und wahrscheinlich ist der Typ gar nicht so übel, wenn man ihn erst einmal kennt. Aber die Wahrheit ist die, um ein wirkliches Kennenlernen ging es ihm gar nicht. Hätte dieser Kerl echtes Interesse daran gehabt, mich kennenzulernen, dann hätte er kaum so eine Riesenshow abgezogen und mich ausgerechnet nach dem Training, mit meiner versammelten Mannschaft im Schlepptau, abgepasst. Dem ging es nur um Kira, die erfolgreiche und vorzeigbare Mannschaftskapitänin. Oder noch schlimmer, um Kira die Schlagzeile. Nicht um mich, als Privatperson. Und was an der Sache am traurigsten ist, ist, dass ich nichts anderes gewohnt bin. Typen meinen ständig einen Anspruch darauf zu haben, mich anzubaggern. Als ob ich ihnen, aufgrund meines Aussehens, irgendetwas schuldig wäre. Die Mühe, sich erst einmal ein paar Minuten mit mir ungezwungen zu unterhalten oder gar meine Interessen herauszufinden, hat sich noch keiner mehr gemacht. Meist vergehen nur einige Sekunden zwischen dem Herstellen des ersten Blickkontaktes und dem Unterbreiten eines unmoralischen Angebots. Aber der Oberknaller nach so einer Anmache ist, dass ausgerechnet mir vorgeworfen wird, ich sei zu oberflächlich.
Mit 15 hat mir diese offensichtliche Aufmerksamkeit von Männern geschmeichelt. Und ja, ich gebe es zu, ich habe es auch einige Male zu meinem eigenen Vorteil genutzt. Aber seit dieser Geschichte am Nikolaus-Wochenende vor ein paar Wochen, graust es mir allein schon bei der Vorstellung, jemanden in meine Nähe zu lassen. Also habe ich beschlossen, erst einmal auf Abstand von der Männerwelt zu gehen. Keine Typen – keine Probleme, oder? So einfach ist das.
»Timmi? Der ist gerade mal vier.« Nora lacht glucksend auf.
»Genau!«, stimme ich in ihr Lachen mit ein und merke erleichtert, wie die Anspannung langsam von meinen Schultern fällt. »Aber hey, Timmi wird mal ein echter Frauenschwarm, der bringt einen immer mit seinen süßen Witzen zum Lachen. Und er ist ein kleiner Gentleman. Genau mein Typ, das gefällt mir!«, scherze ich.
»Ach komm, von wegen Gentlemen. Du stehst doch wie wir alle auf die Bad Boys. Je verwegener, desto heißer.« Kichernd verdreht Nora die Augen, bevor sie sich an ihrem Schließfach zu schaffen macht. Mit einem leisen Quietschen öffnet sich die Tür und ein zerdrückter Coffee-to-go-Becher sowie ein leopardengemustertes Handtuch fallen ihr entgegen. Kleine Chaotin, denke ich und erwidere: »Ach wozu überhaupt einen Typen, die sorgen ohnehin nur für Drama.«
»Sag bloß, du verfolgst immer noch diese absolut idiotische Idee, das ganze Jahr über männerlos zu bleiben«, nörgelt Nora und sieht mich ungläubig an. Augenblicklich bereue ich es, dass ich mich ihr überhaupt anvertraut habe. Denn das ist das Problem mit Nora, sie ist nicht gerade diskret und intime Details über mein Gefühls- oder Sexleben möchte ich nun wirklich nicht in einer stickigen Kabine voller neugierig lauschender Ohren bequatschen. Man sollte es sich eben gut überlegen, bevor man eine andere Person in Details seines Lebens einweiht. Auch wenn es im Moment der Schwäche trostspendend sein mag, sich jemandem anzuvertrauen, so gibt es kaum etwas Verletzenderes, als wenn das anvertraute Wissen auf einmal gegen einen verwendet wird. Und sei es nur in unbedachten Momenten wie diesem.
»Ach, nur bis zum Jahreswechsel«, spiele ich mein Unbehagen herunter. »Sind ja ohnehin nur noch zwei Wochen.«
»Du bist verrückt! Und was machst du dann bitte an Silvester? Willst du etwa, wie so ein Mauerblümchen einsam und allein in der Ecke stehen, während wir anderen im Feuerwerkswirbel knutschen?«, entrüstet sie sich.
»Also echt, Nora. Hast du etwa vergessen, wer vor dir steht?«
Splitterfasernackt trete ich vor sie und stemme die Arme in einer Siegerpose in die Hüfte. Herausfordernd schaue ich ihr in die Augen.
»Ich bin Kira Kirschbaum und verflucht noch mal absolut großartig. Großartig genug, um mein eigenes Feuerwerk zu sein. Ich bin so großartig, dass ich überhaupt keinen Kerl brauche, und jetzt lass uns endlich unter die Dusche. Sonst friert mir noch mein Arsch ab«, rufe ich ihr laut lachend entgegen und vernehme voller Wohlwollen das zustimmende Gekicher um mich herum.
»Gut so Kira!«, ruft Anna im Vorbeigehen, bevor sie in der Tür zu den Damenduschen verschwindet.
»Wuhuu!!«, jubilieren auch meine Teamkameradinnen.
»Oh, na das wollen wir lieber nicht riskieren.« Nora grinst süffisant. »Das würde die Männerwelt wohl kaum verkraften.«
Und so komme ich endlich zu meiner wohlverdienten Dusche, den Typen von vorhin, längst aus dem Gedächtnis gelöscht.
Caroline
»Und sollte ich von Ihnen noch keinen Beitrag erhalten haben, erwarte ich ihren Konzeptentwurf für die anstehende Semesterarbeit mit einem fünfseitigen Essay über ihre Forschungsmethoden bis Ende des Monats per E-Mail. Sollten Sie schon jetzt Beratungsbedarf verspüren, tragen Sie sich bitte bei meinem Assistenten in die Liste für die ersten Sprechstundentermine im neuen Jahr ein«, endet der einschläfernde Monolog von Professorin Albrecht.
Ein leises Raunen geht durch die Reihen, der Großteil der Studierenden hört allerdings ohnehin schon lange nicht mehr zu. Die Mädelsgruppe links von mir tuschelt. Eine Rothaarige mit kurzem akkurat geschnittenem Bob-Haarschnitt reicht soeben nicht gerade unauffällig eine Zeitschrift herum und deutet auf ein Foto. Ich erkenne sofort, dass es sich um die neueste Ausgabe der Famous handelt. Nicht, dass ich meine kostbare Zeit je selbst mit Klatschblättern verschwenden würde, aber gänzlich drumherum kommt man ja leider nicht. Zwar flüstern die Klatschtanten, aber ihre Stimmen schrillen vor Aufgeregtheit so laut, dass ich sie auch zwei Sitze weiter noch deutlich vernehme.
»Die lasse ich mir auf jeden Fall zu Weihnachten schenken!«, stimmt eine Dunkelblonde der Rothaarigen anerkennend zu.
»Ich bin ja eher für den schwarzen Mini. Den hatte KK in ihrem letzten Video an. Total schick, hat so etwas Französisches.«
»Ja, voll!«, stimmen ihr die anderen eifrig nickend zu.
»Wer spricht denn von Oder?«, gibt die Dunkelblonde kess von sich und blättert weiter. »Soll Schatzi mir einfach beide kaufen!«
Sie klimpert übertrieben mit den Augen, sodass ihre Sitznachbarinnen noch stärker kichern. Die Dozentin rattert ihre Informationen einfach weiter in Rekordzeit runter. Die enorme Geschwindigkeit ihres Monolog-Marathons macht deutlich, dass auch sie den Beginn der Weihnachtsferien herbeisehnt.
»Habt ihr ihre neuen Frisuren-Ideen gesehen?«, meldet sich nun die kleine bislang eher wortkarge Asiatin zu Wort. »Das Video ist der Hammer! Den Fischgrätenzopf probiere ich nachher gleich mal aus.«
»Schade, dass deine Haare so kurz sind«, entgegnet die Dunkelblonde und wirft der Rothaarigen einen bedauernden Blick zu.
Ich verdrehe innerlich die Augen und bemühe mich, die Schnattertanten zu überhören. Echt wissbegierige und interessierte Kommilitonen habe ich da. Da soll mich noch mal jemand fragen, warum ich in den letzten Monaten seit Semesterbeginn noch keinen richtigen Anschluss in meiner Universität gefunden habe. Bevor ich mich auf Small-Talk-Freundschaften einlasse, bin ich lieber für mich allein. Da habe ich wenigstens meine Ruhe vor solch trivialen Gesprächsthemen.
Ich sehe wieder nach vorne und notiere mir gewissenhaft die Daten in meinen Moleskine-Kalender. Er ist abgewetzt und überfüllt, dafür liebe ich ihn umso mehr. Ohne dieses lederne Organisations-Hilfswerk wäre ich vollkommen aufgeschmissen. Nur mit Hilfe der vielen farblich unterteilten Checklisten, Tabellen und Notizen behalte ich den Überblick über all meine Pflichten. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich und ja es ist nur ein Kalender, aber er vermittelt mir das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Ich bin ein Nerd. Aber was solls, das habt ihr ohnehin schon längst gemerkt, nicht wahr?
»Meiner Erfahrung nach, bieten sich vor allem folgende Werke zur Recherche an …« Während die Dozentin endlich zu ihrer letzten Folie mit Literaturempfehlungen wechselt und den Studierenden schöne Semesterferien wünscht, überlagern sich bereits die Stimmen. Feierlich werden die letzten Glühweinschlucke aus den zur Tarnung verwendeten Thermobechern getrunken. Als würde das Alkoholverbot auf dem Campus aufgrund der nahenden Feiertage plötzlich nicht mehr gelten. Also echt. Meine Kommilitonen tun gerade so, als ob die Professoren nichts mitbekommen würden, nur weil es sich um ein jährliches Campus-Ritual handelt, dass in der letzten Vorlesung vor den Weihnachtsferien vermeintlich heimlich zusammen angestoßen wird.
Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich bei dem Blödsinn mitgemacht habe, kann ich euch beruhigen. Natürlich nicht! Wobei so ein Schlückchen Glühwein vielleicht meine flatternden Nerven beruhigen würde …
Nein, ermahne ich mich selbst. So einen Unsinn mache ich nicht mit, genauso wenig, wie bei dem Bingo-Spiel. An solchen Kindereien habe ich keinerlei Interesse, immerhin bin ich zum Studieren hier. Ich find´s fragwürdig, warum die meisten Studierenden überhaupt in der Vorlesung sind, wenn sie ihre Aufmerksamkeit ohnehin mit Begeisterung auf alles andere richten, statt Professorin Albrechts Vortrag zu folgen.
Okay, wenn man es genau nimmt, achten sie auf die Worte heute schon akribisch. Aber den Inhalt versuchen sie gar nicht erst zu begreifen. Den meisten meiner Kommilitonen geht es heute nur darum, auch ja bei allen Wörtern oder typischen Professorenphrasen der Bingo-Liste einen Schluck Glühwein zu trinken, um die benötigten fünf Felder in einer Reihe abzuhaken. Dass ihr Verhalten nicht nur kindisch ist, sondern auch die Vorlesung stört, begreifen sie nicht. Wobei vermutlich merken sie schon, wie nervig es ist, wenn sie reihenweise auf Toilette hechten. Aber interessieren tut es sie nicht die Bohne.
Also echt, sowas von unreif!
Um mich herum werden Notizen zusammengepackt, Klappsitze werden hochgeklappt und das Rascheln von Taschen und Schuhgeklapper vermischt sich mit fröhlichen Festtagsgrüßen. Mit einem schwarzen Fineliner zeichne ich einen sauberen Haken hinter die Vorlesung und verstaue meinen Kalender zusammen mit meinen restlichen Unterlagen in meiner großen leicht ausgefransten Ledertasche. Der Vorlesungssaal leert sich und die Uhr an meinem Handgelenk macht mir nur zu deutlich, dass ich es nicht länger aufschieben kann.
Zeit, nach Hause zu fahren.
Jetzt wisst ihr es also.
Wisst, wovor ich mich so verzweifelt drücke.
Ich folge der tuschelnden Rothaarigen und ihrer Clique aus der Reihe und werfe einen letzten Blick auf die mittlerweile zusammengerollte Famous. Die Zeitschrift ist nicht länger von Bedeutung und liegt leicht zerknittert auf dem Boden des Vorlesungssaals. Im Vorbeigehen greife ich nach ihr und überlege kurz, sie der Rothaarigen an den akkurat frisierten Hinterkopf zu werfen, entscheide mich dann aber doch für die vernünftigere Vorgehensweise. Mit einem leisen Klong landet sie im halbgefüllten Mülleimer. Die Clique merkt von meinen stummen Widerworten nichts, geradezu unsichtbar bin ich für sie. Aber wer bin ich auch schon. Nur eine von vielen anderen wortkargen Studentinnen. Im Einheitsblaugrau gekleidet und ohne das geringste Fashion-Highlight oder andere herausstechende Freizeitaktivitäten. Namenlos. So unauffällig wie möglich. Und genau so wollte ich es ja auch. Will es noch immer. Und doch fühle ich mich ausgeschlossen. Dabei ist es meine eigene Entscheidung, mit einigen Metern Abstand hinter der quasselnden Clique hinterherzulaufen statt neben ihnen.
»Ich wette, KK hat insgeheim was mit Jonas am Laufen«, mutmaßt eine Schwarzhaarige, die mir zuvor noch gar nicht aufgefallen ist. Sie trägt flippigere Klamotten als die anderen und erinnert mich ein wenig an Katy Perry. Ihre Stimme klingt nasal, was aber auch an der triefenden Nase liegen kann. Wintergrippen machen eben auch bei Schönheiten keine Ausnahme.
»Nein, bestimmt mit diesem Sportler. Wie hieß der noch mal – Lars? Ne, Leon!«, rätselt die kleine Asiatin mit.
»Quatsch, Kaffee-Kira steht eindeutig auf Ältere. Ich wette, sie hat etwas mit einem ihrer Lehrer!«, widerspricht ihr die Rothaarige und der Katy-Perry-Verschnitt schnalzt mit der Zunge.
»Irrks!« Sie keuchen lauthals auf und ich verziehe angewidert das Gesicht. Hier an der Universität von Oldenburg bringt mich keiner mit KK alias meiner kleinen Schwester Kira in Verbindung. Sie ist mein kleines Geheimnis. Und das soll auch so bleiben.
Auch wenn ich in der Beliebtheitsskala der Katy-Gang wohl einige Pluspunkte einheimsen würde, wenn ich ihnen meine Connection zu ihrem Idol verriete. Stattdessen entfliehe ich der Masse von aufgeregten Erstsemestern und folge der Menge durch das große Eingangsportal in die kalte Winterluft hinaus. Augenblicklich strömt weißer Atem aus meinem Mund. Ich ziehe meinen großen Wollschal aus meiner Tasche und binde ihn über meine Nase. Im Gehen ziehe ich die alte Daunenjacke ein wenig enger. Das laute Geschnatter des Vierergespanns lasse ich mit dem vorweihnachtlich geschmückten Campus hinter mir. Schummriges Licht vereinzelter Laternen erhellt den schneebedeckten Kiesweg zum Parkplatz. Die frische Schneedecke knirscht unter meinen Stiefeln und verschmilzt zu einem gräulichen Einheitsmatsch. Eilig ziehe ich meinen Autoschlüssel aus der Tasche und eile an den parkenden Wagen vorbei.
Brr, ist das kalt geworden. Wo sind bloß meine Handschuhe?, frage ich mich, während ich die kribbelnden Finger schlotternd aneinander reibe.Die herabfallenden Schneeflocken wirbeln um mich herum. Mit geröteten Fingern kratze ich das vereiste Schlüsselloch frei. An mir hasten vermummte Studenten vorbei zu ihren Wagen und preschen mit spritzenden Reifen vom Parkplatz. Mit aller Kraft ziehe ich die Fahrertür meiner alten Klapperkiste auf und drehe den Schlüssel im Zündschloss. Doch nichts passiert.
Einmal. Zweimal. Beim dritten Startversuch gibt mein Wagen endlich nach. Ratternd springt die Heizung an und ich betätige immer wieder die Scheibenwischer, um den pulverigen Frischschnee von der Windschutzscheibe zu entfernen. Als wäre es nicht schon eisig genug, bläst die Heizung mir nun auch noch die eiskalte Luft des Wageninneren ins Gesicht. Genervt steige ich aus und kratze schnell den Restschnee von der Frontscheibe. Dann fahre auch ich endlich von dem mittlerweile menschenleeren Parkplatz. So langsam heizt sich das Wageninnere auf und meine von der Kälte geröteten Finger nehmen wieder einen normalen Farbton an. Im Radio ertönt Dean Martins Winter Wonderland und ich betätige summend den Blinker. Einmal die Spur wechseln und schon nehme ich die zweite Abzweigung und fahre direkt auf die Autobahn.
Es ist das erste Mal seit meinem Studienbeginn vor einigen Monaten, dass ich das idyllische kleine Oldenburg hinter mir zurücklasse und mich nach Hause in die Großstadt aufmache. Ich wünschte, ich könnte meinen Besuch noch um einige weitere Monate aufschieben. Zuhause warten ein paar unangenehme Gespräche auf mich. Sachen, die ich lange aufgeschoben habe und am liebsten weiter ignorieren würde. Menschen, denen ich mich stellen muss. Dinge, die ich regeln sollte. Aber darüber will ich nicht nachdenken, jetzt noch nicht. Für den Augenblick muss ich nur fahren.
Der Schnee lässt nach und wirbelt nur noch vereinzelt an den Fensterscheiben vorbei. Mein Magengrummeln übertönt beinahe das laute Rattern der Motorengeräusche. Den Gedanken, dass ich eigentlich mit der alten Kiste unbedingt mal in die Werkstatt müsste, verdränge ich hartnäckig.
Keine Zeit, kein Geld.
Auf der Autobahn ist nicht viel Verkehr und da mein Magen nicht zu grummeln aufhört, suche ich mit der rechten Hand in meiner Handtasche nach einem Energieriegel. Außer einem vertrockneten Tomate-Rucola-Sandwich aus der Mensa habe ich heute vor Nervosität nichts runtergekriegt. Aber vielleicht ist mir auch so schlecht, eben weil ich noch nichts Nahrhaftes zu mir genommen habe.
Ah, da haben wir ihn ja. Schokolade-Nuss. Mit diesen ganzen Fruchtmischungen kann man mir gestohlen bleiben. Herzhaft beiße ich in den Riegel und freue mich schon auf ein heißes Bad und ein leckeres Abendessen nachher. Wenigstens etwas Gutes muss es ja haben, nach Hause zu kommen. Ja Caro, spreche ich mir selbst Mut zu, zumindest darauf kannst du dich freuen.
Kira
»Dreieinhalb von zehn Sternen. Höchstens. Ugg-Botts sind sowas von 2010.«
Kritisch beäugt Nora ein an uns vorbeischlenderndes Mädchen, bevor sie ihren Blick durch das gut besuchte Einkaufszentrum schweifen lässt. Wir sitzen in der Nähe unseres Lieblingscafés auf dem Betonsockel einer abstrakten Statur und lassen die Beine baumeln, während wir die Outfits der vorbeilaufenden Passanten bewerten.
»Immer noch besser, als mit Ballerinas durch den Schnee zu watscheln.« Ungläubig deute ich auf eine Mädchenschar, die sich die Nasen am Schaufenster eines Juweliers plattdrücken. Nora macht einen zustimmenden Laut und schlürft an ihrem Lebkuchen-Latte. Ich lehne mich über die Sushi-Packungen, die zwischen uns verstreut liegen und greife mit zwei feinen Holzstäbchen nach einem Avocado-Maki. Die Einkaufspassage ist wie ein zweites Zuhause für Nora und mich. Wir sind schon so oft hier gewesen, dass wir mittlerweile in den Läden Ein- und Ausgehen, ohne überhaupt noch auf der Suche nach etwas Neuem zu sein. Die Kosmetikerinnen kennen uns bereits und stören sich nicht mehr da dran, wenn wir stundenlang Produkte ausprobieren oder unser Make-up auffrischen. Oder wir probieren Kleider an, bei denen wir nicht mal in Erwägung ziehen, sie zu kaufen. Ein ganz normaler Schulnachmittag eben. Wir testen uns gerade durch die Weihnachtsedition einer bekannten Kaffeekette, da fällt mir ein Mädchen aus unserer Schule ins Auge. Prompt verschluckt Nora sich neben mir an meiner heißen Schokolade mit Weihnachtskeksstückchen.
»Nicht deine Geschmacksrichtung?«, frage ich grinsend und meine eigentlich das Getränk.
»Ach du grüne Neune, die hält sich wohl selbst für ein Weihnachtspaket.« Nora prustet los und stimmt in mein Gelächter mit ein.
»Ach komm, immerhin ist Samt gerade angesagt«, witzle ich und wir schauen beide dem Mädchen hinterher. Sie ist zwei Klassen unter uns und trägt ein ausladendes samtrotes Kleid, mit einer riesigen Schleife auf Taillenhöhe.
»Ja, wenn du drei Jahre alt bist vielleicht. Aber so läuft man doch nicht als Teenie herum.« Meine beste Freundin schnaubt und schüttelt abfällig den Kopf.
»Ich glaube, ich habe genug gesehen. Lass uns ins Kino. Vielleicht hat Greg ja wieder Dienst und spendiert uns ein paar Freikarten.« Ich strecke mich gelangweilt.
»Du meinst Georg.« Nora prustet los und ich strecke ihr die Zunge raus.
»Als wenn sich irgendjemand tatsächlich all die Namen deiner Verflossenen merken könnte«, ziehe ich meine beste Freundin auf und klopfe mit meinen schneeverkrusteten Schuhsohlen gegen den Betonsockel. Während ich eher aus Langeweile mit Jungs knutsche, verliebt Nora sich stets Hals über Kopf und ja es ist immer die ganz ganz große Liebe. Aber ebenso schnell, wie sie sich in jemanden verknallt, verliert sie nach ein paar Stunden, Tagen oder Wochen auch wieder das Interesse. Nur um dann ihr nächstes Opfer auszuwählen.
Okay, so wahllos wie ich sie gerade darstelle, ist sie gar nicht. Sie sucht eben den Richtigen – für ihr erstes Mal.
Ich schiebe mir die letzte Sushirolle in den Mund und sehe aus dem Augenwinkel, wie Nora kurz auf ihr Handy schaut.
»Immer noch keine Nachricht?«, erkundige ich mich.
Sie schüttelt frustriert den Kopf und lässt die Beine baumeln. Nora hat echt ein Händchen für die falschen Typen. Das mit ihr und Jonas geht jetzt schon seit etwas über zwei Monaten, was ein Rekord in der Nora-Zeitmessung ist. Ich rechne jeden Tag damit, dass sie ihn endlich abschießt. Tut sie aber nicht. Und das, obwohl allgemein bekannt ist, dass er nichts Festes sucht. An ihrer Stelle würde mir das gelegen kommen. Neben der Schule, dem Hockeytraining und unserem Nebenverdienst als Video-Blogger bleibt ohnehin kaum Freizeit über. Warum sollte man die damit verschwenden immer nur denselben Typen zu treffen? Außerdem enden Beziehungen immer in einem großen Drama und Meer von Tränen, da habe ich echt kein Bedürfnis nach.
Wenn man so wie ich, einmal jemanden verloren hat, den man wirklich geliebt hat, macht man keine Zukunftspläne mehr. Dann hört man auf, an das viel zu oft versprochene Happyend zu glauben. Was bringt es auch, sich in träumerischen Schwärmereien zu verlieren? Lieber lebe ich im Moment, statt verzweifelt das Leben, um jemand anderes zu planen, bevor es mir ohnehin wieder entgleitet. Wenn ihr mich fragt, kann man nur ein absoluter Idiot sein, wenn man so blöd ist, sein Herz zu verschenken. Es an ein anderes Individuum zu binden, ohne zu wissen, was derjenige damit vorhat. Wie pfleglich er mit dem eigenen Herzen umgehen wird. Ich jedenfalls bin alles andere als auf der Suche nach einem Herzensbrecher.
Aber genug von mir. Ihr seid wohl kaum hier, um meine abgeklärte Meinung zum Thema Liebe – oder wenn es um Nora geht Sex – zu hören. Nein, in dieser Geschichte geht es um etwas anderes. Aber das werdet ihr noch früh genug herausfinden.
Ich will Nora gerade auf eine Passantin aufmerksam machen, die trotz Vorweihnachtszeit mit einem sommerlichen Blumenmuster bei der Bäckerschlange schräg gegenüber ansteht, da bemerke ich eine tuschelnde Mädchengruppe, die neugierig die Hälse in unsere Richtung reckt.
»Doch ich bin mir sicher, dass sie das sind«, flüstert die eine und ihre Freundin mit der blauen Wollmütze mustert uns aufmerksam, bevor sie sich wieder ihren Freundinnen zu wendet. Aufgeregt tuscheln sie, bevor sie wieder in unsere Richtung gucken.
Auch wenn ich mittlerweile daran gewöhnt bin, immer und überall erkannt zu werden, ist mir dieser anfängliche Moment und die dazugehörige Unsicherheit in ihren Gesichtern unangenehm. Immerhin will ich nicht überheblich sein und auf sie zu gehen, als wäre ich irgendein Weltstar. Zumal die Möglichkeit besteht, dass sie mich nicht erkannt oder nur verwechselt haben. Oder einfach nur über mein Outfit lästern. Was allerdings eher unwahrscheinlich ist, da ich in meinem neuen Topshop-Shirt und den Armedangels Skinny-Jeans absolut bombastisch aussehe, nur mal so nebenbei erwähnt.
Für gewöhnlich ignoriere ich in solchen Situationen das Getuschel so gekonnt wie möglich, bis sich eine traut, mich direkt anzusprechen. Das ist leichter. Ich liebe meinen Job, aber die Trennung meines öffentlichen Ichs von der privaten Kira, fällt mir auch nach fast drei Jahren nicht leicht.
Wenn ich jemandem im Alltag vorgestellt werde, dann ist da stets dieses leichte Zögern. Die Stirn wird gerunzelt und ich werde genau abgecheckt, bis meinem Gegenüber klar wird, woher er meinen Namen kennt. Noch bevor er meine Hand geschüttelt hat, urteilt er bereits über mich. Aufgrund der Schlagzeilen, den Aussagen anderer. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann.
Früher habe ich versucht, die vorgefertigten Meinungen zu berichtigen. Den Leuten mein wahres Ich zu zeigen. Wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, habe ich mich bemüht, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Ich habe mit Elan diskutiert und mich darum bemüht, den Hochmütigen meine Sichtweise zu zeigen. Aber in den letzten Monaten ist es mir den Aufwand nicht mehr wert. Sollen sie denken, was sie wollen. Mich für oberflächlich, konsumgesteuert und unbedacht halten. Die eine Person, deren Meinung mir wirklich wichtig ist – am allerwichtigsten von allen war – die zählt nun nicht mehr.
Ich verdränge meine Gedanken. Stattdessen greife ich nach den leeren Essensbehältern und werfe sie in den Mülleimer des Sushistandes. Ich hoffe, dass Nora nicht merkt, wie aufgewühlt ich innerlich schon wieder bin. Wie leicht mich das Getuschel aus der Bahn wirft. Ich war zwar auch früher etwas launisch, doch nie habe ich so schnell die Geduld verloren. Ich bin so voller Wut, voller Enttäuschung und Zorn, dass ich bei den kleinsten Sachen ausrasten könnte. Tue ich natürlich nie. Wie würden meine Fans das bloß finden, wobei die Klatschpresse sich vermutlich sogar noch bedanken würde. Statt meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, lache ich einen Tick lauter, während ich innerlich tobe. Nur in meinen Gedanken lasse ich dem Zerstörungswahn freie Bahn. Und je erfolgreicher ich meine Gefühle verberge, desto wütender macht es mich insgeheim, dass niemand hinter meine Fassade blickt.
»Na los, Süße. Dann lass uns Georgie mal einen Besuch abstatten«, necke ich Nora und ziehe sie lachend hinter mir her, noch bevor sie merkt, dass wir wieder einmal erkannt wurden. Nirgends sicher sind, vor der Bürde des Ruhms.
Caroline
Knapp 200 Kilometer und zweieinhalb Stunden Fahrtzeit später zwänge ich mich endlich in eine winzige Parklücke nicht weit von meinem Elternhaus entfernt. Je näher ich meinem Wohnviertel in den letzten Minuten kam, desto langsamer fuhr ich durch die menschenleeren Straßen. Aufmerksam betrachtete ich alles. Suchte nach äußerlichen Veränderungen, die erklären würden, warum ich mich so fremd fühle, obwohl dies meine Heimat ist. Alles sieht so aus wie immer und doch passe ich hier nicht mehr her. Ich entdecke niemanden, den ich kenne.
Bis auf die dicke Schneeschicht auf den Dächern und Gehwegen hat sich scheinbar nichts verändert. Es ist bereits finster und die meisten Vorhänge sind zugezogen. Nur vereinzelte Wohnzimmer werden durch das flackernde Fernsehlicht des üblichen deutschen Abendkrimis erhellt. Als der Motor verstummt, atme ich einmal tief ein und spreche mir selbst Mut zu, bevor ich in die Eiseskälte hinaustrete. Dann tapse ich, vollgeladen mit verschiedenen Taschen und Tüten voller Büchern und dreckiger Wäsche, langsam wie ein Pinguin über den vereisten Gehweg, bis ich endlich an meinem Ziel angekommen bin.
Morgensternweg Nummer 13.
Das rote Backsteinhaus, das neunzehn Jahre lang mein Zuhause war. Der Ort, den ich die letzten Monate am meisten gemieden habe. Der Grund, warum ich im vergangenen Jahr zahlreiche Nachtschichten in der Bibliothek eingelegt habe, um ihm für ein paar weitere Stunden zu entkommen. Für sechseinhalb Monate konnte ich es verdrängen.
Mein Leben, meine Familie, dieses Haus.
Aber jetzt stehen die Weihnachtstage bevor und so langsam gehen mir die Ausreden aus, warum ich mich nicht endlich Zuhause blicken lasse. Zwiegespalten, ob ich nun lächeln oder weinen soll, stehe ich einen kurzen Moment vor der massiven Haustür. Die Tüten in meinen Armen sind zum Zerbersten schwer und die Eiseskälte kaum erträglich, sodass ich es einen Atemzug später hinter mich bringe. Langsam schließe ich die Haustür auf und rufe: »Ich bin wieder da!«
Doch niemand hört die Nervosität in meiner Stimme, denn das Einzige, was mir entgegen hallt, ist eine ohrenbetäubende Leere.
KAPITELZWEI
Caroline
Es ist nicht so, dass ich keinerlei glückliche Erinnerungen an mein Zuhause habe. Das ist es ja gerade: Ich hatte hier die beste Zeit meines Lebens. Nein WIR hatten die beste Zeit.
Als Familie.
Wir haben gelacht und geweint. Die Erlebnisse des Tages gemeinsam Revue passieren lassen und unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Wir sind zwar auch mal in die Wolle geraten, aber spätestens am Frühstückstisch am nächsten Morgen war alles wieder verziehen. Bis sich vor dreieinhalb Jahren alles änderte. Schleichend und doch wahrnehmbar.
Einen Moment stehe ich starr in der Diele, überwältigt von ihrer Präsenz. Ich hatte damit gerechnet, dass der unverkennbare Geruch, der jeden Ankömmling unseres Hauses begrüßt mit der Zeit verfliegen würde, aber noch immer liegt ein leichter Hauch von Shalimar in der Luft. Ich schlucke den brennenden Schmerz hinunter und verdränge den Verlust. Sperre all die Erinnerungen in eine Kiste, weit hinten in meinem Kopf, die viel zu klein dafür ist.
Ich lasse die Taschen fallen und rufe erneut, doch niemand antwortet. Perplex laufe ich durch den kurzen Flur und schalte das Deckenlicht im Nebenzimmer an. Ungläubig wandere ich von einem Zimmer ins nächste, bis ich die gesamte untere Etage durchquert habe. Das Wohnzimmer, die Küche ja sogar die Vorratskammer – keine Menschenseele ist zu finden.
Anscheinend sind sie ausgeflogen, schießt es mir durch den Kopf. Aber nein, das kann nicht sein. Haben die mich etwa vergessen?
Zorn keimt in mir auf und meine Schritte werden schneller. Ich laufe zurück in den Flur und suche auf dem kleinen hölzernen Beistelltisch nach einem gelben Klebezettel mit einer Botschaft. Nichts. Mein Blick wandert hoch zum Spiegel. Nicht einmal dort wartet ein Willkommensgruß oder gar eine Entschuldigung auf mich.
»Verdammt! Tolle Familie.«
Das ist ja wohl ein Scherz. Ein Willkommensessen nach all den Monaten meiner Abwesenheit ist kaum zu viel verlangt. Noch während ich überladen mit meinen Sachen die Stufen ins Obergeschoss hochlaufe, verwandelt sich mein angespanntes Zähneknirschen in Enttäuschung. Vom Tränenschleier geblendet bleibe ich vor meiner Zimmertür stehen. Wie eben schon vor der Haustür spreche ich mir Mut zu. Atme ein und wieder aus und schlucke meinen Frust hinunter. Wie immer. Meine Gefühle kommen in der Prioritäten-Rangliste zuletzt.
Sei stark für mich, Caroline, höre ich die bittende Stimme meiner Mutter. Du musst jetzt tapfer sein, um es ihnen nicht noch schwerer zu machen.
Mit angehaltem Atem öffne ich die Tür zu meinem alten Schlafzimmer. Es sieht genauso aus, wie ich es vor ein paar Monaten zurückgelassen habe. Nur wirkt es irgendwie unpersönlicher und kälter als ich es in Erinnerung habe. Die Wände sind in einem ausgeblichenen Hellgelb gestrichen und bis auf ein Periodensystem hängen keine Bilder dran. Alles liegt ordentlich an seinem Platz, sogar das Bett ist sorgfältig bezogen. Ich fröstle und merke, dass die Heizung in diesem Zimmer ausgeschaltet ist. Ich stelle meine Taschen neben der Tür ab und laufe zum Heizkörper hinüber, um ihn anzudrehen. Unschlüssig schaue ich mich im Raum um. Mein Blick gleitet wieder aus der offenen Tür hinaus ans andere Ende des Flures. Die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern steht leicht offen. Ein Schauer überläuft mich. Erst Wut, dann Trauer und nun Sorge – so rasant wie in den letzten Minuten sind meine Emotionen das gesamte letzte halbe Jahr nicht geschwankt. Und da wundere sich noch einmal jemand, wieso ich dieses Haus verabscheue. Aber die Sorge zieht mich voran, raus in den Flur.
O bitte lass ihm nichts passiert sein. Oder ihr.
Vorsichtig spähe ich ins Elternzimmer, kann aber noch immer niemanden entdecken.
»Paps?«, rufe ich zögerlich aus. »Bist du Zuhause?«
Es ertönt keine Antwort, ich schalte auch hier das Licht an. Abermals überwältigt mich ihre Präsenz wie ein Bulldozer. Das Doppelbett ist ordentlich zurechtgemacht, vor der linken Betthälfte liegen noch immer achtlos abgestreifte Hausschuhe und zusammengeknüllte Socken. Auf dem Nachttisch daneben befinden sich eine Handcreme und ein aufgeschlagener Roman. Ein glückliches Pärchen ziert das Buchcover. Es ist, als würde sie jeden Augenblick aus dem Badezimmer kommen und sich mit einem Glas Rotwein und einem schnulzigen Liebesroman ins Bett setzen. Beunruhigt wende ich mich ab und greife in die hintere Hosentasche meiner Jeans. Ich angele nach meinem Handy, entsperre den Bildschirm und schicke eine Nachricht an meine Schwester: Wo zur Hölle seid ihr und wieso liegen Mamas Sachen noch immer überall herum?
Nachdem ich notdürftig ausgepackt habe, mache ich mich auf den Weg zurück in die Küche. Wenn ich schon kein Willkommensessen serviert bekomme, muss ich mir eben selbst eine Kleinigkeit zaubern. Erst beim erneuten Betreten der Küche bemerke ich, wie vollgestellt sie ist. Vorhin hatte ich nur einen kurzen Blick hineingeworfen, um nach meiner Familie zu suchen, aber jetzt schaue ich genauer hin und mir fällt all das dreckige Geschirr auf. Halbgeleerte Schüsseln mit aufgeweichtem Müsli stapeln sich neben zahlreichen Lieferservice-Verpackungen. Der Geruch von einer thailändischen Nudelmischung vermischt sich mit dem Gestank von leeren Bierflaschen, die in der Spüle gestapelt sind. Die Pizzareste neben der halbleeren Chips-Tüte sind so eingetrocknet, dass sie mit Sicherheit nicht erst seit gestern Abend dort liegen. Angewidert verziehe ich das Gesicht und nehme mir eine große Mülltüte, um mich schleunigst um das Chaos zu kümmern.
Es sieht aus, wie nach einem Wochenende sturmfreier Bude. Als hätte ein Teenager das Elternhaus zum ersten Mal für sich allein gehabt. Und nicht so, wie man es von einem erwachsenen Mann mit seiner fast volljährigen Tochter erwarten würde. Mit grummelnden Magen räume ich die saubere Spülmaschine aus, um sie anschließend mit dem dreckigen Geschirr zu befüllen. Ich entdecke ein, wie es scheint, noch frisches Schwarzbrot und belege mir zwei Brotscheiben mit Käse. Ich nehme mir nicht die Zeit mich zum Essen hinzusetzen, sondern beiße einfach im Stehen, während der Aufräumaktion, von den Broten ab. So hatte ich mir mein Willkommensessen echt nicht vorgestellt.
»Na, kaum Zuhause und schon räumst du wieder hinter Paps her?«, ertönt hinter mir plötzlich die spöttische Stimme meiner Schwester. Ich zwinge mir ein Lächeln auf die Lippen, dann drehe ich mich zu ihr um. Noch bevor ich sie zu einer Umarmung heranziehen kann, entgleitet mir das Lächeln bereits wieder. Doch das liegt gar nicht daran, dass es mir vor unserem Wiedersehen am meisten gegraust hat. Ihre Erscheinung lässt mich erstarren. Jetzt wo sie nach all den Monaten der inneren Monologe auf einmal leibhaftig vor mir steht, verpufft mein Zorn mit einem Mal und zurückbleibt nur ein Hauch von Mitgefühl. Nein, eine ganze Wagenladung. Vor mir steht eine blasse Gestalt, die bis auf ihr lässig übergeworfenes Jeanshemd komplett in Schwarz gekleidet ist. In ihren engen Jeans und den abgewetzten Bikerboots wirkt sie zerbrechlicher denn je. Ich schüttle leicht den Kopf, blinzle ein paar Mal, um sie richtig in Augenschein zu nehmen. Zu realisieren, dass diese Frau vor mir so gar nichts mit der Erinnerung an das lebensfrohe und freche Mädchen gemeinsam hat, das ich einst kannte. Man scheint mir meine Enttäuschung anzusehen. Sie mustert mich mit einem ebenso skeptischen Gesichtsausdruck und verschränkt die Arme vor der Brust, lenkt meine Aufmerksamkeit damit nur noch mehr auf das viel zu kurzgeschnittene Croptop.
»Was hast du da denn bitte an?«, entfährt es mir entsetzt und ich schlucke. Dann reißt mir der Geduldsfaden: »Mensch Kira! Du holst dir noch eine Lungenentzündung, es ist Winter! Hast du mal rausgesehen? Meine Güte, das hast du doch gar nicht nötig!«
Ihre Lippen kräuseln sich verächtlich und einen unsagbar langen Augenblick schaut sie mich einfach nur an. Genau wie früher. Wenn Kira etwas nicht passt, zucken die Muskeln in ihrem Kiefer und eine kleine Vene tritt hervor. Ich rechne mit einer patzigen Antwort. Zu meiner Verblüffung dreht sie sich nur augenrollend um und schaltet den Milchkocher an.
»Auch schön dich zu sehen, Schwesterherz«, wirft sie mir störrisch entgegen. Unbeholfen sehe ich in der Küche umher. Bin nicht sicher, ob ich besser gehen oder bleiben soll. So unangenehm ist die Spannung, die in der Luft liegt. Nervös pule an meiner Nagelhaut und räuspere mich. Verdammt, so sollte unser erstes Gespräch nicht ablaufen. Kira scheint ähnliche Gedanken zu haben.
»Möchtest du auch einen heißen Kakao?«, richtet sie etwas versöhnlicher das Wort an mich. Ihre melodische Stimme klingt zaghaft.
»Ja, bitte«, murmle ich und hole eine halbleere Kekspackung aus dem obersten Küchenschrank, die ich eben erst ordentlich verstaut hatte. Ich stelle sie auf den kleinen Küchentisch in der Ecke. Dann verharren wir wieder in dieser unerträglichen Stille und blicken beide stumm auf die sich langsam erhitzende Milch. Es bilden sich kleine Bläschen und ein weißer Dampf steigt im Milchaufschäumer auf. Fieberhaft suche ich nach Worten, um das Eis zwischen uns zu brechen. Aber ich weiß partout nicht wie. Manchmal kommt mir Kira wie ein Panther vor: In einem Moment schnurrt sie noch samtig, wie ein kleines Kätzchen und im nächsten attackiert sie einen mit scharfen Krallen.
Okay ihr habt mich erwischt, schon wieder.
Ich neige zu Übertreibungen.
Na schön, ertappt.
Aber bei Kira weiß man echt nie, woran man gerade ist!
Und ihre Worte können mindestens genauso schmerzhaft wie Pantherkrallen sein. Wenn ihr nur wüsstet, wozu sie fähig ist. Was sie mir angetan hat. Ich knirsche mit den Zähnen, um auch diese schmerzhafte Erinnerung zu verdrängen.
»Du kommst ja ganz schön spät nach Hause«, gebe ich letztlich nur lahm von mir. »Ich dachte, jetzt wo die Vorabitur-Prüfungen anstehen, nimmst du die Schule etwas ernster und bist unter der Woche nicht mehr ständig unterwegs.«
»Ach.« Nun schaut sie mich direkt an. Ihre linke Augenbraue hebt sich und der Kiefermuskel zuckt verdächtig. »Und ich dachte, du hast die Stadt verlassen, um endlich mal ein eigenes Leben anzufangen, anstatt dich ständig in das anderer einzumischen.«
Okay war ja klar, dass sie etwas verstimmt sein würde, aber solche Vorwürfe habe ich dann nun doch nicht verdient. Immerhin bin ich hier diejenige, die hintergangen wurde. Aber das hat Kira so an sich. Obwohl sie diejenige ist, die Mist gebaut hat, schafft sie es, stattdessen ihrem Gegenüber ein schlechtes Gewissen einzureden. Nun, zumindest tut sie das bei mir.
»Kira …«, beginne ich versöhnlich, aber werde von ihrer immer lauter werdenden Tirade überrollt.
»Wenn du nur hier bist, um wieder ständig die Ersatzmutter raushängen zu lassen und alle meine Schritte zu überwachen«, donnert sie los, während ihre Wangen immer mehr glühen, » sag´s lieber gleich. Dann packe ich nämlich meine Sachen und zisch gleich wieder ab.«
»Moment mal, Kira«, versuche ich, sie zu besänftigen. »Ich verstehe ja, wenn es dir gegen den Strich ging, dass ich mich in letzter Zeit nicht so oft gemeldet habe. Aber ich musste mich schließlich erst mal auf dem Campus einleben und –«
»Nicht so oft? Ach, so nennt man das jetzt also, wenn jemand ohne Vorwarnung einfach so abtaucht und absolute Funkstille herrscht«, speit sie verächtlich aus.
Wütend funkeln wir uns an, bis der Milchkocher anfängt zu piepen und wir beide erschrocken zusammenfahren. Ich will meine Hand ausstrecken, doch Kira ist schneller. Ich denke schon, sie schüttet mir die heiße Milch gleich über, so wutverzerrt ist ihr Gesicht. Aber dann dreht sie sich nur um und hantiert kurz in der kleinen Küchenzeile, um anschließend zwei dampfende Tassen mit heißer Schokolade auf den Küchentisch zu befördern. Zögernd gehe ich zu ihr hinüber und will mich gerade hinsetzen, da richtet sie abermals das Wort an mich.
»In ein paar Wochen verpisst du dich ja eh wieder. Also was interessiert es dich, wie wir hier unser Leben führen«, gibt sie patzig von sich und schiebt sich eine lange dunkle Haarsträhne hinters Ohr. »Du hast dein Mitspracherecht verwirkt, als du einfach abgehauen bist.«
In meinem Hals bildet sich ein dicker Kloß und ich komme mir mies vor. So richtig mies. Als hätte ich kein Anrecht darauf gehabt, mir ein neues Leben aufzubauen. Aber ich konnte einfach nicht länger bleiben. Konntest du nicht oder wolltest du nur nicht?, zischt mir meine innere Kritikerin zu.
Ich konnte nicht! Nicht nur wegen der Sache mit Mama. Vor allem wegen des Kusses. Aber das sage ich natürlich nicht. Kira ist immerhin meine kleine Schwester und sollte sich mit so etwas nicht herumplagen müssen. Und sie hat ja Recht, ich hätte sie besser beschützen sollen. Wenn nicht ich, wer dann?
»Mensch Kiri, du tust ja so, als hätte ich euch im Stich gelassen«, setze ich mich zu ihr und wende mich mit sanfter Stimme an sie. »Es tut mir leid, wenn es sich für dich so angefühlt hat. Aber ich musste mich nach dem Abitur erst einmal auf meine eigene Zukunft konzentrieren.«
Kira schaut stur auf den Tisch und kaut auf ihrem Daumennagel herum.
»Und in Oldenburg habe ich das Gefühl, dass ich das auch wirklich kann. Es gibt richtig gute Studienprogramme«, setze ich erneut an. Kira blickt weiterhin stumm auf die Tassen vor ihr, sodass ich übereilt fortfahre. »Und ihr könnt mich ja mal besuchen.«
Ich beiße mir auf die Lippe und verdränge schnell den Gedanken, dass mir nichts unangenehmer wäre, als mit Kira über den Campus zu laufen. Immerhin bin ich extra so weit weggezogen, gerade damit niemand meine Schwester mit mir in Verbindung bringt.
»Ja, schon gut«, murmelt sie schließlich. Hoffentlich sieht sie mir meine Erleichterung nicht an, weil sie nicht direkt auf den Vorschlag, mich zu besuchen, eingegangen ist. Aber Kira sieht nur weiterhin auf die Getränke und schiebt mir schließlich die angeschlagenere der beiden Keramiktassen zu. Sie ist aus einem zarten hellgelb und auf der Außenseite steht aus krakeligen Buchstaben zusammengesetzt Caroline. Schnell greife ich nach der Tasse und verdecke die Inschrift. Verdränge die Erinnerung an den Nachmittag vor gut zehn Jahren.
Kira und ich liebten es, zu basteln und bekamen nicht genug vom Ostereierbemalen. Eines Sonntagnachmittags gingen uns die Eier aus und Mama reichte uns spontan zwei Tassen. Wir hatten einen Heidenspaß. Auch wenn Kira erst sechs war und gerade einmal ihren Namen schreiben konnte, kritzelte sie eifrig unzusammenhängende Buchstaben, kleine Motive, Blumen und krakelige Herzchen. Ich weiß noch, wie ihr dabei im Mundwinkel die Zungenspitze raushing, weil sie so konzentriert malte. Und auch wie sauer Paps abends war, weil die bunte Farbe nicht wie erwartet wieder vom Geschirr abwaschbar war. Aber Mama lachte nur und je älter wir wurden, desto mehr bedeutete uns unser personalisiertes Geschirr, sodass wir es schließlich nicht nur behielten, sondern auch wie einen Schatz hegten und pflegten. Seit meinem Umzug habe ich keinen Gedanken mehr an diese Tassen verschwendet. Und die Erinnerung, wie eigentlich alle anderen auch, in diesem Haus zurückgelassen.
»Uni ist halt spannender, als hier mit Paps und mir abzuhängen. Versteh schon.« Noch immer schaut Kira auf ihre Tasse und dreht sie unruhig in ihren Händen hin und her. Diesmal übertönt die Trauer den vorwurfsvollen Tonfall und erweicht mein Herz wieder ein Stück weit für sie. Was soll ich bloß machen, um ihr zu helfen? Würden unsere Wünsche sich bloß nicht so sehr voneinander unterscheiden.