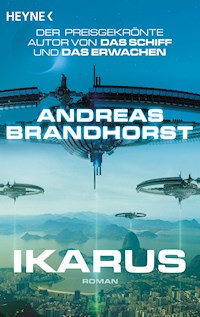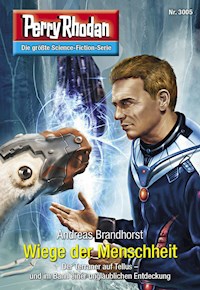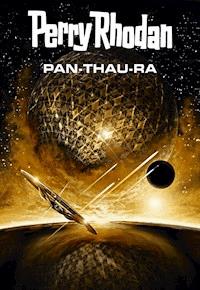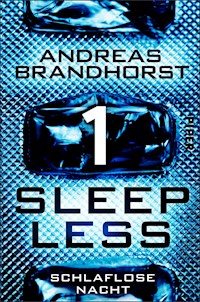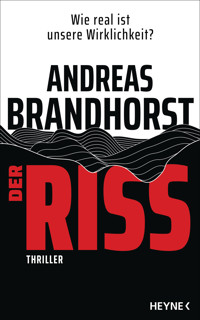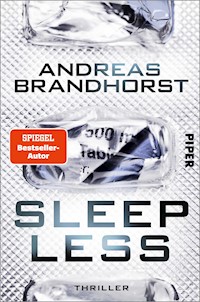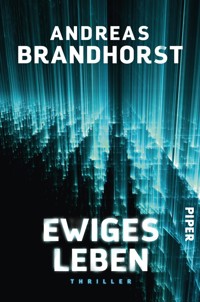
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin Sophia erhält einen scheinbar harmlosen Auftrag: Für den Biotechnologie-Konzern Futuria soll sie ein Porträt für die Firmengeschichte verfassen. Futuria wird wegen seiner Verdienste um die gentechnische Heilung von Krankheiten wie Krebs und der Forschungen auf dem Gebiet der Lebensverlängerung geschätzt. Doch je tiefer Sophia gräbt, desto unheimlicher wird ihr das Unternehmen, dessen Gründer, der legendäre Salomon Leclerq, seit einigen Jahren verschwunden ist. Sie stößt auf Hinweise, dass Futuria den genetischen Schlüssel für die Unsterblichkeit gefunden hat. Doch hinter der Verheißung von ewigem Leben verbirgt sich ein düsteres Geheimnis, ein großangelegter Plan, den das Unternehmen verfolgt. Gemeinsam mit dem abtrünnigen Casper muss Sophia alles daransetzen, den Plan zu vereiteln. Denn Futuria hat nicht vor, sein Wissen nur zum Wohle der Menschheit einzusetzen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-99177-3
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: shutterstock/DrHitch
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Prolog
Zwanzig Jahre später
I – Wenn der Tod stirbt
Sophia Marchetti
1 – Der Helikopter glitzerte …
2 – Der Wind fachte …
3 – Der Mann sah …
4 – »Sie hätten nicht …
5 – Sophia träumte. Das …
Jossul
6 – Jossul ging langsam …
7 – Jossul verließ die …
8 – Dünner Nieselregen fiel …
Sophia Marchetti
9 – Drohnen patrouillierten über …
10 – Der Mond schien …
11 – Der Superexpresszug hatte …
12 – Borris, dachte Sophia …
Papst Pius XIII.
13 – »Heiliger Vater!«, ertönte …
14 – Der Konvoi rollte …
Sophia Marchetti
15 – Von der Terrasse …
16 – Ein Geräusch weckte …
Jossul
17 – Jossul saß auf …
18 – Ein Schritt, lang …
19 – Jossuls Wahrnehmungen veränderten …
20 – Jossul saß noch …
Papst Pius XIII.
21 – Scheinwerfer machten die …
Sophia Marchetti
22 – Es war noch …
23 – »Sollen wir warten, …
Lars Fosnes Børndalen
24 – Børndalen schlug die …
25 – Mitten in der …
Jossul
26 – »Halt hier an, …
27 – Regen fiel auf …
28 – Einige Stunden später, …
Sophia Marchetti
29 – »Es wird wieder …
30 – Zweige schlugen ihr …
31 – »Was einmal funktioniert …
32 – »Ein einfacher zwölfstelliger …
Sophia Marchetti
33 – Sophia hätte darauf …
34 – Der nächste Raum …
35 – Es war eine …
Sophia Marchetti
36 – Im Osten zeigte …
37 – »Der Test war …
Papst Pius XIII.
38 – Heute sterbe ich, …
Jossul
39 – Ein blauer, wolkenloser …
40 – Eine Dreiviertelstunde später …
41 – Jossul stand inmitten …
42 – »Die Welt ist …
II – Zweimal ewiges Leben
Papst Pius XIII.
43 – Ich lebe, dachte …
44 – Auch hier gab …
Sophia Marchetti
45 – Sophia stand in …
Jossul
46 – Manchmal gingen sie …
47 – Sie überquerten die …
48 – Bruno Eberhard Kreuzbach …
Papst Pius XIII.
49 – Papst Pius, von …
50 – Sie standen auf …
51 – »Sie sehen müde …
Sophia Marchetti
52 – Die von Casper …
53 – Der Nachrichtensprecher kehrte …
Jossul
54 – Die Menschen jubelten, …
55 – »Ich bin Giulia«, …
56 – Finnegan sah auf …
57 – Die blaue Limousine …
Papst Pius XIII.
58 – »Wie schnell vergeht …
59 – Schon eine Viertelstunde …
60 – Ein Fahrstuhl trug …
Sophia Marchetti
61 – »Halten Sie an«, …
62 – Sie fuhren kreuz …
Jossul
63 – Mailand brannte. Nicht …
64 – Jossul schlief und …
Sophia Marchetti
65 – Es war fast …
66 – Der Morgen war …
67 – Als Sophia und …
Papst Pius XIII.
68 – Um drei Uhr …
Jossul
69 – Um kurz nach …
70 – »Haben Sie kein …
71 – Die Futuria-Filiale in …
Papst Pius XIII.
72 – Es schmerzte, dass …
Sophia Marchetti
73 – Plötzlich gab es …
74 – Sie schritten durch …
75 – Der letzte Waggon …
76 – In Raumanzüge gehüllt …
Sophia Marchetti
77 – Schiefergrauer Teppichboden schluckte …
78 – »Wir müssen sie …
79 – Das Blockhaus stand …
Jossul
80 – »Sie sind noch …
Zwischenspiel
Papst Pius XIII.
81 – Der Dieb des …
82 – Luigi Giordano traf …
Sophia Marchetti
83 – Im Osten stieg …
84 – Sie saßen am …
Zwischenspiel
III – Projekt M
Jossul
85 – Der Mann im …
86 – »Lukas«, sagte Jossul …
87 – Das etwa vierzig …
Zwischenspiel
Papst Pius XIII.
88 – Papst Pius, durch …
89 – Luigi Giordano kam …
90 – Der große Platz …
Sophia Marchetti
91 – Sophia fiel nicht …
92 – Sophia erinnerte sich …
93 – Sophia schrie, lachte …
Jossul
94 – Jossul schlief und …
95 – Um kurz vor …
96 – Drohnen patrouillierten am …
97 – Ein E-Wagen von …
98 – »Angefangen hat es …
Papst Pius XIII.
99 – Die weiße Frau …
Sophia Marchetti
100 – »Ich will nicht …
101 – Die Schmerzen in …
Zwischenspiel
Sophia Marchetti
102 – Die Übelkeit wurde …
Casper
103 – Der Superexpresszug Mailand–Genf …
104 – »Nehmen wir dem …
105 – Etwa zwei Kilometer …
Papst Pius XIII.
106 – Bist du durstig? …
Jossul
107 – Eine Stunde später …
108 – Als nur noch …
Casper
109 – »Von Polizei nichts …
110 – Pläne, dachte Casper, …
Jossul
111 – Die Saat des …
Papst Pius XIII.
112 – Papst Pius verbrachte …
Casper
113 – »Wie können wir …
114 – Ein Schritt, ein …
Jossul
115 – Ein Werkzeug, dachte …
Papst Pius XIII.
116 – »Ich weiß nichts …
Casper
117 – Der Schrei lähmte …
Sophia Marchetti
118 – Zugezogene Jalousien sperrten …
Epilog
Papst Pius XIII.
Zitat
Wenn wir Menschen ein angeborenes Verlangen nach Unsterblichkeit haben, so ist es klar, dass wir in unsrer jetzigen Lage nicht sind, wo wir sein sollten. Wir zappeln auf dem Trocknen, und es muss irgendwo ein Ozean für uns sein.
Matthias Claudius, deutscher Dichter, * 15.08.1740, † 21.01.1815
Prolog
Vor einigen Jahren
Der Regen fiel grau und gerade, unbewegt von Wind, ein Vorhang, der die Farben des Gartens dämpfte. Pascal Salomon Leclerq blickte durch das Panoramafenster nach draußen, als sich die Zimmertür hinter ihm öffnete.
»Bitte keine Kamera«, sagte er. »Das Sterben ist eine sehr private Angelegenheit.«
»Kameras sind inzwischen nicht mehr nötig«, antwortete eine Frauenstimme. »Aber wir müssen dabei sein. Zwei Zeugen. Für die Polizei. Für nachher.«
Nachher, dachte Pascal und blickte noch immer nach draußen. Jenseits des Gartens, einige Hundert Meter entfernt, lag der Genfer See, grau wie der Regen und der Himmel, aus dem er fiel. Er hatte diese Villa mit bester Hanglage für die letzten Wochen seines Vaters gemietet, in der Hoffnung, dass ihm Garten und Aussicht den letzten Weg erleichtern würden.
Eine Hand erschien links in Pascals Blickfeld und stellte ein Glas auf den Tisch. Es schien nur Wasser zu enthalten, aber dieser Eindruck täuschte. Fünfzehn Gramm Natrium-Pentobarbital waren in der klaren Flüssigkeit gelöst. Schon wenige Gramm waren tödlich für einen Menschen.
»Es regnet«, sagte Pascal leise. »Ich habe mir Sonnenschein gewünscht.« Er lauschte den eigenen Worten und fand sie dumm. Ob Regen oder Sonne, spielte das eine Rolle?
»Noch kann er es sich anders überlegen.« Wieder die Frauenstimme. »Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen.«
Pascal drehte sich um. Dort saßen sie, die beiden Assistentinnen von Dignitas, beide in mittleren Jahren, selbst noch ein ganzes Stück vom Tod entfernt.
Ein Laut lenkte ihn von den Sterbebegleiterinnen ab, ein leises Stöhnen, ein kurzes Wimmern, wie aus Schmerz oder gar Furcht. Doch Pascal hörte die wahre Botschaft darin: Entschlossenheit und auch Erleichterung.
Er begriff, dass er während der vergangenen Minuten vermieden hatte, seinen Vater anzusehen. Der alte Albain saß nicht mehr in seinem Rollstuhl, sondern von Kissen gestützt in der Ecke des Sofas. Sein Anblick schmerzte: das Gesicht fast so grau wie die Regenwelt jenseits des Fensters und verschrumpelt wie ein alter Apfel. Der Mann, der sein Leben lang stark gewesen war, ein Fels in der Brandung, schien kaum mehr zu sein als Haut und Knochen. Nach den letzten beiden Schlaganfällen hatte er mehr als dreißig Kilo verloren, trotz der Magensonden.
»Vater …« Pascal setzte sich neben ihn. »Dies ist kein guter Tag, um zu gehen.« Wie dumm, dachte er erneut. Wie dumm. Warum rede ich solchen Unsinn?
Er gab sich die Antwort: Weil ich Angst habe. Mehr Angst als er.
Albain ächzte. Speichel rann ihm aus den Mundwinkeln. Ein seltsam staubiger Geruch haftete ihm an, vielleicht der Geruch des Todes.
»Er muss es selbst tun«, sagte eine der beiden Assistentinnen. »Er muss das Glas nehmen und trinken. Alles andere wäre aktive Sterbehilfe.«
Die zweite Frau, etwas molliger als die andere und mit rosigen Wangen, fügte hinzu: »Es hört sich an, als hätte er Schmerzen, aber er hat keine. Wir haben ihm etwas gegeben.«
»Ich weiß.«
Pascal sah seinem alten Vater in die Augen und erkannte einen wachen, eingesperrten Geist, der trotz der schmerzstillenden Mittel litt. Der starke Mann existierte noch, tief drinnen, und wollte nicht schwach sein und dahinsiechen, auf fremde Hilfe angewiesen. Die Augen sprachen: Doch, mein Sohn, dies ist ein guter Tag, es ist der beste von allen.
Pascal legte seinem Vater den Arm um die schmal gewordenen Schultern. Er schwieg; es war bereits alles gesagt.
Der alte Albain Leclerq brummte etwas, und Pascal glaubte, ein »Danke« zu hören. Eine faltige Hand streckte sich zum Glas aus.
Aber sie zitterte, die Hand des alten Mannes, der sterben wollte. Sie zitterte und war zu schwach, um das Glas zu heben. Beim dritten Versuch wäre es beinahe umgekippt – Pascal hielt das Glas im letzten Moment fest.
Albain sank zurück und schien noch etwas mehr zu schrumpfen. Seine Lippen zitterten wie die Hand, und diesmal stahl sich ein gurgelnder Laut zwischen ihnen hervor. Pascal glaubte zu verstehen: Bitte.
Er nahm das Glas.
»Sie bringen sich in Schwierigkeiten«, warnte die schlankere der beiden Assistentinnen.
»Und wenn schon. Es geht hier nicht um mich, sondern um meinen Vater.«
Albain trank sofort, als sein Sohn ihm das Glas an die Lippen setzte. Er trank langsam, und Pascal beobachtete, wie sich beim Schlucken der Kehlkopf bewegte.
Einige Minuten später schlief Albain ein, mit dem Kopf auf Pascals Schulter …
Als es abends nach zehn Uhr an der Tür klingelte, ahnte Pascal, wer ihm einen Besuch abstatten wollte.
»Ich nehme an, Sie kommen von der Polizei«, sagte er statt eines Grußes.
»Kommissar Dumont«, stellte sich der Mann vor. Er war höchstens Mitte dreißig, trug Jeans und Lederjacke. »Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie gestatten.«
»Es ist spät.«
»Vielleicht nicht zu spät für das Gespräch, das ich mit Ihnen führen möchte.«
Pascal wich beiseite, und der Besucher trat ein.
»Ihr Vater ist hier gestorben, nicht wahr?«, fragte Kommissar Dumont, als sie im Wohnzimmer Platz nahmen, vor dem großen, leeren Kamin. Nach dem langen Regentag war es kühl, aber Pascal hatte kein Feuer im Kamin angezündet und im weichen gelben Schein einer Stehlampe gesessen.
»Ja, heute Morgen.« Pascal wartete.
»Dignitas ist verpflichtet, uns Meldung zu erstatten.« Dumont saß entspannt, die Hände im Schoß gefaltet. »Sie haben aktive Sterbehilfe geleistet. Das ist bei uns verboten.«
»Wollen Sie mich verhaften?« Es klang etwas aggressiver als beabsichtigt.
»Zunächst einmal möchte ich mit Ihnen reden. Sie sind Alleinerbe Ihres Vaters, nicht wahr?«
Pascal beugte sich vor, öffnete die auf dem Tisch liegende Mappe und schob sie dem Kommissar hin. »Hier finden Sie alle Unterlagen, darunter das Testament, eine Patientenverfügung meines Vaters und eine notariell beglaubigte Erklärung, die er vor einigen Jahren geschrieben hat.«
Dumont sah sich die Unterlagen an. »Sie sind gut vorbereitet.«
»Nein, das bin ich nicht. Das ist niemand von uns. Der Tod kommt immer plötzlich und viel zu früh, selbst wenn man ihn erwartet.«
Der Kommissar blätterte in den Unterlagen. »Ihr Vater hinterlässt Ihnen ziemlich viel. Aktien, Immobilien, ein gut gefülltes Bankkonto.«
»Er hat sich nie die Zeit genommen, sein Geld auszugeben«, erwiderte Pascal und starrte in den leeren Kamin. »Er hat immer nur gearbeitet und alles andere auf später verschoben.«
»Seine Anwaltskanzlei war sehr erfolgreich«, sagte Dumont.
»Sie ist es noch immer.«
»Sie sind kein Anwalt, sondern Genetiker.«
»Molekularbiologe«, korrigierte Pascal.
»Sie haben ein kleines Unternehmen in der Nähe von Genua«, fuhr Dumont fort, ohne von den Dokumenten aufzusehen. »Ihre Frau stammt aus Genua. Ich nehme an, deshalb haben Sie sich dort niedergelassen. Und nach Ihrer Scheidung vor ein paar Jahren sind Sie in Ligurien geblieben. Kann ich verstehen. Ein schönes Fleckchen Erde.«
»Sie haben sich gut informiert.«
»Ihre Firma heißt Nuova Biogenetica Srl und ist nicht sehr erfolgreich. Ohne die finanzielle Unterstützung Ihres Vaters hätten Sie Ihre Laboratorien längst schließen müssen.«
Pascal schwieg und fühlte noch immer den Kopf seines Vaters an der Schulter, als dieser entschlafen war.
»Jetzt haben Sie genug Geld, um im großen Stil weiterzumachen. Neue Technik, mehr Zeit für Forschung und Entwicklung.« Dumont klappte die Mappe zu und schob sie in die Mitte des Tisches.
»Mein Vater wollte kein Anwalt werden«, sagte Pascal. »Er hat mir einmal davon erzählt, bei einer Wanderung in den Pyrenäen, vor vielen Jahren. Er hat dem Druck seines Vaters nachgegeben, der ihn unbedingt zu seinem Nachfolger machen wollte, und so entstand Leclerq & Leclerq. Mein Vater hat es nicht fertiggebracht, seinen Vater zu enttäuschen – er hat sich in ein Leben pressen lassen, das er nicht führen wollte. Er hat gearbeitet und gearbeitet, und während die Jahre vergingen und zu Jahrzehnten wurden, hat er davon geträumt, durch die Südsee zu segeln. Oder als Architekt großartige Gebäude zu errichten. Oder Romane zu schreiben. Er wollte tauchen, durch die Sahara marschieren, Japans Kultur kennenlernen und im australischen Outback der Stille lauschen. Aber jetzt …« Pascal seufzte. »Jetzt ist er tot und nimmt seine Träume mit ins Grab.«
»Sie haben sich strafbar gemacht, Monsieur Leclerq«, sagte der Kommissar ohne Strenge in den Worten.
»Mein Vater war immer ein starker Mann. Er hatte Angst davor, ein Pflegefall zu werden, dahinzuvegetieren und für alles auf Hilfe angewiesen zu sein.« Pascal Leclerq deutete auf die Mappe in der Tischmitte. »Er hat ausdrücklich um einen würdevollen Tod gebeten. Das war sein letzter Wunsch.«
»Er hätte das Glas selbst nehmen und ohne fremde Hilfe trinken müssen.«
»Dazu war er nicht mehr imstande!«, entgegnete Pascal scharf. »Der starke Mann war bereits zu schwach!«
»Ich verstehe.« Dumont nickte kurz und stand auf.
Pascal erhob sich ebenfalls. »Sind Sie Vater, Kommissar Dumont? Haben Sie einen Sohn?«
»Nein.«
»Stellen Sie sich vor, Sie sind alt und gebrechlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben dauernd Schmerzen und können nicht mehr ohne Hilfe essen oder auf die Toilette gehen. Stellen Sie sich vor, alles wird mühevoll, jeder einzelne Atemzug. Für was würden Sie sich entscheiden, Kommissar Dumont? Für ein Leben unter solchen Umständen oder einen schnellen, schmerzlosen Tod? Wären Sie nicht dankbar für einen Sohn, der das Glas für Sie hält?«
Sie gingen zur Tür.
»Wenn ich die Wahl hätte …« Dumont blieb vor der Tür stehen.
»Ja?«
»Ich würde das Leben wählen, Monsieur Leclerq. Ein Leben ohne Gebrechlichkeit und Schmerzen. Ich würde mir wünschen, dass es immer weitergeht.«
»Und wenn es immer so weiterginge, Kommissar Dumont … Was würden Sie mit all der Zeit anfangen? Welches Leben würden Sie führen?«
»Derzeit bin ich ganz zufrieden damit, Kommissar zu sein«, sagte Dumont. »Aber auch ich habe Träume. Jeder von uns hat welche, nicht wahr? Wenn ich genug Zeit hätte … Vielleicht würde ich versuchen, die Welt zu verändern.«
Pascal glaubte zu verstehen. »Sie sehen jeden Tag schlimme Dinge.«
»Ich blicke jeden Tag in die Abgründe der menschlichen Seele.« Dumont war plötzlich sehr ernst. »Glauben Sie, dass man die Welt verändern kann, Monsieur Leclerq?«
»Vielleicht. Mit den richtigen Werkzeugen.« Pascal öffnete die Tür. »Haben Sie vor, mich zu verhaften?«
»Ich nehme an, Sie verlassen die Schweiz nach der Bestattung.«
»Sobald ich die Urne bekommen habe. Morgen.«
»Gut.« Der Kommissar trat in die Nacht. »Auf Wiedersehen, Monsieur Leclerq! Oder besser: Leben Sie wohl!«
Kurz vor der italienischen Grenze klarte es auf. Die grauen Regenwolken blieben zwischen den Bergen hängen, die Sonne schien, und es wurde wärmer.
Pascal verließ die Autobahn, parkte seinen alten Lancia auf einem Rastplatz und betrat das Restaurant. Mit Kaffee und einer vom Morgen übrig gebliebenen Brioche setzte er sich ans Fenster und beobachtete die Menschen, wie sie kamen und gingen, jeder von ihnen mit einem eigenen Leben, voller Zwänge, Hoffnungen und Träume.
Wir leben, als wären wir unsterblich, dachte er. Wir schieben hinaus, was uns wichtig ist, weil wir vorher andere Dinge erledigen müssen und glauben, genug Zeit zu haben. Aber die Zeit genügt nicht, sie genügt nie. Wir haben nie genug davon. Wir werden alt, und irgendwann ist es zu spät.
Eine Fliege weckte seine Aufmerksamkeit. Sie lief über die Fensterscheibe, verharrte kurz, tastete mit ihrem Saugrüssel und lief weiter. Musca domestica, erkannte er. Eine gewöhnliche Stubenfliege, mit einer Lebenserwartung zwischen sechs und zweiundvierzig Tagen, je nach Temperatur und Nahrungsangebot.
Solche Fliegen konnten nicht viel aufschieben; die Natur verdammte sie zu einem kurzen Leben. Bei anderen Lebewesen war sie großzügiger. Ein Klongehölz in Tasmanien – vom Aussterben bedroht, obwohl theoretisch unsterblich – war mehr als vierzigtausend Jahre alt. Auf einem schottischen Friedhof wuchs eine fünftausend Jahre alte Europäische Eibe. Auf Sizilien gab es eine dreitausend Jahre alte Kastanie, auf Kreta einen ebenfalls dreitausend Jahre alten Olivenbaum und im Südwesten Schwedens eine fast zehntausend Jahre alte Fichte. Oder die Actinobakterien im sibirischen Permafrost: Angeblich lebten sie seit einer halben Million Jahren und waren damit älter als der Homo sapiens sapiens. Die genetische Programmierung bestimmte, wie alt ein Organismus werden konnte. Mit einer Änderung dieses Programms konnte man die Lebensspanne verkürzen oder verlängern.
Was hatte der Kommissar in der Schweiz gesagt? Ich würde mir wünschen, dass es immer so weitergeht.
Pascal beobachtete die Fliege und dachte: Wir brauchen die richtigen Werkzeuge. Mit den richtigen Werkzeugen ist alles möglich.
Die Fliege schwirrte davon, und Pascal blickte ihr nach. Plötzlich wich ein Schatten von ihm, und er sah alles klar und deutlich, klarer und deutlicher als jemals zuvor. Die Ereignisse der vergangenen Tage hatten ihm einen Schleier von den Augen gezogen. Vor ihm erstreckte sich die Zukunft, er betrachtete sie wie eine Landschaft, die im Sonnenschein lag, nachdem sich der Nebel von Nacht und Morgen aufgelöst hatte. Alles war deutlich zu erkennen, das Ziel ebenso wie der Weg dorthin.
Pascal schob den Teller beiseite, stand langsam auf und blieb einige Sekunden lang reglos stehen, die Zukunft im Blick. Dann verließ er das Restaurant, den Kaffee nur zur Hälfte getrunken, die Brioche nur zur Hälfte gegessen.
Im Auto saß er mehrere Minuten lang still und stumm, holte schließlich das Handy hervor und wählte die Nummer seines Büros. Es klingelte nur einmal, bevor sich Amadeus Vanheuver meldete, sein niederländischer Freund, Kollege und Assistent.
»Ich habe nicht damit gerechnet, schon so bald von dir zu hören«, sagte Amadeus. »War bestimmt alles andere als angenehm für dich, die Sache in der Schweiz.«
»Hör mir zu, Mozart.« Pascal versuchte langsam zu sprechen, obwohl die Worte aus ihm herausdrängten. »Wir stellen alles um. Schluss mit Mäusen und Ratten. Ab sofort konzentrieren wir uns auf das menschliche Genom, unsere DNA. Darauf setzen wir unsere Genschere an.«
»Krisper?«
So sprach Amadeus, von seinen Freunden Mozart genannt, es aus: Krisper. Er meinte die neue CRISPR/Cas-Methode, eine zuverlässige, billige und sehr präzise genetische Schere.
»Ja.«
»Mit Mäusen und Ratten verdienen wir viel Geld«, erwiderte Amadeus. »Wenn wir damit aufhören, stehen wir bald mit leeren Händen da.«
»Geld haben wir genug, das ist kein Problem mehr«, sagte Leclerq. »Es stammt von jemandem, der gern mehr Zeit gehabt hätte.«
»Die menschlichen Gene sind tabu, Pascal. Daran herumzupfuschen, könnte uns in große Schwierigkeiten bringen.«
»Wir pfuschen nicht daran herum. Wir schneiden Krankheit und Tod aus ihnen heraus.« Pascal holte tief Luft und sah die nächsten Jahre klar vor sich. »Wir verändern die Welt, wir beide. Wir bauen uns die Werkzeuge, mit der wir sie verändern. Wir fangen neu an und geben uns einen neuen Namen. Darum wollte ich dich bitten, Mozart. Sorg dafür, dass der neue Name noch heute eingetragen wird. Ein Name, der eine bessere Zukunft bedeutet.«
»Wie lautet er?«
»Futuria.«
Zwanzig Jahre später
I
Wenn der Tod stirbt
Sophia Marchetti
Bei Tres Cantos,
nördlich von Madrid
1
Der Helikopter glitzerte silbern im Sonnenschein und näherte sich mit einem dumpfen Wummern der Rotorblätter. Als er neben den weißen Gebäuden der Futuria-Niederlassung zur Landung ansetzte, fühlte Sophia plötzlichen Schwindel und einen kurzen Schmerz, wie ein Brennen in den Knochen, eine Erinnerung an den Tod, von dem sie nur wenige Tage trennten. Sie hob die linke Hand, während der Redner auf dem Podium vor den weißen Gebäuden der Futuria-Niederlassung sprach, und sah erste rote Punkte auf dem Handrücken – die Marker erinnerten sie daran, dass sie eine neue Therapie brauchte.
Ich habe sie vergessen, dachte sie. Ich habe meine Krankheit vergessen, als gäbe es sie gar nicht mehr.
»Alles in Ordnung?«, fragte der aus Schweden stammende Borris. Er trug eine Datenbrille, deren Gläser Bilder einer kompakten Kameradrohne wiedergaben – sie schwebte wie ein etwas zu groß geratenes Insekt über ihm und zeichnete die Präsentation auf.
Die Brille war Sophias Idee gewesen. Ein kleines lokales Netzwerk verband sie nicht nur mit der Kamera, sondern auch mit den Datenbanken ihrer Smartphones und über deren Netz mit den Archiven von InterMedia, der Nachrichtenagentur, für die Sophia und Borris arbeiteten.
Sophia und Borris hofften, dass es sich beim angekündigten Ehrengast dieser Veranstaltung um den legendären Pascal Salomon Leclerq handelte, der Futuria vor zwanzig Jahren gegründet und innerhalb weniger Jahre zu einem Global Player gemacht hatte, im Bereich der Genetik und Biotechnologie mindestens ebenso groß und bedeutend wie die digitalen Riesen Google, Facebook, Amazon, Alibaba und Baidu. Seit drei Jahren war der exzentrische Firmengründer nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, und eigentlich hielt es Sophia für unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet hier, unter der heißen spanischen Sonne im Hinterland von Madrid, vor einem Publikum sprechen würde, das aus nicht mehr als hundert ausgewählten Gästen und Journalisten bestand. Aber man konnte nie wissen. Es wäre ein echter Knüller, dachte Sophia und merkte, wie ihre Gedanken schon wieder fortglitten von der Krankheit. Sie spielte kaum noch eine Rolle in ihrem Leben, was sie Futuria verdankte.
Sie zeigte Borris die roten Marker und ließ die Hand sinken. »Morgen in Madrid. Die nächste Therapie.«
Er wusste Bescheid und nickte. Dürr und groß stand er im warmen Wind, das weiße T-Shirt wie eine an seinem schmalen Leib flatternde Fahne, in der einen Hand das Smartphone und wie Sophia mit einer Hörkapsel im Ohr. Die Vorträge wurden auf Spanisch gehalten, und es gab genug Ähnlichkeit mit dem Italienischen, um sie zu verstehen, wenn nicht zu schnell gesprochen wurde.
Aber Sophia und Borris wollten sicher sein, keine halb versteckten Hinweise zu überhören – deshalb benutzten sie die Übersetzungsapps ihrer Handys. Wie alle anderen Anwesenden erhofften sie sich die große Ankündigung, auf die die Welt schon seit Jahren wartete.
Der Redner auf dem Podium – Montero, Filialdirektor von Futuria Tres Cantos, ein schlanker, in seinem hellgrauen Anzug elegant wirkender Mann um die sechzig – hatte vom neuen genoptimierten Getreide auf dem nahen Feld gesprochen. Er unterbrach sich, als der Helikopter landete.
Alle Blicke richteten sich auf die beiden Personen, die aus dem Hubschrauber kletterten: auf der einen Seite eine rotblonde Frau Mitte oder Ende dreißig, auf der anderen ein Mann Anfang vierzig mit weißblondem Haar.
»Erkennst du sie, Borris?«, fragte Sophia. Er überragte alle anderen Leute in der Nähe, und mit seiner Datenbrille sah er mehr.
»Vanheuver und Melissa Fontaine«, antwortete Borris. »Offenbar hat er den Helikopter selbst geflogen. Von Leclerq keine Spur.«
»Meine Damen und Herren«, sagte Montero, als die beiden Neuankömmlinge die kurze Treppe zum Podium hochstiegen, begleitet von einigen Sicherheitsleuten, die aus einem der weißen Gebäude gekommen waren, »ich habe Ihnen einen besonderen Gast versprochen, und hier sind gleich zwei. Ich freue mich, den stellvertretenden Geschäftsführer von Futuria Amadeus Vanheuver und seine Frau, die kybernetische Spezialistin Melissa Fontaine, begrüßen zu dürfen.«
Der Filialdirektor klatschte, und das Publikum vor dem Podium applaudierte ebenfalls.
»Vielleicht kommt es doch noch zur großen Ankündigung«, sagte Borris. »Ich meine, warum sollte Leclerqs Vize sonst hier aufkreuzen?«
Fontaine, Vanheuver und Montero schüttelten sich die Hände. Dann trat Futurias stellvertretender CEO ans Rednerpult.
»Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können.« Er deutete zum nahen Kornfeld. »Direktor Montero hat über FF19 gesprochen, wie wir dieses neue Getreide nennen. Pflanzen sind schon damals, vor Futuria, gentechnisch verändert worden. Ich vergleiche die früher übliche Gentechnik gern mit einer Herzoperation bei geöffnetem Brustkorb. Futurias Verfahren, das von uns patentierte Schnelle und sichere Genome-Editing, kurz SUSGE, entspricht hingegen einem minimalinvasiven Eingriff.«
Die Worte klangen nicht neu. Sophia strich mit der Kuppe des Zeigefingers übers Handydisplay, öffnete eine App und fand, was sie suchte. Die Worte waren zwei Jahrzehnte alt. Jemand anders hatte sie vor zwanzig Jahren in Deutschland gesprochen, der Leiter des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
»Aber ich möchte Direktor Montero nicht vorgreifen und ihm Gelegenheit geben, seinen Vortrag zu beenden.« Vanheuver wich beiseite, Applaus erklang, und Montero kehrte ans Mikrofon zurück.
Er beschrieb die SUSGE-Methode und breitete die Arme aus, als wollte er das ganze Tal umschließen. »Vor dreizehn Jahren, sieben Jahre nach der Gründung von Futuria, haben wir DuPont Pioneer übernommen, den damals größten Agrarkonzern der Welt. Es war eine riskante Übernahme, die große finanzielle Ressourcen band, aber Pascal Salomon Leclerq und sein Vize Amadeus Vanheuver«, Montero nickte in Richtung des Mannes mit dem weißblonden Haar, »beschlossen die Übernahme, weil sie an eine bessere Welt glaubten. Den Hunger besiegen! – das hatte Leclerq damals auf einen Merkzettel geschrieben. Es sollte nicht mehr der Profit an erster Stelle stehen, wie es bisher gewesen war, sondern die Zukunft des Menschen, ein besseres Leben für uns alle – Futuria!«
»Jetzt trägt er ein bisschen zu dick auf«, hörte Sophia Borris murmeln. Zu viele schöne Worte, hatte er einmal gesagt. Für Sophia gab es genug schöne Taten – sie selbst war das beste Beispiel dafür.
»Heute bilden Flora und Fauna nur einen kleinen Teil von Futuria«, fuhr Montero fort, »aber wir sind dabei, den Hunger ganz aus der Welt zu vertreiben. Dieses Getreide ist eine Mischung aus Weizen, Roggen, Gerste und Hirse. Hinzu kommen kleine Anteile von Mais, Reis, Amaranth, Buchweizen und Quinoa, nicht mehr als jeweils zwei Prozent des genetischen Materials. Es ist uns gelungen, den Gluten-Anteil zu reduzieren, was bedeutet: Auch Menschen, die an Zöliakie leiden, an Glutenunverträglichkeit, werden das Brot, das mit Mehl von diesem Getreide gebacken wird, genießen können.« Montero lächelte. »Obwohl auch die Zöliakie bald für immer Vergangenheit sein wird. Unsere SUSGE-Scheren schneiden diesen genetischen Ballast, den wir alle mit uns herumtragen, aus unserer DNA. Wir arbeiten daran!«
Das Publikum belohnte ihn mit Applaus.
»Flora-und-Fauna-19, so nennen wir dieses Getreide, oder kurz FF19. Es wächst dreimal so schnell wie unsere letzten Sorten und hat einen zehnmal so großen Ertrag. Es verbraucht weniger Wasser, kommt sowohl mit Hitze als auch mit Kälte besser zurecht und weist eine hohe Schädlingsresistenz auf.«
Das Korn stand kräftig und gerade, wie ein großer goldener See zwischen den Bergen. Wellen wanderten darüber hinweg, wenn sich die Ähren im Wind duckten.
Jenseits des Kornfelds fuhr ein weißer Lieferwagen trotz der Absperrung über den Weg. Einzelheiten konnte Sophia nicht ausmachen.
Auf der anderen Seite des kleinen Platzes, am Rand des Publikums, stand ein hochgewachsener Mann, und für einen Moment begegnete sie seinem Blick. Er lächelte, aber es war ein falsches Lächeln – Sophia kannte es von mehreren Begegnungen. Stefan Lautner aus München, einunddreißig Jahre alt und damit fünf Jahre jünger als sie, ein eitler Adonis, der seine äußere Perfektion nicht nur teuren Futuria-Behandlungen verdankte, sondern auch ebenso teurem Bodyhacking. Geld spielte für ihn keine Rolle, denn er stammte aus einer reichen Familie. Groß, schlank, breitschultrig, das kastanienbraune Haar schulterlang, die Augen blau wie Opal – es gab keinen Makel an seinem Erscheinungsbild. Und wenn er doch einen entdeckte, beseitigte er ihn sofort mit den modernen Werkzeugen der Selbstoptimierung.
Doch hinter dieser Fassade aus Perfektion, von der sich viele Menschen, die ihn nicht kannten, täuschen ließen, steckten Neid, Missgunst, Arroganz und ein kranker Ehrgeiz, das Bestreben, immer und überall Erster und Bester zu sein.
Lautner arbeitete für Global News, den größten Konkurrenten von InterMedia. Mit seinen guten Beziehungen – und auch mit der guten Arbeit, die er zweifellos leistete – war es ihm mehr als nur einmal gelungen, InterMedia und ihr, Sophia, lukrative Aufträge wegzuschnappen.
Sie beugte sich zu Borris. »Hast du ihn gesehen?«, fragte sie leise.
»Mistkerl«, sagte Borris schlicht.
»In letzter Zeit hängt er an uns wie eine Klette.«
»Vielleicht weil er glaubt, dass wir erfolgreicher sind.« Borris sah weiterhin nach vorn, zum Podium. »Er wird versuchen, uns den Erfolg wegzuschnappen, wenn er Gelegenheit dazu bekommt.«
Sophia wusste, was er meinte. Das Jubiläum. In einigen Monaten jährte sich zum zwanzigsten Mal der Tag, an dem Pascal Salomon Leclerq und Amadeus Vanheuver Futuria gegründet hatten. Aus diesem Anlass wollte das Unternehmen einen großen Bericht in Auftrag geben, über die Firmengeschichte und darüber, wie sehr Futuria die Welt in den beiden vergangenen Jahrzehnten verändert hatte und in den nächsten Jahren weiter verändern würde. Ein großer Exklusivauftrag, der breiten Raum in den Medien einnehmen würde und jede Menge Anerkennung, aber auch viel, viel Geld bedeutete.
Lautner interessierte sich nicht für das Geld, davon hatte er genug, wohl aber für den Ruhm. Ihm ging es um das Rampenlicht, um die auf ihn gerichteten Scheinwerfer, um die Spiegel der Bewunderung, in die er blicken und an denen sich sein narzisstisches Selbst erfreuen konnte.
Vierundvierzig Journalistenteams hatten sich offiziell um den Auftrag beworben, unter ihnen Sophia und Borris. Seit Monaten arbeiteten sie mit ihren Berichterstattungen auf das große Ziel hin, und die Chancen standen gut. Wenn InterMedia leer ausging, wäre die Enttäuschung groß, gestand sich Sophia ein. Sie hoffte, dass in dem Fall nicht ausgerechnet Stefan Lautner den Zuschlag bekam – sein triumphierendes Lächeln hätte sie kaum ertragen.
»Vielleicht ist er hier, weil auch er etwas Großes erwartet«, sagte sie. »Eine wichtige Nachricht. Ich hoffe doch, Vanheuver ist nicht mit leeren Händen gekommen.«
»Wir sind auf alles vorbereitet«, erwiderte Borris. »Wir können sofort online gehen. Lautner müsste verdammt schnell sein, um uns zuvorzukommen.«
Als sich Sophia wieder dem Podium zuwandte, fühlte sie einen Stich im Nacken und dann im Rückgrat, wie von einer Nadel, die durch ihre Wirbelsäule wanderte.
»Flora und Fauna von Futuria gibt der Welt zu essen«, intonierte der Direktor.
»Wann gibt uns Futuria ewiges Leben?«, rief jemand. Sophia kannte die Stimme – Stefan Lautner setzte sich in Szene.
Lauter Applaus wies darauf hin, dass diese Frage alle beschäftigte. Die Unsterblichkeit des Menschen war das größte Ziel von Futuria. Leclerq hatte zum letzten Mal vor drei Jahren davon gesprochen, dass »das goldene Portal des ewigen Lebens« bald geöffnet werden konnte, und seitdem hatte sein Vize Vanheuver bei Pressekonferenzen und in Interviews mehrmals darauf hingewiesen, dass man unmittelbar vor dem entscheidenden Durchbruch stehe.
Der elegante Direktor auf dem Podium lächelte. »Wir arbeiten daran«, verkündete er. »Es dauert nicht mehr lange. Wir sind fast so weit.«
Wieder erklang Applaus, und Sophia klatschte ebenfalls.
»Dort hinten tut sich was«, sagte Borris und deutete nach Norden.
Der weiße Lieferwagen auf der anderen Seite des Kornfelds hatte angehalten. Hinter ihm stiegen Vögel auf.
Sophia sah genauer hin. Nein, es waren keine Vögel, sondern Drohnen, größer als die über ihnen fliegende und von Borris gesteuerte Kamera, aber nicht so groß wie Futurias Überwachungs- und Sicherheitsdrohnen, die am Rand des Platzes mit dem Podium patrouillierten. Einige von ihnen änderten den Kurs und schwirrten über das wogende Korn hinweg.
Fahrzeuge rollten zwischen den Gebäuden auf der linken, westlichen Seite des Kornfelds hervor, beschleunigten auf der asphaltierten Zufahrt und jagten mit hoher Geschwindigkeit am Ufer des goldenen Sees entlang.
Am weißen Lieferwagen öffnete sich die Seitentür.
»Kannst du was erkennen, Borris?«, fragte Sophia.
»Jemand ist ausgestiegen.« Borris stand auf den Zehenspitzen, trotz seiner Größe. »Läuft durchs Kornfeld.«
Die dunklen Drohnen, die Sophia für Vögel gehalten hatte, fielen – abgedrängt von Futurias fliegenden Sicherheitsrobotern – ins Kornfeld, und plötzlich loderten Flammen.
Eine Sirene schickte ihre laute Stimme durchs Tal.
2
Der Wind fachte das Feuer an, und als die ersten Feuerwehrwagen aus Tres Cantos kamen, waren bereits drei Viertel des Kornfelds verbrannt. Doch das Feuer hatte auch den Brandstifter erwischt. Er schien nicht aufgepasst zu haben, oder die Sicherheitsleute von Futuria hatten ihm den Fluchtweg abgeschnitten.
Was auch immer der Fall sein mochte: Er hatte schwere Verbrennungen davongetragen, an beiden Beinen, dem linken Arm und der linken Seite.
Eine Notdienstdrohne wollte ihn in ein Krankenhaus im fünfundzwanzig Kilometer entfernten Madrid bringen, aber Filialdirektor Montero erklärte sich bereit, den Schwerverletzten in Futurias medizinischer Abteilung zu behandeln, was ihm einen neuerlichen Applaus der erschrockenen Präsentationsgäste einbrachte.
Das Feuer wurde gelöscht, die dichten Rauchwolken verzogen sich, und am wieder blauen Himmel über dem Tal, das seinen goldenen See verloren hatte, erschien ein schwarzer Schriftzug, geschaffen von Pigmenten, freigesetzt von einigen Dutzend Mikrodrohnen.
FUTURIA IST NICHT DIE ZUKUNFT, SONDERN UNSER VERDERBEN!
»Traditionalisten?«, brummte Borris kurze Zeit später, als sie zusammen mit den anderen Gästen das von Zypressen und Platanen gesäumte Hauptgebäude betraten. Polizei aus Tres Cantos und Sicherheitsleute von Futuria riegelten das Gelände ab.
»Bitte bewahren Sie Ruhe!«, rief weiter vorn jemand. »Es findet eine Überprüfung statt, zu unserer aller Sicherheit. Bitte halten Sie Ihre Ausweise und Einladungen bereit!«
Sophia fröstelte im klimatisierten Saal und schlang die Arme um sich. Schwäche kroch ihr in die Knie, und sie lehnte sich an die nahe Wand, da es keine freien Sitzplätze mehr gab.
»Ist alles aufgezeichnet?«, fragte sie.
»Ja, von Anfang an. Und die Daten sind bereits übermittelt.«
Wie aus dem Nichts erschien Stefan Lautner vor ihnen, begleitet von der Kamerafrau Emily, die ebenso gut Fotomodell hätte sein können, und seinem kleineren, nicht annähernd so modisch gekleideten und verdrießlich wirkenden Assistenten Clemens.
»Oh, geht es dir nicht gut, liebe Sophia? Du siehst … krank aus.«
»Hallo, Stefan!« Bei ihm klang das Wort krank wie schmutzig. Sophia versuchte ihre Schwäche zu verbergen. »Das ist Borris, falls du ihn übersehen haben solltest, weil er so klein und unauffällig ist.«
»Hallo, Borris!«, erwiderte Lautner. »Was macht die Bildersammlung?«
»Kommt gut voran.«
Stefan Lautner lächelte zuckersüß. »Ich würde gern noch ein wenig mit euch plaudern, aber Direktor Montero hat uns zu sich gebeten. Ich nehme an, er möchte uns etwas Wichtiges mitteilen.« Er zwinkerte und ging.
Sophia sah ihm nach, als er zusammen mit Emily und dem verdrießlichen Clemens den großen, saalartigen Empfangsraum durchquerte und auf der anderen Seite in einem Flur verschwand.
»Du hast recht, Borris.«
»Womit?«
»Er ist ein Mistkerl.« Sophia stützte sich wieder an der Wand ab, um die Beine zu entlasten, aber die Knie zitterten trotzdem.
»Woher weiß er von meiner Bildersammlung?«, fragte Borris.
»Ist sie ein Geheimnis?«
»Das nicht, aber …«
Mehr hörte Sophia nicht, denn Borris’ Stimme verlor sich in all den anderen, die immer lauter und schließlich zu einem Donnern menschlicher Aufregung und Sorge wurden. Das Atmen fiel ihr schwer, der Sauerstoff schien knapp zu werden, und ein oder zwei Minuten lang konzentrierte sie sich ganz darauf, nicht in Ohnmacht zu fallen. Sie bemühte sich, den Flur im Auge zu behalten, aber die Leute standen nicht still, sie wanderten umher, bildeten Gruppen und gestikulierten.
Nach einer Weile ging es Sophia besser. Borris wandte sich ihr zu, und seine Lippen bewegten sich.
»Ich verstehe kein Wort.« Sie hob die Hände zu den Ohren. »Es ist zu laut.«
Er beugte sich zu ihr. »Lautner ist zurückgekehrt. Hab beobachtet, wie er dort drüben nach rechts ging, zum Nebenausgang. Vielleicht sollten wir uns an seine Fersen heften, was meinst du?«
Bevor Sophia darüber entscheiden konnte, näherte sich ihnen ein junger Mann in der schlichten Uniform der Sicherheitsabteilung. »Señora Marchetti? Señor Ekström?« Er rief fast. »Von InterMedia?«
Sophia und Borris holten ihre Ausweise hervor, und der junge Mann warf einen Blick darauf. »Direktor Montero möchte Sie sprechen. Wenn Sie so freundlich wären, mich zu begleiten …«
Er führte sie in einen mit Teppichboden ausgelegten Flur, an dessen Wänden Bilder von Futuria-Filialen auf den fünf Kontinenten hingen, und schließlich in ein Büro mit einem breiten, hohen Panoramafenster. Bis vor wenigen Minuten hatte es einen prächtigen Ausblick ins Tal geboten; jetzt sah man viel Ruß und Asche.
»Es sieht schlimmer aus, als es ist«, sagte der nicht mehr ganz so elegant wirkende Montero hinter dem Schreibtisch. Sein grauer Anzug hatte Falten und Flecken bekommen. »Das Feld ist abgebrannt, aber wir können eine neue Saat ausbringen. FF19 wächst schnell. Eine kleine Verzögerung bei unseren Forschungen, weiter nichts.« Er strich sich mit einer Hand übers graue Haar. »Entschuldigen Sie. Bitte setzen Sie sich!«
Mehrere Ledersessel standen in der Nähe. Sophia und Borris sanken in die beiden direkt vor dem aus Stahl und Holzimitat bestehenden Schreibtisch. Ein Computerschirm stand auf dem Tisch, ausgestattet mit einem kleinen holografischen Projektor. In der Ecke des Zimmers, neben einigen Bonsais – unter ihnen ein Chinesischer Penjing –, bemerkte Sophia eine Eden-Konsole mit einem Liegesitz. Sie fragte sich, ob Filialdirektor Montero gelegentlich Ausflüge in Futurias virtuelle Welten unternahm. Gehörte das zu seinen Aufgaben? Wirkte er bei der Gestaltung von Eden mit?
»Zeichnen Sie auf?«, fragte der Direktor. Er stand noch immer.
»Nein«, antwortete Borris. »Unsere Kameradrohne ist draußen.«
»Sie hat alles aufgenommen, nicht wahr?«
»Ja«, bestätigte Sophia. »Die Bilder sind bereits übertragen.«
»Aber Ihr Bericht noch nicht, nehme ich an.«
»Nein.«
Montero trat hinter dem Schreibtisch hervor, ging zum Panoramafenster und sah nach draußen. Sophia und Borris wechselten einen Blick und warteten.
Schließlich drehte sich Montero um und stand mit dem Rücken zum Fenster.
»Wir sind eine kleine Filiale«, begann er. »Im globalen Maßstab spielt Futuria Tres Cantos keine Rolle. Wir helfen nur ein wenig mit beim Bau der Zukunft. Wichtig ist nur das: der Bau einer besseren Zukunft. Dass ein Kornfeld abgebrannt ist …« Montero zuckte mit den Schultern. »Kaum der Rede wert. Aber …« Er atmete tief durch. »Aber es könnte mehr daraus entstehen, eine größere Sache.«
»Sie möchten den Deckel draufhalten«, sagte Borris, der manchmal sehr direkt sein konnte. »Weil es dem Geschäft schadet?«
»Unsere Gegner versuchen, mehr Einfluss zu gewinnen«, erwiderte Montero. »Überall auf der Welt führen sie Aktionen mit dem Ziel durch, Aufmerksamkeit zu erregen. Einige traditionalistische Gruppen haben sich mit Jossuls Fanatikern verbündet, die sich ›Cherubim‹ nennen. Je mehr sie in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken, desto größer wird ihr Einfluss. Und wenn ihr Einfluss weiter wächst, können sie immer mehr Steine in den Weg legen, der uns alle in eine bessere Zukunft führen soll.«
Die Stimme aus dem kleinen Hörer in Sophias Ohr übersetzte fast synchron. Man konnte vergessen, dass zwei verschiedene Sprachen gesprochen wurden, Italienisch und Spanisch.
Sophia kam einem Einwand von Borris zuvor. Sie dachte an den Exklusivauftrag und fühlte sich wie auf dünnem Eis, als sie sagte: »Wir müssen Bericht erstatten. Das ist unsere Aufgabe, deshalb sind wir hergekommen.«
»Ja, aber die Art der Berichterstattung …«
Hatte Direktor Montero darüber mit Lautner gesprochen? Hatte er auch ihn gebeten, nichts verlauten zu lassen oder die Sache herunterzuspielen? Und wie würde Stefan Lautner auf eine solche Bitte reagieren? Wahrscheinlich fügte er sich Futurias Forderung, nahm Sophia an. Um den Filialdirektor nicht zu verärgern.
Aber das war der falsche Weg. Über die Vergabe des Auftrags für einen Exklusivbericht wurde nicht hier entschieden, nicht in Tres Cantos, sondern in den obersten Chefetagen, in einer der drei großen Firmenzentralen, in San Francisco für virtuelle Realität, Paris für Verwaltung oder Genf für Genetik. Nicht die Abwesenheit von Kritik gab den Ausschlag dafür, wer über das Jubiläum berichten durfte, sondern die richtige Mischung aus Objektivität, Engagement, persönlichem Stil und kommunikativer Effizienz. Journalistische Glaubwürdigkeit war ein wichtiger Punkt.
Sophia gehörte zu den wichtigen Influencern in den Medien, weil sie großen Wert darauf legte, immer und überall glaubwürdig zu sein. Sie hielt Futuria für einen der größten Wohltäter der Menschheit, vielleicht den größten überhaupt, doch das hinderte sie nicht daran, auch kritische Fragen zu stellen und aktuelle Entwicklungen aus ihrer Sicht zu schildern. Die Traditionalisten und erst recht Jossul waren lange genug mit medialen Samthandschuhen angefasst worden. Sie stellten ein immer größer und drängender werdendes Problem dar, das man nicht löste, indem man darüber schwieg.
»Direktor Montero«, begann sie behutsam, »ich glaube, es wird höchste Zeit, dass die Medien im Allgemeinen und Futuria im Besonderen die bisherige Kommunikationspolitik in Bezug auf die Traditionalisten und Jossuls Fanatiker ändern.« Sophia wurde sich bewusst, wie hochgestochen das klang. »Oder anders ausgedrückt: Es wird höchste Zeit, dass wir den Knüppel rausholen. Wir sollten den jüngsten Anschlag nicht herunterspielen, sondern ihn nutzen, um mit unmissverständlicher Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass die Traditionalisten und religiösen Eiferer gegen ausreichend Nahrung für alle sind, gegen die Heilung von Krankheiten, die jedes Jahr Tausenden von Menschen das Leben kosten, wie zum Beispiel HIV und Krebs. Allen muss klar werden, dass uns die Traditionalisten und religiösen Eiferer in eine Vergangenheit voller Leid und Schmerz zurückwerfen wollen. Nicht weniger Aufmerksamkeit wäre der richtige Weg, Direktor, sondern mehr. Jemand versucht, uns unsere Zukunft zu stehlen, und dieser Jemand gehört bekämpft!«
Borris brummte zustimmend. Er hatte sich in den vergangenen Monaten mehrmals dafür ausgesprochen, mit der falschen Rücksichtnahme auf irgendwelche religiösen Gefühle Schluss zu machen und den Traditionalisten und Jossuls Fanatikern gegenüber einen deutlicheren Standpunkt zu beziehen. Auf seiner Fahne stand »Wahrheit« geschrieben. Immer und überall die Wahrheit, ohne Rücksicht auf nichts und niemanden.
Sophia stand auf und fühlte dabei erneut Schwäche in den Knien, als hätte sie zehn oder zwanzig Kilo an Gewicht zugenommen. Vielleicht war es falsch, das Gespräch auf diese Weise zu beenden, aber sie wollte nicht als Bittstellerin erscheinen, die zu Zugeständnissen bereit war, weil sie sich als Gegenleistung dafür den großen Auftrag erhoffte.
»Ich bin mir nicht sicher, ob Sie recht haben«, sagte Direktor Montero vorsichtig.
»Bitte glauben Sie mir, dass ich Ihnen helfen will«, betonte Sophia. »Ihnen und damit uns allen. Klare Kante, das Übel beim Namen nennen.« Ihr fiel etwas ein. »Wie geht es dem Brandstifter? Erlauben Sie uns, mit ihm zu sprechen?«
»Die Polizei ist bei ihm.«
Borris war ebenfalls aufgestanden. »Nach der Vernehmung durch die Polizei?«
»Nur einige Minuten«, fügte Sophia hinzu. Dies war eine gute Gelegenheit, die sie nicht ungenutzt verstreichen lassen durfte. »Ich möchte herausfinden, wie er tickt. Vielleicht gelingt es mir, einen Blick in seinen Kopf zu werfen.«
Montero gab nach. »Na schön. Aber nur ein paar Minuten. Wenn die Polizei mit ihm fertig ist.« Er ging zur Tür.
»Direktor …« Sophia blieb vor ihm stehen und sah ihm in die kastanienbraunen Augen.
»Ja?«
»Galt der Anschlag dem genoptimierten Getreide oder Vanheuver?«
»Die Polizei ermittelt noch«, erwiderte der Filialdirektor ausweichend.
»Was ist Ihre persönliche Meinung?«, wollte Borris wissen.
Montero zögerte kurz. »Dass unmittelbar nach Vanheuvers Eintreffen ein Anschlag erfolgt ist, kann wohl kaum ein Zufall sein. Ich glaube, die Gebäude sollten in Flammen aufgehen, nicht das Kornfeld.«
»Die Traditionalisten haben bisher keine Mordanschläge verübt«, sagte Sophia. »Vielleicht gehört der Attentäter zu Jossuls Leuten.«
»Die Polizei untersucht alle Möglichkeiten.« Montero öffnete die Tür.
»Wo ist Vanheuver? Können wir ihn sprechen?«
Plötzlich war das dumpfe Wummern von Rotorblättern zu hören. Sophia blickte aus dem Fenster und sah, wie der silberne Helikopter aufstieg. Zwei weitere Hubschrauber mit Polizeiemblemen nahmen ihn in Empfang und eskortierten ihn in Richtung Madrid.
»Schade!« Sophia seufzte. »Ich hätte ihm gern eine wichtige Frage gestellt.«
»Fragen Sie mich!«
»Ich verspreche Ihnen, dass dies unter uns bleibt.« Sophia fühlte wieder das Stechen in den Knochen. »Wie lange dauert es noch, bis wir den Tod besiegen?«
»Nicht mehr lange«, sagte Montero ernst. »Nicht mehr lange.«
3
Der Mann sah aus wie eine frisch verpackte Mumie – auf das Körpergewebe abgestimmte weiße Verbandsfolie bedeckte beide Beine, den linken Arm und Teile des Oberkörpers. Im unverletzten Gesicht fielen die großen Augen auf, blau wie Spaniens Sommerhimmel. Sommersprossen zeigten sich auf Nase und Wangen.
Es war ein junger Mann, nicht älter als fünfundzwanzig, schätzte Sophia, während sie neben dem Krankenbett stand, umgeben von medizinischem Gerät. Vermutlich kein Spanier, nach dem blonden Haar und den blauen Augen zu urteilen.
»Können Sie mich verstehen?«, fragte Sophia.
Das Gesicht des jungen Mannes blieb völlig unbewegt. Es zeigte weder Schmerz noch irgendeine Emotion, war einfach nur eine leere Maske.
»Er hat ein Pseudoopiat bekommen«, sagte der Arzt, ein hagerer Mann in mittleren Jahren und mit einer großen Datenbrille, die ihm die Anzeigen der medizinischen Überwachungsgeräte direkt in die Augen projizierte. »Oxykadin. Gegen die Schmerzen und zur Beruhigung. Er hört und versteht Sie. Auch die Polizisten hat er gehört und verstanden.«
»Wie geht es ihm?«
»Fast sechzig Prozent der Haut und des subkutanen Gewebes sind verbrannt«, antwortete der Arzt. Er trug einen grünen Kittel und sah darin aus wie ein Chirurg. »Noch etwas mehr, und es wäre zu viel für das hier gewesen.« Er deutete in die Runde und meinte die kleine medizinische Abteilung von Futuria Tres Cantos.
Sophia bemerkte Direktor Montero, der neben der Tür stand und leise mit einem Polizisten sprach. Sie nickte Borris zu, der daraufhin eine Minikamera hervorholte.
»Wer sind Sie?«, fragte Sophia. »Warum haben Sie das Kornfeld abgebrannt?«
Der junge Mann schwieg.
»Kennen Sie mich? Ich bin Sophia Marchetti von InterMedia. Sie möchten einen großen Auftritt? Hier bekommen Sie ihn.« Sie deutete auf Borris und die Minikamera. »Warum das Feuer? Erklären Sie mir die Hintergründe! Wer hat Sie geschickt? Von wem stammt der Auftrag?«
Montero und der Polizist näherten sich.
»Das ist eine Kamera«, sagte der Direktor unglücklich.
Sophia warf ihm einen Blick zu, der so viel bedeutete wie: Vertrauen Sie mir!
»Sie versündigen sich am Werk der Schöpfung«, sagte der in weiße Verbandsfolie gehüllte junge Mann. Mehrere dünne Schläuche und einige drahtlose Sensoren verbanden ihn mit den medizinischen Geräten und einer Überlebensmaschine von Futuria und Samsung-Meditech am Kopfende der Liege. Sie war geöffnet und bereit, den Verletzten aufzunehmen.
Borris seufzte und rollte mit den Augen, während er die Kamera hielt.
»Er ist ein Nichtregistrierter«, sagte der Polizist, der einige Jahre jünger als Montero zu sein schien und einen grauen Schnurrbart hatte. »Und natürlich hat er keinen Ausweis dabei. Es wird eine Weile dauern, ihn zu identifizieren. Der weiße Elektro-Nissan, mit dem er gekommen ist, gibt uns vielleicht den einen oder anderen Hinweis. Und natürlich untersuchen wir die Reste der Branddrohnen.« Er trat näher an die Liege heran und lächelte in die Kamera.
Sophia musterte den Schwerverletzten. Jemand, der nie seine DNA hinterlegt hatte, der für die genetischen Datenbanken gar nicht existierte. Jemand, der Erbkrankheiten und Krebs riskierte. Vom eigenen Feuer verletzt lag er da, den Leuten ausgeliefert, die er bekämpfte und ohne deren Hilfe er vermutlich gestorben wäre. Das musste ihm klar sein. Dennoch lag Feindseligkeit in den großen blauen Augen.
Sophias Knie zitterten, vielleicht aus Zorn auf diesen dummen, blinden Fanatismus.
»Warum?«, fragte sie. »Warum wollen Sie, dass Menschen an Krankheiten sterben, die längst besiegt sind, dass sie Hunger leiden und in Schmerz gefangen bleiben? Warum sind Sie gegen den Fortschritt, der uns allen mehr Freiheit schenkt?«
Sophia fiel auf, dass sie mit ihrer Journalistenstimme sprach, doch hinter den Worten steckte noch etwas mehr, eine besondere Eindringlichkeit, die den Fragen eine persönliche Note gab. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, wie sich Direktor Montero entspannte. Der Polizist aus Tres Cantos glaubte sich im Bild und lächelte noch immer.
»Sie versündigen sich an Gottes Werk«, wiederholte der junge Mann. »Sie versündigen sich an der Natur, die Er geschaffen hat. Sie versündigen sich am menschlichen Wesen, von Ihm bestimmt. Sie nehmen uns hier und jetzt Krankheit und Schmerz und verstoßen damit gegen die Strafe, die Er uns allen auferlegt hat. Damit verhindern Sie, dass wir uns in Leid und Pein erneuern können, um unsere Schuld abzustreifen und zurückzukehren ins Paradies, wo uns bei Ihm Glück und wahres ewiges Leben erwarten.«
Es waren ruhige Worte, erfüllt von unerschütterlicher Gewissheit, gesprochen von einem Mann, der die Wahrheit zu kennen glaubte und alle bedauerte, die Täuschung und Lügen zum Opfer fielen.
»Haben Sie sich genug Verstand bewahrt, um die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Sie sich irren?«, fragte Sophia. Etwas kroch ihr über den Rücken, so fühlte es sich an. »Oder hat Ihnen Jossul auch den letzten Rest von Rationalität aus dem Gehirn gewaschen? Von ihm kommen Sie doch, oder?«
»Er wird mir seinen Segen und sein Licht schicken, obwohl ich versagt habe.«
»Wer? Jossul?«
Sie erhielt keine Antwort.
»Hatten Sie es auf Vanheuver abgesehen?«, fragte Sophia.
Der Mann auf dem Krankenbett schwieg.
»Ein religiöser Spinner.« Der Polizist aus Tres Cantos kam noch einen Schritt näher und zeigte wieder sein Lächeln für die Kamera. »Seit einiger Zeit werden es immer mehr.«
»Vielleicht«, sagte Sophia zu dem Attentäter, »hat Ihnen Jossul sein Licht bereits geschickt. Es blendet Sie so sehr, dass Sie die Wirklichkeit nicht mehr erkennen. Die Menschen wollen nicht sterben, um in einem hypothetischen Jenseits ein besseres Leben zu führen. Sie wollen das bessere Leben hier, in dieser unserer Welt. Sie wollen nicht hungern und nicht krank sein. Futuria hilft uns allen. Futuria schenkt uns eine bessere Zukunft, und bald erwartet uns das größte Geschenk von allen: ewiges Leben. Nicht im Jenseits. Nicht im Garten eines Gottes, sondern hier auf der Erde.«
Montero nickte zufrieden, doch für Sophia blieb das Nicken undeutlich und schemenhaft, obwohl der Direktor neben ihr stand. Ein graues Wogen verdichtete sich in ihren Augenwinkeln und schränkte das Blickfeld ein. Das Zittern in den Knien wurde stärker und ging in die Oberschenkel über. Ihr wurde plötzlich heiß, sie atmete schneller.
»Futuria lügt«, sagte der Mann, der das Kornfeld in Brand gesteckt hatte. Er bewegte sich, und Sophia hatte plötzlich das laute Knistern der Verbandsfolie im Ohr. »Seit Jahren verspricht man Ihnen Unsterblichkeit, aber Sie werden immer wieder vertröstet. ›Bald ist es so weit‹, heißt es ständig, nicht wahr? Es ist eine Lüge. Die Unsterblichkeit existiert bereits, doch sie bleibt wenigen Menschen vorbehalten, die genug Geld und Macht haben, um sie sich leisten zu können. Es ist gottlose, sündige Unsterblichkeit, von verdorbenen Menschen geschaffen. Und sie kann von Menschen zerstört werden. Das wissen wir … denn in den vergangenen Monaten haben wir mehrere Unsterbliche getötet!«
»Was?«, krächzte Sophia.
Ihre Knie gaben nach, und sie fiel, als sich die Welt in einen grauen Strudel verwandelte.
4
»Sie hätten nicht so lange warten sollen«, sagte der Arzt. Er trug keinen grünen Kittel, sondern einen weißen, was Sophia beruhigte.
»Ich weiß«, murmelte sie. »Ich weiß.«
»Sie standen unmittelbar vor der kritischen Phase. Ist Ihnen klar, was das bedeutet?« Der Arzt hantierte mit medizinischen Sensoren und richtete einen väterlich-strengen Blick auf sie.
»Man hat es mir erklärt. Mehrmals.«
»Wenn die kritische Phase begonnen hat, ist ein größerer Eingriff nötig«, fuhr der Arzt geduldig fort. »Rückgrat, Knochenmark, Stammzellen …«
»Ich weiß.« Sophia wandte den Kopf, suchte automatisch nach Borris, doch er befand sich nicht im Raum. Sie fand das merkwürdig. Borris war immer da, erst recht in solchen Momenten. »Das Jahr ist noch nicht um. Diesmal ist es schneller gegangen als sonst.«
Der Arzt hielt ihr einen warmen Sensor an den Hals und blickte auf einen nahen Monitor. »Stress, besondere Umstände. Es gibt einige physiologische und psychosomatische Faktoren für ein verfrühtes Rezidiv, Señora Marchetti. Die Marker warnen Sie davor. Achten Sie auf die Marker, Señora! Übrigens, Sie haben noch einen alten Portkatheter.« Sophia fühlte einen kurzen Druck unter der linken Achsel. »Wir könnten ihn durch einen modernen Port ersetzen, wenn Sie …«
»Nein«, sagte Sophia schnell. Sie verabscheute medizinische Eingriffe, selbst die kleinen mikrochirurgischen. Trotz der jährlichen Therapien hatte sie sich nie daran gewöhnt. »Beim nächsten Mal.«
Der Arzt trug auf seinem weißen Kittel das Futuria-Symbol, eine goldene Triskele aus drei radialsymmetrisch angeordneten Kreisbögen, Symbol für den Weg des Lebens und auch die Zukunft.
Er wölbte die buschigen Brauen. »Wie Sie wünschen.« Er richtete einen mahnenden Zeigefinger auf sie. »Geben Sie besser auf sich acht, Señora! Mit Myeloproliferativen Neoplasien ist nicht zu spaßen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.«
»MPN«, murmelte Sophia. Ihr Bett stand direkt am Fenster, und das Kopfende war hochgestellt, sie lag nicht, sie saß. Draußen lag Madrid in glühender Sonne. Inzwischen kannte sie die Stadt gut genug, um den Campo del Moro zu erkennen, den Park zwischen dem Fluss Manzanares und dem Königspalast. Die Plaza Armería vor der Kathedrale, in Form eines lateinischen Kreuzes errichtet, befand sich ganz in der Nähe. Dort hatte vor anderthalb Jahrzehnten der letzte große Anschlag des IS stattgefunden, mit mehr als dreihundert Todesopfern.
»Futuria hat mich nach Madrid gebracht«, sagte Sophia. Sie war noch immer benommen und versuchte sich an etwas Wichtiges zu erinnern.
»Stimmt.« Der Arzt stimmte ein freundliches Lachen an. »Bei uns sind Sie besser aufgehoben. Sie haben den vergangenen Tag im Tiefschlaf verbracht, mit unserer Hilfe, möchte ich hinzufügen, und die Therapie gut überstanden. Ich gebe Ihnen gleich etwas, das Sie erneut ruhig und friedlich schlafen lässt, für einige weitere Stunden.«
»Nein, ich …«
»Ärztliche Verordnung«, unterbrach sie der Mann im weißen Kittel mit gespielter Strenge. »MPN, ganz recht. Eine Mutation der JAK 2, der Januskinase Zwei. Leicht zu behandeln mit unseren Genscheren und Repair-Kits. Allerdings gibt es in Ihrem Fall Komplikationen. Ich habe mir die Diagnose vom letzten Jahr angesehen und noch einmal überprüft. Ihre Krankheit ist eine Mischform aus Polycythaemia vera, Essenzieller Thrombozythämie und Primärer Myelofibrose; bei Ihnen wurde auch das sogenannte Philadelphia-Chromosom nachgewiesen, was ich bestätigen kann. Man könnte es so ausdrücken: Ihre Krankheit ist über ein breites genetisches Spektrum verteilt, und jedes betroffene Gen muss einzeln repariert werden. Das kann sehr aufwendig sein, erst recht kurz vor oder gar während einer kritischen Phase.«
»Man hat mir gesagt, dass es eine sehr seltene Krankheit ist. In jedem Jahr werden nur ein oder zwei Fälle pro hunderttausend Einwohner diagnostiziert.«
»Inzwischen sogar noch weniger«, sagte der Arzt. Er machte sich daran, die Geräte neben dem Bett zu justieren. Ein elektrisches Summen wie von einem nahen Insektenschwarm lag in der Luft. Gelbe, rote und grüne Kurven wanderten über einen Monitor. »Das Genscreening bei der Registrierung hilft uns, rechtzeitig Mutationen zu erkennen, aus denen sich später Krankheiten entwickeln können. Wer heute geboren wird, ist besser dran, Señora Marchetti.«
»Knochenkrebs.« Sophia erinnerte sich daran, dass ihr dieses Wort früher Angst gemacht hatte. »Ich habe ihn von meiner Mutter.«
»Eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks.« Mit einem weiteren freundlichen Lächeln beugte sich der Arzt über die Liege, und Sophia spürte einen neuerlichen kurzen Druck bei ihrem kleinen Katheter unter der linken Achsel. »Es werden zu viele rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen gebildet. Daraus kann sich ein sehr aggressiver Krebs entwickeln, der innerhalb kurzer Zeit zum Tod führt. Noch ist es uns nicht gelungen, Sie ganz von der Krankheit zu befreien, aber wir arbeiten daran. Bis wir mit der Arbeit fertig sind, können wir Ihre MPN nur in einen tiefen, tiefen Schlaf schicken. Auch Sie werden jetzt schlafen, damit sich Ihr Körper erholen kann.«
Wir arbeiten daran, dachte Sophia, als ihr die Augen zufielen. Es war gut zu wissen, dass jemand an all diesen Problemen arbeitete, noch dazu mit großem Erfolg. Das machte es leichter, die Augen zu schließen und auf die Zukunft zu vertrauen.
Die Tür wurde geöffnet, und eine Stimme erklang.
»Sophia? Ich habe gute Nachrichten.«
Sie öffnete die Augen – oder vielleicht nur eins, denn die Lider waren schwer. Borris stand dort, in einem Zimmer, das größer geworden war. Seine Gestalt zeichnete sich klein vor einer weit entfernten Tür ab. Er bewegte sich und sprach, doch seine Stimme war nur ein Brummen ohne Worte.
Sophia schlief.
5
Sophia träumte.
Das Loch im Boden war groß und tief. Es musste groß und tief sein, denn Bello brauchte viel Platz. So hatte sie den Hund genannt: bello, schön. Von Anfang an war er groß gewesen und dann noch größer geworden, obwohl sie selbst wuchs. Seine fröhliche Lebendigkeit hatte sie ihr ganzes junges Leben lang begleitet, doch nun lag er reglos da, in einem Karton neben dem Loch. Zwei Blumen schmückten seinen Kopf; Sophia hatte sie vor wenigen Minuten gepflückt.
Sophia war gerade acht geworden und erlebte ihre erste direkte Begegnung mit dem Tod. Sie stand in der heißen Augustsonne, die Wangen feucht von Tränen, den Geruch von Erde und der nahen Lagune von Orbetello in der Nase. Ihr Vater Gianmario, von allen Gianni genannt, hob das Grab aus. Er schwitzte. Der Boden war hart und trocken.
»Vielleicht wacht er wieder auf.« Sophia kniete neben dem Karton und legte die Hand auf den Rücken des Schäferhunds. »Vielleicht müssen wir nur ein wenig warten …«
»Nein, Schatz.« Ihre Mutter kam näher. »Bello hat eine lange Reise begonnen, von der er nicht zurückkehrt. Er wird zu einem Stern am Himmel. Vielleicht kannst du ihn heute Abend sehen.«
»Er wird zu einem Stern?« Sophia wischte sich mit einer Hand die Tränen fort.
»Heute Abend halten wir gemeinsam Ausschau, ja? Vielleicht sehen wir ihn, wenn er bereits am Ziel seiner Reise angekommen ist.«
Gianmario schnaufte, während er weitergrub. Der Spaten bohrte sich in die harte Erde, das Loch wurde noch etwas tiefer.
»Das ist Unsinn, Esther.« Opa Francesco, Giannis Vater, stand im Schatten eines alten Olivenbaums. »Dein Bello, Sophia, geht den Weg allen Lebens. Er kehrt dorthin zurück, woher er gekommen ist. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.« Er bekreuzigte sich.
»Francesco …«, begann Esther.
»Setz dem Kind keine Flausen in den Kopf«, brummte der alte Francesco. Er nahm eine Hand vom Knauf seines Gehstocks und winkte. »Sterne sind nicht die Seelen von Verstorbenen, sondern ferne Sonnen. Wer stirbt, zerfällt zu Staub. Deshalb legen wir deinen Bello in die Erde und stecken ihn nicht in eine Weltraumrakete.«
Papa Gianni schnaufte etwas lauter und bohrte den Spaten tiefer in den Boden.
»Hör auf damit!« Mama Esther sprach mit scharfer Stimme. Ihr deutscher Akzent wurde deutlicher. »Kinder brauchen Träume. Sie brauchen etwas Schönes, an dem sie sich festhalten können.«
»Kinder sollten die Welt kennen und verstehen, in der sie aufwachsen«, erwiderte Opa Francesco. »Je eher, desto besser. Die Welt wird nicht besser, indem man sie leugnet.«
Und damit wankte er davon, auf seinen Gehstock gestützt.
Die achtjährige Sophia blickte auf ihren Bello hinab. Mehr Tränen flossen.
»Ich will nicht, dass er zu Staub oder Erde wird.«
Mama Esther ging neben ihr in die Hocke, während Papa Gianni kurz innehielt; Schweiß perlte auf seiner Stirn.
»Heute Abend sehen wir uns die Sterne an«, sagte Mama Esther. »Wenn wir einen neuen entdecken, wissen wir, dass Bello am Ziel seiner Reise angelangt ist.«
»Können wir Bello nicht einfach wieder lebendig machen?«, schluchzte Sophia. »Wenn wir dem Doktor genug Geld geben …«
»Ich fürchte, das geht nicht, mein Schatz. Selbst wenn wir dem Doktor noch so viel Geld geben. Es tut mir leid.«
Am Abend saßen Mutter und Tochter draußen im Garten, nicht weit von Bellos Grab entfernt. Vater und Großvater waren im Haus geblieben.
Sophia weinte nicht mehr, fühlte aber eine tiefe Leere, tiefer als das Loch, das Papa Gianni gegraben und das Bello aufgenommen hatte. Der Himmel war klar und still.
»Wo ist er?«, fragte Sophia. Wie sollte man einen neuen Stern finden, wenn es so viele von ihnen gab?
»Mal sehen.« Mama Esther blickte mit ihr nach oben. Sie sprachen Deutsch, wie immer, wenn sie allein waren. Ob Deutsch oder Italienisch, für Sophia spielte es keine Rolle. Sie fühlte sich in beiden Sprachen zu Hause.
Eine Sternschnuppe erschien am dunklen Himmel.
»Dort! Hast du gesehen? Bello ist gerade im Himmel angekommen.«
»Wo? Wo?«
Mama Esther deutete auf einen Stern im Süden, über der Lagune.
»Ich glaube, ich glaube … Ja, ich glaube, das könnte er sein.« Sophia beobachtete den Stern, der funkelte und etwas heller leuchtete als die anderen in seiner Nähe. Sie dachte an die Worte ihres Großvaters. »Ist das wirklich Bello?«